

|
Seite 197 |




|



|
|
:
|
IV.
Der Güstrowsche Erbfolgestreit.
Oberlehrer Dr. Richard Wagner .
~~~~~~~~~~~~~~
E iner der Vorgänge, in und mit denen sich die Entwickelung Deutschlands aus den Zuständen des Mittelalters zu denen der Neuzeit vollzogen hat, ist die Verwandlung der Länderkomplexe, die die fürstlichen Familien Deutschlands seit der Umbildung der früheren Reichsämter zu erblichen Reichsfürstenthümern als Hausbesitz zu gewinnen gewußt hatten, in moderne Staaten; ein wichtiges Moment in dieser Entwickelung bildet die Einführung des Primogenitur=Erbrechtes, das ein Ausfluß des entstehenden Staatsgedankens war, an Stelle des alten, auf privatrechtlichen Anschauungen beruhenden Erbteilungsrechtes, nach dem in einem Fürstenhause so gut wie in jeder privaten Familie nach dem Tode des Familienvaters seine sämmtlichen Deszendenten, oder wenigstens nach dem salischen Gesetze die männlichen, gleichen Antheil an der gesammten Hinterlassenschaft, auch der an Land und Leuten, zu beanspruchen hatten. Daß jenes alte Erbtheilungsrecht unsäglich viel Unheil, Zank und Zersplitterung im Gefolge gehabt hat, daß also die Einführung des Primogeniturrechtes ein Fortschritt war, ist heute für jeden klar, der nur einen Blick in die Geschichte des Deutschen Reiches wie seiner Territorien wirft. Bekannt ist ja, daß die Stellung, die die Hohenzollern in Deutschland errungen haben, eine ihrer stärksten Wurzeln in der Constitutio Achillea des Jahres 1473 hat, in welcher der Kurfürst Albrecht Achilles die Primogenitur und die Untheilbarkeit, die in der Goldenen Bulle von 1356 nur für die Kurlande im engeren Sinne - die Besitzungen, an denen die Kurstimme haftete - festgesetzt war, für den gesammten Hohenzollernschen Hausbesitz einführte, wodurch


|
Seite 198 |




|
Brandenburg einen Vorsprung vor sämmtlichen übrigen deutschen Territorien erhielt. Allein, was dem nach Jahrhunderten Zurückschauenden klar zu Tage tritt, liegt für die Mehrzahl der Zeitgenossen noch im Dunkel. Sehr begreiflich also, daß man diese Neuerung nicht sogleich überall in ihrer vollen Bedeutung würdigte, daß sie nur langsam Nachfolge fand, und sehr begreiflich auch, daß von denen, die dadurch in ihren persönlichen Ansprüchen verkürzt wurden, viele den erbittertsten Widerstand erhoben. 1 ) Besonders hat Meklenburg einen langen und schmeren Entwickelungsprozeß durchmachen müssen, ehe es zur definitiven Einführung der Primogenitur gelangte. Die letzte Phase dieses Prozesses ist der Güstrowsche Erbfolgestreit, eben hierin liegt die historische Bedeutung dieses Streites, wie seines Abschlusses, des Hamburger Vertrages, die um die Zeit der 200jährigen Wiederkehr des 8. März 1701 zu einer eingehenden Betrachtung aufforderte und Veranlassung zu der folgenden Studie gegeben hat. 2 )
Vor der Schilderung des Streites selbst einen kurzen Ueberblick über die ihm vorausgehenden Stadien jenes Entwickelungsprozesses zu geben, erschien um so unumgänglicher, als nur aus der Kenntniß dieser früheren Vorgänge ein richtiges Verständniß für den Rechtsstandpunkt zu gewinnen ist, den die streitenden Parteien im Güstrowschen Erbfolgestreit eingenommen haben. Eingehender als die frühere Zeit mußte dabei die Geschichte der drei Testamente Adolph Friedrichs I., sowie der Kamf Christian Louis gegen das letzte dieser Testamente erzählt werden, da alles dieses in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Güstrowschen Erbfolgestreit steht.


|
Seite 199 |




|
I.
Bestrebungen für die Einigung der meklenburgischen Lande und die Einführung der Primogenitur im Kampfe mit entgegengesetzten Strömungen bis zum Beginn des Güstrowschen Erbfolgesreites.
Konsolidationsbestrebungen neben Fortdauer der Theilungen vom 14. bis 16. Jahrhundert.
Verwandt mit den Bestrebungen für die Einführung der Primogenitur in Meklenburg, aber doch von ihnen zu unterscheiden, sind die der Zeit nach jenen vorangehenden Konsolidationsbestrebungen am Ende des 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts, die das Ziel hatten, das völlige Auseinanderfallen des meklenburgischen Hausbesitzes in Folge der vielen Theilungen zu verhüten, neu gewonnene Landschaften mit dem bisherigen Besitz zu verknüpfen und im Falle des Aussterbens einer Linie den Heimfall ihrer Lande an die noch vorhandenen Linien zu sichern. Sie gingen aus von Herzog Albrecht dem Großen und seinem Bruder Johann und wurden veranlaßt durch den Wunsch, die Landschaft Stargard unauflöslich eng an die übrigen Lande der Hauptlinie anzuketten. Nachdem beide Brüder sich von Kaiser Karl IV. den 10. Juni 1373 aufs Neue mit der Herrschaft Stargard hatten belehnen lassen, erwirkten sie eine Urkunde von ihm, datirt vom 22. Juni, in welcher die dauernde Vereinigung der Herrschaft Stargard mit dem bisherigen reichsunmittelbaren Besitz der Hauptlinie ausgesprochen ward, dergestalt, daß der gesammte Landkomplex ein einheitliches und - unbeschadet der 1352-1355 erfolgten Abtretung von Stargard an Herzog Johann - untheilbares Herzogthum bilden sollte. 1 ) In einer zweiten Urkunde, vom 10. August, wird


|
Seite 200 |




|
bezeugt, daß trotz der Theilung zwischen den Herzögen Albrecht und Johann ihre Lande dennoch ein Gesammtlehen sein und für alle Zeiten bleiben und im Falle des Aussterbens der einen Linie deren Lande auf den andern Bruder oder dessen Lehenserben fallen sollen. 1 )
Durch die Erbverbrüderung vom 27. Oktober 1418 und die in ihrem Gefolge von den verschiedenen Landestheilen abgelegten Eventualhuldigungen 2 ) wurde auch Wenden=Werle in den Kreis dieser Bestimmungen gezogen. Seinen staatsrechtlichen Ausdruck fand der also geschaffene Zustand wie anderwärts in Deutschland, so auch in Meklenburg in der Formel der Belehnung "zur gesammten Hand", durch welche neben der prinzipiellen Gleichberechtigung der Lehnserben auch die Zusammengehörigkeit des Erbes gegeben ward. Die erste meklenburgische Staatsurkunde, die ihn enthält, ist der Lehnbrief, den im Jahre 1442 (den 24. Juni) nach dem Aussterben der Linie Werle (1436) die Herzöge Heinrich, Heinrich der Aeltere, sein Vetter, und Johann, sein Bruder, von Kaiser Friedrich III. erhielten; 3 ) er wird dann in allen folgenden Lehnbriefen wiederholt.


|
Seite 201 |




|
In diesen Urkunden findet der Gedanke des Gesammtbesitzes und der Untrennbarkeit der meklenburgischen Lande einen entschiedenen Ausdruck, durch sie ward der Gefahr begegnet, daß einmal ein Stück des Ganzen etwa als Mitgift oder durch testamentarische Bestimmung an ein anderes Fürstenhaus gelangte oder auch ein Landestheil die Reichsunmittelbarkeit einbüßte. Die Gepflogenheit der Theilungen innerhalb dieses Gesammtbesitzes ward durch sie nicht beseitigt, vielmehr ausdrücklich als zulässig anerkannt. Es war eine Gunst des Geschickes, die schlechte Benutzung fand, daß nach dem Aussterben der übrigen Linien Herzog Heinrich IV. (der Dicke) im Jahre 1471 den ganzen Landbesitz seines Hauses vereinigte. Heinrich unterließ jeden Versuch, dem gerade in den Jahren seiner Alleinregierung gegebenen Beispiele Brandenburgs zu folgen und die Einheit des Landes zu einer dauernden zu machen. Indessen stellte sich nach seinem Tode (1477) eine Art Alleinregierung wie von selbst her, indem von seinen drei Söhnen Albrecht II., Magnus und Balthasar der älteste, Albrecht, schon 1483 kinderlos starb und der jüngste, Balthasar, aus freiem Entschluß die Regierung dem weit bedeutenderen Bruder thatsächlich überließ.
Die gleiche Lage wie 1483, daß also der Bestand der fürstlichen Familie auf zwei Brüder zusammenschmolz, entstand im Jahre 1508, nachdem Herzog Balthasar 1507 und Herzog Erich, der zweite der drei Söhne des Herzogs Magnus, 1508 gestorben war, beide ohne männliche Erben zu hinterlassen. Bis dahin hatten die Brüder mit dem Oheim die Einkünfte gemeinschaftlich genossen, die Regierung aber diesem überlassen unter der Bedingung, daß er nichts ohne Rath, Wissen und Willen der Neffen vornehme. Nach Balthasars Tod hatte Herzog Heinrich als der älteste der Brüder die Regierung zu übernehmen, und noch 1513


|
Seite 202 |




|
überließ ihm Herzog Albrecht das Regiment in einem neuen Vertrage auf fünf Jahre, indessen vermochte sich der ehrgeizige und leidenschaftliche junge Fürst nicht so wie früher sein Oheim Balthasar in die Rolle des unthätigen Mit=Nutznießer zu finden und begann auf Theilung zu drängen. Eine vollständige Theilung des Landes in zwei Hälften mit getrennter Regierung setzte er freilich nicht durch; im Neubrandenburger Hausvertrage vom 7. Mai 1520 kam es bei Fortbestand gemeinsamer Regierung zu einer Theilung der Einkünfte, wobei man, um keinen zu benachtheiligen, zu dem wenig glücklichen Auskunftsmittel griff, die beiden Brüder alle zwei Jahre mit ihrem Theile wechseln zu lassen. 1 ) Die Verhältnisse, die dadurch geschaffen wurden, waren nicht eben erquicklich und veranlaßten die Stände des Landes, um ferneren Trennungsbestrebungen einen Riegel vorzuschieben, zum Abschluß des Unionsvertrages vom 1. August des Jahres 1523, dem Grundpfeiler der ständischen Einheit Meklenburgs. Die Streitigkeiten zwischen Heinrich und Albrecht wiederholten sich in noch verschärftem Grade, als nach dem Tode Albrechts (1547) und Heinrichs (1552), dem sein einziger Sohn Magnus (Bischof von Schwerin) schon (1550) vorangegangen war, Albrechts Söhne das Land erbten. Jhr ältester, Johann Albrecht I., vertrat von Anfang an den Einheitsgedanken mit aller Entschiedenheit, allein er vermochte ihn nicht durchzusetzen und ward durch den Ruppiner Machtspruch (1. August 1556) genöthigt, seinem Bruder Ulrich die Hälfte des Landes einzuräumen. 2 ) Wie sehr die Streitigkeiten vor wie nach dieser Theilung dem edlen und hochstrebenden Fürsten das Leben verbittert und die Regierung erschwert haben, ist bekannt.
Das Testament Johann Albrechts I.
Was ihm im Leben nicht gelungen war, suchte er für die Zukunft anzubahnen durch sein Testament, in dem er zum Regenten seiner Landeshälfte mit Ausschluß seines jüngeren Sohnes Sigismund August seinen erstgeborenen, Herzog Johann, bestimmte und sodann im Falle der Erledigung des Güstrower Lande=


|
Seite 203 |




|
theiles die Vereinigung des ganzen Landes anordnete. Bei der Bedeutung, die dieses Testament für die folgende Entwickelung und besonders auch für den Güstrower Erbfolgestreit gewonnen hat, mag es erlaubt sein, die betreffenden Bestimmungen im Wortlaut hierher zu setzen:
"Volgendts setzen Wier Vnß zu Erben in diese Vnsere Lande Fürstenthumb und Herrschaft Lehen und Aigen - Vnsere Beyde Freündtliche liebe Söhne Hertzog Johanssen und Hertzog Sigismunden Augusten, also und dergestalt, daß - Hertzog Johanns als der älter regirender Landts=Fürst seyn, und zu mehrer Urkund solcher praerogativ in allen Brieffen diesen stylum gebrauchen soll, vor Vnß und Vnsern Freundtl. lieben Bruder Herzog Sigismunden Augusten u. s. w.
Aber Vnsern Jüngsten Sohn Herzog Sigismunden Augusten, alß der Leibs halben etwas blöd, und zu ertragung der Last und Bürde der Land=Regierung (die dan auch ohne das auf dieser Helfte der Mecklenburgl. Lande, weiter nicht kan zerrissen werden) auß natürlicher angebohrner Schwachheit etwas zu unvermügendt, setzen Wier zum Erben ein in nachfolgende Aembter und Stadt Strelitz, die Combterey Myrow und Juenakh, - ohne die Landtsfürstliche Hoheit, Obrigkeit, und Herrschung über die von der Ritterschaft, - welche alle vnserem ältisten Sohn, Herzog Johanßen, als dem regirenden Landts=Fürsten allein zustehen sollen;" Herzog Sigismund August soll außerdem jährlich aus der Kammer 6000 Gulden erhalten.
"Vnd ob Vnß wohl unverborgen, daß in etlichen Chur= und Fürstl. Heusern die Lande und Leuhte unter den Söhnen zugleich pflegen außgetheilt zu werden, So haben Wier doch erhebliche wichtige Ursachen, warumb wier solchs unter unsern Lieben Söhnen anders verordnen, und die angeregte Gleichheit nicht statt haben lassen können, dann Wier aus der erfahrung gelernet, daß durch kein ander mittel die Herrschaften in grössern abfall, verringerung, unvermügen und abgang gerahten, als durch die vielfältige zerstückung und zerreißung, Darumb auch die Löbl. Kayserl. Lehen=Recht außtrücklich verbieten, die Herzogthumb, Marggrafschaften und dergleichen Fahnlehen nicht zu theilen, sondern in einem Corpore unzergäntzt beysammcn bleiben zu lassen; So wissen Wier auch und seindt es selbs mit unserer mercklichen Beschwerung innen worden, waß auß gesambter ungescheidener Regirung, da der eine Bruder in allem durchauß so viel Gewalts und Macht alß der ander hat,


|
Seite 204 |




|
vor Vnrichtigkeit erfolgt, und daß keiner der Landtschaft recht und vollkömlich mächtig ist, noch seyn kann, sondern trennungen der von Adel und Städte erwachsen, und wann ein Herr gepeut und der ander verpeut, wann der eine verfolget, der ander vergleitet, und dergl. unheil entstehet, darüber die Herrschaft und ihre Authoritaet zu verachtung und Schimpf gesetzt, auch wohl zwispaltige mißbillige Religion eingeführet, und Kirchen, Schulen, Land und Leuthe verwirret und irre gemacht werden, aus welcher Vrsachen dann auch bey Weiland unsere gnädigen Lieben Herrn Groß=Vaters Herzog Magnus Zeiten seine Gnad die Regierung allein geführt, ungeachtet daß Seine Gnad zween Brüder Herzog Ehrichen und Herzog Baltzarn gehabt, und von wegen solcher einigen unzertheilten und gleichwohl nicht gemeinen noch gesambten, sondern auf seiner Gnaden Perschon allein haftender Regirung diese Lande zu Meckelnburg in höchstem flor, wohlfahrt und ansehen geschwebt, Sein Gnad ein füertreflicher Hochgeachter Fürst bey jedermann im Gantzen Reiche gewesen, und die fürnembsten Chur= und Fürstlichen Heuser in teutschland sich mit derselbigen zu befreundten Lust und verlangen gehabt;"
"Derhalben soll unser Lieber Sohn Herzog SigismundAugustus dieser vnserer Väterl. disposition und wohlbedachten Verordnung ohn eintzige einrede, sperrung oder ausflucht unweigerlich volge thuen, bey denen pflichten damit Er Vnß, als der Sohn dem Vatter, von Gottes Natur und Rechtswegen, kindtlichen Gehorsam zu leisten schuldig;"
"Solte sich auch nach Gottes schickung der Fall der massen zutragen, daß unser Freundlicher lieber Bruder Herzog Vlrich und seiner Lieb Gemahl, oder auch unsere beyde andere Freündtliche Liebe Brüder, Hertzog Christoffer, und Herzog Carl, vor oder nach unsern Todt versturben, und also alle die Lande nnd Herrschaften zu Meckelnburg auf unsere Linien und stamm allein fielen; So wollen wir doch nicht, daß dieselbige zwischen Unsern Beyden Lieben Söhnen getheilet, sondern unser ältester Sohn Herzog Johannes umb obgehörter und anderer mehr bewegenden uhrsachen willen, Fürnemlich aber, damit dies Fürstl. Hauß Meckelnburg wiederumb desto mehr in zunehmen und aufsteigen gebracht werde, darinn allein succediren, herrschen, regieren und erben, Aber mehrgenanndtem vnserm jüngsten Sohn noch einmahl so viel an Aembtern und einkünfften auch Jahrgelt auß der Cammer - mit obberührter Maaß und vorbehalt abtretten und einreümen soll, alß ihme Herzog Sigismunden Augusten albereit hierin vermacht und außgesetzet ist."


|
Seite 205 |




|
"Solte aber unser ältester Sohn, nach Gottes willen, ohn Mennliche eheliche gebohrne Leibs=Erben versterben, so sollen alß dann alle unsere Land und Leüthe, sambt allen Lehen und aigen - auf unsern jüngsten Sohn Herzog Sigismunden Augusten nach Erbgangs Recht kommen und verstammet werden, Gleicher gestalt es dann auch herwieder mit unsers ältisten Sohns Succession in des jüngsten erbschaft, da der Jüngste am ersten versturbe, soll gehalten werden."
Das Testament erhielt den 12. Juni 1574 die Kaiserliche Confirmation, wodurch es rechtsgültig ward. In der darüber ausgestellten Urkunde heißt es, daß der Kaiser auf Johann Albrechts Ansuchen "ob inserierts Testament - in allen und jeden desselben Worten, Puncten, Clauseln und Articuln sonderlich aber so viel die verordnete Succession und Erbsetzung auch andere Sr. Lieb. Verlassenschaft und dero Fürstenthumb, Landt und Leuthe Regierung anlanget", confirmiere und bestätige: "Und meinen, setzen und wöllen, daß ob inserierts Testament - stett, fest und unverbrüchlich gehalten und vollenzogen, und weder von gedachte Vnsers lieben Oheim und Fürsten Söhnen und Erbnehmen, auch deren Nachkommen, noch sonst jemand andern - darwieder etwas fürgenohmmen, gehandlet oder verstanden werden soll." "Und gebitten darauf allen und jeden Churfürsten, Fürsten u. s. w. -, daß Sie obeinverleibtes Testament - bey würden und Kräften bleiben und Herzog Johanns Albrechten zu Mekelnburg Söhne, Erbnehmen und nachkommen, dessen ruhewiglich geniessen - lassen" - "und dann Jhnen, vielbemelts Herzogs Johanns Albrechten zu Mekelnburg Söhnen, Erbnehmen und Nachkommen, daß Sie solches Testament - gebührlicher weise halten und vollnziehen, auch darwieder nit thuen in kein weise, als lieb einem jeden seye unser und des Reichs schwehre Ungnad und straff und darzu ein Poen nemblich Funfzig Mark Lotiges Goldes zu vermeiden, die ein Jeder, so oft Er freventlich hiewieder thete, vnß halb in unser und des Reichs Cammer, und den andern halben theil oft genants Herzog Johanns Albrechten Söhnen, deren Erben und nachkommen, wider die also gehandelt wurde, unnachleßlich zu bezahlen verfallen seyn solle." 1 )


|
Seite 206 |




|
Durch dies Testament ward die Primogenitur zunächst für den Landestheil Johann Albrechts und seine Söhne eingeführt und für deren Lebenszeit bei Erledigung der Güstrower Landeshälfte deren Vereinigung mit der Schweriner bestimmt. Daß diese Bestimmungen durch die kaiserliche Confirmation, in der auch von den Nachkommen der Söhne des Erblassers die Rede war, auch auf diese ausgedehnt ward oder werden sollte, ließ sich anzweifeln; 1 ) andererseits wird aus der Begründung der Erbfolgebestimmungen völlig klar, daß Johann Albrecht allerdings auch für die fernere Zukunft nach dem Tode seiner Söhne den Wunsch hegte, seine Nachkommen möchten fernere Theilungen vermeiden, vielmehr gegebenen Falles das ganze Land unter der Regierung eines Fürsten, des jedesmaligen Primogenitus, vereinigen, und wenn er auch dieser seiner Willensmeinung keinen rechtlich bindenden Ausdruck gegeben haben mag, so war es doch jedenfalls ein Abfall von den heilsamen Intentionen des großen Ahnherrn, wenn seine Nachkommen wider den Geist des Testamentes die Vereinigung der beiden Landestheile bei gebotener Gelegenheit unterließen.
Und allerdings vollzog sich die weitere Entwickelung nicht in der von ihm eingeschlagenen Richtung. Nach Johann Albrechts Tode (1576) hielt zunächst sein Bruder Herzog Ulrich, als Vormund des noch minderjährigen Herzogs Johann, das Testament den Ansprüchen seines jüngeren Bruders Christoph gegenüber aufrecht, der seinen früheren Verzicht auf die Regierung, weil in unmündigem Alter geleistet, für nichtig erklärte, dem Testament die Anerkennung weigerte und die Regierung der ganzen Schweriner Landeshälfte beanspruchte auf Grund des Rechtssatzes, den früher seine Brüder gegen ihn geltend gemacht hatten, daß Meklenburg nicht mehr als zwei regierende Herren haben dürfe und daß diese die ältesten Herzöge sein müßten. 2 )


|
Seite 207 |




|
Er ermäßigte indessen seine Ansprüche auf die Forderung der Hälfte von Johann Albrechts Landestheil, aber auch dies erreichte er nicht und starb vor Beendigung des Zwistes, den 4. März 1592. Inzwischen waren die beiden Söhne Johann Albrechts, Johann und Sigismund August, mündig geworden. Als nun Sigismund August ebenfalls das Testament des Vaters anfocht, vermittelte Herzog Ulrich mit Herzog Adolf von Holstein zusammen einen Vergleich zwischen den beiden Brüdern (den 20. Mai 1586 zu Schwerin), in dem Sigismund August noch einmal ausdrücklich auf die Regierung verzichtete und dafür eine ausreichende Apanage erhielt. 1 )
Der Schweriner Landestheil blieb also ungeschmälert in Herzog Johanns Besitz, dagegen gelangte der zweite Abschnitt der Erbfolgebestimmungen des Testamentes, die Vereinigung mit Güstrow, nicht zur Ausführung, da Herzog Johann lange vor seinen beiden Oheimen, Ulrich und Karl, starb (22. März 1592).
Der Theilungreceß des Jahres 1621.
Er hinterließ zwei minderjährige Söhne, Adolf Friedrich und Johann Albrecht. Für sie übernahm nun Herzog Ulrich (bis 1600 noch mit Sigismund August zusammen) die Vormundschaft, und als Ulrich 1603 ohne männliche Erben starb, folgte ihm in der Regierung von Güstrow wie in der Vormundschaft über die beiden Großneffen sein Bruder Karl. Im Jahre 1607 wurden die beiden jungen Herzöge vom Kaiser für großjährig erklärt. Jetzt hätte also, den Intentionen des Großvaters zufolge, der ältere, Adolf Friedrich, die Regierung des Schweriner Landestheiles übernehmen, der jüngere, Johann Albrecht, mit einer Apanage abgefunden werden müssen. Allein beide Brüder traten zunächst die Regierung gemeinschaftlich an, und als im Jahre 1610 durch den Tod des Herzogs Karl auch Güstrow erledigt ward, schlossen sie den 9. Juli 1611 den Theilungsvertrag zu Fahrenholz, dem nach weiteren Verhandlungen der Theilungsrezeß vom 3. März des Jahres 1621 folgte. Auch dieser erhielt, wie früher das Testament Johann Albrechts I., die kaiserliche Bestätigung. 2 )


|
Seite 208 |




|
Wenn in der ganzen Zeit von 1607 bis 1621 der ältere Bruder keinerlei Versuch macht, im Sinne des großväterlichen Testamentes die alleinige Regierung des Schweriner Landestheiles und nachher des ganzen Landes zu gewinnen, vielmehr den gänzlich entgegengesetzten Standpunkt einnimmt und auf "Total=Division", d. i. völlige Trennung der beiden Landeshälften - also Zerreißung der Union der Stände -, dringt, so hat er selbst später dies auffallende Verhalten dadurch erklärt, daß ihm wie seinem Bruder damals das Testament des Großvaters überhaupt nicht bekannt gewesen sei. Dies steht zu lesen in einem Testamentsentwurfe, den auf Adolf Friedrichs Geheiß dessen Kanzler Reinking im Jahre 1633 verfaßt hat und in dem verordnet wird, daß, im Falle Herzog Johann Albrecht ohne Leibeserben sterben sollte, der Güstrowsche Landestheil mit dem Schweriner vereinigt und nur eine Regierung sein und bleiben soll, "wohin dann" - so heißt es wörtlich - "Unser in Gott ruhender hochgeliebter Herr Großvater Hertzog Johann Albrecht zu Mecklenburg in seinem Testamente gezielet, daß auff ebenmäßig begebenden Fall es also gehalten, und nicht mehr als ein regierender Hertzog zu Mecklenburg seyn und künfftig bleiben solle, und woll zu wünschen gewesen wäre, daß dasselbe nach Unsers Hochsehl. Herrn Vaters Absterben, Unsern verordneten Herrn Vormündern vorgeleget Uns auch hernachher nicht hinterhalten und bey Unser Brüderlichen Vergleichung consideriret und in acht genommen wehre. 1 )


|
Seite 209 |




|
Ein Fortschritt war es, daß in dem Rezeß eine weitere Theilung der beiden Landeshälften für alle Zeit untersagt ward. Die betreffende Bestimmung lautet: "Es sollen auch Unsere Fürstenthümer und Lande hinführo und zu ewigen Zeiten von Uns oder Unsern Erben und nachkommenden Hertzogen zu Mecklenburg ferner nicht subdividiret, oder in mehr den jetzige zwo Theile getheilet werden, sondern es bey denselben einig und allein verbleiben."
Durch diese Bestimmung ward die Primogenitur innerhalb der beiden fürstlichen Linien eingeführt. Ueber die Regelung der Erbfolge für den Fall des Aussterbens der einen Linie enthält der Rezeß keine Bestimmung, 1 ) und auch aus den Worten des kaiserlichen Lehnbriefes, den beide Brüder d. 9. Juli 1621 erhielten, daß, wenn einer der beiden Brüder ohne Erben mit Tode abgehen sollte, alsdann des Verstorbenen Land und Leute an den Lebenden und seine Lehnserben fallen sollten, war nicht zu ersehen, ob nach dem Tode beider Brüder der Primo= oder Sekundogenitus der überlebenden Linie das Erbe einer erloschenen Linie zu beanspruchen habe.
Die drei Testamente Adolf Friedrichs I.
Eine ganz andere Stellung als in den Theilungsverhandlungen mit seinem Bruder nahm Adolf Friedrich I. zu der Erbfolgefrage ein, als nach der Wallensteinschen Invasion beide Brüder wieder in ihr Land zurückkehrten. Er faßte seitdem die Vereinigung des ganzen Landes für die Zukunft ins Auge. Auf doppeltem Wege strebte er sie an, durch die Formulirung der Huldigungseide, die beide Brüder nach ihrer Rückkehr Ende 1632 und Anfang 1633 ihren Ständen abnahmen, und durch testamentarische Bestimmung.


|
Seite 210 |




|
Beide Eide, der zu Schwerin wie der zu Güstrow, nannten neben dem regierenden Fürsten auch dessen ältesten, der in Güstrow den "künftigen" ältesten Sohn, beide enthielten auch eine Eventualhuldigung an den Fürsten der anderen Landeshälfte und dessen Deszendenz im Falle des Aussterbens der Linie des eigenen. Der Vorschlag zu dieser Eventualhuldigung ging von Herzog Adolf Friedrich aus, der ihn in einem Briefe an den Bruder, datirt vom 10. Oktober 1632, damit begründet, daß auf diese Weise ihre rechtmäßigen Erben "umb so viel mehr ihrer anererbten Lande und Leute gesichert sein und pleiben, und nit etwa frembde praetensiones einwenden, und die Landschafft, welche durch absterben Jhres regierenden Landesfürsten Jhrer Pflichten relaxiret, an sich ziehen möchten." Johann Albrecht erschien diese Eventualhuldigung überflüssig, da dieser Punkt, wie er am 16. Oktober schreibt, "ohnehin schon in den Brüderlichen Erbverträgen seine Richtigkeit habe und darin deswegen zu ihrer beederseits assecuration außdrücklich disponiret worden", ging aber doch darauf ein, als Adolf Friedrich seinen Vorschlag erneuerte, der von ihm "auß gutem getreuem und sorgsamen gemüthe, zu keinem andern ende alß zu des Fürstlichen Haußes und deßen rechten Erben ferneren und mehren versicherunge wolmeinentlich erinnert" sei; auch eine abundans cautela schade ja nicht. Die Eidesformeln sind darauf im Auftrage Adolf Friedrichs von dessen Kanzler Reinking abgefaßt, von Johann Albrecht gebilligt und, soweit sie die Erbfolge betreffen, auch ohne Aenderung in der vorgeschlagenen Form benutzt worden.
In der Güstrowschen Eidesformel nun wird in dem Passus der Eventualhuldigung neben dem Namen des Herzogs Adolf Friedrich auch der seines ältesten Sohnes, des Herzogs Christian, ausdrücklich genannt. Auch diesem also schwur die Güstrower Ritterschaft Treue für den Fall, daß ihr Herzog in Ermangelung von Leibeserben sterben und etwa auch Herzog Adolf Friedrich schon todt sein sollte, womit die eventuelle Vereinigung beider Herzogthümer unter Herzog Christian, der Ausschluß von dessen jüngeren Brüdern von der Erbfolge in Güstrow, mithin die Geltung des Primogeniturrechtes auch für den Anfall von Güstroro an Schwerin vorläufig gesichert war. 1 )


|
Seite 211 |




|
Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir eben in der Absicht Adolf Friedrichs dies festzustellen den eigentlichen Grund für die ganze Einfügung wie einen Hauptgrund für die Erneuerung der Huldigung überhaupt sehen: er wünschte eben seinem ältesten Sohn und Nachfolger dadurch die Erwerbung auch des Güstrowschen Landestheiles im Falle seiner Erledigung zu sichern. 1 )
Um dieselbe Zeit, im Jahre 1633, ist der Testamentsentwurf entstanden, den im Auftrage Adolf Friedrichs der Kanzler Reinking verfaßte und aus dem oben schon jene Klage, daß Adolf Friedrich bei Abschluß der Erbverträge das großväterliche Testament nicht gekannt habe, herausgehoben ward. Aus diesem Testamentsentwurf spricht dieselbe Anschauung, wie aus dem Eidesformular. Adolf Friedrich setzt darin, wie dies ja dem Erbvertrage entsprach, seinen ältesten Sohn, Herzog Christian, zu seinem Erben in der Landesregierung ein, "allein, so lange Er lebet, oder nach seinem Absterben, seinen ältesten Sohn" u. s. w. "nach Ahrt und Eigenschafft der Primogenitur=Rechten." Dann heißt es weiter: "Wehre es auch Sache, daß Unser - Bruder Hertzog Hans Albrecht zu Meckl.,


|
Seite 212 |




|
ohne Mann=Leibes Lehens=Erben mit Tode abgehen solte-; so wollen Wir doch, daß - vermüg des iuris Primogeniturae das gantze Hertzogthumb Mecklenburg Fürstenthumb Wenden - mit der gantzen Landesregierung auff Unserm ältesten Sohn, und dessen ältesten Sohn und Nachkommen, wie vorhin gemeldet, nach den Rechten der ersten Gebuhrt fallen, dieser Unser Schwerinischer Theil mit dem Güstrowschen consolidiret, und eine Regierung seyn und bleiben soll," worauf die o. a. Stelle über Johann Albrechts I. Testament folgt. 1 )
Dies Testament war also eine Art Erneuerung des großväterlichen, und zwar eine verbesserte, insofern hier klar und bündig ausgesprochen ist, was man dort vermißt, daß nämlich in alle Zukunft im Falle der Erledigung des andern Landestheiles der Primogenitus und regierende Fürst des Schweriner Herzogthums jenen mit diesem vereinigen soll.
Noch im Jahre 1642 hielt Adolf Friedrich an derselben Anschauung fest, wie aus einem Schreiben an seinen damaligen Kanzler Cothmann vom 13. Januar dieses Jahres hervorgeht. Darin sagt er: "Und da Unseres Pflegesohnes Ld. (d. i. der junge Herzog Gustao Adolf von Güstrow) ohne Männliche Leibes Lehns=Erben verstürbe, muß vermöge des Großväterlichen Testaments, auch sonsten Jure Primogeniturae und dem löblichen Herkommen bey Fürstl. Häusern im Röm. Reich gemäß, Unser Primogenitus auch in dem Güstrowischen Antheile allein succediren, ein Fürstenthumb mit dem andern consolidiret, und im gantzen Lande Eine Regierung geführet werden." 2 )
Indessen scheint er schon damals in diesen seinen Anschauungen nicht mehr ganz fest gewesen zu sein. Darauf deutet die Thatsache hin, daß er schon einige Monate vorher, den 13. Oktober 1641, von Herzog Christian, der auf längere Reisen zu gehen im Begriffe war, einen Revers ausstellen ließ, in dem sich dieser verpflichtete, etwaigen testamentarischen Bestimmungen des Vaters, wie es künftig nach seinem Tode mit der Landes=Regierung, auch mit seiner Gattin und seinen übrigen Kindern gehalten werden solle, Gehorsam zu leisten. 3 )
Was hier schon von ferne sich vorzubereiten scheint, wird im Laufe der folgenden Jahre, als schwere Irrungen mannig=


|
Seite 213 |




|
facher Art Vater und Sohn einander völlig entfremdeten, zum festen Entschluß. Der sehr ungünstige Eindruck, den der Vater von dem Charakter seines ältesten Sohnes bekam, der Wunsch, dessen jüngere Brüder von ihm möglichst unabhängig zu stellen, die Vorliebe, die er für seinen zweiten Sohn Karl faßte, wohl auch schon die Befürchtung, daß Christian zum Katholizismus übertreten könne, alles trug dazu bei, die Ueberzeugung von der Nützlichkeit der Combination des ganzen Landes in Adolf Friedrich wankend zu machen. Im Jahre 1647 ließ er eine Umarbeitung jenes ersten Testamentsentwurfes vornehmen, nach dem der Schweriner Landestheil allerdings ungetheilt auf seinen ältesten Sohn übergehen und zwar mit dem inzwischen erworbenen Bisthum Schwerin, 1 ) der Güstrower aber im Falle seiner Erledigung seinem zweiten Sohne Karl zufallen und es auf Grund des uralten Herkommens und der 1621 getroffenen Erbtheilung bei zwei Regierungen jederzeit verbleiben solle. Das Testament wurde vollzogen und beim Rathe von Lübeck hinterlegt.
Als darauf im folgenden Jahre durch den Westfälischen Frieden die Bisthümer Ratzeburg wie Schwerin als weltliche Fürstenthümer an die Schweriner Linie fielen, geschah es nicht ohne Zuthun Adolf Friedrichs, daß beide nicht dem Herzogthum Schwerin incorporirt wurden, wie die meklenburgischen Stände wünschten, sondern für jedes von beiden ein gesonderter Lehnbrief ausgestellt ward und jedes sein besonderes Votum auf den Reichs= und Kreistagen behielt. 2 ) Worauf dies abzielte, beweist die Aenderung, die im Jahre 1654 mit dem Testament des Jahres 1647 vorgenommen ward. In diesem dritten Testament, das den 31. Oktober 1654 unterzeichnet und dann an Stelle des zurückgezogenen zweiten in Lübeck deponirt ward, wird angeordnet,


|
Seite 214 |




|
daß Herzog Christian als Primogenitus das Herzogthum Schwerin (doch ohne das Bisthum), Herzog Karl das Fürstenthum Ratzeburg, Herzog Johann Georg, der dritte Sohn, das Fürstenthum Schwerin, jeder der übrigen Söhne jährlich 3000 Rthlr., und wenn ihm noch mehr bescheert würden, von diesen jeder jährlich 2000 Rthlr. erhalten sollte. 1 )
Wenn Herzog Christian ohne Erben sterbe und also Herzog Karl sein Nachfolger im Herzogthum Schwerin werde, so solle er Ratzeburg an Johann Georg und dieser das Fürstensthum Schwerin an den nächstältesten Bruder, Gustav Rudolf, überlassen, und so solle es auch weiter gehalten werden, wenn der eine oder der andere Bruder ohne Leibes=Erben abgehe, daß alsdann die jüngeren Brüder gradatim in der vorigen Stelle treten und dafür die Schwerinsche Kammer der Zahlung der bis dahin ihnen zukommenden Apanage enthoben sein solle. Eine ebenmäßige Bewandniß solle es auch haben, wenn Herzog Gustav Adolf diese Welt ohne Hinterlassung männlicher Leibes=Erben segnen würde, "da dann - so heißt es wörtlich - vermöge Brüderlicher Verträge allewege zwo Regierungen verbleiben müssen und also - Herzog Carl zur Güstrowischen Regierung kommen würde." Alsdann solle derselbe das Ratzeburgische dem Tertiogenito, und dieser dem Quartogenito das Schwerinsche Fürstenthum, und so fortan, - eröffnen. Jedoch solle auf diesen Fall der Sohn, dem das Güstrowsche zufalle, den übrigen Brüdern, so viel Jhrer Apanage aus der Meklenburg=Schwerinschen Kammer zu fordern hätten, die Hälfte derselben zugeben und so der Schwerinschen Kammer die halbe Bürde abzunehmen - gehalten sein. Die Fürstenthümer sollten erblicher Besitz sein und erst dann mit dem Herzogthum Schwerin wieder vereinigt werden, wenn sie durch den Tod der übrigen Brüder oder das Aussterben ihrer Nachkommenschaft erledigt eien. 2 )
Dies dritte Testament Adolf Friedrichs entfernt sich, wie man sieht, noch weiter als das zweite von der unierenden Tendenz des ersten und bedeutet eine vollständige Rückkehr zu der alten Observanz, nach der möglichst viele der Mitglieder des Fürstenhauses mit Land und Leuten zu versorgen waren, und


|
Seite 215 |




|
dafür ist eine Form gewählt, die noch den Nachtheil mit sich brachte, daß die beiden Fürstenthümer häufiger, als es an sich nöthig war, den Regenten zu wechseln Aussicht hatten.
Und gerade wie Adolf Friedrich die Ausführung seines ersten Testamentes durch Aenderung der Huldigungseide im Jahre 1633 zu sichern gesucht hatte, machte er im Jahre 1654 den gleichen Versuch zu Gunsten seines dritten Testamentes.
Den 2. Mai 1654, ward der junge Herzog Gustav Adolf, der einzige Sohn und Erbe des im Jahre 1636 gestorbenen Johann Albrecht II., mündig und berief deshalb die Ritterschaft seines Landestheiles zur Ableistung der Huldigung auf den 5. Juli nach Güstrow. Adolf Friedrich sandte seinen Hofmarschall O. v. Wackerbarth zu diesem Tage nach Güstrow, um dem Akte beizuwohnen und die Eventualhuldigung durch Handschlag entgegenzunehmen, und gab ihm ein Eidesformular mit, das den 21. Juni d. J. bei Ableistung eines Lehnseides auf der Schweriner Regierungskanzlei benutzt war. Es unterschied sich von dem im Jahre 1632 benutzten dadurch, daß der Name des Primogenitus, des Herzogs Christian, fortgelassen war und nach Herzog Adolf Friedrich sogleich dessen "Mann=Leibes=Lehens=Erben" genannt wurden. Ebenso fehlte am Schlusse bei dem Passus der Eventualhuldigung in diesem Formular, wie übrigens ja auch in dem Schweriner des Jahres 1632, der Name des Güstrowschen (künftigen oder schon vorhandenen) Primogenitus. Wackerbarth sollte verlangen, daß das Güstrower Formular genau diesem entsprechend eingerichtet, also bei der Eventualhuldigung der Name des Herzogs Christian nicht genannt werde, und, falls man in Güstrow sich weigere darauf einzugehen, feierlich gegen die Huldigung Protest einlegen. 1 ) In Güstrow verglich man den 5. Juli den Wortlaut des von Wackerbarth mitgebrachten Formulars mit dem des im Jahre 1632 in Güstrow benutzten und bemerkte sogleich die Bedeutung der Aenderung. Der Geheime Rath beschloß sie abzulehnen und bei dem Formular des Jahres 1632 zu bleiben mit der Begründung, Adolf Friedrich hätte, wenn er etwas daran geändert wünschte, dies eher mittheilen müssen, damit man es in Erwägung hätte ziehen und rechtzeitig sich entschließen können; in ipso actu könne nichts mehr geändert werden. Wackerbarth erhielt hiervon Mittheilung; er erklärte darauf, unter diesen Umständen dem Huldigungsakt


|
Seite 216 |




|
nicht beiwohnen zu können und sandte einen schriftlichen Protest dagegen ein. Die Ritterschaft erbat und erhielt, wie dies auch sonst Brauch war, als sie am 5. erschien, Aufschub bis zum andern Morgen. Dies ward Wackerbarth angezeigt und ihm anheim gegeben, einen Expressen mit einem Berichte und einer Kopie des für den Huldigungsakt bestimmten Formulars, in dem also Herzog Christian genannt war, nach Schwerin zu schicken. Er that dies, und man schob am 6. Juli den Huldigungsakt, der auf 11 Uhr angesetzt war, bis halb 3 Uhr hinaus, um noch die Antwort auf Wackerbarths Bericht aus Schwerin abzuwarten; als sie aber bis dahin nicht eingetroffen war, ging der Akt vor sich unter Benutzung des alten Formulars.
Noch am selben Nachmittag traf die Antwort aus Schwerin ein, in der Adolf Friedrich seinen Standpunkt festhielt. Ein Schreiben an Gustav Adolf lag bei, in dem er darauf aufmerksam gemacht wird, daß durch das Formular, das man in Güstrow benutzen wolle, der Schweriner Secundogenitus gegen den Erbvertrag von der Regierung ausgeschlossen würde, woraus eine "Kriegs=combustion" erfolgen könne, durch welche "Land und Leute endlich möchten consumiret werden". Der Brief kam erst an, als die Huldigung bereits vollzogen war, und ward am nächsten Tage, nachdem inzwischen Wackerbarth noch einmal schriftlichen Protest eingesandt hatte, von Gustav Adolf ausführlich beantwortet. In dieser Antwort weist Gustav Adolf darauf hin, daß die Auslassung des (künftigen) Güstrower Primogenitus im Anfang der Eidesformel wieder das alte gleiche Successionsrecht aller Söhne einführe, das durch den Erbvertrag abgeschafft sei, erklärt sich aber mit Adolf Friedrichs Ansicht über die Nothwendigkeit zweier Regierungen in Meklenburg durchaus einverstanden. Er habe deswegen mit den Landräthen verabredet, daß auf dem nächsten Landtage die Ritterschaft eine Supplication übergeben solle, daß es - trotz des Huldigungseides - jederzeit bei zwei Regierungen verbleibe, 1 ) und sei auch erbötig, den Eid bei der bevorstehenden Huldigung der Städte rvie auch den Lehneid hiernach einzurichten.
Adolf Friedrich erklärte sich (den 11. Juli) hiermit einverstanden, nur daß er eine kleine Wortumstellung vorschlug, der Gustav Adolf stattgab (den 15. Juli). Mit dieser Wort=


|
Seite 217 |




|
Umstellung lautete der Passus der Eventualhuldigung in dem Eidesformular, das bei dem Huldigungsakte der Städte wie auch für den Lehnseid fortab von Gustao Adolf benutzt ward, folgendermaßen: Wir (Jch) loben und schweren - (in Mangel oder gäntzlichen Abgang von Lehnserben der Güstrowschen Linie) "dem auch Durchlauchtigen, Hochgebohrenen Fürsten und Herrn, Herrn Adolph Friedrichen Hertzogen zu Meckl. cum. tot. tit. und nach Sr. F. Gn. tödtlichen Hintritt, den Gott auch lange verhüte, nach Einhalt der Brüderlichen Erb=Verträge S. Fürstl. Gnaden überpleibenden Männlichen Leibes=Lehns=Erben, rechtmäßigen wahren Hertzogen zu Mecklenburg als Unsern von Gott gegebenen Landes=Fürsten und Erb=Herren, getreu - zu seyn." 1 )
Adolf Friedrich also war es gelungen, für seine damalige Auffassung über das Recht des Secundogenitus auf die andere Landeshälfte im Falle von deren Erledigung die Zustimmung auch des Güstrower Neffen brieflich konstatirt zu erhalten. 2 ) Die Wirkung des Huldigungseides, der sich noch auf Herzog Christian als eventuellen Nachfolger im Güstrowschen gerichtet hatte, war durch die folgenden Lehnseide wieder aufgehoben. Somit mochte Adolf Friedrich glauben, die Ausführung seines Testamentes


|
Seite 218 |




|
vollends sicher gestellt zu haben. Allein der geschädigte Primogenitus, Herzog Christian, erhob einen erbitterten und erfolgreichen Widerstand.
Christian Louis' Kampf für die Primogenitur bis zum Beginn des Güstrowschen Erbfolgestreites.
Herzog Christian Louis gehört zu den Persönlichkeiten in unserer Landesgeschichte, deren Charakterbild noch schwankend ist. In der Regel ist er recht ungünstig beurtheilt worden. Schon seine Zeitgenossen klagen über seinen "bizarren humeur" und sprechen von seiner "bekannten Unbeständigkeit". 1 ) Jedermann kennt die beißende Schilderung der Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte über die Rolle, die er am französischen Hofe gespielt hat. 2 ) David Franck faßt seine Ansicht über ihn in die Worte zusammen: "Er liebte anders keine Beständigkeit, als beständig unbeständig zu sein. 3 ) In schroffem Gegensatz zu diesen sehr abfälligen Urtheilen steht das eines Forschers aus neuester Zeit, der sich eingehend mit ihm beschäftigt hat: "Herzog Christian I. war vielleicht neben dem großen Kurfürsten von Brandenburg der weitblickendste Staatsmann in seiner Zeit." 4 ) Dies Lob dürfte zu stark sein, doch ist eins allerdings schon aus seinem Verhalten in der Erbfolgefrage klar: Von Unbeständigkeit ist dabei nichts zu spüren, man müßte denn etwa die Zurücknahme des ihm in jungen Jahren abgepreßten Reverses als eine solche ansehen. Von der Ausstellung dieses Reverses abgesehen, zeigt sein ganzes Verhalten in der Erbfolgefrage sowohl seinen Brüdern wie dem Güstrower Vetter gegenüber die zäheste Konsequenz, darauf gerichtet, von seinen Rechten als Primogenitus nichts abbröckeln zu lassen, die fürstlichen Lande ungetheilt und ihre Einkünfte möglichst ungeschmälert - der dreißigjährige Krieg hatte sie ja ohnehin stark genug geschmälert - in seiner Hand zu behalten, gegebenen


|
Seite 219 |




|
Falles Güstrow mit Schwerin wieder zu vereinigen und für das ganze Land das Primogeniturrecht zur unbestrittenen Geltung zu bringen. Zu alledem stand das letzte Testament des Vaters in schroffstem Gegensatz, gegen dieses also begann Christian Louis, sobald er einige Kenntniß davon erhielt, einen Kampf, den er dann sein ganzes Leben hindurch ohne jedes Wanken und Schwanken, und wenn auch nicht in allen Stücken siegreich, so doch nicht ohne bedeutende Erfolge fortgesetzt hat.
Schon im Mai des Jahres 1653, also 1 1/2 Jahr vor der Unterzeichnung des letzten väterlichen Testamentes, übergab er auf dem Reichstage zu Regensburg zwei Schreiben an den Kaiser (den 14./4. und 18./8. Mai), in deren erstem er den Kaiser ersuchte, seinen Vater zur Wiederauslieferung jenes Reverses zu veranlassen oder denselben zu annulliren, während er in dem zweiten nach Wiederholung dieses Ansuchens feierlich gegen ein etwaiges Testament des Vaters Protest einlegte, sofern darin etwas ihm Nachtheiliges enthalten sei, sowie auch gegen eine etwaige kaiserliche Confirmation desselben vor Vernichtung des Reverses und die Bitte aussprach, die Confirmation entweder gar nicht zu ertheilen oder zum Wenigsten solange damit zurückzuhalten, bis der Revers zurückgegeben oder kassirt sei. Die Eingaben hatten den gewünschten Erfolg, das Testament erhielt die kaiserliche Bestätigung nicht und so brauchte sich Christian Louis an dasselbe nicht gebunden zu halten, als er im Jahre 1658 nach dem Tode des Vaters den Thron bestieg.
Er nahm die gesammten Schwerinschen Lande in Besitz, weigerte seinen Brüdern die Herausgabe der Fürstenthümer und erbat und erhielt die kaiserliche Belehnung auch über diese (17. Juni 1659).
Auf seine Veranlassung erhielt der Lehnbrief über das Herzogthum Schwerin eine Fassung, die ihm auch den Besitz des Güstrower Landes sicherte, für den Fall, daß es bei seinen Lebzeiten erledigt ward. Er setzte nämlich in dem Passus über den Heimfall (s. o. S. 209) an die Stelle des Wortes Gebrüdern das Wort Gevettern, so daß der Passus nun lautete: "ob einer auß obbesagten beeden Gevettern von Todeswegen abgehen, und keine Männliche Lehns=Erben hinter Jhm verlassen würde, daß aldann des Verstorbenen Theil Land und Leute an den Lebendigen, und seine Lehns=Erben kommen und fallen sollen", während es früher vor 1621 geheißen hatte, an die Lebendigen, womit sämmtliche noch übrige Glieder des Fürstenhauses gemeint waren.


|
Seite 220 |




|
Eine scheinbar ganz harmlose und selbstverständliche, in Wahrheit sehr bedeutungsvolle Aenderung, denn durch dieselbe wurden für Christians Lebens= und Regierungszeit seine Brüder von der Erbfolge in Güstrow ausgeschlossen und zugleich wurde ein urkundlicher Beweis geschaffen, auf den sich künftighin die regierenden Fürsten von Schwerin berufen konnten, um ihr Recht auf Güstrow gegenüber den anderen Gliedern der Schweriner Linie darzuthun.
Sehr bald darauf trat der Heimfall von Güstrow durch den Tod des jugendlichen Erbprinzen Johann (den 6. Februar 1660), des einzigen Sohnes, den Herzog Gustav Adolf damals hatte, in den Bereich der Wahrscheinlichkeit. Daß Christian Louis schon damals in der That entschlossen war, wenn Gustav Adolf sterben sollte, Güstrow unverweilt in Besitz zu nehmen, beweist eine Instruktion an seine Räthe, die er in Hamburg, den 3. Februar 1661, ausstellte und worin die Räthe Befehl erhalten, wenn in Abwesenheit ihres Herrn Herzog Gustav Adolf sterben sollte, "gestrax" zwei, drei oder mehr von ihnen mit dem Obersten und Kommandanten von Halberstadt nach Güstrow zu entsenden und von Stadt und Land im Namen des Herzogs Besitz zu ergreifen und alles zu verordnen, "was zu maintenirung der possession und beybehaltung competirenden primogenitur und Successions Rechte und Gerechtigkeiten an diesem Fürstenthumb nötig, diensahm und zulänglich seyn mag." 1 )
Die ganze Frage wurde allerdings durch die Geburt eines neuen Erbprinzen von Güstrow, Karl, die am 18. November 1664 erfolgte, wieder in die Ferne gerückt, doch ging am Güstrowschen Hofe das Gerücht, Christian Louis, der mit seiner ersten Gemahlin, einer Schwester Gustav Adolfs, in Unfrieden lebte, die Ehe mit ihr zu trennen wünschte und sich nach Frankreich wandte, um eine französische Prinzessin heimzuführen, wolle die Hülfe Frankreichs gewinnen, um Gustav Adolf vom Thron zu stoßen. Es wird ihm die Aeußerung in den Mund gelegt, ihm gehöre auch der Güstrowsche Theil, Gustav Adolf sei usurpator desselben; er werde Alles bekommen. Die Besorgniß vor Gewaltstreichen des Schweriner Vetters, sowie der
 . aufbewahrten
Gesandtschaftsberichte, die, soweit es
erforderlich schien, mit herangezogen sind.
. aufbewahrten
Gesandtschaftsberichte, die, soweit es
erforderlich schien, mit herangezogen sind.


|
Seite 221 |




|
Wunsch, die französische Heirath Christian Louis' zu hintertreiben, waren es, die Gustav Adolf Schweden in die Arme trieben.
Dem großen Schwedenkönige, dessen Namen der Güstrower Herzog trug, verdankte das Meklenburger Fürstenhaus seine Rettung, die schwedische Königin, Hedwig Eleonore, die nach dem Tode ihres Gatten, Karls X., die Vormundschaft für ihren Sohn Karl XI. führte, war eine Schwester der Gattin Gustav Adolfs, Magdalene Sibylla, 1 ) und wenn auch Meklenburg nicht weniger als seine Nachbarländer an der Ostsee unter Schwedens willkürlichem und herrischem Auftreten zu leiden hatte, 2 ) so durfte man doch von ihm erwarten, daß es dem Platzgreifen französischen Einflusses an der Ostseeküste entgegenarbeiten und schon deswegen, aber auch wegen der nahen Verwandtschaft seines Fürstenhauses mit dem Güstrower diesem seinen Schutz gegen die Schweriner Prätensionen nicht versagen werde. Gustav Adolf sandte also im Jahre 1663 seinen Kanzleirath und Kammerjunker von Vieregg nach Stockholm und ließ dort von den Drohungen Christian Louis' Mittheilung machen; diese hätten allerdings, solange er, Gustav Adolf, lebe und männliche Nachkommen habe, nichts zu sagen, aber, wenn er ohne männliche Nachkommen sterbe, werde Christian Louis gewiß Ernst machen, "Land und Leute hochbetrüben und der Herzogin und ihren Töchtern sehr beschwerlich" sein. Deswegen sei Herzog Gustav Adolf auf den Gedanken gerathen, mit Herzog Karl - dem nächstälteren Bruder Christian Louis' -, der in schwedischen Kriegsdiensten gewesen und nach den Fürstlichen Erbverträgen in Ermangelung eines männlichen Erben Gustav Adolfs rechtmäßiger Nachfolger sei, verhandeln zu lassen, um von ihm bestimmte Zusicherung zu erhalten, was er der Herzogin und ihren Töchtern zuwenden wolle, wenn Gustav Adolf sich anheischig mache, ihm die Nachfolge zu verschaffen und zu dem Zwecke ihm eine Eventualhuldigung leisten lasse. Der König möge hierzu seinen Beistand


|
Seite 222 |




|
in Aussicht stellen, auch etwaige Gewaltthätigkeiten Christian Louis' gegen Gustav Adolf oder dessen Erben abwehren helfen und seinen Gouverneuren in Pommern, Wismar und Bremen darauf bezügliche Anweisungen geben. 1 )
Auf diese Güstrower Wünsche ging man in Schweden nur theilweise ein. Man suchte allerdings der französischen Heirath Christian Louis' entgegenzuwirken, versprach auch Beistand gegen etwaige Uebergriffe desselben, aber auf die Erbfolgefrage zögerte man so weit sich einzulassen, wie Gustav Adolf es begehrte, und diesem selbst stiegen Zweifel auf, 2 ) ob wirklich die Erbfolge dem Herzog Karl gebühre. Er ließ also die Sache fallen und begnügte sich mit einer allgemein gehaltenen schriftlichen Zusicherung schwedischer Unterstützung gegen Schwerin, die den 8. August 1663 von der königlichen Regierung - der Königin und den Regentschaftsräthen - unterzeichnet wurde.
Die Geburt des Erbprinzen Karl war dann die Veranlassung zu einer zweiten Sendung Viereggs nach Schweden. Er bot dem jungen Könige Karl und der Gemahlin des schwedischen Kanzlers eine Patenstelle an, die beide annahmen, und verhandelte auch wegen der von Christian Louis angeblich beabsichtigten Besetzung von Dömitz und Bützow mit fremden Truppen und der Differenzen zwischen Güstrow und Schwerin, ohne jedoch besondere Resultate zu erzielen. Erst Anfang 1666 (den 16. Jan.) kam es zum Abschluß eines förmlichen Allianzvertrages auf 4 Jahre, der, in seinen Hauptartikeln allgemein gehalten, einen Neben= und Geheimartikel hatte, in dem der König bei zu besorgenden Unruhen von Seiten des Herzogs Christian dem Herzog Gustav Adolf beizustehen versprach. Das Bündniß ward den 16. Dezember 1670 bis zur Majorennität des Königs und den 22. September 1674 von dem nunmehr mündig gewordenen Könige selbst erneuert.
Indessen unterließ Herzog Christian Louis, mochte er nun jene Drohungen ausgesprochen haben oder nicht, um so mehr bei Lebzeiten Gustav Adolfs Güstrow anzutasten, als ihm im eigenen Lande in seinen jüngeren Brüdern die bittersten Feinde erwuchsen, mit deren Bewältigung er genug zu thun hatte. Sie verlangten die Ausführung des väterlichen Testamentes, mithin die Abtretung der beiden Bisthümer an den Secundo- und den


|
Seite 223 |




|
Tertiogenitus, während Christian Louis das Testament als nicht vorhanden behandelte und auch, als es im Jahre 1660 infolge eines kaiserlichen Befehls eröffnet ward, seine Ausführung zu weigern fortfuhr. Den langen Streitigkeiten in ihren Einzelheiten nachzugehen, ist hier unnöthig; das Wesentliche ist, daß Christian Louis seinen Standpunkt behauptete. Herzog Karl starb den 20. August 1670, Herzog Johann Georg den 9. Juli 1675, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Herzog Gustav Rudolf schloß den 19. März 1669 zu Bützow einen Vergleich, in dem er "auß gutem freyen Willen und vorbedächtlich allen und jeden praetensionen", die er aus dem väterlichen Testament oder auch sonst erhoben, entsagte. Uebrigens starb er schon ein Jahr darauf, den 14. Mai 1670. Herzog Friedrich, der den 24. Mai 1669 einen vorläufigen Verzicht ausgesprochen, wiederholte diesen für sich und die Seinigen den 16. Mai 1681. 1 ) Den jüngsten Bruder, den Posthumus Adolf Friedrich (II.) fand Christian Louis durch einen Vertrag ab, den er den 18./28. Dezember i. J. 1687 zu Paris unterzeichnete, und worin er ihm Schloß und Amt Mirow, die alte Johanniterkomthurei, die vorher schon die Herzoge Karl und Johann Georg besessen hatten, zum Wohnsitz und Nießbrauch überwies, allerdings ohne einen förmlichen Verzicht auf die Fürstenthümer von ihm erlangt zu haben. Für den Augenblick hatte nun Christian Louis Ruhe im Hause, allein nur für ganz kurze Zeit.
Zwei Todesfälle im Beginn des Jahres 1688 schufen eine völlig veränderte Lage. Den 15. März dieses Jahres starb der Erbprinz Karl von Güstrow, und am selben Tage ward die Aussicht, daß ihm seine Gattin, Marie Amalie von Brandenburg, einen Erben schenken werde, durch die Geburt eines todten Prinzen zerstört. Bei Gustav Adolfs Alter und Kränklichkeit war kein Ersatz mehr zu hoffen, das Güstrower Herzogthum mußte also in voraussichtlich nicht allzu ferner Zeit erledigt werden. Die Frage, wer es erben werde, ward weit verwickelter, als sie sonst gewesen wäre, durch den Tod des Herzogs Friedrich von Grabow, der einen Monat nach Herzog Karl am 28. April das Zeitliche segnete und drei unmündige Söhne, Friedrich Wilhelm, Karl Leopold und Christian Ludwig (II.), hinterließ. Es ließ sich bezweifeln, ob diese seine Söhne in die Rechte, die er etwa auf Güstrow hatte, eintreten mußten, oder sein Bruder Adolf


|
Seite 224 |




|
Friedrich. Wer das Primogeniturrecht als gültig auch für den Heimfall einer Landeshälfte ansah, mußte die Combination beider Herzogthümer unter Herzog Christian Louis oder dessen Nachfolger, dem ältesten Sohne Friedrichs von Grabow, Herzog Friedrich Wilhelm, fordern. Wer dagegen die Combination auf Grund des Rezesses vom Jahre 1621 für unstatthaft hielt, hatte sich noch zu entscheiden, ob der zweite Sohn Friedrichs von Grabow, Herzog Karl Leopold, oder der letzte noch lebende Bruder Christian Louis', Herzog Adolf Friedrich, der dem Güstrower Herzoge um einen Grad näher verwandt war als die Söhne Friedrichs, die bessere Berechtigung habe. Die Entwickelung, die das Erbrecht, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, im meklenburgischen Fürstenhause genommen hatte, erlaubte es, für jeden der drei Prätendenten Rechtsgründe genug ins Feld zu führen.
Doch ist Herzog Karl Leopold bis zum Jahre 1700 mit seinen Ansprüchen nicht hervorgetreten, desto entschiedener aber machte Herzog Adolf Friedrich die seinen geltend.
Sein Streit darüber mit den beiden Schweriner Herzögen Christian Louis und Friedrich Wilhelm ist der Güstrower Erbfolgestreit, der also mit jenen beiden Todesfällen im Jahre 1688 beginnt. In seinem ersten Stadium verknüpft er sich mit zwei anderen Streitfragen, die Adolf Friedrich gleichzeitig auf die Bahn brachte, aber eher fallen ließ. Er machte nämlich Miene, den Söhnen Friedrichs auch die Erbfolge in Schwerin zu bestreiten und benutzte den Tod seines Bruders zur Erneuerung seiner Ansprüche auf eins der Fürstenthümer, für das er mindestens eine Erhöhung seiner Apanage verlangte.


|
Seite 225 |




|
II.
Meklenburgische Combinationspläne in den letzten Lebensjahren des Herzogs Christian Louis.
Verhandlungen der Herzoge Friedrich und Christian Louis mit Adolf Friedrich.
Die Schweriner Erbfolgefrage hatte bereits vor dem Tode des Herzoge Friedrich von Grabow zu Verhandlungen zwischen ihm und Adolf Friedrich Veranlassung gegeben. Im Jahre 1687 hatte nämlich Herzog Friedrich an diesen das Ansinnen gestellt, auf die Erbfolge im Schwerinischen Hause für sich und seine Nachkommen zu verzichten, mit dem Anerbieten, ihm eine zulängliche Apanage sichern zu wollen. Adolf Friedrich lehnte diese Anmuthung ab, und auch eine persönliche Zusammenkunft mit dem Bruder in Grabow ließ ihn nicht andern Sinnes werden.
Durch ihn erhielt sein Schwiegervater Herzog Gustav Adolf 1 ) Kenntniß von diesen Verhandlungen, und auch dieser begann Erwägungen über die Erbfolge im Schwerinischen anzustellen. Sie bezogen sich auf den Fall, wenn Herzog Friedrich noch vor Adolf Friedrich und Christian Louis sterbe. Um sich zu vergewissern, wer dann das bessere Anrecht auf Schwerin habe, die Söhne Friedrichs oder Adolf Friedrich, erbat er sich ein Gutachten von der Juristen=Fakultät zu Frankfurt a. d. Oder (d. 27. März 1687). In der Facti Species, die dem Schreiben an die Fakultät beigegeben war, sind fingirte Namen an die Stelle der richtigen eingesetzt: Ein Fürst Namens Auffridius hat drei Söhne hinterlassen, Cajus, der kinderlos ist, Sejus, der gestorben ist und Söhne hinterlassen hat, und Titius. Die Frage wird aufgestellt, ob beim Tode des Cajus die Söhne des zweiten Bruders Sejus oder der jüngste Bruder Titius das Fürstenthum zu erben hätten. Die Verhüllung der wirklichen Namen ist sehr durchsichtig, Auffridius ist Adolf Friedrich I., Cajus, Sejus und


|
Seite 226 |




|
Titius sind die drei Brüder Christian Louis, Friedrich und Adolf Friedrich II. Die Antwort der Fakultät (datirt vom 1. April 1687) stellt die Gegenfrage, ob in dem betreffenden Fürstenhaus das Primogeniturrecht eingeführt sei oder nicht. Wer dies behaupte, werde den Beweis erbringen müssen, daß es ordentlich - durch kaiserliche Confirmation - geschehen sei. Wenn dies nicht zu erweisen sei, so müsse das Fürstenthum in zwei Theile getheilt werden, von denen der eine den Söhnen des Sejus, der andere dem Titius zufallen müsse. Durch dieses Gutachten, das auch Adolf Friedrich bekannt geworden sein wird, mußte dieser noch in seiner Ueberzeugung bestärkt werden, daß seine Befugniß zur künftigen Nachfolge im Herzogthum Schwerin gegründet sei, da kein Hausgesetz über die Primogenitur vorhanden sei. 1 ) Er blieb also den wiederholten Zumuthungen Friedrichs gegenüber unzugänglich und wandte sich nach Friedrichs Tod an den König von Schweden, Karl XI., um diesem seine Berechtigung zur Erbfolge in Schwerin zu erweisen und Schwedens Unterstützung zu erbitten. Der König verlangte eine juristische Deduktion von dem Rechte Adolf Friedrichs und antwortete, als er diese erhalten hatte, er werde Adolf Friedrich in seinem Verlangen nach Möglichkeit willfahren. Es war eine höfliche Ablehnung; Schweden enthielt sich jeder Einmischung in die Schweriner Erbfolgefrage.
Nach Herzog Friedrichs Tod nahm Christian Louis deren Lösung selbst in die Hand. Er gedachte sie zugleich mit den andern Streitfragen, die durch die beiden Todesfälle Anfang 1688 aufgerollt waren, dadurch zu lösen, daß er Adolf Friedrich eine Verbesserung seiner Apanage in Aussicht stellte für den Fall, daß er durch einen Revers auf alle sonstigen Erbfolgeansprüche verzichte.


|
Seite 227 |




|
Adolf Friedrich scheint eine Zeit lang geschwankt zu haben, ob er sich auf einen solchen Revers einlassen solle. Er wandte sich, wie er in allen wichtigen Angelegenheiten pflegte, an seinen Schwiegervater mit der Bitte um guten Rath, da seine ganze Hoffnung auf Gustav Adolf stehe (Schreiben vom 6. August 1688) und übersandte dabei die Punkte, die von Christian Louis aufgesetzt seien, nebst einem Gegenvorschlag von ihm selbst. Die Antwort Gustav Adolfs ist "dilatorie" gehalten und begnügt sich mit dem Hinweis, welches Interesse er wegen seiner Tochter an Adolf Friedrich nehme.
Welche Wirkung diese Antwort auf Adolf Friedrich gehabt hat, ist nicht ersichtlich; doch ward sein anfängliches Schwanken - wenn er wirklich geschwankt hat und nicht vielleicht der Brief an seinen Schwiegervater nur ein Höflichkeitsakt war - bald zu einer entschiedenen Ablehnung, und bei dieser blieb es, obgleich nun Christian Louis allen Bitten und Forderungen gegenüber, die dürftige pekuniäre Lage, in der Adolf Friedrich sich befand, zu bessern, 1 ) völlig taub blieb.
Diese Behandlung empfand Adolf Friedrich als bittere persönliche Kränkung und gab seinem Unwillen in seinen Briefen häufig lebhaften Ausdruck. Um aus seinen vielen Aeußerungen nur eine herauszuheben, beklagt er sich - Ende 1691 2 ) - seinem Schwiegervater gegenüber "über den fast unversöhnlichen Haß und abwillen", der ihm vom Herzog Christian Louis "zugeworfen" werde, 3 ) ohne auf die sachlichen Motive, die Herzog Christian Louis bei dieser seiner unbrüderlichen Handlungsweise leiteten, irgendwie einzugehen.
In demselben Briefe drückt er seine Zuversicht aus, daß Gustav Adolf ihn und seine Nachkommen zu der Succession erkiesen werde, und sucht darüber nähere Versicherung und Gewißheit zu erhalten. Dann bittet er um Weiterzahlung einer Beihülfe von 1500 Thlr. jährlich, die ihm sein Schwiegervater bei seiner Vermählung versprochen hatte, die aber das letzte Mal nicht bezahlt war, und fragt noch einmal, ob er, falls Gustav Adolf ihn nicht


|
Seite 228 |




|
weiter unterstützen wolle, den Revers Christian Louis' unterzeichnen könne, wenn Christian Louis ihm mit kaiserlicher Confirmation die Versicherung ertheile, daß der Revers sich nur auf seine, Christian Louis', Person und Erben beziehe. Gustav Adolf verspricht in der Antwort Weiterzahlung der 1500 Thlr., über den Punkt der Erbfolgefrage aber drückt er sich zweifelnd aus: "E. Lbd. wissen selbst, wie delicat derselbe ist;" hierin könne er "so bloßhin für sich nichts disponiren", sondern müsse die gemeinen Lehnsrechte und pacta Familiae gelten lassen.
Kurz nach diesem Briefwechsel, der Adolf Friedrichs Hoffnungen nicht eben zu ermuthigen geeignet war,. entschloß er sich auf den Rath des bekannten Grafen Bernstorff, 1 ) der als Premierminister von Lüneburg=Celle eine einflußreiche und verdienstvolle Thätigkeit entfaltete, dabei aber lebhafte Beziehungen zu seinem Heimathlande Meklenburg zu unterhalten fortfuhr, zu einer Reise nach dem Haag, um in persönlicher Aussprache den harten Sinn des Bruders, wenn möglich, umzustimmen, allein auch diese Reise hatte nicht den gewünschten Erfolg, Christian Louis blieb dabei, vor Unterzeichnung des Reverses könne von weiteren Zugeständ=


|
Seite 229 |




|
nissen keine Rede sein. Auf der Rückreise sprach Adolf Friedrich wieder bei Bernstorff in Celle vor, der sich seiner denn auch weiter annahm und von seinem Herrn das Versprechen erwirkte, sich für ihn wegen der Grabowschen Forderung und der Apanage bei Christian Louis zu verwenden und auch eine kaiserliche Kommission in dieser Sache zu übernehmen. Dieser Verabredung entsprechend reichte nun Adolf Friedrich eine Klage in Wien gegen Christian Louis wegen Vorenthaltung der ihm nach dem väterlichen Testamente zukommenden Apanage ein und ersuchte zugleich darum, Lüneburg=Celle ein Kommissorium zur Vermittelung in dieser Sache zu ertheilen.
Mit diesem Schritte, den er ohne Vorwissen seines Schwiegervaters gethan, erregte er nun freilich dessen Unwillen. Gustav Adolf hätte lieber gesehen, wenn er selbst das Kommissorium erhalten, und ließ dies auch durch seinen Wiener Bevollmächtigten, den Geheimen Sekretär Joh. Heinr. v. Pommer Esche, d. 19. März beim Reichshofrath beantragen. 1 )
Wenn Adolf Friedrich in dieser Zeit seinem Schwiegervater gegenüber eine selbstständige Haltung annahm, so lag der Grund hierfür offenbar in der Wahrnehmung, daß er auch an seinem Schwiegervater keine sichere Stütze mehr habe. Herzog Gustav Adolf hatte nämlich schon längst eine ganz andere Lösung der Schweriner wie Güstrower Erbfolgefrage ins Auge gefaßt.
Gustav Adolfs Combinationsplan.
Das erste und dringendste Bedürfniß war für ihn die Sicherung seiner Gattin wie seiner Töchter. Der Vertrag mit Schweden vom Jahre 1666 schien ihm dafür noch zu wenig Gewähr zu bieten, und so sandte er denn Ende 1689 den Oberst Oesterling nach Stockholm, um die Erneuerung desselben in veränderter Form zu erwirken. Nach einigem Zögern ließ sich Schweden dazu bereit finden (d. 22. Februar 1690). Der neue Vertrag enthielt vier Paragraphen: der erste betraf die Erneuerung der alten Allianz, der zweite verhieß Schwedens Unterstützung, um für Gustav Adolfs Wunsch eigenes Militär zu errichten, in Wien die Genehmigung zu erwirken, 2 ) der dritte versprach, daß


|
Seite 230 |




|
der König nach Gustav Adolfs Tode sich seiner Gemahlin und Töchter annehmen wolle, damit sie im Genusse der ihnen verschriebenen Güter und Einkünfte geschützt würden, der vierte dehnte dieses Schutzversprechen auch auf die Minister, Räthe und Diener des Herzogs aus. 1 )
Nach Oesterlings Rückkehr ging Ende März 1690 Hofrath Thile nach Stockholm mit der Ratifikation des Vertrages, auch einer "Erkenntlichkeit" an die leitenden schwedischen Staatsmänner und dem Auftrage, vom Könige eine geheime Verordnung an seinen Gouverneur von Pommern, Generalfeldmarschall Grafen Bielke, zu erwirken, daß dieser, wenn über kurz oder lang der Höchste über des Herzogs Person verfüge, sofort auf seiner Gemahlin Begehr eine Anzahl Mannschaften in die Residenz Güstrow und die Aemter Güstrow und Schwaan, der Leibgedinge der Herzogin, verlege und nicht verstatte, daß Jemand davon Besitz ergreife wider den Willen der fürstlichen Wittwe, bis diese wegen des Nießbrauchs des ihr und ihren Kindern Zukommenden genugsam versichert sei; auch zum Schutze der fürstlichen Räthe und Minister sollten diese Truppen bestimmt sein. Der Grund für das Ansuchen um diese Verordnung war, daß es zuviel Zeit erfordere, wenn erst von Güstrow an den König berichtet und von diesem dann nach Pommern Ordre gegeben werde. Während Thile hierüber noch verhandelte, ward er in einem Schreiben vom 3. Mai angewiesen, Graf Bielke zu ersuchen, auf ein paar Monate 50 Mann nebst einem Unteroffizier an Gustav Adolf zu entleihen, die zur Ausbesserung der Befestigungen von Güstrow


|
Seite 231 |




|
verwandt werden sollten. 1 ) Da Graf Bielke gerade nicht in Stockholm anwesend war, so wandte sich Thile auch mit dieser Bitte an den König. Beide Wünsche fanden Gewährung; den 15. Juli meldet Graf Bielke den Empfang der betreffenden königlichen Schreiben.
Schon im Oktober desselben Jahres ward Hofrath Thile aufs Neue zu Bielke nach Hamburg gesandt. Es handelt sich um den Plan des Herzogs, eigenes Militär zu errichten. Da hierzu schon wegen der finanziellen Schwierigkeiten nicht sobald Aussicht war, so kam Gustav Adolf auf den Gedanken, eine größere Menge schwedischer Truppen in seinen Dienst zu nehmen, und hoffte dabei, daß Schweden sich hierauf einlassen und annehmbare finanzielle Bedingungen stellen werde. Er ließ um ein Regiment guter Fußvölker und eine Schwadron Dragoner anhalten. Da aber Bielke die Meinung äußerte, daß der König ein ganzes Regiment zu geben sich schwer entschließen werde und sicher es nicht ohne Offiziere werde geben wollen, während Gustav Adolf die Truppen unter das Kommando seiner eigenen Offiziere zu stellen wünschte, so erklärte der Herzog auf die Dragoner verzichten und vor der Hand mit 5 Kompagnien zu Fuß zufrieden sein zu wollen; umgekehrt erschien ihm im Dezember 1690 ein Regiment Dragoner von 8-10 Kompagnien zu 80 Mann für seinen Zweck entsprechender. 2 ) Allein der König zeigte gegen Ueberlassung einer irgendwie erheblicheren Truppenzahl ein starkes Widerstreben. Er hatte Wünsche um Abtretung von Regimentern von seiten des Kaisers wie anderer Fürsten mehrfach abgeschlagen und besorgte deshalb, wenn er Güstrow


|
Seite 232 |




|
gegenüber von dieser Praxis abweiche, den Unwillen des Kaisers wie jener andern Fürsten zu erregen; auch hegte er nicht die Absicht, sich tiefer, als es das Interesse Schwedens wie seine verwandtschaftlichen Gefühle für die Güstrower Herzogin erforderten, in die meklenburgischen Händel hineinziehen zu lassen. Er wünschte keinen Krieg wegen Güstrow zu führen; die Gefahr eines solchen aber ward um so größer, je stärker die schwedische Truppenabtheilung war, die im Güstrowschen stand. Es wurde also vorläufig (Ende 1690) nur die schon in Boizenburg stehende schwedische Garnison von 50 Mann um weitere 50 Mann verstärkt, erst später (Frühling 1692) eine Kompagnie schwedischen Fußvolks nach Güstrow gelegt, dem Vorgeben nach, um dort die schadhaft gewordenen Befestigungen auszubessern, in Wahrheit zu dem im Vertrage angegebenen Zwecke; darauf lautete wenigstens die geheime Instruktion der Schweden.
Herzog Gustav Adolf gedachte sich ihrer, wie auch der größeren schwedischen Truppenabtheilungen, die er zu erhalten hoffte, noch zu einem anderen Zwecke zu bedienen. Welcher es war, davon gab er im Sommer 1691 durch Thile in Stockholm eine erste leise Andeutung. Gustav Adolf war zu Ohren gekommen, daß Adolf Friedrich sich in Schweden um Unterstützung beworben für sein Recht auf Schwerin, und auch Zusage erhalten habe. Er ließ melden, er gönne zwar seinem Vetter alle Beförderung gerne, habe aber bei dieser Sache noch eine und andere wichtige consideration, wovon er künftig dem König pari geben wolle, und darum ersuchen, daß Schweden in dieser Sache ohne Gustav Adolfs Vorwissen keine bindende Verpflichtung eingehe, dagegen ließ er für sich selbst um Ausstellung einer Vollmacht für den Generalgouverneur in Pommern anhalten, ihm ohne weitere königliche ordre auf sein Ansuchen Hülfe zu leisten. Was Adolf Friedrich betraf, so stellte sich bald heraus, daß keinerlei bindende Verpflichtungen von seiten Schwedens für ihn bestanden, vielmehr nur allgemein gehaltene Versprechungen vor mehreren Jahren (s. o. S. 226) gegeben waren. Man willfahrte hierin Gustav Adolfs Begehren, und als sich im Januar 1692 Adolf Friedrich in einem neuen Schreiben an die Königin=Mutter wandte, worin er sich beklagte, daß er so gänzlich verlassen und außer Stande sei, zu seinen Befugnissen zu gelangen, den König um Unterstützung ersuchte und zur nachdrücklicheren Beförderung seiner Affairen um Verleihung eines Obrist=Platzes für ein schwedisches Regiment bat, erregte er wohl Mitgefühl am schwedischen Hofe, erhielt aber auf Thiles Dazwischen=


|
Seite 233 |




|
treten die Mahnung, er möge zu seinem Schwiegervater ein gutes Vertrauen fassen und seinem heilsamen und wohlgemeinten Rathe folgen; ein Regiment sei nicht vakant. Noch in demselben Monate trat dann Thilo mit dem Plane seines Herrn, nach dem Tode Christian Louis' beide Herzogthümer unter seiner eigenen Regierung zu vereinigen, 1 ) wobei er auf Schwedens Beistand rechne, offen hervor. Hofrath Polus, die rechte Hand des Kanzlers Oxenstierna, war der Erste, mit dem er darüber sprach. Polus erklärte ihm in voller Offenheit: "die Schweden wären was jaloux und sähen ungern, daß eine ihnen benachbarte Macht anwüchse und formidable würde" und auf Thiles Einwurf, daß doch durch die Verstärkung der Macht Gustav Adolfs auch Schwedens Macht verstärkt werde, dessen treuer Freund er sei, hatte Polus nur die Antwort, man müsse die Sache überlegen. Er hatte dann über den Gegenstand eine Unterredung mit seinem Chef. Auch dieser war der Ansicht, daß durch die Vereinigung der beiden meklenburgischen Herzogthümer die schwedische Macht an der Ostsee gefährdet und zurückgedrängt werde. Am gefährlichsten sei diese Combination wenn sie unter dem Hause Schwerin stattfände und dieses sich dann, wie es den Anschein habe, eng mit Brandenburg alliire. 2 ) Dem befreundeten Gustav Adolf gönne man eine solche avantage eher. Den Inhalt dieser Unterredung theilte Polus, um sich für die Erkenntlichkeit, die ihm Thile zu Anfang des Jahres mitgebracht, dankbar zu erweisen, diesem mit, ja er fügte sogar seiner Erzählung den Rath hinzu, der Herzog möge sich in dieser Sache nicht gänzlich auf Schweden verlassen; man werde ihm vielleicht einige Verheißung thun, er wisse aber nicht, ob man in dieser so delikaten Sache zuversichtlich darauf bauen könne. 3 ) Trotz dieser wenig ermuthigenden


|
Seite 234 |




|
Nachricht gab Gustav Adolf seinen Plan noch nicht auf, konnte aber die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms nicht hindern, von der er überhaupt erst Nachricht erhielt, als sie bereits vollzogen war.
Christian Louis' Gegenmaßregeln.
Christian Louis hatte, auch aus der Ferne und schon ein sterbender Mann, dennoch gute Wacht gehalten und wohl bemerkt, daß der Güstrower Vetter etwas im Schilde führen müsse.
Die fortwährenden Botengänge nach Schweden und zu Graf Bielke, das Einrücken schwedischer Truppen und ihre Verstärkung, alles deutete auf gefährliche Anschläge hin. Er that also Alles, was möglich war, um ihre Ausführung zu hintertreiben und seinem Neffen Friedrich Wilhelm, dem ohne Zweifel nach dem Primogeniturrecht die Erbfolge gebührte, den Thron zu sichern.
Als ältester Bruder des verstorbenen Herzogs Friedrich hatte er die Vormundschaft über dessen Söhne übernommen. Im Juni 1690 ließ er nun seinen zukünftigen Nachfolger nach Schwerin bringen, wo dieser den 2. Pfingsttag, d. 11. Juni, eintraf und auf dem Bischofshofe Wohnung nahm. In Schwerin ward die letzte Hand an die Erziehung des jungen Fürsten gelegt; er erhielt noch Unterweisung in "Sprachen und Exercitien. 1 ) Die Bemühungen seiner Lehrer wurden durch mahnende Briefe des Oheims unterstützt, der auch mit seinen Räthen in Schwerin fortwährend eine rege Korrespondenz unterhielt.
Anfang 1692 hatte der schon bejahrte Fürst an starkem Husten zu leiden, der ihn so angriff, daß der Schriftwechsel mit Schwerin im Februar des Jahres ins Stocken gerieth. Gerüchte von seinem bevorstehenden Tode verbreiteten sich, und in Schwerin erzählte man, daß Herzog Gustav Adolf Schritte vorbereite, um sich nach Christian Louis' Tode der Vormundschaft zu bemächtigen. Die Räthe wie auch Friedrich Wilhelm selbst schrieben besorgt nach dem Haag und baten um Nachricht über sein Befinden und Instruktion für den Fall seines Todes. Die Antworten des Herzogs sind datirt vom 25. Februar neuen Stils. Er beschwichtigte ihre Besorgnisse wegen seiner Gesundheit, mit


|
Seite 235 |




|
der es jetzt wieder besser gehe, und ordnete an, daß alle seine Räthe und Diener nach seinem Tode Herzog Friedrich Wilhelm als ihren rechtmäßigen Herrn erkennen und ihm in Befestigung seines Regimentes wie auch zur Erlangung der Regierung im Güstrowschen behülflich und beförderlich sein sollen.
Falls Gustav Adolf noch bei seinen Lebzeiten stirbt, soll das erledigte Herzogthum sofort in seinem Namen von Friedrich Wilhelm und der Regierung zu Schwerin in Besitz genommen werden. Christian Louis will auch darauf bedacht sein, seine Verordnungen über die Erbfolge in eine förmliche pragmatische Sanktion zu bringen, vor der Hand aber läßt er es bei den gegebenen Verordnungen bewenden. Friedrich Wilhelm erhält noch einmal eine nachdrückliche Mahnung, die Güstrowsche Succession ja nicht zu vernachlässigen, 1 ) und die Mittheilung, daß Christian Louis Willens sei, mit der verwittweten Herzogin zusammen bei Kays. Maj. für ihn veniam aetatis (d. i. die Großjährigkeit vor der sonst üblichen Zeit) zu erbitten. Solle sich aber vor dem Erfolg dieses Schrittes mit ihm etwas begeben, so möge sich Friedrich Wilhelm nichts desto weniger in der Possession aufrecht halten gegen alle, so ihn darin zu turbiren unternähmen, und sich dazu des Rathes und der Assistenz seiner - Christian Louis' - Leute bedienen, "damit Recht und Gerechtigkeit gehandhabt, und Kai. Maytt. und dem Reiche das Ihrige prestiret werde."
Die Räthe versprachen in ihrer Antwort auf das Schreiben des Herzogs vom 25. Februar auf das Feierlichste Gehorsam und wiederholten ihre Versicherung noch einmal den 9. März/28. Februar, baten aber in einem neuen Schreiben vom 16./6. März, in dem sie sich sehr ausführlich über das Erbrecht auf Güstrow äußern, der Herzog möge, wenn es sein Befinden erlaube, selbst kommen, weil so den etwaigen schädlichen Güstrowschen Plänen am besten zu begegnen sei. Der Herzog erfüllte diese Bitte nicht und hätte


|
Seite 236 |




|
sie, auch wenn er gewollt hätte, wohl kaum noch erfüllen können, da sein Zustand eine so weite Reise schwerlich noch gestattet hätte, allein er blieb bis an seine letzten Lebenstage eifrig darauf bedacht, die Interessen seines Neffen nach Möglichkeit zu fördern und, was ihm etwa bei der Schwerinischen und Güstrowschen Erbfolge in Wege stehen könnte, wegzuräumen.
Den 25. April erließ er an seine Räthe die Weisung, die Landräthe und Deputirten der Ritterschaft und Landschaft nach Schwerin zu berufen und ihnen einen Provisional=Eid oder einen schriftlichen Revers abzuverlangen, daß sie nach seinem Tode Friedrich Wilhelm für ihren rechtmäßigen, angeborenen Landesfürsten und Herrn anerkennen würden. Interessant ist die Begründung dieser Maßregel, die der Herzog in einem Post=Scriptum giebt. Der vornehmste Grund dazu lag nämlich in dem damals jüngst geäußerten Wunsche Brandenburgs, die alten Verträge wegen der Eventual=Erbfolge zu erneuern. Christian Louis war besorgt, daß bei der bevorstehenden Veränderung Brandenburg unter dem Vorwand, seine Leute bei der Huldigung zu haben und sich bei seinem vermeintlichen Rechte zu behaupten, "allerhand unlust und wol gar Thätlichkeiten im Lande anfangen und verüben könnte"; dann sei zu befahren, wie auch schon jetzt verlaute, daß Lüneburg solchem "Dominat"(!) nicht stillsitzend zusehen, sondern auf gleiche Maße widersprechen werde, es könnten sich dann wohl gar noch andere hinzuschlagen und das Unheil vergrößern, woraus aber nichts denn gänzliche Verwüstung (desolation) des Staates, ja wohl gar desselben Zerrüttung erfolgen könne. Diesem großen Unheil sei nicht besser vorzubauen, als wenn man sich durch die Interims=Huldigung fürs erste von der Nothwendigkeit einer öffentlichen Huldigung nach eingetretenem Todesfall zu dispensiren trachte. - Dies also, die Besorgniß Christian Louis', Brandenburg könne seinen Tod benutzen, um auf Grund seines Eventual=Erbrechtes sich in Meklenburg festzusetzen, und dadurch kriegerische Verwickelungen veranlassen, war es in erster Linie, was ihm den Gedanken der Eventualhuldigung eingegeben hat. Erst in zweiter Linie weist er dann auf die Güstrowschen "gefährlichen desseins" hin, gegen die man sich ebenfalls am besten durch den Provisional=Huldigungsakt schützen könne.
Dem Befehle des Herzogs gemäß wurden die Landräthe und Deputirten der Stände auf den 13. Juni nach Schmerin geladen und leisteten hier in feierlicher Versammlung willig dem an=


|
Seite 237 |




|
wesenden Herzog Friedrich Wilhelm den Handschlag der Treue und des Gehorsams. 1 )
Die letzte Maßregel, die Christian Louis im Interesse seines Neffen traf, war die Besetzung der Festung Bützow durch zwei Kompagnien dänischer Dragoner, die später durch Fußvolk abgelöst werden sollten. Es war die Antwort auf die Besetzung Güstrows und Boizenburgs durch die Schweden. Das betreffende Schreiben des Herzogs aus dem Haag an die Regierung in Schwerin ist datirt vom 6. Juni, es enthielt neben ausführlicher Begründung der Maßregel 2 ) den Befehl, der Oberstallmeister


|
Seite 238 |




|
v. Bibow solle nach Kopenhagen reisen zum Abschluß der betreffenden Stipulation.
Indessen hatte der Herzog bereits durch direkte Verhandlung mit Dänemark den Abschluß soweit vorbereitet, daß die dänischen Dragoner schon am 9. Juni (a. St.) in Bützow einrückten, obgleich Bibow erst den 7. Juni Nachmittags aus Schwerin abreiste und das Schreiben des Königs Christian von Dänemark, welches die Bewilligung der Truppen ausspricht, erst vom 18. Juni datirt ist. 1 ) Der Eid, den die Dänen dem Herzog schwuren, ward gleich auf Friedrich Wilhelm mit gerichtet. Im Laufe der nächsten Tage wurden kleine Abtheilungen Dragoner


|
Seite 239 |




|
über die Aemter Meklenburg, Redentin, Bukow und Doberan vertheilt und auch Haus und Amt Schönberg (im Fürstenthum Ratzeburg) durch eine Abtheilung besetzt.
Da zu erwarten war, daß bei den benachbarten Fürsten und auch beim Wiener Hofe die Aufnahme der fremden Mannschaft Anstoß erregen werde, so wurden auf Anordnung Christian Louis' von Schwerin aus Schreiben an den Kaiserlichen Gesandten im niedersächsischen Kreise Baron v. Gödens (d. 9. Juni), den churbrandenburgischen Statthalter Fürsten zu Anhalt, die schwedische Regierung zu Stade, den Gouverneur von Wismar, Generalleutnant v. Buchwaldt, und die Regierungen der welfischen Staaten Celle=Hannover und Wolfenbüttel (diese sämmtlich d. 10. Juni) abgelassen mit der Anzeige, daß der Herzog sich entschlossen, zur Ausbesserung der Befestigung von Bützow einige Kompagnien Dänen in sein Land aufzunehmen, die ihm der König abgetreten, und der Bitte, deswegen keinen Argwohn zu schöpfen.
Die Antworten auf diese Schreiben bekam Christian Louis nicht mehr zu Gesicht. Seine Lebenskräfte waren in schneller Abnahme begriffen 1 ) und er verschied den 11./21. Juni. Auf seinen Befehl war sein schwer leidender Zustand verheimlicht worden; die Nachricht von seinem Tode gelangte durch Eilboten zuerst an den Rath von Bünsow nach Ratzeburg und von dort nach Schwerin an die Regierung, wo sie am 15. Juni (a. St.) ankam.
Nachmittags um 2 Uhr fuhr Herzog Friedrich Wilhelm aus seiner bisherigen Wohnung auf das Schloß, um hier als regierender Fürst seinen Wohnsitz zu nehmen. Noch am selben Abend leisteten die Räthe ihrem neuen Fürsten den Eid der Treue. Den 16. Juni wurden die Befehle zur Besitzergreifung für die verschiedenen Theile des Landes unterzeichnet. Nirgends erhob sich Widerstand oder auch nur Widerspruch. In Güstrow erfuhr man den Tod des Herzogs erst am 18. Juni; die offizielle Todesanzeige ward nach Güstrow aus dem Haag erst gesandt, als ein Kourier aus Schwerin die Nachricht dorthin gebracht, daß Friedrich Wilhelm die Regierung unangefochten angetreten habe.
Die Schweriner Erbfolgefrage war damit in der Hauptsache gelöst. Freilich ungefährdet war die Stellung des jungen Herzogs selbst im Herzogthum Schwerin noch nicht. Noch hatte


|
Seite 240 |




|
Gustav Adolf seine Anschläge auf Schwerin nicht aufgegeben, noch viel weniger Adolf Friedrich seine Ansprüche. Diesem bot vielmehr der Tod Christian Louis' Veranlassung, seine Ansprüche auf Grund des väterlichen Testamentes in weitestem Umfange zu erneuern. Ebenso war die Güstrowsche Erbfolgefrage noch ungelöst geblieben.
III.
Der Streit über die Belehnung Friedrich Wilhelms und das Güstrower Eheprojekt.
Weitere Verhandlungen Gustav Adolfs mit Schweden.
Die gefährlichste Zeit war für den jungen Fürsten die Frist, bis aus Wien der zu erwartende kaiserliche Erlaß mit der venia aetatis eingetroffen war. Sie ging indessen ohne Anfechtung vorüber. Herzog Gustav Adolf wagte keinen gewaltsamen Schritt, da ihm Schweden seine Unterstützung nicht in dem gewünschten Maße lieh. Vom 23. Juli 1692 ist das Dekret datirt, das die Volljährigkeit Friedrich Wilhelms aussprach; mit ihm war etwaigen Vormundschaftsgelüsten des Güstrower Herzogs die Spitze abgebrochen. Er spann indessen seine Verhandlungen mit Schweden noch weiter fort.
Kurz vor dem Tode Christian Louis' hatte er, als die dänischen Truppen nach Bützow rückten, Thilo wieder an Graf Bielke nach Hamburg gesandt und um Ueberlassung von zwei Regimentern gebeten, da die Zahl der schon ins Schwerinische eingerückten oder noch zu erwartenden Dänen vom Gerüchte bis auf ganze Regimenter vergrößert war. An Abtretung einer solchen Truppenmacht dachte Schweden um so weniger, als sich das Uebertriebene jener Gerüchte bald herausstellte, doch wurde noch im Sommer 1692 die eine schwedische Kompagnie in Güstrow durch zwei neue abgelöst. Die bald darauf von Brandenburg wieder begonnenen Verhandlungen mit Herzog Friedrich Wilhelm über die Erneuerung der Eventual=Erbfolge


|
Seite 241 |




|
boten dann Gustav Adolf einen neuen Hebel, Schweden gegen Friedrich Wilhelm in Bewegung zu setzen. Im Oktober 1692 erhielt Graf Bielke durch Thilo Mittheilung von diesen Verhandlungen und Gustav Adolf ließ ihm sagen, er für seine Person würde viel lieber mit dem König von Schweden einen solchen Erbfolgevertrag aufrichten. 1 ) Den 4. Dezember desselben Jahres sandte Thile einen Bericht ähnlichen Inhalts an Hofrath Polus nach Stockholm. 2 ) In Schweden sprach man sich zwar über dieses Angebot nicht ungünstig aus, es blieb aber bei freundlichen Worten.
Einen letzten Versuch mußte der Geh. Kammerrath Mumme machen, der im Januar 1693, nach Thites Tod, an den Grafen Bielke gesandt ward und überhaupt seitdem die Verhandlungen mit Schweden fast ausschließlich führte. Die Instruktion (datirt vom 4. Januar), die er mitbekam, hatte 9 Paragraphen. Die wichtigsten davon sind folgende: Nach § 1 sollte Mumme sich schon auf dem Wege nach Stettin in Demmin erkundigen, aus was für Leuten die Garnison dort bestehe, und den Kommandanten sondiren, ob er den Befehl habe, wenn man einige Hülfe in Meklenburg begehre, dazu bereit zu sein; nach § 2 hatte Mumme bei Bielke selbst anzuhalten, daß dieser den Major seines eigenen Regimentes als Kommandeur nach Demmin lege. Mumme, der den Grafen am 22. Januar auf dessen Gut Schönenwalde traf und eingehende Unterhaltungen mit ihm hatte, erhielt hierüber von Bielke selbst den Bescheid, daß er nicht allein dem Major in Demmin die gewünschte Ordre gegeben, sondern auch sein ganzes Regiment zu Pferde und einige Kompagnien zu Fuß an die Grenze gelegt habe, so daß sie in kurzer Zeit in Meklenburg stehen könnten. Soweit also war man in Schweden auf Gustav Adolfs Ersuchen um Verstärkung der schwedischen Truppen in seinem Lande eingegangen.
Nach § 3 sollte Mumme den Grafen bitten, er möge befördern, daß der Herzog die gewünschten Truppen mit künftigem Frühling und zwar zuerst ein Regiment Dragoner von 600 Mann bekomme. Bielke erzählte über diesen Punkt, der König habe bisher Bedenken gehabt aus Sorge, daß die Ueberlassung solcher Truppen bei den Nachbarn Verdacht ("ombrage") erregen möchte, versprach aber seinen Einfluß aufzubieten, daß die Bitte gewährt


|
Seite 242 |




|
werde, und rieth ein Regiment von 600 Mann zu Fuß, das Holstein in Dienst gehabt habe, zu nehmen unter denselben Bedingungen wie Holstein (Deponirung von etwa 7200 Rth. bei Uebernahme der Truppen, Rückgabe der Summe bei Rückgabe der Leute). § 4 bezog sich auf die Brandenburgische Eventualhuldigung und ein Gerücht, als wenn es den Kurfürsten gereue, die Sache so früh angeregt zu haben, worüber Bielke nichts zu sagen wußte. Bei Gelegenheit dieser Materie sollte Mumme "incidenter" erwähnen (§ 5), daß Gustav Adolf "lieber sähe, daß mit dem Könige zu Schweden eventualiter etwas pacisciret werden könnte." Bielke ist nach Mummes Bericht auf diese Anregung gerne eingegangen; es werde eine angenehme Materie sein und den König wie den Kanzler noch williger für Gustav Adolfs Interesse machen, doch hat er noch genauere Auskunft gewünscht, worüber aber Mumme nicht instruirt gewesen ist. Auf § 6 wird sogleich zurückzukommen sein. § 7 und 8 können hier bei Seite gelassen werden. 1 ) § 9 enthielt die Frage, ob Graf Bielke nichts von der Absicht Friedrich Wilhelms wisse, Truppen nach den Niederlanden zu senden, "dabey Er dann absonderlich zu sondiren hat, wenn


|
Seite 243 |




|
etwa dem jungen Herrn etwas Menschliches begegnen solte, ob der Herr Graff auf solchen Fall unser interesse und zu nehmende Entschließung ohn rückreferiren, wirklich secundiren und zu bewerkstelligen unß helfen könnte." Der Graf antwortete hierauf, von des Herzogs zu Schwerin Verrichtungen in Holland und Brabant sei ihm nichts bekannt, er habe auch nicht gehört, daß Friedrich Wilhelm Regimenter zu werben sich anheischig gemacht haben solle. Zu der gewünschten Unterstützung habe er keinen speziellen Befehl, allein seine ordre fei so allgemein eingerichtet, daß er S. Durchl. in allen Begebenheiten assistiren solle, und werde er auf den genannten Fall kein Bedenken tragen, S. Durchl. Willen zu erfüllen. Also die Antwort war so günstig wie möglich, allein die Voraussetzung erfüllte sich nicht: Friedrich Wilhelm behielt sein Schwert in der Scheide und kam wohlbehalten in die Heimath zurück.
Gustav Adolf ließ nun die ganze Sache fallen, er selbst mochte den in der Instruktion angenommenen Fall für wenig wahrscheinlich gehalten haben. Weit mehr beschäftigte ihn damals ein anderer Plan, die Streitfrage zu beseitigen und die Kombination der Meklenburgischen Lande, die auch er für wünschenswerth und heilsam hielt, zu erreichen, den er in § 6 derselben Instruktion dem Grafen Bielke vorlegen ließ. Der Paragraph lautete: "Noch hat Er auch von des Herrn Herzogs zu Schwerin intention daß nemlich derselbe gerne beyde Herzogthumb nach Unserm Absterben in seiner personne combiniret haben wolte, erwehnung zu thun, mit dem anführen, daß wir davon eben so gar sehr nicht abgeneigt weren, wen man nur Unsern Schwieger=Sohn H. Adolf Friedrich vergnüglich contentiren, Uns selbsten auch eine zulängliche satisfaction schaffen wolte, wozu man aber sich bißhero nicht genugsahmb herausgelaßen, dörfften mir also auf die gedanken woll kommen, wenn man zu Schwerin bey der froideur bliebe, lieber auff - Unsern Schwieger Sohn die Succession des Güstrowschen Hertzogthumbs, als der Uns auch einen grad näher, als der Schweriner Herr zu bringen. Ob wir sonsten woll gestehen müßen, das es dem publico zuträglicher wehre, das daß gantze Land nur einen Herren hette."
Graf Bielke versicherte, daß der König die Ehe gerne sehen, daß er aber, wenn man Schwerinischer seits sich nicht finden lassen wollte, Gustav Adolf zur Succession seines Schwiegersohnes gern und willig behülflich sein werde.


|
Seite 244 |




|
Erste Verhandlungen über das Eheprojekt.
Dieses Eheprojekt bezeichnet einen neuen Weg zur Kombination der beiden Herzogthümer. Es war bereits vor dem Tode Christian Louis' aufgekommen und Gegenstand geheimer Verhandlungen zwischen Güstrow und Friedrich Wilhelm gewesen. Der Anstoß dazu ging von Güstrow aus. Der Güstrowsche Hofmarschall v. Grävenitz war es, der - ohne Zweifel mit Wissen und Willen seines Herrn - bei einem Vesuche in Grabow im Jahre 1692, d. 18. April, eine Heirath zwischen Friedrich Wilhelm und der Güstrowschen Prinzessin Luise anregte, und im Falle, daß diese Ehe zu Stande komme, die Kombination in Aussicht stellte. Er fand in Grabew bereites Entgegenkommen. Bezeichnend für den Standpunkt, den der junge Herzog von vornherein der ganzen Frage gegenüber einnahm, ist ein Brief, den er d. 30. April an den Güstrower Herzog schrieb, worin es heißt: "woh auch Ew. Gn. nicht durch dero hohe Vorsorge und prudence dahin es mit vermögen, daß Mequelbourg unter einen schuh Kombt, wird es sicher allen anfechtungen und wiederwärtigkeiten, sonders den benachbarten zum besten unterworfen sein und bleiben." Man sieht, der junge Fürst hatte in der Schule seines Oheims und dessen Beamtenschaft bereits etwas gelernt, er hatte die hohe politische Bedeutung der Kombination klar erkannt und faßte auch das Eheprojekt, wie es einem Fürsten geziemt, von vornherein durchaus von politischem Gesichtspunkte auf: als ein Mittel zu der gewünschten Einigung zu gelangen war es ihm willkommen; das Herz, das dem jungen Fürsten lebhaft genug in der Brust schlug, wurde nicht gefragt.
Indessen geriethen die Verhandlungen bei ihrem Fortgang bald auf einen toten Punkt. Grävenitz machte einen zweiten Besuch Anfang Juni (Instr. v. 31. Mai), wo besonders die Rede davon war, wie man die Zustimmung Christian Louis' gewinnen könnte. Ob dieser wirklich noch Kenntniß von dem Eheprojekt erhalten hat, ist nicht ersichtlich, eine Aeußerung darüber von ihm ist nicht erhalten. Mitte Juni (Instr. v. 16.), also schon nach dem Tode Christian Louis', der aber in Güstrow noch nicht bekannt war, finden wir Grävenitz wieder in Grabow, mit dem Auftrage, sich zu erkundigen, ob das Gerücht, daß der Herzog gefährlich krank oder todt sei, der Wahrheit entspreche. Gustav Adolf hatte damals die Absicht, die Vormundschaft neben der Herzogin über die unmündigen Kinder des Herzogs Friedrich zu beanspruchen, mit welchen gefährlichen Hintergedanken, ist oben


|
Seite 245 |




|
dargestellt; in Grabow ließ er sagen, er würde durch die Vormundschaft mehr Gelegenheit haben, den ältesten Prinzen zur Beherrschung des ganzen Landes dermaleins zu befördern. Um veniam aetatis vom Kaiser zu erlangen, dazu sei Friedrich Wilhelm noch 3 Jahre zu jung. Grävenitz sollte versuchen, eine schriftliche Resolution der Herzogin zu erlangen, wozu sich diese indessen nicht verstand.
Schon durch die Worte dieser Instruktion blickt der Plan Gustav Adolfs hindurch, für den er ja gleichzeitig Schweden zu interessiren suchte, Friedrich Wilhelm zunächst bei Seite zu schieben und Schwerin für sich selbst zu gewinnen. Offen trat er mit diesem Plan in einer Instruktion hervor, die Grävenitz d. 3. Juli für eine Reise nach Schwerin erhielt. Grävenitz soll den Wunsch äußern, man möge eine vertrauenswürdige Person nach Güstrow senden, um über die Ehesache zu verhandeln, und dabei "ohne alle Verbindlichkeit" ausprechen, als Satisfaktion für die Zuwendung von Güstrow begehre Gustav Adolf die Abtretung der Regierung auf Lebenszeit und für Herzog Adolf Friedrich die Ueberlassung der beiden Stifter. Man muß gestehen, daß der Plan Hand und Fuß hatte; daß er ehrlich und ernst gemeint war, ist trotz der Verhandlungen mit Schweden, die man ja jederzeit, je nach Bedürfniß, fallen lassen oder, wenn mit Friedrich Wilhelm keine Einigung zu erreichen war, wieder aufnehmen konnte, nicht zu bezweifeln, kein Zweifel auch, daß Adolf Friedrich sich mit den beiden Stiftern oder selbst mit einem derselben begnügt hätte, wenn Gustav Adolf und Friedrich Wilhelm einig waren; allein der Vorschlag fand begreiflicher Weise in Schwerin keinen Anklang.
Am 5. Juli hatte Grävenitz eine Unterredung mit der Herzogin. Sie weigerte sich, die Abtretung der beiden Stifter zu befürworten; Herzog Adolf Friedrich habe kein Recht auf Güstrow; wenn zwei Regierungen im Lande bleiben sollten, sei keiner näher dazu als ihr Sohn Karl, "das wolle sie beweisen mit Hand und Siegel". Wegen Abtretung der Regierung bekam Grävenitz eine ausweichende Antwort: "Wenn es erst so weit sei, würden sich Vater und Sohn darüber wohl vertragen."
Der Streit wegen Mirow und die ersten Verhandlungen zwischen Friedrich Wilhelm nnd Adolf Friedrich.
Inzwischen hatte sich Ende Juni ein ernster Streit mit Adolf Friedrich abgespielt, der sogleich einen recht hitzigen


|
Seite 246 |




|
Charakter angenommen hatte und von dem in jener Unterredung vom 5. Juli ebenfalls die Rede war. Herzog Christian Louis hatte, als er 1667 die Nutznießung des Amtes Mirow an Adolf Friedrich abtrat, sich ausbedungen, auf dem Schlosse Mirow eine kleine Wache zum Zeichen seiner fortdauernden Landeshoheit zu halten, die Adolf Friedrich zu verpflegen hatte. Sie bestand aus einem Sergeanten und 8 Musketieren. Den 25. Juni berichtete nun der damalige Führer der Abtheilung, Sergeant Reimers, er werde mit seinen Leuten wie Gefangene gehalten. Es werde ihm nicht erlaubt, ein Kind in den Flecken zu senden, um eine Kanne Bier oder Lebensmittel zu holen; keiner dürfe mit ihnen reden. Er habe den Herzog selbst, als er diesem einmal begegnet, angesprochen und gebeten, dann und wann jemand hinunterschicken zu dürfen, es sei ihm aber glatt abgeschlagen. Wenn er hinunterschicken wolle, so solle er alle seine Leute nehmen und marschieren damit hinunter." Vor ihre Munitionskammer sei ein Schloß gelegt, er habe indessen noch einen kleinen Vorrath, daß er "zur Noht ein klein Scharmützel damit halten" könne. Ihr Wachlokal sei von 14 Mann aus dem Flecken und 12 fürstlichen Bedienten umstellt, letztere seien mit gezogenen Büchsen und Flinten bewaffnet, erstere hätten bisher nur alte rostige Degen, doch fügte ein Postskriptum bei, daß soeben ein Wagen mit Gewehren aus Strelitz angekommen sei. Mochte auch der Sergeant, wie Adolf Friedrich nachher behauptete, ihn durch brutales Auftreten und lose Reden gereizt haben, so war es doch augenscheinlich, daß das ganze Verfahren, das Adolf Friedrich einschlug, statt in Schwerin sich über den Sergeanten zu beschweren, darauf hinauslief, den Sergeanten zum Abmarsch von seinem Posten zu nöthigen. Adolf Friedrich machte auch gar kein Hehl daraus, daß er nun, da sein Bruder Christian Louis gestorben sei, die Wache nicht mehr dulden könne, da die getroffene Vereinbarung nur für dessen Lebenszeit Geltung gehabt habe, und ließ deshalb die Schlüssel des Schlosses die der Sergeant bisher in Obhut gehabt, mit Gewalt aus dem Wachlokal abholen.
Friedrich Wilhelm war indessen nicht geneigt, auch nur den geringfügigsten Rechtstitel, den er von seinem Oheim ererbt, fahren zu lassen. Er ließ zunächst die Sache durch einen Auditeur untersuchen und sandte, als dieser die Aussagen des Sergeanten bestätigte, am 27. Juni den Schloßhauptmann Le Vandeuil mit einem Schreiben nach Mirow, in dem er sofortige Abstellung der Beschwerden forderte, Zur Bekräftigung


|
Seite 247 |




|
dieser Forderung folgte die eine der beiden Kompagnien dänischer Dragoner dem Schloßhauptmann auf dem Fuße und stellte sich ganz in der Nähe des Schlosses auf, während Le Vandeuil ans Schloß ging, um sich seines Auftrages zu entledigen. Er gab das Schreiben ab, ohne selbst ins Schloß und zur Audienz vorgelassen zu werden. Als er sah, daß es mit der Wache noch in dem vorigen Stande war, ließ er dem Kapitän der Dragoner, v. Sydow, Nachricht geben, er möge anrücken, und dieser rückte nun mit seinen Leuten vor das Schloß. Herzog Adolf Friedrich warf sich aufs Pferd, ritt ihm entgegen und fragte nach seiner Ordre, und als der Kapitän erklärte, er habe Befehl, die Wache in den vorigen Stand zu setzen, rief Adolf Friedrich: "So muß man Gewalt mit Gewalt steuern", und ließ im Flecken bei hoher Strafe verbieten, keinem der Dragoner oder Musketiere für Geld etwas zukommen zu lassen, was aber die Dänen nicht hinderte, sich im Orte einzuquartieren und alle Schlagbäume mit Wachen zu besetzen. Der Schloßhauptmann erhielt ein Antwortschreiben von Adolf Friedrich, datirt vom 30. Juni, in dem sich dieser bitter über die unerhörte Vergewaltigung beschwerte, um sofortige Abberufung der Dragoner und um Absendung eines Rathes zu mündlicher Verhandlung bat. Der zu dem Zwecke nach Mirow deputirte Rat Vermehren fand den Herzog indessen d. 2. Juli nicht dort. Er war über den See nach Strelitz entwichen und von dort nach Güstrow gegangen, um auch mündlich bei seinem Schwiegervater, den er schriftlich bereits benachrichtigt, Beschwerde zu führen. Gustav Adolf legte sich denn auch ins Mittel, in Folge seines Eintretens für seinen Schwiegersohn, wie auch in Folge mündlicher Verhandlungen Vermehrens mit Adolf Friedrich den 4. und 5. Juli in Strelitz, kam es zu einer vorläufigen Einigung: Adolf Friedrich ließ durch einen Kammerjunker die Schlüssel zurückgeben, nicht an den Sergeanten, gegen den er eine starke persönliche Abneigung hegte, sondern an Vermehren. Die Dragoner wurden abberufen, die Wache aber blieb zur großen Unzufriedenheit Adolf Friedrichs, der eine entgegenkommende Aeußerung Vermehrens dahin verstanden, daß dieser die schleunige Abberufung der ganzen Wache erwirken wolle; nur der Sergeant, der soviel Anstoß erregt hatte, ward Mitte Juli abberufen.
Der Streit hatte Adolf Friedrich gezeigt, daß der neue Schweriner Regent vor keiner Rücksichtslosigkeit gegen ihn sich scheuen werde, wenn irgendwie einmal über Hoheitsrechte eine Meinungsverschiedenheit entstände; so schlecht, wie von dem jungen Friedrich Wilhelm war er nicht einmal von Christian


|
Seite 248 |




|
Louis je behandelt worden, dadurch mußte er in seinem Vorsatz nur bestärkt worden, sich in keinerlei Abhängigkeit von dem Schweriner Vetter zu begeben, vielmehr für alles, was ihm etwa von dem Herzogthum Güstrow oder für dasselbe einst zu Theil werde, auf voller reichsfürstlicher Selbstständigkeit zu bestehen. Diese Folge hat der kleine Mirowsche Streit für den bedeutenderen Güstrowschen Erbfolgestreit gehabt.
Zur Verhandlung über die übrigen Forderungen Adolf Friedrichs ward eine Konferenz zu Schwerin verabredet, die den 7. November stattfand, und für welche Herzog Gustav Adolf auf Willen Adolf Friedrichs seinen Geheimen Rath von Leisten in dessen Dienst stellte. Das einzige Ergebniß das sie brachte, war die Erkenntniß des ungeheuren Abstandes von den Forderungen Adolf Friedrichs auf der einen Seite und dem, was die Schweriner ihm boten, auf der andern Seite. Die Mutter der Herzöge Friedrich von Grabow und Adolf Friedrich von Strelitz, die Herzogin Marie Katharina, hatte das Amt Grabow als Witthum besessen und bei ihrem Tode (d. 1. Juli 1665) ein Testament hinterlassen, nach dem Herzog Friedrich und seine Erben die Hälfte der jährlichen Einkünfte des Amtes, also, da diese 3000 Th. betrugen, 1500 Thaler genießen, die übrigen 1500 Thaler in drei Theile getheilt werden sollten, von denen einen Adolf Friedrich erhalten sollte. Von dieser Summe war nur ein geringer Theil ausbezahlt, dazu kam, daß Herzog Friedrich Aliment=Gelder für seinen minderjährigen Bruder erhoben und selbst behalten hatte, im Betrage von 6250 Th., so hoch setzt wenigstens der Rath Vermehren in einem Aufsatze die Summe an. Er zieht dann von diesen Forderungen, deren Berechtigung er so wenig leugnet, wie Friedrich Wilhelm und seine Mutter sie geleugnet haben, was bisher bezahlt sei (3690 Th.), ferner Gerichtskosten, Kontributionsgelder, die Adolf Friedrich widerrechtlich aus dem Amt Mirow zurückbehalten, und den Erlös für verkauftes Holz aus dem Amte Mirow ab und gelangt so zu einer Restsumme von 6390 Th. 29 ßl. Leisten hatte für Adolf Friedrich fast das Zehnfache zu fordern (60765 Rth. 40 ßl.). Ferner verlangte Adolf Friedrich, mit Berufung auf das väterliche Testament, die Abtretung des Fürstenthums Ratzeburg oder Schwerin; wenn dies gar zu große Schwierigkeiten mache, so könne man statt dessen etwa die Summe von 20000 Th. fordern. Sollte die Güstrowsche Erbfolge vorgebracht werden, so sei dies abzulehnen, da es mit der vorliegenden affaire nichts zu schaffen habe. Die Schweriner lehnten alle


|
Seite 249 |




|
Forderungen aus dem - von ihnen ja niemals anerkannten - Testament Adolf Friedrichs I. ab, und als zur Sprache kam, daß ja schon Herzog Friedrich 3000 Rth. geboten, erklärten sie, dies sei unter der Bedingung des Verzichtes auf Güstrow geschehen. Man ging also unverrichteter Sache auseinander.
Fortgang der Verhandlungen über das Eheprojekt.
Inzwischen hatten die Verhandlungen über das Eheprojekt zwischen Schwerin und Güstrow ihren Fortgang genommen. Zwei Vesuche von Grävenitz (im Juli und August) in Schwerin trugen nichts zur Förderung der Sache bei. Auf dem ersten, der noch vor eintreffen der Großjährigkeitserklärung erfolgte, 1 ) überbrachte Grävenitz ein Handschreiben Gustav Adolfs an die Herzogin und stellte vor, daß ohne Abtretung des einen Fürstenthums, wozu noch andere gelegene Aemter zu geben seien, Adolf Friedrich nicht zu bewegen sein werde, seine Ansprüche auf das ganze große Fürstenthum Güstrow, zu denen er sich berechtigt finde, aufzugeben. Die Herzogin erwiderte, sie sei außer Stande, ihren Sohn dazu zu überreden, weil es ihm von allen Räthen widerrathen sei.
Bei dem zweiten Besuche (d. 18. August), zu dem die Beglückwünschung zur mittlerweile erlangten Großjährigkeit den Vorwand bot, fand Grävenitz den Hof so mit den Vorbereitungen zur Leichenprozession beschäftigt, daß er keine Gelegenheit zu weiteren Besprechungen fand. Die Sache ruhte dann eine Weile und kam erst im Oktober aufs Neue wieder in Fluß durch einen persönlichen Besuch, den Herzog Friedrich Wilhelm seinen Güstrower Verwandten machte.
Den Entschluß dazu scheint er erst kurz vor seiner Ausführung gefaßt zu haben: erst am 15. Oktober meldet er sich zum folgenden Dienstag, den 18. Oktober, an. Der Besuch, bei dem Friedrich Wilhelm von seiner Mutter und seinem Bruder Karl begleitet war, trug einen durchaus familiären Charakter, war aber schon deswegen bedeutsam, weil Friedrich Wilhelm bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal die ihm zugedachte Prinzessin von Angesicht zu Angesicht sah. Auch fand sich immerhin Zeit,


|
Seite 250 |




|
in vertraulicher Unterhaltung die schwebenden Fragen zu berühren. Beide Herzöge gaben sich die Hand darauf, daß sie die fremden Truppen entlassen wollten. 1 ) Zur weiteren Förderung der Ehesache und Successionsfrage wurde eine Konferenz beiderseitiger Räthe verabredet. Dies die positiven Ergebnisse des Besuches.
Was den allgemeinen Eindruck betrifft, den Friedrich Wilhelm aus Güstrow mitnahm, so war er nicht ungünstig; wie ihm die Prinzessin gefallen, darüber erfahren wir nichts, über den Herzog aber erklärte er einige Wochen später, er habe wahrgenommen, daß Gustav Adolf mit ihm "zu einerlei Zweck abziele." Indessen muß er doch den Eindruck bekommen haben, daß eine schnelle Einigung nicht zu erwarten sei, wenigstens ließ er sich durch die Aussicht auf die Konferenz nicht abhalten, für den Fall von Gustav Adolfs Tod


|
Seite 251 |




|
Veranstaltung zu treffen. In denselben Tagen, in denen das Datum der Konferenz zwischen den beiden Höfen verabredet ward, unterzeichnete er (d. 11. November 1692) eine Ordre an seinen Generalmajor v. Francke, er solle, wenn er die Nachricht von Gustav Adolfs Ableben erhalte, sofort alles, was an Mannschaften aufzubringen, zusammenziehen und Besitz von Güstrow, Stadt und Land, besonders auch von Boizenburg und dem Zoll ergreifen. Eine ähnliche Ordre an seine Räthe trägt das Datum des 20. November. In der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Tagen fand die Konferenz in Güstrow statt. 1 )
Gewarnt durch die ungeheuren Ansprüche Adolf Friedrichs, die er mittlerweile genauer kennen gelernt, gab Friedrich Wilhelm den Räthen eine Instruktion mit, die ihnen eine sehr vorsichtige Zurückhaltung auferlegte. Sie wurden angewiesen, die Vorschläge, die etwa von Güstrowscher Seite zur Erreichung des heilsamen Zweckes gemacht würden, ad referendum entgegenzunehmen, selbst aber keine bindenden Verabredungen über Einzelheiten einzugehen. Als ihre eigene Ansicht 2 ) hätten sie, wenn die Güstrower die Rede auf die einzelnen Bedingungen brächten, auszusprechen, daß Friedrich Wilhelm zu der erforderten condition (d. i. der Ehe) geneigt sein werde, wenn er zuförderst versichert sei,
1. daß Gustav Adolf zur größeren Sicherheit sogleich von Adolf Friedrich einen Verzicht in optima forma zu Wege bringen wolle und könne, dafür werde sich Friedrich Wilhelm wegen der Apanage Adolf Friedrichs (der jetzigen wie der künftig, nach dem Heimfall Güstrows zu bewilligenden) "der raison und possibilitat gemäß" erklären;
2. daß Ritter= und Landschaft in einer kurzen Frist mit Vorwissen und in Gegenwart Gustao Adolfs Friedrich Wilhelm die Huldigung abstatte;
3. Kaiserliche Konfirmation erfolge und
4. die schwedischen Truppen aus Boizenburg und den


|
Seite 252 |




|
ganzen Güstrowschen Landen sogleich ohne Wiederkehr fortgeschafft würden."
"Wenn dies bona fide erfüllt würde, so wollten Wir gleich die Heyraths=alliance schließen und vollziehen, auch wegen treulicher Vorsorge der hochfürstl. Güstrowschen nachbleibenden Fraw Hertzogin und übrigen Princessinnen - Unß zu allem, was die Justitz, aequitaet und nahe anverwandschaft erfodern kann, anheischig machen." 1 )
Ueber die Konferenz haben sich beide Herzöge mündlich Bericht erstatten lassen, und beide zeigen sich wenig befriedigt. Die große Verschiedenheit des beiderseitigen Standpunktes war hier weit deutlicher hervorgetreten als bei der persönlichen Besprechung der Fürsten. Für Herzog Gustav Adolf war die conditio sine qua non eine angemessene Entschädigung Adolf Friedrichs für die Abtretung seines Erbrechtes auf Güstrow. Als solche sah er die Abtretung der beiden oder mindestens des einen der beiden Stifter an, durch welche Adolf Friedrich souveräner Reichsfürst mit Sitz und Stimme auf Reichs= und Kreistagen wurde. Hiervon konnte er um so weniger abgehen, als er allem Anscheine nach seiner Tochter bei deren Eheschließung nach dieser Richtung hin Zusicherungen gemacht hatte. 2 )


|
Seite 253 |




|
Auch hiervon abgesehen, mußte Gustav Adolf auf Abtretung eines Stiftes bestehen, wenn der Zweck der ganzen Verhandlung erreicht werden sollte. Er kannte seinen Schwiegersohn gut genug, um zu wissen, daß dieser ohnedem niemals gutwillig auf die Erbfolge in Güstrow verzichten werde, und doch war ein solcher Verzicht zur Herstellung des inneren Friedens unerläßlich und gehörte ja auch zu den Bedingungen, die der Schweriner Herzog stellte. Friedrich Wilhelm andererseits kam es gerade darauf vor allem an, daß die gesammten politischen Machtbefugnisse der meklenburgischen Lande in einer Hand vereinigt würden; den Ansprüchen des Strelitzer Oheims auf Güstrow und folglich auch seinen Forderungen auf Entschädigung gestand er schlechterdings keine Berechtigung zu und glaubte schon viel zu thun, wenn er um des lieben Friedens willen eine gewisse Summe Geld und etwa einige Aemter abtrat. Hierüber war er bereit zu verhandeln und eventuell das Quantum des Abzutretenden zu vergrößern, die Forderung eines Reichsvotums aber für Adolf Friedrich erschien ihm nach wie vor als gänzlich unannehmbar, und er hat sich erst, als jede andere Möglichkeit, zum Frieden zu gelangen, erschöpft war, dazu entschlossen.
Seine nächste Aeußerung nach der Güstrower Konferenz ist denn auch äußerst kühl, es ist ein Brief, den er d. 20. November, also denselben Tag, an dem er die Ordre an seine Räthe zur gewaltsamen Besetzung von Güstrow erließ, aus Hamburg an Gustav Adolf schrieb: Die Sache sei nicht in dem Stande, daß desfalls einige ouvertures von ihm erwartet morden könnten, auch hätte der Ober=Marschall v. Grävenitz öfter bei seiner Mutter versichert, daß sein Herr schon sothane difficultät zu


|
Seite 254 |




|
heben von selbst sich getraute. "Alß wird Mir nicht zu verdenken seyn, wen Ew. Lbd. Jch nicht darunter vorgreiffe, sondern zufolge itzerwähnten erbietens das negotium Jhrer hohen prudentz heimbstelle, wie Sie vermeinen, daß man (d. i. Adolf Friedrich) sich daselbst billig und ertreglich herauslaßen und anschicken möge, so denn Ich hinwiederumb zu resolviren nicht ermangeln werde." Gustav Adolf fühlte sich befremdet, daß man sich auf Schwerinischer Seite so lau zeigte; es kam ihm vor, als suche man die Sache hinzuziehen, um inzwischen sich anderweitig umzusehen, doch antwortete er nicht unfreundlich (d. 29. November): Er könne nicht finden, daß Friedrich Wilhelm von ihm noch weiter ouvertures zu erwarten hätte, sondern es beruhe vielmehr "auf dero zulänglicher satisfactions-erklärung." "Wollen nun Ew. Lbd. dieselbe entweder schriftlich mir eröffnen, oder auch Jhren Ministris deßfalls mit den Meinigen darüber in weitere Handlung zu treten - Befehl ertheilen, so soll es an Meiner Cooperation gewißlich nicht ermangeln." Und als Friedrich Wilhelm hierauf nicht antwortete, sandte Gustav Adolf im Dezember wieder Grävenitz an die Herzogin nach Schwerin - Friedrich Wilhelm hatte seine Reise nach Holland bereits angetreten -, um ihr Vorstellungen zu machen, Adolf Friedrich werde nicht zu gewinnen sein, wenn er nicht zum wenigsten eins der beiden Fürstenthümer, nämlich das Stift Bützow, bekomme und ihm dabei von den nächstgelegenen Aemtern, worunter nach Gustav Adolfs Tode auch Schwaan sein könne, so viel zugelegt werde, daß er zu seinem und der Seinen Unterhalt jährlich 20000 Th. an sicheren Einkünften zu heben hätte. Die Herzogin möge veranlassen, daß ein paar geschickte und wohlgesinnte Leute mit genugsamer Vollmacht versehen würden, denn mit dem Hofmarschall v. Löwen und dem Kammerrath Vermehren, die unlängst in Güstrow gewesen, habe man nichts anfangen können, weil sie selbst zugestanden, daß sie keine Vollmacht hätten. Für sich selbst verlange er, ließ Gustav Adolf noch sagen, die Abtretung der Stadt Rostock auf Lebenszeit und 100000 Th. zur Freimachung verschuldeter Aemter, eine Zahlung, die ja übrigens dem Nachfolger, also Friedrich Wilhelm, selbst wieder zu gute kommen werde. In seinen eigenen Forderungen also ist er gegen früher zurückgegangen. Die Abtretung der Regierung wird, da nunmehr Friedrich Wilhelm die Großjährigkeit erhalten und seine Regierung bereits sicher Fuß im Lande gefaßt hatte, nicht mehr verlangt, dagegen die Abtretung wenigstens eines Stiftes an Adolf Friedrich wird festgehalten.


|
Seite 255 |




|
Auf diese Güstrowschen Forderungen bezieht sich ein Rescript Friedrich Wilhelms vom 7. Januar 1693 an seine Räthe aus Brüssel: Es solle ein Fürstenthum kosten, worauf man "umb verhütung ferner dismembrirung des Estats, und daß nicht Status in Statu formiret werde", unmöglich eingehen könne; die Sache dürfte sich also zerschlagen. "Man wisse, was solchen fals ab adverso in favor - Prinz Adolf Friedrichs intendiret werde." Eben aus diesem Grunde, um einen völligen Bruch zu verhüten, der Gustav Adolf ganz auf die Seite Adolf Friedrichs treiben mußte, that er nach seiner Rückkehr aus den Niederlanden den ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Verhandlungen. Durch Grävenitz, der wieder einmal in Schwerin das Terrain sondirte, ließ er sagen, er werde in 14 Tagen seine Leute zu Tractaten senden (Bericht v. Gräv. d. 6. März) und schlug darauf (d. 28. März) in einem Schreiben an Gustav Adolf eine Konferenz zu Sternberg auf den 3. April vor, damit - so schreibt er - "Jch so glücklich seyn könne, mit mehrem recht von Ew. Lbd. Mich einen Sohn zu nennen."
Die Konferenz fand am 4. April statt, noch zwei andere folgten, den 27. Mai und 8. August. Die Verhandlungen nahmen den Gang, daß Gustav Adolf seine eignen Forderungen mehr und mehr ermäßigte. Am 4. April ließ er die Wahl zwischen Rostock mit 100000 Thalern Zahlung oder 200000 Th. ohne Rostock, den 27. Mai forderte er nur noch 100000 Th. ohne Rostock; für die Konferenz vom 8. August fehlt es an der Instruktion und dem Bericht aus Güstrow, und auch von Schwerinischer Seite ist nur die Instruktion vorhanden und kein Bericht. Doch ist später von eigenen Forderungen Gustav Adolfs überhaupt nicht mehr die Rede. Man sieht hieraus, wie sehr ihm daran lag, die Einigung zu erzielen, allein von der Forderung eines Fürstenthums für Adolf Friedrich wollte und konnte er nicht abgehen. Friedrich Wilhelm kam ebenfalls so weit entgegen, als es sich mit seinem prinzipiellen Standpunkt irgend vertrug. Den 6. August ließ er an Einkünften so viel anbieten, wie eins der Fürstenthümer zur Kammer liefere, theils an Geld, theils an Domainen. Wenn Güstrow auch für diesen Fall keine Hoffnung mache, sollten die Räthe sondiren, ob, wenn Friedrich Wilhelm sich zur Einräumung eines Fürstenthums an Adolf Friedrich ad dies vitae entschlösse, man alsdann aus der Sache glücklich herauskommen könnte, doch mit Vorbehalt der Landeshoheit und des Votums für Friedrich Wilhelm.


|
Seite 256 |




|
Streit über die Investitur Friedrich Wilhelms vor dem Reichshofrath in Wien.
Die Sache trat darauf in ein neues Stadium dadurch, daß Schweden seine Vermittelung anbot. Es wird darauf sogleich zurückzukommen, vorerst aber noch der juristische Feldzug zu schildern sein, den Adolf Friedrich, während ohne sein Vorwissen diese geheimen Verhandlungen zwischen Schwerin und Güstrow gepflogen murden, in Wien gegen Friedrich Wilhelm geführt hatte.
Der Entschluß dazu entstand in ihm unter dem Eindruck der Konferenz vom 7. November 1692. Am 21. November schreibt er an seinen Schwiegervater, da die Schweriner sich in allen Dingen zuwiderlegten, so habe er sich entschlossen, seinen Sekretär (Karl Heinrich v. Haupt 1 ) nach Wien zu senden. Gustav Adolf, der damals der Hoffnung lebte, durch direkte Verhandlung mit Schwerin ein Abkommen zu Stande zu bringen, räth davon ab; er möge warten, was Friedrich Wilhelm auf ein Schreiben von ihm antworten werde. Hiermit kann nur das Schreiben vom 29. November gemeint sein, das also zur Zeit dieses Briefes noch gar nicht abgegangen war und von Friedrich Wilhelm, der nun seine Reise nach Holland antrat, erst nach seiner Rückkehr, den 28. März 1693, beantwortet wurde. Adolf Friedrich bat d. 28. November um Mittheilung der etwaigen Schweriner Antwort auf Gustav Adolfs Schreiben. Sollte sie in dieser Woche noch nicht kommen, so sehe es "auf lauter Betrug aus, welches leider Jhre größte Qualität ist zu Schwerin, dann sie suchen werden, diese atfaire zu trainiren, bis Sie zu Wien alle Jhre affaires nach Jhrem Willen in stande gesetzet, hernachmahls Sie, so woll Ew. Gnd. als mir alles vorschreiben werden, was Sie nur wollen." Er that dann auf eigene Hand, was er beabsichtigte, und zwar finden mir zunächst den Anwalt Jobst Heinrich Koch in Wien für ihn thätig.
Den 22. Januar übergab Koch an den Reichshofrath eine Eingabe, in der Adolf Friedrich anzeigte, daß Friedrich Wilhelm ihn ungeachtet seiner näheren Verwandtschaft mit dem verstorbenen Herzog Christian Louis ganz von der Regierung (im Herzogthum Schwerin) ausschließen wolle. Obgleich er, wie sich juristisch erweisen lasse, in Bezug auf das Herzogthum den Mitbesitz (die "communionem pro indiviso"), in Bezug auf die


|
Seite 257 |




|
Fürstenthümer Ratzeburg und Schwerin aber die Theilung beanspruchen könne, so wolle er doch für jetzt nur bei dem väterlichen Testament sich beruhigen und verlange auf Grund desselben Ratzeburg oder gleichwerthigen Ersatz. Ein kaiserliches Mandat, das sein Recht anerkennt, wird erbeten und das Ersuchen gestellt, die Exekution des Mandates dem Churfürsten Friedrich von Brandenburg und dem Herzog Georg Wilhelm von Celle zu übertragen. Die Güstrowsche Erbfolgefrage war in dieser ersten Eingabe noch nicht berührt. Den 5. Februar beschloß der Reichshofrath, dem Fürst=Bischof Friedrich August von Lübeck, einem Bruder von Gustav Adolfs Gemahlin, ein Kommissorium zur Schlichtung dieses Streites zu übertragen und Herzog Friedrich Wilhelm aufzufordern, sich dieser Kommission zu unterwerfen. Die Kommission kam denn auch zu Stande, sie tagte in Lübeck vom 23. Oktober 1693 ab, hatte es aber nur mit der Abfindung Adolf Friedrichs wegen seiner Ansprüche auf einen Theil des Schweriner Erbes als Sohn Adolf Friedrichs I. und nicht mit der Güstrowschen Erbfolgefrage zu thun. 1 )
Der ersten Eingabe Adolf Friedrichs folgte den 27. Februar eine zweite, worin die Bitte ausgesprochen wird, Friedrich Wilhelm, ehe Adolf Friedrich von ihm zufriedengestellt sei, die Investitur nicht zu verleihen und ebensowenig über das Herzogthum Güstrow eine Eventual=Belehnung zu ertheilen. Noch genauer geht auf die Güstrowsche Erbfolgefrage ein drittes Aktenstück ein, das auf Grund eines Briefes Adolf Friedrichs vom 7. Mai den 1. Juni überreicht ward, mit dem Titel: "Höchst gemüßigte und in jure et Facto wohl fundirte remonstration und allerunterthänigste Bitten (des Anwalts Koch) in Sachen Herrn Adolph Friedrichs Herzogs zu Mecklenburg=Schwerin contra Herrn Friedrich Wilhelm, -, Diversorum gravaminum in specie den Successionsfall des Herzogthumbs Meckl.=Güstrow betreffend." Hier ist eine kurze "Deductio iuris competentis" beigelegt, durch welche Adolf Friedrich sein Recht auf Güstrow zu erweisen sucht. Friedrich Wilhelm wird beschuldigt, er sei


|
Seite 258 |




|
bemüht, Adolf Friedrich von dem Herzogthum Güstrow, das ihm zukomme, auszuschließen, auch bei der bevorstehenden Investitur und Belohnung über das Herzogthum Mecklenburg=Schwerin "per sub et obreptionem, in denen verhoffenden Kayserl. Lehenbriefen einige anwartung und Kayserl. promesse auf das Herzogthum Mecklenburg=Güstrow zu erwerben" 1 ) und Adolf Friedrich "dahin zu coactiren, daß Sie aus ermangelnden Mitteln zur Fürstlichen Subsistenz, sich dero willen unterwerffen müsten." Adolf Friedrich übergiebt deswegen die Deductio und wiederholt seine schon den 27. Februar ausgesprochenen Bitten, denen er noch die hinzufügt, ihm selbst zur Ableistung seiner Lehnspflicht auch für Ratzeburg und die Eventual=Erbfolge in Güstrow einen Aufschub von 6 Monaten zu gewähren. Auch macht er auf die fremden Truppen (die Dänen) aufmerksam, die Friedrich Wilhelm im Lande habe und von denen Thätlichkeiten zu besorgen seien, und bittet, einigen angrenzenden mächtigen Reichs= und Kreisständen anzubefehlen, ihm auf solchen Fall Beistand zu leisten und ihn bei seinem Recht auf Güstrow zu schützen.
Ende Mai war nun der Schweriner Bevollmächtigte, welcher mit dem in Wien stationirten Hofrath Johann Adam Diettrich um die Belehnung nachsuchen und sie an Stelle des Herzogs empfangen sollte, Ernst Christoph v. Koppelow, in Wien angekommen mit einem Schreiben des Herzogs vom 15. April, das den 28. Mai an den Reichshofrath eingeliefert ward, und am 19. Juni reichten Koppelow und Diettrich das Gesuch ein, zur Abschwörung des Lehneides zugelassen zu werden.
Die Strelitzer Klage über die dänischen Truppen erwirkte den Erlaß eines kaiserlichen Mahnschreibens an Friedrich Wilhelm, datirt vom 16. Juni, worin er aufgefordert wird, die dänischen Truppen zu entlassen, was denn auch im August des Jahres geschah.


|
Seite 259 |




|
Ueber die Investitur fiel die Entscheidung den 30. Juni. Der Reichshofrath hielt dafür, dem Referat des Herrn v. Andler entsprechend, daß Friedrich Wilhelm die Belohnung und zwar für alle drei Schwerinschen Territorien zu ertheilen und Adolf Friedrich an die Kommission zu verweisen sei.
Als Grund für diese Entscheidung wird vorzugsweise angegeben, in der Wahlkapitulation des Kaisers sei ausdrücklich enthalten, daß die Belehnung wegen vorhandener Streitigkeiten nicht gehindert, sondern solche auf den Rechtsweg verwiesen und die Belehnungen im vormaligen tenor ertheilt werden sollten. Dies räth der Reichshofrath auch im vorliegenden Falle an, damit der Kaiser bis zum Austrag der Sache einen geschworenen Vasallen im Herzogthum Schwerin habe.
Adolf Friedrich und seine Bevollmächtigten ließen sich durch diesen Beschluß nicht einschüchtern, sondern verdoppelten vielmehr ihre Anstrengungen, obgleich der Schwiegervater dem Schwiegerwsohn in dieser Sache seine Unterstützung fast ganz entzog. Herzog Gustav Adolf hatte es sehr übel vermerkt, daß sich Adolf Friedrich hinter seinem Rücken nach Wien gewandt, um noch bei seinen Lebzeiten dort Ansprüche auf sein Herzogthum geltend zu machen; er war um so unwilliger, als er, wie oben erzählt, damals sein Erbe nicht Adolf Friedrich, sondern Friedrich Wilhelm zuzuwenden gedachte, jedenfalls wünschte er die Entscheidung darüber nicht an den Kaiserhof gelangen zu lassen, sondern in seiner Hand zu behalten. Somit ließ er durch seinen Bevollmächtigten, v. Pommer Esche, d. 3. Juli um kaiserliche Verordnung bitten, wonach das von seinen Vettern, besonders von Adolf Friedrich geschehene Ansuchen um Eventualbelehnung mit Güstrow nicht angenommen, sondern dieselben mit ihren Ansprüchen an ihn verwiesen werden möchten. 1 ) Nur in einem Punkte erhielt Pommer Esche Anweisung, Adolf Friedrich beizustehen, in der Beanstandung jenes bedenklichen Passus im Lehnbriefe von 1659.
Von Seiten Adolf Friedrichs und seines Bevollmächtigten lief eine Eingabe nach der andern ein, kein Mittel blieb unversucht, um der Sache noch eine günstige Wendung zu geben. 2 ) Den 1. Juli wird gebeten, der Zuschrift


|
Seite 260 |




|
Adolf Friedrichs vom 27. Februar, die nur ad acta gelegt sei, in dem Votum an den Kaiser mit zu gedenken und nichts präjudicirliches vorgehen zu lassen, bis die dem Bischof von Lübeck übertragene Kommission ihr Ziel erreicht habe und der Bericht darüber eingelaufen sei. Den 13. Juli wird auf den präjudicirlichen Passus im Lehnbrief aufmerksam gemacht, der auszulassen sei; und ferner gebeten, wenn wider Verhoffen das väterliche Testament nicht zur Geltung kommen sollte, Adolf Friedrich zugleich mit dem Herzog zu Schwerin zur Investitur zuzulassen und beide coniunctim zu belehnen; den 17. Juli wird auf den Vertrag vom Jahre 1534 hingewiesen, wonach getheilt und über die Theile geloost werden sollte; die Anwendung des Primogeniturrechtes in Meklenburg könne nicht nach=


|
Seite 261 |




|
gewiesen werden. Den 24. Juli tritt Haupt in Action, der den 15. sein Creditiv (datirt vom 17. Mai) überreicht hatte, und miederholt seinerseits die schon früher von Koch ausgesprochenen Bitten, Adolf Friedrich nach dem väterlichen Testament mit Ratzeburg zu belehnen und den Herzog zu Schwerin zur Belehnung über die drei Schwerinischen Lande nicht zuzulassen. Den 27. Juli legitimirt sich Herzog Adolf Friedrich zur Lehns=Empfängniß entweder nach dem väterlichen Testament wegen Ratzeburg oder ab intestato über alle eröffneten meklenburgischen Lehen, und auch der von ihm zur Lehns=Empfängniß abgesandte Adolf Friedrich v. Malzahn nebst Rath Haupt legitimiren sich für diesen Zweck. Am 2. August kommt Haupt ein um Suspension der Investitur in Schwerin mit einer beigelegten Species facti. Auch am 4. und 12. August finden sich wieder Strelitzer Eingaben in den Protokollen des Reichshofrathes verzeichnet. Neben diesen offiziellen Eingaben geht die private Bearbeitung der Reichshofräthe wie auch der kaiserlichen Minister her, wozu der Strelitzer auch die Gesandten anderer Mächte heranzuziehen wußte. Nach einem Bericht von Pommer Esche vom 1./11. Juli hatte der Braunschweigische Envoyé Befehl, ebenfalls dahin zu arbeiten, daß Herzog Adolf Friedrich künftig Güstrow und vor
 . selbst genauer einzugehen,
glaubte ich als Nicht=Jurist unterlassen zu
sollen; die Hauptbeweisstücke, mit denen auf
beiden Seiten operirt ward, wird man aus dem
einleitenden Kapitel leicht sich entnehmen
können. Auch für den Laien wird bei der
Lektüre dieser Schriften leicht klar, daß es
auf beiden Seiten nicht an schwachen
Argumenten, Trugschlüssen und Entstellungen
gefehlt hat; einiges derartige ist in den
Anmerkungen zu Kap. I gestreift. Der Einfluß
dieser ganzen Litteratur auf die
Eutwickelung und den Ausgang des Streits ist
nicht besonders hoch zu schätzen; auf die
Hamburger Kommissionsverhandlungen hat sie
so gut wie gar keinen Einfluß geübt; auch
vorher spielen die politischen
Gesichtspunkte neben den juristischen
Erwägungen schon eine sehr bedeutende
Rolle.
. selbst genauer einzugehen,
glaubte ich als Nicht=Jurist unterlassen zu
sollen; die Hauptbeweisstücke, mit denen auf
beiden Seiten operirt ward, wird man aus dem
einleitenden Kapitel leicht sich entnehmen
können. Auch für den Laien wird bei der
Lektüre dieser Schriften leicht klar, daß es
auf beiden Seiten nicht an schwachen
Argumenten, Trugschlüssen und Entstellungen
gefehlt hat; einiges derartige ist in den
Anmerkungen zu Kap. I gestreift. Der Einfluß
dieser ganzen Litteratur auf die
Eutwickelung und den Ausgang des Streits ist
nicht besonders hoch zu schätzen; auf die
Hamburger Kommissionsverhandlungen hat sie
so gut wie gar keinen Einfluß geübt; auch
vorher spielen die politischen
Gesichtspunkte neben den juristischen
Erwägungen schon eine sehr bedeutende
Rolle.


|
Seite 262 |




|
der Hand das Stift Ratzeburg zu Theil werden möge. Auch der Cellische Minister solle gleichmäßigen Befehl haben. Die Ursache sei die Sorge, daß der Herzog von Schwerin sich mit Dänemark entweder ganz alliiren oder doch in genaues Verständniß setzen und vielleicht das Stift Ratzeburg an diese Krone veräußern dürfte, wodurch Streitigkeiten zwischen Dänemark und den Braunschweigischen Häusern erwachsen könnten. Nach den Berichten von Christiani und Koppelow vom 1. August/23. Juli schlug sich selbst Brandenburg, obgleich es eben erst (den 12./22. Juli) den alten Successions=Vertrag mit Herzog Friedrich Wilhelm erneuert und dabei ausdrücklich versprochen hatte, ihm zum Besitz des Herzogthums Güstrow behülflich zu sein, 1 ) auf die Seite von Strelitz, gekränkt, wie wir später aus Berlin erfahren, durch Friedrich Wilhelms Anschluß an Dänemark, den man als ein Zeichen von Mißtrauen gegen Brandenburg auffaßte.
Allein auch die Schweriner waren nicht
unthätig.
2
) In einem Brief vom 8.
August an den Hofmarschall von Löwen klagt
Koppelow "Sie, auf Strelitzscher seiten
haben mehr assistenz, alß Ich iemahls vermuhten
können, und haben der hiesigen hohen und großen
Gemühter so praeoccupiret, daß es tausend mühe
kostet, selbige auf andere meinung zu
bringen." Indessen diese Mühe belohnte sich
doch: Am 30. Juli machten Koppelow und Diettrich
beim Reichshofrath die Anzeige, daß sie die
Gebühren auf dem Tax=Amte richtig erlegt, und
baten, einen Termin zur Belehnung anzusetzen. Am
19. August fällte der Kaiser die endgültige
Entscheidung, daß Friedrich Wilhelm mit den drei
Fürstenthümern belehnt, Adolf Friedrich aber ein
decretum salvatorium ertheilt werden solle. Am
27. August fand die Belehnung in feierlicher
Audienz statt, eine dem Vizekanzler übergebene
Protestschrift von Haupt blieb ohne Folgen. Die
Lehnbriefe sind vom 26. August datirt;
3
) der von Güstrow und
Strelitz beanstandete Passus ward wörtlich
aufgenommen, ja in dem Lehnbriefe für Ratzeburg
sogar der Passus eingeschoben, der Kaiser
verleihe dem Herzog Friedrich Wilhelm zu
Meklenburg, dem Hause Meklenburg=Schwerinscher
Linie und dessen Successoren, nach dem lineal-
und primogenitur-Recht - das Fürstenthum
Ratzeburg
 ., als sollte
., als sollte


|
Seite 263 |




|
damit ausdrücklich der Anspruch Adolf Friedrichs zurückgewiesen werden. In offenem Widerspruch hierzu erklärte das Decretum salvatorium, das den 27. August ausgefertigt ward, daß die Belehnung wie auch die Ausfertigung der neuen Lehnbriefe Adolf Friedrich in seinen etwaigen "Rechten und Prätensionen gäntzlich ohne einigen Nachtheil und Schaden, und die Außführung dero ansuchens durch den schleunigsten weg Rechtens zu vollführen, außdrücklich reserviret und vorbehalten seyn solle." Am selben Datum ward ein Reskript an den Bischof von Eutin abgelassen, die Kommission fortzusetzen.
Adolf Friedrich hatte das Spiel verloren; nachträgliche Proteste und Bitten, die Huldigung und die Ausfertigung der Lehnbriefe zu inhibiren (vom 28. und 31. August und noch einmal vom 8. October) wurden durch Verweisung auf das decretum salvatorium und die angeordnete Kommission abgethan.
Ebenso fruchtlos blieben die Versuche Pommer Esches, die Auslassung der beanstandeten Stelle im Lehnbriefe oder die Ausstellung eines decretum salvatorium für Gustav Adolf zu erwirken, daß durch den Lehnbrief nichts die Güstrowsche Erbfolge betreffendes weder dem einen noch dem andern zum Vortheil oder Präjudiz angeordnet sein solle. (Eingaben, vorgelegt am 1. September und 25. September.) Auch er wurde in einem Conclusum vom 5. Oktober auf das Adolf Friedrich ertheilte Dekret verwiesen.
Dagegen gewannen die Schweriner im Oktober einen neuen Erfolg. Friedrich Wilhelm hatte in zwei Schreiben vom 24. Juli und 9. August dem Kaiser den Abmarsch der Dänen angezeigt und zugleich auf die Gefahr aufmerksam gemacht, in die er sich dadurch gebracht, da Herzog Adolf Friedrich, dem Gerüchte nach, deutlich zu vernehmen gegeben, daß er sein (Friedrich Wilhelms) Recht auf Güstrow wohl gar armata manu über den Haufen zu werfen gedenke; er hatte dann den Kaiser ersucht, ein "höchst verpoentes Dehortatorium" an Adolf Friedrich ergehen zu lassen, daß er von solchen Thätlichkeiten abstehe und sich an dem ordentlichen Rechtswege genügen lasse. Diesem Ersuchen, das den 8. Oktober durch Koppelow und Diettrich vor den Reichshofrath gebracht ward, gab dieser statt und empfahl den 12. Oktober dem Kaiser den Erlaß eines solchen Dehortatorium, das dann den 9. Januar 1694 unterzeichnet, nach Schwerin gesandt und von dort aus den 19. Februar durch einen Notar Adolf Friedrich zugestellt ward.
Es war augenscheinlich, daß am Wiener Hofe der Schweriner


|
Seite 264 |




|
Einfluß den Güstrower wie den Strelitzer aus dem Felde geschlagen hatte, desto höheren Werth legte Gustav Adolf auf die vermittelnde Thätigkeit Schwedens, die mittlerweile begonnen hatte, mit deren Hülfe er hoffte, die beiden streitenden Neffen in Güte zu einigen, ohne Zuthun und Eingreifen des Wiener Hofes.
IV.
Die schwedische Vermittelung.
Graf Bielke als Vermittler.
Mit Schweden und Graf Bielke war Gustav Adolf in fast ununterbrochener Verbindung geblieben. Auf die Sendung Mummes an Bielke Anfang Januar 1693 folgte eine zweite gegen Ende Februar, zum dritten Male suchte Mumme den Grafen Ende März in Stralsund auf, als er auf dem Wege nach Schweden war. An seiner Stelle führte dann der Kanzler Curtius d. 20. April eine Verhandlung mit dem Grafen auf dessen Gut Schönenmalde in Pommern. 1 ) Zwischen diesen persönlichen Verhandlungen ward noch ein reger Briefwechsel gepflogen. Es handelte sich dabei und auch bei der Sendung Mummes nach Stockholm in erster Linie um Gustav Adolfs Wunsch, zu einer stärkeren Militärtruppe zu gelangen. Das Reichskontingent (die "Römermonate") von beiden Meklenburg war wider Gustav Adolfs Wunsch auch für das Jahr 1693 wieder an Brandenburg assignirt. Der Herzog beabsichtigte dagegen einzukommen und wünschte dazu Schwedens diplomatische Unterstützung. Da er aber befürchtete, daß der Churfürst mittelst Einlegung von Truppen ihn zur Zahlung zu zwingen suchen werde, so begehrte er, daß dem Grafen Bielke Vollmacht ertheilt werde, ihm in diesem Falle beizustehen.


|
Seite 265 |




|
Mumme hatte dafür den schwedischen Staatsmännern einen Vertrag auf Eventual=Erbfolge anzubieten, wie er mit dem Grafen Bielke bereits erörtert war. Er fand indessen in dieser Beziehung bei den schwedischen Staatsmännern nicht das entgegenkommen, was er nach Bielkes Aeußerungen vom Januar erwarten mußte. Auf seine Worte, sein Herr könne unmöglich die brandenburgische Erbhuldigung zugeben, "würde viel lieber eventualiter mit Schweden waß pacisciren," erwiderte Graf Oxenstierna überhaupt nichts. Auch die Ordre an Graf Bielke war nicht zu erhalten. Man hatte in Schweden den Tag von Fehrbellin noch in zu guter Erinnerung, um einen Krieg mit Brandenburg zu wünschen, überhaupt war König Karl XI. im Gegensatz zu seinem Vater wie seinem Sohne eine entschieden friedliebende Natur, dazu mahnte der zerrüttete Zustand der schwedischen Finanzen zu friedlicher Politik, und der Wunsch des Königs, in dem großen europäischen Kriege mit Frankreich als Vermittler auftreten zu können, machte Zurückhaltung in den norddeutschen Händeln nothwendig, damit Schwedens Streitmacht verfügbar bleibe, um jener Vermittelung nöthigenfalls bewaffneten Nachdruck geben zu können. Man hütete sich also in Schweden, zu Brandenburg in Gegensatz zu treten, auch die Bitten des Güstrower Herzogs um eine stärkere Truppenmacht fanden in den ersten Monaten des Jahres 1693 kein Gehör, eine Eingabe Mummes (im April) mit der Bitte um 2 Kompagnien oder 100 Mann Dragoner und 6 Kompagnien oder 600 Mann zu Fuß stieß, wie Mumme den 26. April schrieb, auf allerlei Bedenken. Erst den 7. Juni entschloß sich der König, wieder 2 Kompagnien, aber nicht mehr, aus Pommern nach Güstrow zu senden, die dann dort den 14. Juni wieder eintrafen. Auch was die Verlängerung der Allianz vom Jahre 1690 anbetraf, die zu erwirken ebenfalls Mumme Auftrag hatte, kam er das ganze Jahr 1693 hindurch nicht vom Flecke.
Nicht anders ging es zunächst mit dem Angebot Güstrons, Schweden möge in dem Erofolgestreite zwischen Friedrich Wilhelm und Gustav Adolf die Vermittelung übernehmen und sie dem Grafen Bielke übertragen. Der erste Gedanke hierzu scheint übrigens nicht in Güstrow, sondern vielmehr im Kopfe des Grafen Bielke selbst entstanden zu sein. In dem Gespräche, das Mumme den 27. Februar 1693 mit ihm hatte, kam die Rede auf das Verhältniß zwischen Schwerin und Schweden. Mumme wußte zu erzählen, daß der schwerinsche Hofmarschall von Löwen den Generalleutnant und


|
Seite 266 |




|
Gouverneur von Wismar, v. Buchwald, dort aufgesucht und gebeten habe, ihm jemand am schwedischen Hofe vorzuschlagen, an den sein Herr sich wenden könne, um mit Schweden gute nachbarschaftliche Beziehungen herzustellen; Herzog Friedrich Wilhelm habe zwei Briefe an den König geschrieben, die aber beide ohne Antwort geblieben seien. 1 ) Buchwald, der unter Bielkes Oberkommando stand, hatte diesen genannt, Löwen aber geantwortet, er sei gar zu gut Güstrowisch. Als Mumme dies Bielke erzählte, rief dieser aus: "Er wolle wünschen, daß der Herzog von Schwerin nur seine confiance zu ihm nehmen wolle, so wolle er sein eußerstes thun, beyde Heuser durch eine mariage in ein gutes Vernehmen zu setzen: wenn solches geschehen, werde der König gleichfalls alle propension vor Suerin haben." Diese Aeußerung traf mit Gustav Adolfs höchstem Lebenswunsch zu damaliger Zeit, eben der Heirath Friedrich Wilhelms mit einer seiner Töchter, zusammen; man glaubte in dem Grafen einen höchst werthvollen Bundesgenossen, um dieses Ziel zu erreichen, gefunden zu haben.
Als aber Mumme zu Oxenstierna davon sprach, rieth dieser ab, sich Bielkes in der Ehesache zu bedienen, wie Mumme ohne Zweifel richtig urtheilte, wegen der erbitterten Feindschaft, die zwischen ihm und Bielke bestand. Indessen, es gab ein Mittel, ihn umzustimmen: In Stockholm wie in Stettin herrschte recht "aureum saeculum"; in dieser Beziehung war es in Schweden noch fast schlimmer als in Wien, wo beim Reichshofrath bekanntlich "Geschenke" gang und gäbe waren, und auch beim Grafen Bengt war, wie Mumme ausfindig machte, "res angusta domi", noch mehr bei seinem Sekretär, der im schwedischen Ministerium die Hauptarbeit zu leisten hatte, Hofrath Polus. Als Gustav Adolf jedem der beiden schwedischen Minister, dem Reichskanzler und Graf Gyldenstolp 1000 Rth. und Hofrath Polus 500 Rth. versprechen ließ, für den Fall, daß Schweden die gewünschte Vermittelung übernehme und die Verlängerung der Allianz zu Stande komme, gab Oxenstierna selbst seine Gegnerschaft gegen Graf Bielke auf, und Mumme war geschickt genug, ihm


|
Seite 267 |




|
den Meinungswechsel zu erleichtern, indem er ihm (d. 13. Juni) vorstellte, sein Herr habe gerade Bielke, der nach Oxenstiernas Urtheil gut danach gesinnt war, vorgeschlagen, damit er keinen Schaden anrichte; wenn ein anderer die Kommission erhalte, so sei zu fürchten, daß Bielke die Sache zu Gunsten Dänemarks bei Schwerin zu hintertreiben suchen werde. Der Reichskanzler meinte darauf, man möge es mit Bielke versuchen, er werde ja dessen Relationen in die Hände bekommen und werde die Sache zu Gustav Adolfs Besten wohl zu dirigiren wissen.
In derselben Relation, in der Mumme dies berichtet, giebt er auch ein Gespräch wieder, das er mit Hofrath Polus gehabt; dieser hatte ihm "treuherzig" erzählt, daß der Herzog von Holstein dem Grafen Bengt (Oxenstierna) ad dies vitae 2000 Rth. jährlich und nach seinem Tode seiner Gattin bis zu ihrem Ableben noch 1500 zu geben versprochen. Herzog Gustav Adolf verstand den Wink und erklärte sich bereit (Reskr. vom 28. Juni), dem Grafen Bengt jährlich zeitlebens 1000 Th. zu geben. Das Opfer hätte für diesen Fall erspart werden können, da das Reskript vom schwedischen Hof an den Grafen Bielke bereits den 23. Juni unterzeichnet war. Mumme hielt es aber doch für nützlich, weil dadurch, wie er hoffe, Graf Bengt völlig auf Gustav Adolfs Partei gezogen werde und man deshalb die Erbfolgesache, wenn sie sich draußen nicht völlig abthun lasse, mit Vortheil nach Stockholm selbst ziehen könne. (Rel. vom 24. Juni.)
In dem königlichen Reskript ward Graf Bielke angewiesen, ein Mittel zu suchen, das Successionswerk gütlich abzuthun; es komme hauptsächlich darauf an, daß Herzog Adolf Friedrich billige satisfaction erhalte. Ein sekretes Postskriptum führte dies noch weiter aus: die größte Schwierigkeit bestehe darin, daß der Herzog von Schwerin Herzog Adolf Friedrich keine genugsahme satisfaction für den Verzicht auf seine vermeintlichen (!) Rechte an das Herzogthum Güstrow widerfahren lassen wollte. Herzog Gustav Adolf schlage vor Abtretung des Stiftes Bützow cum omnibus pertinentiis, jure et superioritate, auch voto et sessione in imperio, und eine Apanage von 20000 Rth. Der König finde diese Vorschläge billig. Bielke soll sich bemühen, den Herzog von Schwerin hierzu zu überreden. Insonderheit soll er für Herzog Gustav Adolfs Interesse sorgen. "Weil Wir auch vor des H. Hertzogen zu Güstrau Lbd. undt dero Fürstliche Familie, sowohl wegen der nahen anverwandtschafft, als vieler andern respecten halber billig consideration haben, würden Wir gerne sehen, wenn Jhr zum besten des Hausses Güstrau


|
Seite 268 |




|
was nützliches ausrichten und zu Stifftung einer mariage zwischen des H. Herzogen zu Schwerin Lbd. und einer Güstrowischen Princessin contribuiren könt."
Dem Grafen Bielke war die ihm hiermit gestellte Aufgabe in verschiedener Beziehung äußerst willkommen. Sein hochfliegender Ehrgeiz wie seine unersättliche Habsucht fanden hier ein überaus dankbares Feld der Bethätigung und Ausnutzung. Reiche Geldgeschenke von den betheiligten meklenburgischen Höfen, denen allen an der Gunst des Mächtigen gelegen sein mußte, standen in Aussicht, und wenn die Vermittelung gelang, so hatte er sich nicht nur um Schweden ein wesentliches Verdienst erworben und zu Schwedens politischen erfolgen an den Ostseeküsten einen neuen hinzugefügt, sondern sich auch den Anspruch auf fernere Dankbarkeit des meklenburgischen Fürstenhauses erworben. Welche glänzenden Aussichten für die Zukunft!
Er widmete sich also mit unverkennbarem Eifer dem ihm gewordenen Auftrage, und es ist nicht ohne psychologisches Interesse, zu beobachten, wie skrupellos er dabei für sich selbst zu sorgen wußte, ohne doch gegen seine Instruktion zu handeln. Freilich, die Sache kam nicht sogleich in das erwünschte Geleise. Schwerin hielt sich zunächst zurück. Man war hier augenscheinlich wenig erbaut von Schwedens Anerbieten, von dem man nichts Gutes erwartete, und suchte Zeit zu gewinnen, da es nicht anging, das Anerbieten einfach abzulehnen. Das Schreiben Bielkes vom 18. Juli 1693, in dem er von der ihm gewordenen Kommission Anzeige machte, beantwortete Friedrich Wilhelm den 28. Juli, indem er in des Grafen Erwägung stellte, die Mittel, wodurch zum Zwecke zu kommen sei, zu eröffnen. Bielke antwortete den 9. August, die Mittel müßten von den Parteien angegeben werden; der Herzog möge ihm einen Ort bezeichnen, wo er ihm aufwarten könne, oder einen seiner Minister zu ihm senden. Dergleichen geschah aber nicht, vielmehr hörte man aus Wien, daß die Schweriner dort die schwedische Vermittelung zu hintertreiben suchten.
Ebensowenig konnte der Graf bei Adolf Friedrich ausrichten, mit dem er im Oktober 1693 in Pasewalk eine Zusammenkunft hatte. Adolf Friedrich verlangte Ratzeburg; der Graf schrieb darauf ziemlich herabgestimmt an Gustav Adolf, er vermöge nicht abzusehen, wie ein Akkord zu hoffen sei. Indessen fand er bald einen Weg, sich dem Schweriner Hof zu nähern und diesem sein Mißtrauen zu benehmen. Er bat den Herzog zum Gevatter für seine jüngste Tochter. Daraufhin entschloß sich Friedrich Wilhelm zu dem Versuche, den Grafen für sich zu gewinnen.


|
Seite 269 |




|
Er nahm die Pathenstelle an und sandte im Dezember 1693 seinen Kammersekretair Varenius an den Grafen nach Stettin, um ihm ein theures Präsent - einen kostbaren Ring, den Bielke dann noch bei Varenius' Anwesenheit anlegte - als Pathengeschenk zu überbringen und zugleich ihm - für seine Tochter! - 10 bis 12000 Th. zu versprechen, wenn er Friedrich Wilhelm zum Besitz von Güstrow verhelfe oder wenigstens "simulando et differendo Praejuditz und Schaden declinire", ein Anerbieten, welcheS Friedrich Wilhelm in einem Schreiben vom 12. Januar 1694 wiederholte, in dem er zugleich gute Behandlung der Fürstlichen Wittme und ihrer Töchter und Erhöhung der Apanage für Adolf Friedrich in Aussicht stellte.
Diese Huld des Schweriner Herzogs zog den Grafen für die nächste Zeit völlig auf dessen Seite. Schon das mündliche Versprechen von Varenins hatte die Wirkung, daß Bielke verhieß, es so zu dirigiren, daß die beiden Kompagnien nicht wieder nach Güstrow marschiren, die 50 Mann aus Boizenburg, die noch nicht lange dort gewesen, ausziehen und, was das Wichtigste war, die übrigen 50 Mann, wenn Gustav Adolf sterbe, sich nicht für Adolf Friedrich, sondern für Friedrich Wilhelm "interessiren" und niemand als diesen zur Besitzergreifung zulassen sollten; er werde den Lieutnant dahin instruiren (!).
Anfang Januar erwartete er den Besuch von Mumme und dem Strelitzer Rath Gutzmer; er wünscht, daß Varenins in der Nähe bleibe, damit er ihm sogleich Mittheilung machen könne von dem, was er mit diesen verhandele. Nach Gutzmers Besuch schreibt des Grafen Sekretair, der auch sein Sümmchen abbekommen, an Varenins, der Strelitzer habe ein Kreditiv von Adolf Friedrich und ein Empfehlungsschreiben der Fürstin überbracht. "Es hilfft aber bey Jhr. Excell. eben so wenig alß wen Sie gänzlich nicht davon dächten, weil dieselbe nur allein befließen sein Jhrer Durchl. zu Schwerin Interesse bey dieser affaire zu beobachten." Bielke war es auch, der in einem Brief an den Hofmarschall von Löwen vom 2. Januar 1694 den Rath gab, daß Friedrich Wilhelm in Bützow eine genügende Mannschaft von eigenen Leuten halte, die sofort zu Güstrow Besitz ergreifen könnten. Für die schwedischen Gruppen wolle er bürgen, daß sie es so bald nicht hindern sollten. Am 6. März schreibt er an Varenius, der Herzog von Güstrow habe begehrt, daß wieder zwei Kompagnien nach Güstrow kämen, sie sollten aber bei diesem Zustande nicht hinkommen, und wenn es doch geschehe, in nichts hinderlich sein. Den 24. März fragt


|
Seite 270 |




|
er, ob Friedrich Wilhelm gern sehe, daß die Schweden in Boizenburg blieben; er könne beides thun, sie dort lassen oder abfordern.
Allein alle diese Beweise von Ergebenheit hatten doch auch den diplomatischen Zweck, den Schweriner Hof geneigter zu machen, auf seine Vorschläge einzugehen, in deren Mittelpunkt die Vermählung Friedrich Wilhelms stand.
Die besten Aussichten, daß das Abkommen auf diesem Wege zu Stande kommen werde, schienen Ende März des Jahres 1694 zu bestehen. In dem eben schon citirten Briefe vom 24. dieses Monats spricht sich Bielke sehr hoffnungsvoll aus. Mumme, der wieder nach Schweden gehen solle, habe Ordre, alles zu thun, was möglich, um Adolf Friedrich zur raison zu bringen, so daß die Kombination ohne die allergeringste Schwierigkeit geschehen könne. Mumme hat versichert, daß Herzog Gustav Adolf gänzlich entschlossen sei, mit dem allerehesten Alles in Richtigkeit zu bringen, an die Herzogin von Strelitz sind die Prinzessinnen geschickt. Er stellte in diesem Brief auch seinen Besuch in Schwerin in Aussicht.
Dieser erfolgte im Osterfest, Anfang April. Der erste Ostertag war am 8., den 12. reiste Bielke wieder ab. Am Osterdienstag, den 10. April, zeigte der Rath Taddel mit dem Archivar dem Grafen die Originale von Johann Albrechts Testament und der Kaiserlichen Konfirmation, dem Vergleich vom Jahre 1586 und der Konfirmation des Rezesses vom Jahre 1621. Vor seiner Abreise fand eine Sitzung des Geheimen Rathes statt, in der beschlossen wurde, wie der Graf gerathen, Jemand nach Schweden zu senden, um dort mit Hülfe des schwedischen Hofes Adolf Friedrich zum Nachgeben zu bewegen, und ferner über die Erbfolge, die Ehe und die Unterstützung durch fremde Mächte, Dänemark und Brandenburg, verhandelt wurde. Bielke wurde ersucht, in Güstrow zu erklären, wenn Gustav Adolf seinen Adel in feierlicher Versammlung an Friedrich Wilhelm als seinen Nachfolger weise, sei Friedrich Wilhelm zu sofortiger Werbung entschlossen. In Betreff der Abfindung Adolf Friedrichs bekam Bielke den Eindruck, daß Friedrich Wilhelm zwar ein Fürstenthum nicht abtreten wolle, aber doch, wenn Adolf Friedrich "sich nur irgend finden lassen wolle", dahin zu bringen sein werde, ihm zu begegnen, daß er als ein Fürst leben könne. Assistenz fremder Mächte werde Friedrich Wilhelm, wie er ihm bestimmt versichert, nicht nachsuchen, er, der Graf, habe ihm deshalb die Gegenversicherung gegeben, daß auch die zwei Kompagnien Schweden in Güstrow sich in die Sache nicht einmischen sollten.


|
Seite 271 |




|
Von Schwerin reiste der Graf nach Güstrow. Ueber die Vorgänge daselbst ist noch ausführlichere Kunde als über die in Schwerin erhalten, und zwar stammt sie vom Grafen selbst, der nach seiner Abreise aus Güstrow in Demmin den 18. April Varenius eine eingehende Schilderung derselben gab, die im Ganzen einen durchaus glaubwürdigen Eindruck macht. Adolf Friedrich war damals in Güstrow, und Bielke hat mit den beiden Herzögen wie auch den Räthen häufig und eingehend gesprochen. Es kam hauptsächlich darauf an, Adolf Friedrich zum Nachgeben zu bewegen, wobei der Graf von Gustav Adolf bereitwillig unterstützt wurde. Es kam zu Auftritten von recht dramatischem Charakter, allein alles scheiterte an Adolf Friedrichs Festigkeit, dem seine Gattin getreu zur Seite stand. Zuerst benahm der Graf ihm die Hoffnung auf schwedischen Beistand; er fragte in der ersten Unterhaltung, auf was sich denn Adolf Friedrich verlasse, Friedrich Wilhelm habe viele, er aber gar keine Assistenz zu hoffen, und als Adolf Friedrich darauf zu verstehen gab, er setze große Hoffnung auf Schweden, erwiderte der Graf, der König werde sich nicht einmischen, so lange Friedrich Wilhelm keine fremde Hülfe suche. Gustav Adolf rieth er, doch einmal seine Autorität bei seinem Schwiegersohn zu gebrauchen. Dies war am Sonnabend, den 14. April. Gleich nach Mittag an demselben Tage war dann eine Sitzung des Geheimen Rathes, an der auch die zwei Landräthe theilnahmen. Diese erklärten, sie sähen die Kombination der beiden Herzogthümer aus dem Grunde gern, weit dem Lande leichter fiele, einen als zwei regierende Herren zu unterhalten. Es wurde beschlossen, zwei Räthe an Adolf Friedrich zu senden, um ihm vorzustellen, daß sein Schwiegervater die Successionsfrage gerne in Güte verglichen sehe. Am Sonntag ward im Gottesdienst vor wie nach der Predigt im Gebete von der Kanzel der schwebenden Verhandlungen besonders gedacht. Den Nachmittag um 5 Uhr gingen dann die beiden Räthe zu Adolf Friedrich, der zuerst sich sehr unwillig zeigte ("Er sehe nun wohl, wie man es mit Jhm meine"), endlich aber versprach, er wolle sich näher erklären. Am Montag ging der Graf auf Mummes Bitten noch einmal zu Adolf Friedrich, den er in großer Erregung fand. Der Herzog äußerte, er sei zwar nicht gesonnen, etwas zu thun, so Jhro Maj. in Schweden mißfallen könnte, aber "ehe er sich was solle andringen lassen, so ihn hernach sein Lebtag gereuen könnte, wolle er lieber der Krone Schweden sein Lebtag als ein Rittmeister dienen, wie einige seiner Vorfahren gethan, und auf solche


|
Seite 272 |




|
Art bei ihr Schutz suchen". Wie der schwedische Rath Braun erzählt hat, sprach er so laut, daß man im Vorzimmer die Worte verstand, er wolle lieber der Krone Schweden alle seine Rechte cediren, als Friedrich Wilhelm die Succession abtreten. Ebenso wenig richtete der Graf bei der Herzogin aus, die sich auf frühere Zusagen ihres Vaters berief (s. o. S. 252, A. 2) und äußerte, man thue in Schwerin sehr übel, daß man mit der Mariage Jhren Herrn Vater zu entfremden suche. Darauf ersuchten die Räthe Scheres und Lehsten den Grafen, folgende Bedingungen Friedrich Wilhelm durch ein Schreiben und Adolf Friedrich mündlich mitzutheilen: 1. Abtretung von dem Fürstenthum Ratzeburg und im Ganzen 30000 Th., 2. Schloß Schönberg als Residenz, 3. Auszahlung der Grabowschen Forderung und der andern Gelder. Der Graf will sich zuerst geweigert haben, diese Kommission zu übernehmen, ließ sich aber dann doch dazu bereit finden, aufs Neue eine Aussprache mit Adolf Friedrich nachzusuchen. Dieser erwiderte ihm, er hätte nie gedacht, daß sein Herr Vater "sich ganz Schwerinisch erklärte", und bat um Zeit. 1 ) Bei einem Gegenbesuch erklärte er, so lange ihm sein Recht nicht zweifelhaft gemacht werde, 2 ) könne er sich zu nichts entschließen, und schlug vor, die drei betheiligten Höfe möchten Jemand nach Stettin abordnen, um dort mit Hinzuziehung einiger Rechtsgelehrten die Sache zu untersuchen. Gustav Adolf verlangte indessen kategorischen und schleunigen Entschluß und ließ Adolf Friedrich sagen, er werde Verzögerung desselben für einen Schimpf aufnehmen, ja er drohte, er werde Adolf Friedrich nicht mehr sprechen und seine Hartnäckigkeit dem König von Schweden hinterbringen


|
Seite 273 |




|
lassen. Alles fruchtete nichts, vielmehr versuchte Adolf Friedrich durch seinen Vertrauten, den Oberst Putbuß, Bielke dafür zu gewinnen, er möge die Ehe hinziehen und den Besitz von Güstrow ihm zuwenden, der Oberst ward aber kurz abgewiesen. 1 ) Die ganze Verhandlung war also ergebnislos geblieben, hatte aber deutlich die Geneigtheit Gustav Adolfs zum Abschlusse mit Schwerin gezeigt, weshalb der Graf durch Varenius die Fortsetzung der Verhandlungen mit Güstrow rathen ließ.
Nachträglich mochte Gustav Adolf das Gefühl haben, mit seinem Schwiegersohn zu hart umgegangen zu sein, und es entstanden in ihm Gewissenzweifel, ob er auch Recht daran thue, zu den Vermittelungsversuchen seine Hand zu bieten, bei denen Adolf Friedrich zum Verzicht auf Rechte genöthigt werden sollte, die auch Gustav Adolf im Ganzen besser begründet erschienen, als die Ansprüche des Gegners. Die Art, wie er diese Gewissenszweifel zu lösen sucht, wirft ein helles Licht auf den frommen und gewissenhaften Sinn des Herzogs, an dessen Regierungshandlungen sich ja gewiß im Einzelnen manches, wie seine allzu starke Hinneigung zu Schweden, tadeln läßt, dessen Charakter aber über allen Tadel erhaben ist. Er wandte sich nämlich an die theologische Fakultät zu Leipzig in einem Schreiben, datirt vom 5. Mai 1694, in dem er die ganze Sache unter fingirten Namen der Betheiligten ausführlich vorlegte. Das Aktenstück ist zugleich sehr bezeichnend für die Ansicht, die damals Gustav Adolf von dem ganzen Stande der Sache hatte: Unter zwei Herren entsteht ein Streit, wer von ihnen einem dritten nach dessen Tode in der Regierung folgen soll. Der eine, Cajus (Adolf Friedrich), hat nach Meinung der vornehmsten Rechtsverständigen mehr Recht zu solcher Succession, als der


|
Seite 274 |




|
andere Prätendent, Sejus (Friedrich Wilhelm); dieser aber gedenkt sein vermeintliches Recht auf allen Fall durchzusetzen ("hinauszuführen"), hat auch Mittel genug dazu, woran es dem Cajus mangelt. Hierbei bemühen sich einige Frieden und Ruhestand liebende Gemüther, diese weitaussehende, gefährliche Sache noch bei Lebzeiten des Dritten, (Justus, d. i. Gustav Adolf), durch gütliche Vermittelung zu schlichten, damit das Land nicht ruinirt werde. Sejus will dem Cajus, wenn dieser ihm seine Ansprüche abtritt, so viel jährliche Renten liefern lassen, daß er seinem Stande gemäß, und was die Mittel betrifft, besser und ruhiger, als wenn er das Land selbst besäße, leben könnte. 1 ) Wenn aber Sejus zur Succession komme und das Land unter einer Regierung vereinigt werde, so "sehen obgedachte Mediatores, daß es dem ganzen Lande zu augenscheinlichem Nuzen und aufnehmen dienen würde, indem Er alsdann capabel seyn würde, einen eigenen militem zu unterhalten, in großer Herren alliance zu treten (: denen im Falle der Division die Bündnüße, wegen dar bekannten Schwachheit des Landes mehr beschwerlich als verträglich fallen würden:) und dadurch bey Kriegszeiten fremde Völcker (: denen das Land sonsten in dergleichen Fällen zu einem allgemeinen Raube dienen müßen:) von seinem Lande ab, und daßelbe im erwündschten Ruhstande zu erhalten, um welcher des ganzen Landes offenbahre Wohlfarth willen alle Kluge und weitsehende Patrioten wündschen, daß, da es die Rechte zulaßen, oder Cajus von seiner vermeintlichen praetension abstehen wolle, die Lande nach dem Todesfall Justi wieder combiniret werden möchten." Die Frage lautet, ob Justus, der sich in dieser zweifelhaften Sache gerne ganz christlich und unparteiisch bezeigen wolle, mit gutem und unverletztem Gewissen die Partei der Vermittler, welche auf die Kombination der Lande abziele, halten könne.
Die "mit Gottes Wort und dem natürlichen Recht überenstimmende" Antwort fiel dahin aus, daß "Justus der Mediatorum partie, melche auf Fried und Ruhe und auf die Wohlfarth des Vaterlandes zielet, mit christlichen, guten und unverletzten Gewißen halten könne." Gustav Adolf setzte also seine Bemühungen fort; ein Beleg dafür, wie eingehend er sich mit der ganzen Frage beschäftigte, ist ein eigenhändig geschriebener Aufsatz über die Kombination, von dem im Archiv ein Auszug vorhanden ist.


|
Seite 275 |




|
Darin werden die Vortheile der Vereinigung der beiden Herzogthümer für die Machtstellung des meklenburgischen Fürstenhauses, der Nutzen, den sie auch für das Reich hätte, insofern das vereinigte Land besser im Stande sein werde, seinen Aufgaben im Reiche zu genügen, und auf der andern Seite der ungewisse Ausgang eines Processes, die gefährlichen Weiterungen, die durch fremde Allianzen entstehen könnten, durchaus überzeugend dargelegt; die Sache sei so einzurichten, daß Prinz Adolf Friedrich seinen Rang als regierender Herr behalte. 1 ) Letzteres ließ sich auch ohne Abtretung eines Fürstenthums dadurch erreichen, daß Adolf Friedrich auf seinen Apanagegütern eine möglichst selbständige Stellung erhielt. So sehen wir denn Gustav Adolf sogar soweit den Schwerinern entgegenkommen, daß er Adolf Friedrich zu bewegen sucht, von der Forderung eines Fürstenthums abzusehen, was aber mißglückte. (Schreiben an Graf Bielke vom 20. Oktober 1694.)
Im Ganzen kamen die Verhandlungen nach den Apriltagen ins Stocken. Das Hauptinteresse war damals von Seiten beider streitenden Parteien der Lübecker Kommission zugewandt, durch welche der langwierige Streit wegen der Schweriner Apanage Adolf Friedrichs endlich nicht ohne Zureden Güstrows und Schwedens zum Schlusse kam.
Zwischen Schwerin und Bielke trat im Laufe des Sommers eine entschiedene Entfremdung ein. Der Graf war unzufrieden, daß man sich in Schwerin nicht zur Heirath entschließen wollte, ohne über den Verzicht Adolf Friedrichs ganz sicher zu sein, und daß man einer von ihm zu Wismar vorgeschlagenen Konferenz auszuweichen suchte. Noch mehr erregte seinen Unwillen das Mandat, das Friedrich Wilhelm in Wien ausgewirkt hatte, in dem Güstrow zur Entlassung der Schweden ermahnt wurde. Auch blieb ihm nicht unbekannt, daß Schwerin am liebsten die schwedische Vermittelung ganz vermieden und die Entscheidung vor den Kaiserhof gebracht hätte. Einen sehr drastischen Ausdruck gab er seinem Unmillen in einem Schreiben, das er im August an Mumme nach Stockholm schickte. Er beschwert sich


|
Seite 276 |




|
darin bitter über die "Schweriner tromperien", Schwerin habe so gar nichts aufrichtiges im Schilde, indem es die Konferenz, wozu es sich vordem willig erwiesen, nun ganz ausgeschlagen; unter ihrem Vorgeben die Mariage mit Güstrow zu schließen sei eben das Gift verborgen, womit man Güstrow sicher zu machen und neutral zu halten trachte. Varenius erhielt Auftrag, Bielke so viel wie möglich zu begütigen, was ihm auch in so weit gelang, als Bielke die Verbindung und den Briefwechsel mit Schwerin nicht abbrach. 1 ) Der Schwerpunkt der Verhandlungen verlegte sich jedoch in der zweiten Hälfte des Jahres 1694 an den


|
Seite 277 |




|
Hof von Stockholm selbst, wohin damals auch Schwerin und Strelitz Gesandte geschickt hatten.
Verhandlungen in Stockholm.
Der Gedanke dazu stammte schon aus dem Jahre 1693. Die Königin=Wittwe von Schweden war es, die, wie Mumme den 6. Mai berichtet, ihm sagte, sie würde gerne sehen, wenn auch ein Schweriner Minister nach Stockholm käme. Wenn es geschähe, wolle sie ihm schon so viel zureden, daß der Herzog keine andere als die Güstrowische Partei suchen solle.
Im Schweriner Ministerium bildete die Frage, ob man Jemand nach Schweden schicken sollte, zum ersten Mal den Gegenstand einer Geheimen=Rathsverhandlung am 17. und 18. März 1694. Die Absendung nach Schweden selbst erschien in Schwerin noch weit bedenklicher wie die Vermittelung durch Bielke, man glaubte sie aber, da bereits bekannt war, daß von Strelitz jedenfalls Jemand dorthin gehen werde, nicht ablehnen zu können, nur müsse vermieden werden, daß man in Stockholm selbst die Vermittelung in die Hand nehme. Wenn aber einer von den Ministern hingehe, so werde man sie ihm offeriren. Sie anzunehmen, hieße, sich in eben das Netz verwickeln, das man zu Güstrow ausgespannt, und es werde dabei ein Fürstenthum verloren gehen, wodurch das Primogeniturrecht Friedrich Wilhelms umgestoßen und künftiger weiterer Zerstückelung des Staates Thür und Thor geöffnet werde. Schlage man aber die Vermittelung ab, so sei Schwedens Gegnerschaft zu fürchten. Durch die Annahme aber werde der Kaiser beleidigt, die Sache aus seinen Händen gezogen und auch an der Seite alles verdorben, was bisher mit so großer Mühe und Kosten erworben sei.
Man kam auf die Auskunft, nicht einen der Minister, sondern einen Kavalier nach Schweden zu senden, der um die Gewogenheit des Königs für Friedrich Wilhelm sich bewerben, dabei unter der Hand nachforschen könne, was etwa Güstrow mit Schweden abgemacht, und, nach dem Erbfolgestreit gefragt, eine Informationsschrift vorlegen könne mit dem Hinzufügen, die Sache schwebe bereits vor dem Kaiserhofe. Sehe man, daß von Schweden Vortheil zu hoffen, so könne Friedrich Wilhelm noch "allemahl daselbst zuschlagen." Für die Mission ward dann der Geh. Rath v. Koppelow in Aussicht genommen, derselbe, der die Verhandlungen wegen der Investitur in Wien geführt hatte und also in diplomatischen Geschäften kein Neuling war.


|
Seite 278 |




|
Auch bei Bielkes Besuch in Schwerin war von der beabsichtigten Sendung nach Schweden die Rede. Bielke war damit einverstanden; er hoffte jedenfalls, daß man ihn auch zu den Verhandlungen in Schweden zuziehen werde, da ja doch der König ihm speciell die Führung der Sache übertragen hatte.
In der Sitzung am 12. April beschloß man, in Schweden die Versicherung abgeben zu lassen, Friedrich Wilhelm werde zur Vermählung schreiten, wenn ihm schwedische Hülfe zur Besitzergreifung von Güstrow zugesichert werde.
Da aber die Mission nach Schweden bei allen befreundeten Höfen auffallen mußte, so sollten diese vorher, theils brieflich, theils durch Gesandte, davon in Kenntniß gesetzt und um Anweisung an ihre Gesandten in Schweden, den Schweriner Abgesandten zu unterstützen, ersucht werden.
So geschah es denn auch. Ohne Schmierigkeit ward von Herzog Georg Wilhelm von Celle, dem Kreisobersten, die gewünschte Weisung an seinen Stockholmer Gesandten erwirkt. Nach Kopenhagen ward der Oberstallmeister v. Bibow, der bereits früher dort gewesen war, gesandt, ebenfalls, für den Augenblick wenigstens, mit dem gewünschten Erfolg. 1 ) Am schwierigsten war die Sendung nach Brandenburg, wohin Koppelow selbst sogleich im April ging.


|
Seite 279 |




|
Mit Brandenburg hatte Friedrich Wilhelm den 12./22. Juli 1693 den alten Erbvertrag erneuert und zugleich einen Geheimvertrag geschlossen, in dem der Kurfürst ihm seine Unterstützung in der Erbfolgefrage versprach. Im Einklang hiermit war Adolf Friedrich, als er sich noch im Jahre 1693 nach Berlin um Unterstützung wandte, abgewiesen worden, wobei sich der Kurfürst auf ein Rechtsgutachten stützte, das er von seinem Kanzler v. Unversehrt hatte anfertigen lassen und das für Friedrich Wilhelm ausgefallen war. Man hatte Adolf Friedrich bedeuten lassen, weil das Recht so klar für Friedrich Wilhelm sei, trage man Bedenken ihm beizustehen; er möge nur auf eine gute Apanage reflektiren. Indessen war man schon damals nicht recht zufrieden mit Schwerin. Schon daß Schwerin so lange säumte, die Nachweise für seine Rechte auf die Erbfolge vorzulegen, empfand man als einen Beweis von Mißtrauen. Man nahm übel, daß Schwerin sich mit Güstrow in geheime Verhandlungen einließ, ohne in Berlin vorher davon Mittheilung zu machen. Der Anschluß an Dänemark erregte entschiedenen Unwillen. Auch hatte Brandenburg in Bezug auf den Erbfolgevertrag noch weitere Wünsche, man begehrte eine Eventualhuldigung bei Gelegenheit der in Schwerin zu veranstaltenden feierlichen Huldigung, auch kaiserliche Konfirmation für den Erbfolgevertrag.
Beides schob Schwerin, offenbar absichtlich, auf die lange Bank. So fand der Rath Schnobel, der Ende 1693 nach Berlin gesandt ward, um das Anrecht Friedrich Wilhelms durch Vorlegung der damals vorhandenen juristischen Schriften zu erweisen und wegen eventueller militärischer Hülfe zu sondiren, kein allzu bereites Entgegenkommen. 1 )
Was man in Berlin wünschte, war ein weit engerer Anschluß Schwerins an Brandenburg. So war denn auch in dem


|
Seite 280 |




|
Entwurf eines Traktates wegen Bereitstellung einer Kompagnie Dragoner an der Grenze, den der brandenburgische Minister Dankelmann d. 26. Januar 1694 an Schnobel gab, als Entgelt für die zu bewilligende Truppenhülfe gefordert, daß Friedrich Wilhelm "sich mit dem Hause Brandenburg vor allen zusammen setze und zu beyderseits conservation verbinde." Eine so enge Verbindung, die Meklenburg zu einem Vasallenstaat Brandenburgs herabdrücken mußte, war denn doch bedenklich erschienen, überdies hatte sich Friedrich Wilhelm entschlossen, vorläufig von aller fremden Truppenhülfe ganz abzusehen. Schnobel war also Anfang Februar abberufen mit dem Befehl, die Sache in statu quo zu lassen, und man gab auf Dankelmanns Projekt gar keine Antwort, was dieser sehr übel vermerkte. Koppelow bekam dies offen zu hören, als er Ende April nach Berlin kam. Doch zog der brandenburgische Staatsmann bald mildere Saiten auf, und er sowohl wie der Kurfürst erklärten sich mit der Sendung nach Schweden einverstanden.
Im Juli ging dann die Reise nach Schweden vor sich. Man entschied sich schließlich in Schwerin dafür, Koppelow gar nichts Schriftliches mitzugeben, er sollte aus der in seine Instruktion eingeflochtenen Rechtsdeduktion mündlich so viel anführen, wie ihm gut scheine. Den 24. Juli kam auch Mumme in Stockholm wieder an und fand Koppelow und Schultze schon vor.
Ehe die Verhandlungen Früchte zeitigen konnten, suchte man von Wien aus, in vollem Einverständniß mit Schwerin, den ganzen schwedischen Vermittelungsgelüsten die Wurzel abzuschneiden durch ein Memorial, das der kaiserliche Gesandte Mitte August in Stockholm übergab, worin er den König ersuchte, zum Präjudiz des Kaisers, vor dem allein alle und jede Lehnsstreitigkeiten zwischen Reichsfürsten auszumachen seien, nichts zu unternehmen und die Prätendenten, falls einer oder der andere sich um seine Assistenz bewerbe, an den Kaiser zu verweisen. In Schweden ließ man sich ebenso wenig hierdurch wie durch einen Einmischungsversuch Dänemarks, 1 ) abhalten, weiter zu verhandeln. Es ist überflüssig, auf die einzelnen Vesprechungen der schwe=


|
Seite 281 |




|
dischen Staatsmänner mit den drei Abgesandten einzugehen. Das Hauptinteresse konzentrirt sich auf zwei Vergleichsprojekte von Güstrow und von Strelitz, von denen das Güstrower den 4. September an Mumme abgesandt und den 20. von diesem Oxenstierna überreicht, das Strelitzer den 27. November von Schultze in Stockholm übergeben ward.
Das Güstrower Projekt beginnt mit der Forderung wenigstens des einen der beiden Fürstenthümer, und zwar wird Bützow in Aussicht genommen, da Adolf Friedrich genugsam dargethan habe, daß ihm mit Ratzeburg nicht gedient sei, weil es dort an einer passenden Residenz fehle, sich auch keine Edelleute oder Städte darin befänden, und das Land von dem Herzogthum Sachsen=Lauenburg ganz eingeschlossen sei.
2. Dazu wird so viel an Aembtern und Einkünften gefordert, daß im Ganzen, Ratzeburg eingerechnet, jährlich 40000 Rth. herauskommen. Was die Aemter und liegenden Gründe anbelangt, so sollen sie von jeder Landeshoheit der Schweriner Herzöge befreit sein, doch nur die Amtshäuser, Dörfer, Höfe, Mühlen und dergleichen, aus denen Adolf Friedrich seine Einkünfte bezieht, nicht auch der in den Aemtern wohnende Adel und die darin belegenen Städte.
3. wird ein Anschlag im einzelnen aufgestellt und zur Abtretung vorgeschlagen:
| das Stift, veranschlagt auf | 6000 | Th. | |
| das Kloster Rühn auf den Todesfall der Prinzessin nebst den Gütern, die die Prinzessin dazu genossen | 2000 | " | |
| die Kollekten des Fürstenthums | 2000 | " | |
| das Amt Schwaan | 6000 | " | |
| die Komthureien Mirow und Nemerow 1 ) | 4000 | " | |
| ----------------- | |||
| 20 000 | Th. | ||
| dazu an baarem Gelde jährlich | 20 000 | Th. | |
| aus dem Boizenburger Zolle. | |||
4. völlige Satisfaction in der Grabowschen Forderung.
5. Die bis dato noch rückständigen Alimenten=Gelder.
6. Zureichende Alimentations=Gelder bis zum Tode Gustav Adolfs.
Die Eingabe Schultzes vom 27. November zerfällt in zwei Theile, der erste giebt die Gründe an, "warumb das communicirte


|
Seite 282 |




|
Project zum Fundament der Transaction nicht gesetzt und dieser seits angenommen werden könne."
Dieser Theil enthält folgende 10 Punkte, die hier in abgekürzter Form wiedergegeben werden:
1. Das Herzogthum Güstrow trage menigtens 150000 Rth., das angebotene betrage nur 31000 Th. - wie nachher im einzelnen nachgewiesen wird - ja, wenn es auch auf 40000 Th. erhöht würde, so würde Herzog Adolf Friedrich auch hiernach trotz seines so offenbaren Rechtes noch nicht den vierten Theil der Einkünfte des Herzogthums bekommen; aber er wolle nicht verhoffen, daß ihm dies zugemuthet werde.
2. Adel und Städte könnten nicht von den Aemtern losgerissen werden, dies gereiche zu Jhrer hochfürstl. Durchl. "despect und Verkleinerung" und würde zu allerhand Konfusion und Streit Anlaß geben.
3. Das Fürstenthum Schwerin trage nicht 6000, sondern nicht viel über 4000 Rth.
4. Das Amt Rühn sei von Herzog Christian Louis bei einem in Wien übergebenen Anschlage nur auf 200 Rth. angegeben, könne also unmöglich jetzt auf 2000 angeschlagen werden.
5. Die Kollekten des Fürstenthums würden nur zu Reichs= und Kreistagen ausgeschrieben und dafür verwandt, könnten also nicht unter die Einkünfte gerechnet werden.
6. Das Amt Schwaan bringe jetzt an freien Einkünften kaum 3000 Th. ein.
7. Man würde bei einer bloßen Assignation auf den Elbzoll zu Boizenburg desselben gar nicht versichert sein, wenn nicht auch Amt und Stadt Boizenburg abgetreten würden.
8. Das Projekt sei auf Adolf Friedrichs Erben nicht mitgerichtet.
9. Es sei wegen der Landes=Aussteuer der Fürstlichen schon erzeugten oder noch zu hoffenden Prinzessinnen, auch fernerer Descendenten nichts bestimmt.
10. Es sei von kaiserlicher Konfirmation und kaiserlicher, wie anderer hohen Häupter Garantie nichts erwähnt, ohne welche der Traktat nicht gesichert sei.
Darauf folgen dann die Forderungen Adolf Friedrichs. Er verlangte cum Jure Superioritatis, Episcopali, mit eingesessenem Adel, zugehörigen Städten, Flecken, Dörfern u. s. w. zu erblichem Besitz:
1. Das Fürstenthum Ratzeburg cum voto et sessione in Comitiis et Circulis, allen seinen Pertinentien und De-


|
Seite 283 |




|
pendentien, wie auch dem Ratzeburgischen Bischofs=Hofe zu Lübeck, an Werth zu schätzen auf etwa 12000 Rth.
2. Das Fürstenthum Schwerin mit Amt und Ort Warin, Kloster Rühn, dieses erst nach dem Tode der Prinzessin Sophie Agnes, den Hof Gallentien cum Jure Cancellariatus an der Universität, wie es weiland Herzog Adolf Friedrich I.
| besessen | 5000 | Rth. | |
| 3. | Das Amt Doberan | 8000 | " |
| 4. | Das Amt Schwaan | 3000 | " |
| 5. | Das Amt Stargard | 4000 | " |
| 6. | Die Aemter Strelitz, Feldberg und Wanzka, die er bereits besaß, mit voller Landeshoheit. | ||
| 7. | Das Jus Superioritatis über das zwischen diesen und den folgenden belegene kleine Amt und Städtlein Wesenberg. | ||
| 8. | Die Komthureien Mirow und Nemerow | 4000 | " |
| 9. | Den Elbzoll zu Boizenburg, und weil man dessen sonst nicht versichert, dazu | 20000 | " |
| 10. | Stadt und Amt Boizenburg | 3000 | " |
| ---------------------------- | |||
| Zusammen ohne Nr. 6 und 7 | 59000 | Rth. | |
11. Daneben die Schuldforderungen, 79000 Rth., so weit, was davon bezahlt ist, mit Quittungen nicht bescheinigt werden kann, in einer Summe sofort auszuzahlen.
12. Die Alimente für die letzten 2 Jahre, 6600 Rth.
13. Daß die Pacta Familiae, insoweit sie dem Vertrage nicht widersprechen, beibehalten werden und ihnen gemäß der Aeltere allemal die Oberhand haben müsse.
14. Daß Herzog Adolf Friedrich mit den Landesschulden und sonst darauf haftenden Lasten nichts zu thun habe, sondern das abzutretende frei und ohne jede Belastung geliefert werde.
15. Aussteuerung und Dotirung der (jetzt vorhandenen und künftigen) Prinzessinnen vom Lande.
16. Zu Anbau und Reparirung des Residenzschlosses zu Bützow 10000 Rth.
17. Zulängliche Alimentgelder bis zum Eintritt des Todesfalles und sofortige Einräumung des Jus Superioritatis et Episcopalis über das Amt Mirow.
18. Kaiserliche Konfirmation des Vergleiches auf Kosten der Schweriner, auch Garantie des Kaisers und des Königs von Schweden.


|
Seite 284 |




|
darunter stand noch die Bemerkung: "Obiges ist nicht einmahl der Helffte des Herzogthums Meklenburg Güstrowschen theils Revenüen zu vergleichen, daher dann davor gehalten wird, daß solches Project gar raisonnable sey, und man fürstlich Schwerinischer seits so viel weniger solches zu refusiren uhrsache haben werde."
Mit der Ansicht, daß dieses Projekt "raisonnable" sei, stand nun allerdings Schultze allein; es erregte vielmehr allgemeinen Unwillen, auch bei Schweden. Der schwedische Reichskanzler erklärte Koppelow, die Strelitzer Forderungen seien gar zu enorm; wenn Adolf Friedrich sich ferner hartnäckig erweisen sollte, so werde der König seine Hand ganz von ihm abziehen. Adolf Friedrich müsse von einem Fürstenthum abstehen. Diese ganz Schwerin freundliche Strömung war freilich nur von kurzer Dauer. Man kam bald wieder auf die Forderung eines Fürstenthums oder wenigstens eines Reichsvotums für Adolf Friedrich zurück und war bereit, dies mit allerlei Vorbehalten zu verklausuliren, daß es nur noch, wie Oxenstierna sich einmal ausdrückte, "einem Schatten ähnlich sei."
In Schwerin hatte man anfänglich, wie oben erzählt, die Absicht gehabt, sich auf eine förmliche Vergleichsverhandlung in Stockholm überhaupt nicht einzulassen, und gleichzeitig mit den Besprechungen in Schweden noch einmal direkte Verständigung mit Güstrow versucht. Man schickte dazu den Sekretär Varenius nach Güstrow (den 9. August), um noch einmal wegen der Ehe zu sondiren. 1 ) Auf Anregung des Sekretärs schrieb dann Friedrich Wilhelm, um dem Einfluß Adolf Friedrichs der vom 21. August bis zum Ende des Monats in Güstrow war, entgegenzuarbeiten, d. 25. August einen Brief an Gustav Adolf, in dem er seinen lebhaften Wunsch ausdrückte, daß nunmehr, da die Kommissionsverhandlungen zu Lübeck beendet seien, in der Successionssache die Ruhe im Hause befestigt werde; Gustav Adolf möge doch Adolf Friedrich bei dessen Anwesenheit die ganze Sache beweglich zu Gemüthe führen und ihn dahin dis=


|
Seite 285 |




|
poniren helfen, daß er sie auf billige Bedingungen in Güte und in der Stille heben lassen möge.
Gustav Adolf erhielt das Schreiben erst, als Adolf Friedrich schon wieder abgereist war; er antwortete den 30. August mit dem Vorschlage, daß Friedrich Wilhelm einen seiner vertrauten Räthe senden und ihn wissen lassen möge, was für Aemter und Einkünfte er an Adolf Friedrich neben dem einen saekularisirten Stifte einzuräumen geneigt sei; er könne alsdann, "weil er sonst keine Hoffnung habe, Jhro Lbd. zu gewinnen", denselben mit mehr Nachdruck zur Aufgabe seiner Ansprüche disponiren.
Die Antwort war für Friedrich Wilhelm einer Ablehnung gleich, doch sandte er im November 1 ) den Hofrath Taddel nach Güstrow, der um eine Konferenz mit dem Präsidenten v. Ganß bitten und ihn sondiren sollte, ob Gustav Adolf gegen ein "leidliches Geld=Quantum und das bindende Heirathsversprechen mit Ernst an die Frage eines Aequivalentes für das von Adolf Friedrich geforderte Fürstenthum herantreten wolle. Gustav Adolf ließ hierauf erklären, er könne der schwedischen Vermittelung nicht vorgreifen und seine officia jetzt nicht weiter anwenden. 2 )
Erst jetzt ließ man sich in Schwerin bereit finden, wenigstens mündlich in Schweden auf die Vermittelungsprojekte Bescheid geben zu lassen. Den 12./22. Dezember 1694 erhielt Koppelow ein Reskript mit dem Angebot, daß Friedrich Wilhelm zu dem, was


|
Seite 286 |




|
Adolf Friedrich schon habe, 16-18000 Th. an Geldeinkünften aus dem Güstrowischen zahlen wolle; wenn aber dies abgelehnt werde, so werde er sich an die Entscheidung des Kaisers halten, Oxenstierna fand das Quantum des Angebotes genügend (Rel. vom 12. Januar), es liege nur an dem Reichsvotum; Mumme gegenüber schlug er den 30. Januar 30000 Th. inkl. Ratzeburg vor. Friedrich Wilhelm erklärte sich darauf den 31. Januar zur Bewilligung von 20000 Th. bereit.
Neben der Höhe der Apanage ward auch das Eheprojekt vielfach besprochen. Man rieth in Schweden - wie auch gleichzeitig Graf Bielke - auf das Dringendste zur Eheschließung; es werde sich dann der Ausschlag zu Friedrich Wilhelms Gunsten bald zeigen (so in der Rel. vom 14. Februar 1695 und ähnlich öfter).
Allein in Schwerin blieb man auf dem Standpunkte, es sei gefährlich, die Ehe zu schließen, bevor man wegen der Erbfolge bestimmte Zusicherung habe, ebenso wies man die Abtretung eines Fürstenthums oder die Bewilligung eines wie auch immer verklausulirten Reichsvotums nach wie vor ab. Auch ein persönlicher Besuch Friedrich Wilhelms in Güstrow, d. 14. und 15. Januar 1695, förderte den Ausgleich nicht, da man von beiden Seiten über Höflichkeitsbezeugungen nicht hinausging.
Inzwischen war, im Dezember 1694, in Wien eine Entscheidung gefallen, die der schwedischen Vermittelung ein Ende bereitete: es war eine kaiserliche Kommission zur Schlichtung des Erbfolgestreites eingesetzt. Im Februar 1695 bekam daraufhin der kaiserliche Gesandte in Stockholm den Auftrag, den mecklenburgischen Gesandten in Stockholm zu sagen, daß sie wohl thun würden, wenn sie auf ihre Rückreise bedacht wären. Man wartete in Schweden noch ein Schweriner Ultimatum ab, das Anfang März eintraf; als auch dies dabei beharrte, daß Friedrich Wilhelm keins der beiden Fürstenthümer abtreten werde, gab man weitere Versuche auf, woran auch das eintreffen des Grafen Bielke nichts mehr änderte. 1 ) Die Zögernng zog den beiden Gesandten eine Erneuerung der Aufforderung zur Abreise in schärferer Form zu. Sie ward von beiden befolgt: Die Episode der schwedischen Vermittelung war abgeschlossen und blieb es


|
Seite 287 |




|
auch, obgleich Güstrow noch mehrfach darauf zurückzukommen suchte. Indessen waren für Güstrow wie für Schwerin Mühe und Kosten der Sendung nicht ganz umsonst. Mumme hatte die Verlängerung der Allianz zwischen Güstrow und Schweden auf weitere vier Jahre erwirkt (d. 29. Januar 1695), und Koppelow sichere Nachricht erhalten, daß die im Güstrowschen stehenden Truppen nicht für Adolf Friedrich einzutreten bestimmt waren.
V.
Die kaiserliche Kommission bis zum Tode Gustav Adolfs.
Die Einsetzung der Kommission.
Die Darstellung der Verhandlungen in Wien ist oben im Anfang des Jahres 1694 abgebrochen worden. Sie blieben das Jahr 1694 hindurch in langsamem Fluß. Gegen das Dehortatorium, das am 9. Januar erkannt war, wandte sich der Strelitzer Anwalt Koch sogleich d. 14. Januar mit einer Rechtfertigung, in der er schließlich ein Dehortatorium für Friedrich Wilhelm erbat. Den 8. März lief eine zweite Eingabe ein. Adolf Friedrich beklagt sich darin, daß Friedrich Wilhelm die Lübecker Kommissionsverhandlungen aufgehalten und endlich ganz abgebrochen habe. Auch die Unbilden, die Adolf Friedrich in Mirow erlitten, werden erwähnt und schließlich vom Kaiser die Einweisung in das Stift Ratzeburg sowie die Exekution gegen Friedrich Wilhelm erbeten, wenn er nicht von dem Tode Christian Louis ab die Erträge des Fürstenthums Ratzeburg sofort herausgebe. Den 5. April folgt eine dritte Eingabe, worin dem Kaiser angezeigt wird, daß Friedrich Wilhelm ungeachtet der bereits ergangenen Dehortatoria nach Bützow, das nahe bei der Residenz Güstrow liege, Gruppen habe marschieren, auch verschiedene Wagen mit Lunten, Pulver und anderer Munition habe fahren lassen. Er solle auch bei den Königen von Schweden und Dänemark um Ueberlassung einiger Regimenter angehalten und


|
Seite 288 |




|
auch sonst Allianzen zu gewinnen gesucht haben, um mit bewaffneter Hand das Herzogthum Güstrow nach Gustav Adolfs Tod in Besitz zu nehmen. 1 )
Ein Dehortatorium in arctiori forma wird gegen ihn beantragt und ebenso ein Schreiben an den Kreisobersten und die übrigen kreisausschreibenden Stände. Es wurde denn auch d. 7. April ein neues Mahnschreiben an Friedrich Wilhelm beschlossen, mit der Aufforderung, keine Thätlichkeiten vorzunehmen und dem Versprechen unparteiischer Justiz; d. 15. Mai ward das Schriftstück durch einen Boten Adolf Friedrichs in Schwerin abgegeben.
Den Schwerinern war es ein leichtes, hierauf mit gleicher Münze zu antworten. Den 18. Mai beantragte Rath Diettrich die Kassation dieses Mahnschreibens, zu dem sein Herr keine Veranlassung gegeben; die Verstärkung der Garnison von Bützow, die sich nicht wohl ableugnen ließ, suchte er durch die Behauptung zu verschleiern, daß zwischen den Garnisonen von Dömitz und Bützow, je nachdem es ihr Stand erfordere, häufige Verlegungen stattfänden. In ausführlicherer Form wiederholt er diesen Angriff auf Grund eines am 27. Mai aus Schwerin abgesandten Schreibens, den 23. Juni: Adolf Friedrich habe keinen Grund, sich über die Verstärkung der Garnison von Bützow zu erregen, als seinen eigenen Verdruß, daß ihm dadurch die Macht benommen sei, seine Absichten auf Bützow auszuführen. Friedrich Wilhelm habe niemals Korrespondenz mit dem Könige von Schweden gepflogen außer zur Notifikation seines Regierungsantrittes, habe auch, nachdem er den Abzug der dänischen Sol=


|
Seite 289 |




|
daten, die von seinem Vorgänger ins Land gerufen, selbst veranlaßt, keinen einzigen Minister nach Dänemark geschickt, 1 ) noch weniger an anderen Orten Allianzen gesucht. 2 ) Was aber Adolf Friedrich nicht allein bei dem Kaiser, sondern auch bei den benachbarten Mächten für gefährliches Ansuchen vorgebracht, ja durch seines Vetters Minister in Schweden gepflogen, sei bei allen bekannt, 3 ) und müsse ja der Vorwand der Arbeit an der Güstrowschen und Boitzenburgischen Befestigung seine besonderen Nebenabsichten haben, zumal für gewiß gelte, daß man damit umgehe, die Eventual=Huldigung oder wenigstens einen Handschlag von der Ritter= und Landschaft der Güstrowschen Landeshälfte an Adolf Friedrich leisten zu lassen; 4 ) auch würden für diesen schon Zimmer auf dem Schlosse zu Güstrow in Stand gesetzt, damit er desto leichter Besitz ergreifen könne. Der Kaiser wird ersucht, schleunigst, weil periculum in mora sei:
1. Das Dehortatorium an Friedrich Wilhelm zu kassiren,
2. das vorige Dehortatorium an Adolf Friedrich in arctiori forma zu erneuern,
3. an Gustav Adolf ein Reskript zu erlassen, daß er die schwedischen Truppen, wie Friedrich Wilhelm mit den dänischen gethan, ungesäumt entlasse,
4. Ritter= und Landschaft des Güstrowschen Theiles bei schwerer Pön aufzutragen, daß sie in keine Eventualhuldigung, auch nicht in einen Handschlag sich einlasse, sondern an die 1632 und 1654 geleisteten Huldigungseide sich erinnere und sich nicht davon abwendig machen lasse. Friedrich Wilhelm versichert dann am Schlusse noch seine schon bisher stets bethätigte und noch immer fortdauernde Geneigtheit zu gütlichem Vergleiche noch bei Lebzeiten Gustav Adolfs.
Am 23. Juli zeigte dann Koch den völligen Abbruch der Lübecker Kommission an mit der Bitte um ein Excitatorium an den Bischof zu ihrer Fortsetzung und eine vorläufige Verordnung auf Zahlung von wenigstens 16000 Th. jährlich und 12000 Th. einmalig als Abschlag auf die Schuldforderungen.


|
Seite 290 |




|
Diese Strelitzer Eingabe wie auch die letzten Schweriner wurden erledigt durch eine Reihe von Beschlüssen vom 28. Juli. Sie entsprachen im Ganzen den Schweriner Wünschen, nur daß man sich in Wien zur Kassirung des einmal ergangenen Dehortatorium begreiflicher Weise nicht verstand. Für Gustav Adolf ward ein Dehortatorium ausgefertigt, keine Eventualhuldigung zuzulassen, alle Neuerung abzustellen, zur Verhütung aller Weitläufigkeit alle fremden Truppen ungesäumt zu entlassen und darüber, daß dies geschehen, binnen zwei Monaten zu berichten. Adolf Friedrich ward mit einem Dehortatorium serium ulterius bedacht, sich aller Neuerung und fremden Anhanges zu entschlagen. Die Ritter= und Landschaft erhielt ein rescriptum inhibitorium, sich aller Eventualhuldigung zu enthalten. Beide fürstliche Parteien wurden durch Reskripte ermahnt, die gütlichen Verhandlungen fortzusetzen, und Friedrich Wilhelm besonders daran erinnert, Adolf Friedrich inzwischen solche fürstliche Unterhaltungsmittel zu bewilligen, daß dieser sich ferner zu beklagen keine Urfache mehr habe. Kopien aller dieser Schreiben wurden dem Bischof von Eutin übersandt mit der Erinnerung, allerseits zu Vollziehung der Kaiserlichen Befehle zu mahnen, Herzog Friedrich Wilhelm zur Darbietung besseren fürstlichen Unterhaltes an Adolf Friedrich zu veranlassen, daneben die Kommission fortzusetzen und über den Stand der Dinge, insbesondere darüber, welcher Theil die Schuld trage, daß bisher ein gütlicher Vergleich noch nicht zu Stande gekommen sei, zu berichten.
Es war eine umfassende Aktion des kaiserlichen Hofes, die freilich den Güstrowschen Erbfolgestreit weder entscheiden konnte noch wollte und in dieser Beziehung nur alles zu beseitigen suchte, was einer künftigen Entscheidung durch kaiserlichen Spruch oder Schiedsgericht im Wege hätte stehen können, aber den Apanagestreit zu einer schnellen Beilegung zu bringen bezweckte. Und dies gelang. Beide Parteien waren beflissen, in dieser weniger wichtigen Angelegenheit entgegenkommen zu zeigen, jede mit der Hoffnung, sich dadurch den Kaiserhof für die künftige wichtigere Streitfrage günstig zu stimmen. Die Kommissionsverhandlungen wurden wieder aufgenommen und führten in Kurzem, wie schon erwähnt, zum Abschluß des Lübecker Vergleiches, der dem unerfreulichen Handel ein Ende machte.
Von den übrigen Schreiben erreichte eines seine Adresse vorläufig nicht, das Dehortatorium an Gustav Adolf, das in Schwerin zurückbehalten ward, da man dort immer noch hoffte,


|
Seite 291 |




|
den Güstrower Herzog auf die Schweriner Seite zu ziehen, und es deshalb umsomehr vermeiden wollte, ihm Aerger zu bereiten, als jede seelische Erregung dem alten, schon recht siechen Herrn gefährlich werden konnte. Ritter= und Landschaft beantwortete das an sie gerichtete kaiserliche Reskript durch ein Schreiben, datirt vom 19. Januar 1695, das beim Reichshofrath d. 22.Februar einlief und das die Versicherung enthielt, es sei ihr weder eine Eventualhuldigung angesonnen noch von ihr beabsichtigt. Herzog Adolf Friedrichs Antwort auf das neue Dehortatorium ging den 7. November in Wien ein. Es entsprach durchaus der Wahrheit, wenn er darin über die Truppenverlegung nach Bützow behauptete, dort hätten sonst nur 10 oder 15 Mann gelegen, jetzt sei die Garnison auf etliche Kompagnien verstärkt, augenscheinlich zu dem Zwecke, um bei etwaigem Todesfall das Herzogthum Güstrow armata manu zu besetzen. Eine Uebertreibung aber ist, wenn es weiter heißt, es gehe der Ruf, daß im Herzogthum Schwerin allen Förstern, Jägern, Schützen, Heide= und Landreitern, auch Vögten ein harter Befehl ertheilt sei, sich fertig zu halten, um sich auf erste Ordre und wenn man vernehme, daß Gustav Adolf todt sei, auf dem bestimmten Sammelplatz einzufinden. Bibow sei nach Dänemark geschickt, um dort neue Truppen zu werben, Koppelow aus demselben Grunde nach Berlin und von da nach Schweden. Adolf Friedrich vertraue - schließt dann die Eingabe -, der Kaiser werde ihn wider solche augenscheinlich gegen ihn andringende Gemalt mit nachdrücklicher Hülfe versorgen und ein abermaliges, ganz ernstliches Dehortatorium an Friedrich Wilhelm erlassen. Daß er, Adolf Friedrich, Hülfe in Schweden suche, sei ungegründet, er habe nur nach Koppelows Abreise ebenfalls einen seiner Diener dorthin geschickt, um sein Interesse wider Koppelows Gesuch beobachten zu lassen.
Ueber diese Eingabe beschloß der Reichshofrath d. 22. November dem Kaiser ein Gutachten zu erstatten. Als Diettrich davon erfuhr, beeilte er sich, seinen Prinzipal gegen diesen neuen Angriff zu vertheidigen in einer Zuschrift, die auf sein Gesuch dem Gutachten vom 22. angeschlossen wurde. Diettrich führte darin aus, Friedrich Wilhelm habe alles gethan, um die Sache intra parietes abzumachen, dies habe aber nicht mehr gefruchtet, als daß man sich von dem Kaiserlichen hohen Gerichte ex desperatione causae abgewendet und den König von Schweden zum Vermittler erwählt habe. Friedrich Wilhelm habe deshalb, nachdem er seine Absicht Dänemark, Brandenburg und Celle,


|
Seite 292 |




|
auch Güstrow mitgetheilt, einen Expressen nach Schweden geschickt, um dem König mündlich sein Recht darzulegen und, weil Adolf Friedrich schon vor 1 1/2 Jahren seine Sache durch Einsendung einer großen Deduktionsschrift vor den Reichshofrath gebracht habe, den König zu ersuchen, sich vor der Hand nicht einzumischen. Adolf Friedrich habe dagegen in Schweden die - beigelegten - unbilligen Forderungen vorlegen lassen; da er aber bemerkt habe, daß "die angeborene große Aequanimitaet" des Königs von Schweden so unmögliche Begehren nicht zulasse, wende er sich nun wieder nach Wien und vermeine mit ungegründeten Querellen Friedrich Wilhelm an diesem höchsten Tribunal zu verunglimpfen. Bützow sei deshalb mit mehr Mannschaft besetzt, damit es nicht, wie im letzten pommerschen Kriege, bald von diesem, bald von jenem überrumpelt, ja von dem Fürstlichen Gegner selbst, der laut anliegender Forderungen "so großen Appetit dazu bekommen", weggenommen werde. Noch einmal wird dann die Anschuldigung, Friedrich Wilhelm habe Kriegshülfe bei in= und auswärtigen Mächten gesucht, als unwahr zurückgewiesen, der Lübecker Vertrag beweise sein friedliebendes Gemüth. Der Kaiser wird also gebeten, einen gelinderen Weg zur Beilegung der Sache einzuschlagen, besonders da Friedrich Wilhelm seine Gerechtsame binnen Kurzem durch Druckschriften dem Kaiser und der ganzen Welt vor Augen zu stellen Willens sei.
Die kaiserliche Entscheidung erfolgte den 11. Dezember im Sinne dieser Schweriner Eingabe. Es ward nämlich dem Bischof von Lübeck sammt dem Herzog von Güstrow ein Kommissorium aufgetragen zur Stiftung eines gütlichen Vergleiches, jedoch unter der Bedingung kaiserlicher Ratifikation desselben. Beide streitende Theile erhielten die Anzeige hiervon mit der Aufforderung, sich der Kommission zu unterwerfen und überhaupt sich allein an den Kaiser zu halten und sich aller anderweitigen Anstalten zu entäußern.
Unverkennbar war die Spitze dieser Worte gegen Schweden gerichtet. Auf die schwedische Vermittelung war man in Wien in offizieller Form zuerst durch eine Relation des kaiserlichen Gesandten in Kopenhagen, v. Reichenbach, datirt vom 2. August, aufmerksam gemacht, die den 13. August im Reichshofrath vorgelegt wurde. Es sei im Nieder=Sächsischen Kreise ein schwerer Successionsstreit zu besorgen, der leicht zu einer höchst schädlichen Flamme ausschlagen könne, da von den beiden nordischen Kronen Dänemark dem Hause Schwerin geneigter sei, Schweden aber


|
Seite 293 |




|
eine andere Intention habe, von anderen benachbarten Fürsten zu schweigen. Schweden habe sich vergebens bemüht, die Sache in Güte abzuthun, allem Anscheine nach würden nächstens von beiden nordischen Kronen Bevollmächtigte nach Meklenburg gesandt werden. 1 ) Reichenbach urtheilt, daß "nicht allein der Kais. Maj. allerhöchsten respect und Reichsoberhaubtlichen authoritaet gemäß, sondern auch dem Interesse garnicht zuwieder seye, von Einer solchen importanz Sach zwischen Fürstlichen Reichsgliedern nicht ausgeschloßen zu seyn, sondern vornehmlich dabey zu concurriren und dasjenige hiebey beobachten zu laßen, was für Kayserl. Maj. und dem Teutschen Vaterland ersprießlich."
Diese Relation hat vermuthlich den ersten Anstoß zu der Entscheidung vom 11. Dezember gegeben. Herzog Gustav Adolf war durch dieselbe unangenehm überrascht, obgleich ihm die Ehre der Theilnahme an der Kommission zugedacht war; er hätte die Fortdauer der schwedischen Vermittelung den Kommissionsverhandlungen unter Wiens Aspekten entschieden vorgezogen.
Auch der Schweriner Bevollmächtigte in Wien, Rath Schnobel, war nicht ganz zufrieden und überreichte, ohne erst in Schwerin anzufragen, den 17. Dezember dem Reichs=Vizekanzler Grafen Windischgrätz eine Eingabe, in der er gegen die Adjunktion Gustav Adolfs Bedenken erhob, da dieser als Schwiegervater Adolf Friedrichs in der Streitsache Partei sei. Allein eine sofortige Beschwerde Gustav Adolfs, der durch seinen Gesandten Pommer Esche umgehend von Schnobels Verfahren Nachricht erhielt, sowie die Befürchtung, daß man sich mit diesem ganz überwerfen könnte, erwirkte am Schweriner Hofe die schleunige Desavouirung von Schnobels eigenmächtigem Verfahren. Dieser zog seine Eingabe zurück, die überhaupt noch nicht an den Reichshofrath gelangt zu sein scheint, wenn sie nicht etwa nachträglich aus den Akten getilgt ist, und reichte eine andere d. 18. Januar und eine ähnliche d. 21. Januar 1695 ein, beide mit der Erklärung, daß Friedrich Wilhelm sich die Adjunktion des Herzogs Gustav Adolf zu der Kommission nicht zuwider sein lasse.
Ein wohlüberlegter Schachzug der Schweriner war es, daß sie in denselben beiden Eingaben die Bitte aussprachen, zu desto schleunigerer Beförderung der Sache den kaiserlichen Gesandten beim Niedersächsischen Kreise, Grafen Eck, 2 ) noch in die Kommission


|
Seite 294 |




|
zu deputiren. Am Wiener Hofe konnte es nur angenehm berühren, daß auf diese Weise der Kaiserhof noch unmittelbarer auf den ganzen Verlauf der Verhandlungen Einfluß gewann, und in Schwerin hoffte man mit Grund, den Grafen unschwer ins Schweriner Interesse ziehen zu können. Trotz heimlicher eifriger Gegenarbeit der Güstrower kam d. 18. Februar das Conclusum zu Stande, daß Graf Eck der Kommission beigefügt werden solle, in der ihm nun als dem Vertreter des Kaiserhofes naturgemäß der Vorsitz zufiel. 1 )
Am Tage vorher, d. 17. Februar, übergab Koch im Namen Adolf Friedrichs eine Rechtfertigung gegen das Reskript vom 28. Juli 1694 mit angeschlossener Bitte um ein gleiches Rescriptum inhibitoriale an Ritter= und Landschaft, daß sie sich Friedrich Wilhelm nicht verbindlich mache, und an Friedrich Wilhelm, daß er sich aller Thätlichkeit enthalte. Diettrich antwortete d. 1. März hierauf mit dem Antrage, diese Zuschrift überhaupt von den Akten zu verwerfen, unter Berufung auf § 79 des jüngsten Reichsabschiedes: "Daß alle narrata Supplicae etlichermaßen glaubhafft bescheinigt werden sollen; damit der Referent in erkennung der Processen. nicht malitiöse hintergangen werden möge." Und als er das nicht erreichte, ließ er d. 17. März eine Eingabe folgen "pro declinando dehortatorio", der zur Information eine von Schnobel verfaßte Brevissima Solutio quaestionis, cui Principum Suerinensium post obitum. Dni. Ducis Gustroviensis Gustavi Adolphi de Jure competat apprehensio possessionis Ducatus Gustroviensis", beigefügt war, die erste Schrift, in der der Schweriner Rechtsstandpunkt dem Wiener Hof dargelegt ward.


|
Seite 295 |




|
Gustav Adolfs Gesuche um Interimsverordnung und Protektorium.
Noch in demselben Monat kam ein neuer Güstrowscher Antrag vor den Reichshofrath, dessen Vorgeschichte bis in das erste Drittel des Jahres 1694 zurückreicht. Am 26. April dieses Jahres hatten nämlich die Landräthe beider Herzogthümer ein Schreiben an Gustav Adolf wie auch Friedrich Wilhelm gerichtet und darin auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die es habe, wenn Gustav Adolfs Nachfolger noch ungewiß sei; beide Herzöge möchten doch nicht ermüden in ihren Bestrebungen, die Sache in Frieden zu schlichten. Beide beriefen darauf die Landräthe, jeder die seiner Landeshälfte, zu einer Besprechung in ihre Residenz. Von den beiden Konferenzen ist die Güstrower, die bereits am Tage nach Abgabe des Schreibens, d. 27. April, stattfand, bemerkenswerth. Die Landräthe riethen nämlich darin dem Herzog, er möge sich an den Kaiser mit der Bitte wenden, eine Provisional=Verordnung ad interim ergehen zu lassen, wie es nach des Herzogs Tod gehalten werden solle, bis der Streit entschieden sei. Was sie meinten, erläuterten sie in einem Schreiben vom 28. April genauer dahin: Gustao Adolf möge ein Kaiserliches Mandat an beide streitende Theile erwirken, bis zum Austrag der Sache weder vi noch alio modo sich des Fürstenthums anzumaßen, sondern alles in statu quo zu lassen, die Regierung aber durch die Güstrower Räthe nach des Herzogs noch bei seinen Lebzeiten zu treffender Verordnung so lange fortsetzen zu lassen, bis die kaiserliche Entscheidung gefallen; die gütlichen Verhandlungen könnten daneben fortgesetzt werden.
Der Gedanke fiel bei Gustav Adolf, den, je mehr seine Leibesschwachheit zunahm, desto stärker die Sorge bedrückte, was aus seinem Lande werden würde, wenn es nicht gelänge, den Streit bei seinen Lebzeiten zu schlichten, auf fruchtbaren Boden. Er ging freilich nicht sogleich darauf ein, weil er damals noch von der schwedischen Vermittelung guten Erfolg hoffte, aber schon den 24. August 1694 schrieb er an Mumme nach Schweden, er werde sich beim Kaiser um "ein remedium provisionale bewerben." Und zwar entschloß er sich, um womöglich dem befreundeten Schweden eine führende Stellung hierbei zu gewinnen, diese Interims=Regierung in der Form nachzusuchen, daß seiner Gattin die Regierung übertragen und Schweden mit der "Manutenenz" derselben betraut werde. Im Oktober mußte Mumme in Schweden anfragen, ob der König bereit sein werde, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Er erhielt die Antwort, daß der König, falls er vom Kaiser einen solchen Auftrag erhalte, allerdings ihn


|
Seite 296 |




|
übernehmen werde. So erhielt denn Pommer Esche in Wien den Auftrag, die nöthigen Schritte einzuleiten, und der schwedische Geschäftsträger ward angewiesen, auch in dieser Sache ihm zur Hand zu gehen.
Den 2. November übergab Pommer Esche ein Memorial mit dem betreffenden Antrage an den Kaiser. Er fand indessen begreiflicher Weise wenig entgegenkommen: die Interims=Regierung unter Schwedens Schutz war für den Wiener Hof unannehmbar. Sie mußte bei allen interessirten Mächten, wie auch in Wien selbst, die Besorgniß erwecken, daß sie nur die Ueberleitung bilden werde zur völligen Annexion des Landes durch Schweden. Mindestens war anzunehmen, daß Schweden für diesen Dienst irgend einen Lohn, und wenn es auch nur Rostock war, verlangen werde. Man zog in Wien zunächst die Sache hin und ließ das Memorial ohne Antwort. Im Januar berichtete Pommer Esche (Rel. 355 ohne Datum), der Kaiser habe gemeint, die Provisional=Verordnung sei unnöthig, da zu hoffen sei, daß die Kommission den Zwist in Güte schlichte, reichte aber doch den 31./21. Januar ein zweites Memorial ähnlichen Inhalts ein.
Darauf gesellt sich zu der Bitte um eine Interims=Verordnung die um ein kaiserliches Protektorium, d. h. einen Schutzbrief, durch den der Kaiser die Gemahlin Gustav Adolfs und seine Kinder mit dem, was ihnen zugehörte, sowie alle Räthe und Bediente des Herzogs und seine gesammte Hinterlassenschaft gegen alle Gewaltthätigkeit in seinen besonderen Schutz nehmen sollte. Den 9. März (a. St.) schreibt Pommer Esche, er habe das Gesuch um das Protektorium erhalten und übergeben. Von dem Abschlag der Provisional=Verordnung hatte er schon den 19. Februar berichtet. Er giebt in dieser Relation (vom 19./2.) eine Aeußerung des Reichs=Vizekanzlers wieder, durch welche der Standpunkt des Wiener Hofes scharf und deutlich charakterisirt wird: "Man wüßte, daß Schweden vormahls wegen Mecklenburg ins römische Reich zuerst gekommen, daher denn wohl recht kindisch seyn würde, wenn man zu dergleichen Kriegesfeuer, welches zu löschen es so viel Bluts gekostet, selbst wiederum neue Gelegenheit veranlaßen und befördern wolle." Vergebens bemühten sich der schwedische Gesandte, Graf Gabriel Oxenstierna, ein Bruder des Kanzlers, und Pommer Esche, dieses Vorurtheil zu zerstreuen. Man erwiderte, selbst bei guter Absicht Schwedens sei die Eifersucht der übrigen Mächte zu befürchten, und rieth die Kommission zu beschleunigen. Eine Interims=Verordnung über die Regierung in Güstrow, wie sie Gustav Adolf aus


|
Seite 297 |




|
landesväterlicher Fürsorge dringend wünschte, war also, wenn überhaupt, so jedenfalls nur ohne die schwedische Manutenenz zu erhalten. So entschloß sich denn Gustav Adolf, diese fallen zu lassen und schrieb den 22. Februar an Pommer Esche, er möge die Manutenenz dem Kaiser selbst anheimstellen.
Der kaiserliche Sekretär Connsbruck war es, der gesprächsweise, wie Pommer Esche den 9. März berichtet, den Vorschlag machte, man möchte doch den Auftrag, die Interims=Regierung zu schützen, an die gesammten kreisausschreibenden Fürsten (Schweden, Lüneburg=Celle und Brandenburg) richten. Der schwedische Gesandte, der zugegen war, erklärte sogleich, dieser Vorschlag werde für seinen König wohl annehmbar sein. Pommer Esche erbat also entsprechende Instruktion.
Zur Beförderung der Sache suchte Graf Oxenstierna sogar den englischen und spanischen Botschafter zu veranlassen, die Provisional=Verordnung dem Kaiser zu empfehlen, unter Hinweis auf die schweren Wirren, die zu befürchten seien, wenn nicht rechtzeitig vorgebaut werde.
Das Datum des 20. März trägt der Entwurf zu dem Antwortschreiben an Pommer Esche auf dessen Relation vom 9. Das Konzept zeigt eine ältere Fassung, die Manutenenz möge dem gesammten Niedersächsischen Kreisausschreibe=Amt übertragen werden, also allen drei Kreisdirektoren. Allein Brandenburg, das mit Schwerin so befreundet war, erregte Bedenken, und so setzte man an die Stelle des "Kreis=Ausschreibeamtes" "die beiden kreisausschreibenden Fürsten", also Schweden, welches zur Zeit das Directorium, und Lüneburg, welches das Condirectorium hatte, mit Uebergehung von Brandenburg, in dessen Händen das Directorium pro nunc cessans lag. In dieser Fassung ging das Reskript ab.
Während so Interims=Verordnung und Protektorium von Güstrow aus eifrig betrieben wurden, suchte man die Kommission vom 11. Dezember, deren Beschleunigung vom Kaiserhofe gewünscht und auch von Schwerin nachgesucht ward, hinauszuschieben, da ihre Zusammensetzung für Adolf Friedrich zu ungünstig erschien. Es bot sich dazu ein sehr ausgiebiges Mittel. In den Dekreten vom 11. Dezember war nach der in der Reichskanzlei herrschenden Gepflogenheit, daß geistliche Reichsfürsten den Vorrang vor weltlichen hatten, die sich auch auf die im Westphälischen Frieden anerkannten evangelischen Inhaber katholischer Bistümer, wie den Bischof von Lübeck übertragen hatte, der Name des Bischofs von Lübeck vor den des Herzogs Gustav Adolf gestellt, während in Kreis=


|
Seite 298 |




|
angelegenheiten der Güstrower Herzog den Vorrang vor dem Bischof von Lübeck hatte. In der Umstellung, infolge deren der Bischof überhaupt in den Kommissionsverhandlungen den Vorrang vor dem Herzog erhalten mußte, sah Herzog Gustav Adolf eine schwere Beeinträchtigung seiner reichsfürstlichen Stellung, eine Schmach für ihn selbst, seine Nachfolger wie den gesammten weltlichen Fürstenstand und verlangte, indem er einen Irrthum der kaiserlichen Kanzlei annahm, neue Ausfertigung der Dekrete mit der richtigen Folge der Namen.
In der kaiserlichen Kanzlei wies man die Möglichkeit eines solchen Irrthums weit ab und berief sich auf den geltenden Usus, auch der Bischof erklärte, die Präcedenz nicht aufgeben zu können. Ein monatelanger Briefwechsel zwischen Güstrow und Eutin sowohl unter sich wie mit Graf Eck entspann sich, in dem die beiden nahverwandten und persönlich befreundeten Fürsten bei allen Versicherungen gegenseitiger Achtung und Zuneigung doch ihren Standpunkt mit großer Schärfe festhielten und verfochten. Dadurch bot sich allerdings für Schwerin eine Handhabe, Güstrows Stellung in Wien, die ohnehin keine starke war, noch weiter zu schwächen, indem man unter Betheuerung der eigenen guten Gesinnung Güstrow beschuldigte, es hintertreibe absichtlich die Kommissionsverhandlungen, damit bei Gustav Adolfs Tod Adolf Friedrich mit Schwedens Hülfe das Land an sich reißen könne. Andererseits erhielt Strelitz durch diese Verzögerung Gelegenheit zu einem Versuche, eine günstigere Zusammensetzung der Kommission zu erwirken. Den 11. April ward eine Eingabe von Koch vorgelegt mit der Bitte, das Haus Wolffenbüttel der Kommission noch beizufügen. Den 14. April erfolgte über alle diese Dinge das Votum an den Kaiser, und den 21. April die kaiserliche Entscheidung. Der Kaiser läßt es bei der Kommission bewenden; wenn aber etwa einer der Kommissare Bedenken trage, sich der Kommission zu unterziehen, sollen die übrigen zwei sie fortsetzen. An Graf Eck ward ein kaiserliches Schreiben für Gustav Adolf gesandt, in dem diesem mitgetheilt ward, falls er dem Grafen Eck in Kaisers Namen eine Eventualhuldigung von seinen Räthen, auch Ritter= und Landschaft leisten lasse und die auf den Kaiser eidlich verpflichteten Garnisonen der kreisausschreibenden Fürsten sammt dem kaiserlichen Kommandanten einnehme, so sei der Kaiser geneigt, die Regierung in Güstrow nach Gustav Adolfs Tod durch dessen Räthe in Seinem Namen führen und denselben zu solchem Zwecke ein Protektorium ertheilen zu lassen, wobei auch seine Gemahlin die Sicherheit ihrer Witthumsforderungen


|
Seite 299 |




|
finden könne; er müsse aber die schwedische Garnison aus Güstrow entfernen. Zwei andere Schreiben gingen an Friedrich Wilhelm und Adolf Friedrich mit der Aufforderung, ihre Abgesandten aus Schweden zurückzurufen und nur an die kaiserliche Entscheidung sich zu halten. Daß sie Erfolg hatten, ist bereits erzählt worden. Ohne Erfolg blieb aber die Mahnung, die Schweden zu entlassen, obgleich fortdauernd der Kaiserhof hierauf den höchsten Werth legte. Oben mit Rücksicht auf das Verbleiben der Schweden im Güstrowschen hatte der Kaiser, wie der Schweriner Rath Vermehren Ende April von dem brandenburgischen Kanzler hörte, dem Reichshofrath durch den Reich=Vizekanzler Grafen Windischgrätz einen Verweis ertheilen lassen, daß er so langsam in so gefährlicher Sache verfahre und nicht stärker durch wiederholte Befehle in Güstrow dringe, die Schweden wegzuschaffen.
Fast am selben Tage, wo in Wien diese Entscheidung fiel, wurde in der Heimath das kaiserliche Mahnschreiben vom 28. Juli 1694 durch einen Schweriner Reiter in Güstrow übergeben. Aus Gustav Adolfs Ansuchen um Provisional=Verordnung meinte man nämlich in Schwerin schließen zu sollen, daß er Friedrich Wilhelms Recht auf den Besitz seines Landes nicht anerkenne, wovon man bisher keinen deutlichen Beweis hatte. Auch hatte Graf Eck geäußert, man sei in Wien erstaunt, weshalb es so lange zurückgehalten werde. Friedrich Wilhelm glaubte sich deshalb der bisher geübten Rücksicht entbunden. Die Uebergabe des Schreibens fand wieder einen Reflex in Wien, insofern der Güstrower Anwalt Fabricius auf Geheiß seines Herrn beim Reichshofrath eine Exceptio sub- et obreptionis einreichen mußte, die unter dem 22. Juni in den Akten des Reichshofraths verzeichnet ist, ein Schritt, der indessen ohne Wirkung blieb.
Graf Eck erhielt die Kommissionsdekrete vom 21. April den 20./30. Mai und machte sogleich den Betheiligten Mittheilung davon. Gustav Adolf sandte darauf seinen Geh. Rath v. Scheres nach Hamburg, der in den Tagen vom 4. bis 7. Juni fünfmal mit Eck verhandelte. Der Graf zeigte sich schon hier nach Scheres' Bericht im Allgemeinen als Anhänger der Kombination. Es sei, äußerte er, dem Lande und der Familie wohl zuträglicher von einem Herrn regiert zu werden, weil die Theilungen sehr die Kräfte verminderten. Ueber die Interims=Verwaltung sprach er sich im Auftrage des Kaisers und im Einklang mit dessen Schreiben vom 21. April dahin aus, daß der Kaiser der Herzogin=Wittme in keinem Falle die Interims=Verwaltung übertragen werde, er werde aber auch keine Verordnungen wegen Manu=


|
Seite 300 |




|
tenenz auf die kreisausschreibenden Fürsten ergehen lassen, so lange noch die Schweden im Lande ständen. Ein Protektorium sei unnöthig, da Schwerin sich zu allem Guten erbiete, könne auch keine Kraft haben, so lange die Schweden allein im Lande wären. Erst wenn sie entfernt oder - dies stand in dem kaiserlichen Brief noch nicht - ebenso viele Lüneburger aufgenommen wären, werde ein Protektorium ertheilt werden.
Auch wegen der Präcedenz wurde zwischen Eck und Scheres verhandelt, ohne Erfolg, was den Grafen nicht abschreckte, seine Bemühungen, einen der beiden Theile zum Nachgeben zu bewegen, fortzusetzen. In einem Brief an Scheres vom 25. Juni/5. Juli schrieb er, der Kaiser könne sich nicht an die Gewohnheiten der Kreistage binden, sondern folge dem sonst üblichen Reichs=Stil und =Rang, schlug aber vor, der Eutinische Minister möge bei ihm selbst logiren; dann könne dem Güstrowschen von beiden als einem Gaste unbeschadet des Eutinischen Präcedenzvorrechtes der Vorrang eingeräumt werden. Auch hiermit war man in Güstrow nicht zufrieden. Unter diesen Umständen mußte die Beschuldigung, die Schwerin gegen Güstrow erhob, daß es die Kommission absichtlich in die Lange zu ziehen suche, als begründet erscheinen. Auch ein Schreiben der Landräthe vom 23. Juli, die Gustav Adolf noch einmal die gütliche Beilegung des Streites ans Herz legten und ihn ersuchten, doch an der Kommission sich zu betheiligen, 1 ) brachte keine Aenderung seiner Auffassung zu Wege.


|
Seite 301 |




|
In offizieller Form kam sein Anspruch auf Umstellung der Namen durch zwei Eingaben von Pommer Esche vor das Forum des Reichshofrathes, die unter den Daten des 5. August und 8. August sich verzeichnet finden. Pommer Esche bat darin um Remedur des Irrthums der kaiserlichen Kanzlei durch Ausstellung eines neuen Kommissionsdekretes, in dem Gustav Adolfs Name vor den des Bischofs zu stellen sei; falls der Bischof hiermit nicht einverstanden sei, möge man die Kommission Gustav Adolf und Eck allein übertragen. Ausschließen könne sich der Herzog von der Kommission nicht lassen, da ad transactionem super successione viventis dessen Konsens erforderlich sei.
Auffallend schnell folgte auch diesmal in Wien die Entscheidung, schon am 9. August. Das Conclusum des Reichs=


|
Seite 302 |




|
hofraths fiel dahin aus, daß Gustav Adolfs Gesuche abzuweisen seien und die Kommission, wenn er nicht nachgebe, von Lübeck und dem Grafen Eck allein fortzusetzen sei; Strelitz sei, falls es sich der Kommission nicht stelle, mit Verlust aller seiner Ansprüche auf Lehen und Eigenthum zu bedrohen. Falls Gefahr sich zeige, solle Graf Eck die Reskripte an die kreisausschreibenden Fürsten, die er im Voraus erhielt, abgehen lassen. Diese Reskripte sind datirt vom 13. August und enthalten die Aufforderung an die Kreisdirektoren, und zwar an alle drei, wenn vor erreichter gütlicher Entscheidung der Tod des Herzogs eintreten sollte, sofort zur Aufrechterhaltung der Ruhe einige Truppenabtheilungen in die Stadt Güstrow zu legen und diese sowohl wie auch die Güstrowschen Räthe und Bedienten im Namen des Kaisers, wenn Graf Eck es wünsche, der sich mit den Kreisdirektoren darüber zu bereden Auftrag habe, in des Kaisers Pflicht zu nehmen und die Administration bis auf weitere kaiserliche Verordnung fortführen zu lassen; der Kaiser werde einen seiner hohen Offiziere senden, um das Kommando zu übernehmen. Brandenburg den beiden andern Kreisdirektoren beizufügen hatte man sich in Wien darum entschlossen, "weil auch der Churfürst von Brandenburg ein merkliches hierunter beytragen könne", etwas deutlicher ausgedrückt, weil man hoffte, mit Hülfe von Brandenburg Schweden besser in Schach halten zu können.
Trotz der Drohung, falls er nicht nachgebe, ohne ihn zu verhandeln, hielt Gustav Adolf in der Präcedenzfrage seinen Standpunkt fest, und da man seiner Mitwirkung nicht wohl entrathen konnte, so entschloß sich endlich der Bischof, auf persönliche Vorstellung des Grafen, nachzugeben, unter der Bedingung, daß der Kaiser die Kommission für eine Angelegenheit des niedersächsischen Kreises erkläre, und daß ihm selbst zugleich durch ein Decretum Salvatorium zugesichert werde, seine Nachgiebigkeit in diesem Falle solle kein Präjudiz für künftige Fälle sein. Den 19. August berichtete Eck dies nach Wien. Den 22. September erfolgte in Wien der zustimmende Beschluß.
Endlich konnten nun die Verhandlungen beginnen; die erste Sitzung ward auf den 30. Oktober in Hamburg angesetzt. Sie fand nicht statt, da Gustav Adolf diesen Tag nicht mehr erlebte.
Gustav Adolfs letzte Anordnungen und Tod.
In zunehmender Leibesschwachheit hatte er den Sommer des Jahres noch überstanden, bald bettlägerig, bald wieder sich er=


|
Seite 303 |




|
holend. Er hatte noch die große Freude gehabt, die Prinzessin Louise, dieselbe, die Friedrich Wilhelm zugedacht war, als Braut des dänischen Kronprinzen zu sehen; auch die Beendigung des Erbfolgestreites zu erleben, war ihm nicht vergönnt.
Vielleicht erfuhr er selbst überhaupt nichts mehr davon, daß Mitte Oktober zwei Schwerinsche Räthe, Löwen und Koppelow, in Güstrow erschienen, um ein Schreiben Friedrich Wilhelms an ihn zu überbringen und noch einmal über die Erbfolge und die Ehe zu verhandeln. Ein Aktenstück, das Koppelow den 10. Oktober von Graf Eck aus Hamburg mitbrachte, in dem zur Vermählung Friedrich Wilhelms mit einer der Töchter Gustav Adolfs gerathen wurde, durch welche Schweden neutral werden würde, rief in Friedrich Wilhelm den plötzlichen Entschluß hervor, noch einmal einen Versuch in Güstrow zu machen, ob durch ein Eheversprechen eine Einigung zu erzielen sei. Den folgenden Tag ließ er durch den Hofrath Taddel in höchster Eile eine Instruktion fertigen für Werbung der jüngsten Güstrowschen Prinzessin. 1 ) Während Taddel sich an die Arbeit machte, ging der Herzog auf die Jagd; nach seiner Rückkehr forderte er sogleich Taddel zu sich und erklärte ihm, "er habe der Ehesache weiter nachgedacht, befände aber sonderliche Unruhe in seinem Gemüth." Er gab dann weiter an, der Entschluß zu dieser Sendung sei ihm erst am Morgen gekommen; er wolle es aber lieber bei dem lassen, was vor acht Tagen im Geheimen Rathe verabredet sei, die Ehesache so lange in statu quo zu lassen, bis Koppelow, der wieder nach Schweden gehen sollte, von dort zurück sei und günstigen Bescheid mitgebracht habe. Taddel mußte ein zweites Schreiben aufsetzen, in dem die beiden Räthe beauftragt wurden, bei dem Güstrowschen Minister v. Ganß es zu unterbauen, wenn jemand anders um die Prinzessin würbe, man möge mit dem Abschluß sechs bis acht Wochen warten, bis Koppelow Schwedens Gesinnung erkundet habe; interessire sich Schweden für Schwerin, so werde diese Heirath unfehlbar zu Stande kommen. Zugleich wurde Koppelow angewiesen, im Falle es mit Gustao Adolfs Krankheit Gefahr habe, in Güstrow zu bleiben und abzuwarten, um eventuell bei der Besitzergreifung mitwirken zu können.
Der Brief ward den 11. Oktober, Abends 6 1/2 Uhr, durch einen Reiter abgeschickt und erreichte auch die beiden Räthe noch unterwegs, sie richteten ihre Kommission aus und erfuhren, daß


|
Seite 304 |




|
die Aerzte stets auf dem Schlosse beim Herzog seien, auch ein Priester sei stets zugegen. Am 13. kam Löwen, am 15. Abends Koppelow zurück; dieser berichtete, er habe das ihm mitgegebene Schreiben an Ganß eingehändigt, dieser aber habe es noch nicht übergeben können. Ob Gustav Adolf es noch erhalten hat, ist nicht bekannt, übrigens war der Inhalt des Schreibens gleichgültig, es enthielt nur die Anzeige, daß Koppelow im Begriffe sei, nach Schweden zu gehen, und die Frage, ob der Herzog ihm vielleicht Aufträge mitgeben wolle.
Von Güstrow brachte Koppelow die nicht unwichtige Nachricht mit, man habe in diesen Tagen den kranken Herzog an die früheren Zusagen erinnert, die er seiner Tochter wegen der Erbfolge ihres Gemahls gemacht (s. o. S. 252); er habe geantwortet, ja, das sei wahr, und habe sich die folgende Nacht sehr unruhig geberdet.
Es ist wahrscheinlich, daß diese Erinnerung mitgewirkt hat, den sterbenden Fürsten, der sich bisher im Ganzen bei dem Streite neutral gehalten hatte, in seinen letzten Lebenstagen ganz auf die Seite seines Schwiegersohnes zu treiben. Im Angesichte des Todes mochten in ihm vor dem Wunsche, die Zukunft seiner Tochter und ihres Gatten nach Kräften sicher zu stellen, alle anderen Rücksichten zurücktreten. Er ließ deshalb zwei Tage vor seinem Tode (d. 24. Oktober) einen Brief an den Kaiser schreiben, in dem er ihn in rührenden und dringenden Worten bittet, seinen Schwiegersohn, der sein rechtmäßiger Erbe sei, sogleich nach seinem Tode in den Besitz des Herzogthums zu setzen. 1 )


|
Seite 305 |




|
Dem Inhalte des Briefes entsprechend, nahm er, ebenfalls in den letzten Tagen vor seinem Tode, seinen Civil= und Militärdienern die eidliche Versicherung ab, keinem der beiden Kom=


|
Seite 306 |




|
petenten zugethan zu sein, vielmehr die kaiserliche Entscheidung abzuwarten. 1 ) Am 26. Oktober verschied er zwischen 10 und 11 Uhr Morgens.
|
Ew. Kays. Maytt.
Allerunterthänigster gehorsamster |
|||
|
Fürst
Gustav Adolph. |
|||


|
Seite 307 |




|
VI.
Das Possessions=Urtheil.
Schritte zur Besitzergreifung des Güstrower Landes durch Friedrich Wilhelm, Adolf Friedrich und die Herzogin=Wittwe.
Am Schweriner Hofe ging es in den Tagen vom 23. Oktober ab recht unruhig zu. Man war hier trotz aller kaiserlichen Inhibitorialia entschlossen, Stadt und Land Güstrow, sobald der Herzog todt sei, in Besitz zu nehmen oder wenigstens das Anrecht des Herzogs auf den Besitz öffentlich kundzuthun; angenommen wurde, daß Adolf Friedrich dasselbe beabsichtige. Da dieser sich in Güstrow befand, so konnten die Schweriner den Vorsprung, den er dadurch hatte, nur durch verdoppelte Schnelligkeit wieder auszgleichen hoffen. Im Voraus waren alle Rollen vertheilt, alle Personen bestimmt, die in die einzelnen Aemter und Städte des Landes gehen sollten, alle Instruktionen bis auf das Datum ausgefertigt. Nur auf rechtzeitige sichere Nachricht von Güstrow kam es an, und diese war, trotzdem man in Güstrow Vertrauensmänner hatte, nicht leicht zu erhalten, da man sich am Güstrower Hofe alle Mühe gab, den wahren Sachverhalt zu verschleiern und das Befinden des Herzogs als günstiger hinzustellen, als es war. Es konnte unter diesen Umständen nicht fehlen, daß widersprechende Gerüchte nach Bützow und Schwerin getragen wurden. 1 ) Den 23. Oktober berichtete Oberstleutnant Schenck aus Bützow, er habe sichere Nachricht, daß Gustav Adolf im Todeskampf liege; er möge wohl schon todt sein. So wurden denn am 24. Oktober, Morgens 4 Uhr, die Geheimen Räthe mit


|
Seite 308 |




|
dem Generalmajor zu Hofe berufen. Den hier getroffenen Verabredungen zufolge reiste Generalmajor v. Francke um 10 Uhr nach Bützow, und eben dorthin wurde Rittmeister Hoffmann mit einiger Mannschaft beordert. Nächst der Hauptstadt Güstrow selbst war Boizenburg mit seinem Elbzoll der wichtigste Ort des Güstrower Herzogthums. Damit Gruppen für seine Besetzung oder menigstens die des umliegenden Amtes zur Hand seien, wurde Leutnant Boulenne nach Dömitz geschickt mit der Ordre, eine Kompagnie von dort ins Boizenburgische zu führen und der in dieses Amt bestimmte Civilbeamte, Amtsverwalter Schultz, der am Nachmittag des 24. ankam, erhielt seine Instruktion des Inhalts, er solle in die Stadt zu gelangen und die Possession dort wie auch aus dem Amte zu ergreifen suchen und versuchen, den kommandirenden schwedischen Offizier durch Versprechungen von Erkenntlichkeit und Beförderung zu gewinnen, daß er die Besitzergreifung nicht hindere. Auch alle Uebrigen, die dazu bestimmt waren, ins Güstrowsche zu gehen, erhielten Befehl, sich bereit zu halten.
Den 25. reiste Oberjägermeister v. Löwen, der in Bützow war, nach Güstrow, um dort Nachricht einzuziehen. Ehe er zurückkam, sandte der Küchenmeister Oldenburg, der von Bützow nach Schwaan vorausgeschickt war, von dort aus Botschaft, daß der Herzog am 24. noch gelebt habe. Dagegen berichtete Abends um 9 Uhr der zurückgekehrte Oberjägermeister, daß der Sterbefall in Güstrow "wohl gewiß" erfolgt sei, und um dieselbe Zeit erhielt die Herzogin, Friedrich Wilhelms Mutter, Nachricht, daß Gustav Adolf so gut wie todt sei. Darauf empfingen die ins Güstrowsche bestimmten Personen ihre Depeschen. Einige Stunden später aber kam ein Schreiben des Generalmajors, der Herzog solle den 25., Morgens, eine geschlossene Kutsche haben anspannen lassen, um auszufahren, was er aber für falsch halte. Da man in Schwerin der gleichen Ansicht war, daß nämlich diese beabsichtigte Ausfahrt eine Finte der Güstrower sei, die den Todesfall noch zu verheimlichen wünschten, um für Adolf Friedrich Zeit zu gewinnen, so wurde die Abreise sämmtlicher Mandatare angeordnet. Den beiden Schweriner Räthen, Beselin und Vermehren, die auf dem gleichzeitig tagenden Landtag zu Sternberg thätig waren, wurde ein Reskript zugefertigt, adressirt an die Güstrowschen und Schweriner Landräthe und Deputirte, das den Befehl enthielt, nach erfolgtem Todesfall in Friedrich Wilhelms Namen allein mit den Landtagsverhandlungen fortzufahren.


|
Seite 309 |




|
Allein am 26. gegen Mittag kam aus Güstro der Geh. Rath v. Lehsten in Schwerin an mit einem Schreiben vom 25., das der Herzog, wenn auch mit zitternder Hand, noch selbst unterzeichnet hatte, und mit dem Vorschlage, vorläufig den Erbfolgestreit in der Schwebe zu lassen. War man auch hierzu nicht geneigt, so erfuhr man doch nun, daß der Herzog am 25. und selbst am 26. Morgens früh noch am Leben gewesen sei somit wurden alle gegebenen Befehle widerrufen und Boten ausgesandt, um die Bevollmächtigten zurückzuholen. Allein es erwies sich als unmöglich, die Leute noch rechtzeitig einzuholen, und da am selben Tage sichere Nachricht einlief, daß der Todesfall wirklich eingetreten sei, 1 ) so ergingen Abends um 6 Uhr neue Befehle, die Kommissionen sofort auszuführen, die noch am Abend nachgeschickt wurden.
Die Instruktionen, die den Sendboten mitgegeben wurden, lauteten dahin, daß sie überall an den Amts= und Rathhäusern Blech=Plakate, die sie bei sich hatten, mit Namen und Wappen Friedrich Wilhelms anzuschlagen und dabei zu erklären hätten, daß sie im Namen des jetzt regierenden Herzogs Friedrich Wilhelm Besitz von Amt und Stadt ergriffen; zugleich sollten sie von den Beamten und Gutspächtern, auch von Bürgerschaften und Magistraten in den Städten den Handschlag der Treue fordern. Wenn sie Adolf Friedrichs Wappen bereits angeschlagen fänden, sei es abzunehmen und die Besitzergreifung von Strelitzischer Seite nach Möglichkeit zu verhindern. Jeder Sendbote erhielt einige Soldaten mit, ein Trupp von 28 Mann wurde noch am 27. nachgeschickt, um zu je 4 auf die Aemter Goldberg, Plau, Broda, Stargard, Nemerow, Fürstenberg und Feldberg vertheilt zu werden.
Von Strelitzischer Seite ist behauptet werden, Adolf Friedrich habe beabsichtigt, sich jeder Besitzergreifung zu enthalten, erst als er (d. 26.) erfahren, daß Friedrich Wilhelm in einem Orte nahe bei Güstrow - es ist Schwaan gemeint - um die Mittagszeit des 26. bereits Besitz ergriffen, habe er sich genöthigt gesehen, zur Bekundung seiner Ansprüche sein Wappen in Güstrow an das Rathhaus anheften zu lassen; darauf aber habe er sich beschränkt. So steht zu lesen in einem Bericht, den Graf Eck den 6. November nach Wien sandte. Die letzte Behauptung, daß


|
Seite 310 |




|
Adolf Friedrich sein Wappen nur in Güstrow habe anschlagen lassen, ist indessen unrichtig, gerade wie die Boten Friedrich Wilhelms durchzogen auch Bevollmächtigte Adolf Friedrichs das ganze Güstrowsche Land und hefteten an alle Amts= und Rathhäuser und auf allen Domanialhöfen sein Wappen an oder versuchten es wenigstens. Möglich ist allerdings, daß die Befehle hierzu erst ausgegeben sind, als man Nachricht hatte, daß die Schweriner bereits am Werke seien, die ja schon vor dem Tode des Herzogs am 26. in der Frühe sich auf den Weg machten. Ob aber Adolf Friedrich wirklich die Absicht gehabt hat, keinerlei Handlung zur Besitzergreifung vornehmen zu lassen, falls Friedrich Wilhelm sich dessen enthalte, mag dahingestellt bleiben.
Beide Herzöge fanden in ihrem Bemühen, ihre Rechte auf den Besitz des Herzogthums zur Geltung zu bringen, Konkurrenz von Seiten der Herzogin=Wittwe. Auf Grund des Geheimvertrages mit Schweden vom Jahre 1690 ergingen von Güstrow aus die betreffenden Befehle 1 ) an den Major v. Claßen, den Führer einer Reiterkompagnie in Demmin, der bereits durch Bielke eingeweiht war. Er überschritt mit seiner Kompagnie die Grenze und sandte sie, in kleine Trupps vertheilt, über das ganze Land hin, nicht nur in alle diejenigen Aemter, aus denen der Herzogin und ihren Töchtern Einkünfte angewiesen, sondern auch in die, deren Einkünfte verpfändet waren.


|
Seite 311 |




|
In vielen Fällen war Adolf Friedrich den Schwerinern zuvorgekommen, so in Malchin, Ribnitz, Marlow, Plau, Goldberg, Friedland, Neubrandenburg, Wesenberg, Tessin, Röbel und Nemerow. 1 ) Ueberall fanden hier die Schweriner schon das Strelitzer Wappen angeheftet, nahmen es ab und ersetzten es durch das Schweriner. In Neukalen ward Friedrich Wilhelms Wappen den 28. Oktober an das Thorhaus angeschlagen. Während darauf in der Stadt mit Bürgermeister und Rath verhandelt ward, kam ein Kammerschreiber Adolf Friedrichs und ließ in aller Stille dessen Wappen an das Amts= wie Rathhaus heften; beide wurden sofort wieder abgenommen und zwei Reiter auf dem Amtshauss einquartirt. Aehnlich ging ess in Gnoien. Hier aber erschien darauf ein sschwedischer Korporal mit zwei Reitern und ließ das Schweriner Wappen vom Amts= wie Rathhauss wieder abreißen. Auss Sülze, Stargard und Wanzka wird berichtet, daß man dort schon Schweden vorgefunden, die nicht gestattet hätten, daß Friedrich Wilhelms Wappen angeschlagen werde. 2 )
Ein Unterschied zwischen dem Verfahren der Strelitzer und der Schweriner lag darin, daß Adolf Friedrichs Boten sich, so viel ersichtlich, überall mit stillschweigender Anheftung seines Wappens begnügten, während die Friedrich Wilhelms dabei einen notariell beglaubigten Akt der Besitzergreifung vornahmen und von den Beamten wie in den Städten den Handschlag der


|
Seite 312 |




|
Treue forderten, der ihnen freilich fast überall unter Hinweis auf das kaiserliche Inhibitorium geweigert ward. 1 )
Bei diesem bunten Treiben ging es nicht ganz ohne Gewaltthätigkeiten ab. Ein Gewaltstreich war es schon, daß Friedrich Wilhelm das Siegel Gustav Adolfs beim Landgericht zu Parchim, dessen Auslieferung von dem Präsidenten und den Richtern verweigert ward, durch einen Korporal fortnehmen ließ (d. 28. Oktober). Schlimmer noch war, daß ein Notar, den Adolf Friedrich nach Boizenburg sandte, um dort Besitz zu ergreifen, unterwegs in Banzkow festgehalten und nach Schwerin gebracht ward, wo er sich übrigens dazu gewinnen ließ, im Auftrage Friedrich Wilhelms mit einem Schreiben an Bürgermeister und Rath nach Güstrow zu gehen. Ein zweiter Notar, den der Geh. Rath v. Scheres im Namen der Herzogin=Wittwe nach Boizenburg sandte, ward ebenfalls von den Schwerinern sistirt.
Auf der anderen Seite wurden einem von Bützow aus nach Gnoien und Neukalen gesandten Boten von einem schwedischen Unteroffizier mit zwei Reitern die Ordre und die Wappen, die er bei sich trug, gewaltsam abgenommen und nach Güstrow gesandt.
Ein kriegerischer Zusammenstoß zwischen den schwedischen und Schweriner Truppenabtheilungen ward, obgleich die Schweden, wo sie in der Mehrheit waren, recht brüsk auftraten,vermieden. Am größten war die Gefahr eines solchen in Schwaan und in Boizenburg. In Schwaan hatte der schwedische Sergeant, der auf das Amt gesandt war, auch einige Leute auf den Bauhof gelegt. Als darauf der schwerinische Rittmeister Hoffmann ihn scharf zur Rede stellte und ihm abzuziehen anbefahl, sandte Major Claßen noch einen Kornet, einen Korporal und 9 Reiter, um sich auf dem Bauhof einzuquartiren,


|
Seite 313 |




|
während auch Hoffmann einen Trompeter und vier Leute ebendort einlogirte, was die Schweden geschehen ließen. Auch jeder andere Domanialhof im Amte Schwaan ward mit Schweden (2 Reitern und 1 Musketier) und je einem Schweriner Musketier zugleich belegt. Man vertrug sich indessen, und es begann ein recht fröhliches, kameradschaftliches Leben. Es wird berichtet, daß auf jedem Hofe von den Soldaten binnen 5 Tagen eine Tonne Bier ausgetrunken sei.
In Boizenburg war es d. 28. Oktober Amtsverwalter Schultz gelungen, von der Thorwache unbeanstandet ins Marktthor zu gelangen. Er ging auf das Amtshaus, wo er in Abwesenheit des Amtmanns Thile, der gerade in die Stadt gegangen war, das Plakat mit Friedrich Wilhelms Wappen anheftete, ward aber darauf mit seinem Notar durch die schwedische Wache zum Thore hinausgeleitet und das wiederabgenommene Wappenblech auf seinen Wagen geworfen. Als darauf die Nachricht von der Annäherung der Schweriner Kompagnie aus Dömitz einlief, setzte man die Garnison in Bereitschaft, verschloß die Thore und ließ auch die Bürgerschaft ins Gewehr treten. Die Schweriner sahen indessen, da sie sich überzeugten, daß die Schweden nicht zu gewinnen sein würden, von jedem Angriff auf die Stadt ab und vertheilten sich zu je 6 bis 10 Mann auf die Meierhöfe im Amte. Schon am 30. erging von Schwerin aus Befehl an Boulenne, nur 1 oder 2 Mann auf jedem Meierhof, wo man Possession ergriffen, zu lassen und mit den übrigen wieder nach Dömitz zu marschiren. Anfang November wurden dann auch Schweden auf die Höfe hinausverlegt, doch ohne daß daraus Streitigkeiten entstanden.
Die Einsetzung der Provisionalregierung.
Während überall im Lande bis in den November hinein diese Szenen der konkurrirenden Besitzergreifung spielten, hatten die Verhältnisse in Güstrow selbst schon seit dem 27. eine andere Gestalt gewonnen. Die Güstrowschen Geheimen Räthe waren angewiesen, bei eintretendem Todesfall sich keinem der beiden Prätendenten anzuschließen, sondern auf kaiserliche Verordnung zu warten, die ihnen Graf Eck überbringen werde. Sie verfuhren demgemäß, und obgleich sie nicht hinderten, daß Adolf Friedrich in der Nacht vom 26. zum 27. sein Wappen an das


|
Seite 314 |




|
Rathhaus heften ließ und es auch unangetastet ließen, so gingen sie doch keinerlei Verpflichtung ihm gegenüber ein. 1 )
Graf Eck war am Todestage des Herzogs bereits unterwegs, die Nacht vom 25. zum 26. brachte er in Boizenburg, die folgende in Crivitz zu. Hier hatte er mit den beiden Schweriner Räthen Bünsow und Taddel eine Unterredung, worin er sie auf die kaiserlichen Inhibitorialia verwies, ohne damit Eindruck auf sie zu machen. 2 ) Am Sonntag, den 27., um die Zeit des Morgengottesdienstes kam er in Güstrow an, wo er den 28. die Geheimen Räthe und die Landräthe, die anmesend waren, ver=


|
Seite 315 |




|
sammelte und ihnen die kaiserliche Willensmeinung eröffnete, daß das Geheime Rathskollegium bis zur Entscheidung des Successionsstreites die Regierung im Namen des Kaisers weiter zu führen habe.
Nicht ganz bedingungslos übernahmen die Räthe diesen Auftrag, faßten vielmehr ein Schriftstück ab, in dem sie folgende 12 Forderungen aufstellten: 1. alles in statu quo zu lassen, 2. die Regierung nicht als Sequestration, 1 ) sondern als eine Provisionalregierung einzurichten, 3. der Herzogin=Wittwe, ihren Töchtern, den Räthen und dem Lande ein Protektorium zu ertheilen, 4) der Herzogin zu dem, was ex pactis und sonst ihr zukomme, zu verhelfen, besonders auch zu verordnen, daß ihr nicht zugemutet werde, die Residenz zu verlassen, bis ohne ihre Kosten das Wittthumhaus (Dargun) gebührend eingerichtet sei, 5. die Prinzessinnen des Allods und anderer Ansprüche halber von dem Nachfolger völlig befriedigen zu lassen, 6. das Testament zu bestätigen, 7. die Ueberschüsse zur Abtragung der Schulden, in specie zur restirenden Besoldung der fürstlichen Diener anwenden zu lassen, 8. es in die Wege zu richten, daß die kreisausschreibenden Fürsten den Räthen nichts zumutheten, was dem, was sie jetzt thäten und was ihnen vom Kaiser künftig befohlen werde, zuwiderlaufe, 9) keine Kreis= oder andere Truppen mehr in das Herzogthum einlegen zu lassen, wogegen auch der Abzug der schwedischen Truppen befördert werden solle, 10. den kommandirenden Generalmajor als Kommandanten zu bestätigen, 11. das Güstrowsche Militär zu Pferde und zu Fuß nicht abzudanken, unterzustecken oder außerhalb Landes beordern, sondern im Lande zu lassen und in gutem Stande zu erhalten, 12. das Militär, Offiziere wie Gemeine, vom Lande ohne Beschwerung der Kammer, wie bisher, unterhalten zu lassen.
Durch dieses alles solle, so betheuern die Räthe am Schlusse des Aktenstückes, derjenigen Pflicht, womit ihrem Herrn sie verwandt gewesen, wie auch dem Traktat mit dem König zu Schweden, den er gemacht, nicht präjudicirt werden.
Eck verlangte, als er in diese Forderungen Einsicht genommen, eine Erklärung wegen des Vertrages mit Schweden. Die Räthe gaben sie dahin ab, daß in demselben wider Kaiser und Reich nichts enthalten sei, sondern er nur auf die Wahrung der Ruhe


|
Seite 316 |




|
und Sicherheit in den aneinander grenzenden Ländern beider Fürsten abziele, auch eine Vereinbarung dahin zu wirken enthalte, daß der Herzogin und ihren Töchtern, was ihnen zustehe, ohne Abbruch und Hinderung zukommen möchte. Auf Ecks Versicherung hin, dies alles an den Kaiser berichten zu wollen, von dem er günstige Entscheidung zuversichtlich erhoffe, leisteten die Räthe wie der Kommandant den 30. Oktober ein vorläufiges Handgelübde, die Provisionalregierung übernehmen zu wollen, und erklärten das gleiche in einem Schreiben an den Kaiser vom selben Datum, in dem sie auf die Punkte hinwiesen, die sie Eck übergeben, ebenfalls noch am 30. wurden die Güstrower Truppen 1 ) (3 Kompagnien) für die kaiserliche Provisionalregierung eidlich in Pflicht genommen.
Den 2. November ward ein Patent erlassen, in dem Graf Eck im Namen des Kaisers den Beamten und Einwohnern des Herzogthums die Uebernahme der Provisional=Regierung durch das Geheime Rathskollegium anzeigte und sie zum Gehorsam gegen dieselbe aufforderte. Nirgends im Lande erhob sich Widerstand oder Widerspruch, überall ward der verlangte Treueid willig geleistet. Die Aufgabe des Grafen war allerdings hiermit noch nicht gelöst, es lag ihm noch viererlei ob, einmal die Verhandlungen wegen der von den Räthen gestellten 12 Bedingungen zu beendigen, zweitens die beiden Herzöge zu veranlassen, daß sie ihre zur Ergreifung der Possession gethanen Schritte rückgängig machten, sich der Entscheidung des Kaisers unterwürfen und, wie dieser es wünschte, die Hamburger Vermittelungs=Kommission beschickten, drittens die Entfernung der Schweden aus dem Lande zu erwirken, wozu die Sicherstellung der Ansprüche der Herzogin=Wittwe und ihrer Töchter die Voraussetzung bildete, und viertens zu verhüten, daß die Kreisdirektoren jetzt noch Truppen in das Land einrücken ließen. Die Aufforderung, die hierzu d. 15. August ergangen war, hatte einen bedingten Wortlaut, ihre Ausführung erschien jetzt unnöthig, da sich der Uebergang der Regierung in die Hände des kaiserlichen Bevollmächtigten ohne jede Schwierigkeit vollzogen hatte. Das Einrücken von Kreistruppen erschien unter diesen Umständen als eine unnütze Belastung des ohnehin so arg verschuldeten und zerrütteten Landes; auch mußte es eine entschiedene Stärkung des Ansehens des Kaiserhofes in Deutschland bedeuten, wenn es ihm gelang, ganz aus eigener Machtvollkommenheit ohne Hülfe


|
Seite 317 |




|
der Kreisdirektoren den bedrohten Reichsfrieden an der für Wien so entlegenen Nordgrenze zu wahren und das erledigte Reichsland über das Zwischenstadium bis zur Schlichtung des Streites, die ebenfalls unter unmittelbarer Leitung und unter Mitwirkung des Kaiserhofes zu erfolgen hatte, hinüberzuführen. Somit schrieb Graf Eck sogleich nach Konstituirung der Provisionalregierung an alle drei Kreisdirektoren und ersuchte sie, keine Truppen zu senden, da sie unnöthig seien, und der in Berlin weilende Güstrowsche Legationsrath v. Calnein erhielt Weisung, am Berliner Hofe in demselben Sinne zu wirken.
Daß freilich die Kreisdirektoren eine ganz andere Auffassung von jenem kaiserlichen Reskript hegten, hatten sie in Schwerin unmittelbar nach Empfang der Todesanzeige durch Vernstorff kundgeben lassen, der in einem Schreiben vom 28. Oktober im Namen der drei betheiligten Regierungen dem Herzog Friedrich Wilhelm notifizirte, daß ihnen die Sequestration des erledigten Güstrowschen Landes übertragen sei.
Von den Antworten der Kreisdirektoren auf Ecks Schreiben ist die Georg Wilhelms von Celle im Schweriner Archiv erhalten. Sie macht aus dessen Unzufriedenheit kein Hehl: "Es wäre," heißt es, "zu wünschen gewesen, wan diese sache etwas zeitiger durch diensame mittel praepariret - were. Bei jetzigem Zustande sei das Werk schwerer geworden, und ohne vorgängige Communication mit den übrigen Directoren. schwerlich etwas mit gutem effect auszurichten." Die leitenden Mächte des Kreises zeigten sich also keineswegs geneigt, sich jedes Einflusses auf die Erledigung des Streites wie die zu treffenden vorläufigen Maßregeln zu begeben; ein Konflikt zwischen dem Kaiserhof und den Kreisdirektoren war im Anzuge, der allerdings erst im Beginn des folgenden Jahres akut ward. 1 ) Für Brandenburg und Celle kam noch in Betracht, daß noch immer schwedische Truppen im Güstrowschen standen. Sie ließen deswegen schon in den ersten Tagen des November in Güstrow erklären, falls diese nicht entfernt würden, so würden sie genöthigt sein, die gleiche Anzahl von ihren Truppen ins Land zu legen.
Am Schweriner Hofe herrschte zuerst Neigung, sich an die kreisausschreibenden Mächte anzuschließen, von denen ja zwei Schwerin nicht abgeneigt waren und die dritte eben mit Hülfe der zwei andern wohl am leichtesten in Schach zu halten war.


|
Seite 318 |




|
Friedrich Wilhelm beantwortete deshalb das Schreiben Bernstorffs durch Absendung des Rathes Vermehren an Bernstorf den 1. November mit einem Memorial, in dem darauf gedrungen wurde, daß keinem der drei Kreisdirektoren besondere Befugnisse eingeräumt, vielmehr die schwedischen Truppen weggeschafft würden, und daß die Interims=Regierung mit Vorwissen und Einwilligung Friedrich Wilhelms eingerichtet und keine verdächtigen Personen dabei gebraucht würden; auf diese Bedingungen hin sei der Herzog erbötig, was er in Besitz genommen, den Sequestratoren zu übertragen, doch müsse auch Adolf Friedrich sich ebenfalls aller vermeintlich ergriffenen Possession begeben.
Wenn dieses Memorial noch am 1. November hat unterzeichnet werden können, obgleich man in Schwerin schon den 31. durch den nach Güstrow gesandten Oberstallmeister v. Bibow Kenntniß von der am 30. in Güstrow vollzogenen Eidesleistung hatte, so muß man daraus schließen, daß man in Schwerin im ersten Augenblick von einem Anschluß an die Kreisdirektoren sich mehr Vortheil versprach, als von einer sofortigen Anerkennung der neuen Güstrower Regierung. 1 ) Indessen stellte sich schon im November ein Einvernehmen zwischen Graf Eck und Schwerin her, in Folge dessen man in Schwerin die Verhandlungen mit den Kreisdirektoren abbrach und sich jeder Parteinahme in der sich herausstellenden Meinungsverschiedenheit zwischen diesen und dem Kaiserhofe über die Sequestration enthielt.
Graf Eck soll, wie sein Sekretär im Dezember Varenius erzählte, Anfangs von der Strelitzer Herrschaft sehr eingenommen gewesen sein, wozu besonders beigetragen, "daß Herr Gutzmer ihm eine tiefe Reverenz mit einem Beutel voll rother Dinge gemacht" habe, allein bald darauf, und wie Herr John aus Eutin nach Güstrow gekommen, habe sich das Blatt gewandt, und er habe demnächst den Gutzmer zu verschiedenen Malen "verteufelt hart angefahren", auch seien seine Briefe nach Wien ganz anders eingerichtet gewesen. Hierzu stimmt, daß Graf Ecks erster Bericht nach Wien, von dem oben die Rede war, entschieden Voreingenommenheit gegen Schwerin zeigt, die später nicht wieder zu bemerken ist.


|
Seite 319 |




|
Die erste Beziehung zwischen dem Schweriner Hofe und dem Grafen Eck nach Gustav Adolfs Tode stellte Bibom her, der schon am Todestage des Herzogs nach Güstrow ging, um der Herzogin Friedrich Wilhelms Beileid zu bezeugen. Er erhielt Anweisung (d. 30. Oktober), dem Grafen mitzutheilen, wodurch Friedrich Wilhelm bewogen werden, Possession im Güstrowschen zu nehmen, und um Verfügung zu ersuchen, daß Adolf Friedrich die Residenz verlasse und seine daselbst angehefteten Wappenschilder wieder abnehmen lasse. Den 1. November lief ein Schreiben des Grafen ein mit der Anzeige, daß eine kaiserliche Provisional=Regierung konstituirt sei. Es werde im Interesse Friedrich Wilhelms liegen, wenn er von der Possession abstehe und die Sache schlechterdings Kaiserlicher Verordnung anheimstelle. Man möge sich wegen der gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit der Interims=Regierung in Verbindung setzen und auch die im Güstrowschen liegenden Soldaten abberufen; es solle dann mit den von Adolf Friedrich einquartirten ebenso gehalten werden. Darauf ward den 4. November zunächst Varenius an Eck gesandt mit der Versicherung, daß Friedrich Wilhelm sich fügen werde. Und auch Adolf Friedrich gab schon Anfang November die gleiche Erklärung ab. Die Einigung ward dadurch erleichtert, daß die Provisional=Regierung sich beeilte, der Herzogin=Wittwe beruhigende Zusicherungen wegen ihrer Witthumsforderungen zu geben, auch das kaiserliche Protektorium ihr übergeben ward und sie daraufhin nicht nur den 7. und 9. November dem Major Classen mit seinen Leuten den Abzug aus dem Lande anbefahl, sondern auch schon den 4. November in ihrem Namen durch die Geheimen Räthe ein Schreiben an den König von Schweden absenden ließ, worin sie um Abberufung aller schwedischen Truppen, der in Güstrow wie der in Boizenburg liegenden, ersuchte. 1 )
Den 14. November bekam Eck eine Staffette aus Wien mit dem ernstlichen Befehl, beide Kompetenten noch vor eintreffen der "scharfen kaiserlichen Mandate" dazu zu veranlassen, daß sie ihre ver=


|
Seite 320 |




|
meintlichen Besitzrechte dem Kaiser allein überließen, wie auch der Kaiser in der Interims=Regierung sich Niemanden an die Seite treten lassen werde; die Vermittelungskommission solle fortgesetzt werden. Auf Grund dieses Befehls setzte sich Graf Eck sofort mit dem Bischof von Lübeck in Verbindung, und beide erließen den 18. November ein Schreiben, worin sie den beiden Herzögen von der Kaiserlichen Willensmeinung Mittheilung machten und die erste Kommissionssitzung auf den 13. Januar 1696 in Hamburg festsetzten.
Friedrich Wilhelm hatte schon den 19. November durch Vermehren, den er an den Grafen gesandt, seine guten Gesinnungen betheuern lassen und beantwortete das Einladungsschreiben der Kommission den 3. Dezember mit der Versicherung, daß er die Kommission beschicken werde. An demselben 3. Dezember lief in Schwerin ein Kaiserliches Reskript ein, das mit einem ähnlichen an Adolf Friedrich adressirten zu den in Aussicht gestellten "scharfen" Mandaten gehörte. Sie waren mit anderen zusammen, die sämmtlich vom 28. November datirt waren, das Resultat der Verhandlungen in Wien vom 16. bis 22. November, wo nicht nur verschiedene Relationen des Grafen Eck und das Schreiben der Güstrower Räthe vom 30. Oktober, sondern auch Klagen der Herzogin=Wittwe und Adolf Friedrichs über die gewaltsame Besitzergreifung Friedrich Wilhelms mit der Bitte um Rechtshülfe vorlagen. In dem Reskript an Friedrich Wilhelm giebt ihm der Kaiser sein Mißfallen über die eigenmächtige Besitzergreifung und die gewaltthätige Festnahme des Strelitzer Notars zu erkennen und befiehlt Rücknahme der besitzergreifenden Akte, Abführung der Truppen aus dem Güstrowschen, Rückgabe des Parchimschen Siegels, Abnahme der Wappenschilder sowie Unterwerfung unter die Kommission und deren Beförderung mit der Versicherung, daß dem Herzog die Aufgabe seiner vermeintlichen Possessions=Akte für seine Rechte unpräjudicirlich sein solle, da die Provisional=Regierung nur zu dem Ende angeordnet sei, damit ein Jeder, was ihm zukomme, durch gütliche Verhandlung oder Rechtsspruch ohne kostbare Sequestrations=Verordnung leicht und ohne Weitläufigkeit erhalten könne.
Dies Reskript wird den letzten Anstoß gegeben haben, daß nunmehr ungesäumt, wie schon vorher beabsichtigt war, Vermehren noch einmal, um definitiv abzuschließen, nach Güstrow gesandt ward. Den 5. November reiste er hinüber und verhandelte am 6. mit Eck. Nach seiner Instruktion hatte er eine


|
Seite 321 |




|
Anzahl Bedingungen zu stellen, deren wichtigste waren, daß Adolf Friedrich Güstrow sowie alles in Besitz Genommene räumen solle, und daß das Regierungskollegium in Güstrow umzugestalten sei, insbesondere der Generalmajor v. Oesterling und der Geheime Rath v. Scheres, die für Freunde des Strelitzers galten, daraus zu entfernen seien. Die Hauptschwierigkeit ward dadurch erledigt, daß Adolf Friedrich an eben dem 6. Dezember nach Strelitz abreiste 1 ) und in der Nacht vom 7. auf den 8. auch sein Wappen abgenommen ward. Darauf gab Friedrich Wilhelm den Befehl, daß auch die Schweriner Wappen im Lande Güstrow, wo sie sich noch befänden, entfernt würden. 2 )
Adolf Friedrich hatte kurz vor seiner Abreise dem Grafen ein Schreiben einhändigen lassen, das vom 4. Dezember datirt war und in dem er erklärte, daß er zum 13. Januar noch keinen seiner Räthe zu den Kommissionsverhandlungen nach Hamburg schicken könne, weil er erst eine Anzahl Dokumente aus dem Schweriner Archiv, deren Auslieferung - in beglaubigter Abschrift - ihm bisher geweigert sei, in Händen haben müsse und auch noch die Adjunktion eines Dritten in die Kommission, die er in Wien nochmals beantragen wolle, erwarte. In denselben Tagen erfolgte auch die endgültige Vereidigung der Geheimen Räthe zur Provisional=Regierung. In einem Kaiserlichen Schreiben an Eck, ebenfalls vom 28. November datirt, waren den Räthen die von ihnen gestellten Bedingungen fast ausnahmslos bewilligt. Das gewünschte Protektorium lag bei, ebenso ein Schreiben an die Räthe, worin ihnen die Regierung nochmals aufgetragen mard; auch die Eidesformel, die sie schwören sollten, war beigegeben. Sie leisteten den Eid den 7. Dezember. Darauf reiste Eck aus Güstrow wieder nach Hamburg.
Das Einrücken der Kreistruppen.
Erst nachher bekam er einen Brief des Reichshofraths v. Andler, er möge nicht eher aus Güstrow gehen, als die Schweden wirklich abgezogen. Diese waren nämlich trotz des Schreibens der Herzogin vom 4. November geblieben, was


|
Seite 322 |




|
freilich Eck, auch wenn er länger in Güstrow verweilt hätte, nicht hätte hindern können.
Das Verbleiben der Schweden aber war die Haupttriebfeder für die beiden andern kreisausschreibenden Mächte, auf einer gemeinsamen Besetzung des Güstrower Landes von Seiten des gesammten Kreisdirektoriums, wie sie in dem kaiserlichen Reskript vom 13. August 1695 eventuell in Aussicht genommen war, ohne dad gegen den Willen des Kaisers zu bestehen. Mit Schweden, uns nicht den Schein auf sich laden wollte, eigensüchtige Zwecke im Güstrowschen zu betreiben, ward ein Einvernehmen erreicht, wonach es sich verpflichtete, nach Einrücken von je einer Kompagnie von Brandenburgern und Lüneburgern nur die gleiche Anzahl in Güstrow zu lassen. Ein schwedischer Offizier, Oberstleutnant v. Klinckowströhm, ward zum Kommandeur der vereinigten Streitmacht bestimmt, die in Eid und Pflicht des Kreisdirektoriums treten sollte.
Alle diese Vorgänge fanden ihren Wiederhall im Reichhofrath in Wien, wo überdies inzwischen wieder einige Eingaben von Schwerin und Strelitz eingelaufen waren, 1 ) und gaben mit diesen zusammen Anlaß zu einer neuen Expedition kaiserlicher Reskripte, datirt vom 11. Februar 1696. Das an Adolf Friedrich gerichtete enthält unter Abschlag seines Antrages auf Verstärkung der Kommission 2 ) die Mahnung, die Kommission nicht weiter zu verzögern; Graf Eck habe gemessenen Befehl, bei den Kommissionsverhandlungen, also nicht vorher, wie Adolf Friedrich beanspruchte, ihm die gewünschten Dokumente mitzutheilen; wenn er die Kommission antrat, werde sich der Kaiser wegen der gewünschten 1000 Th. monatlicher Zahlung entschließen. Die Provisionalregierung wurde angewiesen, die Hin= und Wiederreise Adolf Friedrichs nach Güstrow sowie das Verbleiben eines


|
Seite 323 |




|
seiner Räthe dort nicht zu gestatten. An Schweden erging ein Schreiben mit nochmaliger Aufforderung, die Truppen aus dem Güstromschen zurückzuziehen. Es sei dort Alles in ruhigem Stande, auch sei Befehl gegeben und unter heutigem Datum erneuert, der Herzogin=Wittwe und ihren Töchtern ihre berechtigten Forderungen zu befriedigen. Die beiden andern Kreisdirektoren wurden aufgefordert, keine Truppen zu senden, es sei Verordnung zur Beschleunigung der Kommission ergangen.
Die Reskripte blieben, soweit sie die Kreisdirektoren betrafen, völlig wirkungslos, ebenso auch der Versuch Friedrich Wilhelms, der in Bezug auf das Kreisdirektorium andern Sinnes geworden war, noch in letzter Stunde die beabsichtigte Maßregel rückgängig zu machen 1 ) und der ins Güstrowsche bestimmten Lüneburger Kompagnie den Durchzug zu versagen. Den 18. Februar überschritt eine Kompagnie Lüneburger unter Kapitän Schönberg in der Stärke von 107 Mann bei Hitzacker die Elbe, blieb die Nacht im Lauenburgischen, marschirte den 19. bis nach Zierzow, den 20. bis Vietlübbe, eine Meile von Plau, und rückte den 21. in Plau ein, wo am selben Tage eine Kompagnie Brandenburger, 111 Mann stark, zu ihr stieß. Beide Kompagnien blieben hier vorläufig stehen 2 ) und beriefen sich, den Abgesandten der Provistonalregierung gegenüber, auf ihre Ordre.


|
Seite 324 |




|
Den 4. März kam in Güstrow der Oberstleutnant Klinckowströhm an, den 7. marschirte darauf die eine der beiden dort liegenden schwedischen Kompagnien ab, die andere ward den 27. März von Klinckowströhm und den beiden Räthen v. Viereck (aus Berlin) und Spörcke (Lüneburger) für das Kreisdirektorium in Eidespflicht genommen. Dasselbe geschah den 31. in Plau mit den dortigen Kompagnien.
Neue kaiserliche Schreiben, die auf die erhaltenen Berichte hin den 28. März ergingen, änderten hieran nichts, nur daß die Brandenburger und Lüneburger ihre Quartiere wechselten und mehr im Lande vertheilt wurden. Dem geschlossenen Einvernehmen der drei kreisausschreibenden Mächte gegenüber war der Kaiser machtlos.
Das Possessions=Urtheil.
Hinausschaffen ließen sich die Kreistruppen, wenn die Vermittelungs=Kommission wieder ins Leben trat und Erfolg hatte. Allein wiederholte Versuche, sie wieder in Gang zu bringen, blieben erfolglos: Adolf Friedrich hatte immer wieder Gründe, die Beschickung hinauszuschieben.
Man beschritt deshalb in Schwerin den Weg, eine direkte Entscheidung des Kaisers über den vorläufigen Besitz des streitigen Landes herbeizuführen. Zu den dazu erforderlichen diplomatischen Verhandlungen reiste der neue Ministerpräsident, den Friedrich Wilhelm Anfang 1696 in Dienst genommen hatte, Graf Horn, 1 )


|
Seite 325 |




|
selbst nach Wien (im Mai), und zwar nahm er seinen Weg über Berlin, um sich hier womöglich der Mitwirkung des Kurfürsten zu versichem, die ihm aber nicht in dem gewünschten Grade gewährt ward. 1 )
In Wien langte er den 6./16. Juni an. Nach einer ersten persönlichen Audienz beim Kaiser, in der dieser seiner Gewohnheit gemäß die Deduktionen des Grafen mit der allgemeinen Versicherung zu thun, was der Gerechtigkeit gemäß sei, beantwortete, ließ er durch den Rath Diettrich d. 20./30. Juni ein von ihm selbst entworfenes Memorial beim Reichshofrath einreichen, welches die Bitte enthielt, den Besitz von Güstrow Friedrich Wilhelm zuzusprechen.
Es kam dann d. 9. Juli zu einer Verhandlung, in der das gesammte Material, das seit dem Tode des Herzogs Gustav Adolf über den Erbfolgestreit in Wien eingegangen war, dem


|
Seite 326 |




|
Reichshofrath vorgelegt ward. 1 ) Das Resultat war lächerlich geringfügig: ein Reskrivt an die Administrations=Räthe in Güstrow, die Geldforderung eines 10 Jahre lang unbezahlt gebliebenen Güstrower Beamten, des Hofgerichtssekretärs Martens, an dessen Sohn zu begleichen, "Ponantur interim reliqua ad acta," lautete der Schluß dieses Konklusums.
Der Grund, weshalb man über die Hauptfragen sich noch nicht zu entscheiden wagte, lag in der Besorgniß, daß durch eine einseitige kaiserliche Entscheidung der bereits eingetretene Zwiespalt zwischen Kaiserhof und Kreisdirektorium sich verschlimmern werde. Das Kreisdirektorium blieb fortdauernd den kaiserlichen Vorhaltungen gegenüber bei der Behauptung, daß sein Verfahren den Reichskonstitutionen gemäß sei; es bestritt dem Kaiser das Recht, die Regierung im Güstrowschen in seinem Namen allein führen zu lassen, und erklärte es nicht für vollkommen ausgemacht, ob in Sachen von Fürstenthümern, die vom Reiche zu Lehen gingen, der Kaiser allein durch den Reichshofrath zu urtheilen und nicht vielmehr die Kurfürsten und Fürsten des Reiches dabei hinzuziehen habe; die Verhandlung sollte dann nach Absicht des Kreisdirektoriums, wie aus einem Schreiben Friedrich Wilhelms an Horn vom 12. Juli zu ersehen ist, nach Regensburg verlegt werden. Von Seiten der Kreisdirektoren war eine Konferenz ihrer Wiener Gesandten mit kaiserlichen Bevollmächtigten über diese Streitfrage vorgeschlagen worden; und wenn auch einzelne der Reichshofräthe sich schon damals für ein summarisches Urtheil ausgesprochen hatten, so hatte doch die Mehrheit sich dafür entschieden, vorerst das Ergebniß jener Konferenz abzuwarten. Obgleich Graf Horn vielfach hiergegen remonstrirte, da die Konferenz dem Kaiser gefährlich und seinem Herrn schädlich sei, so trat doch auch der Kaiser dem Vorschlage des Reichshofraths bei. Die Konferenz ward auf den 19. August angesetzt und zu derselben neben zwei andern Reichshofräthen der Vicepräsident, Graf Zeyl, und der Referent, Herr v. Andler, deputirt. Sie erhielten die Aufgabe, den Ministern der Kreisdirektoren die Befugniß des Kaisers zur alleinigen Entscheidung der Sache nachdrücklich vorzustellen, sich aber auf weitere Erörterungen nicht einzulassen. Allein die Konferenz kam überhaupt nicht zu Stande. Als nämlich die Bevollmächtigten zusammentraten, erhob der schwedische Gesandte, Graf Gabriel Oxenstierna,


|
Seite 327 |




|
den Anspruch, als Gesandter eines auswärtigen Königs den Vorrang selbst vor den kaiserlichen Räthen zu erhalten. Wegen dieser Formfrage mußte die Konferenz, noch ehe sie die Verhandlungen begonnen, abgebrochen werden. Die Entrüstung über diese Anmaßung des Schweden war groß unter den Wiener Staatsmännern, ebenso groß aber auch ihre Verlegenheit, was nun zu thun sei. Sie zeigte sich schon darin, daß man Wochen lang zögerte, dem Kaiser den Vorfall zu referiren. Erst den 12./22. September schreibt Graf Horn, der es an Mahnungen nicht hatte fehlen lassen, daß Graf Zeyl zum ersten Mal dem Kaiser Bericht erstattet habe. Graf Horn hatte darauf sogleich auch persönlich wieder Audienz erbeten und erhalten und mit Erlaubniß des Kaisers diesem ein Schriftstück vorgelegt, worin er die Bitte ausspricht, weil er auf den Gedanken gekommen, "daß einige ihm verborgene Zweifel Ursache der Verzögerung seien", der Kaiser möge einige von seinen Ministern zu Kommissarien benennen, mit denen er über die Hindernisse, die etwa dem Spruch im Wege ständen, konferiren und ersehen könne, ob sie nicht zu heben seien, wenn sie etwa "das Publicum concerniren" (d. h. politischer Natur sein) sollten. "Der Justice nach" finde er nicht den geringsten Zweifel, warum nicht wenigstens über das Possessorium unverweilt ein Spruch erfolgen könne, weil sein Herr eventualiter schon mit dem Güstrowschen belehnt sei und also die wirkliche Belehnung ihm nicht wohl zu versagen stehe, die Einreden des Herzogs von Strelitz aber auf dem Prozeßwege sich untesuchen ließen; weil ferner auch der Herzog von Strelitz Spruch wiederholt begehrt und genugsam gehört sei und weil endlich nach den Reichskonstitutionen, wenn dergleichen Gefahr wegen Besitz oder Verwaltung eines Reichslandes sich zeige, der Kaiser auch ex officio über den Besitz entscheiden könne."
Dieses Aktenstück gelangte den 24. September an den ReichShofrath, der dann den 29. September in Betreff der Konferenz mit den Kreisministern das Konklusum faßte, daß der Kaiser seiner Autorität nichts vergeben könne, was dem schwedischen Gesandten angezeigt ward, ohne diesen zum Nachgeben zu bewegen. Es dauerte wieder einige Wochen, bis eine Konferenz mit dem brandenburgischen und cellischen Gesandten - ohne den schwedischen - zu Stande kam (d. 25. Oktober). Auch diese aber förderte die Sache nicht, da auch Brandenburg und Celle fest auf dem Anspruch beharrten, das Kreisdirektorium habe an der Interims=Regierung Antheil zu nehmen.


|
Seite 328 |




|
Die Verstimmung der Wiener leitenden Kreise über diesen Fehlschlag suchte Graf Horn eifrig und nicht ohne Erfolg zu Gunsten seines Herrn auszunutzen. An den sehr einflußreichen Prästdenten des Reichshofraths, Grafen Oettingen, der nach längerer Abwesenheit wieder zurückgekehrt war, wandte er sich mit einem schriftlich ausgearbeiteten Aktenstück, 1 ) um ihn zur Beförderung eines günstigen Spruches zu bestimmen.
Auch auf die übrigen Mitglieder des Reichshofrathes suchte er, unterstützt von dem Legationssekretär Christiani, in vielfachen Unterhaltungen einzuwirken, wobei er auch die in Wien bekanntlich so gern gehörten "klingenden" Gründe wohl zu benutzen mußte. 2 )
So bequemte man sich denn endlich im Dezember 3 ) zu der entscheidenden Verhandlung. In 8 Sitzungen, vom 7. bis


|
Seite 329 |




|
20. Dezember, 1 ) hielt Herr v. Andler Referat über die Güstrowsche Successionsfrage. Den 20. Dezember erfolgte das Konklusum, die Entscheidung des Kaisers fiel den 12. Januar 1697. Sie lautete: "Jhro Kayserl. Maytt. haben dem H. Hertzog Friedrich Wilhelm zu Mecklenburg das Possessorium des Hertzogthums Güstrow und deßen Lande und Leuthen zuerkennet, auch anbey resolviret, daß zu solchem ende so woll an die Kayserl. Kommission und Abgesandten im Nieder=Sächsischen Kreyse, dem Grafen von Egg, als an die Kreyßausschreibenden Herrn Fürsten, die Herren Herzogen zu Schwerin und Strelitz, die verwittibte Hertzogin, die verordnete Kayserl. Regierung zu Güstrau, und die Ritterschaft rescribiret, an die unterthanen auch zulängliche Patentes abgefaßt. Er Herr Hertzog Friedrich Wilhelm zur wirklichen belehnung admittiret, daß Petitorium aber vor dero in sachen verordneten Kayserl. Commission auszuführen reserviret sey, und dem H. Herzogen zu Strelitz ein Decretum Salvatorium ertheilt werden sollen, und solches alles dem Kayserl. Abgesandten im Nieder=Sächsischen Kreyße, behöriger Ohrten zu publiciren und zu insinuiren auf getragen."
Von demselben Datum sind die in dem Konklusum genannten Schreiben datirt. In dem an die Kreisdirektoren wurden sie aufgefordert, ihre Truppen nunmehr aus dem Güstrowschen sofort zurückzuziehen und Friedrich Wilhelm nicht zu hindern, das ihm zugesprochene Land in Besitz zu nehmen, sondern ihm vielmehr, wenn es erforderlich werde, dazu behülflich zu sein. Der Kaiser hatte also, vorläufig wenigstens, völlig zu Gunsten von Schwerin entschieden. 2 )


|
Seite 330 |




|
VII.
Besitzergreifung von Güstrow und Depossedirung.
Die Vollziehung des kaiserlichen Spruches.
Das Urtheil war ergangen, jetzt galt es seine Ausführung. Da jedenfalls von Seiten des Herzogs von Strelitz und wohl auch von Seiten des Kreisdirektoriums Widerspruch zu erwarten war, so dachte man am sichersten zu gehen, wenn man das Urtheil zunächst möglichst geheim halte und es unverweilt zur Ausführung bringe. Der vollzogenen Thatsache gegenüber, hoffte man, werde das Kreisdirektorium wenigstens nicht zum äußersten schreiten und offene Gewalt vermeiden, da für alle drei den Kreis dirigirenden Mächte die Erhaltung guter Beziehungen zum Kaiserhofe in ihrer damaligen Lage werthvoll sein mußte.


|
Seite 331 |




|
Schweden hatte im Kriege gegen Frankreich die Vermittelung übernommen und legte, wie man in Wien wußte, großen Werth darauf, weshalb man annahm, daß es um der weit unbedeutenderen Güstrower Affaire willen nicht in offenen Gegensatz zum Kaiser treten werde, weil dadurch jene Vermittlerrolle erschwert, wo nicht unmöglich gemacht werden konnte. Die beiden eng verbundenen welfischen Häuser Lüneburg=Celle und Hannover waren zur Durchführung der von ihnen vereinbarten Union und für die Hannoversche Kurwürde 1 ) fortdauernd auf das Wohlwollen des Kaiserhofes angewiesen. Und Friedrich von Brandenburg vollends konnte für sein Streben nach der Königskrone der Zustimmung des Kaisers nicht entrathen, auch war die geheime Klausel in dem Vertrage vom Jahre 1693 zwischen Kurfürst Friedrich und Herzog Friedrich Wilhelm, die sich auf die Güstrowsche Succession bezog, in Wien bekannt. Man glaubte also ein summarisches Verfahren in der Güstrower Sache einschlagen zu können, wobei man sich freilich vollständig verrechnete.
Noch am 23. Januar n. St. erhielt in Wien der Strelitzische Rath Haupt auf eine Frage die Antwort: "Man habe diesseits nichts zu besorgen, weil in Wien die Sache nicht übereilt, sondern an die Kommission verwiesen werde. Man müsse Geduld haben; wenn der Graf v. Oettingen (der Vizepräsident des Reichshofrathes, der krank war) wieder zu Hofe komme, solle das Votum dem Kaiser vorgetragen werden."
Inzwischen war der Eilbote mit den kaiserlichen Reskripten an den Grafen Eck bereits längst unterwegs. Als er in Hamburg angekommen war, ließ Graf Eck den dortigen Ministern der Kreisdirektoren anzeigen, er habe im kaiserlichen Dienst eine nothwendige Reise vorzunehmen, und gab Befehl, daß ihnen die betreffenden Reskripte erst 24 Stunden nach seiner Abreise eingehändigt werden sollten. In möglichster Eile machte er sich auf den Weg nach Güstrow, unterwegs schloß sich ihm Herzog Friedrich Wilhelm, der bereits eingeweiht war, mit geringem Gefolge an, und so langten beide den 16. Januar (a. St.) Nachmittags 2 Uhr in


|
Seite 332 |




|
Güstrow an. Eck gab Befehl, sofort die Thore zu schließen und fuhr mit Friedrich Wilhelm beim Oberpräsidenten v. Ganß vor, wohin schleunigst, während der Herzog in geschlossenem Wagen vor der Thür verblieb, die übrigen Mitglieder des Regierungskollegiums, der Kommandant Generalmajor v. Oesterling, der Kanzler Curtius, der Geheime Rath v. Scheres und der Geheime Sekretär v. Pommer Esche berufen wurden. Als sie versammelt waren, trat auch der Herzog unter sie, und Eck eröffnete ihnen im Namen des Kaisers das ergangene Urtheil, erließ sie ihrer bisherigen eidlichen Verpflichtung und wies sie sofort an Friedrich Wilhelm als ihren Herrn. Darauf erklärte der Oberpräsident im Namen des ganzen Geheimen Rathskollegiums, daß sie alle fortab Herzog Friedrich Wilhelm für ihren Herrn und Landesfürsten erkennten, und Oesterling ließ alle Thore militärisch besetzen und deren Schlüssel dem Herzog überliefern.
Da kam die Meldung, daß der schwedische Kommandant, Oberstleutnant Klinckowströhm, der mit dem größten Theil seiner Leute sich außerhalb des Schlosses zum Zwecke einer Musterung befunden hatte, seine Kompagnie zusammengezogen und durch eine Pforte im Schloßgarten auf das Schloß geführt habe. Der Generalmajor ließ nun sofort Anstalt machen, das äußere Schloßthor und die Pforten zu besetzen. Dabei kam es wegen einiger Geschütze, die auf dem Schloßplatze standen und deren sich sowohl die Schweriner wie die Schweden zu bemächtigen suchten, zu einem feindlichen Zusammenstoß. Klinckowströhm ließ nämlich 6-8 seiner Leute auf die Schweriner Feuer geben, dabei ward dem Generalmajor Oesterling, der hier selbst die Führung hatte, der Rock durchschossen, und zwei Gemeine wurden an den Füßen, aber nur leicht, verwundet. 1 ) Den Meklenburgern war verboten zu feuern, sie behaupteten indessen die Geschütze sowie ihre Posten rings um das Schloß, während die Schweden das Schloß selber mit dem Schloßgarten in Besitz behielten.
Kurz darauf fuhr der Herzog an alle Thore und Posten und nahm überall den Offizieren und Soldaten des früheren Güstrowschen Militärs truppweise, wo man sie gerade fand, den


|
Seite 333 |




|
Eid ab, worauf er im Hause des Geh. Kammerraths Mumme 1 ) Wohnung nahm.
Zwei Versuche, mit der Herzogin=Wittwe in Verbindung zu treten, mißlangen, da die Schweden dem Abgesandten, dem Geh. Rath v. Koppelow, den Eintritt ins Schloß verwehrten, während sie zur selben Zeit einen dänischen Gesandten frei passiren ließen.
Am Morgen des nächsten Tages, eines Sonntages, kam das Gefolge des Herzogs und die Garde zu Fuß und zu Roß an, 2 ) und etwa um Mittag wurde eine berittene Ordonnanz (ein "Einspänniger") nach Strelitz an Adolf Friedrich abgesandt, um ihm das an ihn adressirte kaiserliche Reskript zu überbringen.
Um dieselbe Zeit versammelte sich der Rath und die Bürgerschaft vor dem Rathhause und Graf Eck theilte zunächst dem Rath den kaiserlichen Spruch mit und forderte ihn zur Ableistung des Treueides auf. Nach Besprechung mit der Bürgerschaft antwortete der Rath, es sei wider ihre Privilegien und Freiheiten, zu schwören, ehe diese bestätigt seien; doch genüge dafür ein schriftlicher Revers des Herzogs. Indessen gaben sich Rath wie Bürgerschaft am Montag nach längerem Hin= und Herreden mit der ihnen überbrachten mündlichen Zusicherung zufrieden und leisteten den Handschlag. Am selben Tage wurden nach allen Seiten Beamte ausgesandt, um in allen Aemtern und Städten die kaiserlichen Patente bekannt zu machen und den Handschlag der Treue entgegenzunehmen. Fast überall vollzog sich der Uebergang der Regierung auf den neuen Herren ohne Schwierigkeit. 3 )


|
Seite 334 |




|
Eine sehr unliebsame Ueberraschung war allerdings das plötzliche Anrücken von drei schwedischen Kompagnien aus Wismar gegen Güstrow den 19. am Spätnachmittag. Der sie kommandirende Offizier erklärte, er komme auf Befehl der Herzogin. Man ließ ihn aufs Schloß, wo er von der Herzogin die Weisung erhielt, sich mit seinen Leuten wieder von der Stadt zurückzuziehen. Er gehorchte und quartierte den 20. die eine Kompagnie im Amte Güstrow, die zweite im Amte Ribnitz, die dritte im Amte Schwaan ein. In Schwaan traten die Schweden den Schweriner Beamten entgegen, welche für den Herzog Besitz ergreifen wollten. Und als man die Herzogin=Wittwe, die selbst schon am 18. durch ihren Rath v. Behr mit Friedrich Wilhelm Beziehung angeknüpft hatte, deswegen um Auskunft ersuchte, ließ sie sagen, es sei dies (d. h. das Auftreten der Schweden in Schwaan) wider ihren Willen geschehen. 1 ) Augenscheinlich waren die Bewegungen der Schweden nicht ausschließlich von der Herzogin abhängig. Was weiter daraus sich entwickeln sollte, blieb vorläufig noch unklar. Für das Schloß und seine Umgebung war mit Klinckowströhm schon am 18. ein Abkommen getroffen worden, daß man es auf beiden Seiten bei dem status quo belassen wolle. Klinckowströhm hielt es aber doch für nöthig, den 18. Abends die Lüneburger Kompagnie und den 19. die Brandenburger näher an die Stadt heranzuziehen. Auch diese entfernten sich dann wieder weiter, gaben aber einen Theil ihrer


|
Seite 335 |




|
Leute zur Verstärkung der Besatzung des Schlosses ab und wurden in der Nähe auf dem Lande einquartiert. Das große Vorderthor des Schlosses wurde von innen verrammelt und gegen einen Einfall verwahrt, auch die hintere Pforte verschlossen und mit Schießlöchern versehen.
Um jeden Schein, daß um des Schutzes der Herzogin und ihrer Töchter willen die Anwesenheit der Kreistruppen im Lande nöthig sei, zu beseitigen, wurden schon den 19. von Seiten der Schweriner der Herzogin 1500 Rth. zu vorläufiger Bestreitung ihres Hofhalts gezahlt und den 20. gütliche Verhandlungen in Graf Ecks Wohnung mit ihren Bevollmächtigten begonnen, die den 1. Februar auch auf die Prinzessinnen ausgedehnt wurden. Der Herzog bewies ein so weitgehendes Entgegenkommen, daß man sich den 19. Februar bereits über die Hauptpunkte des Vergleiches einigte: Der Herzogin=Wittwe ward ein jährliches Einkommen von 12000 Rth. in Aussicht gestellt, jeder der Prinzessinnen 4000 Th. Courant und 1000 Th. Species, der letzten, nach dem Tode der andern übrig bleibenden 7000 Th. Die Schweriner erklärten indessen die beiden Verträge nicht eher vollziehen zu können, als die Kreistruppen abmarschiert seien, und setzten in Wien wie an allen betheiligten Höfen alle Hebel in Bewegung, um deren Abberufung zu erwirken.
Der Vertrag der Kreisdirektoren vom 24. Februar 1697.
Die ersten Nachrichten, die noch im Januar aus Berlin und Celle einliefen, 1 ) lauteten nicht ungünstig, wenn auch nicht völlig zufriedenstellend. In Berlin erklärte man, Schwerin sein


|
Seite 336 |




|
Recht gerne zu gönnen, allein man habe sich bei Ergreifung der Possession übereilt. Es könne nicht gut geheißen werden, daß man bei Ausführung des Urtheils das Kreisdirektorium übergangen habe. Einer bindenden Antwort mich man an beiden Höfen durch die Wendung aus, da die Leute Kreisvölker seien, so bedürfe es zu ihrer Abberufung der Zustimmung des gesammten Kreisdirektoriums. Indessen schien von beiden Höfen nichts Böses weiter in Aussicht zu stehen. Weit ernstere Nachrichten kamen aus Schweden, wo die Herzogin von Strelitz selbst auf Besuch weilte. Sie war, wie auch die Königin=Mutter, auf das Höchste erschrocken gemesen über das kaiserliche Urtheil und mehrmals von Ohnmachten befallen worden. Dann hatte sie den König fußfällig um Beistand gegen das ungerechte Urtheil angefleht und auch erreicht, daß der schwedische Hof sich entschloß, das kaiserliche Urtheil oder wenigstens dessen übereilte Ausführung kraft des kreisausschreibenden Amtes anzufechten.
Rechtsgründe dazu waren reichlich vorhanden und wurden auch von Adolf Friedrich, der sofort nicht nur beim Grafen Eck und in Wien gegen das ungebührliche Verfahren protestirt, sondern sich auch an die Kreisdirektoren mit einer Beschwerde gewandt hatte, zur Benutzung an die Hand gegeben. Nach kürzeren Protesten brachte Gutzmer nach Hamburg zu den Verhandlungen der dort zusammentretenden Konferenz der Kreis=


|
Seite 337 |




|
minister eine ausführliche Darstellung der Begebenheiten in Strelitzischer Auffassung mit. 1 ) Er beklagt sich darin, daß man seinen Wunsch auf Adjungirung eines dritten Kommissars zu der Vermittelungskommission nicht erfüllt, auch trotz mehrfachen Ansuchens ihm die Eingaben des Gegners zur Beantwortung nicht mitgetheilt, auch bereits den Spruch gefällt, obgleich die Sache erst in dem Stadium der Kommissionsverhandlungen und Mittheilung der eingekommenen Schriften (in puncto Commissionis et Communicationis) gestanden. Er beschwert sich ferner darüber, daß dem Schweriner Geh. Rathspräsidenten Grafen o. Horn auf dessen Ansuchen eine Kommissionsverhandlung mit einigen Reichshofräthen (d. 15. Januar) gewährt sei, ohne daß der Strelitzische Bevollmächtigte trotz seines vorher eingegebenen Ansuchens hinzugezogen sei. 2 ) Daß das Urtheil in Wien nicht sofort, wie es der Brauch verlange, publicirt, vielmehr der Rath Haupt geflissentlich in Unkenntniß darüber gehalten sei, und die Reskripte sogleich an den Grafen Eck gesandt seien, der dann in höchst gewaltsamer Weise mit Herzog Friedrich Wilhelm Besitz von Güstrow ergriffen und nachher erst das kaiserliche Reskript Herzog Adolf Friedrich zugestellt habe, so daß es diesem dadurch unmöglich gemacht sei, einen Aufschub der Ausführung des Urtheils zu erwirken ("das remedium suspensivum zu ergreifen"), wie den Reichskonstitutionen gemäß sei.
Die Minister der Kreisdirektoren in Hamburg wie ihre Regierungen eigneten sich die Strelitzer Auffassung von der Unrechtmäßigkeit des ganzen Verfahrens in allen Stücken an. Das eigentlich ausschlaggebende Moment war indessen für sie die völlige Uebergehung des Kreisdirektoriums bei der Ausführung des Urtheils. Die sämmtlichen drei kreisdirigirenden Mächte waren sich darin einig, daß der Kaiser auf Grund der Reichsverfassung verpflichtet gewesen sei, das Urtheil vor der Ausführung den Kreisdirektoren mitzutheilen und diesen dann dessen


|
Seite 338 |




|
Ausführung zu übertragen. Auch hier war wie so oft in ähnlichen Fragen nicht der juristische Befund entscheidend: Das Reichsrecht erwies sich als dehnbar und unklar genug, um beiden Auffassungen, der kaiserlichen wie der entgegengesetzten, eine Begründung zu gestatten. Den Ausschlag gab für die leitenden Mächte des Kreises der politische Gesichtspunkt. Die Entscheidung eines solchen Streites rein aus kaiserlicher Machtvollkommenheit erschien den norddeutschen Fürsten als ein Präcedenzfall, dessen Wiederholung für die Selbständigkeit des deutschen Fürstenstandes gegenüber der Habsburgischen Weltmacht die bedenklichsten Folgen nach sich ziehen konnte. Anstoß erregte auch bei den protestantischen Höfen der zufällige Umstand, daß einem Katholiken, wie Graf Eck war, die Ausführung des kaiserlichen Urtheils über ein protestantisches Fürstenthum übertragen war. Im Hintergrunde standen dabei sicher schon damals, was im Laufe der folgenden Jahre deutlicher zum Vorschein kam, Besorgnisse, als könne auch für das lutherische Bekenntniß eine Gefahr daraus erwachsen. 1 )
Diesen Erwägungen gegenüber blieb eine neue Expedition kaiserlicher Reskripte, datirt vom 5./15. Februar, in denen über das eigenmächtige Auftreten Klinckowströhms Beschwerde geführt und Anerkennung des kaiserlichen Schlusses verlangt ward, völlig wirkungslos. Den 24. Februar (a. St.) kam in Hamburg eine Konvention zu Stande, in der die drei Höfe ein festes Zusammenhalten in dieser Angelegenheit verabredeten. Auch Brandenburg schloß sich trotz des Geheimvertrages mit Friedrich Wilhelm vom Jahre 1693 der Vereinbarung an. In zwei Schreiben, von denen das eine, datirt vom 18. Februar, von dem Grafen Mellin, dem schwedischen Gouverneur in Stade und Herzog Georg Wilhelm von Celle, das andere, datirt vom 21. Februar, von Kurfürst Friedrich unterzeichnet war, wurde Herzog Friedrich Wilhelm in scharfen und schroffen Worten auf den empfindlichen Eingriff in das Amt der Kreisdirektoren, der von ihm begangen sei, hingewiesen und aufgefordert, alles wieder in den Stand zu setzen, darin es vor der "so genannten Execution" gewesen; das


|
Seite 339 |




|
Schreiben schloß mit der Drohung, daß bei etwaigem widrigem Bezeigen Friedrich Wilhelms ihr Amt die Kreisdirektoren "unumgänglich dahin würde anleiten müßen", dem Herzogthum Güstrow "den gehörigen Schutz zu verschaffen".
Die Schreiben waren gleichlautend bis auf den einen freilich sehr wichtigen Unterschied, daß in dem Schreiben von Schweden und Lüneburg der Ausdruck gebraucht war "ohne einzigen Verzug", während das brandenburgische Schreiben eine Frist von zehn Tagen, um das Geschehene rückgängig zu machen, setzte. Beide Schreiben wurden nicht sogleich abgesandt, sondern zurückgehalten, bis man ihnen mit Waffenmacht zwingenden Nachdruck geben konnte.
Vom 25. Februar ist das ausführliche Antwortschreiben der Kreisdirektoren auf das kaiserliche Reskript vom 12. Januar datirt, worin nach kurzer Rechtfertigung ihrer bisherigen Schritte das Verfahren des Reichshofrathes bei dem Konklusum wie auch die Art der Ausführung desselben ausführlich beleuchtet wird. Nothwendig müsse daraus die Sorge erwachsen, daß "wie also, ohne den einen Theil auf das gegenseitige Einbringen zu hören, ohne Egard auf die Reichs= und andere gute Ordnungen, ja fast ohne allen formellen Process ex nudo arbitrio einiger der Reichs=hoff=Räthe über gantze Fürstenthümer disponiret werden solte, kein Stand, viel weniger andere im Reiche eine Stunde sich des seinigen versichert halten können." Bei der Exekution habe dann ein zu ganz andern Sachen verordneter Kommissarius in das Amt der Kreis=Direktoren gegriffen und diese gleichsam nur in subsidium dazuziehen wollen, auch habe man ihre Völker, die sie zur Erhaltung der gemeinen Sicherheit ins Fürstenthum Güstrow verlegt, ohne ihnen selbst oder dem kommandirenden Offizier ein Wort, wenigstens so zeitig, daß die deshalb nöthigen Ordres hätten gegeben werden können, davon zu sagen, theils mit List, theils mit Bedrohung, theils gar mit Gewalt zu delogiren gesucht. Die Fürsten urtheilen, indem sie die Person des Kaisers selbst aus dem Spiele lassen, daß alles dies "aus irrigem und mangelhaftem Bericht sub- et obreptitie erschlichen werden", und verlangen gänzliche Aufhebung alles bisher in der Sache Geschehenen und ein Gericht aus unparteiischen Reichsfürsten. Inzwischen wollen sie - dies wird hier bereits offen ausgesprochen - ihre Truppen im Güstrowschen noch verstärken.
Allen Bemühungen des Schweriner Herzogs gelang es nicht, das drohende Unwetter abzuwenden, das sich dann Mitte März entlud.


|
Seite 340 |




|
Der Feldzug der Kreisdirektoren gegen Herzog Friedrich Wilhelm.
Die Zwischenzeit war in Güstrow im ganzen ruhig, doch nicht ohne jede Störung des Friedens verlaufen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar gegen 1 1/2 Uhr versuchten die Schweriner eine Pforte am Leninschen Thore einzuheben, um dieses gegen einen Ausfall der Schweden zu sperren. Es wurde aber vom Schlosse aus bemerkt, worauf Pechkränze und Granaten nach den Meklenburgern geworfen und 50 bis 60 Musketenschüsse auf sie abgegeben, auch einige verwundet wurden. Die Schweriner antworteten mit Musketenfeuer und brannten auch zwei Geschütze ab, mußten sich aber zurückziehen und die Pforte liegen lassen. 1 ) Den 15. Februar ward die lüneburgische Kompagnie durch eine andere abgelöst, die 120 Mann stark war, und zugleich die brandenburgische in die Vorstädte verlegt, so daß dort jedes Haus mit 10 bis 30 Mann belegt war. Den 19. begann Klinckowströhm Anstalten zu treffen, um eine Brücke über den Schloßgraben zu bauen. Friedrich Wilhelm ließ, um dies zu hindern, der Arbeitsstelle gegenüber in der nächsten Nacht eine Batterie aufwerfen, allein als es Tag ward und die Schweden den Bau bemerkten, versahen sie das Dach des nächstgelegenen Schloßthurms mit Schießscharten, von wo aus sie die Batterie bestreichen konnten.
Da immer bestimmtere Nachrichten von Truppenbewegungen gegen die Grenze hin einliefen, so verstärkte Friedrich Wilhelm die Garnison von Güstrow durch 50 Mann aus Boizenburg und ebenso viele aus Dömitz, die den 1. März ankamen, und verlangte von der Bürgerschaft, daß sie sich verpflichte, für ihn im Nothfall die Waffen zu ergreifen. Indessen bat diese, durch ein


|
Seite 341 |




|
Schreiben von Klinckowströhm gewarnt, in mehrfachen Eingaben flehentlich, von dem Erscheinen unter Gewehr verschont zu bleiben. 1 )
Um wenigstens der Treue der früheren Güstrowschen Mannschaften versichert zu sein, von denen manche, die man am 16. Januar nicht gerade auf den Straßen oder Posten getroffen hatte, noch nicht geschworen hatten, wurden sie den 6. März noch einmal alle in Eid genommen. 2 )
Ein letzter Versuch, durch Unterhandlungen mit Adolf Friedrich die schon im Zuge befindliche Bewegung zum Stehen zu bringen, scheiterte. Adolf Friedrich antwortete auf ein Schreiben, in dem ein Vergleich vorgeschlagen war, mit der höhnischen Abweisung: Wenn sein Vetter sich mit dem Schwerinischen begnüge und ihm das Güstrowsche lasse, so sei der beste Vergleich zu hoffen. Auch die Unterhandlungen mit der Herzogin=Wittwe und ihren Töchtern, die nahezu abgeschlossen waren, kamen ins Stocken.
Endlich rückten, in den Tagen vom 11. März ab, die für den kleinen Feldzug bestimmten Kreistruppen ins Land ein. Die drei schon früher aus Wismar ins Güstrowsche gerückten schmedischen Kompagnien zogen sich wieder näher an Güstrow heran, dazu kamen noch zwei andere Kompagnien zu Fuß, vier Kompagnien Lüneburger zu Fuß und eine zu Pferde und ebenso viele Brandenburger, 3 ) so daß also zu den schon seit 1695 im Lande stehenden drei Kompagnien noch jede der Mächte 5, alle drei also im Ganzen, die frühere Besatzung eingeschlossen, 18 Kompagnien stellten. Die ganze Streitmacht, die sich unter dem Kommando des Oberstleutnants Klinckowströhm in Güstrow zusammenzog, war mithin 1800 bis 2000 Mann stark.
Den 15. März näherten sich die Truppen von allen Seiten der Stadt, und zwischen 10 und 11 Uhr Morgens erschienen die beiden Kapitäns v. Wolfrath (ein Schwede) und Baron v. Löben (ein Brandenburger) beim Herzog und übergaben die beiden Schreiben der Kreisdirektoren vom 18. und 21. Februar mit dem Ersuchen an den Herzog, binnen 24 Stunden den Ort


|
Seite 342 |




|
zu verlassen. Der Herzog ließ sofort Schreiben an die drei Kreisminister nach Hamburg entwerfen, in denen die Bitte enthalten war, ihm Zeit zum Bericht an den Kaiser zu lassen, und als am 16. die zwei Offiziere wiederkamen, erhielten sie den Bescheid, der Oberstleutnant möge bis zum Eintreffen der Antwort von Hamburg alles in statu quo lassen. Klinckowströhm bewilligte indessen nur nochmals 24 Stunden Bedenkzeit und bezeichnete die 10tägige Frist in dem brandenburgischen Schreiben als einen Irrthum. Als am 17. Morgens die beiden Offiziere wiederkamen, ward ihnen die erfolgte Absendung des Couriers (am 16.) nach Hamburg angezeigt und die Bitte wiederholt, wenigstens bis zu dessen Wiederkunft, die binnen drei Tagen zu erwarten sei, noch Frist zu gewähren. Allein Klinckowströhm schlug dies ab.
Als man darauf wahrnahm, daß er im Schlosse viele Fenster ausheben und an deren Stelle Hölzer mit Schießlöchern anbringen ließ, um den Schloßplatz und die Straßen bestreichen zu können, traf Friedrich Wilhelm Vertheidigungsanstalten: Er verstärkte sämmtliche Wachen, ließ den Rest seiner Leute vor sein Quartier - das Posthaus - rücken und auf der Straße sowohl an ihrer Ausmündung nach dem großen Schloßplatze zu, wie auch an der andern nach dem Domplatze einen Erdwall aufwerfen und mit je 2 Geschützen besetzen.
Darauf führte noch am selben Abend Klinckowströhm fünf Kompagnien seiner Streitmacht beim Bauhofe über die von ihm geschlagene Brücke in den Lustgarten, er selbst mit gezogenem Degen an ihrer Spitze. Sodann ließ er einen Theil dieser Truppen aus dem Schloß auf zwei Wegen in die Stadt marschieren, sich über die Wälle vertheilen und das große Schloßthor mit Gemalt aufschlagen. Ueberall wurden die Schweriner Wachen verdrängt, und auch die Hauptwache an der Schloßbrücke, welche versuchte durch Vorhalten der Bajonette - zu schießen hatte der Herzog verboten - sich der Gegner zu erwehren, mußte der Uebermacht weichen und zog sich, wie sämmtliche übrigen Wachen, nach dem Quartier des Herzogs zurück. Als Stadt und Wälle auf diese Weise in die Gewalt der Kreistruppen gelangt waren, ließ Klinckowströhm den Herzog noch einmal auffordern, er möge jetzt belieben, mit seinen Truppen den Ort zu verlassen, gab indessen, da es bereits spät geworden war, noch einmal Bedenkzeit bis auf den folgenden Morgen.
Am Abend trennten sich die früheren Güstrowschen Mannschaften von den Schwerinern. Sie blieben die Nacht auf dem


|
Seite 343 |




|
Domkirchhof, verweigerten den Gehorsam und ließen sich drohend vernehmen, sie würden auf die Schweriner Feuer geben.
Im Posthause rieth Graf Eck auf das entschiedenste, nicht zu weichen und im Falle des Angriffs Feuer geben zu lassen. Daraufhin erklärte der Herzog noch am 18. früh, als Klinckowströhm wieder jene beiden Offiziere sandte, er werde nicht fortgehen und Gewalt mit Gewalt vertreiben. Klinckowströhm zog nun noch die beiden Reiterkompagnien in die Stadt, ließ sie mit vier Kompagnien Infanterie bis an die Brustwehren heranrücken und das Posthaus auch im Rücken umstellen. Schon drang ein Trupp der Gegner durch die Justiz=Kanzlei von hinten nach dem Posthause vor, die allerdings wieder zurückgedrängt wurden; schon begannen die bis an die Brustwehren gerückten Kreistruppen diese zu übersteigen: da entschloß sich der Herzog zum Nachgeben trotz Ecks Widerspruch; 1 ) er ließ also die beiden Kreis=Kapitäne zu sich entbieten und sagte ihnen, daß er - unter Vorbehalt seiner Rechte - der Gewalt weiche, und obgleich der im Zimmer anwesende Graf Eck ihm sogleich ins Wort fiel und ihn inständigst bat, sich nicht fortzubegeben, blieb er doch bei seinem Entschluß und bewilligte auch die Forderung, daß das frühere Güstrowsche Militär am Platze bleiben solle. Die Kreistruppen bildeten nun in den Straßen bis zum Schnoienthor Spalier, um die Schweriner hindurchmarschiren zu lassen. Der Herzog selbst erhielt bis 4 Uhr Aufschub, erschien aber unerwartet schon um 1 Uhr vor seinem Quartier, stieg zu Roß und sprengte mit seinem Gefolge und der berittenen Garde hinter dem Dom herum und an der Mauer entlang zum Hagebökschen Thore hinaus. Seine Fußtruppen zogen um 2 Uhr mit Trommelschlag, doch ohne Schalmeien und mit zusammengebundener Fahne durch das Spalier ab. 2 )


|
Seite 344 |




|
Graf Ecks erzwungene Abreise.
Noch war der kaiserliche Bevollmächtigte Graf Eck anwesend. Obgleich ohne Ordre, wie er es mit ihm halten solle, glaubte doch Klinckowströhm sich verpflichtet, auch dessen Entfernung aus Güstrow zu erzwingen. Eine persönliche Begegnung zwischen Beiden fand im Zimmer des Herzogs nach dessen Abreise statt. Klinckowströhm betrat das Haus mit einer Anzahl von Offizieren, nach seiner Aussage, um die Räume, die der Herzog bewohnt hatte, zu besehen. Erst im Hause selbst hörte er, daß der Graf drinnen sei, und ließ sich darauf bei ihm anmelden, wurde auch vorgelassen und forderte nun den Grafen auf, weil dessen Verbleiben "Seiner Pincipalen Intention, sonderlich da Friedrich Wilhelm bereits abgereist und Er also an andern Ohrten commoder alß hier leben könnte, ganz nicht conveuable were, sich anderswohin zu begeben, da ihm besser seyn werde." 1 ) Der Graf schützte zuerst Mangel an Pferden und Wagen vor, schlug aber Klinckowströhms Anerbieten, sich seiner eignen Wagen und Pferde zu bedienen, aus; er werde nicht gehen, man trüge ihn denn hinaus. Er berief sich auch auf das Völkerrecht und erklärte, man möge ihm, da er keine Ordre zur Abreise habe, auch solche nicht anmuthen. Der Oberstleutnant erwiderte darauf, als ein Soldat begreife er nicht in diesem Stücke, was Jus gentium wäre, und bestand darauf, daß Eck binnen zwei Stunden abreisen müsse. Dann empfahl er sich und ließ kurz darauf, während Eck noch in des Herzogs Zimmer sich aufhielt, die Thorschlüssel, die dort aufbewahrt wurden, durch einen Fähnrich und einen Sergeanten mit vier Gemeinen abholen, wogegen Eck feierlich Protest einlegte.
Der Schluß der Szene spielte sich einige Stunden später in Ecks Wohnung, im Hause des Kanzleiraths Stieber, ab. Hier erschienen zuerst die beiden auch zu den bisherigen Verhandlungen benutzten Kapitäne v. Wolfrath und v. Löben und


|
Seite 345 |




|
drangen nochmals auf Abreise; auf Ecks Weigerung gaben sie noch zwei Stunden Frist, während dessen sie Pferde für die Kutsche des Grafen, auch für die Dienerschaft und Bagage Wagen und Pferde besorgen lassen wollten. Durch Requisition beim Bürgermeister wurden dann drei Wagen und 16 Pferde herbeigeschafft und Kapitän Schultz (aus Stralsund) an Eck gesandt, um ihm diese anzubieten. Nach Schultz's Bericht antwortete Eck, die Pferde und Wagen könnten zur Abfuhr der Bagage dienen; er für seine Person werde bleiben und warten, bis der Herr Oberstleutnant Leute schicke, die ihn hinaustrügen.
Nach Ablauf der zwei Stunden brachte der schwedische Sergeant Seeger die Anzeige, daß die "verlangten" Wagen und Pferde bereit und vor der Thüre seien. Auf der Diele begegnete ihm der schwerinische Oberstleutnant v. Schenk, der nach Seegers Aussage betrunken war. Mit ihm gerieth Seeger in einen Wortwechsel, bei dem der Oberstleutnant ihn hart anfuhr. Durch die lauten Worte aufmerksam gemacht, öffnete der Graf die Thür und fragte, was es gebe, worauf Seeger seine Meldung anbrachte. Schenk warf die Frage dazwischen: "Habt ihr auch einen Stuhl zum Tragen?" Seeger antwortete, man müsse zusehen, daß man einen herbeischaffe. Der Graf, der diese Worte hörte, schwieg dazu und schloß die Thür wieder.
Seeger meldete darauf Klinckowströhm, der Graf wolle nicht weg, wenn man ihn nicht trüge, und berichtete auch, was der Oberstleutnant Schenk gesagt, worauf Klinckowströhm anordnete, daß Seeger fünf Unteroffiziere, darunter auch Brandenburger und Lüneburger - zwei waren von Adel -, mitnehmen und einen bequemen, auf seinem Zimmer stehenden, mit rothem Sammet beschlagenen Sessel hintragen lassen solle, um einen solchen bei der Hand zu haben, falls der Graf "ferner befehlen werde, getragen zu werden". Doch will er den Unteroffizieren nachdrücklich eingeschärft haben, sich gegen den kaiserlichen Gesandten "mit der allergrößten praecaution, civilitaet und respect" zu betragen und keine Gewalt zu gebrauchen, vielmehr ihm vorzustellen, er möge sich selbst und den Fuhrleuten durch spätes Fahren zu keiner Unbequemlichkeit Anlaß geben. Der Sergeant trat also mit seinen Kameraden, indem sie den rothen Sessel vor der offenen Zimmerthür auf der Diele stehen ließen, in das Vorzimmer des Grafen ein, in dem sich neben andern auch der Graf befand. Seeger machte seine Bestellung, es sei Alles zur Abreise fertig. Eck antwortete, es sei ihm nicht gelegen, er wolle nicht weg, und fragte, als er durch die offene Thür


|
Seite 346 |




|
den Sessel erblickte, was dieser solle. Seeger erwiderte, S. Excellenz hätte ja solchen selber verlangt, worauf Eck sagte, er sei Gottlob noch in dem Stande, selber zu gehen. Auf eine neue Mahnung Seegers, der Graf möge die Fuhrleute nicht aufhalten, rief Eck aus: "So greifet mich denn an," und schlug, als Seeger auf ihn zutrat, mit beiden Händen vor sich mit den Worten: "Gegen einen Kerl wehre ich mich, aber nicht gegen viele." Seeger trat zurück und sagte: "Bewahre Gott! Jhro Excellenz, das hat gantz die Meinung nicht, ich finde mich auch nicht capable mit Ew. Excellenz mich zu überwerffen, habe auch im geringsten vom H. oberstleutnant keine ordre dazu, vielmehr Ew. Excellenz mit aller civilitaet zu begegnen und helffen, daß Sie vohrt zu Wagen kommen mögen." Nach einem weiteren Wortwechsel, worin der Graf fragte, ob die Unteroffiziere Ordre hätten, Gewalt zu gebrauchen und Seeger dies in Abrede nahm, that Eck einige Schritte nach der Thür mit erhobenen Händen und laut protestirend, daß ihm zu viel geschehe; Seeger ging rückwärts vor ihm her. In diesem Augenblick trat ein Lakai herein mit der Meldung, es sei noch nicht Alles fertig. Seeger ging nun hinaus, um nachzusehen, was es gebe. Es fand sich, daß des Grafen Diener, die inzwischen die Bagage aufgepackt hatten, die Befürchtung hegten, vier Pferde würden dessen Chaise nicht ziehen können. Als aber der Fuhrmann dies für möglich erklärte, trat Seeger wieder ins Zimmer mit der Anzeige, jetzt werde es an nichts fehlen, und bitte er gehorsamst, weil der Herr Graf einmal schon gütigst resolvirt hätte wegzugehen, bei der vorigen Meinung zu verbleiben. Eck gab wieder die Antwort, er ginge nicht von seinem Posten, er werde denn mit Gemalt davongetragen, und ob der Sergeant Ordre dazu habe? Seeger verneinte dies. Darauf schwieg der Graf einen Augenblick und rief dann überlaut: "Wo ich weg soll, so fasset mich an! Nach einigem Zaudern trat Seeger mit einer Verbeugung an den Grafen heran und rührte, wie er selber nachher behauptet hat, nur mit seiner rechten Hand an des Grafen linken Aermel, als wenn er ihn fortführen wolle. Der Graf hob nun beide Hände auf und rief überlaut, ihm geschehe die größte Gewalt. Seeger trat sofort einige Schritte zurück und sagte, Excellenz möchte dies für keine Gewalt von ihm aufnehmen, er wisse nicht, daß er eine einzige Miene gemacht haben sollte, woraus man eine Gewalt abnehmen könne. Darauf sagte Eck, er habe auf sie nichts zu sagen und sei mit ihrer Höflichkeit wohl zufrieden; er würde auch des Herrn Kapitäns Conduite,


|
Seite 347 |




|
so der Herr Oberstleutnant zu ihm geschickt, zu rühmen wissen, welchem er seinen Gruß zu hinterbringen bitte, das übrige aber wolle er für die größte Gewaltthat annehmen, da er leicht merken könne, was Seeger für Ordres haben müßte. Darauf ging er - wie die Kreisunteroffiziere ausgesagt haben -, ohne angefaßt zu sein, indem die Unteroffiziere ihn begleiteten, aus dem Zimmer und dem Hause, mit erhobenen Händen protestirend, stieg in die Kutsche - es war gegen 6 Uhr - und ward nach Bützow gefahren, von wo er am nächsten Morgen nach Schwerin zum Herzog sich begab.
Nach Ecks eigenem Bericht sind die Unteroffiziere zuletzt auf Seegers Befehl auf ihn zugetreten und haben ihn zwar anfangs um Verzeihung gebeten, aber ihn endlich nach und nach zur Thür aus der Stube bis an den Wagen geschoben. 1 )


|
Seite 348 |




|
Der Handstreich war also vollkommen gelungen. Da eine neue Regierung sich nicht auf der Stelle einsetzen ließ, so wurden noch am Abend des 19. die Justizkanzlei, das Geheime Rathszimmer, die Räume der Kammer und Renterei versiegelt.
Am folgenden Tage wurde das Güstrowsche Militär, mit Ausnahme der Offiziere und der meisten Unteroffiziere, die man entließ, durch Drohungen, man werde sie sonst an Händen und Füßen fesseln lassen, genöthigt, "dem Hause Mecklenburg unter dem Kommando der kreisausschreibenden Fürsten" einen Treueid zu leisten. Die drei Kompagnien zu Fuß gehorchten auch, ohne sich viel zu sperren; die Leibgarde zu Pferde weigerte dagegen anfänglich den Eid, allein in kleinen Trupps vorgeführt und hart bedroht, fügte auch sie sich. Noch einmal versuchten dann die Güstrower eine Auflehnung, als sie den 22. auf Wache kommandirt wurden. Sie schützten vor, sie hätten nur dem Hause Meklenburg und nicht dem Oberstleutnant Treue geschworen und versagten den Gehorsam, allein eine reichliche Anwendung der Prügelstrafe gegen die Renitenten brach ihren Widerstand. 1 )
Inzwischen war auch Boizenburg, nächst der Hauptstadt der wichtigste Ort des Herzogthums, in den Besitz des Kreises übergegangen. Der schwedische Kapitän Wulfrath war hier den 20. erschienen und hatte nach Weigerung des Fähnrichs Lanckow, freiwillig abzuziehen, mit Hülfe der dort noch liegenden Schweden die Schweriner Wachen von ihren Posten fortdrängen lassen und die früheren Güstrower unter der Besatzung von den Schwerinern


|
Seite 349 |




|
getrennt. Es wurde dann vereinbart, daß die Schweriner den 21. früh abmarschiren sollten, was auch Morgens um 6 Uhr geschah. Die Güstrower leisteten auch hier den gleichen Eid wie ihre Kameraden in Güstrow.
VIII.
Der Streit zwischen dem Kaiser und den Kreisdirektoren.
Die letzten kaiserlichen Reskripte vor der Depossedirung und die ersten nach derselben.
So war durch das vereinigte Kreisdirektorium der kaiserliche Richterspruch gewaltsam umgestoßen, der durch ihn eingesetzte Landesfürst verjagt und der Vertreter der kaiserlichen Majestät ebenfalls, und zwar nicht ohne persönliche Verunglimpfung, aus dem Lande entfernt worden.
Es konnte nicht fehlen, daß dieses Vorgehen in aller Welt das größte Aufsehen, in Wien helle Entrüstung erregte. Der Kaiser, sagte einer der Wiener hohen Beamten, 1 ) werde eher Krone und Szepter daran setzen, als solche unerhörte Beschimpfung dulden. Im ersten Unwillen ward (d. 20./10. April) den Gesandten der drei Mächte in Wien der Hof verboten. Allein der Gewalt mit Gewalt zu begegnen, war man nicht in der Lage. Gern hätte man eine andere Macht, z. B. Dänemark, vorgeschoben, indessen Dänemark verhielt sich gegenüber den Sondirungen des Schweriner Gesandten v. Halberstadt ablehnend, noch viel weniger dachte von den übrigen deutschen Fürsten einer daran, der Koalition der drei mächtigsten norddeutschen Höfe mit Gewalt entgegenzutreten, wenn sie es auch an höflichen Betheuerungen der Theilnahme für Friedrich Wilhelm, auch wohl des Unwillens über das Geschehene nicht fehlen ließen.
Die nächsten zwei Expeditionen aus der kaiserlichen Hofkanzlei nach der vom 6. März, eine vom 20. März und eine vom 3. April, waren noch abgesandt, ehe man Kenntniß von den


|
Seite 350 |




|
Vorgängen des 18./28. März hatte, doch waren die Absichten der Kreisdirektoren sowie die Truppenansammlungen an der meklenburgischen Grenze bereits bekannt. Der Kaiser spricht demzufolge den 20. März in einem Schreiben an Eck die Hoffnung aus, daß diese Gerüchte grundlos oder die Kreisdirektoren inzwischen durch die Verordnungen vom 6. März auf andere Gedanken gebracht seien, sendet aber doch auf alle Fälle neue Verordnungen an Friedrich Wilhelm, die Possession von Güstrow weder an die kreisausschreibenden Fürsten noch an jemand anders abzutreten und sich, falls Gewalt gebraucht werden sollte, auf alle thunliche Weise dagegen zu schützen, an Adolf Friedrich, sich nur an den Kaiser und den ordentlichen Weg Rechtens zu halten, an die Ritter= und Landschaft sowie die Beamten und Unterthanen des Herzogthums Güstrow, bei Vermeidung der kaiserlichen Ungnade und scharfer Bestrafung, Niemandem als dem Kaiser und Herzog Friedrich Wilhelm anzuhängen, an die kreisausschreibenden Fürsten, deren Amt es sei, vielmehr die kaiserlichen Urtheile in Fällen, da es nöthig sei und deswegen requirirt werde, zu befördern als zu hindern, sie möchten das etwaige Vorhaben ihrer Minister in Hamburg inhibiren und Adolf Friedrich an den Kaiser verweisen; auch die kaiserlichen Gesandtschaften in Regensburg sowie in Schweden, im Haag und in England werden angewiesen, wenn die Rede auf den Güstrowschen Erbfolgestreit komme, "aller Orten den Unfug des Kreisdirektoriums vorzustellen". 1 )
Bei Abgang der Expedition vom 3. April war schon bekannt, daß sich eine ziemliche Anzahl Kreisvölker der Stadt Güstrow nähere. Friedrich Wilhelm wird deshalb ermahnt, sich nichts gegen die kaiserliche Autorität aufdrängen zu lassen, noch sich des Besitzes von Güstrow zu begeben; die Herzogin=Wittwe, die man in dem - allem Anschein nach unbegründeten - Verdacht hatte, ihre Hand mit im Spiele zu haben, wird gewarnt, "von all dergleichen abzustehen"; die Kreisdirektoren werden nochmals ernstlich ersucht, dem kaiser=


|
Seite 351 |




|
lichen Urtheil nicht zuwider zu sein; ja es wird an ihre Truppen ein besonderes Mandatum Avocatorium et Inhibitorium erlassen, in dem Jeder mit der Reichsacht (!) bedroht wird, der sich gegen den Kaiser gebrauchen lasse; Ritter= und Landschaft, Bürger, Unterthanen und Angehörige des Herzogthums Güstrow erhalten ein Protectorium, worin aber zugleich auf Zuwiderhandlungen, d. h. auf Unterstützung der Kreistruppen u. dergl., eine Strafe von 100 Mark Goldes gesetzt wird.
Ueber die vollzogene Thatsache der Deposedirung äußerte sich der Wiener Hof den 13. April. Das Reskript an die Kreisdirektoren, das von diesem Tage datirt ist, ergeht sich in den schärfsten Ausdrücken des Unwillens über das "niemahlen, seit des unter einem Christlichen Haupte stehenden Römischen Reichs, erhörte, contra jus gentium, ja wider Vernunfft selbsten lauffende factum." In keinen Reichs=Satzungen sei dem Kreisausschreibe=Amt solche absolute Gewalt gegen ihr von Gott vorgesetztes allerhöchstes "Oberhaupt mit so entsetzlichen, auf so vielfältiges unschuldiges Blutvergießen abgezielten violentien. außzubrechen gegeben", vielmehr werde den Kreisdirectorien in krafft des klaren Inhalts des Recesses vom Jahre 1555 § 73 befohlen, "sich keiner Hoheit über andere Stände anzunehmen, oder sich unter dem Schein dieses Amts Verwaltung in einige Superiorität über die andern einzudringen, oder ferneren Gewalts und Macht, alß Jhnen vermöge dieser Ordnung zustehet, anzumaßen", und nur wenn Kriegs=Empörung, Rottirung und scheinbare (d. i. augenscheinliche) Gefahr zur thätlichen Handlung vorhanden, werde den Kreisdirektoren durch die Reichskonstitutionen aufgetragen, darauf Obacht zu haben, solches abzuwenden, jedoch aber dem Kaiser als des Reichs höchstem Oberhaupt und dem von dem Kreise erbetenen General=Obristen, von ihrem Vorhaben und, was sie dazu veranlaßt, Nachricht zu geben. Der Kaiser weist dann darauf hin, wie er in seiner vierzigjährigen Regierung sich jeder Zeit auf das Aeußerste angelegen sein lassen, damit "die heilsahm justitz, alß die grundfeste eines wollstehenden Reichs, bey ihrer gerechtsahme manuteniret, und dan das gesamte Heil. röm. Reich von aller in= und außwärtigen beunruhigung frey gesetzet werde. Er habe dazu mit exponirung seiner Erb=Königreiche und Lande, sacrificirung seiner milice, und Erschöpffung seiner Cameral=Mittel ohnaußsetzlich und jederzeit gantz geneigt concurriret, und werde nicht ermangeln, auch noch ferner, auf und so lange dem Allerhöchsten, Jhn die Bürde des Reichs=Regiments tragen zu laßen, gefalle, ohnverrückt darin zu verharren." Dieser


|
Seite 352 |




|
Gedanke bietet den Uebergang zu der Erklärung, daß der Kaiser auch jetzt zur Bezeigung seiner auf gänzliche Beruhigung des Reiches beständig gerichteten Gesinnung, obgleich er ganz wohl befugt sei, diesen gegen ihn "außgebrochenen ärgerlichen hostilitaten mit höchstbilliger Gleichförmigkeit zu begegnen", damit noch anstehen wolle; und da er für den König (resp. Kurfürsten oder Herzog) jeder Zeit eine "particuliere propension getragen" und solches ihm selbst wie seinem Hause durch die That bezeugt habe, so könne er nicht glauben, daß dieses alles von jenem so schlechterdings außer acht gesetzt sei, vielmehr sei er überzeugt, daß jener "als Teutscher, auf die beforderung und Concurrirung der Kayserl. Ehre und reputation verpflichteter Fürst, und vornehmes Mitglied des heil. Reichs, sonderlich bey jetzigen beschwerlichen Kriegen und conjuncturen, solche unerhörte abscheuliche Mißhandlung und Vergreiffung an den Kayserl. characterisirten Personen fürzunehmen, keines weges werde befohlen und bewilliget haben, oder auch guht heißen und approbiren, sondern vielmehr dieses alles, auß einem unzeitigen Eyfer und Hitzigkeit derer von Jhrem Hause, und in Hamburg sich befindlichen Ministrorum und des Klinckoströms herrühren", und daß deshalb die Fürsten ihre Truppen aus Meklenburg wieder abberufen, die schuldigen Räthe und Minister exemplarisch bestrafen, Klinckomströhm aber und diejenigen, welche sich an dem kaiserlichen Gesandten vergriffen, zur Abstrafung unverlängt stellen, damit der Kaiser "wiedrigenfalß nicht gemüßiget werde, gegen dieselben zu würklicher satisfaction und redressirung des gantzen werckes selbsten, eine demonstration fürzunehmen." Im Falle die Fürsten "sich sothanen scandaleusen Verfahrens theilhafftig machen, und es approbiren, auch darauf weiter verharren, und die verlangte satisfaction entziehen wollten, werde der Kaiser nicht allein die gebührende ferner fürnehmen laßen, sondern hebe auch hiermit alles, was von jenen bey diesem wercke, gegen die allerhöchste Kayserl. authorität und jurisdiction wie auch gegen alle Rechte und Reichssatzungen verübet worden, gänzlich auf, cassire und annullire es, alß menn dergleichen Thätlichkeiten niemahls vorgegangen oder verübet werden wären, dem Herzog Friedrich Wilhelm aber confirmire und bestätige Er alle seine Rechte und Gerechtigkeiten hiermit kräfftigst." Der Kaiser hofft, daß die Fürsten "dero bey dem Reiche erworbenen ruhm eines Patriotischen Fürsten, durch etwanige hitzige consilia, und von Privat=Personen herrührende passiones auf solche wieder ein gekröhntes, und dem reiche so viele jahre, in ver=


|
Seite 353 |




|
schiedenen schweren Angelegenheiten, mit Anwendung aller möglichsten kräffte, vorgestandenes allerhöchstes Oberhaupt ergriffene Art, nicht in die Gefahr setzen."
Auch an die Regensburger Gesandtschaft ging den 13. April wieder ein Schreiben aus Wien ab, worin sie Nachricht von dem Vorgefallenen erhielt, damit sie das Verfahren des Kreises gehöriger Orten vorstellen könne, und die Güstrowsche Ritter= und Landschaft erhielt ein Mandat mit dem erneuten Befehl, bei Strafe von 100 Mark lötigen Goldes, ungeachtet der Thätlichkeiten des Kreisdirektoriums, sich nur an den Kaiser zu halten und Friedrich Wilhelm nach wie vor für ihren Landesfürsten zu achten; auch in diesem Schriftstück wird alles, was das Kreisdirektorium vorgenommen, für null und nichtig erklärt.
In ähnlichem Sinne hatte Friedrich Wilhelm sogleich nach seiner Wiederankunft zu Schwerin an die Stände wie Beamte Schreiben erlassen, in denen er sie mahnt, ihm treu zu bleiben und dem Kreisdirektorium den Gehorsam zu versagen, und den 24. März ein Reskript folgen lassen, worin u. a. allen Beamten anbefohlen wird, sub poena dupli nichts von den Revenüen des Herzogthums Güstrow an den Kreis auszuzahlen.
Freilich, Herzog Friedrich Wilhelm war machtlos, der Kaiser in Wien, und die Truppen der Kreisdirektoren standen im Lande, Gehorsam fordernd und ihn zu erzwingen gewillt. Dadurch kam das Güstrowsche Land, wie seine Stände und Beamten in eine höchst mißliche Lage.
Die Güstrowschen Beamten und Stände unter der Interims=Regierung.
Gleich im März war jedem der Landräthe, als sie sich weigerten, bei einer Vertheilung der Kosten für die Einquartierungslast mitzuwirken, eine Kompagnie auf ihre Güter gelegt worden. Indessen zogen die Kreistruppen größtentheils Ende März wieder ab, mit Ausnahme derer, die bereits vorher im Lande gestanden hatten, und der drei im Januar aus Wismar ausgerückten schwedischen Kompagnien, die wieder in den Aemtern Güstrow, Schwaan und Ribnitz Quartier nahmen. Auch diese drei marschierten den 2. Ostertag (d. 5. April) nach Wismar zurück und ließen nur auf jedem Hofe und auf den Amtshäusern in den drei Aemtern einen oder einige Mann liegen "zur Behauptung der Possession". Und für die noch im Lande verbleibenden Truppen wurde nicht die Löhnung, sondern nur das


|
Seite 354 |




|
Service verlangt, dieses aber sollte schon vom Januar ab nachgezahlt werden. Für die früheren Güstrower Truppen mußte auch Löhnung beschafft werden, weshalb Klinckowströhm sich wieder an die Stände wandte.
Auf Anweisung Friedrich Wilhelms (vom 1. April und 3. Mai) weigerten diese fortgesetzt ihre Mitwirkung bei der Repartition der Kosten, worauf Klinckowströhm sie auf eigene Hand vornahm. Um Geld zur Löhnung der Güstrower Truppen zu bekommen, ordnete er an, daß sämmtliche Domänenpächter des Amtes Güstrow die Pachtsumme, die sie zu Ostern d. J. schuldig waren, vom 7. April an ihn abliefern sollten. Sie baten durch ein Schreiben vom 4. April in Schwerin um Verhaltungsmaßregeln und stellten dabei vor, daß ihre Bauern bereits ohnehin durch die Einquartierung so mitgenommen seien, daß sie weder Brod= noch Saatkorn mehr hätten, und also durch eine Exekution völlig ruinirt werden würden, so daß sie würden davon gehen und die Höfe wie die Bauern=Hufen unbestellt und unbesät würden bleiben müssen. 1 ) Angewiesen, die Summe nicht an Klinckowströhm, sondern an den Güstrowschen Landrentmeister Dörckes zu bezahlen, gehorchten sie und machten Klinckowströhm Anzeige davon. Dieser ließ nun den 8. April durch einige Soldaten 1000 Th. aus dem Hause des Landrentmeisters abholen trotz der Proteste desselben. Den 28. April wurde Dörckes aufgefordert, die Schlüssel zur Rentkammer herauszugeben, und als er es weigerte, ein Schmied geholt, um die Thür zu erbrechen; endlich, als dieser schon bei der Arbeit war, entschloß sich der Rentmeister, die Thür aufzuschließen. Es fanden sich noch 1060 Th. in der Kasse; Klinckowströhm ließ sie den 5. und 6. Mai abholen und den 6. auch durch einen Sekretär den Schlüssel zur Rentkammer trotz der Proteste des Landrentmeisters wegnehmen.
Am 5. Mai kamen in Güstrow die drei Räthe an, die von den Kreisdirektoren zur Einrichtung und Führung einer Interims=Regierung abgeordnet waren: J. Chr. Koch (Schwede), T. Schreiber (Brandenburger) und E. W. Spörcke (Lüneburger) 2 ). Sie eröffneten die versiegelten Collegia wieder, for=


|
Seite 355 |




|
derten die Schlüssel von den Beamten, in deren Verwahrung sie waren, nöthigenfalls mit Gewalt, ab und suchten die Landesverwaltung wieder neu zu organisiren und die Finanzgefälle des Landes an sich zu ziehen; auch begannen sie sogleich mit den fürstlichen Amtleuten über einen zu leistenden Eid sowie mit den Ständen zu verhandeln. Da sie fast ohne Unterbeamte gekommen waren, so suchten sie von den früheren Güstrowschen Beamten so viel, wie sie brauchten, zur Fortführung ihrer Funktionen im Dienste des Kreises zu bewegen.
Die drei Männer hatten eine recht dornenvolle Aufgabe übernommen, denn sie sahen sich anfänglich bei jedem Schritte, den sie thaten, einem einmüthigen Widerstande gegenüber. Es muß anerkannt werden, daß sie, um ihn zu brechen, kein größeres Maß von Strenge anwandten, als für ihren Zweck unvermeidlich war. Weit höhere Anerkennung aber verdienen die Güstrowschen Beamten wie Stände, die ihrem vom Kaiser eingesetzten Fürsten die Treue hielten und seinen Weisungen folgten, so lange es irgend möglich war, so viel Ungemach sie sich auch dadurch zuzogen.
Es würde zu weit führen, hier die Schicksale eines jeden einzelnen Beamten, wie sie sich aus den im Archiv aufbewahrten Berichten herausschälen lassen, ausführlich zu erzählen, ein kurzer Ueberblick aber ist nicht nur für die damalige Lage des Landes lehrreich, sondern erfüllt auch eine Art Ehrenpflicht der Geschichtsschreibung gegen die Männer, die damals für ihren Fürsten gelitten haben. Wir beginnen mit den in Güstrow selbst wohnenden Beamten.
Ein Abtrünniger fand sich unter ihnen gleich in den ersten Tagen der Kreisregierung, es war der Archivar Chop, der dann später - 1701 - in Adolf Friedrichs Dienste trat. Auch der Rentschreiber Storm leistete den 12. Mai, nachdem er sich einige Tage lang hatte nöthigen lassen, dem Kreise den Eid und ward dafür mit der Funktion des Landrentmeisters betraut an Stelle des bisherigen Landrentmeisters Dörckes, der sich für den Kreis nicht hatte gewinnen lassen. Später stellte sich heraus, daß Herzog Gustav Adolf, als er auf dem Todtenbette lag, Storm die Obhut über eine Anzahl wichtiger, in der Renterei aufbewahrter Urkunden besonders ans Herz gelegt hatte, zu denen dieser, da ja die Räume der Renterei beim Einbruch der Kreistruppen versiegelt worden waren, nicht anders gelangen konnte, als wenn er sich durch Wiederaufnahme seiner Funktion Zutritt dazu verschaffte. Er fand denn auch Gelegenheit, sie für die Zeit der


|
Seite 356 |




|
Interims=Regierung unauffällig bei Seite und in sichere Verwahrung zu bringen. Von diesen beiden abgesehen, ließ sich keiner der in Güstrow selbst stationirten Beamten des Geh. Rathes, der Kammer und Renterei für den Kreis gewinnen, 1 ) und soweit Amtshandlungen von Seiten des Kreises von ihnen begehrt wurden, ließen sie sämmtlich es erst auf den Zwang ankommen.
Der Kammersekretär Joh. Schuckmann lieferte den Schlüssel zur Kammer den 12. Mai nicht aus, sondern ließ ihn sich wegnehmen, der Kanzleisekretär Moritz Heim wurde, als er den 14. die Schlüssel zur Justiz=Kanzlei abzuliefern sich weigerte, mit 20 Thaler Strafe und mit Exekution bedroht, falls er die Schlüssel bis zum 15. Mittags 12 Uhr nicht ausliefere. Er sah sich also genöthigt, zu gehorchen. Dann verlangte man Rechnung über die fiskalischen Strafgelder von ihm, er berichtete dies nach Schwerin und erhielt von dort Befehl (d. 26. Mai), sie zu weigern. Dafür ward er den 26. Juni mit Hausarrest belegt, bis er die Rechnung eingeliefert; den 7. Juli erhielt er ein neues Drohschreiben, und da ihm zu Ohren kam, daß man ihn in Gewahrsam bringen wolle, so fügte er sich und lieferte die Rechnung ab.
Auch vom Landrentmeister Dörckes ward Ablegung der Rechnung von Johannis 1696 an verlangt; er ward den 29. Mai mit 1000 Th. Strafe bedroht, wenn er sie nicht binnen sechs Wochen einliefere, und erhielt den 2. Juni zur vorläufigen Bestrafung 2 Musketiere in Exekution, wodurch er sich denn auch das Versprechen abnöthigen ließ, mit der Arbeit zu beginnen.


|
Seite 357 |




|
Ueber sämmtliche frühere Güstrowsche Beamte, die ihren Wohnsitz dort noch hatten, kam Ende Juni eine empfindliche Heimsuchung. Es hatte sich das Gerücht verbreitet, daß Kursachsen für den Kaiser mit Heeresmacht eintreten werde, und daß 8000 Sachsen auf dem Marsche nach Meklenburg seien. Die Kreismächte trafen deshalb Anstalten, um ihnen zu begegnen, und Schweden warf zur Verstärkung der Güstrower Garnison vier aus den 18 in Wismar liegenden ausgesuchte Kompagnien Infanterie, zusammen 400 und etliche 30 Mann, nach Güstrow (d. 24. Juni). 1 ) Bei deren Einquartierung wurden - wie Mumme schreibt, auf Veranstaltung der "gottlosen" Bürger selbst, aber doch vermuthlich auch als Strafe für ihre ablehnende Haltung - gerade die Beamten, die als fürstliche Diener sonst von solchen Lasten frei waren, besonders stark belegt. Mumme hatte auf seiner kleinen Meierei vor der Stadt drei Tage lang einen Kapitän und 30 Gemeine liegen, er löste deshalb seinen Haushalt in Güstrow ganz auf und zog nach Rostock, um dort bessere Zeiten abzuwarten. Das Gerücht vom Anrücken der Sachsen erwies sich übrigens sehr bald als falsch, und am 8. Juli marschirten die Schweden nach Wismar zurück.
Noch aber war den Beamten keine Ruhe gegönnt. Es fand sich, daß in den Registraturen und im Archiv nicht alle Akten vorhanden waren; die fehlenden vermuthete man in den Händen der früheren Güstrower Beamten. Es erging also an diese die Aufforderung, die Akten, die sie etwa noch in Verwahrung hätten, herauszugeben oder einen Eid zu leisten, daß sie seit Anwesenheit der Kreisregierung keine mehr gehabt hätten. Am glimpflichsten verfuhr man mit dem alten und kranken Oberpräsidenten v. Ganß; er erhielt d. 7. Juli Befehl, sobald sein schwächlicher Zustand eine Durchsicht seiner Papiere erlaube, alle öffentlichen Dokumente und Akten herauszugeben; soweit ersichtlich, ist indessen der Befehl unausgeführt geblieben.
Schärfer trat man gegen die übrigen auf. Den Hofräthen Duncker und Schäffer z. B. holte man die Akten, da sie sie einem Befehl aus Schwerin zufolge nicht ablieferten, mit Gewalt aus ihren Zimmern hinweg. Der Geh. Sekretär v. Pommer Esche, der eine Anzahl Akten nach Schwerin gesandt hatte, ward den 8. Juli mit Exekution (von einem Musketier) und Stadtarrest belegt, bis er die geforderten Akten herausgebe oder beschwöre, daß er sie bereits früher an Friedrich Wilhelm abgeliefert habe.


|
Seite 358 |




|
Er erwirkte die Erlaubniß zu einer Reise nach Schwerin, um in der dortigen Geh. Registratur die abgelieferten Akten nach sehen und ein Verzeichniß derselben nebst einem Lieferungsschein sich ausstellen zu lassen. Auch damit war indessen die Kreisregierung noch nicht zufrieden; sie verlangte den Eid, der aber war pommer Esche in Schwerin verboten werden. So wurde den 20. Juli der Soldat ihm wieder ins Haus gelegt, auch Stadtarrest wieder verhängt. Den 24. ward die Exekution verdoppelt und der Stadtarrest in Hausarrest verschärft. Pommer Esche klagte in einem Schreiben, das er den 26. Juli nach Schwerin sandte, die beiden Leute forderten Branntwein und Bier, "so viel sie saufen könnten" 1 ) und verübten auch sonst allerlei Mutwillen, den Tag über hätten sie meistens einige ihrer Kameraden bei sich und verursachten mit beständigem Tabackrauchen nicht geringen Verdruß. Es ginge das Gerücht, daß er bei weiterem Widerstand gefänglich eingezogen werden solle, er bat deshalb um die Erlaubniß, den Eid leisten zu dürfen, worauf er denn auch d. 2. September die Erlaubniß erhielt und den 6. September durch Leistung des Eides sich von Exekution und Hausarrest befreite.
Von den außerhalb Güstrows stationirten fürstlichen Beamten waren die wichtigsten der Zollinspektor Thilo in Boizenburg und der Verwalter der Saline in Sülze, Valentin Möller. Thile wurde schon auf den 15. Mai nach Güstrow geladen, erhielt aber (d. 29. Mai) Aufschub bis zum 7. Juni, bei Gelegenheit einer Reise nach Güstrow - Ende Mai - wurde er hier sogleich von der Kreisregierung vor die Amts=Kammer gefordert und ihm der Antrag gemacht, in Kreisdienst zu treten. Er lehnte dies ab, stellte sich den 7. Juni nicht und erhielt den 28. Juni Befehl, die Zollzettel vom Januar an mit einem Extrakt, was von dieser Zeit an bis Johannis an den Grafen Bielke abgeführt werden, einzusenden. Zum 6. Juli wieder peremptorie vorgefordert, ward er in Güstrow krank und konnte schon deshalb der Citation nicht Folge leisten; darauf ward er den 10. Juli - in Güstrow - mit zwei Mann Exekution belegt, und als er den 16. Juli zum ersten Mal seit seiner Krankheit ausgehen wollte, ward ihm der Hausarrest angekündigt.


|
Seite 359 |




|
Den 17. Juli schrieb der Oberpräsident v. Ganß nach Schwerin und rieth, der Herzog möge gestatten, daß Thile sich dem Kreise pflichtig mache; es sei gefährlich, die arcana des Zolles in andere - z. B. lüneburgische - Hände kommen zu lassen. Von Schwerin aus bekam Thilo nun Ordre, zu veranlassen, daß er auf Kaution entlassen werde, und nach Schwerin zu einer mündlischen Besprechung herüberzukommen (d. 19. Juli), allein sein Gesuch wurde von der Kreisregierung abgeschlagen und ihm nur noch drei Tage Bedenkzeit gegeben (d. 23. Juli). Man wartete aber mit weiterer Verfügung noch einige Tage länger, und in einer Geh. Ratssitzung am 29. Juli gab Herzog Friedrich Wilhelm seine Einwilligung zur Unterwerfung Thiles unter die Kreisregierung. Dieser erhielt im Geheimen einen Wink, es nicht zum Aeußersten kommen zu lassen, und es gelang ihm, den 31. Juli die Kreisräthe zu bewegen, ihn von der Leistung eines langen Eides, den sie ihm vorgelegt hatten, zu entbinden und sich mit einem Handschlag und der kurzen Versicherung zu begnügen, daß er auf Grund seines dem Herzog Gustav Adolf geleisteten Eides "des Fürstl. Mecklenburgischen Hauses Beste unter des Kreises Direction" beobachten wolle.
Der Salinen=Verwalter Möller, der etwa 3000 Th. Kapital in der Saline stecken hatte, folgte einer Citation nach Güstrow auf. den 7. Juni und ward hier mit Verjagung von seinem Posten bedroht, wenn er sich nicht dem Kreise pflichtig mache. Er meldete dies den 11. Juni nach Schwerin, erhielt aber von hier (d. 13. Juni) einen Verweis, daß er überhaupt der Citation der sogenannten Kreisregierung gehorcht habe, und die Mahnung, den kaiserlichen Verordnungen bei der darin angedrohten Strafe nachzuleben. Als er darauf zwei von der Kleisregierung geforderte Schriftstücke, darunter einen Ueberschlag über die von Johannis 1697-98 etwa zu hoffende Einnahme, nicht einsandte, ward er d. 25. August bei 100 Th. Strafe sofort nach Güstrow vor die Kammer geladen. Den 4. September ward er zu 100 Thaler Strafe förmlich verurtheilt und Exekution durch einen Reiter verhängt, wofür die tägliche Gebühr 8 ßl. nebst freiem Mahl und Futter für das Pferd betrug, die Citation aber bei Strafe erneuert. Er ging darauf den 21. September nach Güstrow, wo ihm mitgetheilt ward, daß er die Stadt nicht eher wieder verlassen dürfe, als bis er durch einen Eid sich der jetzigen Regierung verbindlich gemacht; weigere er sich noch ferner, so werde er kassirt werden. Darauf endlich leistete er den Handschlag in derselben Weise wie Thilo.


|
Seite 360 |




|
In eine sehr üble Lage geriethen auch manche der Beamten auf den Aemtern, die bei Uebernahme derselben Kautionen gestellt und auch wohl Summen aufgewandt hatten, um die Ackerwirthschaft in Gang zu bringen, und die nun in Gefahr kamen, Kaution wie Vorschüsse einzubüßen.
Schon im Mai verlangte die Interims=Regierung von den Amtshauptleuten und Domänenpächtern die Auszahlung der von Johannis 1696 bis 97 etwa noch restirenden Pension, und zwar ward die Entrichtung der erst zu Johannis fälligen Quote gleich mitverlangt und außerdem ein Handschlag der Treue gefordert. Ueber das Verhalten der Gutspächter fehlt es an Nachrichten, es mag noch mehreren ähnlich gegangen sein, wie dem Pächter von Schwiesow im Amte Güstrow, Namens Reuter, dessen Erlebnisse aktenmäßig feststehen. Reuter ward, als er den Handschlag weigerte, sogleich zu 200 Th. Strafe verurtheilt und mit Verjagung von seinem Hofe bedroht. Als er für diesen Fall Auszahlung des früher gemachten Vorschusses und Ersatz für das den Bauern geliehene Korn und Vieh im Werthe von etlichen 100 Th. verlangte, ward er damit abgewiesen. Ein anderer Pächter, der das Gut übernehmen sollte, war bereits zur Hand; so fügte sich Reuter, um nicht ruinirt zu werden.
Ueber die Aemter fließen die Nachrichten reichlich. Das Amt Ivenack verwaltete im Auftrage des Hauptmanns Junge, der dafür 6000 Th. Kaution gestellt hatte, der Leutnant Röhl, der selbst wieder 3000 Th. an Junge gezahlt hatte. Er ward auf den 27. Mai nach Güstrow berufen, um dort die Pension bis Johannis 1697 zu entrichten, und zugleich angewiesen, das Salzgeld 1 ) einzuziehen und 14 Tage vor Johannis einzuschicken. Er gehorchte nicht, erhielt also Exekution und wurde dann bei einer Reise durch Güstrow festgehalten und vor die Kreisräthe geführt. Ein Mandat auf 100 Th. Strafe lag ausgefertigt da, ihm ward mitgetheilt, er habe den 3. Juni die Pension zu zahlen. Als er auch dies unterließ, ward zu dem einen Musketier noch ein zweiter und ein Korporal auf seinen Hof gelegt. In einem Klagebrief, den er darauf noch Schwerin schickte, heißt es, das Amt sei ohnehin schon ruinirt, im verwichenen Jahre sei das Getreide meistentheils taub gewesen und erfroren, die Bauern hätten weder Saat= noch Brodkorn, das Amtshaus, in=


|
Seite 361 |




|
gleichen die Zimmer auf dem Meyerhofe fielen zusammen, so daß er selbst das Futterkorn nicht mehr ins Trockene bringen könne und in seiner Wohnung (im Amtshause) in Lebensgefahr schwebe. Weitere Nachrichten fehlen; es ist anzunehmen, daß auch Röhl sich über kurz oder lang zum Gehorsam gegen die Kreisregierung bequemt hat.
Exekution (einen Reiter) finden wir auch in Fürstenberg bei Hauptmann Vict. Siegism. v. Oertzen, in Broda bei Amtmann Brunsich und in Neukalen bei O. Fr. v. Thun, der den 4. Juni ebenfalls lebhaft über "den miserablen Zustand der armseligen Bauern" klagt, die wegen Mangels an Brodkorn kaum das Leben haben. Trotzdem ward ihm von der Kreisregierung noch ein Vorschuß von 150 Th. auf die Herbstpension, zahlbar in drei Raten, d. 28. Juli, 28. August und 28. September, abgefordert. Ebenso erhalten Hauptmann v. Erlenkamp im Amte Plau und Amtmann Grabow in Goldberg Exekution wegen Nichtzahlung der Pachtgelder, die seit dem 20. August verdoppelt ward. Erlenkamp rechnet den 3. Januar 1698 aus, daß die Exekution, die er schon 8 Monate im Hause gehabt, ihn bereits 120 Th. gekostet. Selbst das Amt Wredenhagen, das Graf Bielke in Pfandbesitz hatte, ward nicht verschont. In Ribnitz mußte der Amtmann Christiani nicht nur verdoppelte Exekution leiden, sondern ward schon im Juni durch zwei Reiter nach Güstrow in Gewahrsam gebracht und mußte sich hier d. 15. Juni zum Handschlag verstehen.
Amtmann Krull in Boizenburg hatte schon seit dem 15. Mai doppelte Exekution, den 1. Juni wurde er gar, weil er wieder einer Berufung nach Güstrow nicht Folge geleistet hatte, mit einem Korporal und 12 Mann belegt. Er hatte mit seinem Vater einen Vorschuß von 7-8000 Thaler auf das Amt gemacht, und der Vater besaß in Boizenburg eine große Holzhandlung mit bedeutender Schifffahrt auf der Elbe; alles dies war in Gefahr, trotzdem gehorchte er der Weisung von Schwerin (Schr. v. 9. Juni), lieber alle Extremitäten zu leiden, als die fällige Pachtsumme - 600 Th. .- nach Güstrow zu zahlen. Endlich bedrohte man ihn d. 17. Juni in Güstrow mit persönlichem Arrest, wenn er nicht zahle. Da er das Geld nicht bei sich hatte, so mußte er es sich von einem dortigen Freunde borgen, um nur wieder freizukommen. Ebenso ward Hauptmann Dechow zu Stargard, der es schon zu verdoppelter Exekution und zwei Strafmandaten auf je 100 Th. hatte kommen lassen, bei einer persönlichen Anwesenheit in Güstrow gezwungen, das


|
Seite 362 |




|
verlangte Geld (700 Th. auf Abschlag) dort aufzuleihen und leistete auch das Treuversprechen, da man ihn mit sofortiger Ausweisung aus dem Amte bedrohte, in dem er fast sein ganzes Vermögen angelegt hatte.
Hauptmann Wolfrath hatte im Jahre 1694 das Amt Schwaan auf vier Jahre bis Johannis 1698 gepachtet und dafür 4000 Th. Kaution gestellt. Für diese Kaution waren ihm jährlich 200 Th. aus den Einkünften des Amtes verschrieben, den Bauhof hatte er gegen 800 Th. jährlicher Pacht und 20 Th. Flachsgelder in eigene Bewirthschaftung genommen. Im letzten Pachtjahre sollte der Vorschuß abgetragen werden. Er hatte die Absicht, den Kontrakt nicht wieder zu verlängern, da er nach seiner Ansicht den Bauhof zu theuer gepachtet hatte. Er ward auf den 26. Mai nach Güstrow citirt und, als er nicht kam, laut Ordre vom selben Datum mit 2 Musketieren auf Exekution belegt, an deren Stelle d. 5. Juli ein Reiter trat. Zum 7. Juli bei Strafe von 100 Th. wieder citirt, blieb er wieder aus und erhielt den 16. Juli ein neues Schreiben, er solle bei 200 Th. Strafe den 23. sich persönlich stellen und das erste Strafgeld mitbringen. Er berichtet dies den 18. Juli nach Schwerin und fügt hinzu, der Herzog möge ihm nicht übel nehmen, wenn er der Gewalt nachgebe. Den 5. August schreibt er, daß er sich gefügt habe. Die Kreisräthe bewiesen ihm dafür das entgegenkommen, daß sie auf der Zahlung der 100 Th. Strafe nicht bestanden, sondern versprachen, deswegen an ihre Herren referiren zu wollen.
Auch die Städte wurden vielfach mit Exekution belegt, weil sie auf Friedrich Wilhelms Befehl die Accise=Gelder an die neue Regierung nicht zahlten, die diese auch für den April und Mai schon verlangte; sie hatten es aber leichter als die Amtshauptleute, weil auch für sie die Exekution nur in einem einzelnen Mann bestand. So mard Güstrow d. 26. Mai mit einem Reiter belegt und meldete deshalb d. 9. Juni, daß es die Accise gezahlt, erhielt aber dafür den 13. Juni von Schwerin die Warnung, nicht wieder zu pariren. 1 ) Auch Friedland erhielt Ende Mai Erekution. Ebenso ward nach Neubrandenburg schon den 26. Mai ein Reiter geschickt, der täglich bei freiem Futter und Mahl 6 ßl. zu beanspruchen hatte. Den 11. Juni langte


|
Seite 363 |




|
ein zweiter an und ein Schreiben, datirt vom 9., mit der Drohung, die Stadt werde mit 100 Th. Strafe und schwerer Exekution belegt werden, wenn nicht die restirende Accise und Orbör gezahlt werde. Bürgermeister und Rath richteten an den Herzog eine Bittschrift, um Gottes willen ihnen zu erlauben nachzugeben. Friedrich Wilhelm aber antwortete den 13. Juni, es verbleibe bei den kaiserlichen Mandaten. Da die Bürgerschaft sich weigerte, die Exekutionskosten und die Strafe mit tragen zu helfen, so legten der Bürgermeister und die Rathsmitglieder den 18. Juni ihre Aemter nieder, erhielten aber aus Güstrow einen Befehl, datirt vom 21. Juni, bei 100 Th. Strafe sich des Regiments der Stadt weiter anzunehmen. Die Bürgerschaft, die sich zu dem Standpunkt des Rathes, daß man um des rechtmäßigen Landesherrn willen auch Leiden zu ertragen habe, nicht aufzuschwingen vermochte, hatte nämlich den 19. eine Eingabe an die Kreisräthe gemacht und auch eine Deputation nach Güstrow gefandt, worin sie vorstellte, sie sei an der Nichtablieferung gänzlich unschuldig, die Gelder seien längst eingegangen, und um Befreiung von der Exekution und den Gebühren dafür bat. Der Rath schickte darauf das Geld mit der Post nach Güstrow, womit man dann zufrieden war. 1 )
Während alle diese Einzel=Erlebnisse sich abspielten, hatten die Verhandlungen der Kreisregierung mit der Gesammtkörperschaft der Güstrowschen Stände einen ähnlichen Verlauf genommen. Die Landräthe waren schon auf den 26. Mai nach Güstrow entboten. Sie erschienen nicht, sondern schickten nur ihren Sekretär, um sie mit dem Hinweis auf die kaiserlichen Verordnungen zu entschuldigen. Am selben Datum erhielten sie durch Friedrich Wilhelm das kaiserliche Protektorinm vom 13. April, freilich ein Dekret von recht fragwürdigem Werth für sie, das ihnen nur einen papiernen Schutz gewährte und sie zugleich mit schweren Strafen bedrohte, wenn sie dem Kreisdirektorium gehorchen würden.
In Güstrow fand man ihre Entschuldigung nicht ausreichend; eine nochmalige Citation auf den 22. Juni erging in verschärfter Form: Ritter= und Landschaft sollte, möchten ihre Deputirten erscheinen oder nicht, jedenfalls zu allem, was


|
Seite 364 |




|
in Güstrow beschlossen werde, verbunden sein, "zu dessen Effect man alsdann gebührende Mittel anzuwenden" wissen werde (d. 8. Juni). Trotzdem blieben die Deputirten auch diesmal aus und schickten wieder nur ihren Sekretär, wandten sich aber den 23. Juni, an demselben Tage, wo, wie oben erzählt, das Land wieder mit stärkerer Einquartierung belegt ward, mit einer Eingabe an den Kaiser. Sie versichern darin, daß sie Friedrich Wilhelm auch ferner als ihren Herrn erkennen würden, sprechen aber die Erwartung aus, der Kaiser werde ihnen, was sie sich "lediglich studio conservandi und ad evitandum majus malum würden abdringen lassen", nicht als Ungehorsam anrechnen, und legen ihm die Bitte vor, er möge das Werk so dirigiren, daß das unschuldige Land vor weiterem Verderben errettet werde.
Auf einer Konferenz zu Schwerin d. 27. Juni ließ sich endlich Friedrich Wilhelm erbitten, ihnen zu bewilligen, daß sie sich, menn der Druck zu stark werde, "protestando accomodiren" dürften. Die Stände suchten in lobenswerther Loyalität diesen Zeitpunkt so lange wie irgend möglich hinauszuschieben. Zum 29. Juni kamen ritterschaftliche Deputirte nach Güstrow, aber als Privatleute; sie fuhren bei den drei Räthen nach einander vor und ersuchten jeden um Anstand, bis Antwort vom Kaiser eingelaufen, allein ohne Erfolg. Kurz vor 11 Uhr wurden sie vor die Geheime Kammer gefordert, wo sie eine ganze Anzahl von städtischen Deputirten vorfanden, die nach Aussage der Räthe die Proposition der Kreisregierung zu hören und sich zu unterwerfen gekommen waren. Dem war indessen nicht so. Als die Deputirten der Ritterschaft auch hier ihre Weigerung, eine Proposition von der Kreisregierung anzuhören, wiederholten und den Saal verließen, folgten ihnen die sämmtlichen städtischen Abgeordneten.
Aufs Neue wurden Ritter= und Landschaft auf den 25. August nach Güstrow citirt. Sie suchten vor diesem Termin die Kreisräthe auf und machten geltend, daß vom Kaiser noch keine Antwort da sei. 1 ) Man drohte aber mit Exekution. Trotzdem erschienen sie nicht, einer Weisung von Schwerin aus folgend. Nun wurde d. 27. September ein Kontributions=Edikt für 200 Römermonate von Güstrow aus publicirt, und ein neues Reskript bedrohte die Stände mit 6000 Th. Strafe und Exekution, falls sie nicht d. 4. November erschienen und d. 5.


|
Seite 365 |




|
die Proposition anhörten. Als sie wiederum ausblieben, marschirten d. 15. November 120 Mann zu Fuß (die Officiere und Unteroffiziere nicht gerechnet) mit etlichen Reitern aufs Land, um sich auf den Gütern der Führer des Adels zu vertheilen. Der Landrath v. Jasmund hatte beispielsweise einen Leutnant mit 22 Mann vom 15. bis zum 24. November zu verpflegen. 1 )
Am 6. November gelangte ein Reskript aus Schwerin an die Güstrowschen Stände mit dem Schweriner Kontributions=Edikt (vom 27. Oktober) und dem Befehl, die Kontribution für den Güstrowschen Landestheil nach Schwerin zu liefern, worauf die Interims=Regierung d. 11. November bei 200 Th. Strafe verbot, die Schweriner Edikte anzunehmen oder etwas darauf auszuzahlen. Die Exekution dauerte nach einem Schreiben der Stände an den Kaiser vom 15. April 1698 zu diesem Zeitpunkt noch fort, doch muß sie dann aufgehört haben, wann, ist aus den Akten nicht zu ersehen. Auch die Stände fügten sich und besuchten fortab die Konventionstage der Interims=Regierung. 2 )
Fortsetzung des Schriftstreites.
Ausführliche Berichte von allem, was im Güstrowschen geschah, gelangten durch Friedrich Wilhelm und Graf Eck nach Wien und wurden in den Akten des Reichshofraths aufgespeichert, ebenso auch Eingaben von Adolf Friedrich, der unermüdlich um Aufhebung der Entscheidung vom 12. Januar und um Einsetzung eines unparteiischen Fürstengerichts bat. Auch die Antworten der Kreisdirektoren auf die verschiedenen kaiserlichen Reskripte langten allmählich an. Diejenigen auf das erste Schreiben (vom 12. Januar) wurden zurückgehalten, bis die Depossedirung vollzogen war. Sie finden sich erst den 5. August in den Akten des Reichshofraths verzeichnet, zugleich mit späteren Schreiben vom 24. April (von Graf Mellin und Herzog Georg Wilhelm) und 18. Mai (von Brandenburg). Ein Antwortschreiben Georg


|
Seite 366 |




|
Wilhelms auf das Reskript vom 13. April, datirt vom 23. April (a. St.), ist schon den 31. Mai, und eins von der Regierung zu Bremen, datirt vom 17. Mai, den 13. Juni beim Reichshofrathe präsentirt worden.
In den Schreiben vom 24. April und 18. Mai wird die dem Kaiser hinterbrachte Darstellung von dem Verhalten Klinckowströhms bei der Besitzergreifung als unrichtig und das Einrücken der Schweriner als ein listiger, heimlicher und gewaltthätiger Ueberfall bezeichnet. Die Schweriner seien heimlich in die Stadt eingerückt, die doch dem Oberstleutnant Klinckowströhm anvertraut gewesen, und hätten sich auch des Schlosses zu bemächtigen gesucht; auch seien sie bereits bis in die Thore des äußeren Schloßhofes vorgedrungen gewesen unter vielem Hohnlachen der Gemeinen, die die Ueberraschung für gelungen gehalten hätten, als Klinckowströhm, der auf einem andern Wege mit einem Theil der Seinen ins Schloß gelangte, ihnen noch rechtzeitig entgegengetreten ei. Daß der Oberstleutnant auch nachher den Grafen Eck in das Schloß zu lassen Bedenken gehabt, sei unter solchen Umständen zu entschuldigen, dagegen sei keine Ursache gewesen, den dänischen Minister abzuweisen, der dem Vernehmen nach über die Allodial=Erbschaft (des verstorbenen Herzogs) mit der Herzogin habe verhandeln wollen. Auch die folgenden Rencontres seien dem Kaiser ganz falsch dargestellt, eine "berichtigte" Darstellung liegt bei. Weiter wird dann, obgleich die Schreiben noch nicht Antwort auf die kaiserlichen vom 13. April sind, die Vergewaltigung Ecks erwähnt, über die sich dieser sehr solle beschwert haben. Es wird erklärt, was auch auf anderen Wegen dem Kaiser bereits insinuirt war, daß Klinckowströhm keinerlei Ordre in Bezug auf den Grafen Eck gehabt habe; es thäte den Fürsten gar leid, daß dabei etwas passirt sein solle, was Kais. Majest. auch nur das allergeringste Mißfallen verursachen könnte. Klinckowströhm selbst mache sich anheischig, mit Allen, die dabei gewesen, genugsam erweisen zu können, daß, obzwar er als Soldat geglaubt, daß er den Grafen Eck zu der Zeit nicht mehr als einen kaiserlichen Minister, sondern vielmehr als einen Schweriner Mandatar anzusehen habe, folglich ihm nicht verstatten könne, nachdem der Herzog Güstrow verlassen, noch dort zu bleiben, dennoch der Person des Grafen keine Gewalt angethan sei, vielmehr sei der Graf auf wiederholte Aufforderung von selbst in den Wagen gestiegen und weggefahren. Es wird ihm vorgeworfen, er habe darauf gedrungen, daß Friedrich Wilhelm Feuer auf die Kreisvölker geben lasse, und andere auf das Aeußerste abzielende


|
Seite 367 |




|
Dinge gerathen. Der Kaiser wird nochmals gebeten, zu verordnen, "waß die Rechte, der Sache billigkeit, des Reiches wollfahrt, und Ew. Kays. Maytt. eigene glorie erfordern", und was die Fürsten schon in ihrem vorigen Schreiben erbeten haben. Schließlich wird es zu seinem gnädigsten Gefallen verstellt, weil die in Schwerinische Pflicht getretenen Räthe und Bedienten bis zu rechtlicher oder gütlicher Entscheidung der Sache den Landesgeschäften vorzustehen nicht vermöchten und man daher, weil das Land ohne Administration nicht gelassen werden könne, einige Leute dazu zu befehlen für unumgänglich nöthig erachtet, ob der Kaiser Jemand der Seinigen verordnen wolle, der als Direktor dem Rath präsidire. 1 )
Unter dem 3. Oktober ist in den Akten des Reichshofraths das Schriftstück verzeichnet, in dem der Herzog von Celle und die Bremische Regierung die ausführliche Verantwortung Klinckowströhms (unter dem Datum des 11. August) vorlegten, die bereits oben bei der Erzählung des Hergangs verwerthet ist. 2 )
Im Juni des Jahres sandte Friedrich Wilhelm den Grafen Horn, der inzwischen für kurze Zeit nach Meklenburg zurückgekehrt war, wieder nach Wien mit dem Auftrage, ein schärferes (fiskalisches) Verfahren gegen die Verletzer des kaiserlichen Protektoriums für Güstrow und des Possessionsdekretes zu betreiben. Zu diesen schärferen Maßregeln rechnete man auch die Auf=


|
Seite 368 |




|
hebung der Assignation der diesjährigen Römermonate an Kurbrandenburg und Braunschweig, die damit ihre Truppen im Reichskriege erhalten sollten, und die Zuweisung der Steuer an Friedrich Wilhelm selbst als Entschädigung für die erlittene Einbuße an Einkünften und die aufgewendeten Unkosten.
Trotz der mehrfach wiederholten Klagen über die "Attentata" der "anmaßlichen" Kreisregierung und Bitten um schnelle Hülfe, zu denen sich noch ähnliche Gesuche der Güstrower Stände gesellten, verfuhr man in Wien äußerst bedächtig. Man war dort in arger Verlegenheit. Das Verfahren der Kreisdirektoren gutzuheißen, war unmöglich, ebenso unmöglich aber, mit Waffengewalt den Vertriebenen zurückzuführen, da die Kriege mit Frankreich und der Türkei ja noch fortdauerten. Auf der andern Seite war von dem Kreisdirektorium Nachgiebigkeit in der Hauptsache, also Räumung von Güstrow, nicht zu erwarten. In Schweden war zwar König Karl XI. d. 5. April 1697 gestorben, und man wußte noch nicht recht, wessen man sich von seinem Nachfolger, dem jungen Karl XII., zu versehen hätte, allein so viel wurde bald klar, daß Schweden auch unter dem neuen Regime in der Güstrowschen Angelegenheit im alten Fahrwasser bleiben werde. Auch die Friedensvermittelung mit Frankreich wünschte Schweden fortzuführen, und der Wiener Hof legte Werth auf diesen wichtigen Dienst. Von Brandenburg und Celle standen Gruppen für Kaiser und Reich unter Waffen; in eben diesem Jahre (d. 11. September 1697) gewann Prinz Eugen seinen glorreichen Sieg bei Zenta über die Türken, bei dem sich die Brandenburger in seinem Heere besonders auszeichneten. Da bei Aufhebung der Assignation der Römermonate aus Meklenburg an Brandenburg und Lüneburg die Zurückziehung der brandenburgischen und lüneburgischen Truppen zu befürchten war, so war man in Wien nicht einmal in der Lage, Friedrich Wilhelm diesen pekuniären Erfolg zu verschaffen. Man darf annenmen, obgleich es nicht in den Akten zu lesen steht, daß der Wunsch, eine Antwort auf dieses Gesuch Friedrich Wilhelms überhaupt zu umgehen, ein Hauptgrund mit gewesen ist, weshalb man in Wien die Sache so lange hinzog, bis die Zahlung bereits geleistet sein mußte, und damit diese Frage erledigt war. Erst den 4. November befaßte sich der Reichshofrath mit dem seit April eingelaufenen Aktenmaterial. Er beschloß ein Votum an den Kaiser, aber dessen Entscheidung verzögerte sich noch bis Ende Januar des folgenden Jahres (1698).


|
Seite 369 |




|
Versöhnung des Kaisers mit den Kreisdirektoren.
Inzwischen war es gelungen, mit Hülfe von Holland und England eine Verständigung zwischen dem Kaiser und dem Kreisdirektorium herbeizuführen, wenigstens insoweit, daß die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt werden konnten, und also der Güstrower Streit für die hohe europäische Politik unschädlich gemacht wurde. Die Kreisdirektoren selbst hatten in ihren Schreiben an den Kaiser den Weg angedeutet, auf dem sich eine solche Verständigung anbahnen ließ: Klinckowströhm hatte seine Instruktion überschritten; obgleich es auf der Hand lag, daß die Kreisdirektoren, wenn sie der Regierung von Güstrow sich bemächtigen wollten, den Grafen Eck nicht dort dulden konnten, so hatten sie doch vorsichtiger Weise vermieden, darüber bestimmte Anordnungen zu geben. Klinckowströhm also wurde zum Sündenbock ausersehen, dessen Opferung den Frieden wiederherstellen sollte. Er ward d. 21. Dezember 1697 von seinem Posten abberufen, 1 ) nachher wieder nach Güstrow geschickt und hier in Arrest gesetzt (August 1698). Eine Abbitte desselben beim Grafen Eck ward in Vorschlag gebracht. Den 8. Dezember ließ der Kaiser durch den Grafen Kinsky den Gesandten von Holland und England seine Antwort auf ihre Vermittelungsvorschläge mittheilen, und diese gaben sie den 9. Dezember an die Bevollmächtigten von Schweden und Celle weiter - ein Brandenburgischer Gesandter war damals überhaupt nicht in Wien. Der Kaiser verzichtete in diesem Aktenstück auf genauere Untersuchung des Thatbestandes, weil sie unnöthig sei; der Bericht Ecks, der übrigens als kaiserlicher Gesandter sicherlich mehr Glauben verdiene, als die Aussagen Klinckowströhms und der Unteroffiziere, unterscheide sich nur in Bezug auf das plus et minus von diesen. Auch aus diesen erhelle schon zur Genüge, wie im Einzelnen nachgemiesen wird, daß man den kaiserlichen Gesandten in unverantwortlicher Weise verunglimpft habe. Der Kaiser besteht also darauf, daß hierfür Genugthuung gegeben werde, und erklärt sich unter der Voraussetzung, daß diese binnen zwei bis drei Monaten erfolge, bereit, den Ministern der drei Höfe den Zutritt wieder zu gestatten, vorausgesetzt, daß man in Schweden zur selben Zeit dasselbe dem Grafen Stahremberg gewähre. 2 )


|
Seite 370 |




|
Wiedereinsetzung der Vermittelungskommission.
Erst nachdem dies erledigt war, entschloß man sich in Wien, die lang erwarteten Reskripte abzulassen. Sie sind datirt vom 27. Januar 1698 und halten ihrem Wortlaute nach den Standpunkt des Kaiserhofes in der Güstrowschen Frage sehr entschieden fest, zeigen aber insofern ein entgegenkommen, als durch sie die alte Vermittelungs=Kommission, die seit Gustav Adolfs Tod noch aus dem Grafen Eck und dem Bischof von Lübeck bestand, bisher aber geruht hatte, wieder ins Leben gerufen und durch den König Christian V. von Dänemark als Herzog von Holstein und die Herzöge Rudolf August und Anton Ulrich von Wolffenbüttel verstärkt wurde.
Das Schreiben an die Kreisdirektoren berief sich auf den Artikel 17 des Westfälischen Friedens und § 161 des Reichs=Rezesses vom Jahre 1654, kraft deren einem Stande gegen den andern, vielmehr noch also gegen den Kaiser dergleichen verboten sei. Wenn ein solches Verfahren erlaubt wäre, so "würde die Justitz aller orthen gehemmt, und so viel Kayser im Röm. Reich und Oberste Richter über alle anderen Jhre mitstände sich auff=


|
Seite 371 |




|
werffen, so viel Kreyß=Directores sich in selbigen befänden." Dann werden ihnen auf Grund der Berichte von Friedrich Wilhelm und dem Grafen Eck alle einzelnen widerrechtlichen Handlungen, die sie im Güstrowschen begangen, in langer Reihe vorgehalten, die Hauptschuld dafür aber wieder auf die fürstlichen Räthe in Hamburg und diesmal auch auf den "unruhigen" Strelitzischen Rath Gutzmer geschoben. Noch einmal werden alle Regierungshandlungen der Kreisräthe im Güstrowschen kassirt und die Verstärkung der Kommission angezeigt.
Das an Strelitz gerichtete Reskript ist zugleich an Adolf Friedrich und den Rath Gutzmer adressirt. Dem Herzog wird vorgehalten, "daß er auf übles einrathen des Gutzmers sich gesetzet, und bey dem Kreyß=Directorio in Nieder=Sachsen darüber, alß ob einige nullitates dabey mit untergeloffen, contra fidem actorum beschweret, demselben die revision über unsere allerhöchste Kayl. judicata wieder alles Herkommen, constitutiones Imperij, Jeder Vernunfft selbsten, zugemuthet und auffgetragen, und dagegen deßelben assistentz undt hülff begehret" u. s. w. 1 ) Adolf Friedrich sowohl wie Gutzmer werden bei Strafe von 100 Mark löthigen Goldes aufgefordert, zu gehorchen und Urtheil und Prozeß abzuwarten. Beide werden in feierlicher Form binnen zwei Monaten von Insinuirung dieses kaiserlichen Gebotes an vor den kaiserlichen Hof citirt, um dort persönlich oder durch ihren bevollmächtigten Anwalt anzuzeigen und zu erweisen, daß sie diesem Mandat gehorsam nachgelebt hätten und nachleben würden oder aber "erhebliche beständige ursache, da Sie einige hätten, warumb solche erklährung nicht geschehen solte, in rechten vorzubringen, und endlichen Entscheidts, und erkenntnüß darüber zu gewarten."
Die Güstrower Stände werden noch einmal ernstlich ermahnt, allen widrigen Zumuthungen ungeachtet den kaiserlichen Man=


|
Seite 372 |




|
daten den schuldigen Gehorsam zu leisten, dagegen der angemaßten Kreis=Regierung keineswegs zu gehorchen noch Dekrete derselben anzunehmen oder zu vollziehen. Auch sie werden binnen zwei Monaten vor den Kaiserhof geladen.
Der entscheidende Entschluß, diese Dekrete, die durch das Reichshofrathsgutachten vom 4. November vorgeschlagen waren, zu vollziehen, ward, wie Graf Horn in Erfahrung brachte, im kaiserlichen Geheimen Rath am 27. Januar gefaßt, von diesem Tage wurden sie deshalb datirt. Puplicirt wurden sie indesen erst am 6. März, weil die Mittheilung der kaiserlichen Resolution an den Reichshofrath "aus bewegenden Ursachen" so lange verschoben sei. Diese Ursachen sind in Vermittelungsverhandlungen zu suchen, die zur selben Zeit, besonders von Berlin aus, betrieben wurden und deren Gelingen die Absendung der kaiserlichen Reskripte überhaupt überflüssig gemacht hätte.
Berliner Vermittelungsversuche.
Diese Verhandlungen begannen schon im letzten Quartal des Jahres 1697, als der Minister Dankelmann noch im Amte war. Dieser hatte sich noch kurz zuvor feindselig gegen Schwerin erwiesen. Es war nämlich der Gedanke aufgetaucht oder vielleicht von ihm selbst aufgebracht werden, daß der Johanniterorden die Gelegenheit benutzen möge, die beiden 1648 an Meklenburg abgetretenen Komthureien Nemerow und Mirow wiederzufordern oder mit Hülfe des Kreisdirektoriums gewaltsam wieder in Besitz zu nehmen. Der Kurfürst von Brandenburg war Schutzherr des Ordens, es hätte dies also einen Raub Brandenburgs an dem schutzlosen Lande bedeutet, und zwar einen Raub, der ebenso Adolf Friedrich, den Herrn von Mirow, wie Friedrich Wilhelm betroffen hätte, und außer ihnen noch den frühern Güstrowschen Präsidenten v. Ganß, dem Nemerow von Herzog Gustav Adolf für Lebenszeit überwiesen war, und dessen Forderungen im August d. J. 1697 nach seiner eigenen Angabe noch 24000 Rth. betrugen. Mit dem Oberpräsidenten hatte Dankelmann durch den Geheimen Rath v. Viereck schon im Juli angeknüpft. Er soll beabsichtigt haben, die Komthurei seinem Sohne zuzuwenden. Mochte dies wahr sein oder mochte er nur den von anderer Seite aufgebrachten Plan benutzen, um auf beide Herzöge einen Druck auszuüben, daß sie sich zu einem möglichst schnellen Vergleich entschlössen: jedenfalls rieth er in einem Gespräche mit dem kaiserlichen Geschäftsträger Heems im November, in welchem er die


|
Seite 373 |




|
Forderung des Ordens erörterte, zugleich zu einer gütlichen Vereinbarung über die Erbfolge. Sein Bruder, der Gesandte in Hamburg, versuchte um dieselbe Zeit eine Zusammenkunft der beiden Herzöge in Hamburg zu Stande zu bringen.
Die Gefahr für die beiden Komthureien ward indessen durch den Sturz des allmächtigen Dankelmann noch im November beseitigt, 1 ) seitdem war davon nicht weiter die Rede. Leiter der auswärtigen Politik Brandenburgs wurde Herr v. Fuchs, der schon unter Dankelmann mit den meklenburgischen Angelegenheiten viel zu thun gehabt hatte, ein Mann von vielen glatten Worten, dem aber wenig zu trauen war. Indessen war sein Wunsch, den Güstrower Streit beigelegt zu sehen, durchaus aufrichtig; in Berlin empfand man das Unbequeme der Situation nicht weniger als in Wien. 2 )
Fucks suchte Schwerin zu gewinnen, indem er die ganze Schuld für das Geschehene auf den gestürzten Dankelmann schob, der in sehr eigenmächtiger Weise und ohne etwas davon zu verstehen (!!) die Auswärtige Politik geleitet habe. 3 ) Man werde jetzt suchen, das Geschehene zu redressiren. Das freilich wagte auch Herr v. Fuchs nicht in Aussicht zu stellen, daß Brandenburg sich von den beiden andern Kreisdirektoren trennen könnte, mit großer Entschiedenheit rieth er aber zu einem Vergleich und schlug Abtretung von Ratzeburg cum voto et sessione vor, wünschte auch Absendung eines Schweriner Ministers nach Berlin. Der hier verabredete Vergleich könne dann in Hamburg durch die. kaiserlichen Minister abgeschlossen werden. Da durch dieses Ver=


|
Seite 374 |




|
fahren den Rechten des Kaiserhofes nichts vergeben wurde, so wurde Taddel im Januar 1698 nach Berlin geschickt.
Den 17. Januar berichtet er über eine ausführliche Konferenz, die er mit Fuchs gehabt. Dieser hat erklärt, es sei seinem Herrn gleich, durch wen, wo und auf welche Art die Endschaft erreicht werde, wenn es nur schleunigst geschehe: sonst sei zu besorgen, daß der Kreis noch weiter gehen und das Werk noch schwerer machen werde. Die Abtretung von Ratzeburg sei der kürzeste Weg zur Beilegung, doch werde Brandenburg nicht darauf bestehen. Taddel erwiderte, von Abtretung eines Fürstenthums mit Reichsvotum zu sprechen sei nur vergeblicher Aufenthalt, da dieses dem kaiserlichen Spruche e diametro zuwider sei.
Fuchs hatte dann eine Apanage im Werthe von 20000 bis 25000 Th. als nach seiner Meinung ausreichend bezeichnet, wie schon früher in Schweden ausgesprochen sei. In einer andern Unterhaltung rieth Fuchs, Friedrich Wilhelm möge wieder einen Bevollmächtigten nach Schweden senden, um dort seine Interessen wahrzunehmen.
Ein Vorurtheil fand Taddel in Berlin zu bekämpfen, das offenbar schon früher auf die Maßnahmen der drei Kreisdirektoren einen Einfluß geübt und jüngst noch eine Verstärkung erfahren hatte: Man besorgte, Friedrich Wilhelm werde zum Katholizismus übertreten, wie es sein leitender Minister Graf Horn bei seinem Aufenthalt in Wien 1697 gethan hatte. 1 )
Gegen Ende Januar erschien auch Gutzmer in Berlin. Man redete ihm eifrig zu und suchte ihn dafür zu stimmen, daß Adolf Friedrich von votum und sessio abstehen möchte. Gutzmer drohte, sein Herr werde seine Rechte an einen Mächtigeren, womit nur Schweden gemeint sein konnte, abtreten. Er persönlich indessen zeigte sich, wenigstens nach der Behauptung des Herrn v. Fuchs, diesem gegenüber nachgiebig in Bezug auf das Reichsvotum wie das geforderte Fürstenthum; nur müsse seinem Herrn sonst ein Distrikt Landes cum omni Jurisdictione et Jure Episcopali abgetreten werden. 2 ) Daraufhin arbeitete man


|
Seite 375 |




|
in Berlin ein Vergleichsprojekt aus, das Herr v. Fuchs den 10./20. Februar, einen Tag nach Taddels Abreise, dem kaiserlichen Residenten Heems brachte. Graf Eck sandte es dann fünf Tage später aus Hamburg nach Schwerin. Es wird darin vorgeschlagen, das Strelitz zu bewilligende Quantum müsse etwa 40000 Th. an Einkünften betragen oder wenigstens 36000 und steuerfrei sein bis auf die Reichssteuern. Strelitz werden in den cedirten Stücken die Jura Ecclesiastica und das Gericht erster Instanz zugebilligt, dazu freie Administration seines Antheils, Ein= und Absetzung seiner Bediensteten, auch Jurisdiktion über sie. Ueber die Ritterschaft heißt es, sie könne nicht ad aliam curiam feudalem, als welche sie bisher gehabt, gezogen werden. 1 ) Es wird noch einer Heirath Friedrich Wilhelms gedacht.
Diesem Vergleichsprojekt gegenüber verhielt sich Friedrich Wilhelm vorläufig kühl, ebenso fand ein anderer Vorschlag, der von Berlin ausging, in Schwerin nur eine kühle Aufnahme, wenn auch keine Ablehnung: man möge von beiden Seiten einen Bevollmächtigten nach Wien senden und hier einen Vergleich abschließen. Da Graf Horn noch dort war, so brauchte nur das Faktotum Adolf Friedrichs, Gutzmer, ebenfalls nach Wien zu reisen, und die Verhandlungen konnten beginnen. Eine Schwierigkeit war, daß Gutzmer vom Kaiserhofe mit Strafe bedroht war, doch diese ließ sich durch die Ausstellung eines Salvus Conductus heben, zu der man sich in Wien entschloß.
Allein der Wortlaut dieses Geleitspasses erregte Anstoß bei Adolf Friedrich. Der Paß war, wie selbstverständlich, von dem Standpunkte des Kaiserhofes aus abgefaßt, wonach Friedrich Wilhelm der Besitz von Güstrow zuerkannt war und es sich bei Vergleichsverhandlungen nur um eine Apanage für Adolf Friedrich handeln konnte. Dieser über blieb dabei, daß er sich durch seine Suppliken die Appellation wegen des Besitzrechtes auf Güstrow vorbehalten, und wünschte hiernach die Fassung des


|
Seite 376 |




|
Geleitsbriefes geändert; sobald dies geschehen, sollte Gutzmer sofort, wenn die nöthigen Kosten aufzubringen seien, 1 ) seine Reise antreten.
In Wien empfand man es als eine Kränkung, daß Adolf Friedrich sich der Gnade des Kaisers gegenüber, wie sie sich in der Ausstellung des Geleitsbriefes äußere, so abwehrend verhalte, und diese Verstimmung richtete sich auch gegen Brandenburg, das nach Ansicht der Wiener Staatsmänner Schuld an diesem Mißerfolg trug, insofern es die Pflicht gehabt hätte, ehe es den betreffenden Vorschlag in Wien anregte, sich erst bei den beiden Parteien zu vergewissern, daß beide ihn annehmen würden.
Andrerseits ward auch in Berlin eine Verstimmung gegen Wien durch die kaiserlichen Reskripte vom 27. Januar hervorgerufen, die um Ende März dort abgegeben wurden. Man beschwerte sich bitter über die darin enthaltenen harten Ausdrücke, ließ sich indessen durch Heems besänftigen, der durch eine ihm den 26. März zugegangene Instruktion zu milderen mündlichen Erklärungen Vollmacht erhielt. Da überdies Schwerin Bedenken gegen die Verhandlungen in Wien neben der Kommission äußerte, die die Sache nur aufhalten könnten, so kassirte man in Wien den Geleitsbrief an Gutzmer wieder (im Juni) und verwies Adolf Friedrich von Neuem an die Kommission, die nun wirklich ins Leben trat.
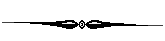


|




|
