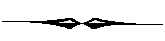|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
|
- Steinzeitliche Funde in Meklenburg
- Das Bündnis Karls des Großen mit den Abodriten
- Barnim von Werle, Propst in Stettin und Camin
- Das Amt der Goldschmiede zu Güstrow und der Güstrowsche Goldschmied Matz Unger
- Die Meklenburgischen Kirchenordnungen : ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung unserer Landeskirche



|



|
|
:
|
I.
Steinzeitliche Funde in Meklenburg.
Von
Dr. Robert Beltz
~~~~~~~~~~
I n den Jahrbüchern des Vereins für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde hat Friedrich Lisch fast 50 Jahre lang (Jahrgang 1 - 46) die Neueingänge zu den damals noch getrennten Schweriner Sammlungen fast ohne Ausnahme besprochen. Mit diesen Abhandlungen ist Lisch nicht nur der Begründer der deutschen Alterthumswissenschaft geworden, sondern hat auch ein allseitig zugängliches und zuverlässiges Bild des hier vorhandenen Materials gegeben, wie es in keinem zweiten deutschen Lande damals geschah oder bisher geschehen ist. Je mehr aber die Sammlungen anwuchsen, desto häufiger mußten Wiederholungen werden, und die regelmäßige jährliche Veröffentlichung aller neuen Funde erwies sich als unzweckmäßig. So hat denn Schreiber dieser Zeilen vorgezogen, bei den Publicationen in den Jahrbüchern den Stoff gruppenweise zu behandeln und die Alterthümer einer bestimmten Periode zusammenzufassen. Wenn dieses Mal die Steinzeit gewählt ist, so geschieht es, weil diese Periode lange nicht zu Worte gekommen ist und so ein besonders großes Material vorliegt. Die Vorführung desselben wird auch dazu beitragen, ein Vorurtheil zu zerstreuen, welches sich der Alterthumspflege oft hemmend entgegenstellt, daß nämlich neue Typen doch nicht mehr gefunden würden und die Alterthümersammlung im Großherzoglichen Museum schon jetzt die Meklenburgische Steinzeit so vollständig repräsentire, daß die Zuführung neuer Funde entbehrlich


|
Seite 2 |




|
sei. Ganz im Gegentheil wird aus dem Verzeichniß hervorgehen, daß unter den Neueingängen durchaus neue Formen sich finden, aber auch daß noch immer Typen hier vermißt werden, welche unsere Nachbarländer bieten und welche nach aller Wahrscheinlichkeit hier auch vorhanden sein müssen, 1 ) und daß die Eingänge so ungleich über das Land sich vertheilen, daß sie ein Gesammtbild der Bevölkerungsverhältnisse des Landes auf Grund der Funde zu geben noch nicht gestatten.
Unter den nicht veröffentlichten Funden befinden sich ziemlich alle bisher bekannten Typen. Um ihre Aufzählung zu einer annähernd vollständigen Uebersicht über die steinzeitlichen Geräthformen in Meklenburg zu gestalten, sind einige ältere, bisher ohne Abbildung veröffentlichte Stücke hinzugezogen.
Die Mehrzahl der Stücke sind einzeln, durch Schenkung oder Kauf, erworben; an Sammlungen sind dem Großherzoglichen Antiquarium, seit 1882 Abtheilung für vaterländische Alterthümer im Großherzoglichen Museum, folgende zugegangen:
- des bei Loigny am 2. December 1870 gefallenen Hauptmanns von Rantzau, enthaltend Steingeräthe, besonders aus der Gegend von Rostock und Grevesmühlen, erworben 1871;
- des Pastors Voß in Neustadt, enthaltend Steingeräthe von verschiedenen. Stellen, erworben 1874;
- des 1875 verstorbenen Lehrers Splitter in Lübsee bei Rehna, enthaltend Steingeräthe, besonders aus der Gegend von Rehna, erworben 1876;
- des verstorbenen Rittergutsbesitzers von Voß auf Tessenow bei Parchim, enthaltend dort und in der Umgegend gesammelte Bronzen, auch einige Steingeräthe, erworben 1882;
- des Försters Mecklenburg in Spornitz, enthaltend Steingeräthe von verschiedenen Stellen, geschenkt 1884;
- des 1890 verstorbenen Försters Dohse in Wredenhagen bei Röbel, enthaltend Stein- und Bronzegeräthe aus dortiger Gegend, erworben 1891;
- des 1893 verstorbenen Pächters Peitzner in Pogreß bei Wittenburg, enthaltend Gegenstände aus allen vor=


|
Seite 3 |




|
geschichtlichen Perioden, besonders aus dortiger Gegend, erworben 1893;
- des 1886 verstorbenen Rittergutsbesitzers von Preen auf Dummerstorf bei Rostock, enthaltend werthvolle bei Dummerstorf gefundene wendische Alterthümer und Steinsachen, geschenkt von den Söhnen 1893.
Paläolithische Zeit
Meklenburg hat keine paläolithischen "Stationen"; weder "Kjøkkenmøddings" noch Höhlenfunde beweisen hier die Existenz eines Menschen, der sich nur des roh behauenen Steines als Werkzeug bediente. Wohl aber hat der Boden eine Anzahl von Einzelfunden ergeben, welche sich den Typen der dänischen "Alterthümer aus der Zeit der Muschelhaufen" anschließen und als älteste Zeugnisse menschlicher Kultur unser besonderes Interesse in Anspruch nehmen. Ueber jene Periode und ihre Funde im Allgemeinen sei auf die neueste Behandlung derselben, S. Müllers Nordische Alterthumskunde, Straßburg 1896, S. 1 ff. verwiesen. Solche Einzelfunde von Feuersteingeräthen im Charakter der älteren Steinzeit (große Schlagflächen, ganz unpolirt, die Seiten in scharfen Kanten zusammenlaufend, der Querschnitt meist oval oder rautenförmig) sind neu erworben:
Manderow bei Wismar. Starkes Geräth mit Spitze, 21 cm lang, am Ende 4, an der Spitze 1 cm breit; die größte Stärke etwa B vom hinteren Ende; schöne scharfe Schneidflächen; gelbbraun. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1884. (Vereinssammlung, Katalognummer 4675.) Ein ähnliches bei Mestorf, Vorgeschichtliche Alterthümer aus Schleswig-Holstein, Fig. 10, aus einem Riesenbette bei Heide, und bei Evans, les ages de la pierre, Fig. 16.

Klütz. Ein ähnliches Geräth, etwa zu einer Lanzenspitze tauglich; 19 1/2 cm lang, hinten 2 1/2, vorn 1/2 cm breit, von stark


|
Seite 4 |




|
ovalem, fast rautenförmigem Durchschnitt; größte Dicke B vom hinteren Ende, durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Großherzogliche Sammlung, Katalognummer ( Gl. III. e. 60.) Es ist wohl die Grundform der dünnen, feinmuschlig geschlagenen Spitzen, welche die künstlichsten Formen unserer entwickelten Steinzeit bilden; der Uebergang läßt sich in allen Stufen verfolgen; das Klützer Exemplar ist das größte und derbste der Art, ihm schließt sich ein schon Jahrb. 3 B, S. 40 besprochenes von Liessow an.
Gr.-Lantow bei Laage. Gewölbter Mittelrücken. Länge 19 cm, größte Breite 4 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer 1890. (Gr. S., Gl. III. e. 92.)
Wir zählen zunächst diejenigen Exemplare auf, welche eine starke Wölbung der oberen Seite haben, ein Hauptunterschied von den Formen der entwickelten Steinzeit.
Pustohl bei Neubukow. Längliche Axt von fast rautenförmigem Durchschnitt; 20 cm lang, oben 3, unten (an der Schneide) 5 cm breit; größte Dicke B vor der Schneide; weißlich. An einigen Stellen tritt der ursprüngliche Stein zu Tage; derselbe zeigt eine Verwitterungsschicht, ein Beweis, daß das Geräth nicht aus frisch gebrochenem Feuerstein gearbeitet ist. Geschenk des verstorbenen Herrn Bobsien auf Pustohl 1880. (V.=S. 4634). Aehnlich Evans a. a. O., S. 12.
Pustohl. Ein ähnliches kleines Exemplar; 11 cm lang, 2 1/2 und 4 cm breit; opak weiß. Wie oben 1875. (V.=S. 4475)
Pustohl. Ein kleines, roh zugeschlagenes, aber zierliches Stück; 10 cm lang, 1 1/2 resp. 3 cm breit; opak weiß, die obere Seite stark gewölbt, die untere grade. Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 15. Wie oben 1871. (V.=S. 4329.)
Nach einer Mittheilung des Herrn Bobsien stammen alle Pustohler Stücke von einer Stelle, wo zahllose Messer und Splitter gefunden werden; wahrscheinlich, daß wir es hier mit einer alten Fabrikationsstelle zu thun haben.
Tessenow bei Parchim. Kleine unregelmäßig ovale Axt, aber noch der natürliche Stein; leicht gewölbt; 10 cm lang, oben und unten 3 cm breit; durchscheinend grau. Sammlung von Voß 1882 (Gr. S., Gl. IV. a. 278.) Aehnlich Evans a. a. O. Fig. 12; fast ganz gleich Montelius, antiquités suédoises, Fig. 11.


|
Seite 5 |




|
Pogreß bei Wittenburg. Länge 11, größte Breite 4 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 393.) Abbildung beistehend.
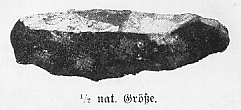
Kowahl bei Wittenburg. Länge 8,5, Breite 4 cm. Desgl. (Gr. S., IV. 1, 394.)
Schwerin, auf dem Schelfwerder in der Nähe des Ziegelsees. Ein roh zugeschlagenes Stück, mit flacher Unterseite, unregelmäßig prismatischer Oberseite; Länge 11, obere Breite 3, untere 4 cm; weißgrau opak. Geschenk des verstorbenen Herrn Rechtsanwalt Beyer. (V.=S. 3458.) Fast identisch Evans, Fig. 30.
Ich füge hier noch zwei Exemplare von quadratischem Querschnitt an, bei uns selten, in Dänemark (s. Müller 14) häufig; die scharfe Schneide durch zwei Schläge gebildet; die Länge beträgt 10 cm, die Breite 1 und 2 3/4 cm. Opak weiß. Gefunden bei Friedrichshöhe bei Rostock mit prismatischen Messern. (Gr. S., Gl. IV. 1, 284.) Abbildung beistehend. Ganz ähnlich u. a. Montelius, Fig. 10. Ein gleiches von Schwerin (Schelfwerder).
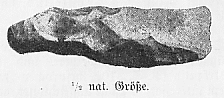
Als zweite Gruppe der beilartigen Exemplare zählen wir diejenigen Stücke mit großen Schlagflächen und scharfen Rändern auf, welche eine nur flach gewölbte Oberfläche haben.
Käselow bei Gadebusch. Beilartiges Geräth mit abgenutzter Schneide von 11 cm Länge, 2 und 4 1/2 cm Breite; die größte Dicke auch hier B von der Schneide; weiß, nicht durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. Aehnlich Evans a. a. O., S. 40, Mestorf a. a. O., Figur 1. (Gr S., Gl. IV. 1, 225.)
Poischendorf bei Dassow. Länge 10 cm, Breite oben 2, unten 4 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 392.)
Lüdershagen bei Güstrow. Schönes gleichmäßig gerundetes Exemplar von 14 cm Länge, 3 und 4 1/2 cm Breite; die größte Stärke B von oben; grau opak. Geschenk des Herrn


|
Seite 6 |




|

von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4247.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 39.
Weitendorf bei Brüel. Ein großes Exemplar mit auffallend starker Verdickung B von der Schneide. Länge 13, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3 1/2 cm; grau. Geschenk des Herrn Burgwedel auf Weitendorf. (V.=S. 4439.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 24. Ein ganz ähnliches, derb zugehauenes Exemplar von 11 cm Länge, 2 1/2 und 5 cm Breite von derselben Herkunft. (V.=S. 4439.)
Miekenhagen bei Kröpelin. Aus dem rohen Stein in großen Schlägen einfach aber zweckmäßig zugehauenes Stück von 9 1/2 cm Länge, 3 und 4 1/2 cm Breite; grau glänzend. (V.= S. 3030; schon kurz besprochen Jahrb. 19, S. 293. Das Stück hat genau die für die dänischen Kjökkenmöddings typische Form; vergl. u. a. Montelius, antiquités suédoises, Fig. 11; Evans, Fig. 37.
Ein fast gleiches Stück stammt vom Kaninchenwerder bei Schwerin (V.=S. 3009, schon besprochen Jahrb. 19, S. 292, ein ähnliches, nur noch derberes und formloseres von Satow bei Kröpelin (V.=S. 3102, besprochen Jahrb. 20, S. 277). Hier sei ein interessantes Stück angeschlossen, welches an der Ostsee zwischen Brunshaupten und Arendsee gefunden wurde (V.=S. 2358). Die untere Fläche desselben ist platt und mit großen Schlägen hergestellt, die obere flachkugelig gewölbt und zum Theil sehr gut geschliffen. Länge 9 1/2, Breite oben und unten 2 1/2 cm weiß opak. Es ist klar, daß das Stück aus einem großen geschliffenen Beile gearbeitet ist und beweisend dafür, daß diese alte Form gelegentlich auch in jüngerer Zeit gebraucht ist. Von gleicher Arbeit sind zwei kleine Geräthe (wohl Pfeilspitzen) von 8 und 7 cm Länge, gefunden bei Alt-Steinhorst (Gr. S., Gl. III. a. 114.). Aus Gesammtfunden ist diese Form leider bei uns nicht bekannt.
Tankenhagen bei Dassow. Klein, nur muschelig geschlagen; an der Schneide noch der rohe Stein. Länge 7, Breite oben 0,50, unten. Grau. Geschenk des Herrn Lehrer Däbler in Upahl bei Grevesmühlen 1894. (Gr. S., Gl. IV. 1,402).
Roggow bei Neubukow. Keilartiger Feuersteinspahn, höchst primitiv, Form D sich nähernd, schon Seitenränder; gelblichweiß. Länge 7, Breite oben 2,5, unten 5,25 cm, grader Durchmesser


|
Seite 7 |




|
(ganz oben) 0,75 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 407.)
Roggow bei Neubukow. Keilartiger Feuersteinspahn gleich dem vorigen, gelblichweiß. Länge 5,5, Breite oben 1,5, unten 4,5 cm, grader Durchmesser (4 cm von unten) 0,50 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 408.)
Zwei andere von Tressow bei Grevesmühlen (V.=S. 2761, 2883, besprochen Jahrb. 18, S. 236), gefunden mit zahllosen Splittern und einfachen Messern, welche auf eine Fabrikstätte schließen lassen.
Schaber sind bei uns selten; die runden Formen
fehlen fast ganz; ähnlich ein Stück von
Neu-Käterhagen bei Neukloster. Einfach mit
runder Schneidfläche; die untere Seite flach,
die obere dreiseitig prismatisch. Länge 8,
Breite 1,5 und 4,5 cm. Sammlung von Rantzau 1871
(Gl. IV 1, 357). Diese Form gehört zu den
allerältesten, vergl. Evans 32; Müller, Ordning
af danske oldsager I, 20, 21; Mestorf 16, 17.

Zu den häufigsten steinzeitlichen Funden gehören die sog. "prismatischen Messer", Spähne von Feuerstein, welche von einem Kerne abgesprengt sind. Die Unterseite ist gewöhnlich
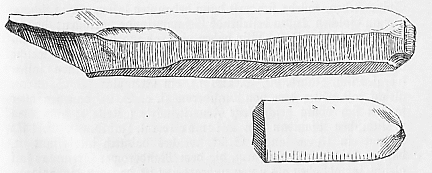


|
Seite 8 |




|
flach und gewölbt, die Oberseite hat eine scharfe Kante oder einen schmalen Grat. Die haarscharfe Schneide ist ein vorzügliches Schneideinstrument. Daß diese Messer schon in der paläolithischen Periode benutzt sind, beweisen die dänischen Muschelhaufenfunde (S. Müller, Nordische Alterthumskunde S. 27 ff.), daß ihr Gebrauch aber sehr tief, ja bis in die geschichtliche Zeit hinab geht, ihr Auftreten auf wendischen Burgwällen (Friedrichsruhe, Krakow, "Dobin" und sonst sehr oft) unter Verhältnissen, die eine Zufälligkeit ausschließen. In größten Massen finden sie sich auf den Wohn- oder Arbeitsplätzen, den sog. Feuersteinmanufacturen, hier fast stets in Gesellschaft von Gegenständen jüngerer Steinzeit.
Eine Aufzählung aller Eingänge an diesen Messern ist müssig, als Beispiele seien erwähnt:
Dummerstorf bei Rostock; zwei Stücke, die größten der Sammlung, 15 cm lang. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S., Gl. III, a. 123, 124.)

Gelegentlich finden sich an ihnen Handhaben, so daß sie auch zum Stechen, als Lanzenspitzen u. s. w., gebraucht sein mögen, z. B. Gegend von Güstrow; leicht gebogen, starker Rücken; 11 cm lang, wovon 4 aus den Griff kommen; 3 cm breit. Geschenk des Herrn Director Fritzsche in Güstrow 1891. (Gr. S., Gl. III a. 118.)
Dieses sind die Steingeräthe unserer Sammlung, welche man wegen ihrer einfachsten Form und Arbeit als die ältesten ansprechen könnte. Daß sie aber wirklich auch zeitlich an der Spitze stehen, würde sich erst dann behaupten lassen, wenn sichere, nur aus solchen Typen bestehende Gesammtfunde vorlägen; das ist nun hier nicht der Fall. Wir haben vier roh zugehauene Feuersteingeräthe aus Dreveskirchen unter Umständen gefunden, welche die Annahme einer Höhlenwohnung berechtigt erscheinen lassen (vergl. Lisch, Jahrb. 30, S. 123 ff.), ein Exemplar (V.= S. 3020) gleicht fast völlig dem von Manderow (s. o. S. 2), daneben aber fanden sich völlig geschliffene Feuersteinäxte ("Keile"); aus dem neolithischen Pfahlbau von Wismar (vergl. Jahrb. 30, S. 1 ff.) stammt ein 13 cm langes Stück, welches dadurch interessant ist, daß es bei einer Grundform, die dem Manderower Exemplar fast gleicht, sowohl oben als unten unbearbeitet ist, dagegen die Seiten=


|
Seite 9 |




|
kanten scharf und wohl auch benutzt sind; eine ähnliche Erscheinung zeigt ein Exemplar von Bützow (vom "Hohenfelde," V.=S. 3300), mit dem Feuersteinsplitter u. A. vergesellschaftet sind. Wir haben hier also eine Grundform, aus der einerseits die späteren Messer, anderseits die Lanzen- oder Dolchspitzen hervorgegangen sind. Es ist eigenthümlich, daß gerade die Gegend von Wismar so verhältnismäßig reich an älteren Steinzeitformen ist; doch ist die Zahl noch nicht genügend, um etwa eine ältere Besiedelung gerade dieser Gegend daraus folgern zu können; bemerkt mag es aber immerhin werden, daß gerade die Gegend um Wismar mit ihrer geschützten Küste den Lebensbedingungen einer paläolithischen Bevölkerung, wie wir sie aus den dänischen Küstenfunden kennen, so entspricht, wie kaum eine zweite in Meklenburg.
Auf der Grenze von älterer und jüngerer Steinzeit scheint der interessante Moorfund von Woltersdorf zu stehen, auf dessen Behandlung durch Lisch, Jahrb. 34, S. 211, hier verwiesen sein mag. Auch einige "Feuersteinmanufakturen", so die von Pustohl und Weitendorf, enthalten so alterthümliche Formen, daß man sie als Uebergangsfunde bezeichnen kann.
Zu den paläolithischen Funden müssen wir theilweise auch die Aexte und Hacken aus Horn und Knochen rechnen. Dahin gehören besonders die Aexte aus Hirschhorn. Das Wurzelende bildet das Bahnende des Geräthes, oft ist die Rose als Hammer benutzt; die schräg durchgesägte Stange bildet die Schlagfläche. In Dänemark sind solche Aexte in Muschelhaufen gefunden (Müller, Nord. Alterth., S. 44 und Abb. 6; Ordning 24), bei Kiel in der paläolithischen Station Ellerbeck (Mestorf, Fig. 6); auch in Meklenburg haben wir sie in dem interessanten Grabe von Plau, einem sog. "liegenden Hockergrabe," in dem Lisch ein Urvolkgrab sah und das sicher älter ist, als unsere Hünengräber. Wir besitzen außer diesen noch acht Hirschhornäxte, und zwar mit seitlichem Loch, so daß der Schaft quer zur Schneide sitzt, zwei aus der Lewitz (Moorfunde), mit vertikaler Durchbohrung, so daß der Schaft der Schneide parallel geht, eins aus dem Pfahlbau von Wismar, je eins von Everstorf, Mildenitz, Lüsewitz, Nütschow, alles Moorfunde, die letzteren drei mit vierseitigem Loch. Unpublicirt ist:
Redentin; Pfahlbau im Hofmoor. Schneide abgebrochen, das große Schaftloch sitzt seitlich, das Ende (von der Rose ge=


|
Seite 10 |




|
bildet) zeigt Spuren der Abnutzung. Länge noch 9 cm. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1886. (V.=S. 4710.)
Die Funde von Wismar und Redentin, wo die Aexte in neolithischen Pfahlbauten gefunden sind, beweisen, daß die Axtform sich nicht auf die ältere Steinzeit beschränkt. Mehrere angearbeitete Stangen, die wohl zu derartigen Aexten verarbeitet werden sollten, sind außerdem bei Wismar gefunden. Auch das Exemplar von Nütschow ist mit jüngeren Steinsachen zusammen gefunden.
Andere Horngeräthe, so der Griff zu einer Steinaxt von Schwerin und ein seltsames dreizackiges Geräth mit Oeffnungen zur Aufnahme kleinerer Beile von Mallin, entziehen sich als Einzelfunde vorläufig noch der zeitlichen Bestimmung.
Neolithische Zeit.
Während von der älteren Steinzeit in Meklenburg nur Spuren und auch diese, wie es scheint, nur lokal beschränkt vorhanden sind, erscheint die jüngere hier reich und voll entwickelt. Es giebt hier keinen Landstrich, in dem nicht Steingeräthe, und zwar von allen Haupttypen, gefunden wurden. Allerdings ist die Vertheilung nicht gleichmäßig: bevorzugt sind die Küsten der Ostsee und der Binnenseen, am ärmsten die zusammenhängenden Sandgebiete, besonders der Südwesten und Nordosten des Landes und die Gegenden mit schwerem Lehmboden. Ein annäherndes Bild der Besiedelung des Landes kann uns die Vertheilung der Hünengräber geben, auf die in einer späteren Abhandlung eingegangen werden soll. - Wir besprechen zunächst die Typen der Werkzeuge.
Ein in die Augen fallender Unterschied zwischen ältere und jüngerer Steinzeit ist die verschiedene Bearbeitung des Feuersteins, den zu glätten man damals erst gelernt hat; bekanntlich hat man demgemäß die beiden Perioden auch als Perioden der ungeglätteten und geglätteten (polirten) Steingeräthe bezeichnet ein Ausdruck, den man als irreführend besser vermeidet, da nicht nur ganze Typenreihen (Dolche, Lanzen, Pfeile, Messer) auch in der jüngeren Steinzeit nie polirt worden, sondern selbst die gewöhnlich polirten Geräthe ("Keile" z. B.) häufig in ungeglättetem Zustande in Gebrauch genommen sind. Ein zweiter technischer Unterschied besteht in der feineren Art der Absprengung, Abquetschung, oder welches Verfahren sonst angewendet ist, der Ober=


|
Seite 11 |




|
fläche des Steines; an Stelle der großen groben Aushöhlungen der paläolithischen Zeit treten jene kleinen muschelartigen Vertiefungen, welche die Herstellung solch staunenswerther Kunstwerke, wie die Dolche es sind, ermöglichten.
Ferner aber ist nicht nur die Herstellungsart, sondern auch die Form der Geräthe eine andere; es differenziren sich die einfachen, vielfach verwendbaren Werkzeuge in speziellere zum Stechen, Schneiden, Schlagen, Schaben u. s. w. Es ist die Aufgabe der Alterthumsforschung, den Spuren nachzugehen, welche die allmähliche Entwickelung dieser steinzeitlichen Kultur andeuten. Leider stehen wir damit noch in den Anfängen; wir können bei den einzelnen Geräthen mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine Art von typologischen Entwickelungsgang aufstellen, aber Gruppen zusammengehöriger Typen der verschiedenen Geräthe lassen sich noch nicht bilden. Ebenso verhält es sich mit den anderen Aeußerungen des Kulturlebens des Steinzeitmenschen; wir finden ihn am Ende im Besitz einer hohen Kultur, unsere Hausthiere sind ihm bekannt, der Zustand des Fischer- und Jägerlebens ist überwunden, Ackergeräthe werden benutzt und Körnerfrüchte gebaut (Weizen, Gerste, auch Hirse, wie die sinnreichen Untersuchungen von G. Sarauw in Kopenhagen festgestellt haben; vergl. auch Buschan, vorgeschichtliche Botanik 1895); die kolossalen Hünengräber zeugen davon, wie beträchtliche Menschenkräfte zur Verfügung standen, das Auftreten südlicher Geräthtypen hier und umgekehrt nordischer in südlichen Gegenden beweist regelrechte Handelsbeziehungen u. s. w. Aber eine Kulturgeschichte können wir noch nicht schreiben. Die jüngere Steinzeit erscheint vorläufig noch als ein Ganzes, und zwar auch zeitlich nicht fixirbar. Die nordische Bronzezeit beginnt spätestens um 1200 vor Chr. Geb. Ob und wie lange sich eine Kupferzeit zwischen sie und die Steinzeit schiebt, ist noch nicht deutlich; um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends muß demnach die Steinzeit spätestens ihre volle Entwickelung erreicht haben; die Anfänge verlieren sich in zeitlosem Dunkel.
Wir zählen im Folgenden daher die Typen einzeln auf und geben das Wenige, was sich über ihre relative Chronologie sagen läßt, bei den einzelnen.
Das bei weitem häufigste Werkzeug ist ein keilförmiges Geräth, welches gewöhnlich aus Feuerstein, seltener aus Diorit,


|
Seite 12 |




|
Grünstein, Serpentin u. s. w. hergestellt wurde. Die beiden Breitseiten stoßen in einer breiten Schneide zusammen. Früher bezeichnete man das Geräth als Keil, jetzt hat sich der Name Beil eingebürgert. Richtig ist keiner von beiden. Es ist klar, daß je nach der Schäftung und mit geringen Modificationen der Form ganz verschiedene Thätigkeiten mit ihm möglich sind; es
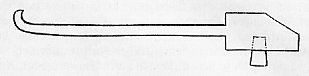
kann damit gestemmt, geschabt, geschnitten, geschlagen werden. Schäfte sind hier nicht erhalten; einmal soll ein Griff gefunden sein, den wir hier nach Lisch, Jahrb. 26, 131, abbilden; über einen anderen Schaft vergl. unter S. 21. Da wir keinen gemeinsamen Ausdruck für diese verschiedenen Leistungen haben, scheint es mir immer noch praktischer, den Namen Keil beizubehalten, der wenigstens ein annähernd richtiges Bild von der Form giebt, als den engen Namen Beil zu brauchen, der für eine große Anzahl gar nicht paßt.
Bei einer Klassificirung der Keile sind das hintere Ende (sog. Bahnende) der Querdurchschnitt, die Gestaltung der Seiten, besonders das Breitenverhältniß der Schmalseiten (die Dicke) und die Gestaltung der Schneide maßgebend gewesen. Die verschiedenen Stadien des Schliffs kommen bei allen vor und können nicht zur Ordnung dienen. So scheiden sich im allgemeinen vier Gruppen, besonders an den Schmalseiten erkennbar; doch sind zahlreiche Uebergangsformen zwischen allen vier selbstverständlich.
A. Ohne Schmalseiten, die Breitseiten stoßen in scharfer Kante zusammen. (Uebergangsform von paläolithischer Zeit s. Montelius, compte rendu du congrès de Stockholm 1876, S. 238 ff.)
I. Mit dreieckigem oder trapezförmigem Durchschnitt Montelius, C. R. 1. 2. 5. 7.
II. Mit annähernd rechteckigem Durchschnitt Montelius, C. R. 6.
B. Mit schmaler Schmalseite, deren größte Dicke am Bahnende liegt. (Lisch, "Streitkeile".)
I. Durchschnitt trapezförmig.
II. Durchschnitt annähernd rechteckig.


|
Seite 13 |




|
C. Mit breiter, gewöhnlich nicht polirter Schmalseite. (Lisch, "Arbeitskeile.") Bahnende gewöhnlich rechteckig.
a. größte Dicke nahe dem Bahnende.
I. Durchschnitt trapezförmig.
II. Durchschnitt annähernd rechteckig.
b. größte Dicke nahe der Schneide.
I. Durchschnitt trapezförmig.
II. Durchschnitt annähernd rechteckig.
D. Mit gewölbter, gewöhnlich polirter Schmalseite; die Breitseite auch gewölbt; Bahnende scharfkantig. (Lisch, "Meißelkeile.")
I. Durchschnitt trapezförmig.
II. Durchschnitt annähernd rechteckig.
Eine besondere Abtheilung für die Hohlkeile und Keile mit auswärts gebogener Schneide halten wir nicht für nöthig, da diese sich an die genannten Typen anschließen (s. unten die Aufzählung besonders unter B).
Der Typus A geht aus den oben besprochenen paläolithischen Formen hervor; wir besprechen zuerst eine Gruppe, die nur durch den Schliff der Schneide sich von diesen unterscheidet.
Die Schlagflächen werden kleiner, und allmählich tritt der feine muschelige Bruch an ihre Stelle.
Tessenow bei Parchim. Oben ziemlich spitz zugehend, starke Schneide, größte Dicke B von derselben. Länge 12 cm, Breite 2 und 4 1/2 cm; speckiggrau. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S., Gl. IV. 1, 275.) Fast ganz gleich Evans a. a. O., Fig. 33.
Tessenow. Meißelförmiges Geräth, grob zugehauen, zum Theil der rohe Stein, die Schneide nur gering angeschliffen. Länge 10 1/2, Breite oben und unten 1 1/2, B von der Schneide 2 1/2 cm; speckig grau. Gleich dem vorigen. (Gl. IV. 1, 277.)
Wakendorf bei Neubukow. Dem vorigen ähnlich, aber stärker gewölbt; Länge 12 1/2, Breite 2 und 3 1/2 cm, weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 230.)
Kirch-Rosin bei Güstrow. Das obere Ende sich zuspitzend und rundlich abschließend; 13 1/2 cm lang, 2 und 5 1/2 cm breit, weiß glänzend. Geschenk des verstorbenen Herrn Landbaumeisters Koch in Güstrow. (V.=S. 4080.) Aehnlich Evans 43.


|
Seite 14 |




|
Aus dem älteren Bestande stammen Exemplare von Güstrow (V.=S. 3511) und Robrow bei Sternberg (Großherzogliche Sammlung, Katalognummer Gl. IV. 1, 29.), ein Mittelding zwischen dem von Lüdershagen und dem ersten Tessenower; angeblich mit einer Urne in einem Hünengrabe gefunden. Leider ist diese Angabe zu unbestimmt; sonst sind bei uns in Hünengräbern derartige Funde nicht gemacht. Wohl aber haben wir ähnliche aus Moorfunden und zwar:
Redentin bei Wismar. Müllermoor (Pfahlbau?).Ein sehr schönes Exemplar von 13 cm Länge, 2 1/2 und 4 cm Breite, durchscheinend grau. (V.=S. 4593, erwähnt Jahrb 28, S. 123.)
Langensee bei Crivitz. Moorfund, fast ganz gleich dem erwähnten. Länge 11, Breite 2 1/2 und 4 cm. Zusammen gefunden mit mehreren andern Keilen jüngerer Form, halbmondförmigen Messern, offenbar ein "Depotfund" (Gr. S., Gl. IV. 1, 119.)
Gr.-Woltersdorf bei Wismar. Moorfund, s. oben. Hier Exemplare, alle fein muschelig geschlagen; der größte gar nicht, der kleinste ganz geschliffen. (V.=S. 4195 - 4198.)
Dahin gehört noch ein sehr hübsches Stück von der "Feuersteinmanufactur" von Eldenburg bei Waren (s. darüber Jahrb. 41, S. 161 und 42, S. 131), ganz rundlich, 7 1/2 cm lang, 1 1/2 und 4 cm breit glänzend grau. (V.=S. 4508.)
Für die zeitliche Stellung der zuletzt besprochenen Keile ist besonders der Fund von Woltersdorf wichtig. Wir haben dort gut geschliffene Exemplare, daneben einfach zugeschlagene. Daß wir diesen Typus also der neolithischen Periode zuschreiben müssen, ist unzweifelhaft; ich halte uns aber für berechtigt, bei dem Funde von einer beginnenden neolithischen Periode zu sprechen. Es würde sich dann das Vorkommen einiger echt paläolithischer Formen am besten so deuten, daß Meklenburg am Ende der paläolithischen Periode seine älteste Einwanderung oder doch seine älteste Kultur erhalten hat. Wenn wir aber oben bei den primitivsten Formen ein auffallendes Hervortreten der Umgegend von Wismar bemerkten, so gilt das für die zuletzt besprochenen Typen auch, und die Wahrscheinlichkeit, daß die älteste Besiedelung die Seeküste entlang von Westen her stattgefunden hat, mehrt sich. Es paßt das auch vortrefflich mit den Vorstellungen, welche sich die nordischen Forscher von dem Gange der Kultur machen. Nach Worsaae ist zuerst in der älteren Steinzeit die östliche Küste der cimbrischen Halbinsel besiedelt, dann die dänischen Inseln; als die Steinkultur nach


|
Seite 15 |




|
Schonen hinüberging, hatte sie schon eine höhere Stufe erreicht, daher die geringere Zahl paläolithischer Formen daselbst; auf einer ähnlichen Stufe wie Schonen scheint mir nun Meklenburg zu stehen. Es würde dann das Steinzeitvolk oder, sagen wir vorsichtiger, die Steinzeitkultur sich nach zwei Richtungen von der cimbrischen Halbinsel aus entwickelt haben. Wie die paläolithischen Vorkommnisse auf Rügen sich bei solchem Gange der Kultur erklären, lasse ich dahingestellt, gestehe aber, daß die Annahme (vergl. R. Bayer, Die Insel Rügen in archäologischer Beziehung), die Insel sei noch in paläolithischer Zeit von den dänischen Inseln aus, nicht vom Festlande her besiedelt, viel Ansprechendes hat und jedenfalls mit dem archäologischen Bestande vortrefflich übereinstimmt.
Entwickelte Formen des Typus A (überwiegend geschliffen) sind folgende:
Lalchow bei Plau. Sehr schönes Exemplar mit seinem muscheligen Bruch. Länge 16, Breite 3 und 6 cm weißgrau. Gefunden in einem Moor zusammen mit einem großen, fein geschliffenen Keil. (Gr. S., Gl. IV. 1, 327.) Aehnlich Evans a. a. O., Fig. 35.

Gnewitz bei Tessin. Die obere Fläche stark gewölbt, die untere platt; 13 cm lang, 2 und 3 1/2 cm breit, derb zugehauen, aber gut geschliffen; gelbweiß opak. Geschenk des Herrn v. d. Lühe 1880 (V.=S. 4567.) Aehnlich Montelius, A. S. 13.
Dummerstorf bei Rostock; im Moor gefunden. Interessant, roh zugehauen, die Schneide noch roher Stein. Länge 10, Breite oben 1, unten 4 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S., Gl. IV. 1, 399.)
Finkenthal bei Gnoien. 8 1/2 cm lang, 1 und 3 cm breit, durchscheinend grauweiß. 1891. (Gr. S., Gl. IV. 1, 365.)
Bei Schwerin (ohne nähere Fundangabe). Gleich den vorigen, aber kleiner. 8 1/4 cm lang, 1 1/2 und 4 1/4 cm breit; weiß glänzend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 223.) Aehnlich Evans 43.
Alt-Steinhorst. Gut geschliffen, aber die Seiten ganz roh zugehauen; wie es scheint aus einem größeren Keil zurechtgeschlagen; Bahnende roh; 7 1/2 cm lang, 2 und 5 1/2 cm breit;


|
Seite 16 |




|
grauglänzend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884 (Gr. S., Gl. IV. 1, 298.)
Lübz. 16 cm lang, 3 und 5 1/2 cm breit; fast ganz geschliffen; weißer glänzender Stein. Die Seiten stoßen nicht wie bei den andern scharf zusammen, sondern lassen eine schmale (1/2 cm) Fläche, die polirt ist. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1889. (Gr. S., Gl. V. 1, 288.) Aehnlich Evans a. a. O., 44.

Roggow bei Neubukow. Grobmuschelig geschlagen, dann geschliffen, ganz schmale Seitenwand; bräunlichweiß; Länge 6 1/2 Breite oben 2 unten 4 cm größte Dicke (ganz nahe der Schneide) 0,50, sonst nur 0,25 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 406.)
Unsere Sammlung besitzt außer diesen Stücken sechs Einzelfunde dieses Typus, und zwar den unter 1 und 2 erwähnten gleichend: von Manderow (V.=S. 3103, vergl. Jahrb. 20, S. 278), Buchholz bei Schwerin (V.=S. 3866) und Bollhagen bei Ribnitz (V.=S. 3818), ähnlich dem von Gnewitz: ein Prachtstück von Lehsen bei Wittenburg (V.=S. 410, Jahrb. 4 B, S. 26), und Uebergangsformen wie das Stück von Lübz: von Klink bei Waren auf dem Behrenswerder (V.=S. 4150) und Dobbin bei Krakow (V.=S. 2129, Jahrb. 11, S. 346), letzteres Stück aus einem Hünengrabe.
An diesen Typus A schließen wir als B die Exemplare mit vierseitigem länglichen Querschnitt, wo also die Seitenflächen verhältnißmäßig schmal sind; meist haben obere und untere Seiten eine schwache Wölbung; neben dem Querschnitt ist für die Form das Längenverhältniß der Schneide und des Bahnendes maßgebend. Von Lisch wird diese Form als "Streitmeißel" bezeichnet, ein Ausdruck, den ich nicht für glücklich halte, denn wenn er (Jahrb. 27, S. 167) sagt, daß "die in großen, also wichtigen Steingräbern gefundenen Keile gewöhnlich breitschneidig, dünn und mit Sorgfalt gearbeitet, also wohl zum Einklemmen in einen gespalteten Schaft, also zu Streitbeilen für Helden benutzt worden sind," so hat sich die Beobachtung durch spätere Funde nur bestätigt, die Folgerungen aber, die in den drei " also" liegen, muß


|
Seite 17 |




|
ich ablehnen, zumal die Keile gerade an der Stelle, wo sie eingeklemmt sein müßten, durchaus nicht am schmalsten sind. Wir
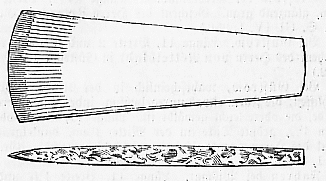
behandeln zunächst diejenigen mit wesentlicher Verjüngung. Wo es nicht besonders erwähnt ist, sind die Breitseiten ganz geschliffen, die Schmalseiten gar nicht. Vergl. Montelius 35, Müller 60, 61, Mestorf 32, 34.
B I. Alt-Sammit bei Krakow. Elegantes Exemplar auch die Seiten etwas geschliffen. Länge 19 1/2, Breite oben 3, unten 6 1/2, Durchmesser 2 cm, grauweiß. Gefunden in dem dritten Hünengrabe zusammen mit einem ähnlich geformten Meißel. Geschenk des Herrn Fabrikant Lorenz in Krakow 1884. (Gr. S. St. 2.)
Degtow bei Grevesmühlen; in der Kiesgrube nahe der Stadt, wo schon öfter Steinsachen gefunden sind. Der obere Theil unbearbeitet, sonst muschlig geschlagen und offenbar benutzt. Länge 15, Breite oben 1,5, unten 4,5, Durchmesser (oben) 1,35 cm. Geschenk des Herrn Sanitätsrath Dr. Jahn in Grevesmühlen 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 416.)
Gr.-Krankow bei Wismar. Länge 13, Breite 1 3/4 und 4 cm, braun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 212.)
Gnoien. Länge 13, Breite 2 und 5 cm, durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 219.)
Wismar. Länge 13, Breite 1 1/2 und 4 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 335.)
Kritzow bei Wismar Länge 12 1/2, Breite 2 und 3 1/2 cm, opak weiß grau. Geschenk des Herrn Burmeister i. K. 1880. (V.=S. 4613.)


|
Seite 18 |




|
Schwerin (Johann Albrechtstraße). Länge 12, Breite 1 3/4 und 4 1/2 cm, weißgrau opak. (Gr. S. Gl. IV. 1, 358.)
Gressow bei Grevesmühlen. Länge 11 1/2, Breite 2 und 4 cm, glänzend grau. Geschenk des Herrn Zwerch in Gr. 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 356.)
Bei Güstrow. Länge 11, Breite 2 und 4 1/4 cm, rothgelb. Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 1652.)
Bei Güstrow, wahrscheinlich in der Klues. Breitseiten geschliffen, die Form etwas unregelmäßig, indem die untere Fläche gerade, die obere leicht gewölbt ist. Länge 11, Breite oben 1 1/2, unten 4 1/2, größte Dicke (in der Mitte) 1 cm, dunkelgrau. Geschenk des Herrn von Kolhans auf Golchen 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 403.)
Fahren bei Wismar. Länge 11, Breite 1 3/4 und 4 cm gelb. Geschenk des Herrn Dr. Crull. (V.=S. 4660.)
Wir schließen hier noch einige breitere Beile an; diese haben allerdings ebenfalls eine starke Verjüngung, nähern sich aber durch ihre Breite schon dem unten folgenden Typus (B II.)
Beckerwitz bei Wismar. Schlank, Länge 10, Breite oben 3, unten 5, größte Dicke (4 von unten) 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn K. Mann 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 371.)
Pogreß. Länge 7 1/2, Breite oben 3 unten 5, Dicke 1 cm, gelbbraun. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. nach Beckerwitz, Gl. IV. 1, 378.)
Wakendorf bei Neubukow. Schneide abgebrochen. Obere Breite 1 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr., S. Gl. IV. 1, 236.)
Von ganz gleicher Form besitzen wir zwei Beile (Wattmannshagen, V.=S. 1173, Jahrb. 9, S. 21 und Schwerin, V.=S. 4404), welche nur zugeschlagen, aber nicht geschliffen sind; beide haben Abnutzung an der Schneide, ein Beweis, daß auch die ungeschliffenen Exemplare gelegentlich in Gebrauch genommen wurden.
Während die Verjüngung meist eine gleichmäßig zunehmende ist, also die Schmalseiten gerade sind, zeigt sich an mehreren auch eine stärkere Ausladung an der Schneide, so daß die Kanten der Schmalseiten eine nach unten gebogene Linie bilden. Doch sind das nur Ausnahmen, die uns nicht berechtigen, eine besondere Abtheilung aus ihnen zu machen. Vergl. Montelius 23, Müller 64, Mestorf 35. Hierhin gehören Exemplare von:


|
Seite 19 |




|
Waren. Länge 14, Breite 3 und 5 1/2 cm; dunkelrothbraun. Sammlung Struck 1886. (Gr. S., Gl. IV. 1, 319.)
Roggow bei Neubukow. Muschelig geschlagen, zierliche Form, starke beilartige Ausschweifung, wie bei keinem zweiten Exemplar unserer Sammlung. Länge 12 1/2, Breite oben 1,5, unten 4,25 cm, größte Dicke (3 von unten) 1,5 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 404.)
Löwitz bei Rehna. Schön geschwungene Schneide; Länge 12, Breite 2 und 5 1/2 cm (!); dunkelrothbraun. (V.=S. 4717.) S. beistehende Abbildung.
Gressow bei Grevesmühlen. Länge 9 1/2, Breite 1 1/4 und 5 cm (!); weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 228.)
Neu-Karstädt bei Grabow. Länge 9, Breite 2 und 4 cm, grader Durchmesser (B von oben) 1 cm. Geschenk des Herrn Bunge in Grabow 1887. (Gr. S., Gl. IV. 1, 336.)
Kaltenhof auf Poel. Ganz ungeschliffen, an der Schneide verletzt. Länge 8,5, Breite 2 und 4,5, Durchmesser 1 cm. Geschenk des Herrn Pagels in Schwerin 1887. (Gr. S., Gl. IV. 1, 329.)
Ueber ein Stück von Peccatel (V.=S. 4421) vergl. Jahrb. 29, S. 134.
B II. Vierseitiger Durchschnitt, schmale Seitenflächen, geringe Verjüngung.
Granzow bei Gnoien. Länge 15, Breite 3 und 4 1/2 cm; hellbraun, gesprenkelt. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 192.)
Remlin bei Malchin. Länge 14, Breite 2 1/2 und 4 cm; braun und weißlich. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 210.)
Fundort unbekannt. Länge 14, Breite 2 1/2 und 5 1/2 cm, grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Major von Hanstein 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 330.)
Plau. Länge 13, Breite 2 1/2 und 5 cm, dunkelgrau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 217.)
Tessenow. Länge 11, Breite 2 und 5 cm, glänzend gelbgrau, fleckig. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. IV. 1, 276.)


|
Seite 20 |




|
Neuenhagen bei Dassow. Länge 10, Breite 2 und 5 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1890. (V.=S. 4726.)
Neuenhagen bei Dassow. Zwei ähnliche Exemplare. Länge 8 3/4 (7), Breite 2 3/4 und 4 (2 3/4 und 3) cm; grau, durchscheinend und gelb. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1890. (V.=S. 4728 und 4727.)
Alt-Steinhorst. Länge 10 1/2, Breite 2, 3 und 4 cm; opak weiß. Geschenk des Herrn Grafen Bernstorff 1884. (Gr. S., Gl. IV. 1, 304.)
Wölschendorf bei Rehna. Gefunden an einem Richtwege, der von Wölschendorf nach Brützkow geht, und zwar dort, wo er über eine Wiese führt, die (ein früherer Teich?) den Namen Nummersteich hat; weiß, auf der einen Seite gelbweiß, am Bahnende etwas abgebrochen. Länge noch 8 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, gerader Durchmesser (gleichmäßig) 0,75 cm. Erworben 1895 unter Vermittelung des Herrn Rohde in Rehna. (Gr. S. Gl. IV. 1, 412.)
Lütgenhof bei Dassow. Länge 8, Breite oben 2 1/2, unten 3 1/2, Durchmesser 1 1/2 cm, weißgrau. Sammlung Peitzner 1893.(Gr. S. Gl. IV. 1. 384.)
Ungeschliffene Exemplare dieses Typus sind seltener; einige sind schon oben bei den geschweiften Exemplaren aufgezählt; dazu
Barnekow bei Wismar. Form B I., oben der unbearbeitete Stein. Länge. 10,5, Breite oben 25, unten 4,5, grader Durchmesser 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 214.)
Roggow bei Neubukow. Derb muschelig geschlagen, zum Theil noch der rohe Stein, unregelmäßige Ränder gelbbraun: die Schneide ist leicht nach außen geschweift. Länge 12, Breite oben 3,5, unten 4,5, grader Durchmesser (in der ganzen Mitte 1,5 cm. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen auf Roggow 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1,405.)
Wir schließen hieran als Typus C diejenigen Stücke, bei denen die Schmalseite sich etwas verbreitert und das Streben, stärkere Exemplare zu schaffen, hervortritt. Die Schmalseiten sind nicht mehr gleichmäßig dick, sondern meist in B Entfernung von der Schneide am stärksten; die Schmalseite selten geschliffen, das Bahnende nie scharfkantig, meist rundlich, oft unbearbeitet.


|
Seite 21 |




|
Es sind diese die häufigsten Keile, von Lisch Arbeitskeile genannt, ohne Zweifel auch überwiegend zum Keilen benutzt.
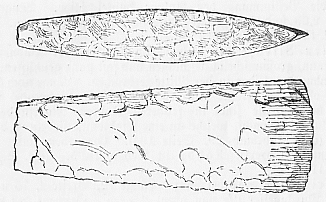
C a. Arbeitskeile wo die größte Dicke nahe dem Bahnend liegt. I. mit rhombischem Durchschnitt. Müller 50, 68.
Beckerwitz bei Wismar. Sehr starkes Exemplar; grobmuschelig zugehauen; Bahnende scharfkantig, fast rechteckig.(4 und 1 1/2 cm.) Länge 24, Breite oben 4, unten 6, größte Dicke (12 von unten) 4 cm; braun fleckig. Erworben durch Herrn Dr. Crull in Wismar 1894. (Gr. S., Gl. IV. 1,400.
Warnemünde. Ganz ungeschliffen, schlankes Exemplar dem Typus B I sehr nahe kommend. Das Stück wurde nahe bei Diedrichshagen am Strande in einer Schlickschicht gefunden darüber lag etwa 30 cm Torf, dann die Sandablagerung der Düne, im Ganzen 1 m unter dem gewöhnlichen Wasserstande. Es waren zusammen vier Stück, von denen zwei in die Rostocker Sammlung gekommen sind (vgl. Geinitz, Jahrbuch 51, Seite 3) Zugleich wurde ein Stück Eichenholz eingeliefert, welches durch starkes Zusammentrocknen seine Form verloren hat, aber deutlich einen Falz zeigt, in welchen unser Stück hineinpaßt, also wohl den Griff desselben gebildet hat. Länge 18,5, Breite 2,5 und 6 größte Dicke 1,75 cm (B von oben). Geschenk des Herrn Apotheker Jörß in Rostock 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 317.)
Rostock. Länge 17, Breite 2,25 und 5, größte Dicke (B von oben) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S., Gl. IV. 1, 208.)
Bobzin bei Wittenburg. Gefunden nordöstlich vom Dorf mit einer durchbohrten Axt (s. unten) 1888 auf einem Funda=


|
Seite 22 |




|
mente von Feldsteinen, welches aber schon so gestört war, daß eine vom Verfasser vorgenommene Untersuchung nur noch das Vorhandensein von Kohle und Urnenscheiben feststellen konnte, aber die Bestimmung der Anlage dunkel blieb. Länge 14, Breite 2,25 und 4,5, größte Dicke (B von oben) 1,5 cm. (Gr. S., Gl. IV. 1, 337.)
Neu=Bitense bei Rehna, im Garten der Büdnerei 1. Gelbbraun, großmuschelig geschlagen und fast ganz geschliffen, auch das Bahnende; leider in der Mitte zerbrochen. Länge noch 12 1/2, Breite oben 2 1/2, größte Dicke (5 cm von dem Bahnende) 2 cm. Auch bei Bitense sind in früheren Jahren Moorfunde (im Wispelmoor) gemacht, welche an eine Pfahlbauansiedelung denken lassen (vgl. Jahrbuch 29, Seite 134). Erworben unter Vermittelung des Herrn Rohde in Rehna 1895. (Gr. S., Gl. IV. 1, 411.)
Kritzower See bei Lübz. Länge 12, Breite 2,75 und 5, grader Durchmesser (B von oben) 2,5 cm. Geschenk des Herrn Posthalter Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S., Gl. IV. 1, 294.)
Pogreß. Gelbbraun; klein und zierlich, zum Theil geschliffen, auch an der Schmalseiten. Länge 10, Breite oben 2, unten 4, gerader Durchmesser (5 cm von unten) 1 1/4 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S., Gl. IV. 1, 376.)
C a II. Bedeutend seltener sind solche mit annähernd rechteckigem Durchschnitt.
Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 2,75, größte Dicke (B vom Bahnende) 2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 305.)
C b I. Starke Beile mit vierseitigem Querschnitt, in der Schneide etwas breiter als am oberen Ende. (S. die Abbildung S. 21.)
Die Schmalseiten sind gerade, nicht geschliffen, die Breitseiten meist ganz geschliffen, das obere Ende nur zugehauen, oft mit Spuren der Abnutzung, die Schneide meist gleichmäßig, nicht mit größerer Abnutzung auf einer Seite. Die größte Dicke liegt meist in B Entfernung von der Schneide. Es sind offenbar die eigentlichen Arbeitsgeräthe zum Hauen, Keilen u. s. w. (Lisch nannte sie daher "Arbeitskeile"; vergl. Montelius a. a. O. 24, 25 Mestorf a. a. O. 21-24;) ihre Schäftung bestand wohl in einer Handhabe aus Horn, die dann in einen Holzschaft geklemmt werden konnte. Vergl. Montelius 24, Müller 59, Mestorf 22-24.


|
Seite 23 |




|
Kl.=Labenz bei Warin. Sehr schönes, besonders starkes Exemplar, gut geschliffen. Länge 20, Breite oben 5, unten 8 1/2, größte Dicke (6 von unten) 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Diestel auf Kl.=Labenz 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 372.)
Dambeck bei Röbel. Gelbbraun, Länge 18 1/2, Breite oben 4, unten 6 1/2, größte Dicke 3 (1/2). Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 361.)
Bei Gnoien. Länge 18, Breite 3 1/2 und 6, größte Dicke 2 1/2 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 187.)
Saunstorf bei Wismar. Länge 17 1/2, Breite 3 3/4 und 6 1/4, größte Dicke 3 1/2 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 185.)
Tatschow bei Schwaan. Grauweiß, Schmalseiten geschlagen, Breitseiten gut geschliffen. Länge 17 1/2, Breite oben 4 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 387.) Angeblich aus einem Hünengrabe.
Brunshaupten Länge 17, Breite 3 und 5, größte Dicke 3 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Erbpächters Risch 1881. (Gr. S. Gl. IV. 1, 271.)
Wotenitz bei Grevesmühlen. Länge 17, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm; durchscheinend grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 206.)
Bresegard bei Grabow. Länge 17, Breite 2 3/4 und 5 1/2, größte Dicke 2 1/4 cm, durchscheinend weiß. Geschenk des verstorbenen Herrn Revisionsrath Wunderlich 1887. (V.=S. 4708.)
Roggenstorf bei Grevesmühlen. Länge 16, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke 3 cm, durchscheinend weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 188.)
Zehmen bei Rehna. Länge 16 1/2, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, rothbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 259.)
Am Kritzower See bei Lübz. Länge 15 1/2, Breite 4 und 6 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, durchscheinend weiß. Geschenk des Herrn Posthalters Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 293.)
Steinbeck bei Parchim. Länge 15 1/2, Breite 2 und 4, größte Dicke 2 cm, durchscheinend hellbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 209.)
Cordshagen bei Rehna. Die Schmalseiten fast ganz geschliffen. Länge 15 1/2, Breite 3 und 5 1/2, größte Dicke


|
Seite 24 |




|
2 1/2 cm, grau opak. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 260.)
Wismar, Müggenburger Moor (Pfahlbau). Länge 15, Breite 4 und 7, größte Dicke 2 1/2 cm, grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gl. IV 1, 193.)
Alt=Karin bei Neubukow. Länge 15, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 2 cm, röthlich weiß. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorf 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 309.)
Wismar. Gefunden hinter dem Friedhofe bei dem sog. Galgenberge, ganz weiß, an allen Seiten geschliffen. Länge 15, Breite oben 2,5, unten 6, größte Dicke (8 von unten) 2 1/4 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 415.)
Beckerwitz bei Wismar. Länge 15, Breite oben 4, unten 6 1/2, größte Dicke (6 1/2 von unten) 2 1/2 cm. Bei Beckerwitz sind in den letzten Jahren zahlreiche Steinsachen, besonders in Mooren gefunden, die auf eine Ansiedelung (Pfahlbau) schließen lassen. Eine Localuntersuchung hat noch nicht stattgefunden. Mehrere sind nach Schwerin gekommen und werden hier aufgezählt, viele befinden sich in und bei Wismar im Privatbesitz. Geschenk des Herrn K. Mann 1892 (Gr. S. Gl. IV. 1, 369.)
In der Lewitz. Hellgrau, oben derb zugeschlagen, die Schneide schön geschliffen. Länge 15, Breite oben 3 unten 6, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn Renard in Helm bei Wittenburg, 1890. (Gr. S. St. 7.)
Harkensee bei Dassow. Länge 14 1/2, Breite 3 und 5, größte Dicke 3 cm, opak weiß. Geschenk des Herrn Gutsbesitzer Hillmann auf Harkensee 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 314.)
Gressow bei Grevesmühlen. Länge 14 1/2, Breite 3 und 6, größte Dicke 2 1/2 cm durchscheinend weiß. Sammlung von Rantzau 1871 (Gr. S. Gl. IV. 1, 194.)
Crivitz. Länge 14 1/2, Breite 3 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, weißgrau. Erworben 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 331.)
Gnoien. Länge 14, Breite 2 1/2 und 5, größte Dicke 2 cm, braunroth und weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 191.)
Fundort unbekannt. Länge 14 1/2, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3 cm, weiß und braun gefleckt. Erworben 1882. (Gr. S. Gl. IV. 1, 281.)
Klütz. Länge 14, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 204.)


|
Seite 25 |




|
Alt=Steinhorst. Etwas abweichend, das obere Ende schräg sehr schön geschliffen, Schneide schräg abgenutzt; Uebergangsform zu D. Länge 14, Breite 5 und 7 1/2 größte Dicke (1/2 vom Ende) 2 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 302.)
Drei=Lützow bei Wittenburg. Gelbbraun, derb und dick alle Seiten geschliffen. Länge 13 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, größte Dicke (6 1/2 von unten) 2 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893 (Gr. S. Gl. IV. 1, 380.)
Granzow bei Gnoien. Länge 13, Breite 3 und 4 l/2, größte Dicke 3 cm, dunkelbraun und weiß gefleckt. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 200.)
Wismar (Ragenmark). Länge 13, Breite 2 3/4 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 355.)
Dreveskirchen bei Wismar. Länge 13, Breite 1 1/2 und 4 1/2 größte Dicke 2 cm, weiß opak. Geschenk des Herrn Mann 1882 (V.=S. 4540.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Länge 13, Breite 2 1/2 und 5, größte Dicke 3 cm, weiß glänzend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorf 1885. (Gr. S. Gl. IV. 1, 301.)
Rederank bei Güstrow. Im Moor gefunden. Länge 13, Breite 3 und 5, größte Dicke 1 1/2 cm, durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Candidaten Rönnberg 1881. (Gr. S. Gl. IV. 1, 273.)
Elmenhorst bei Klütz. Länge 13, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871.(Gr. S. Gl. IV. 1, 203.)
Arpshagen bei Klütz. Länge 12, Breite 2 und 4 1/2, größte Dicke 2 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Karl Mann in Wismar 1887 (V.=S. 4637.)
Schwerin, am Ostorfer See bei dem Ausheben der Baugrube zu dem Wohnhause auf der Höhe neben der neuen Badeanstalt; es sollen in riesigen Boden noch mehrere Exemplare gefunden, aber verworfen sein. Grauweiß, Länge 12 1/2, Breite oben 3, unten 4 1/2, größte Dicke (5 von unten) 2 1/2 cm, derb, muschelig geschlagen, zum Theil geglättet. Geschenk des Herrn Sekretär Metterhausen in Schwerin 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1. 409.)
Rabensteinfeld. Länge 11 1/2 Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/2 cm, grau und weiß gefleckt, 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 285.)


|
Seite 26 |




|
Alt=Karin bei Neubukow. Länge 11, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 2 cm, opak weiß. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 311.)
Helm bei Wittenburg, in einem kleinen Torfmoor Länge 11, Breite 2 1/2 und 3 1/2 größte Dicke 1 3/4 cm, glänzend braun. Geschenk des Herrn Wildhagen 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 345.)
Lübsee bei Rehna. Länge 11, Breite 1 1/2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, graugelb. Sammlung Splitter 1876. (Gl. IV. 1, 266,)
Schwerin, in der Nähe des Küchengartens am großen See, einer Gegend, die durch zahlreiche prismatische Messer u. s. w. als alte Wohnstelle gekennzeichnet ist. Länge 11, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn G. Stargard in Schwerin 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 296.)
Klütz. Unregelmäßige Form, rundlicher als die anderen, Länge 10 1/2, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 1/4 cm, gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1,205.)
Zehmen bei Rehna. Länge 10 3/4, Breite 1 1/2 und 3 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm; gelbbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S., Gl. IV. 1, 265.)
Waren. Auch die Schmalseiten geschliffen. Länge 10 3/4, Breite 2 und 4 1/2 größte Dicke 1 1/4 cm; weiß=grau. Sammlung Struck 1886. (Gl. IV. 1, 320.)
Neuhof bei Neustadt. Länge 10, Breite 2 und 3 1/2, gerader, größte Dicke 1 3/4 cm, opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 229.)
Dargun. Länge 10, Breite 2 und 4 3/4, größte. Dicke 1 /2 cm; blau, durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. Gr. S., Gl. IV. 1, 115.)
Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 2 und 4, größte Dicke 1 1/2 cm, weiß opak. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 306.)
Lübsee bei Rehna. Klein, zierlich, ganz geschliffen. Länge 9, Breite 1 3/4 und 3 1/2, größte Dicke 1 cm; gelb. Sammlung Splitter 1876. (Gl. IV. 1, 184.)
Alt=Steinhorst. Länge 6 1/2 (!), Breite 1 1/2 und 2 3/4, größte Dicke 3/4 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 307.)
Alt=Steinhorst. Länge 9, Breite 2 1/2 und 4, größte Dicke 2 cm. (Gr. S. Gl. IV. 1, 338.)


|
Seite 27 |




|
Zierow bei Wismar. Länge 10, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 cm, fast schwarz. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 350.)
CbII. Auch hier sind wie bei Ca die Keile mit annähernd rechteckigem Durchschnitt selten. Vgl. Montelius 19, Mestors, 21, Merkbuch 1. 7.
Bülow bei Rehna. Gefunden beim Pflügen in der Nähe des "ollen Bülow", eines Moores nordöstlich vom Orte. Grau mit braunen Flecken, schönes gut geschliffenes Stück. Länge 16, Breite oben 5, unten 6 1/2, größte Dicke (7 von oben) 2 1/2 cm. Das Stück befindet sich im Besitz des Finders (Lüth in Bülow). In dem "ollen Bülow" sind ebenso wie in dem benachbarten Moore "Langerieh" mehrfach Steinsachen gefunden (eine schöne Dioritaxt und ein Schleifstein befinden sich im Großherzoglichen Museum); ob auch hier ein Pfahlbau war, bleibt zu untersuchen.
Alt=Steinhorst. Länge 15,5, Breite 3 und 4, größte Dicke 2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 299.)
Manderow bei Wismar. Länge 15, Breite 3 und 4, größte Dicke 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 196.)
Helm bei Wittenburg. Länge 12, Breite 4 und 5, größte Dicke 2,5 cm. Geschenk des Herrn Wildhagen 1883. (Gr. S. GI. IV. 1,282.)
Unvollständige (zerbrochene) Exemplare dieses Typus (C b) sind
Plate bei Schwerin, im Bette der Stör. Untere Breite 6, Dicke 4 1/2 cm (!); grau. Das obere Ende fehlt. Geschenk des Herrn Landbaumeister Ahrens 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 334.)
Peckatel bei Schwerin. Breite oben 3 cm, das untere Ende fehlt; gelbbraun. Geschenk des Herrn Lehrers Rambow in Peckatel 1889. (Gr. S Gl. IV. 1, 353.)
Köchelsdorf bei Wismar. Das obere Ende fehlt; gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 201.)
Brunshaupten. Breite unten 4 1/2, Dicke 2 cm, das obere Ende fehlt; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Risch in Brunshaupten 1881. (Gr. S. Gl. IV. 2, 272.)
Käselow bei Gadebusch. Breite unten 5, Dicke 3 cm, das obere Ende fehlt; grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 241.)


|
Seite 28 |




|
Wotenitz bei Grevesmühlen. Breite oben 3 cm, das untere Ende fehlt; weiß opak. Sammlung von Rantzau 1871 (Gr. S. Gl. IV. 1, 234.)
Dämelow bei Brüel. Sehr starkes Exemplar; Breite oben 4, größte Dicke 4 cm, das untere Ende abgebrochen; weiß opak. Geschenk des Herrn von Storch auf Dämelow 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 343.)
Wendorf bei Wismar; an der See. Breite unten 6 1/2, größte Dicke 2 cm; weißgelb. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV 1, 237.)
Alt=Steinhorst. Breite unten 3, größte Dicke 0,5 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 308.)
Redefin (Dorfstraße.) Weiß, lang und stark, doch fehlt die Schneide; Schmalseiten großmuschlig geschlagen. Länge 2, Breite oben 3, größte Dicke jetzt am Ende 3 cm Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 381.)
Prieschendorf. Gelbbraun; nur der obere Theil. Breite oben 2 1/2 größte Dicke (jetzt am Ende) 1 1/2 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, 382.)
Pogreß. Weiß, der obere Theil eines langen Exemplars. Länge?, Breite oben 2 1/2, größte Dicke (am zerbrochenen Ende) 4 1/2 cm. Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, 377.)
Wismar. Breite oben 3, größte Dicke 0,5 cm. Sammlung von Rantzau 1871. Gr. S. Gl. IV. 1, 244.)
Gelegentlich kommen Exemplare dieses Typus vor, die gar nicht geschliffen sind, dann meist von besonderer Stärke, so
Beckerwitz bei Wismar. Prachtstück. Bahnende schmal, fast Typus D. sich nähernd. Länge 24, Breite 4 und 7, größte Dicke 4 (!) cm (11 von unten). Erworben 1894. Gr. S. Gl. IV. 1, 400.)
Rostock. Länge 23, Breite 3 1/2 und 6, größte Dicke (in der Mitte) 4 cm; grau durchscheinend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 186.)
Dreveskirchen bei Wismar. Länge 15, Breite 3 1/2 und 5, größte Dicke 3 1/2 (!) cm; gelbbraun, innen grau. Geschenk des Herrn Mann 1887. (V.=S. 4539.)
Alt=Steinhorst. Länge 10, Breite 3 und 5, größte Dicke 2 cm; gelbbraun. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 300.)


|
Seite 29 |




|
Auf diese Grundform gehen nun einige "Hohlkeile" zurück d. h. Instrumente mit konkaver Schneide, welche zum Schaben Glätten u. s. w. dienen. Vgl. Müller 52. Montelius 27 Mestorf 38.
Lübseerhagen bei Rehna. Das obere Ende fehlt, untere Breite 6, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 261.)
Benz bei Wismar. Das obere Ende fehlt, untere Breite 5 1/2, Dicke 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Wachtmeister Cordes in Wismar 1888.(Gr. S. Gl. IV. 1, 340.)
Remlin bei Gnoien. Länge 9 1/2, Breite 1 1/2 und 4, Durchmesser 2 cm; gelbbraun, innen grau. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 24.)
Beile von vierseitigem Durchschnitt mit gewölbten Seitenflächen; die Schmalseiten sind auch geschliffen. Das obere Ende spitzt sich meist zu und die Schneide zeigt oft eine Abnutzung nach einer Seite und ist deshalb oft nachgeschliffen. Die größte Dicke liegt auch hier meist B von der Schneide. Es sind die elegantesten Exemplare. Sie unterscheiden sich von den eben besprochenen, mit denen sie durch zahlreiche Uebergangsformen verbunden sind, besonders dadurch, daß sie weniger dick sind und das hintere Ende sich zuspitzt, also das Bahnende eine scharfe Linie bildet (die dünn=nackigen Beile S. Müllers.) Dies sowie die größere Glätte weist auf einen andern Gebrauch wie den der Keile (C z. B.). Ich glaube, daß diese Exemplare meist als Schneideinstrumente gedient und zum Theil mit dem spitzen Ende in einen Schaft eingeklemmt sind, zum Theil überhaupt keine Schäftung besessen haben. Als Gegenstände häuslichen Gebrauchs wurden sie eben sorgsamer gearbeitet als die andern. Vgl. Evans a. a. O., 53, 58, 61, 63.
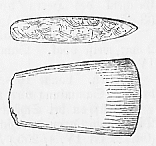
Montelius 19-22. Mestorf a. a. O. 36. Es scheint, daß diese Form in England besonders häufig ist und sich dort direct aus Typus A entwickelt hat, während B wesentlich seltener und unsere Hauptform C so gut wie gar nicht vertreten ist. Auffallend oft sind Keile dieser Form nachgeschliffen, und oft deutlich erkennbar, wie das jetzige Stück nur noch ein kleiner Rest des ursprünglichen ist.


|
Seite 30 |




|
D I. (Mit stärkerer Verjüngung). Montelius 20. Müller 54, 55. Mestorf 19, 20.
Klütz. Prachtstück. Länge 25 1/2, Breite 5 und 7 1/2 Dicke 1 1/4(!) cm; opak weiß. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1. 183.)
Lalchow. Sehr schönes Exemplar, weiß, ganz geschliffen, nur am Bahnende zugehauen. Länge 23, Breite 4 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, (1/3 von oben); gefunden zusammen mit einem ähnlichen im Moor. Erworben 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 327.)
Börgerende bei Doberan. Länge 22, Breite 4 3/4 und 7, Durchmesser 2 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4707)
Ahrenshoop bei Wustrow. Auf pommerschern Gebiet unmittelbar an der meklenburgischen Grenze, Acker nahe dem Bodden. Sehr schönes Exemplar von brauner Farbe mit Streifen; fast ganz geschliffen. Länge 21 1/2, Breite oben 4, unten 7 1/2, größte Dicke (10 1/2 cm von unten) 3 cm. Geschenk der Herren Lichenheim und Pincus in Ribnitz 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 395.)
Granzow bei Gnoien. Schönes Stück. Länge 21, Breite 4 und 8, Dicke 2 1/2 cm; gelbbraun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 184.)
Brandenhusen auf der Insel Poel. Länge 19 1/2, Breite 5 und 7, Dicke 3 cm; weiß inkrustirt. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1884. (V.=S. 4659. )
Wismar. Länge 18, Breite 3 und 7, Dicke 2 cm; weiß opak. Geschenk des Herrn Mann 1882. (V.=S. 4637.)
Dambeck bei Röbel. Dunkelgelbbraun, überall geschliffen. Länge 18, Breite oben 4 1/2 und 6 1/2, größte Dicke 4 1/2 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 361.)
Güstrow. 2 Exemplare. Länge 16 1/2 (11), Breite 5 (3) und 7 1/2 (4 1/2), Dicke 2 (3/4) cm; gelbbraun (grau durchscheinend). Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4650 und 4651.)
Zehmen bei Rehna. Länge 16 Breite 5 und 7, Dicke 2 cm; weiß opak. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 254.)
Klütz. Länge 16 1/2, Breite 5 und 7, Dicke 2 1/4 cm; dunkelbraun. Sammlung von Rantzau. (Gr. S. Gl. IV 1, 198.)
Blüssen bei Schönberg. Länge 15, Breite 4 1/2 und 6 1/2, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 255.)


|
Seite 31 |




|
Bülow bei Rehna; in einem Moor, "Langerieh" nordwestlich vom Orte. Grauweiß mit schwarzen Stellen. Ausgezeichnetes typisches Exemplar; oben spitz, eine Seite ganz flach Ansatz zur Wölbung. Länge 15, Breite oben 2 1/2, unten 5 1/2. größte Dicke (8 1/2 von unten) 2 cm. Geschenk des Erbpächter Klatt in Bülow, 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 410;) In den nicht weit entfernten Mooren auf Bülower und Rehnaer Gebiet sind schon früher ähnliche Funde gemacht (vergl. Jahrb. 11 B, S. 21, 38, Q 1, 3); in diesem Moore sind schon andere Feuersteingeräthe ferner Pfähle, Thierknochen, Haselnüsse und ein "Topf" gefunden Anzeichen, daß hier ein Pfahlbau gewesen ist.
Beckerwitz bei Wismar. Rundliches Exemplar, Schneide ungleich abgenutzt. Länge 14, Breite oben 5 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn K. Mann 1892. (Gr. S. Gl. IV. 1, 370.)
Heidekaten bei Wismar. Länge 13, Breite 4 und 7, Dicke 1 cm; opak weiß. Geschenk des Herrn Rittmeisters von Weltzien in Schwerin 1882. (V.=S. 4713.)
Gressow bei Grevesmühlen. Länge 13, Breite 4 1/2 und 7, Dicke 1/2 cm; weiß=gelb opak. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 346.)
Wismar. Länge 12 1/2, Breite 5 und 7, Dicke (fast ganz am Ende, da die Schneide nachgeschliffen) 1 3/4 cm; braungelb. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 199.)
Tessenow bei Parchim. Länge 12 1/2, Breite 4 1/2 und 6, D 2 cm; durchscheinend grau. Sammlung von Voß 1882.
(Gr. S. Gl. IV. 1, 274.)
Kölpin. Weiß, Schmalseiten etwas geschliffen, Breitseiten ganz geschliffen. Länge 12 1/2, Breite oben 3 1/2 und 7, größte Dicke (5 von unten) 2 cm. Sammlung Peitzner (Gr. S. Gl. IV. 1, 386.)
Warin. Länge 12, Breite 4 und 6, Dicke 1 1/2 cm; gelbbraune Oberfläche, innen blaugrau. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 347.)
Menzendorf bei Schönberg. Länge 12, Breite 4 und 6 1/2, Dicke 1 1/4 cm; opak graubraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 258.)
Alt=Karin bei Neubukow. Länge 11, Breite 3 und 5, 1 1/4 cm; weiß opak. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 333.)
Daschow bei Plau. Länge 11, Breite 2 1/2 und 5, Dicke 1 1/2 cm; opak grau mit braun gesprenkelt. Geschenk des Herrn Pastor Voß in Neustadt 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 290.)


|
Seite 32 |




|
Käselow bei Gadebusch. Länge 11, Breite 2 und 4 1/2, Dicke 1 1/2 cm; weiß glänzend. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 224.)
Lübz, in einem Moor. Länge 10 1/2, Breite 3 und 5, Dicke 1 1/2 cm; weiß glänzend. Geschenk des Herrn Siegmund in Kritzow 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 297.)
Wismar; an der Haffburg. Gelbgrau, rundlich, ganz geschliffen. Länge 10 1/2, Breite 3 1/2 und 5 1/2, größte Dicke (5 von oben) 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 374.)
Laage. Dunkelgrauer Feuerstein; rundlich, ganz geschliffen. Länge 10, Breite 3 und 5, gerader Durchmesser (2/3 von oben) 1 1/2 cm. Geschenkt von Herrn H. Getzmann in Laage 1893. (Gr. S. Gl. IV. 1, 373.)
Quaal bei Grevesmühlen. Länge 9, Breite 2 und 3 1/2, größte Dicke 1 cm; gelbbraun innen grau. Geschenk des Herrn Förster Mecklenburg in Spornitz 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 289.)
Malchin, an der Bahnstrecke Richtung nach Teterow. Gelbbraun, fast ganz geschliffen; Typus der Hohlkeile, aber die Schneide ist noch nicht gewölbt. Länge 9, Breite 2 und 4 3/4, größte Dicke (4 von unten) 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Pastor Walter in Malchin 1897. (Gr. S. Gl. IV. 1, 418.)
Dambeck bei Röbel. Klein, zierlich, hellgelbbraun und weiß, ganz geschliffen. Länge 8 1/2, Breite 2 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 3/4cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 362
Malkwitz bei Malchow. Länge 8, Breite 3 und 4 1/2, größte Dicke 1 cm; grau glänzend, das hintere Ende zeigt Abnutzung wie von Schlägen, und das Stück scheint als kleiner Keil gedient zu haben. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 322.)
Bei Lübz in der Elde. Sehr zierlich. Länge 8, Breite 1 und 2, Dicke 1 cm; durchscheinend grau. Geschenk des Herrn Dr. Krüger in Kalkhorst 1884. (V.=S. 4725.)
Ave bei Waren. Länge 7, Breite 2 1/2 und 4, Dicke 1 cm; weißlich gelb. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. IV. 1, 323.)
Dambeck bei Röbel. Weiß. Länge 6 1/2, Breite 1 1/4 und 3 1/4, großer Dicke 1 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 363.)
Peckatel bei Schwerin. Der obere Theil fehlt; untere Breite 5, Dicke 1 cm. Geschenk des Herrn Lehrer Rambow in Peckatel 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 352.)


|
Seite 33 |




|
Zehmen bei Rehna. Nur das Bahnende. Breite 1 3/4cm; gelbbraun. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 266.)
Alt=Karin bei Neubukow. Das Bahnende abgebrochen. Untere Breite 5 1/2, Dicke 2 cm; grau durchscheinend. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IV. 1, 310.)
Klein=Laasch bei Grabow. Gefunden in der Elde. Grauweiß, stark beschädigt; nur der untere Theil erhalten. Länge noch 8, Breite unten 6 1/2, größte Dicke 2 cm. (Gr. S., eingeliefert 1897. Gl. IV. 1, 417.)
Rosenhagen a. d. Ostsee. Weißgrau, ganz geschliffen; erhalten nur die Schneide. Breite der Schneide 1, größte Dicke 1 1/2 cm Sammlung Peitzner. (Gr. S. Gl. IV. 1, :385.)
Pogreß. Weißgrau. Nur die Schneide. Breite 5 cm. Sammlung Peitzner (Gr. S. Gl. IV. I, 379.)
Gelegentlich finden sich auch ungeschliffene Exemplare unserer Grundform, meist schön und groß und an der Schneide sorgsam zugeschlagen, sodaß an ihrer praktischen Verwendung kein Zweifel sein kann.
Krusenhagen bei Wismar, in den Tannen, wo ebenfalls ein ungewöhnlich großer Keil aus Diorit. Länge 25, Breite 5 1/2 und 8, größte Dicke 2 cm (in 1/2 Entfernung); grau glänzend. Geschenk des Herrn Revierjägers von Leitner 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 287.)
Dämelow bei Brüel. Länge 20, Breite 5 und 6 1/2, Dicke 3 cm; grau glänzend. Geschenk des Herrn von Storch 1889 (Gr. S. Gl IV. 1, 344.)
D II. Auch hier ist die Form, wo die Schneide ungefähr ebenso breit ist wie das Bahnende, seltener. Montelius 21, 22, Müller 56, Mestorf 36. Merkbuch I 6.
Konow bei Rostock. Länge 18, Breite 2 1/2 und 6 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm, gelbbraun. Geschenk des Herrn Röper in Ronow 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 286.)
Remlin bei Gnoien. Länge 17 1/2, Breite 4 und 7, größte Dicke 1 1/2 cm, braun. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 189.)
Parber bei Rehna, am Hellberg. Länge 16 1/2, Breite 5 und 6 1/2 größte Dicke 2 1/2 cm; Schneide nachgeschliffen. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 256.)
Schwieffel bei Güstrow. Länge 16 1/2 Breite 6 und 7, größte 2 cm. Samml. von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 195.)


|
Seite 34 |




|
Beckerwitz bei Wismar; ganz geschliffen, die Breitseiten stark gewölbt. Länge 15, Breite oben 5 und 6 1/2, größte Dicke (7 von unten) 2 cm, gelbbraun; erworben durch Herrn Dr. Crull 1894. (Gr. S. Gl. IV. 1, 401.)
Wismar. Länge 13 1/2, Breite 5 und 6 1/2 größte Dicke 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl IV. 1, 197.)
Wustrow bei Neubukow. Länge 11, 3/4, Breite 3 1/2 und 4 1/2, größte Dicke 1 1/2 cm. Erworben 1885; angeblich in einem Hünengrabe gefunden. (Gr. 5. Gl. IV. 1, 316.)
Hohlkeile auf Typus D zurückgehend. Montelius 28, Müller 58, Mestorf 38.
Dummerstorf bei Rostock; rundliche Breitseiten, auch das Bahnende gerundet. Länge 10, Breite oben 2 und 4, größte Dicke (5 von unten) 1 1/2 cm hellgelbbraun. Sammlung von Preen 1893. (Gr.S. Gl. 1V. 1, 397.) S. Abbildung.

Dummerstorf bei Rostock.; Bahnende fast spitz, nur schwach konkav. Länge 11, Breite oben 1 und 5 1/2, Dicke (ziemlich gleichmäßig) 2 cm, gelbbraun. Sammlung von Preen auf Dummerstorf. (Gr. S. Gl. IV., 1, 336.)
Gr.=Krankow bei Wismar. Länge 17, Breite 5 und 6 1/2, größte Dicke 2 1/4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr.S: IV. 1,190.)
Die Vertheilung der besprochenen Typen auf die Gesammtfunde ist keine gleichmäßige, sondern, wie schon Lisch bei Gelegenheit des Hünengrabs von Mestlin, Jahrb. 27, S. 167, bemerkte, überwiegend in den Hünengräbern die schmaleren Formen, also unsere Typen B und die Uebergangsform zu C. Ein Keil mit scharfen Ecken (Typus A) ist, abgesehen von dem zweifelhaften Funde von Robrow in Hünengräbern nicht gefunden. Typus B 1 erscheint in Godern (allein), Harkensee (allein), Hoikendorf (mit mehreren gleichen, die verloren sind), Mestlin, Roggow (mit einem spanförmigen Messer), Alt=Sammit (2 Exemplare ist dem berühmten Grabe), Zickhufen (mit gleichen).
Typus B 2 bei: Dobbin (ganz geschliffen) Finkenthal (mit zwei andern), Klink (mit Urnen), Mestlin (siehe oben) Pisede, Alt=Sammit (4 Exemplare), Viecheln (mit einer Bernsteinperle), Hohen Wieschendorf (mit mehreren anderen), Wittenburg.


|
Seite 35 |




|
Auch der Uebergangstypus zu C erscheint häufig und in besonders schönen Stücken, oft ganz geschliffenen und mit konkaver Schneide; so in den Hünengräbern von: Gnoien, Gremmelin, Kuppentin, Mestlin, Alt=Pokrent, Prieschendorf (an verschiedenen Stellen des berühmten Hünengrabes), Alt=Sammit Steinhagen (mit Urne und Schmalmeißel), Tatschow (3 besonders schöne Hohlbeile, ein einfacheres), Bietlübbe (Hohlkeil).
Die entwickelte Form des starken "Arbeitskeils" (C) tritt auf bei: Klink, Lübow (2 Exemplare), Maßlow, Mestlin, Moidentin, Pisede, Prieschendorf, Ruthenbeck, Hohen= Wieschendorf, Zickhusen (2 Exemplare).
Am seltensten erscheint Typus D, nämlich nur bei: Finkenthal (2 Exemplare), Gremmelin, Klink, Kronskamp, Laage, Prieschendorf, Schlutow, und dieses Verhältniß stellt sich noch ungünstiger, wenn man berücksichtigt, daß das Exemplar von Klink von einer Kleinheit ist, welche den praktischen Gebrauch ausschließt und keines der andern Exemplare bei einer systematischen Ausgrabung gewonnen ist, sondern alle als aus zerstörten Hünengräbern stammend eingeliefert sind, sodaß ihre Zugehörigkeit zu einer Grabausstattung nicht ganz zweifellos ist. Auf die verschiedenen Formen der Hünengräber (Hünenbetten, viereckige und ovale Steinkisten u. s. w.) vertheilen sich diese Typen ziemlich gleichmäßig und lassen keine Schlüsse über deren relative Zeitstellung zu.
In den Moorfunden stellt sich das Verhältniß folgendermaßen: die Form A kommt hier vor, so bei Langensee, Redentin, Scharstorf; die Form B überwiegt in den Moorfunden, die man nach der Schönheit der Exemplare als Votivgaben oder dgl. auffassen kann (Dalliendorf, Seehof, Bitense), C und D in den Pfahlbauten; so hat der Pfahlbau von Wismar alle Typen außer A.
2. Keile aus anderen Gesteinsarten.
Weniger häufig als die Feuersteinkeile sind ähnlich geformte Geräthe aus Diorit, Gneis, Kieselschiefer und ähnlichem Gestein. Da eine scharfe Schneide bei diesen Gesteinsarten nicht herzustellen ist, sind sie nicht so vielseitig zu gebrauchen, wie die aus Feuerstein; sie werden überwiegend zum Keilen, Stemmen und Schlagen benutzt worden sein. Ueber ihre Schästung ergiebt sich aus der Form wenig; gelegentlich ist der Theil am Bahnende etwas verschmälert, um das Einklemmen zu erleichtern (vergl. Müller 70 an einem Feuersteinkeil); so an je einem Stück des Wismarschen


|
Seite 36 |




|
Pfahlbaues und von Rehna. Einmal finden sich ganz flache Gruben an den Schmalseiten, wodurch das Stück den Aexten nahe kommt.
Unsere Klassifikation schließt sich der der Feuersteinkeile an, doch bedingt das Material einige wesentliche Unterschiede. An Stelle der Formen mit scharfen Seitenkanten treten hier die mit allseitig rundlicher Fläche (A) und zwar ist das Bahnende entweder spitz (A 1) oder die beiden Enden (Bahnende und Schneide) ungefähr gleichbreit (A 2). Vergl. z. B. Merkbuch 1, 10 und 11. In Mittel= und Süddeutschland sind diese Geräthe ungleich häufiger. Von der ersteren Form besitzen wir 7 (4 Einzelfunde, 2 aus dem Pfahlbau von Wismar), von der zweiten 6 Exemplare (eins von der Feuersteinmanufaktur von Eldenburg). Formen, die dem schmalen Typus der Feuersteinkeile entsprechen, giebt es begreiflicherweise nicht. Die häufigsten sind die mit breiteren Seitenflächen; gewöhnlich sind letztere gerade,häufiger auch vertieft. Diese dem Typus C der Feuersteinkeile entsprechende Form nennen wir B und scheiden auch da zwischen denen, wo die größte Dicke dem Bahnende (B a) und wo sie der Schneide nähe liegt (B b). Je nachdem der Durchschnitt dem Dreieck, dem Trapez oder Rechteck nahe kommt, bezeichnen wir diese Type mit I, II, III. Die erstere Erscheinung (spitz zugehendes Bahnende) kam bei den Feuersteinkeilen nicht vor.
Ba I. 1 ) Tempzin bei Brüel. Interessant dadurch; das an den Schmalseiten kleine Vertiefungen sind, die wohl das Einklemmen in den Schaft erleichtern sollten. Länge 14, Breite 2 und 6, größte Dicke (9 1/2 von unten) 2 1/4 cm Geschenk de verstorbenen Herrn Pächter Sturm in Tempzin 1878. (V.=S. 4497.)
Ruchow bei Sternberg. Uebergang vom Typus A 1. Länge 12, Breite 2 und 4, aber rasch zunehmend, größte Dicke (9 von unten) 2 1/4 cm. Geschenk des Herrn Lembke in Wismar 1883. (V.=S. 4663.)
Ba II. Vergl. Montelius 26. Schwerin. Am Kalkwerder, wo schon oft Feuersteinmesser u. dergl. (. gefunden sind und sicherlich eine steinzeitliche Ansiedlung bestanden hat. Stark verwittert. Länge 21, Breite 4 und 7 1/2., größte Dicke (14 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn G. Stargard in Schwerin 1884. (Gr. S. St. 5.)
Käselow bei Grevesmühlen. Schneide zerbrochen; rundliches stumpfes Bahnende. Länge 14, Breite 3 1/2 und 5 1/2, größte


|
Seite 37 |




|
Dicke (9 von unten) 3 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 249.)
Von dieser Form noch 4 Exemplare (3 Einzelfunde, eins aus dem Moorfunde von Mühlenrosin).
B a III. Klink bei Waren. Von einer Stelle mit vielen Messern u. s. w. (Feuersteinmanufaktur), Sandstein. Derb, nur roh zugeschlagen. Länge 16, Breite 5 und 6, größte Dicke (10 von unten) 5 cm. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. St. 6a.)
Redentin. Dorfmoor (Pfahlbau); sehr stark; Länge 11 Breite 3 und 4, größte Dicke (8 von unten) 3 cm. Geschenk des Herrn von Leitner 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 292.)
Fo. u. (bei Ludwigslust.) Kiefelschiefer. Länge 8, Breite 3 größte Dicke (5 von unten) 1 1/2 cm Geschenk des verstorbenen Herrn Kniestädt 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 295).
Ungleich häufiger sind die Keile, deren größte Breite der Schneide nahe liegt. Hierher gehören die größten und schönsten Exemplare.
B b I. KogeI bei Lübz (?); am Seeufer. Schneide ausgebrochen. Länge 13, Breite 6 1/2, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 248. Diese Form ist selten; wir besitzen nur noch 2 Exemplare
B b II vergl. Müller 21.
Waren; in der Stadt, 2 m tief. Das Bahnende bildet ein längliches Rechteck; die Seitenflächen etwas nach innen gewölbt. Länge 23, Breite 4 1/2 und 7 1/2, größte Dicke (11 von unten) 3 cm.
Rehna. Im Acker nahe dem Kuhmoor, wo schon früher öfter Altsachen gefunden sind. Seltenes Stück. Das Bahnende ist ganz gerade, rechteckig und offenbar beim Arbeiten benutzt; der obere Theil verschmälert sich nach allen Seiten ein wenig zum besseren Einklemmen in einen Schaft, ähnlich wie bei einem Exemplar des Wismarschen Pfahlbaues (vergl. Müller 70). Länge 12, Breite 3 und 5 1/2, Dicke oben 2 1/2, größte (5 1/2 von unten) 3 cm. Geschenk des Herrn E. Körner in Rehna 1895. (Gr. S. Gl. IV. 1, 413.)

Außerdem 8 (6 Einzelfunde, ein Stück aus dem Hünengrabe von Mestlin, eins aus der Feuersteinmanufaktur von Tressow


|
Seite 38 |




|
B b III. Triwalk bei Wismar. Gneis. Rechteckiges, etwas schräges Bahnende. Länge 27, Breite 5 und 6, größte Dicke (13 von unten) 5 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1891. (Gr. S. Gl. IV. 1, 375.)
Wismar; beim alten Zowden gefunden. Uebergang zum Typus C. Oberfläche stark verwittert. - Bahnende gerundet, scharfkantig. Länge 25, Breite 6 und 9, größte Dicke (11 von unten) 4 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1889. (Gr. S. Gl. IV. 1, 354.)
Clueßer Mühle bei Wismar. Bahnende gerundet, aber platt. Länge 21, Breite 6 und 8 1/2, größte Dicke (10 von unten) 3 3/4cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl.IV. 1, 246.)
Krusenhagen bei Wismar. Gefunden in den Tannen etwa 1/2 m tief zusammen mit einem Feuersteinkeil. Ubergang zu B b II. Prachtstück. Bahnende ziemlich scharfkantig; Schmalseiten etwas nach innen gewölbt. Länge 26, Breite 6 1/2 und 9, größte Dicke (11 von unten) 4 cm. Geschenk des Herrn von Leitner, damals Revierjäger in Spornitz 1883. (Gr. S. Gl. IV. 1, 291.)
Sonderbar, daß diese größten Exemplare der Sammlung alle der Gegend von Wismar entstammen. Wir haben außerdem nur ein Stück (Einzelfund) von Waren.
Es kommt als weitere Grundform ein Typus C, der dem Typus D der Feuersteinkeile entspricht, charkterisirt durch gewölbte Breitseiten, kleine Schmalseiten und scharfkantiges Bahnende; überwiegend kleinere Exemplare. Die Lage der größten Dicke ist hier unwesentlich, doch giebt das verschiedene Verhältniß von oberer und unter Breite auch hier 2 Formen (I. II.); spitze Bahnenden kommen nicht vor. Im ganzen ist diese Form selten.
C I. Schwerin. In dem Acker hinter Alexandrinenhöhe (Ostorfer Hals). Stark verwittert. Länge 13, Breite 4 und 7, größte Dicke (8 von unten) 1 1/2 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Putzky auf Alexandrinenhöhe 1884. (V.=S. 4676.):
Gnewitz bei Tessin. Stark gewölbt, besonders an dem untern Theile. Länge 13, Breite 5 und 7, größte Dicke (4 1/2 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn von der Lühe auf Gnewitz 1878. (V.= S. 4561.)
Weitendorf bei Wismar. Länge 10, Breite oben 5 1/2, größte Dicke (6 von unten) 1 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 1, 250.)


|
Seite 39 |




|
Von dieser Art ein Einzelfund und ein Stück aus dem Pfahlbau von Wismar.
C II. Blüssen bei Schönberg. Uebergang von Ba I. Länge 16, Breite 6 und 8, größte Dicke (9 von unten) 3 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 1, 253.)
Fo. u. Typisches Stück. Aphanitdiabas (?); an der Schneide ausgebrochen. Länge 12 1/2, Breite 5 1/2 und 6 1/2, größte Dicke (in der Mitte) 1 cm. Erworben 1887. (Gr. S. Gl. IV. 1, 3321
Neuburg bei Wismar. Uebergang von B b II: Schmalseiten leicht eingebogen. Länge 14 1/2, Breite 5 und 10, größte Dicke (7 von unten) 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Drost von Oertzen in Wismar 1887. (V.=S. 4721.)
Hiervon noch mehrere Exemplare.
Aus dem Verzeichniß geht hervor, daß diese Keile in Hünengräbern nur ganz vereinzelt (nur Mestlin) auftreten.
Singuläre Formen sind ein Stück von Doberan (V.=S. 4419), welches in Form eines Dreiecks spitz zugeht, während die breite Seite platt ist und eins von Rogahn (Moorfund V.=S. 2467); ein Dioritkeil vom Typus A, der an Stelle der Schneide zwei in einer Kante stumpfwinklig zusammenstoßende Flächen hat.
Den Keilen an Arbeit sehr ähnlich und auch zeitlich gleichstehend ist ein meißelförmiges Geräth, vierseitig, gewöhnlich mit geringem Breitenunterschiede zwischen Breit=und Schmalseite. Die breitere Seite ist gewöhnlich die schneidende; der Formenunterschied ist nicht groß, meist verbreitert sich der Meißel in der Mitte etwas. Je nachdem die Schlagfläche breiter, gleich breit oder schmäler ist als die schneidende Fläche, scheiden wir drei Typen A, B, C. Ungeschliffene Exemplare sind selten; häufiger ist es, daß nur die Schneide angeschliffen ist, oder daß nur die Breitseiten geschliffen sind; gewöhnlich das ganze Geräth geschliffen. Hohlmeißel wie Müller 133 kommen bei uns nicht vor.
A. Obere (Schlag)Fläche breiter als Schneide. Müller 131, Montelius 30.
Alt=Steinhorst. Leider zerbrochen, erhalten der untere Theil. Länge noch 9 1/2, Breite 2 1/2 und 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1885. (Gr. S. Gl. IV. 2, 52.)
Das stärkste Exemplar ist älter. Wismar. Oben der natürliche Stein, Schneide spitz und scharf, Länge 17 1/2, Breite


|
Seite 40 |




|
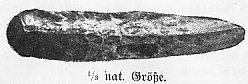
oben 3, unten 2, größte Dicke (8 von unten) 2 1/2 cm. Erworben 1854. (V.=S. 2967.)
Hinter=Bollhagen bei Doberan. Zerbrochen; erhalten der untere Theil. Länge noch 8, Breite 2 und 1 1/4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 2, 43.)
B. Oben und unten ziemlich gleich breit. Montelius 29, 30, Müller 123-126, Mestorf 41, 42.
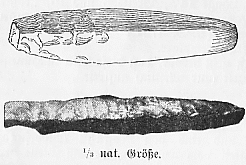
Maßlow bei Wismar. Aus einem Hünengrabe. Ganz ungeschliffen. Länge 10. Breite 2, größte Dicke (10 von unten) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 2, 41.)
Lübseerhagen bei Rehna. Ganz geschliffen. Länge 14, Breite 2, größte Dicke (8 von unten) 2 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 2, 38.)
Schwerin. Am Küchengarten, wo vielfach Messer und dergl. gefunden worden, die auf eine Ansiedelung weisen. Nur der untere Theil geschliffen. Länge 14, Breite 2, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Geschenk des Herrn G. Stargard - in Schwerin 1884. (Gr. S. Gl. IV. 2, 51.)
Alt=Sammit bei Krakow. Aus einem Hünengrabe (III.); sehr zierlich, ganz geschliffen. Länge 11 1/2, Breite 1 1/4, größte Dicke (7 von unten) 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Fabrikant Lorenz in Krakow 1886. (Gr. S. St. 2b.)
Umgegend von Crivitz. Ganz geschliffen. Länge 11 1/2, Breite 1 1/4, größte Dicke (6 von unten) 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Förster Mecklenburg in Spornitz 1883. (Gr. S. Gl. IV. 2, 50.)
Umgegend von Rehna. Sehr zierlich, fast ganz geschliffen. Länge 9, Breite 1 1/4, größte Dicke (5 von unten) 1 1/4 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 2, 40.)


|
Seite 41 |




|
Umgegend von Rehna. An den Seiten der unbearbeitete Stein. Länge 8, Breite 1 1/4, größte Dicke (5 von unten) 1 1/2 cm Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. IV. 2, 39.)
Ivendorf bei Doberan. An der Schneide verletzt, die Seitenflächen nicht geschliffen. Länge 7 1/2, Breite 1 1/4, größte Dicke (4 von unten) 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Oberst von Weltzien in Schwerin 1886. (V.=S. 4718.)
Dazu noch unvollständige Exemplare von Rostock, aus der Feuersteinmanufaktur von Tressow und zwei unbekannten Fundorts (Sammlung von Rantzau. Gl. IV. 2, 44-47) und zwei von Alt=Steinhorst (Graf A. Bernstorff 1884. Gl. IV 2, 53. 54.)
C. Die Schneide breiter als der obere Theil.
Köchelstorf bei Wismar, starkes gerundetes Exemplar. Länge 12, Breite oben 1, unten 2, größte Dicke (6 von unten) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr.S. Gl.IV. 2,42.)
Hof Redentin bei Wismar.
Aus einem Moore, in dem ein Pfahlbau vermuthet wird. Ungewöhnlich breit, fast einem Keile ähnelnd. Nicht ganz geschliffen. Länge 12, Breite oben 2, unten 3, größte Dicke (6 von unten) 1 3/4 cm. Geschenk des Herrn Karl Mann 1889. (Gr. S. Gl. IV. 2, 57.)
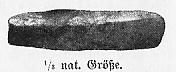
Fo. u. Ganz ungeschliffen, leider fehlt die Schneide Länge noch 9, Breite oben 1, unten 2, größte Dicke (4 von unten) 2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. IV. 2, 48.)
Außerdem besitzt die Sammlung:
Typus A. Ungeschliffen; 1 aus dem Moorfund von Großwoltersdorf. Geschliffen: 6 Einzelfunde, 1 aus einem Hünengrabe, 3 aus Moorfunden.
Typus B. Ungeschliffen: 3 Einzelfunde. Geschliffen: 27 Einzelfunde, 12 aus Hünengräbern, 13 aus Moorfunden, 3 aus Wohnplätzen.
Typus C. Ungeschliffen: 2 Einzelfunde. Geschliffen: 6 Einzelfunde, 4 aus Hünengräbern.
Die Vertheilung ist also eine ziemlich gleichmäßige.


|
Seite 42 |




|
Längliche Klingen, fein muschelig geschlagen, an den Rändern oft gezahnt. Da diese Klingen je nach der Schästung als Dolche oder Lanzen verwendbar sind, kann man nur bei denen, welche ein offenbar zum Greifen bestimmtes Schaftende haben, ihre Bestimmung sicher angeben. Oft fehlt der Griff gänzlich; wo er auftritt, ist er flach und breit, oder viereckig.
Wir ordnen demnach unser Material in 3 Gruppen:
I. Klingen ohne Schaft.
a) Die größte Breite liegt unten; meist kleinere, typologisch ältere Exemplare, die überwiegend als Lanzenspitzen gebraucht sein werden. Siehe Montelius 49, Müller 151-153, Evans 250, Mestorf 70.
b) Die größte Breite liegt in der Mitte. Diese Form ist selten. Siehe Montelius 51, Evans 273.
c) Die größte Breite liegt nach oben. Hierhin gehören die größten und best gearbeiteten Exemplare; oft ist die Klinge so dünn, daß eine praktische Anwendung kaum denkbar erscheint Siehe Müller 160. Evans 274, Mestorf 61.
An den bisher beschriebenen Exemplaren war eine Vorkehrung zur Schästung nicht erkennbar. Bei der Eintheilung der folgenden Formen legen wir die Gestaltung der Schaftendigung resp. Griffs zu Grunde. Wird durch eine leichte Einkerbung, oder Einziehung der Klinge die Befestigung in einem Schafte erleichtert, so entsteht ein Typus mit Schaftzunge, der sich dann zu den künstlicheren mit vollem Griff entwickelt hat. Wir scheiden zwischen solchen mit flachem und kantigem (vierseitigem) Schaft. Zunächst geht die Schaftzunge spitz zu und ist mit der Klinge von gleicher Dicke, dann wird der Schaft stärker, die Verjüngung nach unten hört auf. Je nachdem der Schaft allmählich in die Klinge übergeht oder schärfer ansetzt, entstehen zwei verschiedene Formen. Schließlich wird der Griff künstlich gestaltet, die Seiten gezahnt ("gekröfelt"), der Fuß verbreitert sich seitlich und es entstehen Stücke von staunenswerther Kunstfertigkeit. Selbst verständlich sind hier die Uebergänge der einzelnen Formen zahlreich und eine chronologische Scheidung auf einzelne Perioden nur im allgemeinen durchführbar, ebenso wie nur die Bestimmung des ersten Typus (mit spitzer Schaftzunge) als Lanzenspitzen der mit breitem oder künstlich gearbeitetem Griff als Dolche aus gesprochen werden kann, bei vielen der in der Mitte liegenden


|
Seite 43 |




|
ihre Bestimmung zweifelhaft sein muß. Wir kommen nach dem Gesagten zu folgender Eintheilung:
II. Klingen mit flachem Schaft (Griff).
a) Spitze Schaftzunge, gleich dick wie das Blatt. Sie Müller 162. Mestorf 68.
b) Schaft mit parallelen Rändern, meist dicker und wenig bearbeitet als das Blatt.
1. Schaft allmählich in das Blatt übergehend. Siehe Müller 161, 163. Mestorf 63, 68.
2. Schaft schärfer absetzend. Montelius 45, 48. Müller 164, 165. Mestorf 69.
c) Griff sich unten verbreiternd, gewöhnlich mit gekröselten Seiten.
1. einfachere Formen. Montelius 56. Müller 17 Mestorf 62, 65.
2. künstlichere Formen. Montelius 55, 58. Müller 168, 170. Mestorf 56-58, 61.
Die künstlichsten Formen sind diejenigen, wo der Griff mit vier Kanten gebildet wird, also ein vierseitiger, quadratische oder rhombischer Griff entsteht. Klinge und Griff sind ganz verschieden behandelt; die Klinge gewöhnlich nicht blattförmig, sondern spitz zugehend. Durch Eleganz der Form und Feinheit der Ausführung stellt diese Dolchform den Höhepunkt der steinzeitlichen Kunstthätigkeit dar. Auch hier sind Uebergangsformen zahlreich, sowohl zu den einfacheren als künstlicheren Klingen mit flachem Schaft.
III. Klingen mit vierseitigem Schaft.
1. einfachere. Siehe Montelius 57. Müller 166.
2. künstlichere. Müller 167. Mestorf 60. Kemble, horae ferales II, 29, 30.
Typus Ia. Vergl. untenstehende, schon früher publicirt Spitze von Alt=Sammit (Jahrb. 30, S. 135).



|
Seite 44 |




|
Alt=Gutendorf bei Marlow; im Moor 2 Exemplare grau durchscheinend, stark gezahnt. Länge 11 (11 1/2), größte Breite (4 [3] von unten) 3 [2 1/2] cm. (V.=S. 4027, 4028.)
Dargun. Grau durchscheinend, fein gezahnt. Länge 11 1/2 größte Breite (5 von unten) 2 1/2 cm. Eingesandt 1884. (Gr. S. Gl. III. c. 75.)
Gr.=Wüstenfelde bei Teterow. Grau; unten unregelmäßig und dick, an paläolithische Typen (St. Acheul) erinnernd. Länge 10 1/2, größte Breite (1 1/2 von unten) 4 cm. Sammlung Struck 1886.(Gr. S. L. I. F. 1a. 40.)
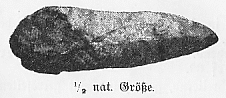
Pogreß bei Wittenburg. Weißgrau; unten dick; Spitze abgebrochen. Länge (ursprünglich) 8 1/2 cm, größte Dicke (1 von unten) 3 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. L. I. F. 1a. 53.)
Tessenow bei Parchim. Weiß; zerbrochen, nur die schön gezahnte Spitze erhalten. Länge 8 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. III. c. 68.)
Consrade bei Schwerin; im Torfmoor. Grau durchscheinend. Länge 8 1/2, größte Breite (4 von unten) 1 3/4 cm Geschenk des verstorbenen Herrn Oberförster Drepper 1877 (V.=S. 4554.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Grauweiß. Nur der untere Theil erhalten. 7 cm lang. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1889. (Gr. S. Gl. III. c. 79.)
Ludwigslust, im Küchengarten. Grauweiß durchscheinend. Klein (Pfeilspitze?). Länge 6 1/2, größte Breite (1 von unten) 2 cm. Eingereicht 1884. (Gr. S. L. I.. F. 1 a. 42.)
Typus I b. Suckow bei Güstrow. Grünlichbraun; unten noch der rohe Stein, sonst fein muschelig. Länge 12 1/2, größte Breite (Mitte) 4 cm. Geschenk des Herr Schmidt in Suckow 1890. (Gr. S. Gl. III. c. 89.) (S. Abbildung.)
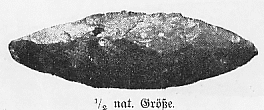
Redentin bei Wismar. Aus dem


|
Seite 45 |




|
Müllermoor, wo 1869 ein Pfahlbau entdeckt wurde (vgl. Jahrb. 38, S. 125). Schwarzgrau. Länge 10 größte Breite (Mitte) 3cm. Geschenk des Herrn Mann in Wismar 1889. (Gr. S. Gl. III. c. 87.)
Typus I c. Gegend von Klütz. Dunkelgrau durchscheine von feinster Arbeit, Griffende und Spitze fast gleich gut geschlagen.

Länge 22, größte Breite (14 von unten) 5 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. III c. 59.)
Biendorf bei Kröpelin; in einem Moor. Weißgrau; fein geschlagen. Länge 17, größte Breite (9 von unten) 3 1/2. cm. Geschenk des Herrn Landbaumeister Luckow in Rostock 1880. (V.=S. 4639.)
Dummerstorf bei Rostock, im Moor. Grauschwarz; feines Blatt. Länge 16 1/2, größte Breite (9 1/2 von unten) 4 1/2 cm Sammlung von Preen 1893. (Gr. S. Gl. III. c. 98.)
Tessenow bei Parchim. Weißgrau, etwas gebogen. Länge 16 cm, größte Breite (11 von unten) 3 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. III. c. 69.)
Klingen des besprochenen Typus I finden sich außerdem in der Schweriner Sammlung 40 Stück, und zwar:
I a: 30 Stück: 11 Einzelfunde, 11 Moorfunde, 8 Grabfunde
I b: 3 Stück: 2 Einzelfunde, 1 Moorfund;
I c: 7 Stück: 4 Einzelfunde, 3 Moorfunde.
Typus II a. Dummerstorf b. Rostock. Graublau. Grundform der des vorigen Exemplars ähnlich; Uebergangsform aus Typus I. Länge 10, größte Breite (5 von unten) 3, Länge des Griffs 4 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S. Gl. IIIc. 99.)
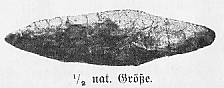


|
Seite 46 |




|
Laage. Hellgraubraun, Griff ganz flach und unten spitz zugehend wie Müller 102 (Lanzenspitze) nur etwa zur Hälfte erhalten. Länge noch 11, größte Breite (7 von unten) 4, Länge des Griffs 5 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1889. (Gr. S. Gl. IIIc. 86.)
Typus II b 1. Tessenow bei Parchim. Weißgrau, ziemlich großmuschelig, besonders am Griff. Länge 20, größte Breite
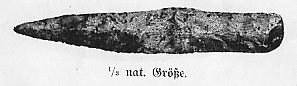
(13 von unten) 3 1/4, Länge des Griffs 7 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. IIIc. 68.)
Dummerstorf bei Rostock. Braun. Länge 16, größte Breite (10 von unten) 3, Länge des Griffs 5 1/2 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S. Gl. IIIc. 100.)
Hornstorf bei Wismar. Braun. Länge 16, größte Breite (10 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 7 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1882. (V.=S. 4661.)
Vietgest bei Güstrow. Grau durchscheinend. Länge 16, größte Breite (8 von unten) 1 1/2, Länge des Griffs 6 cm. Geschenk des Herrn Senator Beyer in Güstrow. (V.=S. 4380).
Gottmannsförde bei Schwerin. Weißlich, derb zu gehauen. Länge 11 2/1, größte Breite (6 1/2 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 5 cm. Sammlung von Rantzau. (Gr. S. Gl. IIIc. 57)
Peckatel bei Schwerin. Zwei Exemplare. Weißgrau, durchscheinend. Länge 10 (7 1/2), größte Breite (5 von unten,) 2 (3 1/2), Länge des Griffs 4 (3) cm., Geschenk des verstorbenen Herrn Rambow, Peckatel 1874. (V.=S. 4423. 4424.)
Möllenbeck bei Grabow. Weißgrau durchscheinend, der Griff unregelmäßig, etwas schief, weniger bearbeitet als die Klinge. Länge 17 1/4, größte Breite (10 von unten) 2 3/4, Länge des Griffs 6 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. Gl. IIIc. 70.)
Typus II b 2. Neubukow. Weißlich der Griff stark mit leicht erhöhtem Mittelgrate, die Klinge gezähnt; das größte Exemplar unserer Sammlung. Länge 33, größte Breite (15 von unten) 5, Länge des Griffs 10 cm. Geschenk des verstorbenen


|
Seite 47 |




|
Herrn Commerzienrath Schultz in Ludwigslust 1891. (Gr. S Gl. IIIc. 91).
Gegend von Waren. Weiß, die Klinge nur etwa zu Hälfte erhalten. Länge noch 13 1/2, größte Breite (11 von unten) 3 1/4, Länge des Griffs 7 1/2 cm. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. IIIc 84.)
Wietow bei Wismar. Grauweiß. Länge 16, größte Breite (8 1/2 von unten) 3 1/2, Länge des Griffs 6 1/2 Breite des Griffs 3 cm. Geschenk des Herrn Oberst von Weltzien (V.=S. 4598
Hohen=Sprenz bei Laage. Grau durchscheinend. Länge 14, größte Breite (6,5 von unten) 4, Länge des Griffs 4 1/2, Breite des Griffs 2 cm. Geschenk des Herrn Haackert in Hohen=Sprenz 1882. (Gr. S. Gl. IIIc. 71).
Maßlow bei Wismar. Grau durchscheinend. Länge 14 größte Breite (7 1/2 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 5 1/2 Breite des Griffs 1 1/2. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr S. Gl. IIIc. 54).
Biendorf bei Neubukow; im Moor, zusammen mit eine Klinge vom Typus Ia, grauweiß durchscheinend. Länge 13 größte Breite (7 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 7, Breite des Griffs oben 2, unten 1 1/4 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Landbaumeister Luckow in Rostock 1880 (V.=S. 4640).
Mühlen=Rosin bei Güstrow; in dem Torfmoor der (Erlenmühle am Inselsee, mehrere Fuß tief, zusammen mit zahlreichen anderen Steinsachen. Hellgrau; Griff abgebrochen. Länge 11 größte Breite (4 von unten) 3 1/2 cm. Geschenk des Herrn Senator Beyer in Güstrow (V.=S. 4358.)
Consrade bei Schwerin im Torfmoor, 1 1/2 bis 1 4/5 m tief. Bläulich grau; sehr dünn. Erhalten nur die Spitze. Länge 9 1/2, Breite 5 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Oberförster Drepper. (V.= S. 4555).
Kritzow bei Wismar. Gelbbraun (außen). Nur derb zugehauen, unregelmäßig gezahnt. Länge 12 1/2, größte Breite (8 von unten) 2 1/2, Länge der Klinge 5 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar (V.=S. 4667).
Garvensdorf bei Neubukow. Braun. Länge 12, größte Breite 7 (von unten) 2 3/4, Länge des Griffs 5, Breite des Griffs 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Dahlstein in Wismar. (V.=S. 4339.)
Zidderich bei Goldberg. Schwarzgrau; Klinge gezähnt. Erhalten nur Klinge und Griffansatz; Länge noch 9, größte Breite 2 1/4 cm. Geschenkt von Herrn Cords in Below 1875. (V.=S. 4490.)


|
Seite 48 |




|
Zehlendorf bei Güstrow. Schwarzgrau. Nur der Griff 5 cm lang. Geschenk des Herrn Lehrer Krüger in Zehlendorf 1890. (Gr. S. Gl. IIIc. 90.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Weißgrau. 2 Griffe, 5 und 4 cm lang. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. Gl. IIIc. 76. 78.)
Desgleichen eine gelbbraune Spitze von 9 cm Länge (= den vorigen Gl. IV c. 80.)
Zarnewanz bei Tessin. Weißgrau. Klinge von 9 cm Länge und 4 cm Breite. Geschenk des Herrn von der Lühe auf Gnewitz 1878. (V.= S. 4577.)
Neu=Käterhagen bei Neukloster. Schwarzgrau durchscheinend. Griff mit Mittelrippe. Länge 11, größte Breite (7 von oben) 2 1/4, Länge des Griffs 4 1/2 cm. Sammlung Pastor Voß 1874. (V.=S. 4448.)
Redefin bei Hagenow. Außen gelbbraun, innen hellgrau Erhalten nur der Griff, 7 cm lang. Sammlung Peitzner 1893. (G. S. Gl. III c. 95.)
Drei=Lützow. Gelbbraun. Länge 13, größte Breite (7 von unten) 3 1/2, Länge des Griffs 5 cm. Erworben 1871. (V.=S. 4351.)
Typus II c 1. Der Uebergang von dem eben besprochenen Typus ist ganz unmerklich. Wir rechnen hierher nur solche Exemplare, bei denen auch der Griffabschluß schon absichtlicher gestaltet ist, indem er gerade abschließt oder nach den Seiten sich etwas verbreitert; im allgemeinen = Müller 171.
Lambrechtshagen bei Rostock. Weiß, Spitze abgebrochen Länge 18, größte Breite (10 von unten) 4, Länge des Griffes 7, Breite des Grifffußes 2 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. III c. 52.)
Grevesmühlen. In dem Gehölz Steinbrink unter einem großen Steine. Weißgrau durch scheinend. Ein ausnehmend

schönes Exemplar, besonders durch die feingeschlagene ungewöhnlich lange Spitze. Länge 20, größte Breite (10 von unten) 6, Länge des Griffes 7, Breite des Grifffußes 3 cm. Erworben 1896. Gr. S. Gl. IIIc. 104.)


|
Seite 49 |




|
Bartelshagen bei Teterow. Weiß, stumpf. Länge 18 größte Breite (9 1/2 von unten) 4, Länge des Griffes 6, Breite des Griffes unten 3, oben 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Pogge auf Bartelshagen. (V.=S. 4674.)
Laage. Gelbbraun glänzend, Griff leicht gewölbt. Länge 17 größte Breite (10 von unten) 3, Länge des Griffes 7, Breite des Griffes unten 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1889. (Gr. S. Gl. III c. 85.)
Lübsee bei Rehna. Gelbbraun. Länge 16, größte Breite (9 von unten) 3 1/4, Länge des Griffes 6, Breite des Griffes unten 3 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. Gl. III c. 61.)
Suckow bei Güstrow. Hellgrau mit schwarzen Streifen Länge 15 1/2, Breite (9 von unten) 3, Länge des Griffes 5 1/2 Breite des Griffes unten 3 cm. Geschenk des Herrn Schmidt in Suckow. (Gr. S. Gl. III c. 88.)
Miekenhagen bei Neubukow. Grauweiß. Länge 14 1/2 größte Breite (8 von unten) 2 1/4, Länge des Griffes 5, Breite des Griffes unten 3 cm. Sammlung von Rantzau 1871.(Gr. S. Gl. III c. 53.)
Dummerstorf bei Rostock; gefunden mit zwei ähnlichen Exemplaren an der Scheide von Potrems. Dunkelgelbbraun. Erhalten nur Griff und Klingenansatz. Länge noch 9, Länge des Griffes 6 cm. Schenkung des Herrn von Preen 1893 (Gr. S. Gl. IIIc. 101.)
Typus II c. 2. Kuhlrade bei Ribnitz. Braungelb. Sehr schönes Exemplar. Das Klingenblatt fein gemuschelt, der Griff mit leichtem Mittelgrate, unten scharf abschneidend. Länge 20,
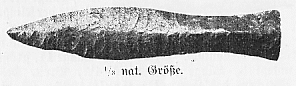
größte Breite (11 von unten) 4, Länge des Griffes 6 1/2, Breite des Griffes oben 2 3/4, unten 4 cm. Erworben 1883 (Gr S. Gl. IIIc. 73.)
Neu=Käterhagen bei Neukloster. Bläulich grau. Der Griff von feinster Arbeit mit gekröselten Seitenkanten und Fuß, auch Mittelrippe. Erhalten nur Griff und halbe Klinge. Länge noch 14, größte Breite (12 von unten) 5, Länge des Griffes 8, Breite des Griffes unten 5 cm. Samml. Pastor Voß 1874. (V.=S. 4447.)


|
Seite 50 |




|
Neu=Käterhagen. Braun. Länge 18, größte Breite (11 von unten) 4, Länge des Griffes 6, Breite des Griffes unten 4 cm. Sammlung Pastor Voß 1874. (V.=S. 4446.)
Kuhlrade. Braungelb, dem eben besprochenen Stück ähnlich, aber die Klinge ist kurz und spitz, offenbar nachgearbeitet Länge 13 1/4, Breite der Klinge (6 von unten) 2, Länge das Griffes 6, Breite des Griffes unten 3 cm. Erworben 1883 (Gr. S. Gl. IIIc. 74.)
Pogreß bei Wittenburg. Rothbraun. Aehnlich den vorigen, aber der Griff ohne Mittelgrat. Länge 14, größte Breite (8 von unten) 3 1/2, Länge des Griffes 5 l/2, Breite des Griffes oben 3, unten 3 1/2 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. Gl. IIIc. 94.
Fahren bei Wismar. Grau durchscheinend. Gleich dem vorigen. Länge 14, größte Breite (8 von unten) 3, Länge des Griffes 5, Breite des Griffes oben 2 1/2, unten 3 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar 1882. (V.=S. 4658.)
Schwerin. Am Ostorfer See. Grau. Die Klinge ganz kurz, wohl durch Nacharbeitung, aber nicht spitz, sondern ganz rund. Länge 9, größte Breite (7 von unten) 3, Länge des Griffes 5 1/2, Breite des Griffes oben 2 1/2, unten 3 cm. Geschenk des Herrn Maler Körner in Schwerin 1883. (Gr. S. Gl. IIIc. 72.)
Dummerstorf bei Rostock. Bläulich weiß. Spitze einer Klinge, noch 7 cm lang. Zusammengefunden mit 2 anderen Exemplaren, Gl. IIIc. 100 und 101. (Gr. S. Gl. IIIc. 102.)
Typus III 1. Brützow bei Rehna. Grünlichgelb der Griff nur derb zugeschlagen. Länge 15 1/2, größte Breite der Klinge (9 von unten) 2 1/4, Länge der Klinge 6, Breite der Klinge 1 1/2 cm. Erworben 1895. (Gr. S. Gl. IIIc. 103.)
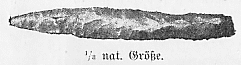
Tatow bei Neubukow. Gelbbraun. Länge 11, größte Breite (7 von unten) 3, Länge des Griffs 4 1/2. Breite des Griffs 1 1/2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1887. (V.=S. 4722.)
Käselow bei Wismar. Weißgrau. Klinge von 10 cm Länge, 2 cm Breite. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. Gl. III c. 58.)
Typus III 2. Tramm bei Crivitz. Braun. Ziemlich derb, besonders der Griff, aber alle Kanten sowohl Seiten= als Mittelkanten gekröselt. Länge 15 1/4, Breite (10 von unten) 3, Länge des Griffs 7 1/2, Breite des Griffs 2 cm. Erworben 1884. (Gr. S. Gl. IIIc. 95.)


|
Seite 51 |




|
Wismar. Mit weißer Oberfläche, wie in kalkigen Schicht gelegene Steine sie gewöhnlich haben. Länge 16, größte Breite (11 von unten) 2 1/4, Länge des Griffs 7, Breite des Griffs 2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1897. (Gr. S. Gl. IIIc. 105.)
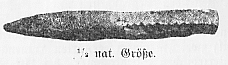
Moltow bei Warin. Grünlichbraun. Länge 21, Breite (13 von unten) 3, Länge des Griffs 9, Breite des Griffs 2 cm. Erworben 1880. (Gr. S. Gl. IIIc. 51.)
Kritzow bei Wismar Grünlichbraun. Länge 18 1/2, größte Breite (11 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 6, Breite des Griffs 2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1883. (V.=S. 4667.)
Ivendorf bei Doberan. Braun. Nur Griff; 9 cm lang. Geschenk des Herrn Oberst von Weltzien 1884. (V.=S. 4702.)
Hütten bei Doberan. In einem Torfmoor zusammen mit einem halbmondförmigen Messer und einem Hirschhorn. Gelb. Spitze abgebrochen. Länge 15, größte Breite (11 von unten) 2 1/2, Länge des Griffs 7, Breite des Griffs 1 1/4 cm. (V.=S. 4089.)
Von den Klingen der besprochenen Typen befinden sich in der Schweriner Sammlung außer den besprochenen
| Einzelfunde | Moorfunde | aus Wohnstätten | Grabfunde | ||
| Typus | II a | 6 | 2 | - | - |
| " | II b 1 | 7 | 1 | 3 | - |
| " | II b 2 | 19 | 5 | - | 2 (?) |
| " | II c 1 | 13 | 7 | - | 1 (?) |
| " | II c 2 | 6 | - | - | - |
| " | III 1 | 65 | 5 | - | - |
| " | III 2 | 17 | 11 | 1 | - |
| unbestimmbare Reste | 18 | - | - | - | |
| --------- | --------- | --------- | --------- | ||
| 92 | 31 | 4 | 3 | ||
Zu der letzten Spalte ist noch zu bemerken, daß es bei allen drei Funden sehr fraglich ist, ob es sich wirklich um Gräber handelt: das eine Stück wurde bei Malchow angeblich "in einer Urne mit Asche und Gebeinen" gefunden, eine Notiz die wenig glaubwürdig erscheint, da die Beisetzung des verbrannten Leichnams in Urnen einer wesentlich jüngeren Zeit angehört als diese Steinartefakte; das andere bei Blankenhagen (bei Ribnitz) "beim Wegräumen eines Hünengrabes" ohne nähere Angabe, welcher Art das Grab gewesen ist; das dritte 1836 bei


|
Seite 52 |




|
Kirch=Mulsow "an einem Hügel unter einem großen Steine" (Jahrb. 2 B, S. 34). Also: Gestielte Klingen sind aus sicheren steinzeitlichen Begräbnissen nicht bekannt geworden.
Ungestielte dagegen mit vollster Sicherheit: bei Gottesgaben wurde eine "neben einem menschlichen Gerippe" gefunden, bei Vilz zwei "in einem zerstörten Hünengrab" bei Resow in einer unterirdischen Steinkammer, bei Alt=Sammit in einem "Ganggrabe". S. Lisch, Jahrb. 26, bes. S. 135.
Sehr merkwürdig ist nun, daß im Gegensatz zu dem Fehlen der Dolche in Begräbnissen sie in den Moorfunden besonders häufig sind (vergl. die Tabelle) und zwar gerade die künstlichsten Formen. am meisten. Wir werden bei den sog. "halbmondförmigen Messern" sehen, daß dort ein ähnliches Verhältniß besteht. Dolche und Messer bilden das gewöhnliche Inventar der Moorfunde, fehlen dagegen in Hünengräbern fast ganz. Unser Material ist bei weitem nicht groß genug, um zwingende Schlüsse über das chronologische Verhältniß zu gestatten. Mit allem Vorbehalte nur sei daher aus dem angegebenen gefolgert: die entwickelteren Dolchformen gehören einer jüngeren Periode an als die großen Steingräber; in diese Periode fallen auch die Moorfunde, also ein ähnliches Verhältniß wie später in der Bronzezeit, wo auch die schönen Moorfunde einer jüngeren Periode angehören. In anderen Ländern finden sich Dolche in Gräbern vom Ende der Bronzezeit (vergl. das große Grab von Karleby in Schweden bei Montelius, Compte rendu du congrés de Stockholm, S. 173) der Bronzezeit selbst (z. B. Typus IIIc auf Amrum; s. Olshausen, Ztschr. f. Ethnol. 1890, Bhdlg., S. 276.)
Gelegentlich finden sich Klingen mit sägeartig ausgezahnten Seiten, die wohl auch als Lanzenspitzen gedient haben. Wir besitzen nur drei Exemplare, alle aus weißgrauem Feuerstein.
Von der Lauenburger Grenze. Schönes Exemplar von der Grundform II a. Unten leicht eingekerbt zur Befestigung an einem Schafte. Länge 19, größte Breite (8 von unten) 5, Länge des Griffes 5 cm. Aelterer Bestand, vgl. Jahrb. 38, S. 133. (V.=S. 4294.)
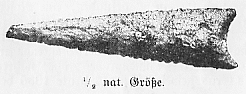
Sternberg. Lanze oder Pfeilspitze mit


|
Seite 53 |




|
halbrunder Einkerbung. Länge 11 1/4 Breite unten 3 cm. Aelterer Bestand; vgl. Jahrb. 7 B, S. 22. (V.=S. 810.) Vgl. die Abbildung.
Lübsee bei Rehna. Grundform Ia, etwa gleich Müller 154, ähnlich Montelius 68. Leider fehlt die Spitze. Länge noch 10, größte Breite 2 1/4 cm. Sammlung Splitter 1876, (Gr. S. Gl. III. c. 106.)
In Arbeit den Dolchen und halbmondförmigen Messern sich anschließend sind die Pfeilspitzen, meist kleine, überaus zierliche Geräthe, nie geschliffen, aber sorgsam gedengelt. Es lassen sich drei Formen scheiden:
A. mit rundlichem oder rhombischem Durchschnitt, gewöhnlich derber gearbeitet; der Stiel erkennbar. Merkbuch I, 31. Evans 278 ff. in zahlreichen Varianten.
B. Mit rund ausgeschnittenem Schaftende. Müller 179, Montelius 59, 61, 64, Mestorf 52, 53. Merkbuch I, 29. Schumann I, 12. Evans 329.
C. Mit kleiner seitlicher Einkerbung am Ende. Müller 178.
D. Mit rundem kleinem Schaftende und kleinem Schaftstiel. Müller 180, Montelius 60, Mestorf 52, 54, 55. Merkbuch I, 30. Evans 303 ff.
Die sog. "querschneidigen" Pfeilspitzen wie Merkbuch I, 32 (Vergl.; S. Müller, Nord. Alterthumskunde, Seite 33) sind in Meklenburg nicht beobachtet worden, werden aber auch hier wie in allen Nachbarländern vorkommen.
Von Typus A besitzen wir nur 4 Einzelfunde, dazu kommen 3 aus einem Hünengrabe (Stuer); das abgebildete Exemplar unbekannten Fundorts.

Von Typus B, dem bei weiten häufigsten, haben wir 40 ältere Einzelfunde, zwei in dem Pfahlbau von Wismar; an neueren:

Dambeck bei Röbel. Sehr fein geschlagen. Länge 4, Breite 2 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr S. LI. F 1a 51.)
Alt=Steinhorst. Gleich der vorigen; Spitze abgebrochen. Länge 3, Breite 1 1/4 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. LI, F 1a. 43.)


|
Seite 54 |




|
C. Selten, nur vier Exemplare (Einzelfunde), davon neu:
Ludwigslust. Unregelmäßig, kleine Kerbe. Länge 7 cm, größte Breite 3 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Kniestädt in Ludwigslust 1883. (Gr. S. LI, F1a. 42.)

Progreß bei Wittenburg. Derb, Spitze abgebrochen. Länge 8, größte Breite 3 cm. Sammlung Peitzner 1893. (Gr. S. L ... 53.)
Alt=Steinhorst. Aus einem prismatischen Messer. Länge 3 3/4, größte Breite 1 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1885. (Gr. S. LI, F1a. 44.)
D. Nur zwei Exemplare; neu erworben:
Helm bei Wittenburg. Länge 3, Breite 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Renard in Helm 1890. (Gr. S. St. 9.)

Eine eigenartige Erscheinung ist, daß Pfeilspitzen vom Typus B bei uns zu den häufigsten Vorkommnissen in bronzezeitlichen Gräbern gehören. Wir haben an die 30 Exemplare aus großen und reich ausgestatteten Kegelgräbern (Brunsdorf, Dabel, Friedrichsruhe, Pölitz, Slate; vergl. Jahrb. 34, S. 217 und 47, S. 276.) Wir würden den Typus demnach in die Bronzezeit versetzen müssen, wenn nicht das Vorkommen in dem Pfahlbau von Wismar und das Auftreten dieser Spitzen in dänischen Steinaltergräbern sie zeitlich sicherte. Bemerkenswerth ist immerhin, daß die einzigen Pfeilspitzen, die bei uns in Hünengräbern gefunden sind, der einfacheren, doch wohl älteren Form angehören.
Den Lanzen und Dolchen nahestehend, sowohl durch sorgsame Bearbeitung des Steines als durch die Fundverhältnisse ist ein der nordischen Steinzeit eigenthümliches Geräth, das Lisch als "halbmondförmiges Messer" bezeichnete. Der Feuerstein ist kleinmuschelig geschlagen, die Seiten leicht gezahnt, nie geschliffen. Die eine Seite (der Rücken) ist stets gleichmäßig gekrümmt, die andere (die Schneide) mehr oder weniger gebogen, oder auch gerade. Je nachdem die Biegung nach außen geht, fehlt oder nach innen geht, kann man drei Formen unterscheiden, die aber


|
Seite 55 |




|
unmerklich in einander übergehen und oft nur durch Abnutzung der Schneide entstanden sind. Die Krümmung nach außen (Form 1) ist stets nur unbedeutend. Auch der Rücken ist gewöhnlich bearbeitet, wohl um das Einklemmen in den Holzschaft zu erleichtern. Uebrigens kann man von Rücken und Schneide nur bedingt sprechen. Gelegentlich zeigen sich auch an dem Rücken Spuren der Benutzung; nach Bedürfniß wird die eine oder die andere Seite als Schneide benutzt sein. Im Gebrauch werden diese Geräthe dazu gedient haben, Einschnitte oder Einkerbungen zu machen; sie nehmen eine Mittelstellung zwischen Messer und Säge ein. S. Müller und andere bezeichnen sie auch mit letzterem Namen (z. B. Nordische Alterthumskunde S. 139). - Vergl. unsere Form 1: Montelius 72, Müller 138, Mestorf 26. Form II: Montelius 71, 73, Müller 139, Mestorf 27. Form III: Montelius 74, Müller 140, Mestorf 25.
I. Schneidefläche etwas nach außen gewölbt.
Mühlen=Rosin bei Güstrow. 2 Exemplare, gefunden in einem Moor mit anderen Steingeräthen. Gelbbraun und grauweiß Länge 11, (10), Breite 4, (2 1/2) cm. (V.=S. 4367, 4368.)
Dambeck bei Röbel. Schwarz, grob zugeschlagen. Länge 9 1/2 Breite 3 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. III b. 39.)

Dambeck. Weiß, grob zugeschlagen. Länge 9, Breite 2 1/4 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. III b. 40.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Grau durchscheinend. Abnutzungsspuren auf der gekrümmten Seite. Länge 9 1/2, Breite 2 1/4 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1886. (Gr. S. Gl. III b. 31.)
II. Schneidefläche annähernd gerade. Bei allen Exemplaren sind beide Seiten leicht gezahnt.
Dummerstorf bei Rostock. Gelbbraun. Sehr schönes Exemplar. Länge 15, Breite 4 3/4 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S. Gl. III b. 41.)



|
Seite 56 |




|
Warnemünde. Grau durchscheinend. Länge 11, Breite 4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. GI. III b. 28.)
Tessenow bei Parchim. Grau, einfach zugeschlagen. Länge 11, Breite 4 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr.S. Gl. III b. 26.)
Redentin bei Wismar. Aus dem Pfahlbau beim Hofmoor. Grau. Länge 11, Breite 4 cm. Geschenk des Herrn Mann 1889. (Gr S. Gl. III b. 37.)
Friedrichsruhe bei Crivitz. Grau durchscheinend, Länge 10, Breite 3 cm. Geschenk des Herrn Wildhagen 1882. (Gr. S Gl. III b. 25.)
Neukloster. Grau durchscheinend. Länge 10 1/4, Breite 3 1/2 cm. Geschenk des Herrn Kreuzer in Zehlendorf 1879 (V.=S. 4376.)
Mühlen=Rosin. Moorfund s. oben. Grünlichgrau. Länge 9, Breite 2 cm. (V.=S. 4060.)
Schwerin. Im Hofküchengarten, wo schon oft Altsachen aus Stein gefunden sind (s. o. S. 26). Weiß. Länge 9, Breite 3 cm. (Gr. S. Gl. III b. 22.)
Helm bei Wittenburg. Dunkelgrau, eine Spitze abgebrochen, Länge noch 9, Breite 3 cm. Geschenk des Herrn Wildhagen 1887. (Gr. S. Gl. III b. 34.)
Consrade bei Schwerin. 3 Exemplare, mit anderen Steingeräthen in einem Moor gefunden. Gelb, (schwarz, grau durchscheinend.) Länge 10, (10, 9,) Breite 3, (3, 2) cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Oberförster Drepper 1874. (V.=S. 4456-4458.)
III. Schneidefläche nach innen gewölbt.
Ueberende bei Waren. Gelbbraun. Länge 14, Breite 3 cm. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. Gl. III b. 32.)
Hütten bei Doberan, im Moor zusammen mit einer Speerspitze. Schwarz mit gelben Streifen. Länge 12, Breite 3 cm. (V.=S. 4090.)
Dambeck bei Röbel. Grau durchscheinend. Länge 12, Breite 3 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. Gl. III b. 38.)
Dämelow bei Brüel. Grau durchscheinend. Länge 11 1/2, Breite 3 1/4 cm. Geschenk des Herrn von Storch 1889. (Gr. S. Gl. III b. 35.)
Helm bei Wittenburg. Grau durchscheinend. Länge 11, Breite 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Holzwärter Renard in Helm 1890. (Gr. S. St. 8.)
Waren. Gelbbraun. Länge 12, Breite 3 cm. Beide Seiten scharf zugeschlagen. Samml. Struck 1886. (Gr. S. Gl. III b. 33.)


|
Seite 57 |




|
Peckatel bei Schwerin. Weiß. Länge 12, Breite 3 1/2 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Rambow in Peckatel 1874. (V.=S. 4425.)
Zippendorf bei Schwerin. Gelbweiß, sehr stark gekrümmt. Länge 9 1/2, Breite 2 1/2 cm. Erworben 1884. (Gr. S. Gl. III b. 29.)

Gegend von Laage. Grauweiß. Länge 10, Breite 2 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1889. (Gr. S. Gl. III b. 36.)
Neu=Käterhagen bei Neukloster. Grau durchscheinend, nur zur Hälfte erhalten. Länge noch 7 1/2, Breite 3 1/2 cm. Sammlung Pastor Voß 1874. (V.=S. 4449.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Grauweiß; nur zur Hälfte erhalten. Länge noch 5, Breite 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1886. (Gr. S. Gl. III b. 30.)
Consrade bei Schwerin, im Moor zusammen mit einer größeren Anzahl Messer, Dolche, Keile. Grauweiß. Länge 10, Breite 3 cm. (V.=S. 4557.)
In der Schweriner Sammlung befinden sich von den besprochenen Messern außer den genannten
| Einzelfunde | Grabfunde | Moorfunde | von Wohnplätzen | |
| Form I | 2 | - | 10 | keine |
| " II | 11 | - | 20 | keine |
| " III | 8 | 1 (?) | 16 | keine |
| --------- | --------- | --------- | --------- | |
| Summa | 21 | 1 (?) | 48 |
Der angebliche Grabfund (von Levin bei Dargun) ist zweifelhaft; es ist ein gegen 1840 "in einem Hünengrabe" gefundenes Stück, über das weitere Angaben fehlen. Dagegen gehören sie zu dem regelmäßigen Bestande der Moorfunde, ähnlich den Dolchen, mit denen sie auch häufig zusammen vorkommen. Die bisherigen Beobachtungen berechtigen uns noch nicht, diese Verschiedenheit der Fundverhältnisse ohne Weiteres zu einer chronologischen Scheidung zu benutzen. Wahrscheinlich ist es aber auch hier, daß die "halbmondförmigen Messer" erst den letzten Perioden der neolithischen Zeit angehören.


|
Seite 58 |




|
Nach den sog. Keilen sind die weit verbreiteten axtförmigen Geräthe das am häufigsten auftretende Werkzeug der Steinzeit. Dieselben dienen offenbar ganz überwiegend zum Schlagen (Aexte), doch ist oft auch die hintere Seite (das Bahnende) abgeplattet oder hammerartig gestaltet (Axthammer); größere axtförmige Geräthe mit einem Schaftloch, das zu klein ist, um einen entsprechend starken Schaft aufzunehmen und die man deshalb als " Setzkeile" erklärt hat (Voß=Stimming, Alterthümer von Brandenburg, Text S. 18) kommen in Meklenburg nicht vor. Das Material der Aexte ist nie Feuerstein (derselbe ließ sich nicht durchbohren), sondern überwiegend Diorit; andere Gesteinsarten, wie Granit, Gneis, Sandstein sind seltener benutzt, Kieselschiefer anscheinend nie. Eine wissenschaftlichen Ansprüchen nachkommende Untersuchung unserer Aexte nach ihrem Stoffe hat noch nicht. stattgefunden, ist auch ohne Schädigung der Exemplare nicht durchzuführen. Unsere unten gegebenen Bestimmungen beruhen daher nur auf dem Augenschein und sind sicher vielfach zu berichtigen. Die Schäftung geschah ganz überwiegend durch ein Schaftloch, welches bei uns fast stets mit der Schneide parallel geht. Nicht selten finden sich statt des Schaftlochs flache Gruben. Man könnte diese für angefangene Schaftlöcher halten, zumal sie bei denselben Typen sich finden, wie die Schaftlöcher; doch spricht dagegen, daß sie auch an ganz fertigen, offenbar benutzten Exemplaren vorkommen, ferner, daß so bearbeitete Aexte auch in Gräbern auftreten und doch nicht anzunehmen ist, daß das Steinzeitvolk seinen Todten unfertige und unbrauchbare Gegenstände mitgegeben habe. Wir müssen vielmehr annehmen, daß die Grube zur Befestigung an einem Schafte mit benutzt ist, wobei allerdings das genauere Verfahren dunkel bleibt. Eine dritte Art Schäftung ist die durch einen Schaftstiel, eine Verjüngung des Geräthes am Bahnende, besonders bei stärkeren Exemplaren angewandt, die man darum auch als Pflugscharen aufgefaßt hat. Eine vierte und besonders seltene ist die durch eine Schaftrille, eine umlaufende Kerbe zur Befestigung durch ein Band.
Höchst mannigfaltig sind die Formen der Aexte vom rohen nur durchbohrten Stein bis zu den künstlichsten, ja gekünstelten, deren Form über Zweck und Material hinausgeht. Um eine Uebersicht zu gewinnen, ordnen wir unser Material nach der Gestaltung der wichtigsten Glieder (Schneide, Seiten, Schaftloch,


|
Seite 59 |




|
Bahnende), wobei freilich von scharf gesonderten Typen nicht die Rede sein kann, sondern zahlreiche Uebergangs= und Kreuzungsformen sich finden.
I. Gerade einfache Formen.
A. Rundlich; der Stein wenig bearbeitet.
1. Bahnende und Schneide gleich hoch :
a) rundes oder spitzes Bahnende,
b) gerades Bahnende. 1 )
2. Schneide höher als Bahnende:
a) rundes oder spitzes Bahnende,
b) gerades Bahnende. 1 )
B. Die Seiten schneiden sich in Kanten.
1. Bahnende und Schneide gleich hoch:
a) rundes oder spitzes Bahnende,
b) gerades Bahnende. 1 )
2. Schneide höher:
a) rundes oder spitzes Bahnende,
b) gerades Bahnende. 1 )
II. Gerade künstlichere Formen.
1. Das Bahnende besonders gestaltet:
a) scharfe Kante oder Leiste,
b) kegelstumpfförmig,
α) sonst einfach,
β) die Seiten mit Lappen absetzend;
c) gerade und scharfrandig abschneidend,
d) bogen= oder kammförmig (diese Exemplare meist mit länglichem Schaftloch).
2. Besondere Gestaltung am Schaftloch:
a) scharfe Kante oder Leiste an der Seite,
b) Knollen (Buckel) an der Seite.
3. Besondere Gestaltung der Seiten:
a) Vertiefung der oberen und unteren Seite (am Schaftloch gewöhnlich buckelartige Ausbiegung),
b) erhöhter Grat auf der oberen Seite (Bahnende halbkugelig),
c) die Nebenseiten vom Schaftloch aus zu dreieckigen Flächen geschliffen.


|
Seite 60 |




|
III. Gebogene (geschweifte) Formen:
α) auf I zurückgehend,
β) auf II zurückgehend,
γ) doppelt geschweift,
1. mit Doppelflügeln,
2. bootförmig,
3. "Amazonenaxt".
I. Einfache Form. Weder Bahnende noch Schaftloch oder Schneide sind besonders ausgezeichnet. Diese einfache in Mittel=, Süddeutschland und sonst häufige Form (siehe Voß=Stimming Text S. 3) ist bei uns nur vereinzelt.
A. Rundlich, der Stein wenig bearbeitet.
Passentin bei Penzlin. Der Stein nur geglättet und durchbohrt, Bahnende daher unregelmäßig. Form etwa = Montelius
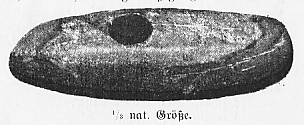
35, Merkbuch I, 17. Länge 20, Dicke im Schaftloch (8 1/2 1 ) vom Bahnende) 6, Länge der Schneide 5 cm. Geschenk des Herrn Lemke auf Passentin 1883. (V.=S. 4673.)
Stieten bei Sternberg. Unregelmäßige Form, Kanten wenig bearbeitet. Länge 13, Dicke im Schaftloch (4 vom Bahnende) 5 Sammlung von Voß 1882. (Gr.S. L. I. A. 1a, 73).
B. Mit scharfen Kanten. 1. Bahnende und Schneide fast gleich breit, das Bahnende gewöhnlich rundlich (a). Vgl. Müller 88, Merkbuch I, 16. Die abgebildete Form aus Lalchow nach Jahrbuch 30, S. 38.
Fundort unbekannt. Groß, stark verwittert. Länge 25, Dicke im Schaftloch (8 vom Bahnende) 4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. L ... 116)


|
Seite 61 |




|
Ribnitz. Länge 17 1/2, Dicke des Schafllochs (4 1/2 vom Bahnende) 6, Länge der Schneide 6, größte Breite 5 cm. Erworben 1893. (Gr. S. L. I. A. 1a, 99.)
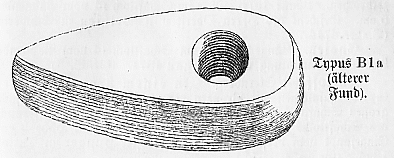
Benitz bei Schwaan. Länge 15, Dicke des Schaftlochs (5 1/2 vom Bahnende) 6, größte Breite 6, Länge der Schneide 6 cm, Erworben 1895. (Gr. S. L ... 107).
Federow bei Waren. Das Schaftloch ungewöhnlich groß (4 cm) und fast in der Mitte der Axt. Länge 14, Dicke des Schaftlochs (7 1/2 vom Bahnende) 4 1/2, größte Breite 3 1/2 vom Bahnende), 7, Länge der Schneide 5 1/2 cm. Geschenk des Herrn Dr. Schmidt, jetzt in Schleiz 1882 (Gr. S. L ... 71.) -
Fundort unbekannt. Schlanke Form. Länge 13, Dicke im Schaftloch (3 vom Bahnende) 4 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. L ... 115.)
Bülow bei Rehna; im sogenannten "Ollen Bülow", einem Moore, wo schon mehrmals Steinsachen gefunden sind und ebenso wie in dem benachbarten Moore "Langerieh" ein Pfahlbau vermuthet wird. Niedrige Form, gut geglättet und mit scharfen Rändern. Länge 13 1/2, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 5, größte Breite 5, Höhe 2 1/4 cm Geschenk des Herrn Erbpächter Burmeister in Bülow 1895. (Gr S. L ... 108.)
Zolkendorf bei Stavenhagen, Form gleich den vorigen. Länge 10, Dicke des Schaftlochs (5 vom Bahnende) 5 cm Geschenk des Herrn Dr. Schmidt, jetzt in Schleiz 1882. (Gr. S. L ... 72.)
Neu=Kalen. An der Schneide und am Bahnende beschädigt. Länge 11, Dicke im Schaftloch (4 vom Bahnende) 4 1/2 cm. Geschenk des Herrn Bürgermeister Mau in Neu=Kalen 1888. (V.=S. 4723.)
Ludwigslust. An der Schneide beschädigt. Flacher und mit schärferen Kanten als die bisherigen Exemplare. Länge 10,


|
Seite 62 |




|
Dicke im Schaftloch (3 vom Bahnende) 4 cm. Eingereicht 1884. (Gr S. L ... 77.)
Heidekaten bei Neubukow. Verwittert und an der Schneide zerbrochen. Länge 10 (?), Dicke im Schaftloch (4 vom Bahnende) 5 cm. Geschenk des Herrn Oberst von Weltzien in Schwerin. (V.=S. 4714.)
Gnoien. Länge 9, Dicke im Schaftloch (4 vom Bahnende) 3 1/2 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. L ... 119.)
Turloff bei Sternberg. In einem bronzezeitlichen Grabe zusammen mit Bronzen der zweiten Periode. Einfach; großes Schaftloch (2 1/4 cm Durchmesser). Länge 9, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 4, größte Breite 4, Höhe 3 cm Eingesandt vom verstorbenen Herrn Förster Hunger in Turloff 1895. (Gr. S. Br. 374.)
Schwerin, beim Schloßbau gefunden. Diabas (?); die Schneide fehlt; Länge noch 9, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 4, größte Breite 4, Höhe 4 cm. Geschenk des Herrn von Nettelbladt in Güstrow 1880. (V.=S. 4654.)

Dummerstorf bei Rostock Bahnende spitzer zugehend als bei den bisher besprochenen. Länge 8, Dicke im Schaftloch (3 1/2 vom Bahnende) 3, größte Breite (am Schaftloch) 3, Breite de Bahnendes 1 1/2 cm. Sammlung von Preen 1893. (Gr. S. L ... 103.)
Cordshagen bei Rehna. Auch am Bahnende benutzt. Länge 7, Dicke im Schaftloch (2 1/2 vom Bahnende) 4 1/2 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. L ... 113).
Bei mehreren dieser Stücke scheint auch das Bahnende gelegentlich benutzt zu sein als Hammer, deutlich ist dieses bei einigen, wo dasselbe gerade abschneidet. (Typus B 1 b.)
Karnitz bei Neukalen. Sandstein. Nicht durchbohrt; auf einer Seite eine Grube. Länge 21, größte Breite 7, Höhe 4 1/2 cm. Geschenk des Herrn von Levetzow auf Lelkendorf 1886. (V.=S. 4711).
Stassow bei Tessin. Starkes Exemplar; die obere und untere Fläche leicht eingebogen. Länge 18, Dicke im Schaftloch (5 1/2 vom Bahnende) 7, Breite am Schaftloch 5, am Bahnende 4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. L ... 111.)


|
Seite 63 |




|
Wozeten bei Laage. Schaftloch nicht durchgehend, auf beiden Seiten die Bohrung nur angefangen. Länge 12 1/2, größte Breite (am Schaftloch) 4 1/2, Höhe 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 4 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1892. (Gr. S. L ... 98.)
Kowalz bei Tessin. Angeblich aus einem Hünengrabe Schön geschliffen. Länge 15, größte Breite 7, Dicke 6 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Landrath von Plüskow auf Kowalz 1883. (V.=S. 4666).
Als Gruppe B 2 bezeichnen wir die Exemplare, wo die Schneide höher ist als das Bahnende
a. mit rundem Bahnende; vgl. Mestorf 83.
Jamel bei Grevesmühlen. In der Kiesgrube in der Forst rechts der Chaussee nach Grevesmühlen, wo vielfach steinzeitliche Geräthe gefunden sind. Gneisartiges Gestein. Kein Schaftloch, sondern nur auf einer Seite flache Grube. Länge 15 1/2, größte Breite 4, Höhe am Bahnende 4, an der Schneide 4 1/2 cm. Geschenk des Herrn Sanitätsrath Dr. Jahn in Grevesmühlen 1897. (Gr. S. L ... 124.)
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Gneis(?) Aus einer "Feuersteinmanufaktur." Schneide abgesplittert. Länge 11, größte Breite 4 1/2, Höhe am Bahnende 5, an der Schneide etwa 6, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 4 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1886. (Gr. S. L ... 85.)
Zietlitz bei Schwerin. Länge 12, Höhe am Bahnende 2, an der Schneide 4, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 4 1/2 cm. Erworben 1885. (Gr. S. L ... 80)
Rutenbeck bei Crivitz. Länge 10, Höhe des Bahnendes 3, des Schaftlochs 5, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 4 1/2, größte Breite (am Schaftloch) 4 1/2 cm. Eingereicht 1891. (Gr. S. L ... 97.)
Weniger häufig sind die mit geradem Bahnende abschneidenden Axthämmer). Typus B 2 b; vgl. Merkbuch I, 15.
Kassow bei Wismar. Starkes Exemplar. Länge 20, Höhe am Bahnende 4, an der Schneide 6 1/2, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 7 cm. Geschenk des Herrn Dr. Crull 1882. /V.=S. 4672).
Bülow bei Rehna; gefunden in einem Moderloch. Länge 5 größte Breite (Bahnende) 5, Höhe an der Schneide 6, Höhe am Bahnende 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch


|
Seite 64 |




|
3 1/2 cm. Geschenk des Herrn Erbpächter Jacobs 1896. (Gr. S. L ... 109.)
Cordshagen bei Rehna. Länge 12 1/2, größte Breite (am Schaftloch) 6, Breite des Bahnendes 3, Höhe der Schneide 6, Höhe am Bahnende 5, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 5 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. L ... 112.)
Dassow. Aehnlich dem Exemplar von Jamel. Doch scheint das Stück trotz der unvollständigen Bohrung benutzt zu sein, wie oft; es muß dann eine andere Art der Schäftung angewendet sein. Länge 11, größte Breite 3 1/2, Höhe am Bahnende 3 1/2, an der Schneide 5 cm. Sammlung Pastor Voß. (V.=S. 4452.)
Gegend von Schwerin. Auffallend starkes Bahnende. Länge 11, größte Breite (am Schaftloch) 5, Breite am Bahnende 4, Länge am Bahnende 3 1/2, Länge an der Schneide 5 1/2 Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 4 1/2 cm. (V.=S. 4436.)
Außerdem besitzt die Schweriner Sammlung:
| A 1 a | 5 Einzelfunde, (bei einem statt des Schaftlochs flache Gruben.) | |
| b | 2 Einzelfunde, | |
| 2 a | 1 Einzelfund, statt des Schaftlochs auf beiden Seiten starke Vertiefungen, | |
| b | 1 aus einem Hünengrabe (?) (Gremmelin). | |
| B 1 a | 33 Einzelfunde (2 mit flachen Gruben, eins mit unvollständiger Bohrung und aus einem zerbrochenen Exemplar hergestellt), 2 aus Pfahlbauten (Gägelow), 2 aus Moorfunden (Lalchow, Langsdorf), einer aus Feuersteinmanufaktur (Eldenburg, | |
| b | 11 (1 mit unvollständiger Bohrung, 1 aus einem zerbrochenen Exemplar), Einzelfunde, 1 Moorfund (Tarnow), | |
| 2 a | 19 Einzelfunde (3 mit unvollständiger Bohrung, von diesen eins aus einem zerbrochenen Exemplar); 2 aus Pfahlbauten (Bützow, Wismar), 2 aus Hünengräbern (Leisten, Dobbin); | |
| b | 8 Einzelfunde (4 mit unvollständiger Bohrung, davon 2 aus zerbrochenen Exemplaren), 1 Moorfund (Sülz), 1 aus einem Pfahlbau (Bützow), 1 aus einer Feuersteinmanufactur (Tressow), 1 aus einem Hünengrab (Mestlin). |
Dazu vom Typus B etwa 30 unvollständige Exemplare.


|
Seite 65 |




|
II. Gerade Aexte mit Schaftloch; sonst einfach, aber ein Glied stärker betont.
1. Bahnende.
a. das Bahnende verengert sich zu einer schmalen Leiste, eine in Meklenburg häufige, sonst, soweit ich sehe, seltene Form. Das abgebildete Exemplar aus dem Pfahlbau von Wismar nach Jahrb. 30, S. 38.
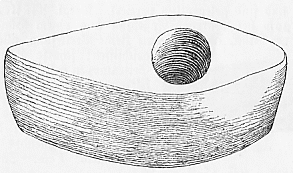
Tessenow bei Parchim. Sonst vom Typus I. B 2. Länge 14 1/2, größte Breite (im Schaftloch) 5 1/2, Länge des Bahnendes 3 1/2, Länge der Schneide 4 1/2, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 5 cm. Sammlung von Voß 1882. (Gr. S. L ...73.)
Zarrentin. Aehnlich den vorigen. Länge 15, größte Breite (am Schaftloch) 6, Länge des Bahnendes 5, Länge der Schneide 6, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 5 cm. Erworben 1874. (V.=S. 4427.)
Schwasdorf bei Gnoien. Länge 11, größte Breite (am Schaftloch) 4, Länge des Bahnendes 2 1/2, Länge der Schneide 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 3 1/2 cm, Sammlung Struck 1886. (Gr. S. L ... 84.)
Laage. Aehnlich dem vorigen. Länge 10, größte Breite (am Schaftloch) 3 1/2, Dicke am Schaftloch (3 vom Bahnende) 3 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1889. (Gr. S. L ... 92.)
Dambeck bei Röbel. Länge 10 1/2 größte Breite (am Schaftloch) 4 1/2, Länge des Bahnendes 3, Länge der Schneide 4, Entfernung des Schaftlochs vom Bahnende 4 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. L ... 95.)
Von diesem Typus 8 Einzelfunde; dazu 3 aus Hünengräbern (Malchin, Stuer, Tatschow), 2 aus Pfahlbauten (Wismar).


|
Seite 66 |




|
II. 1 b. Das Bahnende kegelförmig.
a. Die einfachste Form unterscheidet sich wenig von dem als I B beschriebenen Typus, nur setzt das Bahnende schärfer an oder zieht sich rascher zu der stumpf kegelförmigen Endung zusammen. Von dieser Form 5 Einzelfunde, darunter ein Bruchstück.
b. Eine hübsche Form entsteht, wenn die vier Seiten am Bahnende in halbrunden Lappen enden; diese Lappen setzen meist scharf ab und sind gelegentlich verziert. Vergl. Müller 86.
Kargow bei Waren. Angeblich aus einem Hünengrabe. Sehr schönes Stück, im Kegel eine kleine Vertiefung. alle Seiten geschliffen; scharfe Kanten, die Seitenlappen gestrichelt, einer der seltenen Fälle verzierter Aexte. Länge 13, größte Breite (3 vom Bahnende) 5, Höhe des Schaftloches vom Bahnende 5, Entfernung des Bahnendes 2, Höhe der Schneide 4 cm. Sammlung Struck 1886. (Gr. S. L ... 83.)
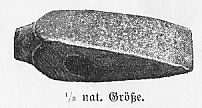
Von dieser Form 6 Einzelfunde, darunter ein Stück mit angefangener Bohrung und Bohrzapfen (Zippendorf, vergl. Jahrbuch 39, Seite 122), und ein Bruchstück.
c. Bahnende rechteckige Fläche und scharfrandig; vergl. Müller 91, Kemble III. 3 Voß=Stimming I. 2, 1 und 8 (in Brandenburg häufig und noch in der Bronzezeit im Gebrauch, (s. ebenda. III. 1, 2 a, III. 5, 9 und Text S. 3.)
Käbelich (Meklenburg=Strelitz). Niedriges, schön geglättetes Exemplar. Länge 16 1/2, größte Breite (am Schaftloch) 5, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 6, Höhe am Schaftloch 1 1/2, Höhe an der Schneide 2 1/2 cm. Erworben 1887 (Gr. S. L ... 86.)

Neukalen. Gneis. Länge 20, größte Breite (am Schaftloch) 6, Entfernung des Schaftloches vom Bahnende 7, Höhe gleichmäßig 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Bürgermeister Mau in Neukalen 1888. (V.= S. 4723.)
Von dieser Form nur noch 4 Einzelfunde, darunter 1 Stück mit angefangener Bohrung, aus einem zerbrochenen umgestaltet,


|
Seite 67 |




|
und 1 Bruchstück, 1 aus einem Hünengrabe (Mestlin), 1 aus einem Wohnplatz (Schwerin).
d. Das Bahnende besteht aus einer bogenförmigen Erhöhung (Kamm); eine seltsame Form, gewöhnlich ist das Schaftloch länglich. Vergl. Mestorf 88, Müller 97. Merkbuch II. 10. Wir haben 4 Einzelfunde der Art.
II. 2. Einfache, gerade Aexte mit Besonderheiten des Schaftloches.
a. Leiste an der Seite. Müller 72.
Bastorf bei Kröpelin. Auf dem Berge, wo 1878 der Leuchtthurm erbaut ist. Schlankes Stück. Länge 17, größte Breite (am Schaftloch) 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 8, Höhe am Bahnende 3, Höhe an der Schneide 4 cm. Geschenk d. Herrn Wittholz in Fulgen 1880. (V.=S. 4583.)
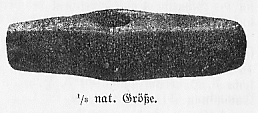
Außer diesen nur zwei Exemplare aus einem Moorfunde (Dalliendorf) und einem Pfahlbau (Gägelow).
b. Wulstartige Erweiterung des Schaftloches. Aehnlich Merkbuch I. 18.
Fo. u. Starkes Exemplar aus schwarzem (schiefrigem) Stein. Länge 19, größte Breite (am Schaftloch) 6, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloche 7 1/2, Höhe des Bahnendes 4, Höhe der Schneide 5 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. L ... 117.)
Neustadt. Im Schaftloch zerbrochen. Aehnlich Voß=Stimming I. 3, 7, eine in Meklenburg sonst nicht vorkommende Form. Länge (Schaftloch bis Schneide) 9 cm. Erworben 1896. (Gr. S. L ... 110.)
II. 3. Gerade Aexte mit künstlich gearbeiteten Seiten.
a. Obere und untere Seite vertieft; charakteristisch eine Form mit starker Ausbiegung am Schaftloch, die oft buckelartig ist, oft in der vertieften Fläche ein erhöhter Grat. Bahnende gerade abschneidend. Müller 98, 99, Mestorf 96. Merkbuch II. 2. Ein leicht geschweiftes Exemplar aus der Neumark aus einem Grabe mit Leichenbrand vom Ende der Steinzeit s. Goetze, Zeitschr. für Ethn. 1892, Verhandl. S. 178, Fig. 4, wo Analogien besonders


|
Seite 68 |




|
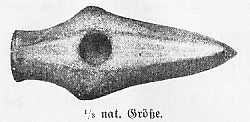
von der unteren Oder angeführt sind. Das hier abgebildete Stück ist ein älterer Fund von Deven.
Lübesse bei Schwerin. Rundliche Ausbauchung am Schaftloche, die Vertiefung der Seiten nur angedeutet. Länge 17, größte Breite 5, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloche 7, Höhe am Bahnende 3, Höhe an der Schneide 4 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Putzky aus Alexandrinenhöhe 1886. (V.=S. 4716.)
Klein=Varchow bei Penzlin. Kein durchgehendes Schaftloch, sondern auf beiden Seiten tiefgehende Gruben. Länge 16 1/2, größte Breite 5, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloche 6, Höhe am Bahnende 3, Höhe an der Schneide 4 1/2 cm. Sammlung Struck 1886 (Gr. S. L... 81.).
5 Einzelfunde dieser Art, darunter ein Stück mit nicht vollendeter Bohrung, 3 aus Hünengräbern (Dölitz, Frauenmark, Laage); auch scheinen 7 Bruchstücke diesem Typus anzugehören.
b. Erhöhter Mittelgrat, erinnernd an die Gußnähte eines bronzenen Exemplares; auch sonst liegt die Nachahmung metallener Aexte hier nahe, und in der That sind die Vorbilder hierfür vorhanden und zwar, was besonders wichtig ist, in Kupfer; vergl. Montelius A. f. A. XXIII, S. 437, eine Axt aus Schonen, wobei nachgewiesen ist, daß diese kupfernen Exemplare aus Oesterreich=Ungarn stammen.
Weit verbreitet, auch weit über das nordische Gebiet hinaus (vergl. aus Oesterreich: Much, Ztschr. d. anthrop. Gesellschaft Wien 24, S. 88, Italien: bulletino paletnologico XVIII, 1892, Nr. 12 und 6) ist eine Form mit starkem Grate an der oberen und unteren, oft auch an den Seitenflächen, die hinten mit einer halbkugeligen Verdickung abschneidet, vergl. Mestorf 89, Merkbuch II. 5; ähnliche Formen, die den Uebergang von der vorigen darstellen, Müller 100 u. s. w. (vergl. auch Goetze, Zeitschr. für Ethn. 1892, Verhandl. S. 178, Fig. 1, wo eine eigenthümlich preußische Form dieses Typus abgebildet ist.)
Kummerow bei Malchin. Sehr schönes Exemplar, Länge 18, größte Breite 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaft=


|
Seite 69 |




|
loche 8, Höhe des Bahnendes 3 1/2, Höhe der Schneide 4 cm. Aelterer Bestand, vgl. Jahrb. 6 B, S. 33. (V.=S. 728.)

Upost bei Dargun. Zwischen Bahnende und Schaftlochwulst eingezogen und mit 2 Längskehlen verziert, Grate an den Seiten; kein Schaftloch, sondern flache Gruben. Länge 16, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloche 6 1/2, größte Breite 4, Höhe des Bahnendes 4 1/2, Höhe der Schneide 4 cm. Geschenk des Herrn Schmidt in Warrenzin 1889. (V.=S. 4730.)
Wie eine Vereinfachung dieser Form erscheint ein Exemplar:
Fundort unbekannt. Stumpfkegeliges Bahnende, glatter Mittelgrat und glatte leicht erhöhte Ränder am Schaftloch. Länge 12 1/2, größte Breite 4, Entfernung des Schaftloches vom Bahnende 5, Höhe am Bahnende 2, Höhe an der Schneide 4 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. L... 118.)
Außerdem 1 annähernd ähnliches und 4 Bruchstücke.
c. Anderer Art sind rundliche Formen, bei denen die Nebenseiten vom Schaftloch an zur Schneide zu poliert sind, sodaß eine dreiseitige Fläche entsteht. Aehnlich Müller 84, 85 Mestorf 79.
Gutow bei Grevesmühlen. Länge 12, größte Breite 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloche 6, Höhe des Bahnendes 3, Höhe des Schaftloches 3 cm. Geschenk des Herrn Wildhagen 1879. (V.=S. 4604.)
Außerdem 1 Exemplar von Viezen (dieses das abgebildete).

Aexte mit facettirten Seiten, wie sie für südlichere Steinperioden (z. B. die ältere Thüringische Steinzeit) charakteristisch und viel nach dem Norden exportirt sind (vergl. Goetze, Ueber neolithischen Handel. Bastian=Festschrift S. 5. Merkbuch II. 3), finden sich in Meklenburg, wie es scheint, nicht. Ein Exemplar, unbekannten Fundorts, gehört dem ältesten Bestande der Großherzoglichen Sammlung an und kann auswärts gekauft sein.


|
Seite 70 |




|
III. Geschweifte Exemplare.
Fast sämmtliche bisher behandelte Typen kommen auch in Exemplaren vor, an denen die Ober= oder Unterseite oder auch nur der Schneidentheil gebogen ist. Seltener sind die einfachen Aexte (Form III ?.), von diesen haben wir nur zwei Stücke von Typus A I., häufiger die künstlicheren. Aber auch abgesehen von diesen kommen eigenartige geschwungene Typen vor. Wir scheiden die ersteren mit III ( von den letzteren mit III ?.
?. 1. Entsprechend dem Typus mit spitzem, leistenförmigem Bahnende (II 1 a). Von diesen haben wir 13 Exemplare, darunter 2 aus Hünengräbern (Dobbin, Vietlübbe), 1 aus einem Moorfund (Langensee); entsprechend dein mit kegelförmigem Bahnende (II 1 b), zwei Exemplare, meist ältere Funde.
Lübsee bei Rehna. Typus II 1 a. Nur leicht nach der Schneide zu gebogen, sonst gleich. Bohrung unvollständig, konisch auf beiden Seiten. Länge 10, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 3, Höhe am Bahnende 2 1/2, an der Schneide 3, größte Breite 3 cm. Sammlung Splitter 1876. (Gr. S. L ... 114.)
Klütz. Schön erhalten, ohne jedes Schaftloch. Länge 15, Höhe des Bahnendes 1 1/2, Höhe der Schneide 4 1/2, größte Breite 4 cm. Sammlung von Rantzau 1871. (Gr. S. L ... 125.)
Kl.=Pravtshagen bei Grevesmühlen. Typus II 1 b ?. Granit (?), zerbrochen; nur an der Unterseite angebohrt, woselbst der Bohrzapfen noch erkennbar. Sehr ähnlich dem oben erwähnten Exemplar aus Zippendorf. Länge?, größte Breite 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 5 cm. Geschenk des Herrn Dr. Splieth in Kiel 1893. (Gr. S. L ... 102.)
Entsprechend dem Typus II 2 b.
Rabensteinfeld bei Schwerin. Gefunden im Acker beim Pflügen. Das Bahnende leicht gebogen. Länge 17 1/2, größte Breite 5, Höhe am Bahnende 3 1/2, an der Schneide 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 8 cm. (Gr. S. L ... 68.)
Dambeck bei Röbel. Aehnlich dem vorigen, aber auch die obere Seite gebogen. Länge 14, größte Breite 4, Höhe am Bahnende 3 1/2, Höhe an der Schneide 3, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 5 cm. Samml. Dohse 1891. (Gr. S. L ... 94.)



|
Seite 71 |




|
Ratzeburg. Aehnlich dem vorigen Melaphyr. (?) Länge 14, größte Breite 3 1/2, Höhe am Bahnende 3 1/2, an dem Schaftende 4, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 6 cm. Erworben 1887. (Gr. S. L ... 87.) Dazu vier ältere Funde, ein Stück aus einem Hünengrabe (Gnoien).
?. 2. Eine interessante Form sind die mit grade abschneidendem walzenförmigem Bahnende und wulstartige Erweiterung des Schaftloches. Alle (sechs) Exemplare unserer Sammlung sind fast gleich: die Schneide nach unten gebogen, an der oberen, bei 2 auch unteren Seite, kantige Erhöhungen, anscheinend die Nachahmung von Bronzeäxten. Das abgebildete Exemplar ist 1859 bei Zierow bei Wismar gefunden. Ein ähnliches, kleineres und einfacheres Exemplar (etwa= Montelius 41) aus Waren ist in das Berliner Völkermuseum gekommen (abgebildet Merkbuch II., Figur 4). Aehnliche Formen Müller 81.
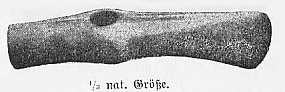
Eine Abart stellt eine nur durch ein Stück vertretene Form vor, wo das Bahnende breit hammerförmig endet und die starke Verbreiterung des Schaftloches in scharfem Winkel abschließt. Das Stück ist in Prützen bei Schwaan gefunden und Friderico-Francisceum I, 1 abgebildet. Das Gestein ist schieferartig, und das Stück wohl importirt.
III ?. Unter den nach beiden Seiten gebogenen Aexten treten drei Formen hervor:
Eine doppelflügelige, vertreten durch ein älteres, aber noch nicht abgebildetes Exemplar. Vgl. Müller 73 und 76.
Rüst bei Dobbertin. Das Bahnende verbreitert sich etwas, an den Seitenflächen beim Schaftloch je zwei erhöhte Streifen, die obere Seite vertieft. Länge 18 1/2, größte Breite 2 1/2, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 7, Höhe am Bahnende 5, am Schaftloch 3 1/2, an der Schneide 5 cm. Gefunden 1838, (V.=S. 310.)



|
Seite 72 |




|
2. "Bootförmige"; eine Form, die auf Typus II 2 b zurückgeht. Von den verschiedenen bei Müller abgebildeten Formen kommt in Meklenburg nur die eine Fig. 77 vor.
Dambeck bei Röbel. Bahnende und Schneide fast gleich behandelt, doch ersteres nicht geschärft. Länge 18, größte Breite 5, Höhe am Bahnende 4 1/2, am Schaftloch 4, an der Schneide 4 1/2, Entfernung des Bahnendes vom Schaftloch 8 cm. Sammlung Dohse 1891. (Gr. S. L ... 93.)

Bobzin bei Wittenburg. Dem vorigen ähnlich; gefunden zusammen mit einem Feuersteinkeile (s. S. 21) im Acker 30 cm tief. Länge 14, größte Breite 3 1/2, Höhe am Bahnende 3 1/2, am Schaftloch 2 1/2, an der Schneide 3 1/2, Entfernung des Bahnendes von der Schneide 6 cm. Erworben 1888. (Gr. S. L ... 88.)
Von dieser Art noch drei Exemplare, eins aus einem Hünengrabe (Püttelkow), eins aus einem Pfahlbau (Wismar).
3. Zweischneidige Aexte mit gewölbter Schneide (Amazonenäxte). Montelius 39. Müller 94 Mestorf 101.
Gr.=Potrems bei Laage. Länge 16, Entfernung des Schaftlochs von einem Ende 6, größte Breite 5, Höhe der Schneiden 8 1/2, im Schaftloch 2 1/2 cm. Geschenk des Herrn Pastor Beyer in Laage 1889. (Gr. S. L ... 91.)

Die Sammlung enthält noch zwei sehr ähnliche Exemplare.
Wir haben bisher die Aexte nur nach ihrer Form klassificiret. Es ist eine weitere Aufgabe, denselben ihre relative zeitliche Stellung anzuweisen. Dazu gewähren nun leider unsere Funde keinen Anhalt. Aus der eben gegebenen Aufzählung geht hervor, daß unter den 16 aus Hünengräbern stammenden Stücken ziemlich alle Typen vertreten sind, überwiegend allerdings die künstlicheren. In einem Grabe von Mestlin (Nr. 2), welches durch seine Bauart ein hohes Alter anzudeuten scheint, finden sich zwei Aexte sehr


|
Seite 73 |




|
einfacher Arbeit, in dem von Püttelkow, welches wir an das Ende setzen müssen, eine sehr künstliche "bootförmige" Axt. Mehrmals finden sich Aexte von solcher Kleinheit, daß sie wohl nur einen symbolischen Zweck gehabt haben können (Dobbin Leisten, Bietlübbe). Umgekehrt finden sich in den Moor= und Wohnplatzfunden (21 Stück) überwiegend die einfacheren Formen, wie ja natürlich. Daß die Stücke von einfachen Formen nicht ohne weiteres als ältere zu betrachten sind, zeigt z. B. der Fund von Turloff, wo eine Axt Typus I. B 1 a in einem bronzezeitlichen Grabe gefunden ist.
sind überaus selten, wie überhaupt in der nordischen Steinzeit. Die Verbindung der Axt mit dem Schaft durch Umschnürung scheint immer nur ein Nothbehelf geblieben zu sein. Besondere Typen haben sich mit Ausnahme der Form Montelius 37, Müller 83, die gelegentlich im östlichen Dänemark, häufiger in Schweden auftritt, nicht entwickelt.
Die meklenburgischen Exemplare sind :
Gegend von Bützow. Sandstein; wenig bearbeitet; das Bahnende der natürliche Stein; tiefe Einschnitte an den Seiten; keine Schmalseiten, sondern Kante; die Schneide geglättet. Länge 19, größte Breite 11 cm. Erworben 1883. (Gr. S. L. I. A. 2 a (5).
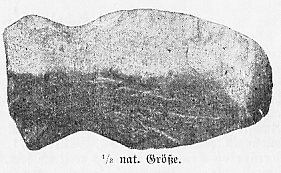
Alt=Steinhorst bei Ribnitz. Diorit (?). Eine unfertige, noch nicht ganz durchbohrte und im Schaftloch zerbrochene, schmale Axt ist durch Einkerbungen an der oberen und unteren Seite zur Befestigung an einem Schafte brauchbar gemacht. Das Ende (die Bruchfläche) ist unverändert gelassen. Länge 10 1/2, Höhe am Bahnende 4 1/4,



|
Seite 74 |




|
an der Schneide 7 1/2, größte Breite 3 1/2 cm. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. L ... 78.)
Hühnerland bei Grabow. Diabasaphanit (?). An die oben beschriebene Form der, Dioritkeile erinnernd, aber mit einem sich nach allen Seiten verschmälernden Endstück, um das eine schmale Rille herumläüft. Länge 11, Höhe am Bahnende 3 1/2, an der Schneide 5 1/2, größte Breite 3, Länge des Endstückes 3 cm. Sammlung von Voß 1883. (Gr. S. L ... 76.)

Unsere Sammlung besitzt noch ein viertes Exemplar, welches nach glaubwürdigen Nachrichten bei Hagenow im Acker gefunden und 1881 eingeliefert ist. (Gr. S. Gl. IV. 1, 49 vergl. Jahrb. 47, S. 302). Es ist ein flach rundlicher (zungenförmiger) Stein mit scharfen Einschnürungen an den Schmalseiten. Diese Form ist hier ganz singulär und entspricht genau den bekannten Axtformen amerikanischer Stämme; sodaß ich sie bis auf weiteres für ein fremdes, hier verloren gegangenes Stück halten möchte.
Die stärksten Exemplare pflegen nicht mit einem Schaftloch versehen zu sein, sondern haben ein kurzes griffartiges Ende zum Einklemmen in einen Schaft; zur besseren Befestigung ist fast stets die obere Seite vom Ende bis über den Schaftansatz hinaus vertieft. Man hat diese Aexte auch als Pflugscharen aufgefaßt, ein Zweck, zu dem die größeren Exemplare ohne Zweifel wohl verwendbar waren. Material meist Diorit. Abbildungen s. Montelius 16, Müller 71, Mestorf 84, 87, Friderico-Franc. 29, 3. So weit ich sehe, sind diese Geräthe überall nur als Einzelfunde bekannt geworden. So auch die elf Schweriner Stücke.
Am Plauer See gefunden (der Fundbericht ist zweifelhaft). Länge 20 1/2, Länge des Schaftabsatzes 8, Länge der Schaftvertiefung 11 1/2, Höhe am Schaftansatz 7 cm. Geschenk des Herrn von Oertzen aus Käselow 1895. (Gr. S. L I. A². 2, 6.)



|
Seite 75 |




|
Hagenow. Klein, gedrungen. Länge 12, Länge des Schaftabsatzes 0, Länge der Schaftvertiefung 9 1/2, Höhe 6 1/2, größte Breite 5 cm. Geschenk des verstorbenen Herrn Landbaumeister Luckow in Rostock 1880. (V.=S. 4641.) Dieses das abgebildete Stück.
Ein durchlochtes Steingeräth mit ausschließlich platten Seiten (Hammer) ist nur einmal beobachtet. Fundort unbekannt. Beide Schmalflächen sind rund (2 1/2 cm Durchmesser) und abgeplattet; die andern vier Seiten oval mit umgrenzenden Linien. Die Form erinnert an den Typus II. 1 bß der Aexte. Länge 7, Höhe 3 1/2 cm Aus dem ältesten Bestande der Sammlung, abgebildet Frid. Franc 28, 3 (Gr. S. L ... 25).
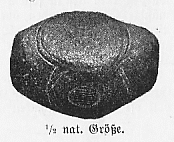
Anhangsweise zu den Aexten sei ein Geräth erwähnt, welches gewöhnlich ebenso mit einem Schaftloch versehen ist, wie die Aexte, aber schwerlich zum Schlagen gebraucht ist. Die Unterseite ist nämlich ganz flach und scheint zum Glätten gedient zu haben. Das Schaftloch steht senkrecht zu der breiten Schneide. Diese Stücke sind im Gebiet der nordischen Steinzeit selten (vergl. Müller, Fig. 115) und erinnern an gewisse, besonders in den Thüringischen Steinzeitgebieten häufige Formen, die man als "flache Steinhacken" und "schuhleistentartige Steingeräthe" bezeichnet hat (s. Goetze, Gefäßformen der neolithischen Keramik, S. 5 und 6 und Bastian=Festschrift, S. 7.).
Wir besitzen nur drei (leider zerbrochene):
Neukalen. Gneis; im Schaftloch zerbrochen, gleichmäßig zur Schneide zu abschneidend. Länge noch 12, Höhe 4, Breite 8 cm (also sehr beträchtlich). Erworben 1863. (V.= S. 3753.)
Jabel bei Malchow. Diabas (?), kleines Bruchstück; noch 7 cm lang, 7 cm breit, 4 cm hoch. Erworben 1861. (V.=S. 3537.)
Priborn bei Röbel. Flache Granitscheibe. Die Durchbohrung nur halb fertig, spitz zugehend, beide Seiten flach. Länge noch 12 1/2, Breite 7 1/2, die Höhe 3 1/2 cm. Geschenk des Herrn Gymnasiallehrer Struck in Waren 1876. (V.=S. 4503.)


|
Seite 76 |




|
8. Ackergeräthe u. s. w.
Daß in der Steinzeit Ackerbau getrieben ist, beweisen nicht nur Funde von Feldfrüchten selbst, sondern auch Geräthe, die zur Bestellung des Bodens und der Bearbeitung der Früchte gedient haben. Zu den ersteren zählen starke Hacken aus Stein, zu denen vielleicht schon einige der oben besprochenen " Aexte mit Handhabe" gehören. Wir rechnen hierher auch folgenden Fund:
Lüningsdorf bei Güstrow. Am Fuße des Schmockberges wurden 1 m tief in festem Lehm zwei Granitsteine von unregelmäßiger Form gefunden, oben breiter, unten zugespitzt. Länge 32, Breite oben 10, größte Dicke 5 cm. Ein anderer Zweck als zur Bodenauflockerung ist nicht recht findbar. Geschenk des Herrn Busch in Schwerin 1897. (G. S. L. I. A 2a. 7.)
Sehr häufig sind ferner die Quetschmühlen, ausgehöhlte Granitblöcke, in denen das Getreide zerquetscht wurde, vom Landvolk oft als "Hünenhacken" bezeichnet (vergl. Lisch, Jahrb. 30,
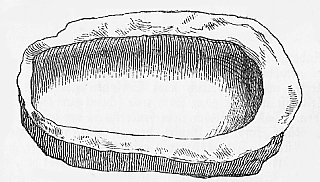
S. 40); in Hünengräbern sind diese Geräthe noch nicht gefunden, aber in Moorfunden, die als Pfahlbauten angesprochen werden, mehrfach, so bei Gägelow und Wismar. Sie kommen aus dem Lande, wo sie noch vielfach Verwendung unter der Dachrinne, als Tröge u. s. w. finden, in Massen vor; auch in Kirchen findet man sie häufig eingemauert. Beachtenswerth ist, daß sie in mehreren Fällen zwischen den Steinhäufungen der bronzezeitlichen Kegelgräber gefunden sind; so neuerdings in Retzow bei Plau (ich zählte noch 10 Stück), wo eine Anzahl Kegelgräber zwecks Steingewinnung durchwühlt sind. In dem Grabraum einer bronzezeitlichen Bestattung sind sie noch nicht beobachtet, doch ist es immerhin wahrscheinlich, daß sie auch in der Bronzezeit noch im Gebrauch gewesen sind.


|
Seite 77 |




|
Zu diesen Quetschmühlen gehören wohl die Reibsteine, runde, mit einer Hand zu haltende Steine (Granit, auch Sandstein), deren Seiten abgeflacht sind. Mit einer Quetschmühle zusammen sind sie allerdings nur einmal beobachtet, fehlen aber an Stellen, wo man steinzeitliche Ansiedelungen zu Wohnzwecken vermuthet, selten. Von neueren Erwerbungen seien hier erwähnt:
Schwerin. Am Küchengarten, an der Stelle einer " Feuersteinmanufaktur". Geschenk des Herrn Stargard 1884. ( Gr. S. L II H. 6.)
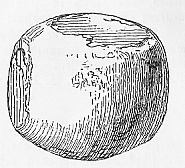
Lübz. 9 Exemplare zusammen gefunden. Geschenk des Herrn Pastor Dr. Krüger in Kalkhorst 1890. (Gr. S. L. II H. 12-21.)
Alt=Steinhorst. Mit zahlreichen Steingeräthen von einer "Feuersteinmanufaktur", 2 Stücke. Geschenk des Herrn Grafen A. Bernstorff 1884. (Gr. S. L. II H. 7, 8.)
Goldberg. In der Lüschow (Torfmoor) mit Thongeräthen, an einer Stelle, wo ein Pfahlbau vermuthet wird. Geschenk des Herrn Bürgermeister Dr. König 1896. (Gr. S. St. 24.)
Außerdem Einzelfunde von Tessenow bei Parchim, Gressow bei Wismar, Dämelow bei Brüel, Wismar (Hassburg), Triwalk bei Wismar.
Wegen dieser Sandsteinplatten, die zum Glätten der Feuersteingeräthe und dergleichen dienten, sei auf Lisch, Jahrb. 30,
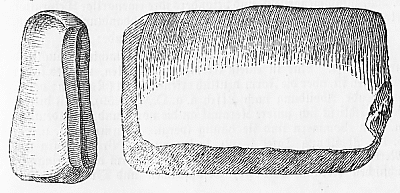


|
Seite 78 |




|
S. 31, verwiesen, wo zwei Arten, die "keulenförmigen" und "flachen" unterschieden werden. Auch diese Geräthe sind in Wohnstellen, aber auch in Hünengräbern beobachtet worden. An neueren Funden sei erwähnt:
Bülow bei Rehna. Gefunden in dem Moor "ollen Bülow", wo ein Pfahlbau vermuthet wird. Unregelmäßig vierseitig, röthlichbrauner Sandstein. Geschenk des Herrn Burmeister in Bülow 1897. (Gr. S. L. II G. 8.)
9. Keramik.
Die Töpfereiprodukte, der (jüngeren) Steinzeit haben einen scharf ausgeprägten Stil, der sie nicht nur von denen der anderen vorgeschichtlichen Perioden bestimmt scheidet, sondern auch eine Anzahl lokaler Gruppen in den verschiedenen Ländern, wo eine Steinzeit bestanden hat, hervortreten läßt. Es ist eine Beobachtung von größter Tragweite, daß verwandte Züge sich in der steinzeitlichen Keramik weit entlegener Länder zeigen; sicherer wie an anderen Produkten lassen sich hier Kulturbeeinflussungen und Kulturübertragungen feststellen, Wir beschränken uns in unserer Uebersicht auf die Vorführung des Meklenburgischen Materials, und verzichten auf die lockende Aufgabe, der Entstehung unserer Formen und Ornamente aus verwandten in anderen Gebieten nachzugehen. Meklenburg zeigt auch hier den engsten Zusammenhang mit der dänischen Steinzeit, ist aber von mitteldeutschen Typen nicht unbeeinflußt geblieben, und nimmt so eine vermittelnde Stellung zwischen mitteldeutscher und nordischer Keramik ein.
Die steinzeitlichen "Urnen", wie man damals sagte, während wir heute das Wort Urne auf ein Grabgefäß (Behälter der Leichenbrandreste) beschränken, sind von Lisch schon im Jahrb. 10, S. 253, zusammengestellt, und besonders ihre eigenartige Dekoration betrachtet, Für die Einzelheiten sei auf diese Abhandlung verwiesen. An Formen scheiden sich besonders folgende:
1. Amphoren. Gefäße mit kugeligem, abgeflachtem Bauch und kurzem Halse. Nur in einem Exemplare vertreten, welches leider zerbrochen ist, aber die Form deutlich erkennen läßt (Remlin; vergl. umstehende Abbildung nach Lisch a. a. O., S. 259). Mit diesem Gefäße schließt sich unsere Keramik an die nord= und mitteldeutsche an. In Pommern sind sie häufig (vergl. Schumann a. a. O., S. 16, Abbildung Tafel I. 32), treten auch in Brandenburg auf (Merkbuch II. 17) und bilden dann eine Hauptform der thüringisch=sächsischen Keramik (Goetze, Gefäßformen und Ornamente der


|
Seite 79 |




|
Schnurkeramik im Saalgebiet, S. 32 flgd.), allerdings mit dem wesentlichen Unterschiede, daß dort die Henkel nur selten zwischen Bauch und Hals sitzen, wie bei uns. Wie es scheint, stellt unserExemplar die nordwestlich Fundstelle dieses Typus dar.
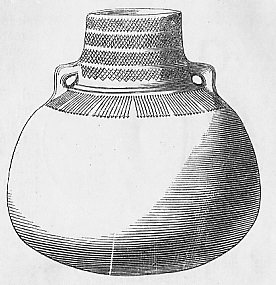
2. Krüge. Gefäße mit kugeligem Bauche, Stehfläche, hohem Halse und Henkeln. Eine Verwandtschaft mit der Amphorenform ist unverkennbar. Wir besitzen drei fast gleiche Exemplare aus den Hünengräbern von Molzow und ein etwas abweichendes aus dem Hünengrabe von Helm. Beide Gräber (Molzow Steinkiste; Helm Langhügel ohne Steinhaus) scheinen dem Ende der Steinzeit anzugehören. Die Verbreitung dieser Form ist gerade die entgegengesetzte wie die der ersten; sie findet sich hauptsächlich in Dänemark (Müller R. A., S. 67, Abbildung 36. Ordning Abbildung 229), vereinzelt in Schleswig=Holstein (Mestorf Abbildung 132); südlicher tritt eine ähnliche Form auf mit einem starken Henkel, die im Norden nur vereinzelt vorkommt (z. B. Schleswig=Holstein: Mestorf 135, Brandenburg: Voß=Stimming Tafel 72, Westfalen:
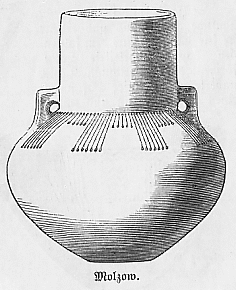


|
Seite 80 |




|
Lindenschmit A. u. f. V. I. II. 4, 2.)
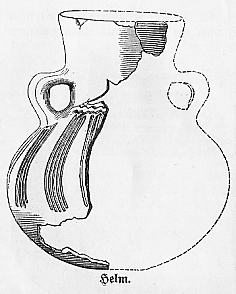
3. Schalen. Geräthe mit schmaler, oft gerundeter Standfläche, starker Ausbauchung, eingezogenem Halse und weiter Oeffnung.
a. Ohne Henkel. Ostorf bei Schwerin. Auf der Insel im See wurde seit 1877 eine steinzeitliche Station aufgedeckt, über deren Charakter nicht volle Klarheit erlangt ist. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Wohn=, nicht Grabstätte, und die Schädel sind jüngere Veimengung (vergl. Lisch, Jahrb. 44, S. 69 und über die Schädel Merkel, Jahrb. 49, S. 1). - Sehr schönes Exemplar, tiefschwarz, Höhe 13, Breite 16 cm. (Gr. S. St. 15.)
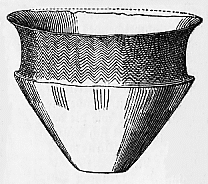
Müller bildet 220. 222 ähnliche Formen ab und erklärt sie für dänische, aus dem folgenden Typus abgeleitete Lokalformen; eine Abweichung ist auch unverkennbar; unser Gesäß hat einen spitzeren Fuß und nähert sich dadurch der unten zu besprechenden Becherform.
b. Mit Henkel. Ostorf. Gefunden zusammen mit dem vorigen. Ebenfalls sehr schönes, leider zerbrochenes Exemplar, die Ornamente in Tief=
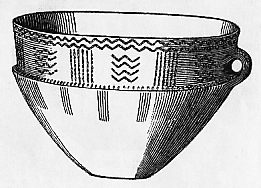


|
Seite 81 |




|
stich mit Kanal, anscheinend imitirtes Schnurornament. Höhe 12, Weite 18, Standfläche 5 cm.
Dieser Form gehört wohl auch das sehr große zerbrochene Gefäß von Tatschow (Hünengrab, s. Abbildung nach Lisch a. a. O., S. 257) an.
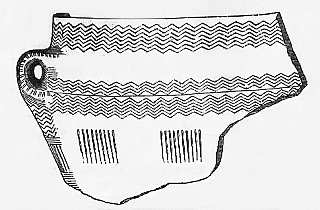
Die Verbreitung dieses Typus ist eine viel größere wie die des ersten. Müller, Abbildung 219, erklärt ihn für eine ältere norddeutsch= dänische Form (aus Schleswig= Holsteins. s. Mestorf, Abbildung 134. Hannover Lindenschmit A. u. f. V. I. III. 4, 9). Nach Süden bietet z. B. der von Goetze, Ztschr. f. Ethn. 1892, S. (182), abgebildete Krug von Tangermünde eine Analogie und ein Bindeglied zu dem "Bernburger" Typus der Gegend an der unteren Saale.
4. Töpfe. a. Mit gleichmäßiger Wandung (kein Bauchrand). Blengow bei Neubukow. Aus dem Jahrb. 37, S. 139 beschriebenen interessanten Hünengrabe. Nur zur Hälfte erhalten; leicht gebogene Wandung; kein Bauchrand; gerade Standfläche. Höhe 14, Weite ursprünglich etwa 11, Standfläche 8 cm. Aus dem Nachlaß des Herrn Baumeister Thormann geschenkt von Herrn Architekt Thormann 1894. (Gr S. St. 12.)
b. Mit Bauchrand. Dahin gehört zunächst eine schlanke Form mit hochliegendem Bauchrande und eingezogenem Halse, von der zwei Exemplare aus den Hünengräbern von Prieschendorf (vergl. die Abbildung nach Lisch a. a. O., S. 260) und Maßlow vorliegen.
Ferner eine rundliche Form mit Henkeln an den Seiten und abgerundetem Fuße, die als Tragtopf benutzt sein wird.
Blengow. Fundverhältnisse und Erwerbung wie oben. Schwacher Bauchrand; zwei seitliche Henkel Tannenwedel=


|
Seite 82 |




|
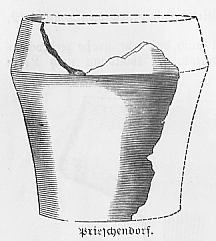
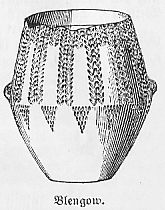
ornament in Tiefschnitt am oberen, Dreieckornament desgl. am unteren Theile. Höhe 13, Weite 8 1/2 cm.
Ein ganz ähnliches Exemplar haben wir aus Steinhagen (Hünengrab). Die Form ist nicht häufig. Müller giebt Abbildung 231 ein Stück und bezeichnet die Form als selten in Dänemark und dort nur ohne Verzierungen vorkommend. Aus Schleswig=Holstein Mestorf Abbildung 145.
Rundlicher ein weiteres Exemplar. Penzin bei Bützow. Gefunden 1869 in einem Torfmoor. Sehr hübsches Gefäß, leider fehlen große Stücke des oberen Theiles; runder Leib, kleine eingebogene Standfläche; der Hals scharf ansetzend, darunter eine Rille, die wohl zum Tragen diente; nur ein (kleiner) Henkel erhalten, ursprünglich wohl vier, je 2 zusammen. Das Verzierungssystem zeigt die Abbildung. Die Ornamente sind tief eingestochen. Höhe noch 11, obere Weite 12 cm. Geschenk des Herrn Amtsschreibers Brunkow in Schwerin. (Gr. S. L. I. A. 1 b 6.)
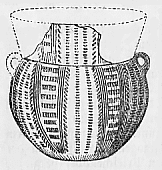
Aehnlich scheint ein Gefäß gewesen zu sein, von dem leider nur eine Scherbe gefunden ist:
Puchow bei Penzlin. Auf der Halbinsel "Heuwerder" findet sich eine starke Kulturschicht wendischer Ueberbleibsel, welche Verfasser im März 1894 mit freundlicher Unterstützung des


|
Seite 83 |




|
Herrn von Maltzan auf Puchow einer vorläufigen Untersuchung unterzog. Mitten zwischen jungwendischen Scherben kam die steinzeitliche zu Tage. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob, wie zu vermuthen, hier auf den Trümmern einer steinzeitlichen Pfahlbauansiedlung spätere Generationen gesiedelt haben. Die Scherbe ist dadurch interessant, daß sie das echt meklenburgische Hängeornament (s. unten Abbildung 86) in der uns fremdartigen Ausführung durch Schnurornament zeigt.
c. Hängegefäße. Blengow. Kleines Gefäß mit zwei seitlich durchbohrten Henkeln und spitzem Fuße, aus demselben Grabe wie die beiden oben genannten. Bei uns nur dieses Gefäß.
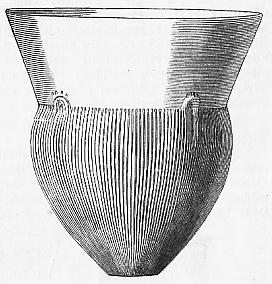
Vergl. Müller, N. A., S. 153, Ordning 231. In Dänemark gehören sie zu den häufigeren Gefäßen in Hünengräbern.
5. Becher. Zwei sehr verschiedene Formen.
a. Große Becher mit spitz zugehendem Fuß und weiter Mündung; der Hals scharf ansetzend.
Goldberg. Gefunden beim Torfstechen in der Lüschow; nicht weit davon ein kleines Henkelgefäß und ein Reibstein, Kleiner und einfacher als die meisten Exemplare dieses Typus; ganz schwarz. 9 1/2 cm hoch, 11 cm breit. Geschenk des Herrn Bürgermeister König 1895. (Gr. S. T. 1 a 26.)
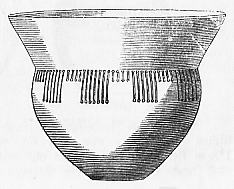


|
Seite 84 |




|
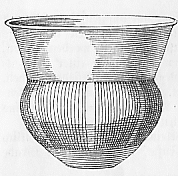
Aehnlich sind zwei Formen aus Molzow, s. vorstehende Abbildungen (im ganzen vier Exemplare); dahin gehört auch eins aus einem Hünen grabe von Neukalen und dem Pfahlbau von Wismar (nebenstehend abgebildet). Die Form scheint eine meklenburgische Lokalform zu sein, wenigstens zeigen die aus Dänemark (Müller R. A., S. 153, Abbild. 78, Mitte) und Schleswig=Holstein (Mestorf 147) abgebildeten Stücke nur Aehnlichkeiten Ein ferneres Exemplar von Molzow gleicht fast dem von Goetze, Ztschr. s. Ethn. 1892 (S. 178) abgebildeten becherartigen Gefäße von Warnitz in der Neumark, welches dort mit gutem Rechte als jungsteinzeitlich bezeichnet ist. Auch die Grabform der Molzower Gräber weist auf eine relativ junge Zeit; wir dürfen demnach diese Becherform überhaupt als jünger ansprechen.
b. Kleine Becher mit eingebogener Wandung ("geschweifte Becher").
Zickhusen bei Schwerin (s. beistehende Abbildung). Gefunden in einem großen Begräbnißplatze; verziert mit einem Bande aus sich schneidenden Linien, darunter zwei unregelmäßige Längslinien, die eine ein "imitirtes Schnurornament." Höhe 12, obere Weite 10 cm. (Gr. S. L. I. B. 1 b. 44.)
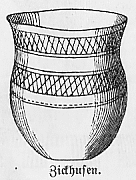
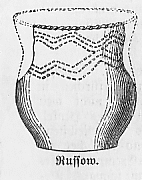
Russow bei Neubukow. Gefunden in einer kleinen quadratischen Steinsetzung von vier 60-80 cm hohen Steinen, die 1 1/2 m tief unter dem Boden auf einem Steinpflaster stand und auch nach oben durch ein Steinpflaster geschlossen war, also


|
Seite 85 |




|
wohl eine unterirdische Grabkammer jüngster Steinzeit. Das Gefäß (Abbildung vorstehend) ist halb zerbrochen, 7 cm hoch und ursprünglich wohl ebenso weit. Geschenk des Herrn Landrath von Oertzen 1896, (Gr. S. St. 22.)
Außerdem Fragmente aus Hünengräbern von Pampow und Kuppentin, mit echtem Schnurornament, sowie aus der Feuersteinmanufaktur von Damerow.
Der geschweifte Becher hat wohl das größte Verbreitungsgebiet von allen steinzeitlichen Gefäßen. (Vergl. Tischler, Schriften d. physik=ökon. Gef. in Königsberg 1883, S. 115; weitere Literatur bei Goetze, Gefäßformen u. s. w., S. 64; ferner Müller, N. A., S. 197.) Dieselbe Form findet sich in Portugal, Sizilien, Oesterreich, Mittel= und Norddeutschland, Dänemark und England. Zugleich aber ist deutlich, daß gewisse Verbreitungscentren hervortreten: in Deutschland besonders das Saalegebiet (Goetze a. a. O.), wo die Form einer älteren Periode angehört; von da ist sie in das ostbaltische Gebiet übertragen und gehört dort der jüngeren Periode an (vergl. für Pommern Schumann a. a. O., S. 16). Im westbaltischen Gebiete treten sie nur vereinzelt auf. Für Schleswig=Holstein s. Mestorf Fig. 131, 136 aus Hügelgräbern jüngeren Charakters, für Dänemark Müller a. a. O. und Ordning 225.
Ebenso eigenartig wie die Form der steinzeitlichen Gefäße ist ihre 0rnamentirung. Schon die Ausführung derselben zeigt einen besonderen kraftvollen Charakter; es lassen sich vier Verfahrungsarten scheiden: der einfache Tiefstich mit zugespitztem Holzstäbchen; der "Tiefstich mit Kanal" (so nach Virchow, Goetze a. a. O.), indem ein seichter Kanal gezogen und innerhalb dieses die Stiche neben einander eingedrückt sind; ferner der seichte Strich und schließlich das Schnurornament, die durch eine eingedrückte Schnur hergestellte Verzierung; diese Verzierung ist auch durch Stichverfahren nachgeahmt (imitirtes Schnurornament).Aus Form= und Fundverhältnissen geht hervor, daß seichte Striche und Schnurornament hier im allgemeinen einer jüngeren Periode angehören.
Der Form nach scheiden wir horizontale und vertikale Linienmotive und plastische Verzierungen.
1. Horizontale; durchaus überwiegend, bandartig den oberen Theil des Gefäßes, Hals und Bauchrand umlaufend.


|
Seite 86 |




|
a. Stichband; zum Theil aus einfachen vertikal geführten Stichen, wie z.B. von Ostorf (s S.80) oder von Stichen mit schrägem Seitenstrich wie von Prieschendorf. (Abbildung).
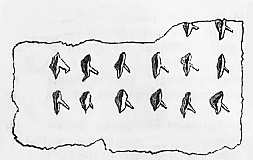
b. Band von senkrechten Parallellinien, zum Theil mit freiem Raum dazwischen, zum Theil größere und kleinere wechselnd. Dieses besonders häufige Motiv (Hängeornament) scheint eine Meklenburg eigenthümliche Verzierung zu sein(vgl. Goetze, Gefäßformen, Tafel II, 54.)
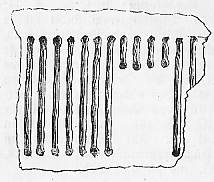
c. Dreieckband; auch häufig, z. B. von Lübow und Blengow; von mitteldeutschen Formen bei Goetze am angeg. Orte 34-36, 37 wesentlich dadurch unterschieden, daß hier die Dreicke nie mit Linien umrissen sind.
d. Zickzackband; sehr verschiedenartig, oft einfach (Lübow, Steinhagen u. s. w.), oft mehrfach (Tatschow, Ostorf u. s. w.), vgl. Goetze a. a. O., 28; einmal weit ausgezogen, fast an Schnurornament erinnernd,(Russow, siehe oben die Abbbildung) vgl. Goetze a. a. O. 29. Für hier alleinstehend ein Gefäß von Mestlin, wo das große Dreieckband die Innenseite des Gefäßes (Schale) bedeckt (s. umstehende Abbildung).
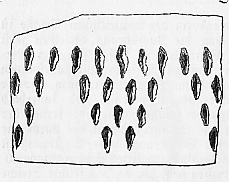
e. Sparrenband (Lisch "Schuppenband"); in verschiedenen umstehend wiedergegebenen Formen wiederkehrend: Prieschendorf, Lübow, Remlin; ähnlich Alt=Sammit, Blengow, Mestlin.


|
Seite 87 |




|
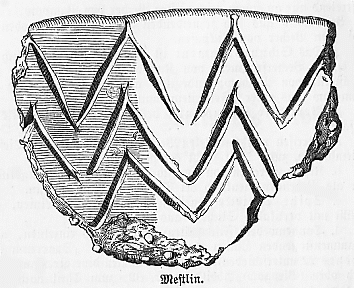
Alle diese Verzierungen sind in Tiefstich ausgeführt (mit Ausnahme der Schale von Puchow).
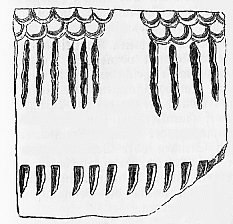
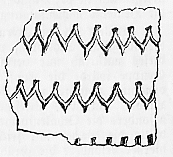
f. Aus siechten Strichen besteht eine andere Art "Sparrenband" gleich dem "Fischgräten=" oder "Tannenwedel"= Muster, vergl. Goetze 15,
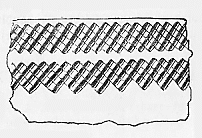


|
Seite 88 |




|
auftretend nur an einem geschweiften Becher von Pampow; ebenso ein Bandmotiv aus sich schneidenden Linien, an dem oben abgebildeten Becher von Zickhusen.
g. Das Schnurornament ist hier sehr selten; deutlich nur an einem Becherfragment von Kuppentin (5 Reihen) und dem Gefäßreste von Puchow; undeutlich an einem Becherreste von Damerow (aus einer "Feuersteinmanufaktur").
2. Vertikale Ornamente; besonders am Bauchtheile des Gefäßes.
a. Streifen von parallelen Vertikallinien, zum Theil Tiefstich (Steinhagen), zum Theil seicht gezogen (Molzow).
b. kleine Streifen von eingestochenen parallelen Längslinien; nur als Nebenornament, so bei Steinhagen und Penzin.
c. Spitze Dreiecke umrissen von mehreren Linien, ausgefüllt mit vertikalen Stichen; aus Penzin.
d. Tannenwedel (Fischgräten)=Muster aus einzelnen, nicht zusammenstoßenden Linien (dadurch von dem "Sparrenmuster" Goetzes 22 unterschieden); die kleinen Linien divergiren zum Theil nach oben (Blengow) Abbildung S. 82, zum Theil nach unten (Lübow).
3. Plastische Ornamente sind sehr selten: das in andern Ländern so häufige Knötchen haben wir nur einmal (Mestlin); gelegentlich ist der Rand eingekerbt (z. B. Russow); einmal sind die Henkel ornamental angedeutet (Molzow).
Wollen wir auf Grund der angegebenen Kennzeichen eine chronologische Scheidung unserer Keramik vornehmen, so kann dieses natürlich nur vermuthungsweise geschehen. Die älteste Gruppe würde die Topf= und Amphorenformen mit Tiefstichornament umfassen und besonders durch die Gräber von Blengow, Lübow, Tatschow, Prieschendorf charakterisiert sein, eine zweite besonders die Schalenformen, wie auf der Ostorfer Seeinsel, eine dritte die Becher mit seichten Strichen oder Schnurornament; hierher besonders die Gräber von Molzow, Helm, Zickhufen und andere, Daß die Grabformen dieser Ordnung entsprechen, wird in einer späteren Abhandlung, welche die Gesammtfunde zum Gegenstande hat, nachgewiesen werden.
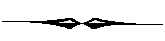


|
Seite 89 |




|



|



|
|
:
|
II.
Das Bündniß Karls des Großen
mit den Abodriten.
Von
Oberlehrer Dr. Richard Wagner.
~~~~~~~~~~~~
D ie Generalversammlung des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, die am 12. Juli 1880 stattfand, eröffnete der damalige zweite Secretair des Vereins, Archivrath Dr. Wigger, mit den Worten: "In der Generalversammlung desjenigen Vereins, der sich die Erforschung und die Pflege der Landesgeschichte zur Aufgabe gestellt hat, ziemt es sich im Jahre 1880 daran zu erinnern, daß die quellenmäßige Geschichte von Meklenburg mit dem Jahre 780 beginnt, sie mithin eben jetzt ihr 11. Jahrhundert abschließt und ihr 12. anhebt." Die historische Thatsache, auf die Wigger hier anspielt, ist das Bündniß Karls des Großen mit den Abodriten, das in den meisten Werken und Handbüchern über meklenburgische Geschichte, so schon von Rudloff (I, 10) und Lützow (I, 16 und 18), auch von L. Giesebrecht in seinen Wendischen Geschichten (I, 97) und noch jüngst in der zweiten Auflage der Meklenburgischen Vaterlandskunde von Quade (III, 27) in das Jahr 780 gesetzt wird. Indessen findet diese Ansetzung in den Geschichtsquellen nur eine unsichere Stütze, die neuerdings dadurch noch schwankender geworden ist, daß die Quellenstellen, auf denen sie beruht, unter den deutschen Geschichtsforschern eine völlig veränderte Erklärung und Auslegung gefunden haben. Daraus erwächst unserer heimischen Forschung die Pflicht einer nochmaligen Prüfung. Zu dieser wollen die folgenden Erörterungen Gelegenheit geben, zugleich erstrecken sie sich auf die weitere Geschichte des Bündnisses, die bisher nicht die verdiente Beachtung gefunden haben dürfte, und suchen, soweit


|
Seite 90 |




|
das vorliegende Material es gestattet, die Fragen zu beantworten, was die Veranlassung zu dem Bündniß gewesen, was der Inhalt der ursprünglichen Verabredungen gewesen sein mag, ob sich spätere Aenderungen derselben nachweisen lassen, ob überhaupt eine Entwickelung in dem Verhältniß der Abodriten zu Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen zu beobachten sei, und wie und aus welchen Gründen sich dann der Abfall der Abodriten vom Frankenreich vollzogen habe.
I. Das Abschlußjahr des Bündnisses.
Die Quellenstellen, auf die sich die bei uns herkömmliche Ansetzung des Bündnisses ins Jahr 780 gründet, hat Wigger in seinen "Meklenburgischen Annalen" S. 1 zusammengestellt. Es sind die folgenden:
1. Annal. Laurissenses 780: Nachdem Karl bei Orhaim (Ohrum an der Ocker) die Barden und viele der Nordleute, die dort zu ihm kamen, hatte taufen lassen, zog er an die Elbe, ubi Ora confluit (Ora=Ohre, sie mündet einige Meilen nördlich von Magdeburg), ibique omnia disponens tam Saxoniam quam et Sclavos, et reversus est in Francia. Der hier in Betracht kommende Theil der Annal. Lauriss. ist erst einige Jahre nach den Ereignissen, wahrscheinlich 788, niedergeschrieben (s. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I 6 195), beruht aber auf gleichzeitigen Aufzeichnungen, die gleich den Annal. Lauriss. selbst, am fränkischen Hofe entstanden zu sein scheinen; die Annalen sind also auch in ihrem ersten Theil eine Geschichtsquelle ersten Ranges. Leider verrathen sie uns nicht, wer die Slaven waren, auf die sich Karls ordnende Thätigkeit bezog, und worin diese bestand. In diesen Beziehungen werden sie durch die sogenannten Annales Einhardi ergänzt, in ihrem älteren Theil eine (von Einhard?) am Hofe Karls ums Jahr 801, nach dem letzten Herausgeber allerdings erst zwischen 830 und 840 (s. Kurze, Neues Archiv 21, I 9 ff.) verfaßte Ueberarbeitung der Laurissenses, die jedoch mancherlei neue, aus verloren gegangenen schriftlichen Quellen oder aus mündlicher Erkundigung stammende Nachrichten enthält:
2. Annales Einhardi 780: Profectus inde (d. h. von Orhaim aus) ad Albiam, castrisque in eo loco, ubi Oraet Albia confluunt, ad habenda stativa conlocatis, tam ad res Saxonum, qui citeriorem, quam et Sclavorum, qui ulteriorem fluminis ripam incolunt, componendas


|
Seite 91 |




|
operam impendit. Quibus tunc pro tempore ordinatis atque dispositis in Franciam reversus est. Nach Einhard sollen es also die Slaven jenseits der Elbe gewesen sein, deren Verhältnisse Karl zu ordnen suchte.
3. Die Annales Mosellani und Laureshamenses, zwei mit einander eng verwandte kürzere Annalenwerke, die, wenn auch nicht gleichzeitig mit den Ereignissen niedergeschrieben, doch auf guten gleichzeitigen Aufzeichnungen beruhen (s. Wattenbach I 6, 143 ff.), enthalten die folgende Notiz: Ann. Mosell. 780 (die Stelle ist in Wiggers Annalen S. 129b Anm. 1 nachgetragen): nec non et Winidorum sen et Fresionum paganorum magna multitudo ad eum conversa est.
Annal. Lauresham. 780: nec non et Winidorum seu Fresonum paganorum magna multitudo credidit; für credidit setzt das Chronicon Moissiacense eine Compilatilon, für die außer andern Werken auch die Annal. Laureshamenses benutzt sind - geradezu baptizata est ein, doch kommt diese Chronik als selbständige Quellenschrift ebenso wenig in Betracht, wie die Ann. Lobienses, die die Notiz der Mosellani und Laureshamenses mit der der Laurissenses über die Nordleute in den Worten zusammenfassen: nec non et Winidorum seu et Frisonum et Nordleudorum multitudo credidit. Wohl aber verdient noch Beachtung ein Annalenwerk, das Wigger noch nicht bekannt war.
Die Annales Maximiani, eine um 811 verfaßte Compilation (s. Wattenbach I 6 146 f., Mon. Germ. S. S. XIII, 19 ff.), die zum Jahre 780 die Worte enthält: et tunc Winedorum atque Fresonum multitudo magna credere se Domino spoponderunt. Zweifellos geht diese Notiz auf dieselbe Quelle zurück, wie die der Mosell. und Lauresh., vermuthlich auf eben die verlorenen Hofannalen, die man als gemeinsame Quelle der Mosell. und Lauresh. erkannt hat. In Fassung wie Inhalt von dieser Quelle unabhängig sind dagegen
4. die Annal. Petaviani, die den Ereignissen gleichzeitig verfaßt sind, in ihnen heißt es zum Jahre 780: et venerunt ad dominum regem multa milia Winethorum hominum: ipse autem adquisivit una cum Dei auxilio. Es fehlen hier die Friesen, die in den Ann. Mos., Lauresh. und Maxim. genannt sind.
Eben diese Zusammenstellung von Friesen und Wenden hat das Befremden der Quellenforscher erregt. Nun findet sich dieselbe Zusammenstellung auch in den Fortsetzungen des Fredegar zum Jahre 747 (s. Fred. cont. c. 117), wo erzählt wird, daß dem König Pippin auf einem Feldzuge gegen die Sachsen (s. über


|
Seite 92 |




|
diesen noch die Ann. Einh. und Mettenses) reges Winidorum seu Frisionum zu Hülse gekommen seien. Auf diesem Feldzuge rückte Pippin durch Thüringen nach Norden in den Nordschwabengau (zwischen Bode und Unstrut). Hier zwischen dem sächsischen Nord und dem fränkischen Südthüringen lagen zwei Gaue mit den Namen Frisonofeld und Winidongo. Da es nun unwahrscheinlich ist, daß Friesen von der Nordseeküste zu Pippin in den Nordschwabengau gekommen sind, so hat man unter den Wenden und Friesen bei Fredegar die Bewohner der beiden thüringischen Gaue Friesenfeld und Wendengau verstanden, so besonders Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reiches 741-752, Berlin 1863, S. 93 und Excurs XXII. und Richter, Annalen des fränkischen Reiches im Zeitalter der Merovinger, Halle 1873, S. 213b.
Dieses Forschungsresultat ist nun auf die Friesen und Wenden des Jahres 780 übertragen worden, zuerst von Kentzler (Forschungen zur deutschen Geschichte XII., S. 348, Anm. 4). Nach dieser Auffassung sollen also im Jahre 780, als Karl an der Elbe stand, die Bewohner des Wendengaues und Friesenfeldes -.auch diese hält Kentzler mit Hahn für Wenden, durch welche die früheren friesischen Bewohner des Gaues verdrängt seien in großen Schaaren zu ihm gekommen sein, sich ihm unterworfen haben und an Ort und Stelle getauft sein. Die Nachricht der Ann. Einhardi bezieht Kentzler (S. 347 f.) auf Ordnung von Grenzstreitigkeiten zwischen den Sachsen und den Wenden jenseits der Elbe, wobei zugleich Karl den Wenden sich als ihr Nachbar im Glanze seines Heeres gezeigt habe. "Dabei, meint Kentzler, werden die Slaven dem Könige insoweit Gehorsam gelobt haben, als sie versprechen mußten, jede Ueberschreitung fränkisch=sächsischen Gebiets auf immer meiden zu wollen."
Nach Kentzler schildern also die Ann Einh. ein ganz anderes Ereigniß als die kleineren Annalen, jene die Beilegung von Grenzstreitigkeiten zwischen den Sachsen und den rechtselbischen Wenden, diese die Bekehrung zweier linkselbischen wendischen Gaue. Kentzlers Deutung der Stellen aus den kleineren Annalen billigen Richter und Kohl, Annalen der deutschen Geschichte II., S. 74 und Mühlbacher, Regesta imperii I., S. 85 f. N. 222b (s. 748, S. 27 N. 55d), in Bezug auf die Notiz der Ann. Einh. gehen sie noch einen Schritt über Kentzler hinaus, indem sie sie überhaupt für irrthümlich halten. Richter sagt: "Unter den hier (780) genannten Friesen können nur die Bewohner des sogen. Friesenfeldes zwischen Saale und Unstrut gemeint sein, unter den Wenden nur die des Wendengaues nahe der Unstrut.


|
Seite 93 |




|
An eine Unterwerfung der Slaven jenseits der Elbe, welche aus dem Zusatz in den Ann. Einh. geschlossen werden könnte, ist durchaus nicht zu denken. Aehnlich Mühlbacher, doch mit einer kleinen Nuance in Bezug auf die Winidi der Mosell.-Lauresh.: "Die hier genannten Fresiones sind die Bewohner des Friesenfeldes, die Wenden wohl zunächst jene des Wendengaues an der Unstrut. Der Zusatz der Ann. Einh., betreffend die Slaven, der offenbar nur eine geographische Erläuterung geben will, wird in diesem Falle geradezu zu einem Irrthum; von einem Christenthum oder einer Abhängigkeit unter den Slaven jenseits der Elbe noch keine Spur". In Uebereinstimmung hiermit heißt es in Mühlbachers deutscher Geschichte unter den Karolingern, Stuttgart 1896, S. 124: Auch die noch slavischen Bewohner des Friesenfeldes und des Wendengaues, der Gegenden nördlich der Unstrut bis zur Saale, ließen sich taufen. "Nachdem er alles sowohl bei den Sachsen als bei den Slaven geordnet hatte, kehrte er zurück" - das ist der wortkarge Bericht des Reichsannalisten über die von Karl getroffenen Maßregeln."- Ueber die Frage, worin diese Ordnung der Verhältnisse bestanden haben könne, geht Mühlbacher stillschweigend hinweg und läßt den Zusatz der Ann. Einh., den er ja für irrthümlich hält, völlig unbeachtet. S. 136 heißt es dann: - "Als Karl (i. J. 789) den befreundeten Abodriten zu Hülfe zog" - wann diese Freundschaft, die doch im Jahre 789 schon bestanden haben muß, geschlossen sein mag, dieser Frage ist weder Mühlbacher noch Kentzler noch Richter näher getreten.
Entgegen diesen Forschern halten Abel und Simson, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem Großen, I 2, Leipzig 1888, S. 348, die Annahme, daß unter den Wenden und Friesen (des Jahres 780) lediglich die Bewohner des Friesenfeldes und des Wendengaues zu verstehen seien, für recht gewagt und nehmen keinen Anstand (S. 359 f.), das Bündniß Karls mit den Abodriten vermuthungsweise ins Jahr 780 zu setzen. Ich gestehe, daß ich mich ebenfalls der Ansicht Kentzlers nicht anzuschließen vermag, so wenig wie mich Hahns Ausführung überzeugt hat.
Was zunächst die Stelle bei Fredegar betrifft, so ist Hahn bei der Begründung seiner Ansicht in einige offenkundige Irrthümer verfallen. Er kennt Wenden nur an der Ostsee in Pommern, so wenigstens muß man aus seinen Worten schließen: "Hier wirklich Friesen anzunehmen, die nordwestlichen Nachbarn der Sachsen, und die Wenden im Nordosten dieses Landes, im heutigen Pommern (sie), wäre weit ausgeholt." Ferner


|
Seite 94 |




|
versteht er seu= "oder", es heißt aber "und", wie schon Platner (Forschungen zur deutschen Geschichte XVII., 424) gegen Hahn richtig bemerkt hat. 1 ) Wenn Hahn ferner die duces gentis asperae Sclavorum, die sich nach den Ann. Mettenses 748 mit Pippin vereinigt haben sollen, den reges Winidorum seu Fresonum bei dem Fortsetzer des Fredegar gleichsetzt und daraus folgert, diese Friesen seien in den Sclavi der Ann. Mettenses miteinzuschließen, sie seien also selbst Slaven gewesen, so erregt diese Gleichsetzung um so mehr Bedenken, als seu eben nicht oder, sondern und bedeutet, der Chronist also Wenden und Friesen als zwei verschiedene Nationen deutlich von einander unterscheidet. 2 ) Vollends liegt nicht der geringste Grund vor, unter den reges Winidorum nur die Fürsten des kleinen Wendengaues zu verstehen. Die Ann. Mettenses sprechen von einem wendischen Heere, von pugnatores quasi centum milia. Mag diese Zahl (s. übrigens quasi) auch noch so übertrieben sein, so muß es doch ein Heer von imponirender Stärke gewesen sein, so schwerlich also nur aus den wendischen Gauen diesseits der Saale, sondern mindestens noch ein Theil der Sorben von jenseits des Flusses, und vermuthlich auch wilzische Schaaren, denn es müssen -das dürfen wir aus dem Ausdruck unanimiter schließen- Angehörige verschiedener Stämme gewesen sein, die sich sonst nicht selten befehdeten, hier sich aber zur Bekämpfung der Sachsen einmüthig unter sich und mit Pippin vereinigten, die willkommene Gelegenheit zu einem Raub= und Beutezug gegen ihrem gemeinsamen Feind, die Sachsen, zu benutzen.


|
Seite 95 |




|
Mögen also die Friesen von der Nordseeküste stammen - sie müßten dann zu Schiffe die Weser oder Elbe aufwärts gefahren sein - oder, was wahrscheinlicher ist, aus dem Friesenfeld: Die Wenden auf den kleinen und obendrein von dem Friesenfeld durch andere unzweifelhaft germanische Gaue, den Helmegau und den Nebelgau, getrennten Wendengau zu beschränken, ist gegenüber der Schilderung der Ann, Mettenses durchaus unthunlich. (Ueber diese Annalen s. Ranke, Weltgeschichte V., 2, 292 ff. und bes. S. 300, wo Ranke das Urtheil fällt: "Ohne die Ann. Mettenses würde die ganze Begebenheit (d. i. eben der Sachsenfeldzug Pippins vom Jahre 748) unverständlich bleiben. Die Erwähnung der Nordschwaben und Slaven wirft allein ein gewisses Licht auf dieselbe.")
Noch weit unwahrscheinlicher aber ist, daß die Annalen im Jahre 780 mit den Wenden und Friesen, die sie nennen, die Bewohner dieser beiden kleinen thüringischen Gaue meinen sollten.
Kentzler sagt, von den Nordsee=Friesen sei nicht anzunehmen, daß sie zu Karl an die Elbe gekommen seien. Und doch fuhr eine Heeresabtheilung von eben denselben Friesen wenige Jahre später (789) auf Schiffen die Elbe hinauf bis in die Havel hinein, um am Feldzuge gegen die Wilzen theilzunehmen (s. Ann. Lauriss. 789): warum sollte da nicht eine Abordnung friesischer Gaue, an Karl gesandt, um einen etwa drohenden Angriff auf ihre Heimath durch Versicherung ihrer Unterwerfung zuvorzu=
Im Wendengau müssen, wie der Name beweist, wendische Niederlassungen zahlreicher gewesen sein als in den umliegenden Gauen, aber ist es denkbar, daß der Wendengau, der mit seiner Ostgrenze etwa 10 deutsche Meilen von der Saale entfernt zwischen germanischen Gauen eingesprengt liegt, zu irgend einer Zeit von einem geschlossenen wendischen Stamme unter wendischen Fürsten (reges!) bewohnt gewesen ist? Die Erklärung, die Wersebe (Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale u.s.w. S. 55) von der Entstehung des Gaunamens giebt, scheint mir sehr beachtenswerth: "In diesen Gegenden können wendische Dörfer wohl nur dadurch erwachsen sein, daß sie von einheimischen Gutsherrn durch slavische Leibeigene angebaut worden; daher denn auch keine eigentlich slavische Ortsnamen, sondern nur solche, die in deutscher Sprache andeuten, daß der Ort wendisch sei (z B. Wolfeswenden), hier vorkommen, welches sich in den Gegenden jenseits der Saale umgekehrt verhält." So hat Bonifacius ums Jahr 740 im Gebiete des Bisthums Würzburg, und des Klosters Fulda Slaven angesiedelt (s. Willebaldi Vita S. Bonifacii c. 24). Zu beachten ist noch, daß der Wendengau keinem der sächsischen Bisthümer unterstellt ward, sondern, und gewiß schon vor 780, zum Sprengel des Erzbisthums Mainz gehörte.


|
Seite 96 |




|
kommen, im Jahre 780 zu Schiffe die Elbe hinauf bis an die Ohremündung gelangt sein? Ueberdies geht meines Erachtens garnicht mit Nothwendigkeit aus den Annalen hervor, daß die Friesen 780 grade an der Elbe zu Karl gekommen seien. Die Annalen geben zunächst die Elbe als das letzte Ziel des fränkischen Zuges an und fassen dann dessen Resultat kurz zusammen, ohne Karls Aufenthalt in Ohrum von dem am Elbufer irgendwie zu unterscheiden, s. d. Lauresham.: pervenit usque ad fluvium Heilba et Saxones omnes tradiderunt se illi, es steht nicht da et ibi (an der Elbe), auch wissen wir aus den Lauriss., daß z. B. die Bardengauer und viele der Nordalbinger zu Karl nach Ohrum kamen und nicht an die Elbe. Es können also die Friesen schon in Ohrum Karl aufgesucht haben. Vielleicht sind Dithmarschen gemeint; daß diese zu den Nordalbingern gehört haben, die Karl im Jahre 780 ihre Unterwerfung anzeigten, läßt sich aus der Thatsache schließen, daß der Missionar Willehad, der eben im Jahre 780 in den Wigmodesgau (zwischen Weser und Elbemündung) gesandt ward, sehr bald darauf auch über die Elbe nach Dithmarschen Missionsgehülfen geschickt hat (s. Vita Willehadi c. 4 und 5, M. Germ. S. S. II. 382, s. auch Dehio, Geschichte des Erzbisthums Hamburg-Bremen, Berlin 1877, I. 15). Es muß dies vor 782 geschehen sein, denn 782 fällt ein Geistlicher in Dithmarschen unter dem Schwerte der Aufständischen (s. V. Willeh. c. 6). Die Sendung von Geistlichen aber setzt, wie Kentzler (a. a. O. S. 346, A. 1) richtig sagt, eine vorangegangene Unterwerfung voraus. Kentzler selbst rechnet denn auch die Dithmarschen zu den 780 vor Karl an der Ocker erschienen Nordalbingern. Warum sollten diese Dithmarschen nicht mit den Friesen der Annalen identisch sein oder wenigstens einen Theil von ihnen bilden? Denn es werden auch noch aus anderen friesischen Gauen damals Abordnungen vor Karl erschienen sein; von dem Rüstringergau (westlich der untern Weser) wenigstens müssen wir es aus demselben Grunde annehmen, wie von den Dithmarschen: auch hierhin sandte Willehad einen Gehülfen, der ebenfalls 782 dem Aufruhr erlag.
Und suchen wir einmal die Worte der Annalen in ihrem Gedankenzusammenhang zu erfassen! Die Annalen wollen einen kurzen Ueberblick geben über die gewaltigen Erfolge, die Karl im Jahre 780 in Sachsen gewonnen hat. Das ganze sächsische Volk liegt ihm zu Füßen, er ernennt Bischöfe, Presbyter und Aebte und weist ihnen ihre Sprengel zu, darin zu taufen und zu predigen. Auf den Satz, der diesen Gedanken enthält (et


|
Seite 97 |




|
Saxones omnes tradiderunt se illi divisitque ipsam patriam inter episcopos et presbyteros seu et abbates, ut in ea baptizarent et praedicarent), folgt unmittelbar der in Frage stehende: nec non et Winidorum seu Fresonum paganorum magna multitude credidit (so die Ann. Lauresh, die andern ähnlich, s. o.). Können die Annalen in diesem Zusammenhang mit den Winidi und Fresones etwas anderes meinen als die Völker der Wenden und Friesen im Unterschied von dem Volk der Sachsen? Drei verschiedene Völker haben sich im Jahre 780 der Macht des Frankenkönigs beugen müssen, die Sachsen und von den Friesen und Wenden wenigstens ein Theil Ist es an sich schon gewagt, die Benennung Fresones von den Bewohnern eines Gaus gelten zu lassen, die (nach Hahn) garnicht Friesen, sondern Wenden waren, so weist, meine ich, vollends der ganze Zusammenhang der Stelle die Beschränkung der Winidi und Fresenes auf die zwei kleinen thüringischen Gaue zurück, die Verfasser der Annalen haben sagen wollen: Auch von den (Völkern der) Wenden und Friesen bekehrte (oder unterwarf) sich ein Theil.
Und wenn wir von der Bekehrung der Wenden, die in den Annalen behauptet wird, vorläufig absehen, besteht denn irgend ein Bedenken, eine freiwillige Unterwerfung eines Theiles der Wenden, vermuthlich der Sorben und Abodriten, im Jahre 780 anzunehmen? Stimmt nicht vielmehr diese durch die kleineren Annalen nahe gelegte Annahme vortrefflich zu dem Ausdruck der Ann. Lauriss.: Karl habe alles geordnet, tam Saxeniam quam et Sclavos, und ebenso vortrefflich zu der Behauptung der Ann. Einh., Karl hätte die Verhältnisse auch der Wenden jenseits der Elbe geordnet, wobei doch als selbstverständlich vorauszusetzen ist, daß sie vor ihm erschienen und seinen Forderungen sich - für den Augenblick wenigstens - fügten, d. h. also im Annalenstil sich ihm unterwarfen?
Einhard - oder wer sonst der Verfasser der, Ueberarbeitung sein mag - zeigt sich über den Sorbenfeldzug des Jahres 782 wie über den Wilzenfeldzug des Jahres 789 vortrefflich unterrichtet, und wenn er bei diesem auf der einen Seite nicht jede Einzelheit der Laurissenses in seine Bearbeitung aufnimmt (so die Theilnahme der Friesen), so bringt er doch aus der andern Seite - und zwar gerade über das Wichtigste, den Verlauf des Feldzuges im feindlichen Lande - selbst werthvolle und unzweifelhaft richtige Ergänzungen bei (so die ganze Erzählung von Dragowit). Ist er 782 und 789 so gut unterrichtet, warum ihn da 780 des Irrthums zeihen? Ueberdies wird sein Zusatz vom Jahre 780


|
Seite 98 |




|
durch die Ereignisse der folgenden Jahre beglaubigt und gestützt. Denn wenn die Sorben 782 rebelles genannt werden (s. Ann. Lauriss.), so muß man doch aus dieser Bezeichnung schließen, daß sie bereits als subiecti angesehen werden. Nun haben die Thüringer und Sachsen seit Samos Zeit manchen Strauß mit ihren wendischen Nachbarn - in erster Linie also den Sorben -ausgefochten (s. Richter, Annalen I., zu dem Jahre 623, 630) und nach einer Nachricht, deren Richtigkeit allerdings bezweifelt wird, sollen sich die Sorben schon früher dem fränkischen Reiche angeschlossen haben (s. Fredeg. c. 68: Dervanus dux gentis Urbiorum, qui ex genere Sclavinorum erant et ad regnum Francorum iam olim adspexerant, s. aber Zeuß, die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837, p. 638) und erst infolge der Schlacht bei Wogastisburg im Jahre 630 zu Samo abgefallen sein. Jedenfalls aber haben sich Franken, Thüringer und Sachsen seit dieser Schlacht begnügt, ihre Grenzen gegen die Einfälle der Wenden zu schirmen, es ist, soviel wir sehen, kein Versuch zu deren Unterwerfung gemacht (s. Richter zu 632, 633 und 747), auch wird der Ausdruck rebelles vor 782 von ihnen nicht gebraucht. Die Sorben, wenn nicht alle, so doch ihre Grenzgaue, werden also 780 Friede und Gehorsam gelobt haben, sie werden zu den Wenden gehören, auf die sich Karls ordnende Thätigkeit bezog.
Man halte dem nicht entgegen, daß die Sorben ganz oder größtentheils links der Elbe wohnten, Einhard läßt unbeachtet, daß die Elbgrenze weiter nach Süden durch die Saalegrenze abgelöst wird, auch mögen die Verhandlungen Karls mit den rechtselbischen Wenden, den Wilzen und Abodriten, wichtiger erschienen sein als die mit den Sorben.
Daß Karl 780 auch zu den Wilzen und Abodriten in Beziehung getreten ist, legt uns ebenfalls der weitere Fortgang der Ereignisse nahe. Den Feldzug des Jahres 789 gegen die Wilzen unternahm Karl, wie Einhard in der Vita Caroli Magni ausdrücklich sagt, wegen der unablässigen Angriffe der Wilzen auf seine Verbündeten, die Abodriten, s. Vita c. 12: Causa belli erat, quod Abodritos, qui cum Francis olim foederati erant, assidua incursione lacessebant nec iussionibus coerceri poterant. Man vergleiche noch Ann. Einh. 789: Ea (das Volk der Wilzen) Francis semper inimica et vicinos suos, qui Francis vel subiecti (das sind die Sachsen) vel foederati (das können nur die Abodriten sein) erant, odiis insectari belloque premere ac


|
Seite 99 |




|
lacessire solebant und Ann. Einh. 798: Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Es hatte also das Bündniß zwischen den Franken und Abodriten schon eine Anzahl Jahre vor 789 bestanden. Der Ausdruck olim in Einhards Vita scheint nun seinen Abschluß in eine recht ferne Vergangenheit zu verlegen. Haben etwa schon vor Karls des Großen Zeit Beziehungen zwischen den Franken und Abodriten bestanden? Sollte etwa unter den Königen der Wenden, die 748 Pippin zu Hülfe ziehen, auch der Abodritenfürst gewesen sein? Wir wissen es nicht, und es ist auch nicht wahrscheinlich, denn das wendische Heer stieß zu Pippin, als er den Nordschwabengau betrat (s. Ann. Mettens. 747), noch südlich von Schöningen und Ohrum, also in weiter Entfernung vom Gebiet der Abodriten. Das olim (vor Alters) bei Einhard erklärt sich ungezwungen aus der Abfassung der Vita erst nach Karls Tod, es spricht nicht gegen das Jahr 780 als Abschlußjahr des Bündnisses.
Nun durchzog Karl nicht nur 780, sondern auch 783, 784 und 785 Sachsen bis an die Elbe (s. die Ann. Einh.), 783 nach den Siegen bei Detmold und an der Hase auf unbekanntem Wege, 784 durch Thüringen bis an die Saalemündung, 785 finden wir ihn sogar im Bardengau, dem Gebiet der Abodriten gegenüber. Hier hatte er freilich eine vortreffliche Gelegenheit zum Abschluß eines Bündnisses mit ihnen. Allein nur 780 ist in unsern Quellen von Verhandlungen mit den Wenden die Rede. Das Schweigen der Quellen ist freilich noch kein Beweis, daß nicht solche auch, 785 könnten stattgefunden haben, aber das werden wir aus diesem Schweigen schließen dürfen, daß die Verhandlungen des Jahres 780 mehr Aufsehen erregt haben und umfassender und wichtiger gewesen sind. Trotzdem führten sie nach dem Geständniß der Ann. Einh. nicht endgültig zum Ziele, dieses Geständniß blickt deutlich durch den vorsichtig gewählten Ausdruck protempore hindurch. Karl ordnete die Verhältnisse der Wenden, soweit es in der ihm noch zu Gebote stehenden Zeit möglich war; darin liegt die Andeutung, daß diese Ordnung noch nicht endgültig war, daß also seine Anordnungen nicht überall Beachtung gefunden haben, nicht dauernd bei den Sorben (s. oben) und auch nicht bei den Wilzen, die trotz der Befehle Karls die Abodriten zu bedrängen fortfuhren. Von solchen Befehlen (iussiones) ist 789 die Rede (s. oben d. Stelle aus der Vita c. 12), Der Plural iussioues ist dabei zu beachten, es scheint also mehrfach ein Befehl an die Wilzen ergangen zu sein,


|
Seite 100 |




|
Ruhe zu halten, gewiß einer 785, als Karl in der Nähe war, der erste vermuthlich 780.
Alles in allem: Ueber einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit kommen wir in dieser Frage, wie in so vielen andern historischen Fragen und ganz besonders solchen aus der von der Ueberlieferung so stiefmütterlich behandelten wendischen Geschichte, nicht hinaus, die überwiegende Wahrscheinlichkeit aber spricht für die Annahme, daß das Bündniß Karls mit den Abodriten im Jahre 780 abgeschlossen ist, als Karl an der Elbe stand und die Angelegenheiten Sachsens und seiner wendischen Grenznachbarn zu ordnen suchte. Unsere heimischen Geschichtsschreiber haben Recht, wenn sie mit dem Jahre 780 die meklenburgische Geschichte beginnen, und auch die Darsteller der deutschen Reichsgeschichte sollten, wenn sie der Beziehungen Karls des Großen zu den Wenden gedenken, kein Bedenken tragen den Abschluß seines Bündnisses mit den Abodriten ins Jahr 780 zu setzen.
II. Veranlassung und Inhalt des Bundesvertrages.
Welche Gründe und welche Erwartungen bestimmten nun Karl und welche die Abodriten zum Abschluß des Bündnisses? Wer hat die Initiative ergriffen? suchte Karl das Bündniß oder die Abodriten? War es ein Bundesvertrag mit gleichem Rechte oder schloß es von vorne herein eine Unterordnung der Abodriten in sich und welcher Art war diese?
Voll in seiner. meklenburgischen Geschichte (p 2) nimmt an, Karl habe sich jenseits der Elbe unter den Slavenstämmen Verbündete gegen die Sachsen gesucht. v. Lützow (Meklenburg. Gesch. I., 17) sagt, Karl hätte in den wendischen. Völkern das sicherste Mittel erkannt, die Sachsen an ihrer schwächsten Seite zu treffen.
In ähnlichem Sinne äußert sich auch Werner, Gründung und Verwaltung der Reichsmarken unter Karl dem Großen und Otto dem Großen, Programm, Bremerhaven 1895, S. 46: "Je länger der Kampf mit dem trotzigen Sachsenvolk dauerte, um so mehr erkannte Karl, daß es vor allem darauf ankam,. auch unter den kriegslustigen Slaven jenseits der Reichsgrenze Ruhe und Sicherheit herzustellen." Boll, Lützow und Werner nehmen also an, daß die Initiative von Karl ausging, der Verbündete gegen die Sachsen suchte.


|
Seite 101 |




|
Dem gegenüber ist zunächst zu bemerken, daß eine unserer Hauptquellen, die Ann. Petaviani (s. o.), ausdrücklich angeben, die Wenden seien zu Karl gekommen, nicht aber, er habe sie zu sich entboten. Doch wird man darauf kein Gewicht legen dürfen. Ob die Wenden oder einige unter ihnen aus freien Stücken kamen oder ob sie alle einer Aufforderung Karls folgten, wird nicht ausgesprochen. Wenn Wigger (Annalen p. 129a gegen Schafarik, slavische Alterthümer II., 517), der die an der Ohremündung erschienenen Slaven nur für Abodriten hält, geltend macht, daß zu einer Zusammenkunft mit den Abodriten allein jener Ort sehr unpassend gewählt sei, so ist das völlig richtig, desto besser aber eignet er sich für Verhandlungen mit allen drei Hauptstämmen der Wenden, den Abodriten, Wilzen und Sorben. Es ist nun möglich, daß die Abodriten aus freien Stücken Karl aufsuchten, doch ebenso möglich, daß Karl sie einlud, es wird sich also nicht ausmachen lassen, wer von beiden Theilen die Initiative zu den Verhandlungen ergriff. Was aber beiden Theilen den Bund als wünschenswerth erscheinen ließ, liegt auf der Hand. Die Abodriten erwarteten von dem Frankenkönig Schutz und Beistand gegen ihre unaufhörlichen Bedränger, die Wilzen, den sie allein nicht gewachsen waren. Und wenn Karl ihnen diesen Schutz versprach, so hatte er dabei neben dem idealen Motiv, daß es einem mächtigen Herrscher wohl ansteht, sich Bedrängter anzunehmen, gewiß auch sehr reale. Nur wird man nicht behaupten dürfen, daß er gegen die Sachsen im Jahre 780 Verbündete gesucht habe. Deren bedurfte es damals nicht, denn Karl hielt Sachsen für unterworfen 1 ) (s. die kirchlichen Einrichtungen und besonders das Aufgebot der Sachsen gegen die Sorben im Jahre 782, Ann. Einh.). Ueberdies bedurften ja die Abodriten selbst des Schutzes, und vorläufig war von ihnen schwerlich Hülfe gegen die Sachsen zu erwarten. Es handelte sich vielmehr für Karl um die Pflicht der neu gewonnenen Provinz seines Reiches auch befriedete Grenzen zu schaffen, damit die christliche Cultur ungestört ihren Einzug halten könne, sie


|
Seite 102 |




|
sicher zu stellen vor den räuberischen Einfällen der Wenden, insbesondere der Wilzen. Das war der Grund, weshalb er, in unmittelbarer Nähe des wilzischen Gebietes, am Elbufer mit seinem Heere Halt machte, das war der nächste Zweck der Verhandlungen, die er dort mit den Wenden pflog. Was konnte ihm da willkommener sein, als daß er unter den Wenden selbst eine Spaltung vorfand, deren kluge Benutzung ihm die Anwendung des Grundsatzes divide et impera möglich machte? Die Spitze des Bündnisses ist also nicht gegen die Sachsen, sondern gegen die Wilzen gerichtet gewesen, die durch die Sachsen und Abodriten in Schach gehalten werden sollten. Wenn später einmal (im Jahre 798) die Abodriten auch gegen sächsische Aufrührer fechten, so konnte Karl dies im Jahre 780 nicht voraussehen.
Selbstverständlich war das Bündniß kein Bund zweier gleich stehender Mächte. Eine solche Auffassung wird von vornherein durch den unermeßlichen Machtabstand des kleinen wendische Stammes von dem fränkischen Weltreich ausgeschlossen. Gewiß treffen Abel und Simson das Richtige, wenn sie sagen (Jahrbücher I., 360): "Welcher Art die Verbindung war, bleibt ziemlich dunkel, doch scheint sie als ein Schutzverhältniß ein gewisse Anerkennung der fränkischen Ober=Hoheit eingeschlossen zu haben."
Selbst wenn der Abodritenfürst im Jahre 780 keiner Huldigung oder Treuversprrchen geleistet haben sollte, so kann er selbst darüber nicht in Zweifel gewesen sein, daß sein Verhältniß zum Frankenkönige eine gewisse Unterordnung seinerseits in sich schließe. Wenn wir aber die oben angeführten Stelle der kleineren Annalenwerke zum Jahre 780 mit Recht vorzugsweise auf die Abodriten bezogen haben, so dürfen wir aus ihnen mindestens eine ausdrückliche Anerkennung der fränkischen Oberhoheit seitens der Abodriten folgern (s. bes. die gleich noch nähe zu besprechenden Wendungen adquisivit in den Ann. Petav, ad eum conversa est in den Ann. Mos.). Ein Theil de Annalen behauptet sogar eine Bekehrung der Wenden zum Christenthum.
Was ist davon zu halten? Hat vielleicht Karl den Abodriten, als er ihnen seinen Schutz versprach, die Verpflichtung auferlegt, der Predigt des Christenthums, wenn er ihnen Missionare sende, keinen Widerstand entgegenzusetzen, oder hat der Abodritenfürst mit seinem Gefolge, als er zu Karl kam, die Taufe genommen? Letzteres ist durchaus unwahrscheinlich, denn die Abodriten werden nicht lange darauf ausdrücklich als Heiden bezeichnet, s. Ann.


|
Seite 103 |




|
Lauresham. 798: quamvis illi Abotridi fanatici (das Wort bedeutet in der Sprache der Zeit Heiden) erant; auch daß Karl den Abodriten so wenig wie den übrigen wendischen Stämmen Missionare gesandt hat, ist zweifellos, doch könnte er im Jahre 780, als er Sachsen für endgültig bezwungen hielt, in der Hoffnung, in nicht allzu ferner Zeit auch die Christianisirung des Abodritenlandes in Angriff nehmen zu können, den Abodriten eine vorläufige Verpflichtung zur Bekehrung abverlangt haben. Ist dieses richtig, oder hat es Karl nicht verschmäht, mit offenbaren Heiden ein Bündniß zu schließen, ohne der Religion dabei auch nur zu erwähnen? Die Frage ist nicht nur für eine Reconstruktion des Bundesvertrages von Bedeutung, sondern weit mehr noch für die Beurtheilung von Karls Persönlichkeit und Politik. Prüfen wir zunächst, um zu sehen, ob sie sich entscheiden läßt, den Wortlaut und Wortsinn der Annalenstellen!
In den Ann. Petaviani heißt es: ipse auten adquisivit (Karl die Wenden) una cum dei auxilio. Adquirere, ein bei den fränkischen Schriftstellern ungemein häufiges Wort, heißt "hinzuerwerben" d. i. sich unterwerfen, seinem Reiche einverleiben (s. z. B. Ann. Petav. 785 : deinde adquisivit terram Beneventanam und viele andere Stellen dieser anderer Annalen; man vergleiche noch die unten angeführte Stelle in Alcuins Briefen); es schließt eine Bekehrung nicht ein, die Petav. also, die nur von Wenden, nicht auch von Frieden sprechen, behaupten garnicht die Bekehrung jener. Die Ann. Maxim. sagen: credere se Domino spoponderunt, die Lauresham. setzen dafür credidit. die Mosell. aber brauchen den Ausdruck ad eum conversa est. Schon Wigger hat (Annalen S. 129 b. Anm. 1) auf das Beachtenswerthe dieser Variante hingewiesen, ohne jedoch weiter Folgerungen daraus ziehen. Es heißt ad eum, nicht ad deum, man wäre versucht, dies zu conjicieren, aber es steht nun einmal nicht da: ad eum conversa es aber, eine allerdings ungewöhnliche Wendung, kann nur heißen: die Wenden und die Friesen wandten sich ihm zu, sie unterstellen sich freiwillig seiner Herrschaft. Wie ist dies Abweichung und den aus derselben Quellen geflossenen Werken zu erklären und was hat in ihrer Quelle gestanden? Habe die Lauresham. und Maxim. oder haben die Mosellani ihre Vorlage mißverstanden? Meines Erachtens ist das erste wahrscheinlicher. Hätte in der Vorlage ein unzweideutiger Ausdruck für die Bekehrung der Wenden und Friesen gestanden, so würde die Mosell. ihm schwerlich abgeschwächt haben; das Gegentheil, daß sich in der


|
Seite 104 |




|
Vorlage ein Ausdruck fand etwa wie der, den die Mosell. brauchen, und daß die Verfasser der Max. und Lauresham. aus diesem neben der Unterwerfung auch eine Bekehrung irrthümlich herauslasen, entspricht weit besser den Charakter dieser Klosteraufzeichnungen, die sich die Unterwerfung eines heidnischen Stammes unter den Frankenkönig kaum ohne Bekehrung vorzustellen vermochten. Ich vermuthe also, daß in der gemeinsamen Quelle der Mosell., Lauresh. und Maxim. eine Bekehrung der Wenden ebenso wenig wie in den Petav. behauptet gewesen ist.
Ferner: Hätte Karl im Jahre 780 den Abodriten Verpflichtungen in Bezug auf das Christenthum auferlegt, so würde er es vermuthlich 789 mit den besiegten Wilzen ebenso gemacht haben. Wir haben über diesen Feldzug ausführliche Kunde ( s. d. Quellenzusammenstellung in Wiggers Annalen), von einem Bekehrungsversprechen der Wilzen aber ist nirgends die Rede, vielmehr läßt sich nachweisen, daß sie ein solches nicht gegeben haben können. Kurz nach dem Siege über die Wilzen schrieb Alcuin an einen Abt, der sich als Missionsprediger in Sachsen aufhielt, in dem er Grüße an Bischof Willehad sendet und zugleich um Nachricht bittet, quomodo consentiant vobis Saxones in praedicatione et si spes ulla sit de Danorum conversione (man sieht, wie weit schon damals der Gesichtskreis der hohen fränkischen Geistlichkeit reichte!) et si Wilti et Viondi, quos nuper adquisivit rex, fidem Christi accipant. 1 ) Aus diesen Worten geht hervor, daß man sich mit der Hoffnung trug, die eben unterworfenen Wendenstämme zu bekehren daß wirklich Missionare zu ihnen gesandt sind, wird man nicht daraus schließen dürfen, es kann und wird unterblieben sein (s. den unten angeführten Brief aus dem Jahre 790, in dem nur von der Unterwerfung der Wilzen neben der Bekehrung der Sachsen die Rede ist); zugleich aber ist klar, daß beim Friedensschluß selbst die Bekehrung nicht zur Bedingung gemacht sein kann, denn es wird deutlich die schon erfolgte Unterwerfung von einem hinterdrein etwa gemachten Versuch der Bekehrung


|
Seite 105 |




|
unterschieden, dessen Gelingen, Alcuin zweifelhaft erscheint und über dessen etwaigen Erfolg er Nachricht wünscht. Wenn aber Karl den Wilzen, als er ihr Schicksal in der Hand hatte, nicht das Versprechen des Religionswechsels abverlangt hat, so wird er es 780 mit den Abodriten vermuthlich ebenso gehalten haben. Es wird ihm nicht unbekannt gewesen sein, welche Macht im Wendenvolke die Religion und ihre Priester hatten. Hätte er daran gerüttelt, die Freundschaft mit den Abodriten hätte sich sicher sehr bald gelockert. Auch wäre ein solches Versprechen für lange Zeit zwecklos gewesen, durch die große Aufgabe der kirchlichen Organisation Sachsens waren alle Kräfte der fränkischen Kirche, die sich eben erst aus dem tiefen Verfall der Merovingerzeit emporzuarbeiten begann, noch auf lange hinaus völlig in Anspruch genommen, es wird auch in Sachsen über Mangel an Geistlichen geklagt. Ließ man doch selbst Nordalbingien zunächst ohne einen eigenen Bischofssitz. Wie war daran zu denken, daß vor der Lösung dieser Aufgabe auch den Wenden das Christenthum gebracht werden könne. Und wenn auch der Gedankenflug eines Alcuin von ihrer Bekehrung träumte, der große Realpolitiker auf dem fränkischen Thron hat sich mit dem zunächst Erreichbaren begnügt, das war die Befriedung der Wenden.
Erst gegen Ende seiner Regierung, als nach öfteren Auflehnungsversuchen Sachsen endlich gebändigt und bereits mit Kirchen erfüllt war und schon eine dreißigjährige Waffenbrüderschaft die Abodriten an die Franken gekettet hatte: da traf Karl die ersten Anstalten zu ihrer künftigen Bekehrung. Er ließ in Hamburg eine Kirche bauen und weihen und überwies sie einem Priester Namens Heridac, den er zum Missionsbischof für die Nordgermanen und die Slaven zu machen gedachte. 1 ) Heridacs und des Kaisers Tod schnitt jedoch die Ausführung dieser Entwürfe ab.
Doch kehren wir zu dem Bündniß vom Jahre 780 zurück! Unsere Annahme, daß der Abodritenfürst im Jahre 780 die fränkische Oberhoheit ausdrücklich anerkannt habe, findet noch eine weitere Stütze in einer Stelle der Ann. Lauresh. aus dem


|
Seite 106 |




|
Jahre 795, wo Witzan vassus domni regis genannt wird. L. Giesebrecht (Wend. Gesch. I. 98 und nach ihm Werner, a. a. O., S. 50) legen Gewicht darauf, daß dieser Ausdruck erst im Jahre 795 gebraucht wird und schließen daraus, daß etwa um 789 oder wenig später der Abodritenfürst, der bisherige Bundesgenosse, Dienstmann des Frankenkönigs geworden sei, und zwar aus eigener Wahl, um sich "an einem mächtigen Herrn einen Rückhalt zu verschaffen." Diese Begründung paßt jedoch offenbar schon auf das Jahr 780. Eben der Wunsch an dem neuen mächtigen Nachbar einen Rückhalt zu gewinnen wird für den Abodritenfürsten von vorne herein das treibende Motive gewesen sein sich dem Frankenkönig zu nähern. Ueberdies darf man aus den Ausdruck vassus nicht allzuviel Gewicht legen Nach 798 wird in den Ann. Einh. das Verhältniß der Abodriten zu den Franken eine societas genannt (s. die oben anführte Stelle), und noch nach Karls Tod nennt sie Einhard rückblickend foederati (s. o, V. Car. c. 12). Es wird hier also zwischen socius oder foederatus und vassus kein Unterschied zu machen sein, der Abodritenfürst war schon seit 780 beides zugleich, doch setz allerdings der Ausdruck vassus voraus, daß er dem Könige gehuldigt, einen Treueid geleistet hat. Dies stimmt zu den adquisivit der Annalen, es wird also schon 780 geschehen sein Ueber einen solchen allgemein gehaltenen Treueid hinaus wird man dem foedus des Jahres 780 kaum einen specielleren Inhalt geben dürfen. Eine Tributpflicht für die Abodriten ist sicher nicht in dem Bündniß festgesetzt (s. darüber unten), aber auch eine ausdrückliche Verpflichtung der Abodriten zur Heeresfolge scheint der Situation nicht recht zu entsprechen. Wenigstens ist es selbstverständlich, daß in den Jahren 780-789, wo die Abodriten alle Mühe hatten sich der Wilzen zu erwehren, ohne von den Franken die versprochene Hülfe zu erhalten, thatsächlich von ihnen weder Tribut bezahlt noch Heeresfolge, etwa in der Sachsenkriegen, geleistet oder beansprucht ist.
III. Die Abodritenfürsten als Verbündete und Vasallen der Frankenkönige
Das Band also, das die Abodriten an das Frankenreich knüpfte, war anfänglich nur lose, Karl mußte, durch die neu Empörung der Sachsen im Jahre 782 wie die mannigfaltigen andern Aufgaben, die ihm die Regierung seines ausgedehnte Reiches stellte, in Anspruch genommen, seine neuen Verbündeten


|
Seite 107 |




|
zunächst sich selbst überlassen und sich damit begnügen, auf die wiederholten Klagen der Abodriten hin den Wilzen, ihren steten Bedrängern, Befehle zuzusenden, daß sie Ruhe halten sollten, die unbeachtet blieben. Erst 789 fand er Zeit zu einer gründlichen Abrechnung; der fränkischen Heeresmacht, der sich auch die Abodriten und selbst die Sorben zugesellten, mußten sich alle wilzischen Stämme bis an die Peene (Fragm. Chesn. 789.), nach einer andern Nachricht bis ans Meer (Ann. Guelferbit.) unterwerfen. Daraus ergab sich für die Abodriten die Folge, daß seitdem auch ihre Abhängigkeit von den Franken deutlicher hervortrat, die Consequenzen des Vasallenverhältnisses, in das sich ihr Fürst begeben hatte, begannen vom Frankenkönig gezogen zu werden. In vier Beziehungen traten sie hervor, in der Heeresfolge, in schiedsrichterlicher Entscheidung von Streitigkeiten durch den Frankenkönig, bei der Fürstenwahl und in der sich einführenden Sitte wiederholter Besuche der Fürsten am fränkischen Hofe unter Darbringung von Geschenken (Tributpflicht).
Ob die Abodriten, als sie sich Karl auf seinem Feldzuge gegen die Wilzen im Jahre 789 anschlossen, einem Gebote des Königs folgten, wird uns nicht berichtet, doch hören wir einige Jahre später (795), daß Karl den Abodritenfürsten zu sich nach Bardowiek entbietet, s. Ann. Einh. 795: Cumque (rex) in pagum Bardengoi pervenisset, et iuxta locum qui Bardenwih vocatur positis castris, Sclavorum, quos se venire iusserat, exspectaret adventum, etc Daß es sich um ein Aufgebot zum Kampf gegen die Sachsen handelt und Witzan an der Spitze eines Heeres kam, erfahren wir aus den Ann. Mosell. 794 (b Wigger S. 148): Sclavorum rex, qui ad eius auxilium venerat. Hier liegt das erste sichere Beispiel vor, daß der Abodritenfürst den Franken auf Befehl Heeresfolge leistet. Witzan fiel allerdings beim Ueberschreiten der Elbe (s. Ann. Einh.) in einen Hinterhalt, den ihm die Sachsen legten, und ward erschlagen. Seine Mannschaft wird nach seinem Tode wieder nach Hause gezogen sein, um an der Wahl eines neuen Fürsten theilzunehmen, und wird sich an den Verwüstungszügen Karls, durch die er den Tod seines Verbündeten rächte, nicht betheiligt haben.
Drei Jahre darauf sehen wir die Abodriten unter Witzans Nachfolger Thrasco Schulter an Schulter mit den Franken gegen die Sachsen kämpfen. Die nordelbischen Sachsen hatten einige


|
Seite 108 |




|
fränkische Königsboten überfallen, auch die auch die Gegenden zwischen der Unterelbe und der Weser befanden sich noch im Aufruhr. Karl eilte mit seinem Heerbann nach Minden und durchzog dann unter Verheerungen, das aufrührerische Gebiet links der Elbe. Zugleich sandte er eine Abtheilung mit einigen Königsboten über die Elbe zu Thrasco, dieser bot, jedenfalls auf Karls Befehl, den ihm die misse überbrachten, sein Volk auf und brach, von der fränkischen Abtheilung begleitet, in Nordalbingen ein; auch die Nordalbinger sammelten sich, und es kam zur Schlacht an einem Orte, der Sunentana genannt wird - es ist höchst wahrscheinlich das später sogenannte Zuentifeld oder Zwentinefeld an der Schwentine, die Gegend von Bornhöved. Die Abodriten, deren rechten Flügel einer der fränkischen Königsboten Namens Eburis - wie es scheint, unter dem Oberbefehl des Abodritenfürsten - führte, erfochten einen glänzenden Sieg, wobei die Sachsen schwere Verluste erlitten (s. die Quellenstelle bei Wigger, Anm. s. 4 f.). Sie sahen sich deshalb gezwungen, mit Karl in Unterhandlung zu treten und ergaben sich im nächsten Jahre (s. Ann. Laur. 799). Die siegreichen Abodriten aber kamen zu Karl, der damals in Nord=Thüringen stand, und "der König ehrte sie hoch, wie sie es verdienten."
Daß die Abodriten noch öfter an den Kämpfen gegen die Sachsen sich betheiligt hätten, ist uns nicht überliefert, doch ist es zu vermuthen, da Karl ihnen im Jahre 804 Nordalbingen überweist, aus dem er die sächsischen Bewohner (ganz oder zum Theil?) hat entfernen lassen (s. Ann. Einh. 804). Wir haben diese Verleihung gewiß in erster Linie als Lohn für gute Dienste aufzufassen. Und da Karl den Sieg an der Schwentine schon reich belohnt hatte, auch ein Zeitraum von 6 Jahren seitdem verflossen war, so liegt die Annahme einer öfteren Waffenhülfe von Seiten der Abodriten bei Bezwingung der Nordalbinger nahe. Zugleich aber wird Karl bei seiner Schenkung noch eine andere Absicht gehabt haben, die nämlich, die Sachsen durch die Abodriten von den Dänen zu trennen (S. Lamprecht, deutsche Gesch. II., S. 26). An diesen ihren nahen nordischen Stammesverwandten hatten die Sachsen bei ihren Auflehnungsversuchen einen steten Rückhalt gefunden, oft waren sächsische Empörer zu den Dänen geflüchtet, um, sobald ihnen die Zeit gekommen schien, wieder zurückzukehren und den Aufruhr von neuem zu entflammen, schon öfter hatte Karl deswegen Gesandte an die Dänen geschickt, so auch eben im Jahre 804, wo es ausdrücklich heißt (s. Ann. Einh.), sie hätten wegen "Auslieferung der Ueberläufer" ver=


|
Seite 109 |




|
handeln sollen. Um die Flucht zu den Dänen zu erschweren und überhaupt den geographischen Zusammenhang beider Völker zu unterbrechen, setzte Karl den Abodritenfürsten nach Art der Markgrafen als Grenzwächter über Nordalbingien ein, wobei es ihm zugleich gestattet war, mit seinen Abodriten von dem entvölkerten Gebiet soviel zu besiedeln, wie sie eben wollten und konnten. Ob die Abodriten wirklich Grenzwachen gegen die Dänen aufgestellt haben, wissen wir nicht.
Es zeigte sich indessen bald, daß die Abodriten allein dieser Aufgabe nicht gewachsen waren. Im Jahre 808 erlag Thrasco einem Angriff des Dänenkönigs Gottfried, der mit einer Flotte an der meklenburgischen Küste landete und von da ins Innere vordrang. Sogleich schlossen sich den Dänen die alten Feinde der Abodriten, die Wilzen, an, auch die Smeldinger und Linonen, zwei kleinere mit den Abodriten verwandte Stämme, die zu Thrascos Reich gehörten, fielen zu den Dänen ab. Trotz tapferster Gegenwehr mußte Thrasco für den Augenblick weichen, doch that er es nicht, ohne den Dänen schwere Verluste beigebracht zu haben, und als diese und die Wilzen abgezogen waren, setzte er sich wieder in den Besitz seines Landes. Karl hatte inzwischen seinen Sohn Karl mit einem starken Heere an die Elbe gesandt. Da die Dänen schon abgezogen oder wenigstens im Abzug begriffen waren, so griff der junge Karl die Smeldinger und Linonen an, um sie für ihren Abfall zu züchtigen, ohne allerdings viel auszurichten (s. Chron. Moiss. 808 und bes. Ann. Laur. min. 808). Im folgenden Jahre zog Thrasco, von sächsischer Mannschaft unterstützt, gegen die Wenden und verheerte ihr Gebiet, wandte sich darauf gegen die Smeldinger, deren Hauptburg er mit Hülfe eines noch stärkeren sächsischen Truppentheils eroberte, und stellte so sein früheres Reich in alten Umfange wieder her. 1 ) Indessen
Außer den Smeldingern und Linonen kann man unter den omnes bei Einhard noch die Müritzer und Warnower verstehen (s. Wigger Annalen, S. 106, 108 und 113). Die Smeldingconnoburg des Chron. Moiss. darf nicht mit Konow (bei Eldena) identificirt werden, wie Lisch ( ... )


|
Seite 110 |




|
hatte sich dem Kaiser bei dieser Gelegenheit gezeigt, daß ein wirksamerer Schutz der Elbgrenze, als die Abodriten ihn zu gewähren vermochten, sowohl gegen die Dänen wie gegen die unruhigen Wendenstämme wünschenswerth sei. Deswegen ließ er schon 808 (s. Ann. Einh.) dem Gebiete der Witzen und Linonen gegenüber an der Elbe zwei Castelle errichten, von denen allerdings das eine, Hohbucki (wohl der Höhbeck an der Elbe bei Gartow, s. Wedekind, Noten zu einigen Geschichtsschreibern des deutschen Mittelalters II., 152 ff., Simson, Jahrbücher II., p. 390, Anm. 8 und die Generalstabskarte) 810 von den Wilzen erstürmt, aber schon 811 wiederhergestellt ward. Gegen die Dänen ward ins Jahre 810 ist Nordalbingien an der Stör die Burg Esesfelth, das heutige Itzehoe, angelegt und über sie wie über die dort angesiedelte Besatzungsmannschaft der sächsische Graf Egbert gesetzt. Wenn so den Abodriten Nordalbingien auch wieder entzogen ward, so genossen dafür auch sie den Schutz der benachbarten Feste, die gewiß weit stärker angelegt war als ihre Gauburgen, von denen Gottfried im Jahre 808 mehrere erobert hatte.
Noch zwei Mal haben in den nächsten Jahren die Abodriten Waffenhülfe geleistet. Zuerst im Jahre 812, wo ein starkes Heer, in drei Abtheilungen getheilt, die Wilzen zur Geiselstellung. und erneuten Unterwerfung zwingt. Das Chron. Moiss., das eine genauere Beschreibung des Feldzuges enthält, berichtet in seinem barbarischen Latein von der einen dieser Abtheilungen: Unus exercitus venit cum eis (hiermit können nur die unmittelbar vorher genannten Wilti gemeint sein) super Abodoritos. Der Verfasser meint ohne Zweifel: venit super eos cum Abodoritis = er überzog sie im Verein mit den Abodriten, s. aus denselben Annalen zum Jahre 808: Godofredus venit super illos Sclavos, qui dicuntur Abotriti.
Endlich erhalten im Jahre 815 die Abodriten von Ludwig dem Frommen den Auftrag, mit den Sachsen zusammen gegen die Dänen zu ziehen. Sie entledigen sich dieses Auftrages, indem sie mit ihrem Gesammtaufgebot ausziehen, ohne jedoch große Erfolge zu gewinnen, da die Feinde einem entscheidenden Kampfe ausweichen. Die Oberleitung des Zuges hatte Graf Baldrich, unter seinem Oberbefehl werden also auch die Abodriten gestanden


|
Seite 111 |




|
haben. S. Ann. Einh. 815: Jussum est ab imperatore, ut Saxones et Abodriti ad hanc expeditionem praepararentur, und nachher: Tunc omnes Saxonici comites omnesque Abodritorum copiae cum legato imperatoris Baldrico, sicut iussum erat - trans Aegidoram fluvium - perveniunt etc.
Nicht um Heeresfolge zu einem Kriege, sondern um ein bewaffnetes Geleit handelt es sich im Jahre 819, wo die Abodriten auf Befehl des Kaisers den 813 zu ihnen geflüchteten Dänenfürsten Harold zu seinen Schiffen führen, s. Ann. Einh. 819: Harioldus, iussu imperatoris ad naves suas per Abodritos reductus. - Sie sind auch hier im Dienste des Kaisers thätig und folgen einem Befehle von ihm.
Unter den besprochenen Beispielen von Heeresfolge und Waffendienst sind außer 819 noch zwei (795 und 815), wo ausdrücklich versichert wird, daß sie auf Befehl des Frankenkönigs geleistet ist. Das Recht also, seine Verbündeten, ohne vorhergehende Verhandlung, durch einen bloßen Befehl zur Heeresfolge aufzubieten, ward sowohl von Karl dem Großen wie auch von Ludwig dem Frommen in Anspruch genommen, und die Abodriten fügten sich diesem Anspruch, der sich aus ihrem Vasallenverhältniß ergab, ohne Weigerung. Doch ist beachtenswerth, daß die Heeresfolge nur gegen die unmittelbaren Grenznachbarn der Abodriten, die Wilzen, Sachsen und Dänen, gefordert und geleistet wird. Ob darüber eine bestimmte Abmachung bestand, muß dahingestellt bleiben.
Ein Fall bildet vielleicht eine Ausnahme: Im Jahre 805 wird Böhmen durch einen concentrierten Angriff dreier Heeresabtheilungen niedergeworfen, die eine dieser Abtheilungen, die von Norden her über das Grenzgebirge vordringt, besteht aus den Sachsen und innumerabilibus Sclavis. L. Giesebrecht (Wend. Gesch. I., 100 f.) vermuthet, diese Slaven wären nur Abodriten gewesen. Wilzen können allerdings nicht wohl gemeint sein, denn gleichzeitig unternahm eine vierte Heeresabtheilung von Magdeburg aus einen Streifzug über die Elbe, wohl um die Wilzen in Schach zu halten und an einer Unterstützung der Böhmen zu verhindern. Auch gegen die Sorben findet schon im folgenden Jahre ein Feldzug statt (s. Ann. Einh. 806), trotzdem können sich diese 805 dem Zuge gegen Böhmen angeschlossen haben, und daß Karl bei der Unzuverlässigkeit der wilzischen Stämme und dem gespannten Verhältniß des Frankenreiches zu den Dänen den Heerbann der Abodriten so weit von ihrer Heimath entfernt haben sollte, ist wenig wahrscheinlich.


|
Seite 112 |




|
Aus dem Schutz= und Vasallenverhältniß, in dem die Abodriten zu Karl standen, ergab sich weiter die Folge, daß sie bei äußeren und inneren Streitigkeiten seine Entscheidung anriefen. Zwei Fälle begegnen uns: Im Jahre 799 sendet Karl von Paderborn aus seinen Sohn Karl mit der Hälfte seines Heeres in den Bardengau ad colloquium Sclavorum, wie die Ann. Lauriss. schreiben. Der Bearbeiter erläutert dies mit den Worten: propter quaedam negotia cum Wiltis et Abodritis disponenda. Wir wissen nicht, welcher Art diese negotia gewesen sind, vermuthlich hatten die Wilzen wieder einmal Streit begonnen, und die Abodriten hatten Karls Entscheidung angerufen.
Deutlicher erkennbar und auch wichtiger ist der zweite Fall, der aus dem Jahre 804 stammt. In diesem Jahre schenkte Karl, wie bereits erwähnt ist, den Abodriten die nordalbingischen Gaue, aus denen die Sachsen entfernt waren. Diese Schenkung geschah, wie uns das Chron. Moiss. belehrt, in Hollenstedt. Dorthin nämlich kam dieser Chronik zufolge der Abodritenkönig Drosuc (=Thrasco) und überbrachte dem Kaiser viele Geschenke. Eben dort in Hollenstedt muß noch mit Thrasco etwas anderes vorgegangen sein. Die Metzer Annalen nämlich, die im allgemeinen über Karls Aufenthalt in Hollenstedt den Inhalt der Ann. Einhardi mit etwas veränderten Worten wiedergeben, haben hinter dem Worte Holdonstat die Einschaltung: In qibus castris etiam Sclavorum prineipes adfuerunt. Querum causis discussis et secundum arbitrium dispositis, regem illis Trasiconem constituit. Man darf diese Nachricht nicht schlechtweg verwerfen, denn die Metzer Annalen zeigen auch hier, ähnlich wie im Jahre 748 und sonst öfter, eine recht eingehende Kenntniß der Vorgänge in Sachsen, sie allein von den uns zugänglichen Quellenwerken kennen das placitum generale, das Karl in Lippspringe auch in diesem Jahre abhielt. Wer aber sind die Sclavorum principes, die vor Karl erschienen, und was bedeutet die Königswürde, die Thrasco über sie erhält? Sie ist sehr verschieden aufgefaßt worden. L. Giesebrecht (I. 100 f.) versteht unter den Sclavi der Metzer Annalen nur die Abodriten und combinirt nach Zurückweisung der Ansicht, daß Thrascos Königthum alle nördlichen Slavenstämme umfaßt habe, die Notiz der Metzer Annalen mit der Schenkung von Nordalbingien in der Weise, daß er dieses Königthum als einen Titel auffaßt, den Karl dem Wendenfürsten als seinem Bevollmächtigten über=


|
Seite 113 |




|
tragen habe, der den nordsächsischen Gauen und der Ansiedelung der Abodriten in ihnen vorstehen sollte. Eine Machterweiterung über wendische Gaue oder Stämme, die bisher Thrasco noch nicht untergeben waren, bedeutet also hiernach dessen neue Königswürde nicht, Thrasco beherrscht nach Giesebrecht um diese Zeit noch nicht einmal den ganzen abodritischen Stamm, wenigsten wird noch ein Herzog außer ihm erwähnt - es ist Godelaib, den der Dänenkönig im Jahre 808 gefangen nimmt und aufhängen läßt, und der in den Reichsannalen alius dux genannt wird. Simson (a. a. O. II, 302) sagt: Drosuc wurde von Karl nach Prüfung der betreffenden Verhältnisse als oberster Fürst der Abodriten eingesetzt; man vergl. noch S. 147, Anm. 2. Aehnlich Werner (a. a. O., S. 49) und Wendt (Die Germanisirung der Länder östlich der Elbe, I, Pr. Liegnitz 1884, S. 19): "So entstand die fürstliche Gewalt bei den Abodriten als ein Schöpfung Karls des Großen, der sie, wie es scheint, einen schon vorher angesehenen und den Franken besonders treu ergebenen Häuptling übertrug, um durch ihn das Volk dauernd an die fränkische Partei zu fesseln". Doch läßt sich auch Wendt durch die Erwähnung Godelaibs in den Annalen zu der Einschränkung bewegen, daß Thrasco anfangs noch nicht über alle Abodriten, sondern nur über den westlichen Theil derselben geherrscht habe. Indessen 817 heißt es von Slaomir: Causa defectionis erat, quod regiam potestatem, quam Sclaomir eatenus post mortem Thrasconis solus super Abodritos tenebat, cum Ceadrago, filio Thrasconis, partiri iubebatur. Hat Slaomir nach Thrascos Tod (809) die Alleinherrschaft über die Abodriten gehabt, so muß sie doch Thrasco, mindestens im letzten Theil seiner Regierung, ebenfalls besessen haben. Diesen letzten Theil aber auf das eine Jahr 808-809, die Zeit nach Godelaibs Tod, zu beschränken, verbietet der Bericht der Reichsannalen zum Jahre 809, wonach Thrasco mit sächsischer Hülfe omnes qui ab eo defecerant, ad suam societatem reverti coegit. Thrasco hat also 809 nur wiedergewonnen, was er schon vorher besessen hatte, auch züchtigt er die Wilzen, vicinoi suos (!), folglich kann er zur Zeit ihres Einfalls, d. i. 808, vor Godelaibs Tod, nicht nur die westlichen Abodriten beherrscht haben. Daß aber etwa Godelaib im Westen und Thrasco im Osten des Landes geherrscht habe, wird durch die Schenkung von Nordalbingien an Thrasco ausgeschlossen die doch seine Grenznachbarschaft voraussetzt. Für Godelaib als selbständigen Fürsten ist neben Thrasco seit 804 über=


|
Seite 114 |




|
haupt kein Raum im Abodritenlande, folglich wird er eben kein selbständiger Fürst, sondern ein Untergebener Thrascos gewesen sein, ein Häuptling über einen Theil des Landes, der unter Thrascos Oberherrschaft stand. Hiermit fällt jeder Grund Thrascos Königsthum vom Jahre 804 so einzuschränken, wie Giesebrecht es gethan hat, dessen Auffassung überdies dem bestimmten Wortlaut der Metzer Annalen widerspricht, Wonach Thrasco den principes Sclavorum nach Untersuchung der Verhältnisse zum König gesetzt wird. Mit Recht sind also Simson, Werner und Wendt von Giesebrechts Auffassung abgewichen, allein auch sie scheinen mir noch nicht ganz das Richtige zu treffen. Besonders scheint mir Wendt zu weit zu gehen, wenn er die Fürstengewalt bei den Abodriten für eine Schöpfung Karls des Großen aus dem Jahre 804 hält. Schon im Jahre 798 tritt Thrasco augenscheinlich als Führer der d. i. aller Abodriten auf, s. die Ann. Lauresham.: Et interim congregati sunt Sclavi nostri, qui dicuntur Abotridi in Combination mit den Ann. Lauriss.: Nordliudi contra Thrasuconen, ducem Abodritorum etc. Es war also der Heerbann der Abodriten, der sich zum Kampfe gegen die Sachsen sammelte, ihr Führer war Thrasco; die Ann. Lauresham. beweisen, daß wir den dux der Ann. Lauriss. als den Herzog der Abodriten, nicht als einen ihrer Herzöge aufzufassen haben. So hat es auch der Verfasser der Ann. Einh. verstanden, s. die Worte: Quorum (d. i. der Abodriten, der Verbündeten der Franken) dux Thrasco cum omnibus copiis suis -- occurrit. Schon Witz n erscheint im Jahre 789 in den Ann. Lauriss. (!) als Fürst der Abodriten, s. die Worte: Fuerunt etiam Sclavi cum eo (der König Karl im Feldzug gegen die Wilzen), quorum vocabula sunt Suurbi, nec non et Abotriti, quorum princeps fuit Witzan. Dasselbe Resultat ergiebt eine Prüfung der Berichte über Witzans Tod im Jahre 795: Karl wünscht von den Abodriten Waffenhülfe und bestellt sie zu sich nach Bardowiek, auf dem Wege dorthin wird Witzin, rex Abodritorum (Ann. Lauriss., Einh., Lauresham.), vassus domni regis (Ann. Lauresham.), von den Sachsen erschlagen. Sollte dieser Vasall Karls, der ihm zu Hülfe zieht, nur einer unter mehreren gleichgestellten Häuptlingen sein und nicht vielmehr der Fürst, der an der Spitze des ganzen Stammes den Bund mit Karl geschlossen hat und sein Vasall geworden ist? Die Fürstengewalt bei den Abodriten ist. also nicht erst eine Neuschöpfung Karls des Großen gewesen, hat vielmehr schon bestanden zu der Zeit, als er mit ihnen in


|
Seite 115 |




|
Verbindung trat. 1 ) Was bedeutet denn aber die Einsetzung des Thrasco zum König im Jahre 804? Zweierlei kann sie meines Erachtens bedeuten. Die causae, die Karl discutit und disponit, sind, wie Karls Entscheidung beweist, Streitigkeiten zwischen den übrigen principes Sclavorum und Thrasco über dessen Oberherrschaft gewesen. Diese Streitigkeiten können darin bestanden haben, daß sich gegen Thrasco unter den ihm untergebenen abodritischen Häuptlinge ein Widerstand erhoben hatte, den Karl niederschlug, wobei er Thrasco als Oberhäuptling anerkannte und bestätigte. Es kann sich jedoch auch um andere Stämme handeln, denn es heißt in den Metzer Annalen Sclavorum principes, nicht Abodritorum. An alle nördlichen Wendenstämme darf man allerdings dabei nicht denken, die Wilzen erscheinen 808 als unabhängig von Thrasco, sie fallen nicht von ihm ab, sondern schließen sich aus freien Stücken wegen ihrer alten Feindschaft gegen die Abodriten dem Dänenkönig an (s. Ann. Einh. 808). Aber in demselben Jahre 808 begegnen uns die Smeldinger und Linonen als Unterthanen Thrascos, s. Ann. Einh. 808 Linones et Smeldingos, qui et ipsi ad Godofridum regem defecerant und 809 die o. a. Stelle, wo es heißt omnes, qui ab eo (d. i. Thrasco) defecerant. Zu diesen omnes können außer den Smeldingern und Linonen noch andere kleinere Stämme gehört haben, wie die Bethenzer und die Vorfahren der später auftauchenden Müritzer und Warnower. Auf diese kleineren Stämme und ihre Fürsten kann sich das Königthum beziehen, das dem Thrasco 804 verliehen wird. Mag nun 804 eine Erweiterung von Thrascos Herrschaftsgebiet unter den Wenden oder nur eine
Witzan
--------^--------
Thrasco Slaomir
|
Ceadrag.


|
Seite 116 |




|
Bestätigung der schon vorher in seinem Besitz befindlichen Herrschergewalt stattgefunden haben: in jedem Falle bedeutet Karls Entscheidung einen starken Eingriff in die inneren Verhältnisse seiner Verbündeten, wie er bis dahin noch nicht vorgekommen war, und wenn dieser Eingriff von den Abodriten selbst begehrt zu sein scheint, so wird damit nur um so deutlicher bewiesen, daß die Abodriten sich mehr und mehr gewöhnten, in Karl ihren Herrn zu sehen.
Sechs Jahre darauf zogen sie selbst aus dem Vorgang des Jahres 804 eine Konsequenz, durch die ihr Abhängigkeitsverhältniß zum Frankenreiche eine neue Verstärkung erhielt.
Nachdem Thrasco im Jahre 809 dem Mörderdolche eines Dänen, den König Gottfried abgesandt, zum Opfer gefallen war, Suchten die Wenden im Jahre 810 den Kaiser in Verden auf, et dedit illis regem, so heißt es in den Ann. St. Amandi, einer gleichzeitigen Aufzeichnung, die wahrscheinlich ein Mitglied der Hofgeistlichkeit zum Verfasser hat (s. Wattenbach I 6, 143). Man könnte zweifeln, ob der Ausdruck so buchstäblich zu nehmen sei, ob nicht vielleicht Karl den von den Abodriten bereits gewählten Fürsten nur anerkannt und seine Huldigung entgegengenommen habe, allein er wird durch die Ereignisse der Folgezeit beglaubigt. Karl hat also nach Thrascos Tod den Abodriten auf ihre bitte kraft eigener Machtvollkommenheit ihren Fürsten gegeben. So war es aber bis dahin nicht gewesen, wenigstens ist bei Witzans Tod von einer solchen Einsetzung Thrascos nirgends die Rede, und wir haben keinen Grund sie zu vermuthen. Woher rührte diese Aenderung, die ohne Frage recht tiefgreifend war? Sie war, irre ich nicht, die Folge der veränderten Stellung des Abodritenfürsten seit seiner "Einsetzung" durch Karl im Jahre 804. Vorher war Thrasco kraft Erb= oder Wahlrechtes Fürst gewesen, seit 804 aber war er es kraft kaiserlichen Richterspruches. So ward denn auch sein Nachfolger nicht mehr von den Abodriten gewählt, sondern von Karl ernannt. Der Kaiser hatte also durch den Präcedenzfall des Jahres 804 das Recht gewonnen den Abodriten bei eintretender Vacanz ihren Fürsten zu setzen.
Auch Ludwig der Fromme hat dieses Recht in Anspruch genommen. Karl hatte im Jahre 810 Ceadrag, den Sohn Thrascos, übergangen, wohl weil er noch minderjährig war, und die Fürstenwürde an Slaomir gegeben. 817 befahl Ludwig (s. Ann. Einh.), - ob auf Antrag einer Partei unter den


|
Seite 117 |




|
Abodriten, wissen wir nicht, jedenfalls aber aus eigener Machtvollkommenheit und ohne Slaomir um seine Einwilligung zu befragen - daß Slaomir die Herrschaft mit Ceadrag theilen solle.
Mit dem Recht der Einsetzung hängt das der Absetzung zusammen, auch dieses hat Ludwig geübt. Als sich Slaomir, zornig über die befohlene Theilung, mit dem Dänen verbündet, sendet Ludwig ein Heer über die Elbe, dem Slaomir sich gefangen geben muß. Er wird nach Aachen vor den Kaiser geführt, und dort wird ein förmliches Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet, er wird abgesetzt und zur Verbannung verurteilt, und Ceadrag erhält das ganze Abodritenreich (s. Ann. Einh. 819, es war jedoch schon 818, s. Mühlbacher, Regesta I, N. 658 g).
Auch Ceadrag beginnt sich mit den Dänen einzulassen, da wird Slaomir in sein Vaterland zurückgeschickt, um wieder an Ceadrags Stelle zu treten. Er stirbt jedoch unterwegs in Sachsen, nachdem er sich vor seinem Tode - der erste abodritische Christ - hat taufen lassen. Ceadrag behält nun die Fürstenwürde, wird aber wegen fortgesetzter Untreue im Jahre 823 aufgefordert sich dem Kaiser zu stellen. Er thut es, wird jedoch freigesprochen (Ann. Einh. 823). Ein zweites Mal (826) entgeht er der Verurtheilung nur dadurch, daß die Besseren seines eigenen Volkes seine Wiedereinsetzung wünschen, muß aber als Bürgen für sein künftiges Verhalten Geiseln stellen. Das ganze Verfahren ähnelt dem gegen abtrünnige Reichsvasallen, die ihrer Lehen verlustig erklärt oder aus kaiserlicher Gnade in ihrem Besitze belassen werden.
Eine ähnliche allmähliche Steigerung der Abhängigkeit tritt uns in Bezug auf die Tributpflicht entgegen.
Einhard nennt die Abodriten in seiner Vita c. 15 tributarii und stellt sie in dieser Beziehung den andern wendischen Völkerschaften völlig gleich. Allein Einhards Werk ist, so hoch man es mit Recht als schriftstellerische Leistung schätzt, in den Einzelheiten nicht immer zuverlässig. So irrt er offenkundig und widerspricht sich selbst, wenn er, von den Abodriten nicht anders wie von den Welataben (den Wilzen), Sorben und Böhmen behauptet, Karl habe sie durch Krieg unterworfen (s. c. 15), er übertreibt entschieden, wenn er sagt, Karl hätte alle slavischen Nationen bis zur Weichsel tributpflichtig gemacht, und wenn er kurz darauf fortfährt, es hätten sich außer den Welataben, Sorben, Abodriten und Böhmen auch die übrigen, deren Zahl weit größer sei, Karl unterworfen. Wir dürfen also auch seiner


|
Seite 118 |




|
Behauptung von der Tributpflicht der Abodriten nicht ohne weiteres Glauben schenken, sondern haben uns in den übrigen Geschichtsquellen nach Erwähnung oder Andeutung solcher Tributzahlungen umzusehen. Bis 804 ist keine Spur davon zu entdecken, 804 aber heißt es, Thrasco habe, als er Karl aufsuchte, "viele Geschenke mitgebracht" (cf. Chron. Moiss.). An die Erfüllung einer von den Abodriten übernommenen Verpflichtung ist hier nicht zu denken, Thrasco folgte nur der Sitte, die selbst von Gesandtschaften fremder Völker beobachtet ward, daß, wer am Hofe erschien, Geschenke darzubringen hatte, zugleich, wird er gewünscht haben, durch seine Geschenke den Kaiser und seine Umgebung sich günstig zu stimmen. So mögen auch früher wie später Gesandtschaften der Abodriten oder ihre Fürsten selbst, wenn sie den Kaiser aufsuchten, Geschenke dargebracht haben. Unter Karl ist zwar sonst nicht davon die Rede, doch war es eine natürliche Folge der Vasallenstellung des Abodritenfürsten, daß solche Gesandtschaften Karl jedesmal aufsuchten, wenn er in der Nähe weilte, daß dann auch wohl der Fürst selbst vor Karl erschien, auch wenn er grade kein bestimmtes Anliegen hatte, und daß man dies auch von ihm erwartete. Auch fordern die Verhältnisse unter Ludwig dem Frommen, die wir sogleich kennen lernen werden, den Rückschluß, eine Tributpflicht der Abodriten in diesem beschränkten Sinne der - freiwillig dargebotenen Geschenke bei Gelegenheit von Besuchen ober Sendungen an den Hof schon für Karls Regierungszeit anzunehmen.
Nach Ludwigs Regierungsantritt kam das Abhängigkeitsverhältniß der Wenden zunächst in einer allgemeinen Huldigung zum Ausdruck. Sie ward vollzogen auf dem Reichstag zu Paderborn, den Ludwig im Juli des Jahres 815 abhielt (s. Ann. Einh. 815: Ibi ad eum omnes orientalium Sclavorum primores et legati venerunt; über die orientales Sclavi sehe man die Aufzählung in den Ann. Einh. 822 (p. 209) nach, wo auch die Abodriten zu ihnen gerechnet werden). Schon im folgenden Jahre erschien wieder eine Gesandtschaft der Abodriten vor dem Kaiser (s. Ann. Einh.). 817 jedoch fällt Slaomir ab, dabei wird ihm die Aeußerung in den Mund gelegt, er werde nie wieder über die Elbe gehen und zur Pfalz kommen (ut adfirmaret, se numquam posthac Albim fluvium transiturum neque ad palatium venturum. Ann. Einh.). Er muß folglich vorher öfter den Hof aufgesucht haben, nicht nur 815, wo er also persönlich erschienen ist, sondern schon früher zu Karls des Großen Lebzeiten, und man muß einen solchen öfter wiederholten


|
Seite 119 |




|
Besuch erwartet haben. Seinem Nachfolger Ceadrag wird später (s. Ann. Einh. 823) vorgeworfen, er habe es versäumt zum Kaiser zu kommen, er muß sich rechtfertigen dilati per tot annos conventus sui (es sind aber nur die Jahre 819-23), und überdies hat er nicht versäumt, im Jahre 822 eine Gesandtschaft mit Geschenken zu senden (s. Ann. Einh.). Der Kaiser beanspruchte also, daß der Abodritenfürst, wenn auch nicht jährlich, so doch öfter persönlich kam. Auch dies war eine Konsequenz seiner Vasallenstellung, und sie wird schon unter Karl - vielleicht seit 804 - sich eingeführt haben, erhielt aber unter Ludwig eine veränderte Form.
Karls Hof war ein wandernder, bis in seine letzten Lebensjahre hatte Karl auch die entfernteren Provinzen seines Reiches öfter aufgesucht, bald hier, bald dort hatte er seinen Richterstuhl aufgerichtet und die Vasallen seines Reiches wie die Fürsten der abhängigen Grenzstämme um sich versammelt. Solche Reichstage betrafen dann neben den allgemeinen Reichsangelegenheiten besonders die Verhältnisse der betreffenden Provinz, die der Herrscher an Ort und Stelle am besten kennen lernen und ordnen konnte. So hatte er den Wenden seine Anordnungen stets aus der Nähe gegeben und hatte ihnen den Weg zu seinem Thron leicht gemacht, indem er zu ihnen an die Grenze kam oder wenigstens als seinen Stellvertreter seinen Sohn sandte. Ludwig hat nach 815 Sachsen überhaupt nicht wieder betreten, er regierte das Reich von dessen Centrum, den Rheingegenden aus; seine Kriege zu führen, schickte er seine Sendboten aus, so schon 815 gegen die Dänen; was vor sein eigenes Forum gehörte, entschied er von seinen Residenzen aus, wie Aachen, Frankfurt, Compiegne. Hier haben auch die Abodritenfürsten als Angeklagte vor ihm erscheinen müssen (s. o.), hier erwartete er auch ihre Huldigungsbesuche, zu denen also die Wendenfürsten eine weite, gewiß ihnen lästige Reise zu machen hatten. Nach war nicht ganz vergessen, daß die Abodriten allein von allen Wendenstämmen sich freiwillig unter Karls Herrschaft gestellt, und welche guten Dienste sie ihm geleistet hatten, Ceadrag erhält Verzeihung propter merita parentum sucrum und wird reich beschenkt entlassen (Ann. Einh. 823); in der Mitte der Huldigungsbesuche und der dabei darzubringenden Geschenke aber wird in Karls letzten Lebensjahren und jedenfalls unter Ludwig kaum noch ein Unterschied zwischen den Abodriten und den übrigen Wendenstämmen bestanden haben. So waren die anfänglichen foederati in der That unvermerkt tributarii geworden, Einhard


|
Seite 120 |




|
hat also nicht so ganz Unrecht, wenn er sie so nennt, und ebenso bezeichnend ist es, wenn er von ihnen sagt, sie seien einst (olim) Verbündete Karls gewesen, das foedus hatte sich in eine Abhängigkeit verwandelt. Etwa ein Vierteljahrhundert später nennt der Verfasser der Vita Hludowici die Abodriten bei Gelegenheit der Erzählung des Feldzuges vom Jahre 815 geradezu olim domno Karolo subiecti: so vollständig war ihr Bundesverhältniß in Vergessenheit gerathen.
Wir sehen also die Kaiser mannigfache Rechte über ihre wendischen Verbündeten in Anspruch nehmen, trotzdem haben sie dieselben niemals als Reichsgenossen, sondern stets als Ausländer angesehen. In der Theilungsurkunde vom Jahre 806 (s. M. G. Leges I, 126 ff., auch bei Richter, Annalen II, 167.) werden weder die Abodriten noch ein anderer der Wendenstämme genannt, ebenso werden in der Theilungsverordnung vom Jahre 817, wo die Ostslaven und Böhmen namentlich angeführt sind, die Abodriten, Wilzen und Sorben übergangen. Man sah eben in diesen Stämmen, auch in den Abodriten, keine Reichsunterthanen, sondern fremde Völkerschaften jenseits der Grenzen des Reiches, die in Abhängigkeit zu erhalten eine Aufgabe der auswärtigen Politik war.
Noch weit bezeichnender aber für die Eigenart des ganzen Verhältnisses als dieses Schweigen der Theilungsurkunden über die Wenden ist die Verordnung Karls des Großen über den Handel mit ihnen. Sie stammt aus dem Anfang des Jahres 806 (s. Richter. II, 165), bildet einen Theil (c. 7) eines ausgedehnten Capitulare, das Karl in Diedenhofen erließ, und lautet: De negotiatoribus, qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debeant: id est part bus Saxoniae usque ad Bardaenowic (Bardowiek), ubi praevideat Hredi; et ad Schezla, 1 ) ubi Madalgaudus praevideat; es werden


|
Seite 121 |




|
dann noch Magdeburg, Erfurt u. a. Orte genannt, darauf schließt die Verordnung mit den Worten: Et ut arma et brunias non ducant ad venundandum; qnod si inventi fuerint portantes, ut omnis substantia eorum anferatur ab eis, dimidia quidem pars partibus palatii, alia vero medietas inter jam dictos missos et inventorem dividatur. C. 13 wird dann bestimmt, daß von den Händlern die alten und berechtigten Zollabgaben, keine neuen und ungerechten erhoben werden sollen.
Die Stelle mit den Kaufleuten in c. 7 ist meistens auf die fränkischen Händler bezogen worden, denen befohlen werde, mit den Slaven und Avaren nur an bestimmten Orten Handel zu treiben, so erklären u. a. L. Giesebrecht (Wend. Gesch. I, 5. 24), Waitz (Verfassungsgesch. IV 2 S. 43) und Simson (Karl d. Gr. II, S. 332). Andere wie Dehio (Gesch. des Erzbisth. Hamburg=Bremen I, S. 57) und Beltz (Wend. Alterthümer, Mekl. Jahrb. LVIII, S. 187 Anm.) verstehen unter den negotiatores wendische Kaufleute, die das Innere des fränkischen Reiches nicht hätten betreten sollen. Dehio vermuthet als Grund für diese Bestimmung, daß Karl die Absicht gehabt habe, der von Seiten der Wenden, die betriebsamere Kaufleute gewesen seien als die Sachsen, drohenden Ueberflügelung entgegenzutreten. Dabei schäzt Dehio das Handelstalent der Wenden doch wohl zu hoch. Und wenn man den Anfang der Verordnung auf die wendischen Kaufleute bezieht, so muß man diese auch am Schlusse als Subject zu ducant ergänzen. Es würde also den wendischen und avarischen Händlern der Einkauf von Waffen in den Grenzplätzen zum Zwecke des Weitervertriebes an ihre Landsleute bei Strafe der Confiscation ihrer gesammten Habe verboten sein. Da wäre es doch auffällig, daß Karl das Verbot an die Fremden richtet statt an seine ihm zum Gehorsam verpflichteten Unterthanen, daß er die Fremden mit harter Strafe bedroht, während die fränkischen Händler, die ihnen Waffen verkaufen, straffrei ausgehen. Die Strafdrohung kann sich meines Erachten nur auf fränkische Reichsunterthanen beziehen, folglich sind auch am Eingang der Verordnung unter den Händlern, "die in den Gebieten der Slaven und Avaren reisen," fränkische Kaufleute zu verstehen, die an der Slaven= und Avarengrenze umherziehen: Diesen wird verboten, weiter als bis zu den genannten Grenzplätzen vorzugehen. An der Ostgrenze sah es damals wieder einmal recht kriegerisch aus, ein Feldzug gegen die Böhmen und Wilzen hatte eben stattgefunden, ein zweiter und ein Zug gegen die Sorben folgten im Jahre 806. In so unruhiger Zeit mag


|
Seite 122 |




|
es bedenklich erschienen sein, die fränkischen Kaufleute den Gefahren von Reisen in die Wendenländer auszusetzen. Wer bürgte dort für ihre Sicherheit, und wer verschaffte ihnen Genugthuung, wenn man sie beraubte? Es empfahl sich mehr, die Wenden mit ihren Producten an die Grenze kommen zu lassen. Ein solcher Grenz=Tauschhandel aber konnte sich nur unter Aufsicht der kaiserlichen Beamten und unter dem Schutze einer bewaffneten Macht gedeihlich entwickeln. Schon deshalb mußte er auf bestimmte Plätze, Residenzen von Grafen, beschränkt werden, wo diese dann auch die Erhebung der Zölle von den Kaufleuten zu überwachen hatten. Zugleich lernten die Wenden in diesen Grenzplätzen Achtung vor der Macht des fränkischen Reiches und seiner höheren Gesittung und Cultur, sahen auch christliche Kirchen und lernten vielleicht die Gebräuche des christlichen Gottesdienstes kennen; ihre Bekehrung konnte durch solchen Grenzverkehr vorbereitet werden. Was endlich das Waffenausfuhrverbot betrifft, so ist dies nichts als die ausdrückliche Anwendung einer längst für das ganze Reich gültigen Rechtsbestimmung auf die Ostgrenze (s. das Cap. Heristallense vom Jahre 779, c. 20). Es hat also selbst den Abodriten gegenüber nichts befremdliches, da diese unmöglich in die Zolllinie eingeschlossen werden konnten. Daß sie mit den übrigen wendischen Stämmen gleich behandelt wurden, war eine nothwendige Konsequenz des ganzen Systems. Und wenn sie in der Ausdehnung des Waffenausfuhrverbotes auch auf ihr Land eine unverdiente Härte sinden konnten, so lag es doch andrerseits nicht weniger in ihrem Interesse als in dem der Franken daß durch die Aufsicht des Grafen in Bardowiek die Sicherheit des Verkehr gewährleistet ward. Aber deutlich ist, daß, alle Wendenländer bei dieser Handelspolitik als Ausländer behandelt wurden.
Daß Karl und seiner Umgebung die Elbe als die Grenze des Reiches und, was jenseits derselben liegt, als Ausland gilt, dafür liefert auch eine Stelle in den Reichsannalen einen Beweis. Nach den Ann. Einh. stellt Karl, als Thrasco im Jahre 808 von den Dänen überrannt war, seinem Sohne, den er an die Elbe sandte, zunächst keine andere Aufgabe als vesano regi resistere, si Saxoniae terminos (das ist die Elbgrenze, da Nordalbingien 804 den Abodriten überwiesen war) adgredi temptaret, er schickte ihn also nicht ins Land der Abodriten, um diesen beizustehen, sondern hieß ihn nur die Elbgrenze schützen. Der junge Karl überschritt allerdings die Elbe und griff die Linonen


|
Seite 123 |




|
an, es scheint also, als wenn er über seinen Auftrag hinausgegangen ist. Freilich, es fragt sich, ob man sich in solchen Einzelheiten auf die Worte des Annalisten verlassen darf. Die Die Ann. S. Amandi sagen: transmisit (= er sandte hinüber ins Wendenland über die Elbe) filium suum Carolum contra eum (den Dänenkönig), ut resisteret ei; et ille reversus est in terram (er zieht sich vor dem heranrückenden fränkischen Heere zurück). Es läßt sich nicht entscheiden, welche der beiden Darstellungen die richtigere ist, doch spiegelt sich in der Auffassung der Reichsannalisten deutlich die Anschauung der Hofkreise wieder, die gewiß Karl selbst theilte, daß es vor allem darauf ankomme, die eigentliche Grenze des Reiches, die Elblinie, zu halten, daß die heidnischen Wenden nicht Glieder des christlichen Frankenreiches seien, und daß die Behauptung des fränkischen Einflusses über sie erst in zweiter Linie und eben um der Sicherheit der Elbgrenze willen Aufgabe der Reichspolitik sei. Dauernd hätte ja sicher Karl die Dänen sich nicht im Abodritenlande festsetzen lassen. Wenn Gottfried, wie der Reichsannalist (s. auch Vita Car. c. 14) sagt, C der Abodriten sich tributpflichtig (vectigales) gemacht hat, so kann dies höchstens ein leeres Versprechen bedeuten, das nicht gehalten ward, wenn es nicht etwa nur heißen soll: er erpreßte von ihnen (bei seiner Anwesenheit und nur für dies eine Mal) einen Tribut. Karl selbst sorgt durch ausgiebige sächsische Unterstützung dafür, daß ihr Herrschaftsgebiet so schnell als möglich im alten Umfange wiederhergestellt wird. Aber für den Augenblick die Abodriten preiszugeben, wo ein Zug über die Elbe - gegen Dänen, Wilzen, Smeldinger und Linonen -gefährlich war, widersprach keineswegs seiner Politik gegenüber den Wenden, deren treibendes Motiv die Sicherung der Elbgrenze war.
Und beobachten wir ein wenig genauer, was nach dem Abzuge der Dänen geschieht! Die Unterstützung, die den Abodriten geliehen wird, soll nur dazu helfen, daß die Wilzen gezüchtigt und die Smeldinger und Linonen wieder unterworfen werden, also die wendischen Grenzstämme, die Sachsen so gut wie das Abodritenland bedrohten. Sich mit dem Dänenkönig wieder ins Einvernehmen zu setzen, überläßt Karl dem Abodritenfürsten selbst, und dieser muß sich dazu verstehen, Gottfried seinen Sohn als Geisel zu stellen - wohl als Bürgschaft für künftiges gutes Verhalten, denn es scheint, als wenn er den Dänenkönig gereizt hatte (s. Ann. Einh. 809, suas ultus est iniurias etc.). -Inzwischen läßt sich Karl nicht ungerne mit Gottfried in Unter-


|
Seite 124 |




|
handlungen ein, und als diese sich zerschlagen, trifft er keinerlei Anstalten, seinen wendischen Freunden Genugthuung und Schadenersatz zu verschaffen durch einen Kriegszug, der Repressalien übt und die Rückgabe der aus Reric weggeführten Kaufleute erzwingt, vielmehr begnügt er sich damit, in Holstein eine Feste errichten zu lassen, um Angriffen der Dänen durch Nordalbingien noch jenseits der Elbe einen stärkeren Widerstand entgegensetzen zu können. Indem nun hier ein sächsischer Graf als Markgraf eingesetzt und fränkische und sächsische Mannschaft um die Feste angesiedelt wird, beginnt die Neubesiedelung von Nordalbingien, bald - nach einer allerdings nicht ganz zuverlässigen Nachricht (in der gefälschten Urkunde Ludwigs des Frommen vom Jahre 834, M. U.=B. Nr. 3), die aber doch auf guter, alter Ueberlieferung zu beruhen scheint, nach siebenjähriger Gefangenschaft also 811 - erhalten auch die 804 fortgeführten früheren sächsischen Bewohner der Gegend die Erlaubniß zur Rückkehr, und Nordalbingien wird wieder zum Reiche gezogen, dessen Grenze sich also über die Elbe nach Norden vorschiebt. Zunächst aber war Itzehoe ein Außenposten jenseits der Reichsgrenze, und der Zweck seiner Gründung die Sicherung der Elblinie. Diese war das eigentliche Ziel, das Karl sich in seiner Grenzpolitik gesteckt hatte, und die Abodriten und ihre Schicksale interessirten ihn nur insoweit, als durch ein gutes Verhältniß mit ihnen die Sicherung Elbgrenze mitbedingt war.
Noch eine andere Maßregel, die mit der Neubesiedelung von Nordalbingien unmittelbar zusammenhängt, hat man, in diesem Falle mit Unrecht, im Sinne eines Ausschusses der Abodriten aus dem Reiche aufgefaßt, die Anlegung des sogenannten limes Saxonicus. 1 ) Unsere einzige Nachricht darüber stammt erst von Adam von Bremen, (Gesta Pontificum Hammenburgensium, die um 1075 verfaßt sind, II, 15). Allein Adam hat offenbar eine Urkunde aus dem Domarchiv von Bremen benutzt (s. Invenimus und praescriptum), seine Angaben sind also glaubhaft.
Dieser limes ist nun häufig (so von Beyer und jüngst noch


|
Seite 125 |




|
von Quade in Raabes Vaterlandskunde III 2, S. 29, und von Benjes in seinem kleinen Grundriß der meklenb. Gesch., S. 15) für einen befestigten Grenzwall gehalten worden, wobei man vielfach auch die Organisation einer Mark, d. h. eines militärisch besetzten Grenzlandstriches, an diesem Wall entlang angenommen hat (so auch Beyer). Man fragt nach dem Zweck einer solchen Mark, da doch Karl mit den Abodriten in Freundschaft lebte, Dehio (I, 38) antwortet: "Karl konnte wohl für den Augenblick sie (die Wenden) seinen Zwecken nutzbar machen, nie auf die Dauer ihrer sicher sein." Noch einen Schritt weiter geht Benjes, er nimmt an, daß unter Slaomir das freundschaftliche Verhältniß zwischen den Obotriten und Franken sich abgekühlt habe. "Der Kaiser bedurfte der Hülfe der Obotriten gegen die unterworfenen und beruhigten Sachsen nicht mehr (NB. wohl aber gegen die Dänen, die stets unruhigen Wilzen, Linonen u. s. w. !); die Obotriten erschienen ihm jetzt sogar als gefährliche Nachbarn des Reichs. Um die Reichsgrenze gegen sie zu sichern, errichtete Karl der Große den limes Saxonicus, einen Grenzwall" u. s. w.
Allein die Auffassung des limes als eines befestigten Grenzwalles ist unhaltbar, wie Bangert nachgewiesen hat. Eine Abodritenmark hat Karl nicht errichtet, der limes hatte nur den Zweck einer genauen Feststellung der Grenze zwischen dem Gebiete, das den Grafen von Itzehoe unterstellt ward, und dem der Abodriten (s. Bangert s. 13 ff). Er stellte höchst wahrscheinlich die damalige Grenze dar, die die Abodriten bei ihrem Vorrücken nach Westen seit 804 erreicht hatten. 1 ) Daß Karl das Gebiet, das sie schon besetzt hatten, ihnen wieder entzogen hat, ist nicht anzunehmen. Die Maßregel beweist also auch


|
Seite 126 |




|
keinerlei Verstimmung, sondern ist nur ein neues Beispiel für Karls ordnende Thätigkeit, die mit besonderer Sorgfalt grade den Grenzen seines Reiches zugewandt war. Nicht einmal das darf man daraus folgern, daß Karl die Abodriten aus den Reiche habe ausschließen wollen. Eine solche Grenzlinie konnte doch auch zwischen zwei Gauen innerhalb des Reiches hergestellt werden, falls ihre Grenzen noch nicht fest bestimmt waren, und es ist gewiß oft geschehen. Der limes Saxonicus war allerdings zugleich Gau= und Reichsgrenze, denn Karl rechnete, wie wir gesehen haben, die Abodriten nicht zum Reiche selbst, aber nicht erst seit 809 und infolge einer Verstimmung, das Abodriten reich war vielmehr für ihn von Anfang an ein auswärtiger Klientelstaat.
IV. Die Auflösung des Bündnisses
Karl der Große hat es vermocht, länger als 30 Jahre die Abodriten in ihrem Klientelverhältniß festzuhalten und seinen Einfluß auf sie allmählich zu verstärken, zuletzt begann er auch ihre Christianisirung anzubahnen (s. o. S. 105). Sie war die Vorbedingung für ihre Aufnahme in das christliche Weltreich, und wäre Karls Wendenpolitik in gleichem Sinne und mit gleicher Energie fortgeführt worden, Slaomir wäre schwerlich so lange der einzige abodritische Christ geblieben, und es wäre schon im 9 Jahrhundert geschehen, was erst im 12. geschah: aus dem Barbarenhäuptling, der unter der Klientel des Reiches stand, wäre schon im 9. Jahrhundert ein Reichsfürst geworden. Allein es sollte anders kommen! Nur allzu schnell lockerte sich nach Karls Tode das Bündniß der Abodriten mit den Franken. Schon 817 hören wir von einem ersten Abfall, er ging von ihrem Fürsten selbst aus, der persönlich verletzt war (s. o. S. 117). Und gleich bei diesem ersten Abfall begnügten sie sich nicht damit, die Beziehungen zu den Franken einfach abzubrechen, sondern gingen sogleich zum Angriff über; mit den Dänen vereint, bestürmten sie Itzehoe, das Bollwerk der fränkischen Herrschaft in Nordalbingien (s Ann. Einh.). Noch war das fränkische Reich stark genug, ohne viel Mühe die unbotmäßigen Vasallen zu überwältigen, der Anschlag auf Itzehoe mißlang und die Streitkräfte der sächsischen Grenzgrafen genügten, den Abodritenfürsten zur Ergebung zu zwingen (718, s. Mühlbacher Regesta 658 g und Ann. Einh. 819 mit der Anm. bei Wigger p. 12, Simson, Ludwig der Fromme, I, 140 mit Anm. 6). Es


|
Seite 127 |




|
ist auffallend, daß bei der Verhandlung vor dem Kaiser abodritische Häuptlinge als Ankläger gegen Slaomir auftreten (Quem cum primores populi sui, qui simul iussi venerant, multi, criminibus accusarent. Ann. Einh.). Noch hatten also die Franken unter den Abodriten eine starke Partei für sich. Sie begegnen uns noch einmal, im Jahre 826, wo abodritische Edle - diesmal sogar ungerufen - zum Kaiser nach Jngelheim kommen und ihren Fürsten der "Treulosigkeit" anklagen (s. Ann. Einh.). Es war nicht das erste Mal, daß auch gegen Ceadrag diese Beschuldigung erhoben ward (s. Ann. Einh. 821 u. 823). Denn kaum hatte dieser den Besitz des Reiches seiner Väter angetreten so begann auch er die Freundschaft mit den Franken zu vernachlässigen und zu den Dänen in Beziehung zu treten. Ein Grund dafür wird nicht angegeben, wir werden die Veranlassung nicht in etwaiger persönlicher Kränkung zu suchen haben, sondert in den politischen Verhältnissen. Die äußere Form, in der sich die Abhängigkeit der Abodritenfürsten vom Reich ausprägte, war drückender geworden, dabei war aber vom Reiche keine entsprechende Gegenleistung mehr zu erhoffen. Der Kaiser saß fern in seinen Residenzen, aus der Nähe drohten die Dänen. Schon unter Karl hatten sie den Abodriten einen schweren Schlag versetzt, den Karl weder hatte hindern noch wieder gutmachen können, sie hatten die abodritische Seehandelsstadt Reric zerstört, die bisher ein Küstenstapelplatz für den orientalisch = nordischen Handel gewesen war, und die Kaufleute von dort nach Schleswig verpflanzt (s. Ann. Einh. 808 u. Beltz, Wend. Alterth. S. 175.) Wenn das unter Karl möglich war, was war erst unter seinem Nachfolger zu erwarten, dessen Schwäche je länger desto mehr zu Tage trat? Kein Wunder, daß der Abodritenfürst wenig Neigung zeigte, die lange Reise zum Hofe des Kaisers zu unternehmen, um dort seine Geschenke zu überbringen, mochte auch der Kaiser, wenn er kam, noch so gnädig ihn empfangen; kein Wunder, daß er sich lieber mit den gefährlichen Nachbarn ins Einvernehmen zu setzen suchte und die Herstellung guter Beziehungen zu den Dänen für eine dringendere Sorge hielt als die Pflege der Freundschaft mit den Franken. Er vermied indessen bis kurz vor dem Ende der Regierung Ludwigs offen mit ihnen zu brechen. Noch einmal - im Jahre 831 - hören wir von slavischen Gesandtschaften, die in Diedenhofen den Kaiser aufsuchten, ja dieser hielt die Zeit für gekommen, um die Bekehrungspläne seines Vaters wiederaufzunehmen. In demselben Jahre 831 ward Ansgar zum Erzbischof von Hamburg ernannt und ihm die Mission unter den Dänen,


|
Seite 128 |




|
Schweden und Wenden übertragen. Mit dem hingebenden Eifer eines ächten Glaubensapostels begann er sein Werk, doch entsprach der Erfolg der auf gewandten Mühe wenig, denn das Schwert stand nicht mehr dem Kreuze schützend zur Seite. Für die Bekehrung der Wenden geschah so gut wie nichts. 1 ) Noch immer galten die Abodriten als Untergebene des Frankenreiches, wir erfahren es im Jahre 838, wo der Dänenkönig Horich die Abtretung des Gebietes der Friesen und Abodriten verlangt (s. Prudent. Trec. Ann. 838). Und vielleicht hängt mit der Zurückweisung dieser Forderung der Abfall der Abodriten zusammen, der noch in demselben Jahre erfolgte. Es heißt zwar, sie seien wieder unterworfen (s. Prudent.), aber schon im nächsten Jahre war ein neuer Feldzug gegen sie erforderlich. Ueber dessen Erfolg wird nichts berichtet, er wird also keinen gehabt haben, und schnell gewannen die Abodriten unter den Franken einen bösen Ruf. Radbert der noch vor Ludwigs Tod eine Lebensbeschreibung Walas († 836) verfaßte, nennt sie eine gens indomabilis (die Stelle ist abgedruckt bei Wigger S. 105 a, Anm. 2, s. über sie Simson, Karl d. Gr. II, 387, Anm. 3), er wird die Meinung wiedergeben, die damals unter den Franken über die Abodriten herrschte. Derselbe Volksstamm, der unter Karl von den Annalisten Sclavi nostri (Ann. Lauresh. 798) und nostri Hwinidi (Chron. Moiss. 809) genannt wird, erscheint als ein unbezwinglicher Gegner, das foedus war in erbitterte Feindschaft umgeschlagen. Es ward auch nicht wiederhergestellt.
Ludwig der Deutsche ließ es zwar, als er den Besitz des Ostreiches angetreten, seine erste Sorge sein, die Wenden wieder in Abhängigkeit zu bringen. Es lebte in ihm ein Funke von der Energie des Großvaters, und mit durchgreifenden Maßregeln suchte er "das Land der Abodriten zu ordnen," nachdem ihr König Gotzomiuzl im Kampf erschlagen war (s. Ann. Fuld. 844). Der Erfolg war trotzdem nur vorübergehend, bald hier, bald dort lodert unter den Wenden der Brand des Aufruhrs wieder


|
Seite 129 |




|
auf, dabei besteht kein Unterschied mehr zwischen den Abodriten und den übrigen Wendenstämmen, sie sind alle gleich unbotmäßig; und wenn sie, mit Heeresmacht überzogen, sich einmal wieder zum Gehorsam und zur Tributzahlung - auch von den Abodriten wird jetzt (seit 844) Tribut gefordert sein - verpflichtet haben, so sind sie nur allzu geneigt, ihr Versprechen zu brechen, sobald das fränkische Heer den Rücken kehrt (s. z. B Ann. Xant. 844). Zuweilen endeten die Wendenzüge mit einen offenbaren Mißerfolg, so der Zug Arnulfs gegen die Abodriten im Jahre 889 (s. Ann. Fuld. 889), der letzte, von dem wir im 9. Jahrhundert hören. Man war froh, daß sie nach einiges Jahren von selbst kamen und um Frieden baten, er ward ihnen gewährt, wobei von einer Verpflichtung zur Tributzahlung nicht mehr die Rede gewesen zu sein scheint (s. Ann. Fuld. 895 und L. Giesebrecht, Wend. Gesch. I, 130). Auch dieser Friede war nur von kurzer Dauer, aus den spärlichen Nachrichten, die wir über die Schicksale Norddeutschlands aus den Jahrzehnten an der Wende des 9. und 10. Jahrhunderts besitzen, tritt uns ein überaus trübes Bild entgegen, und zu den Bedrängern Sachsens gehören neben den Ungarn und Dänen auch die Wenden, oft und weit schweifen sie über die Elbe, die der große Karl einst so kraftvoll und glücklich mit Hülfe der Wenden selbst zu schützen gewußt hatte; damals vermuthlich nahmen sie das hannöversche Wendenland in Besitz. Erst die Könige aus sächsischem Hause vermochten die Flut des Unheils wieder einzudämmen und das deutsche Ansehen jenseits der Elbe, nicht ohne blutige Kriege auch gegen die Abodriten, wiederherzustellen. 3 A Jahrhunderte aber sollten nach Karls Tode vergehen, bis die von ihm begonnene Angliederung der ostelbischen Länder an das Deutsche Reich vollendet war, und grade der Wendenstamm der zuerst von allen zu den Franken in freundschaftliche Beziehung trat, war es, der den Widerstand gegen Christenthum und deutsche Herrschaft am längsten fortsetzte, die meklenburgischen Abodriten, die Verbündeten Karls des Großen.
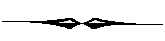


|
Seite 130 |




|



|



|
|
:
|
III.
Barnim von Werle,
Probst in Stettin und Camin.
Von
Dr. M. Wehrmann in Stettin.
~~~~~~~~~~~~~
A m 28. Februar 1317 stiftete Herzog Otto I. von Pommern=Stettin zwei neue Präbenden in der Domkirche zu Camin, von denen die eine sein Neffe (avunculus) Barnim erhalten sollte. 1 ) Es ist dies Barnim von Werle ein Sohn des Fürsten Heinrichs II. von Werle und der Mechtilde, die eine Schwester des Herzogs Otto war. 2 ) Für seine Präbende waren die Einkünfte von 12 Hufen in Sommersdorf (bei Penkun) bestimmt, die später nach dem Tode Barnims für eine Vikarei verwandt werden sollten. Der fürstliche Kanonikus wird kaum in Camin selbst residiert, sondern, wie es damals ganz üblich war, anderswo seine Einkünfte verzehrt haben. Deshalb wird sein Name unter den Caminer Domherren, die in den Urkunden der Jahre 1317 bis 1322 erwähnt werden, niemals genannt. Bald aber erhielt Barnim ein neues geistliches Amt in dem Domkapitel. In einer Urkunde vorn 2. Mai 1322 tritt uns Barnym de Werle prepositus ecclesie Stetinensis entgegen. 3 ) Propst der Stettiner Marienkirche war stets ein Mitglied des Caminer Kapitels. Barnim scheint diese Würde etwa 1321 erhalten zu haben. Am 25. April 1320 wird ein Johannes als prepositus ecclesie S. Marie Stetinensis erwähnt. 4 ) In den Urkunden der nächsten Zeit wird ein Propst nicht namentlich genannt.


|
Seite 131 |




|
Von der Thätigkeit Barnims in seiner neuen Würde als Propst zu Stettin wissen wir wenig, wir erkennen aber, daß die Verhältnisse des dortigen Domkapitels dürftig und traurig waren. Bei den fortgesetzten Kriegen, in denen die Herren des Landes sich befanden, hatten auch die geistlichen Stiftungen schwer zu leiden. Die Marienkirche hatte ihre Besitzungen hauptsächlich in der Umgegend von Stettin, und diese ward 1320 von dem Fürsten Heinrich von Meklenburg verwüstet. 1 ) Das Kapitel suchte deshalb die Einkünfte der Präbenden zu erhöhen. Propst Barnim bat am 2. Mai 1322 den Bischof Konrad die durch Herzog Otto erfolgte Schenkung von 2 Hufen in Kasekow zur Einrichtung einer kleinen Präbende zu bestätigen. Die Bestätigung erfolgte am 26. Mai. 2 ) Doch zu gleicher Zeit wandte sich das Domkapitel an den Bischof und die Herzoge mit der Bitte um Erlaubniß, zwei kleine Präbenden nach ihrer Erledigung zur Verbesserung der andern einzuziehen. Denn die Inhaber können, so heißt es wegen der geringen Einkünfte und der Schäden, welche die Güter in den Kriegsunruhen erlitten haben, ihr Leben nicht geziemend fristen. Der Bischof Konrad gab am 21. Juni seine Erlaubniß, und die Herzoge Otto und Barnim bestimmten am 22. August die Vereinigung der Einkünfte, die dann unter dem 23. August noch vom Bischofe bestätigt ward. 3 ) So erreichte der Propst wenigstens für zukünftige Zeiten eine Verbesserung der Kanonikate. Sonst ist von seiner Thätigkeit nichts weiter bekannt, nur noch einmal wird er als Stettiner Präpositus genannt. Am 29. Mai 1323 vidimieren Barnim, das ganze Domkapitel und der Prior von St. Jakobi zu Stettin zwei ehemals dem Kloster Kolbatz ausgestellte Urkunden. 4 ) Nicht gar viel später muß er seine Stelle niedergelegt haben, denn am 23. April 1324 kommt Giso von Sanne als Propst des Marienkapitels vor. 5 ) Ob etwa der Verzicht Barnims auf seine Würde mit den kirchlichen und politischen Verhältnissen Pommerns zusammenhängt, die 1324 eine entscheidende Veränderung erfuhren, läßt sich nicht erkennen, da sein Name bis 1330 in den Urkunden nicht genannt wird.


|
Seite 132 |




|
In der ersten Hälfte des Jahres 1324 starb der Caminer Bischof Konrad, 1 ) und am 24. Juni 1324 belehnte König Ludwig seinen Sohn Ludwig mit der Mark Brandenburg und den Herzogthümern Stettin und Demmin. 2 ) Damit ward der alte Streit um die brandenburgische Lehnshoheit über Pommern wieder erneuert, und es war natürlich, daß die Herzoge sich in dem Kampfe, der zwischen den Wittelsbachern und der päpstlichen Kurie seit 1323 bestand und gerade 1324 durch die Sachsenhausener Appellatian besonders heftig wurde, auf die Seite des Papstes Johann XXII. stellten. Der Zwiespalt, der durch das Reich ging, fand so auch in Pommern Eingang, besonders als Johann XXII. kraft päpstlicher Reservation die Besetzung des Caminer Bischofsamtes für sich in Anspruch nahm und durch eine Bulle vom 14. November 1324 den Dominikaner Arnold von Elz zum Bischof ernannte. 3 ) Derselbe erhielt auch bald danach die Weihe. 4 ) Gegen diesen vom Papste ernannten Bischof erhob sich im Caminer Domkapitel und in der Diöcese eine heftige Opposition. Das Haupt der äntipäpstlich und brandenburgisch gesinnten Partei war der Probst von Camin, Friedrich von Stolberg, der einen Theil der Domherren veranlaßte, einen Gegenbischof zu wählen. 5 ) Wahrscheinlich war dies Ludwig von Henneberg, des Grafen Berthold Sohn. So fand Arnold, als er in seinen Sprengel kam, den heftigsten Widerstand, den auch päpstliche Bullen nicht beseitigen konnten. 6 ) Es kam zu einem wirklichen Kampfe. Arnold fand Anhang und Unterstützung vornehmlich in Kolberg, während Köslin auf Seiten der Gegner stand. Hierbei wird der Name Barnims nie genannt; keinenfalls gehörte er zu der Partei der Feinde Arnolds, er befindet sich weder unter den Domherren, die in einer von Friedrich von Stolberg am 1. September 1326 ausgestellten Urkunde genannt werden, 7 ) noch wird er in der päpstlichen Bulle vom


|
Seite 133 |




|
24. August 1329 unter den namentlich genannten widerspenstigen Mitgliedern des Domkapitels aufgeführt. 1 ) Er hat sich offenbar ähnlich wie der Vicedominus Friedrich von Eickstedt, der spätere Bischof, von dem Streite ferngehalten, wenn er nicht überhaupt das Land verlassen hat. Denn auch in den Urkunden Arnolds wird Barnim nie genannt. Ob Barnim etwa an dem Kriege, den 1326-28 die Fürsten von Meklenburg und Werle um die Rügensche Erbschaft führten, irgendwie sich betheiligte, ist ganz unsicher und zweifelhaft Im Jahre 1329 kam endlich der Friede zu Stande, in dem Arnold als Bischof anerkannt wurde. Sein Hauptgegner Friedrich von Stolberg war in die Gefangenschaft der Greifenberger gerathen, aus der er im August befreit ward. Er legte entweder sein Amt nieder oder schied in jener Zeit aus dem Leben. Ein Theil der gegnerischen Domherren unterwarf sich andere gaben ihre Würde auf. Arnold ernannte neue Mitglieder des Kapitels. In der ersten uns erhaltenen Urkunde, die der Bischof nach Herstellung des Friedens ausgestellt hat, begegnet uns am 30. Januar 1330 Barnim de Werle als Propst der Caminer Kirche. 2 ) Er hat sich jetzt also offen an den Bischof angeschlossen und die höchste Würde in dessen Domkapitel angenommen.
Nicht lange aber sollte sich Arnold des nach langen Kämpfen errungenen Bischofsamtes erfreuen, in der ersten Hälfte des Jahres 1330 starb er. Jetzt lag die Gefahr nahe, daß der Streit um das Bisthum wieder ausbrechen würde. Es war gewiß das Verdienst des Propstes Barnim, daß derselbe vermieden wurde. Die Wahl des Kapitels richtete sich auf den Vicedominus Friedrich von Eickstedt, der sich nach Avignon begab und vom Papste am 17. September 1330 zum Bischofe bestellt ward. 3 ) Er erhielt dort die Bischofsweihe und am 29. September die Erlaubniß, sich in seinen Sprengel zu begeben. 4 )


|
Seite 134 |




|
Bischof Friedrich schloß sich eng an die Herzoge von Stettin an, die gerade damals in Verhandlung mit der Kurie traten, um dem Papste alle ihre Lande als Lehn aufzutragen. 1 ) Dieser Schritt hatte nur formelle Bedeutung, die Fürsten wollten sich auf diese Weise der märkischen Lehnshoheit entziehen. Gegen Brandenburg war auch das Bündniß gerichtet, das am 13. December 1330 der Bischof und das Caminer Domkapitel, an dessen Spitze Barnim genannt wird, mit den Herzogen schlossen. 2 ) Herrschte auch in dieser Zeit Friede zwischen Pommern und der Mark, so schürte der Papst doch weiter zum Widerstande gegen die Wittelsbacher und belehnte am 13. März 1331 die Herzoge mit ihren Landen. 3 ) Auch trafen diese im Voraus Fürsorge für einen neuen Kampf, schlossen Bündnisse mit den Fürsten von Meklenburg, Werle und Schwerin 4 ) und erhielten am 11. Mai 1331 vorn Bischof und Kapitel von Carmin eine Verlängerung der Einlösungsfrist der 1321 dem Bischofe verpfändeten Stadt und des Landes Camin. 5 ) Deshalb wohl bestätigten auch am 24. Juni 1331 der Bischof und das Kapitel eine der Stadt Camin 1274 verliehene Urkunde. 6 ) Doch die Lage des Bisthums und des Domstiftes war nicht erfreulich. Die ohnehin schon geringen Einkünfte wurden durch die Kriege und Unruhen noch verkleinert, und der Bischof mußte wiederholt Anleihen aufnehmen auch konnte er ältere Schulden der Kirche nicht bezahlen. So befreite er am 25. October 1331 das Kloster Eldena zum Ersatz für 600 Mark, die dasselbe einst der Caminer Kirche geliehen hatte, von einer Lieferung an die Gützkower Kirche. 7 ) Hierbei erwähnt er ausdrücklich die Zustimmung des Propstes Barnim von Werle, der als solcher zugleich Patron der Kirche in Gützkow war. Am 9. November 1331 erscheint er mit anderen Domherren in Stettin als Zeuge in einer Urkunde, durch welche die Herzoge Otto I. und Barnim III. den Bischof mit seinem Vasall Ludolf von Massow vergleichen. 8 ) Am 15. December 1331 überlassen der Bischof und das Kapitel der Stadt Köslin das Dorf Jamund. 9 ) Außerdem wird Barnim


|
Seite 135 |




|
in einer nur theilweise erhaltenen Urkunde, die am 27. Juni 1331 in Camin ausgestellt ist, unter den Zeugen angeführt. 1 ) So sehen wir Barnim das ganze Jahr hindurch in seinem Amt thätig und in steter Begleitung des Bischofs. Deshalb bat Pyl nicht recht, wenn er meint, daß der Greifswalder Präpositus Conrad ihn in seiner Stellung vertreten habe. 2 )
Wie elend die Lage des Bisthums und namentlich des Kapitels war, zeigt der Umstand, daß man damals mit dem Plane umging, den Bischofssitz von Camin nach dem Kloster Belbuck zu verlegen. Man wandte sich deshalb an den Papst und dieser beauftragte am 5. Februar 1332 einige Aebte mit der Untersuchung der Angelegenheit. 3 ) Es heißt in der Bulle, daß der Bischof, das Kapitel und die Herzoge die Verlegung wünschten, da die Domkirche vollständig unbefestigt außerhalb der Stadtmauern liege und auch durch Brand und Raub völlig verwüstet sei, während das Prämonstratenserkloster Belbuck auf einem sehr festen und vertheidigungsfähigen Orte belegen sei. Woran der Plan gescheitert ist, wissen wir nicht. Geldmangel war es gewiß auch, was den Bischof, Propst und das ganze Kapitel veranlaßte, am 21. Februar 1332 eine Salzhebung in Kolberg an die dortige Domkirche zu verkaufen. 4 )
Im Sommer brach der Krieg zwischen Pommern und Brandenburg wieder aus. Die Märker wurden am 1. August 1332 am Kremmer Damm besiegt. 5 ) An dieser Schlacht soll auch Bischof Friedrich, der ja mit den Herzogen im Bunde stand, Theil genommen haben, von dem Propst und den anderen Domherren erfahren wir nichts. Am 22. August befanden sie sich wieder in Camin und verkauften abermals dem Kolberger Domkapitel zwei Dörfer für 1600 Mark slav. Pfennige. 6 ) Ebenso überließen sie am 30. September 1332 eine andere Salzhebung an eine Kolberger Vikarei. 7 ) Auch sonst berichten die Urkunden von manchen Verkäufen, die der Bischof instante tempore solucionis servicii camere curie Romane et propter guerras et


|
Seite 136 |




|
terrarum desolationem vornehmen mußte. 1 ) Am 28. December bezeugen Friedrich, Barnim und das Kapitel, daß das Kolberger Domkapitel ihnen 20 Mark Pfenn. jährlicher Einkünfte aus Greifenberg für eine Hebung von 4 Last Salz überlassen habe. 2 ) Auch der Papst Johann XXII. gestattete dem Bischofe am 14. Januar 1333, von den geistlichen Personen, die geistliche Lehen in der Caminer Diöcese besaßen, ein subsidium charitativum zu erheben. 3 )
Als Dompropst wird Barnim noch am 10. März 1333 erwähnt. 4 ) Bald darauf muß er seine Würde niedergelegt haben, bereits am 6. Juni desselben Jahres erscheint Konrad, der bisherige Präpositus in Greifswald, als Propst des Caminer Domkapitels. 5 )
Daß Barnim damals nicht gestorben ist, bezeugt die Urkunde vom 24. Juni 1335, in der die Herzoge Otto I. und Barnim III. bewilligen, daß die einst für ihren Vetter Barnim von Werle gestiftete Präbende in Camin für den Fall der -Erledigung aufgehoben und die Besitzungen den gemeinsamen Einkünften der Domherren zugelegt werden sollen. 6 ) Hier wird Barnim als noch lebend erwähnt.
Schon Kirchberg berichtet in seiner Reimchronik, daß Barnim in das Kloster Kolbatz eingetreten sei. Diese Nachricht wird bestätigt durch eine Urkunde vom 9. Juni 1339, in der Herzog Barnim III. dem Kloster Stolp an der Peene eine Schenkung zur Unterhaltung von zwei Lampen in der Kirche macht. Hier wird unter den Zeugen dominus Barnym de Werle professus in Colbaz genannt. 7 ) Wenn man gemeint hat, daß der Mord von 1291 die Veranlassung zu dem Eintritte Barnims in das Kloster gewesen sei und er dadurch die furchtbare Tat seines Vaters habe sühnen wollen, 8 ) so erscheint das schon in Anbetracht der Länge der zwischen 1291 und 1333 liegenden Zeit etwas weit hergeholt.


|
Seite 137 |




|
Ein Eintreten in ein Kloster war doch damals nicht so etwas Außergewöhnliches, daß eine ganz besondere Ursache dafür zu suchen wäre. Es kann ja der Wunsch nach Ruhe den alternden Barnim zu dem Schritte veranlaßt haben. Weitere Nachrichten über ihn fehlen ganz. Abt des Klosters Kolbatz, wie behauptet wird, war Barnim nicht, auch haben die Mönche in ihren Annalen oder dem Nekrologium nichts über ihn aufgezeichnet. So verschwindet der Sproß des werlischen Fürstenhauses, der zwei hohe Kirchenämter Pommerns in bewegter Zeit bekleidet hat, für uns in der Stille des Klosters.
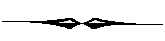


|
Seite 138 |




|



|



|
|
:
|
IV.
Das Amt der Goldschmiede zu Güstrow
und
der Güstowsche Goldschmied Matz Unger.
Zwei Beiträge zur Handwerksgeschichte
von
Dr. F. Crull in Wismar.
~~~~~~~~~~~~
I.
Da im Verlaufe der kirchlichen Umwälzung im 16. Jahrhundert allenthalben das Silber und das Gold, welches viele Generationen hindurch der Frommsinn zum Schmucke des Kultes, zu Ehren Gottes und seiner Heiligen dargebracht hatte, aus den Kirchen, Klöstern und Kapellen heraus geholt wurde, so gelangte eine höchst bedeutende Menge edlen Metalls in den Verkehr; kann man doch den Werth der in Wismar beschlagnahmten Kirchengeräthe auf mindestens 1100 Mark Silber oder rund 15000 Thaler schätzen und soll das in Lübeck confiscirte Kirchensilber, von Gold und Edelsteinen abgesehen, 96 Centner betragen haben. Rechnet man dazu die einbehaltenen Renten und unterschlagenen Hauptstühle, welche geistlichen Personen oder Stiftungen zuständig waren, so kann es nicht Wunder nehmen, wenn die ohnehin bei Männern wie bei Weibern vorhandene Liebhaberei, mit goldenem Geschmuck sich herauszuputzen und die Schenkscheiben oder Credenzen mit Silbergeräth auszustatten, in so erheblicher Weise sich steigerte, daß das Goldschmiede=Gewerk reichlich Ersatz fand für die ehemalige Kirchenarbeit und von hervorragender Wichtigkeit blieb. Seine Bedeutung in jener Zeit erweist schon der Umstand, daß in der Polizei=Ordnung, welche die Herzöge Johann Albrecht und Ulrich 1562 erließen, unter den vierzehn besonders darin Berücksichtigten Aemtern die Goldschmiede und deren Ordnung


|
Seite 139 |




|
an die vierte Stelle gesetzt sind, wie das auch in der Polizei=Ordnung von 1572 geschehen ist, und nicht minder geht die Wichtigkeit, welche man den Goldschmieden derzeit zuerkannte, daraus hervor, daß auf Vorstellung derselben die gedachten Landesherren, wenn nicht vor, so doch Anfangs 1562 ihre Beschränkung in den Städten auf eine feste Zahl, das Schließen der verschiedenen Aemter bewilligt haben, nachdem die Polizei=Ordnung von 1516 bereits allgemein verordnet hatte, daß die Obrigkeiten, um etwaiger Ueberfüllung eines oder des anderen Gewerkes vorzubeugen, nicht mehr Meister zulassen sollten, als von Alters gewesen und wie es Noth thue. 1 ) Auf jeden Fall werden die Goldschmiede dies Privileg dankbarlichst empfangen und auf dessen Beachtung gehalten haben, wie es auch kaum einem Zweifel unterliegt, daß in allen denjenigen Landstädten, wo es Goldschmiede gab, das Schließen stattgefunden hat; in Rostock griff es 1569 Platz, in Wismar erst i. J. 1610. In Güstrow wurde das Amt mit sechs Meistern geschlossen, einer ansehnlichen Zahl, da man in Rostock das Amt mit neun Meistern schloß, aber erklärlich dadurch, daß Güstrow inmitten einer reichen Landschaft belegen und seit uralten Zeiten eine Residenz der Werleschen Herren, seit 1555 diejenige Herzog Ulrichs zu Meklenburg war, welcher dem Goldschmiede Gewerke besondere Huld zuwandte.
Da es in Güstrow 1516 an Aemtern nur die der Bäcker, Gerber, Knochenhauer, Pelzer, Schmiede, Schneider, Schuhmacher und Wollenweber gab, 2 ) so scheinen die Goldschmiede daselbst vor der Schließung corporativ nicht organisirt gewesen zu sein, keine Rolle besessen zu haben, und es wurde wohl in Folge dessen am 26. April 1562 von den gesetzten sechs Meistern eine "Vergleichung" aufgerichtet nach der Weise, wie es überall im Römischen Reiche gehalten würde. 3 ) Durch diese Vergleichung wurden vor


|
Seite 140 |




|
Allem die inneren Verhältnisse des Amtes geordnet, doch berührte dieselbe in ihrem letzten Artikel auch das öffentliche Interesse, insofern solcher festsetzte, wie viel jeder Meister für seine Arbeit nehmen sollte. Kaum beschlossen, wurde der Artikel aber auch schon wieder hinfällig, da die in demselben Jahre herausgegebene landesherrliche Polizei=Ordnung die Goldschmiede auf eine von der Polizei=Ordnung von 1572 (unter Abänderung eines Ansatzes und Hinzufügung eines neuen) beibehaltene Taxe verpflichtete, deren Bestimmungen mit jenen der Vergleichung sich in keiner Weise deckten. Aus irgendwelchem, nicht vorliegendem Anlasse haben dann die Güstrowschen Goldschmiede 1590 ihre "schriftliche Verfassung oder Rolle" -- eben die "Vergleichung", vielleicht ohne den Schlußartikel - bei Hofe eingereicht und um deren Confirmation gebeten, welche Herzog Ulrich ihnen auch unter dem 4. März gedachten Jahres zu Theil werden ließ, jedoch nicht ohne Veränderungen und Zusätze, auch Streichungen mehr oder minder bedeutender Art. 1 ) Nachdem dann Herzog Hans Albrecht in Güstrow zur Regierung gekommen war, hielt das Amt auch bei diesem um Bestätigung an, die, gleichen Lautes wie diejenige Herzog Ulrichs, am 24. November 1612 erfolgte, vermehrt durch einen Artikel, welcher die Goldschmiede gegen Beeinträchtigungen ihres Gewerbes Seitens der Schotten, Leinwandkrämer und anderer Hausirer schützen sollte. Weitere Rollen oder Privilegien der Goldschmiede liegen nicht vor und sind auch kaum erlassen, da letztere bei dem Elende der nächsten hundert und mehr Jahre schwerlich Muth, aber auch keinen Anlaß gehabt haben werden, solche zu suchen, wie auch die wenigen, unten zu erwähnenden Willküren, welche das Amt in dieser Zeit gemacht hat, von geringster Bedeutung sind. - Erst durch die Rolle wurden die Goldschmiede zu Güstrow ein vollgültiges Amt, und das erkannten sie auch recht wohl und legten sich damals, um ihre Stellung kund zu thun, ein Siegel zu, welches noch heute vorhanden und in Gebrauch ist. 2 )
Die für das Amt gültige Ordnung setzte sich aus folgenden Bestimmungen fortan zusammen.
Vor Allem wurden die Meister verpflichtet, keinen Jungen auf eine kürzere Lehrzeit als eine vierjährige anzunehmen. Das ist auch allezeit strenge innegehalten worden und sind von 1580


|
Seite 141 |




|
bis 1700 ein Viertel der eingeschriebenen Jungen auf vier Jahre, die Hälfte auf fünf, ein knappes Viertel auf sechs Jahre, vier auf sieben und fünf auf acht Jahre angenommen; in diesen letzten Fällen wird der Meister die Jungen "in Kleidern und Leinen" gehalten und durch die unbelohnte Arbeit des erfahreneren Burschen sich zu entschädigen gesucht haben. In der Zeit von 1701 bis 1800 lernten zwei Jungen acht Jahre, acht Jungen sieben Jahre und die übrigen 21 sechs Jahre, so daß also in dieser Periode die Lehrzeit eine längere gewesen ist, ohne daß doch die Burschen mehr gelernt hätten als vordem. Die Annahme von solchen sollte nach einer noch im 16. Jahrhundert gemachte Willkür stets in Gegenwart zweier Amtsbrüder geschehen, und mußten dabei Bürgen gestellt werden, Bürgen vermuthlich für ehrliches Herkommen des Jungen und für Schadloshaltung von Meister und Amt, falls diese während der Lehrzeit des Burschen durch ihn Schädigung erfahren sollten. An die Lade, die Kasse des Amtes, hatte der Junge 2 fl. zu entrichten und sollte, wie eine gleichfalls im 16. Jahrhundert gemachte Willkür bestimmte, 4 fl., mehr oder weniger, zahlen, wenn das Einschreibegeld nicht mindestens während der Lehrzeit berichtigt war und der Junge nach Ablauf seiner Zeit einen Lehrbrief forderte. Später, im 17. Jahrhundert und folgend, wurde für das 1654 zuerst erwähnte Ausschreiben bei Beendigung der Lehrzeit eine Gebühr von 4 fl. 12 ß, beziehentlich 2 Thlr. 12 ß N C gefordert und für den Lehrbrief selbst 4 fl. oder - die Ansätze sind nicht überall gleichmäßig - 4 fl. 12 ß bezahlt.
Wie die weitaus größte Zahl der Amtsrollen enthält diejenige der Güstrowschen Goldschmiede so wenig wie deren "Vergleichung" eingehendere Bestimmungen ist Betreff der Gesellen, und beide setzen nur fest, daß kein Meister sich unterfangen solle, einen Gesellen, welcher schon bei einem anderen Meister des Amtes in Arbeit gestanden, ohne des letzteren Einwilligung zuzusetzen bei Strafe von einer Mark löthig, d. i. 17 Mk. Münz, welche, wie die Rolle vorschreibt, dem Amte zu Gute hinterlegt werden sollten, doch geht aus einer tragischen Geschichte, welche sich 1576 zutrug und von einem Aeltermanne, wie es Scheint im Amtsbuche aufbewahrt worden ist, wenigstens das hervor, daß kein Geselle auf eigene Faust arbeiten oder Handel treiben durfte, und daß Meister und Gesellen treu zusammenstanden, wo es die Ehre, wenn nicht des Amtes insbesondere, so doch ihres Gewerkes galt. 1 )


|
Seite 142 |




|
Sprechen sich Vergleichung und Rolle bezüglich der Gesellen nur äußerst wenig aus, so sind deren Bestimmungen über die Meister und insonderheit über das Meisterwerden um so ausführlicher. Suchte ein Geselle Aufnahme in das Amt, so lag es ihm zunächst ob, ein obrigkeitliches Zeugniß über sein ehrliches Herkommen, einen Geburtsbrief und ein Zeugniß von dem Amte, in dem er gelernt, darüber, daß er seine Lehrzeit ordnungsmäßig bestanden habe, einen Lehrbrief, beizubringen, sowie weiter nach zuweisen, daß er drei Jahre ohne Unterbrechung bei einem und demselben Meister nämlich des Güstrowschen Amtes, was zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber nach der Analogie der Rollen anderer Städte nicht zu bezweifeln ist - gearbeitet habe; würde der Geselle die drei Jahre unterbrochen haben, so sollte er dieselben noch einmal von vorne anfangen. Konnte er diese Nachweisungen befriedigend geben, so hatte er, jedenfalls in einer der durch die Polizei=Ordnungen zugelassenen Morgensprachen oder feierlichen Amtsversammlungen, seine Bewerbung vorzubringen und bei Annahme derselben einen Thaler zu erlegen. Solche Bewerbung konnte aber bei der Geschlossenheit des Amtes nur in dem Falle stattfinden, wenn einer der sechs Meister gestorben war oder wenn einer derselben aus irgendwelchem Grunde das Arbeiten aufgeben wollte. In letzterem Falle schloß der arbeitsmüde Meister mit einem Gesellen, welcher sich zu setzen wünschte und hinreichend Gewähr leistete, eine Art Kaufvertrag ab (wie das z. B. auch in Hamburg geschah, aber auch durch die dortige Rolle von 1599 1 ) verboten ist. Aus Güstrow liegt ein Beispiel solcher Transaction vor, indem Nicolaus Weckmann 1601 sein Amt an Gerd Goldberg überließ, wofür dieser dem Amte aber, wie es scheint, Abtrag thun mußte. Für Fremde konnte eine Bewerbung um einen leer gewordenen Platz nur dann thunlich sein, wenn nicht Söhne von Meistern sich um denselben bewarben oder Gesellen, die eines Meisters Tochter ehelichen wollten. Die Rolle von 1590 hat diese Bestimmung als nicht unbillig anerkannt, selbige jedoch insoweit zu ermäßigen gesucht, daß sie anordnete, es sollten Fremde, falls sie sonst den Anforderungen Genüge leisteten, nicht einzig deswegen abgewiesen werden, weil sie sich weigerten, eine Meisterstocher zur Ehe zu nehmen. Die Rolle gestattete auch, daß Meisterswittwen das Handwerk durch taugliche Gesellen ein Jahr lang fortsetzen durften (vielleicht in der Voraussetzung, daß während dieser Zeit ein Geselle sich finden werde,


|
Seite 143 |




|
welcher sie wieder ehelichen möchte), eine Licenz, welche die Goldschmiede selbst Ende des 17. Jahrhunderts in Einklang mit der Polizei=Ordnung noch dahin erweitern, daß sie den Wittwen allgemein gestatteten, mit tüchtigen Gesellen die Arbeit fortzusetzen. Waren nun die vorstehend angegebenen Bedingungen erfüllt, so hatte nach der Vergleichung der fremde Bewerber 8 Thlr. zu zahlen und nach Fertigung des Meisterstücks, zu welchem er jetzt zugelassen wurde, binnen Jahresfrist weitere 8 Thlr., Gebühren, welche die Rolle auf die Hälfte herabgesetzt hat. Zugegeben hat diese aber bestimmt, daß ein Meisterssohn oder eine Meisterstochter, bezw. deren Ehemann, nur die Hälfte der Gebühren, zahlen sollte, ebenso wie nach der Vergleichung die Wittwen heirathenden Gesellen, bezüglich welcher die Rolle nichts festsetzt. Das Geld sollte, wie letztere vorschreibt, in die Lade gelegt, also nicht etwa, wozu große Neigung vorhanden gewesen sein mag, im Amte vertheilt werden. Wenn dann noch die Vergleichung vor Anfertigung des Meisterstücks ebensowohl wie nach Fertigstellung desselben eine Collation zu Mittag und Abend von vier guten Gerichten, Butter und Käse ungerechnet, nebst der erforderlichen Menge von Bier und Wein verlangte, so hat die Polizei=Ordnung dergleichen Schmausereien schon überhaupt untersagt, und spricht daher auch die Rolle nicht weiter davon, doch werden die Güstrowschen Goldschmiede, wenigstens so lange sie im Fett saßen, auf ein Mahl schwerlich ganz verzichtet, und nur auf "Kösten", wie sie 1584 Herman Goldberg und Valentin Krüger "gleich den vorigen Meistern" noch ausgerichtet haben, nicht weiter gehalten, sich mit einer einzigen Mahlzeit begnügt haben. Gäste, die nicht zum Amte gehörten, sollten übrigens ohne dessen Genehmhaltung, wie die Vergleichung will, nicht an dem im Hause eines Meisters zu veranstaltenden Feste theilnehmen.
Nunmehr ging es an die Anfertigung des Meisterstücks oder der Meisterstücke, welche in einer vom Amte bestimmten Werkstatt, deren Inhaber jedenfalls dafür zu entschädigen war, binnen zwei Monaten zu geschehen hatte, während welcher der das Amt begehrende Geselle, der Jungmeister, weder Jungen noch Gesellen halten durfte, widrigenfalls seine Arbeit nichts gelten sollte. Es begriff aber die Aufgabe: 1. ein Trinkgefäß mit einem gedoppelten Bauche, hohem Mundstücke und einem Deckel, also ein Pokal, der hiernach mehr dem Willkomm des Wismarschen Krämer=Amtes, 1 ) als demjenigen im Siegel der Güstrowschen


|
Seite 144 |




|
Goldschmiede geähnelt hätte; 2. einen goldenen Ring mit einem Steine darin und 3. ein Petschaft mit einem vollständigen Wappen, und kein Bewerber um das Amt war von der Herstellung dieser Arbeiten befreit. Als aber der allgemeine Wohlstand in Abnahme gerieth, als nach Pokalen keine Frage mehr war, gestattete das Amt den Jungmeistern auch andere Gegenstände als Meisterstück zu arbeiten und zwar solche, von denen letztere hoffen konnten, daß sich Abnehmer dazu finden möchten, wie das auch an anderen Orten geschehen ist. Eine Bestimmung, wie es gehalten werden sollte, wenn das Meisterstück nicht genügte, fehlt in der Vergleichung sowohl wie in der Rolle und wie überhaupt ist den meisten alten Rollen, doch scheint es, als ob schon im 16. Jahrhundert mindere Fehler durch eine Zahlung an das Amt wett gemacht werden konnten, da, anscheinend 1576, Gerd Oemeke wegen Mängel an seinem Meisterstück 10 Thaler zu zahlen verurtheilt worden ist. 1 )
Wenig erfreulich ist es, daß die Güstrowschen Goldschmiede für nöthig befunden haben, in ihre Vergleichung das Verbot aufzunehmen, daß kein Meister des anderen Arbeit schlecht machen dürfe, und die hohe Strafe von einer Mark löthig auf die Uebertretung desselben zu setzen. Allerdings finden sich schon früh in den Rollen der Wendischen Städte, soweit solche vorliegen, Verbote den Genossen Kunden abzulocken, aber doch nur bei den mehr oder minder handeltreibenden Kumpanien und Aemtern, wie den Wandschneidern, Krämern, Haken, Radlern, und nur die Sattler in Lübeck haben 1502 und die Buchbinder in Hamburg in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein gleiches Verbot für nöthig erachtet, aber ganz erheblich geringere Strafen auf das Uebertreten desselben gesetzt. Da aber schon in der Rolle der Kölnischen Maler und Glaser von 1449 ein Heruntersetzen der Arbeit eines Amtsgenossen mit Strafe bedroht wird. So mag jenes Verbot auch nur den im Römischen Reiche läufigen Gewohnheiten entnommen oder deshalb für nöthig befunden worden sein, weil vor der Aufrichtung der Vergleichung, der amtsmäßigen Constituirung der Goldschmiede, unlauterer Wettbewerb, Concurrenzmacherei im Schwange gewesen ist, und die Goldschmiede einsahen, daß ohne Fernhalten jenes übeln Gebahrens ihr Amt nicht in Ehren und Würden bestehen könne. Das


|
Seite 145 |




|
Privileg von 1590, die Rolle, hat das Verbot allerdings beibehalten, die Buße für Uebertretung desselben aber auf die Hälfte heruntergesetzt; vielleicht ein Zeichen der Geringschätzung, mit welcher man in jener Zeit von oben handwerkliche Ehre anzusehen begann.
Unverändert ist aus der Vergleichung die Bestimmung in die Rolle übernommen, daß Widersetzlichkeit gegen eine von Aelterleuten und Amt erkannte Strafe Verdoppelung dieser nach sich ziehen sollte, falls nicht etwa Gnade für Recht ergehen würde.
Der letzte, in der Vergleichung nicht enthaltene Artikel der Rolle ordnet gemäß dem Schlusse des die Goldschmiede betreffenden Abschnittes der Landes=Polizeiordnungen zwei Schaumeister an, (als welche jedoch nicht die Aelterleute bezeichnet sind), die über den gesetzmäßigen Gehalt des zu den Arbeiten verwendeten Goldes und Silbers wachen und zu dem Ende alle Vierteljahre die Werkstätten besuchen sollten und diejenigen anzeigen, bei denen minderwerthige Arbeit gefunden würde. Die Polizei=Ordnungen schreiben gemäß anderen älteren Goldschmiede=Rollen das Zerschlagen solcher Arbeiten durch die Schaumeister vor und eine mindestens vierzehntägige Umschau. Man wird annehmen dürfen, daß solches Controliren, falls es überhaupt ins Leben getreten ist, sehr bald ein Ende gehabt hat.
Die Lübecker Rolle von 1400 und die Lüneburgische von 1492 untersagen ausdrücklich Verabredungen der Goldschmiede bezüglich der Preise, und wenn ein solches Verbot in den Rollen von Hamburg und Wismar nicht enthalten ist, so wird doch jenes in diesen beiden Städten ebensowenig gestattet gewesen sein. Die Güstrowschen Goldschmiede aber haben, als sie ihre Vergleichung aufrichteten, diese, wie oben bereits erwähnt, mit einer Arbeitstaxe abgeschlossen und eine Strafe für diejenigen unter ihnen festgesetzt, welche sich unterfangen würden, unter derselben zu arbeiten. Diese Taxe hat zur Grundlage die Gegenstände, welche hergestellt wurden, und die darauf zu verwendende Arbeit. Als billigste Arbeit ist die an Tellern und Schüsseln geschätzt, da für jedes Loth 3 ß Arbeitslohn gerechnet werden sollten. Die Arbeit an Löffeln wurde gesetzt zu 3 ß 6 Pf., auch wohl bei reicherer Ausstattung zu 4 ß, wie auch für Hammerarbeit an Bechern 4 ß für das Loth verlangt wurden. "Reutersche große Arbeit" (Poke oder Dolche und Schwerter?) sollte mit 4 ß 6 Pf. berechnet werden und die Arbeit an Messerscheiden und sonstiger "kleinen" Arbeit mit 5 ß. Endlich sind 6 ß angesetzt für


|
Seite 146 |




|
"geschnittene und eingelassene " Arbeit - Niello - und ebensoviel für "größeste" Arbeit. Diese Taxe wird kaum Nachachtung gefunden haben, da die im selben Jahre, in dem sie aufgerichtet war, promulgirte Polizei=Ordnung, wie bereits erwähnt, eine Taxe festsetzte, die durchaus andere Sätze hat. Sie billigte den Goldschmieden für gewöhnliche Arbeit 3 ß Lüb., für durchbrochene 4 ß, für. gewöhnliche getriebene und für gegossene Arbeit 5 ß für jedes Loth an Arbeitslohn zu und verfügte weiter, daß die Goldschmiede für das Loth (zu verarbeiten und, 1572,) zu vergolden, falls sie mir das Gold dazuthun würden, 10 ß 6 Pf erhalten sollten, für einseitig vergoldetes Silber einschließlich des Materials 22 ß, für beiderseitige Vergoldung und Materiallieserung 26 ß, welchen Satz die Polizei=Ordnung von 1572 auf 28 ß erhöht hat Diese fügte auch noch hinzu, daß 100 Gulden an Gold zu Ketten zu verarbeiten mit 3 Gulden Münz gelohnt werden sollte.
Außer Beobachtung dieser Taxe verlangen die Polizeiordnungen dann noch den ausschließlichen Gebrauch des Kölnischen Gewichts, die ausschließliche Verarbeitung l4löthigen Silbers, daß der Goldschmied für die gelieferte Mark sein 1 M. 2 Loth Werksilber geben sollte, Stempelung der Arbeiten mit dem Stadtwappen, dem Merk des Meisters und der Jahreszahl und verbieten das Ankaufen verdächtiger Sachen, das "Granuliren" 1 ) und das Einschmelzen gemünzten Geldes, sowie den Gebrauch geringeren Goldes als des Rheinischen, auch von Gemengen.
Ob die in der Vergleichung fehlende, aber im 5. Artikel der Rolle enthaltene Bestimmung, daß die Erlegnisse der Jung meister in einen "gemeinen Kasten", die Lade, fallen sollten, etwas Neues anordnet, oder ob durch dieselbe eine bestehende Einrichtung gesichert werden sollte, ist nicht zu erkennen. Jedenfalls hat das Amt schon vor 1590 Ausgaben gemacht, welche dafür sprechen, daß sie aus einem angesammelten Schatze bestritten worden sind, indem dasselbe bereits 1572 ist der Domkirche ein Gestühl von fünf Stellen 2 ) erbauen ließ und 1576


|
Seite 147 |




|
einen Mörser 1 ) zu gemeinsamem Gebrauche für 8 fl. 13 ß ankaufte.
Zum Schlusse haben sowohl Herzog Ulrich wie Herzog Hans Albrecht sich und ihren Erben und Nachfolgern das Einsetzen eines Freimeisters vorbehalten.
Im Besitze der Rolle, welche im Großen und Ganzen doch der von den Goldschmieden selbst aufgerichteten Vergleichung entsprach, und bei guter Nahrung mögen dieselben mit frohem Muthe in die Zukunft geschaut haben, aber theils haben Herzog Ulrich, Herzog Karl, Herzog Hans Albrecht Bestimmungen der Rolle durch Mandate und Fürschreiben durchbrochen, wie Aufzeichnungen im Amtsbuche von 1602, 1603, 1605, 1624 und 1626 erkennen lassen, theils machte der unselige dreißigjährige Krieg jener Behaglichkeit und dem Wohlstande aller Klassen ein vollständiges Ende. Bauern und Bürger, Edelleute und Fürsten, alle geriethen mehr oder minder in Bedruck oder gar in Noth und dachten weder an goldenes Geschmeide noch an Geräthe aus Silber: wie konnte unter solchen Verhältnissen ein Goldschmied sein Brot finden? Niemand drängte sich dazu, und während man im Güstrowschen Amte von 1562 bis 1626 nicht weniger als 22 Meister zählt, traten in dem gleich langen Zeitraume von 1634 bis 1698 nur 7 in dasselbe, und bestand solches 1680 und anscheinend auch 1688 nur aus dem einzigen Aeltermann, ja auch wieder 1732 nur aus diesem und noch einem Meister. Ein solcher Zustand mag ungemüthlich gewesen sein und vielleicht auch sein Bedenkliches gehabt haben, so daß der einsame Aeltermann demselben dadurch ein Ende zu machen beschloß, daß er in den angegebenen Jahren den Freimeister veranlaßte in das Amt zu treten, der dann wohl von der Anfertigung eines Meisterstücks befreit blieb, aber allerdings bedeutendere Aufnahme=Gebühren - 24 fl., 6 Thaler, 10 Thaler - zahlen mußte. Wenn es mit solchen erbärmlichen Zustande des Amtes nicht zu stimmen scheint, daß dasselbe jener Zeit eine "Kreitzmühle" (?) und 12 (?uv) Quecksilber um 23 Thaler von dem Aeltermanne kaufte, um gleiche Zeit ein Kapital von 100 fl. austhat, von dem freilich nie Zinsen einkamen und welches zur Hälfte verloren ging, auch für des Amts Kirchenstuhl, wie erwähnt, Opfer brachte, so zeugen diese Ausgaben doch nicht für einen Wohlstand der Einzelnen, sondern


|
Seite 148 |




|
wurden ohne Zweifel aus dem in besseren Tagen angesammelten Vorrath der Lade bestritten.
Wenn angegebenermaßen von 1634, bis 1698 nur 7 Meister das Amt gewonnen haben und von 1698 bis 1762 deren 10 in dasselbe getreten sind, so scheint es einen außerordentlichen Aufschwung anzudeuten, wenn in dem folgenden gleichen Zeitraume, nämlich von 1762 bis 1826, es deren 37 waren, welche in das Amt zu Güstrow aufgenommen worden sind. Das ist aber nur scheinbar so, und die unverhältnißmäßig große Zunahme bei Meister erklärt sich vielmehr daraus, daß seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in kleineren Landstädten angesessene Goldschmiede sich dem Amte in Güstrow angeschlossen haben, und zwar aus sämmtlichen Städten des Herzogthums Güstrow mit Ausnahme von Marlow, Gnoien und Platt, sowie aus Kröpelin, Sternberg, Waren und Malchow, auch aus Bützow und, auffallend genug, ein "Gold= und Silber=Arbeiter" zu Rostock Namens A. H. Kapps oder Kapse, welcher 1800, Mai 17, als "Freymeister im Ampt der Goldschmiede" in Rostock Bürger geworden 1 ) und 1801 in Güstrow ins Amt getreten ist. Von einem förmlichen Amtsbeschlusse, auch auswärts wohnhaste Meister in Güstrow ins Amt zu nehmen, liegt keinerlei Zeugniß vor, und ist es auch nicht einmal vollständig sicher, wann ein solcher erfolgt ist, und nur wahrscheinlich, daß derselbe zwischen 1760 und 1762 falle. Denn die bis zu dem erstgedachten Jahre in das Güstrowsche Amt eingetretenen Meister sind sämmtlich auch Bürger, daselbst gewesen, während der zunächst, nämlich 1762, ausgenommene Joachim Friedrich Sievers im Güstrowschen Bürgerbuche sich nicht findet und ebensowenig J. F. A. Sidou oder Sidon, der 1784, und J. Ch. Fortdran und J. A. Heiden, die 1786 eintraten. Im Amtsbuche ist aber auch ihre Ortsangehörigkeit nicht verzeichnet und nur bei den drei letzten bemerkt, daß sie beziehentlich aus Schwerin, Wittstock und Rechlin gebürtig wären; erst von 1768 an ist notirt, wo die neuaufgenommenen auswärtigen Amtsgenossen ansässig waren. Der Grund, daß solche die Aufnahme in das Güstrowsche Amt suchten, wird gewesen sein, daß sie den Jungen, welche bei ihnen lernten, die Geltung von ehrlichen Gesellen, ihr Fortkommen sichern wollten, und das Amt wird zur Aufnahme bereit gewesen sein, da es voraussichtlich davon keinen Nachtheil zu erwarten hatte, seine Lade vielmehr Vortheil daraus zog.


|
Seite 149 |




|
Als Genossen des Amtes der Goldschmiede zu Güstrow bis zum Jahre 1800 haben sich folgende Meister ermitteln lassen, deren Thätigkeit aber meist nur auswärts zu begrenzen ist. 1 )
- Jacob Grote 1562.
- Matz Kreiten, gen. Unger 1562-1589.
- Hans Krüger 1562-1577.
- Jürgen Stöver 1562.
- Nicolaus Weckmann 1562-1591, bez. 1601.
- Albrecht Hinke 1562-1594.
- Gerd Oemeke 1576-1576/80.
- David Netzebant 1583-1594.
- Herman Goldberg 1584-1613. Lernte 1573 bei Andr. Reimers in Wismar.
- Nicolaus Berkholz 1588-1613.
- Balentin Krüger 1586-1588.
- Melcher Krüger 159.-1605.
- Hans Everdes 1598-1610.
- Gerd Goldberg 1601-1602.
- Adam Stammann 1602-1613, Stiefsohn von 10.
- Jacob Blakogel oder Blackahl 1605.
- Hans Goldberg 1609-1639, Sohn von 9.
- Siegmund Kronschneider 1619.
- Christian Berkholz 1624-1634, Sohn von 10.
- Hans Hoier 1624-1629.
- Samuel Berkholz 1624-1649, Sohn von 10.
- David Medow 1626-1629, Stiefsohn von 15.
- Hans Lemke 1634-1649, Schwiegersohn von 17.
- Hans Goldschmidt 1637-1652.
- Heinrich Hölscher 1658-1706.
- Johann Lemke 1662-1669, Sohn von 23.
- Joachim Lemke 1680-1691, Sohn von 23.
- Joh. Friedr. Molstorf oder Mulstorf 1688-1709.
- Christian von Lohe 1698-1701.
- Lenhard Mestlin 1705-1739.
- Abraham Ratke 1706-1708.
- Joh. Joach. Lemke 1716.
- Andreas Wilk 1732.
- Joh. Heinr. Klähn 1733-1734.
- Christian Kielmann 1735-1745.


|
Seite 150 |




|
- Casp. Joh. Livonius 1754-1755.
- Justus Theod. Rust 1754-1764.
-
Joh. Fel. Fiddichow oder Vitzkow
(Bürgerbuch) 1760. Aus Kolberg.
Joach. Friedr. Sievers 1762. - Joh. Gottl. Schmidt aus Stettin 1765-1788.
- Joach. Heinr. Pöhls aus Wismar 1775-1778.
-
Albr. Ad. Ludw. Regenbogen aus Mirow
1778.
Joh. Friedr. Ant. Sidon oder Sidou aus Schwerin 1784. -
Frdr. Chrph. Schmidt 1786, Bürger 1798. Sohn
von 39.
Joh. Chn. Fortdran aus Wittstock 1786. -
Joh. Phil. Lomberg 1786.
Joh. Aug. Heiden aus Neglin 1786. -
Joh. Dav. Wilhelm 1787, Bürger 1767. Als
Lehrbursche von den Preußen 1759, März,
"mitgenommen" und
"somit" losgesprochen.
F. Frehse zu Boizenburg 1788.
Joach. Friedr. Jacobsen daselbst 1791.
A. C. Comstädt daselbst 1792. -
Ernst Joach. Chrph. Schmidt 1797, Sohn von
39.
Gottfr. Dan. Serrius zu Malchin 1798. - Joh. Friedr. Heinicke aus Bützow 1800, B. 1801.
Die vorstehend aufgezählten Meister waren aber nicht die einzigen Goldschmiede, welche von Errichtung der Vergleichung ab bis zum Jahre 1800 in Güstrow gearbeitet haben. Es ist oben bereits gesagt worden, daß Herzog Ulrich sowohl wie Herzog Hans Albrecht in ihren Privilegien von beziehentlich 1590 und sich und ihren Nachfolgern das Recht gewahrt haben, wie bei anderen Gewerken auch neben dem der Goldschmiede Freimeister einzusetzen. Diese wurden überall von Amtsgenossen nicht viel besser geachtet denn als Störer und Pfuscher, da sie weder der Amtsrolle Genüge gethan hatten, noch der Controle unterstanden, und weder Jungen zu amtsgerechten Gesellen ausbilden, noch solche Gesellen beschäftigen konnten, vielmehr nur auf eigenes, persönliches Arbeiten angewiesen waren. Die Mißstände und Unzuträglichkeiten, welche solche Lage mit sich brachte, haben dann im 17. und 18. Jahrhundert mehrere Freimeister bewogen, sich mit dem Amte zu vertragen und ihren Eintritt in dasselbe zu gewinnen. Das Amtsbuch enthält nur gelegentlich Aufzeichnungen, Freimeister betreffend, und ist daher bei Mangel anderer Quellen die folgende Liste derselben vermuthlich nicht vollständig.


|
Seite 151 |




|
Paul Pigge 1575-1591 (v.Meyenn, Jahrb. 62, B. S.21),
Claus Berkholz seit vor 1602,
Joachim Lemke, 1680 ins Amt tretend,
Joh. Fried. Molstorf 1688 ebenso,
Andreas Wilck 1732 ebenso,
N. Gisenhagen nach 1725,
N. Lapp nach 1726.
Beglaubigte Arbeiten Güstrowscher Goldschmiede, sei es von Amtsgenossen, sei es von Freimeistern, sind bisher nicht bekannt geworden, doch steht zu erwarten, daß Professor Schlies Forschungen im Lande zu Wenden solche demnächst nachweisen werden.
Vor mehr schon als fünfzig Jahren hat Glöckler aus einem im Güstrowschen Superintendentur= Archive erhaltenen und demnächst an das Großhgl. Geh. u. Haupt = Archiv abgegebenen Rechnungsbuche eines Goldschmiedes, als welchen er Matz Unger in Güstrow erkannte, gelegentliche Mittheilungen gemacht, 1 ) doch wird es gestattet sein, in Anlaß des Vorstehenden noch einmal auf den genannten Meister und sein Buch zurückzukommen.
Das gedachte Buch hat numerirt 99, in der That aber, da das auf Fol. 66 folgende Blatt überschlagen, 100 Blätter in schmalem Hochoctav, welche, in sechs ungleichen Lagen geheftet, anscheinend nie einen Umschlag gehabt haben. Die Eintragungen sind von vielen verschiedenen Händen gemacht und theils Niedersächsisch abgefaßt, theils Hochdeutsch, vielfach in einer Mischung von beiden, und rühren also nicht von einer und derselben Person her, sodaß Matz Unger sich der Hülfe Anderer, vielleicht seiner Gesellen, bedient hat, etwa weil er selbst der Sprache und vielleicht dazu des Schreibens noch unkundiger war als jene. Weder findet sich eine Hand irgend hervorragend, noch Spuren eines Dialectes, der auf Matz Unger bezogen werden könnte, obgleich nicht anzunehmen ist, daß er trotz langen Wohnens in Güstrow, vorab beim Schreiben, den Dialect seiner Heimath gänzlich abgelegt haben sollte. Denn Matz Unger, wie er in Güstrow nicht bloß, sondern auch auswärts, z, B. in Wismar, genannt wurde, oder Mathias Kreiten, wie sein rechter Name lautete, war nach der Inschrift seines in der Pfarrkirche zu Güstrow befindlichen Gemäldes, auf dem er mit seiner Frau an einem Tische sitzend dargestellt ist, aus Pest gebürtig und hatte 1580 - dies Jahr


|
Seite 152 |




|
steht auf der Tischdecke -- vierzig Jahre als Goldschmied in Güstrow gewohnt.
Diese in Uncialen ausgeführte Inschrift lautet folgendermaßen:
Der erbar wolgeachten Mathes Kreiten Unger genandt von der stadt Pest in Pononia, in Gustrow 40 jahr sein goltsmidt ampt fleisich gewartet, in erkentnitz Christi gelebet, der kirchen und den armen treulich fuhrgestanden, ist in Gott verstorben ano 15... den. Der erbare und tugentsame Anna. seine eliche hausfrau,
15 .. de
Jahre und Tage sind nicht ausgefüllt.
Matz Unger ist hiernach also 1540 nach Güstrow gekommen, mithin schon bei Lebzeiten Herzog Albrechts des Schönen, und nicht etwa erst, wie man vermuthen könnte, von Herzog Ulrich dorthin gezogen, der, wie die Wismarschen Goldschmiede 1583 sagten, mit ihrer Kunst sich abgab und seine Freude daran hatte. 1 ) Ebenso wenig hat dieser ihn ausschließlich beschäftigt und viel mehr neben ihm auch anderen Goldschmieden Arbeit gegeben. 2 ) Aus der Frühzeit seines Wohnens in Güstrow liegen bisher keinerlei Nachrichten vor, und die erste ist in einem Bittschreiben -an Herzog Johann Albrecht vom 7. November 1552 enthalten, durch welches er an die Zusage erinnert, daß ihm 99 fl., welche weiland Herzog Georg dem Platenschläger Peter Meyworm zu Güstrow schuldig geblieben, ausgezahlt werden sollten. 3 ) Matz Unger nennt darin Meyworm seinen Vorfahren, ist mithin Ehemann von dessen Wittwe gewesen. Von seiner Berufsthätigkeit berichtet am frühesten das Tagebuch des Stralsundischen Bürgermeisters D. Nicolaus Gentzkow, welcher Anfangs Mai 1563 in Güstrow gewesen war und bei Matz Unger eine goldene Kette und drei kleine Ringe bestellt hatte, die abzuholen er am 26. Juni einen Boten absandte. 4 ) Eine klarere Vorstellung über den Geschäftsbetrieb unseres Meisters gewähren aber theils die bereite angezogenen Rechnungsbücher Herzog Ulrichs, die von 1575 bis 1585 reichen, theils und mehr noch eben unser Journal, welches die Jahre 1574 bis 1591 umfaßt.
Die Eintragungen in letzteres sind weder in chronologischer Folge gemacht, noch haben die einzelnen Kunden ein eigenes


|
Seite 153 |




|
Folium erhalten, vielmehr haben, wie es in allen derartigen Büchern alter Zeit der Fall ist, die Schreibenden bald hier, bald da ihre Notizen eingetragen, wo immer eine leere Stelle sich darbot; zwölf Seiten sind nicht beschrieben. Auch sind bei den Notizen nur hin und wieder Jahreszahlen vermerkt zu den rund tausend einzelnen Notizen etwa 130 Mal und noch seltener Tage angegeben, so daß nur in wenigen Fällen festzustellen ist, wann ein Kauf abgeschlossen, eine Schuld contrahirt, eine Zahlung geleistet ist, ein Mangel, der neben meist ungenügenden Angaben über die Person des Käufers oder des Auftraggebers den Werth der Notizen erheblich vermindert. Es ist dem Buche auch nicht zu entnehmen, ob Matz Unger Alles, was er lieferte oder verkaufte, hat eintragen lassen, oder ob er Einzelnes, z. B. Gegenstände, über die er Schuldverschreibungen hatte, draußen ließ, welches Letztere sicher der Fall war bei einem Halsbande mit Edelsteinen und einem Ringe mit einem Rubin, welche Herzog Christopher 1587 erhalten hat. 1 ) Größere Arbeiten hat Matz Unger auf Bestellung ausgeführt, von kleineren, z. B. Löffeln und Ringen, Vorrath gehalten. Die Preise der Arbeiten, welche aus seiner Werkstatt kamen, gehen, wenn auch nicht überall, so doch meistem aus einer Berechnung hervor, der bald Münzwerthe, bald Gewichte zu Grunde liegen und öfters beide, und wenn dazukommt, daß vielfach Silber und Goldsachen angegeben und nach Goldwerth oder nach Gewicht eingerechnet wurden, so ist es nicht anders möglich, als daß die Preise oftmals durchaus unklar bleiben. Versuche, alle Ansätze klar zu stellen, würden eine ungeheure Mühe machen, über mein Vermögen, und noch dazu unnöthig sein, da genug Notizen da sind, um Aufklärung über Werthe und Preise zu geben. Der hauptsächlichste Gewinn, welcher Matz Ungers Journal zu entnehmen ist, besteht darin, daß man erfährt, was in jener Zeit von den Goldschmieden überhaupt verlangt wurde, und was insbesondere Matz Unger geliefert hat.
Da nun aber in dem Berichte hierüber auch manche Gewichts= und Werthangaben vorkommen, so scheint es nützlich zu sein, demselben Folgendes vorauszuschicken, um über jene die nöthige Klarheit zu vermitteln.
1. Das Pfund hatte 32 Loth, das Loth 4 Quentin.
2. Matz Unger hat gerechnet: 1 Gulden = 24 ß, 1 Thaler = 32 ß, 1 rheinischen Gulden = 36 ß, 1 Krone = 44-46 ß,


|
Seite 154 |




|
1 Milreis = 50 ß, 1 Ungerschen Gulden = 48-52 ß, 1 Engelotten = 75 ß, 1 Rosenobel = 122 ß, 1 dicken Thaler = 123 ß und eine Mark löthig = 17 M 1 )
3. Nach gelegentlichen Notizen im Rechnungsbuche galten zur bezüglichen Zeit in Güstrow: der Scheffel Hafer 8 ß, Erbsen
8-12 ß, Gersten 13 ß, Roggen 8-14 ß, ferner eine Ente 2 ß, eine Gans 4 ß, ein Hammel 24 ß, ein Schwein 48-120 ß, ein Ochse 144 ß.
Weitaus den größten Theil der notirten Arbeiten Matz Ungers bilden Gegenstände des persönlichen Schmucks. Armbänder sind 14 Stück verzeichnet, von denen das billigste 10 1/2 fl. kostete, die theuersten, zum Theil mit Diamanten, zum Theil mit Perlen ausgestattet, aus 29 Thaler kamen. Da Unger der Herzogin in ein Armband zwei Wappen machte, so läßt sich annehmen, daß die Armbänder aus größeren flachen Gliedern gebildet, nicht reifenförmig oder aus Ketten zusammengesetzt waren, es wäre denn, daß bloß das Schloß mit Perlen, Edelsteinen, Wappen verziert gewesen wäre.
Bedeutender war die Arbeit an Gürteln, die verschiedener Art waren und im Preise außerordentlich differirten. Es werden außer schlechthin Gürtel noch Leibgürtel, Spanische Gürtel, Gürtel zum Poke und Lannengürtel genannt. Leibgürtel werden gewöhnliche Gürtel sein, welche die Leibesmitte umfaßten, während die Lannengürtel, die schon in einer Lübecker Luxusordnung von etwa 1470 2 ) erwähnt und ihren Namen von den Platten haben werden, mit denen sie beschlagen wurden, lange, schmale Gürtel waren, welche mehr oder minder lose um die Hüften geschlagen würden und deren eines Ende lang herunter hing. Sie waren natürlich nur ein Frauenschmuck, der vielleicht einen wesentlichen Theil des bräutlichen Schmuckes bildete. Für eine Braut, scheint es, wurden 1594/5 von Herman Goldberg in Güstrow ein Gürtel, der mit Lilien verziert war, und eine Lanne gemacht, von denen jener, d. h. die Verzierungen, 5 Loth, diese dagegen 3 Pfund 30 Loth wogen. 3 ) Uebrigens verzeichnet Matz Unger im ganzen Buche nur einen einzigen Lannengürtel, den Herzog Christoph 1587 bestellte und zu dem er 18 Thlr. an den Meister auszahlte. Abgesehen von den im Buche erwähnten, schlechthin so bezeichneten 35 Gürteln


|
Seite 155 |




|
werden dreimal Leibgürtel genannt, zweimal Gürtel zu einen Pok, einmal ein langer Gürtel und zweimal Spanische Gürtel. Diese letzteren und Leibgürtel waren jedenfalls verschieden 1 ), aber ob und was die übrigen Bezeichnungen Besonderes bedeuten muß dahingestellt bleiben. Soviel sich erkennen läßt, hat Matz Unger die Gürtel, die entweder weiß blieben oder in Niello verziert oder aber vergoldet wurden, vorherrschend mit Muscheln beschlagen, obschon in jener Zeit auch vielfach anderes Ornament angewendet wurde. 2 ) Das Gewicht des Beschlages der Gürtel einschließlich Ring und Zunge oder Ort, mittelst deren man dieselben Schloß, betrug durchschnittlich 17 Loth.
Nicht recht klar ist, was man unter Handtrew zu verstehen hat, welche Matz Unger einige Male lieferte. Eine hanttruwe war im Mittelalter ein Zeichen der abgeschlossenen Verlobung und bestand entweder in einem Ringe oder in einer Bretze (Vorspann, Brustheftel, Brosche), doch ist an letztere schon wegen des Gewichtes derjenigen, welche in unserm Buche vorkommen, nicht zu denken, wie sie denn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auch kaum mehr in Gebrauch waren, obschon die Rolle der Lüneburger Goldschmiede von 1587 sie noch als Meisterstück fordert. Man wird annehmen müssen, daß es Ringe gewesen sind, wenn Ulrich v. Bülow, anscheinend 1580, ein "Handtrew" einen Goldgulden schwer kaufte, bei dem der Arbeitslohn 8 ß betrug, doch versteht man nicht, wenn notirt ist, Matz Unger habe 1581 Otto v. Lehsten "4 gulden Ringe gemacht Handtruw", Philipp Goldstein (?) einen goldenen Ring "mit 2 Handtruw", 1579 Jasper v. Flotow einen Ring "mit eynen Hantruw." Entscheidend scheint eine Notiz, nach der Matz Unger 1580 Herzog Karl 3 Hantruw=Ringe übersandte, das Stück zu 1 1/2 Thlr., von denen der Herzog einen behielt. Herman Goldberg fertigte in den neunziger Jahren für eine und dieselbe Person, offenbar


|
Seite 156 |




|
zur Hochzeit, einen Trauring im Werthe von etwa 6 M. 4 ß und einen "Hantruwring" im Werthe von 5 M. Joachim v. Maltzan erhielt von Matz Unger 1581 zu seinem Beilager nach Plau nur allein einen Trauring im Werthe von 9 Mark.
Hoikenknöpfe und zwar vergoldete, d. h. Knöpfe, um den Mantel am Halse zu schließen, sind mit einmal, fünf an der Zahl, als geliefert verzeichnet.
Auch Halsbänder begegnen auffallender Weise nur wenige. D. Hosmann (Johann oder Jesaias?) erhielt 1578 ein solches zu 80 Thalern, während der Preis für ein Halsband, welches Jungfrau Sophia v. d. Osten in selbigem Jahre erhielt, nicht angegeben ist. Reich mit Diamanten, Rubinen und Perlen ausgestattet war eins, welches Jasper v. Flotow bei Matz Unger bestellte und zu dem er ihm 79 Kronen übergab, aber noch kostbarer scheint ein Halsband gewesen zu sein, welches Herzog Christopher 1587 nebst einem Ringe mit einem Rubin für 300 Mark gekauft hat. 1 )
Vielfach sind Haken verlangt worden, in der Regel in Mehrzahl und paarweise. Meistens waren sie vergoldet; nur einmal wird erwähnt, daß sie und Niello verziert waren. Jedenfalls waren sie zum Schließen der Kleidung mittelst einer Schnur bestimmt. Das Gewicht eines einzelnen Hakens betrug im Durchschnitt ein halbes Loth.
Ein vergoldetes Hutband von 2 Loth 1 1/2 Quentin, welches 2 Thlr. 7 ß kostete, ist einmal verzeichnet und ebenso eins, anscheinend jedoch unvergoldet und mit sieben Löwen daran, welches für einen Diener bestimmt war. Sehr viel kostbarer waren die Hutkränze, wie man einen auf Herzog Ulrichs Portrait sieht. Matz Unger lieferte 1561 einen zu 18 Thlr., 1584 einen zu 17 1/2 Kronen und noch einen anderen zu demselben Preise.
Ketten waren im 16. Jahrhundert ein überaus beliebter, in mannigfachster Weise ausgestalteter Schmuck, und sind daher auch mehr als dreißig Stück solcher in Matz Ungers Buch verzeichnet, deren Gewicht sich zwischen 24 Goldgulden und 300 Goldgulden bewegte. Fast ausnahmslos waren dieselben von Gold; silberne, die auch einige wenige Male vorkommen, mögen wohl vergoldet worden sein. Die Form der Ketten anlangend, so wurden dieselben bekanntlich nicht bloß aus rundem


|
Seite 157 |




|
Draht hergestellt, sondern auch aus flachen Ringen, die künstlich gebogen und verziert wurden, 1 ) doch kamen auch reicher gestaltete vor, wie Anna v. Lehsten, geb. v. Schwetzin, zu Gottun 150 fl zu drei Panzerketten einzahlte, in deren jeder drei emaillirte Stücke sein sollten und auf einem derselben das Wappen der v. Lehsten und ihr Name, Joachim v. Maltzan aber 1581 zwei Panzerketten erhielt, in denen acht emaillirte "Stücke" angebracht waren, jedes zu 2 1/2 Thlr., und Otto v. Adrums Frau eine Kette machen ließ, welche sogar zwölf Stücke enthielt. Aus solchen "Stücken" wurden auch ganze Ketten hergestellt. 2 )
An die Ketten, auch Halsbänder, wurden kleine selbstständige Schmuckstücke, Anhängsel, pendeloques, oder nach Matz Unger Kleinode gehängt, doch scheint die Nachfrage nach solchen nicht allzu stark gewesen zu sein, da nur sechs oder sieben in unserem Buche notirt sind. Der Preis für dieselben war je nach der Ausstattung derselben äußerst verschieden, denn während Hieronymus v. Wangelin ein Kleinod zu 6 Thlr. 24 ß, die Herzogin 1582 oder 83 eins zu 8 Thlr. erhielt, lieferte Matz Unger Herzog Ulrich 1577 ein Kleinod zu 55 Thlr., und dasjenige, welches er 1587 Hans v. Rohr verkaufte, kostete gar 65 Thlr., war aber auch mit Diamanten und Rubinen ausgestattet und enthielt eine Darstellung von Christi Geburt. Vielleicht war auch die "Dreifaltigkeit" von 7 3/4 Kronen Gewicht, welche unser Meister 1581 dem D. Hofmann machte, ein Kleinod, denn die Dreifaltigkeits=Ringe sollen erst hundert Jahre später erfunden sein. 3 ) Statt eines Kleinods wurden auch Goldstücke an die Ketten gehängt, Portugalöser. und Rosenobel, besonders aber auch Portrait=Medaillons, 4 ) Conterfeis, die vom Landesherrn als Gnadengeschenke vergeben wurden. Matz Unger hat nach seinem Buche deren dreizehn für Herzog Ulrich, 1581 eins für Herzog Johann mit dessen Bildniß angefertigt und zwar für jenen in zwei Größen, für die er an Arbeitslohn einen Thaler, beziehentlich einen Gulden erhielt. Darnach kann die darauf verwendete Arbeit nicht von Bedeutung gewesen sein und nur im Gießen 5 ) der 15 1/2, beziehentlich 9 1/2 Kronen schweren Medaillons und deren Ausputzen bestanden haben. Die Formen dürften kaum von Matz Unger und vielleicht von dem Berliner Goldschmiede Heinrich


|
Seite 158 |




|
Rappost herrühren, der 1576 mehrmals einige Zeit in Güstrow beim Herzoge gewesen ist. 1 ) Uebrigens verstand auch Matz Unger in Eisen zu schneiden, da er einen derartigen, dem Herzoge gelieferten Stempel notirt hat. Was es mit dem Pfenning auf sich hatte, welchen er 1579 für Herzog Ulrich "geprägt" hat, muß dahin gestellt bleiben. Da die Herzogin denselben erhielt und das Gewicht, 9 Kronen, sowohl wie der Arbeitslohn, 1 fl, mit jenen der kleineren Conterfeis übereinkommen, liegt der Gedanke nahe, daß der Pfenning ein "Gnadenpfennig" gewesen ist, aber es steht fest, daß jene, die Conterfeis, gegossen worden sind. Merkwürdig ist, daß Levin Moltke 1581 von Matz Unger ein emaillirtes Conterfei Herzog Ulrichs auf seine Kosten - 14 Thlr. 8 ß - sich hat machen lassen.
Anhänger waren auch goldene, mit Bisam gefüllte Birnen, die aber nicht an der Kette, sondern am Armbande getragen sein werden. Eine Frau v. Buggenhagen erhielt eine solche zu 11 Thlr. und Caspar v. Flotow eine zu 18 Thlr., ungerechnet die vier Steine, mit denen sie besetzt war. Eine Muskatnuß (Muxsate), welche Claus Gamm machen ließ, kann in eben solcher Weise benutzt sein; sie wog an Gold nur eine Krone und der Arbeitslohn betrug nicht mehr als 1/2 fl. Desemknöpfe, Knöpfe mit Bisam gefüllt, mögen eben dazu gehören; für die Herzogin machte Matz Unger 1581 einen goldenen zu 15 Thlr. 12 ß und zehn silberne vergoldet zu 3 fl das Stück, welche vielleicht an das Gefolge verschenkt worden sind.
Viel verlangt wurden Knöpfe, theils einfach von Silber, theils vergoldet und auch geschnitten und vergoldet. Sie wurden aber offenbar nicht zum Schließen der Kleider gebraucht, sondern um diese, auch Gürtel damit zu besetzen. Von Gewicht waren sie nicht bedeutend; zwanzig Stück wogen etwas mehr als 4 1/2 Loth, zwanzig andere aber etwas weniger als 6 Loth, also jeder einzelne Knopf ungefähr ein Quentin.
Fünfmal wird in unserem Buche ein Schmuckstück als Madeys, Maddsie, Madey, Madei bezeichnet, viermal darunter weiblich. Bei Schiller=Lübben findet sich das Wort nicht, aber Frisch führt unter Medel an: Medeyen und citirt nach Matthesius: sammete Paret mit Medeyen oder Straußfedern. Es wird also ein Hutschmuck, aigrette, gewesen sein, welcher aus Gold und Edelsteinen hergestellt wurde, wie unser Journal ergiebt, und


|
Seite 159 |




|
man wird nicht irren, wenn man den Hutschmuck Herzog Ulrichs auf dessen öfter angeführtem Bilde für eine Madei ansieht. Eine der erwähnten kostete 14 Thlr., eine andere 18 Thlr., eine dritte sogar 27 Thlr. 20 ß. Vgl. Anlage 3.
Ringe mit edlen Steinen waren ein viel begehrter Schmuck. Am beliebtesten waren solche mit Rubinen, von denen zehn Stück im Preise von 6 1/2 bis 28 Thlr. notirt sind. Vier Ringe mit Diamanten kosteten jeder 8 Thlr. Der Preis von drei Ringen mit Saphiren schwankte zwischen 12 und 24 Thlr. Zwei Ringe mit Smaragden kosteten 3 und 12 Thlr., einer mit einem Türkis 3 1/2, einer mit einem Granaten 4 Thlr. Zwei Ringe mit Krötensteinen kamen 5 und 5 Thlr. 16 ß., zwei mit Elendsklauen 1 Thlr. 16 ß. und 2 Thlr. An goldenen Siegelringen wird nur ein einziger, für Lüdeke v. Bülow, genannt, den Matz Unger aber nicht selbst anfertigte, sondern durch Herman Goldberg schneiden ließ. 1 )
Außer den oben erwähnten Knöpfen wurden auch sehr viel Stifte - so, nicht Schiffte, wie es meist scheint, muß es heißen - zum Schmucke der Kleidung 2 ) und sonst in verschiedener Weise gebraucht. Sie waren durchweg bedeutend schwerer als Knöpfe. Wie diese wurden sie aber meist dutzendweise gekauft, und kam das Dutzend 2 Thlr. 16 ß. bis 30 Thlr., wahrscheinlich nach ihrem Gewicht und der Arbeit, welche darauf verwendet war; einmal sind Stifte erwähnt, die mit Perlen verziert waren. Genaueres über Form und Ausstattung läßt sich nach Matz Ungers Buch nicht angeben. Wie sie sind auch Steinchen verwendet.
Wenn auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Zeiten vorbei waren, wo die Mannschaft persönlich Kriegsdienste leistete, so behielten die Mitglieder derselben doch die Sitte bei, auf Festen, auf Reisen und vielleicht überhaupt in der Oeffentlichkeit Wehren zu tragen, während dies in den Städten, obwohl den Bürgern wie den Gästen schon sehr früh, wenn nicht von je, verboten war, 3 ) und es bildeten daher die Waffen in der besagten Zeit mehr einen Schmuck der Männer, als daß sie


|
Seite 160 |




|
Gebrauchsgegenstände gewesen wären, obschon sie öfters bei Zwistigkeiten, z. B. gelegentlich größerer Zusammenkünfte, zu schlimmen Dingen verwendet wurden. Die Arbeit des Goldschmiedes an denselben war aber nicht von großer Bedeutung und beschränkte sich auf den Beschlag der Scheiden, auf die Mundstücke, Ringe und Ortbänder, welche letztere, da sie leicht abfielen, am häufigsten bestellt wurden. Daß Matz Unger einen Griff, ein Stichblatt oder einen Korb geliefert hätte, dafür bringt sein Buch kein Beispiel. Uebrigens bezeichnet dieses die Wehren überall als Schwerter, und nur einmal wird Herzog Ulrich als Eigenthümer eines Rappiers oder Stoßdegens und ebenso D. Hofmann als Eigenthümer eines Tashakens, eines kurzen Säbels oder langen Messers, genannt.
Hat man nicht viel an die Schwerter gewendet, so waren Dolche oder Poke der Männer und die Messer, welche die Frauen an Ketten am Gürtel trugen, Gegenstände, mit denen erheblicher Luxus getrieben wurde. Bei den Dolchen oder Poken machte man den Knopf und das Kreuz von Silber - ob auch den Griff, das Heft? - beschlug damit die Scheide und ließ bei irgend besserer Lebensstellung das Silber vergolden, auch wohl mit Niello verzieren. Uebrigens barg die Scheide nicht bloß den Dolch, sondern neben ihm zwei Messer und einen Pfriem, deren Hefte aber auch nicht von Silber gearbeitet, vielleicht nur mit silbernen Hauben versehen waren. Die Scheide scheint, wenn nicht meist, so doch häufig mit Sammet überzogen worden zu sein. Der Preis der von Matz Unger gelieferten Poke bewegte sich zwischen 20 und 53 Thlr. Da der Beschlag der Messerscheiden bei den Frauen allein in Betracht kam, so war der Preis für diese natürlich viel geringer, dürfte jedoch zuweilen auch 20 Thlr. erreicht haben. Die Notizen in unserem Buche lassen bestimmte Kosten nicht genügend erkennen, und es ergiebt sich aus denselben nur, daß das Gewicht durchschnittlich 16 bis 17 Loth betrug. 1 )
Das Geräth anlangend, was Matz Unger herstellte, so nehmen unter demselben die Trinkgefäße, die als Becher, Trinkgeschirre, Trinkschauer, Köpfe bezeichnet werden, den ersten Platz ein. Die Becher, welche sämmtlich vergoldet waren, hatten im Durchschnitte ein Gewicht von 18 Loth, wenn auch ein Becher mit Deckel


|
Seite 161 |




|
40 1/2 Loth und ein ganz goldener, 1584 für die Herzogin gearbeiteter 50 1/2 Loth wog. Die Trinkschauer oder Trinkgeschirre waren schwerlich, wie in Schiller=Lübben nach Schmeller und Frisch (s. v. Schower) erklärt ist, große Trinkbecher, sondern das, was wir unter einem Pokale verstehen, wenn auch in einer Aufzeichnung in unserem Buche zwei Geschirre zuerst Trinkschauer und hernach Becher genannt werden. In der Regel vergoldet, hatten sie ein Gewicht von 7 oder 8 Mark, d. i. 112, beziehentlich 128 Loth. 1 ) Ein Kopf, den Matz Unger für Herzog Ulrich machte, wog unbedeutend weniger, nämlich 6 Mark 12 Loth und kam 67 1/2 Thlr., während der bloße Beschlag eines solchen (aus Maser, Steingut, Grünstein?) nur 12 D Loth schwer war. Die einmal, 1576, genannten "Maiolen", welche Matz Unger Herzog Ulrich im Gewichte von fast 3 Mark lieferte, werden auch Trinkgefäße gewesen sein. 2 ) Kannen sind nur drei verzeichnet, eine von 29 Loth zu 19 Thlr. 30 ß, eine von 33 Loth zu 28 Thlr. 6 ß und eine sogar von 10 Pfund 18 Loth, alle vergoldet und sämmtlich für Herzog Ulrich ausgeführt.
Schüsseln hat Matz Unger nur ausgebessert, aber einige Schalen, zum Theil vergoldet, geliefert, deren Gewicht sich zwischen 18 und 42 Loth bewegt. Eine bedeutende Arbeit bestand in vierzehn Confectschalen, welche er zum Geschenk für den König von Dänemark lieferte und von denen sechs 9 Pfd. 13 Loth, andere sechs 9 Pfd. 11 Loth und zwei 3 Pfd. 3 Loth 2 1/2 Q. wogen.
Ein Kommentel oder Napf hat Matz Unger nur aufgebessert, aber drei vergoldete Salsere (Brühnäpfe, Saucenpfannen) neu geliefert, welche 3 M. 1 Loth wogen. Ein viel verlangter Gegenstand waren Löffel, die, wenn sie auch hin und wieder zu 3, 5, 12, 15 bestellt worden sind, doch in den meisten Fällen einzeln verkauft wurden, was damit zusammenhing, daß Hochzeitsgäste einem jungen Ehepaare einen Löffel zu verehren pflegten, wenn auch unter besonderen Umständen von Einzelnen mehr, z. B. ein Becher, gegeben worben ist. Das Gewicht der damals bekanntlich aus einer kleinen runden Schale und einem ziemlich dünnen, in eine Traube, Figur oder dergl. auslaufenden Stiele bestehenden Löffel bewegte sich zwischen 2 und 6 Loth, doch bildeten die Schwereren nur Ausnahmen und die von 2 oder 3 Loth die Regel. Wollte man ein Mehreres thun, so ließ man die Löffel vergolden.


|
Seite 162 |




|
Außer den aufgeführten Arbeiten an Schmuck und Geräth fielen Matz Unger aber auch manche kleinere Aufgaben verschiedener Art zu, welche Gegenstände persönlichen Gebrauchs betrafen. So beschlug er dem D. Martin Bolfras ein Buch mit 7 1/2 Loth Silber, Hans Hahn ein solches mit 9 D Loth und für Herzog Ulrich ein Schreibbüchlein oder Notizbuch mit 1 3/4 Loth. Für letzteren fertigte er auch eine silberne vergoldete Büchse zu einem Seier oder Uhrwerke an, die auf 9 Thlr. 8 ß kam, vergoldete 1580 den großen Seier, den der Herzog im Wagen mit sich führte, 1 ) sammt Weiser für 10 Thlr. 28 ß und 1582 ebendenselben oder auch einen neuen für 20 Thlr. 6 ß. Ein silbernes Schreibzeug, an dem das Wappen Herzog Ulrichs vergoldet angebracht war, fast 5 Mark wiegend, erhielt dieser 1579 für 50 Thlr. 12 ß und 1580 zwei kleine silberne Laden zu 6 1/2 und 7 D Thlr. Spagirischen Unterhaltungen desselben Herzogs 2 ) diente eine silberne "Dystileren=Kruke" mit einem Helme, die 4 M. 11 1/2 Loth wog und auf 47 Thlr. 18 ß kam, ebenso wie eine silberne Spitze, die Matz auf ein Gläschen machen mußte. 3 ) Der Herzogin arbeitete er ein Kammfutter (Kammbehälter) auf, stach ihr Wappen auf einen Kelch und vergoldete diesen und fertigte einen für Hans v. Bülow von der Marnitz im Gewichte von 39 Loth an. Nehmen wir noch dazu, daß er für Herzog Ulrich eine messingene Büchse gravirt - er erhielt dafür 2 Thlr. - und dessen Wappen auf "ein Koffer gestochen hat" - dafür 3 Thlr. -, so ergiebt sich, daß Matz Unger in diesen Dingen fast ausschließlich von fürstlicher Seite beschäftigt worden ist. Einen verwandten Gegenstand aber, nämlich Zahnstocher, und zwar goldene, hat er ausschließlich Privaten geliefert, und zwar von erstaunlichem Werthe, denn dieselben wurden nicht etwa in einer Tasche, sondern offenbar und zur Schau getragen, 4 ) so daß sie auch mit Edelsteinen hin und


|
Seite 163 |




|
wieder ausgestattet wurden. Der Preis bewegte sich von 10 Thlr. aufwärts bis zu 18 Thlr. 1 )
Endlich gaben auch Jagd und der fürstliche Marstall Matz Unger zu thun. Jene anlangend, so hatte er Köcher, Pulverflaschen, Jägerschwerter zu beschlagen oder deren Beschlag zu bessern, doch waren dies Arbeiten von geringem Belange. Etwas mehr wurde auf die Jägerhörner verwendet, und erhielt z. B. der öfter genannte Hans v. Bülow ein solches, dessen Beschlag sammt "Hitzbendeken" (?) auf 14 Thlr. 6 ß kam. Was den Marstall betrifft, so ersieht man aus unserm Buche, daß, anscheinend 1579, Matz Ungers Gesellen das Hinterzeug von zwölf Pferden - dasselbe war also mit Silber beschlagen - ausgeputzt haben, und er 1580 auf dasselbe 52 Stifte und drei große und vier kleine Angesichte, d. h. Masken oder Engels= oder Löwenköpfe, wahrscheinlich in Ergänzung geheftet hat; letztere wogen insgesammt 1 Pfd. 7 1/2 Loth. Viel bedeutender war der Werth der Maulkörbe, die Herzog Ulrich erhielt oder ausbessern ließ; ein solcher kam auf 38 Thlr.
Aus dem Vorstehenden ist wenigstens das ersichtlich, daß Matz Unger Gelegenheit hatte, Goldschmiedearbeiten jeglicher Art auszuführen, und daß er eine umfängliche, mehr oder minder prunkliebende Kundschaft hatte. In dieser steht allerdings Herzog Ulrich weit voran, von Privaten aber ragten unter seinen Kunden sehr hervor Caspar v. Flotow zum Stur, Hans v. Bülow, Vater und Sohn, zur Marnitz, der Marschall Joachim v. d. Lühe und Claus v. Oldenburg zu Wattmannshagen. Alle seine Kunden aufzuzählen, würde einen unverhältnißmäßig großen Platz in Anspruch nehmen, doch mögen unter denselben zwei merkwürdige erwähnt werden, nämlich ein Pastor Michel, der 116 Loth Silber angab, aus denen fünf Dolche nebst Gürteln hergestellt werden solchen, und Christianus der Thor oder Hofjunker, dem Matz Unger einen Gürtel machte.
Arbeiten Matz Ungers sind bisher nicht bekannt geworden; es könnte sich nur um kirchliche Gefäße handeln, denn die Schmuckgegeunstände, Tafelgeräth u. s. w. sind theils aus Noth der Zeit, theils, weil sie für altmodisch befunden wurden, längst eingeschmolzen. Jedenfalls wird man annehmen können, daß er


|
Seite 164 |




|
nicht bloß im Allgemeinen ein tüchtiger Meister war, sondern auch durch seine Geschicklichkeit hervorragte, wofür ein Beweis darin vorliegt, daß der Professor David Chyträus mit Matz Unger Rücksprache nahm, als es sich darum handelte, ob der Stammbaum Herzog Ulrichs in Holzschnitt oder in Kupferstich ausgeführt werden solle. 1 )
Mit prompter Zahlung in barem Gelde bei Ablieferung von Arbeit war es zu Matz Ungers Zeit übel bestellt, und bald mußte er entweder das Ganze oder mehr oder minder bedeutende Reste eben anschreiben, bald sich mit Lieferungen von Naturalien an Korn, Vieh oder Holz begnügen, mit denen Forderungen von den Schuldnern beglichen wurden. Immerhin muß seine Kundschaft als eine gute angesehen werden, da sie ihm offenbar zu Wohlstand verholfen hat, zu dem vielleicht die Heirath mit des Platenschlägers Wittwe den Grund legte. Er besaß ein Haus, so groß und wohleingerichtet, daß sowohl Jasper v. Flotow sammt seiner Frau und Dienerschaft wie auch dessen Leute mit Pferden bei ihm einkehren und nächtigen konnten, und hatte eine Scheune, also wohl auch Grundbesitz auf dem Stadtfelde. Ueberdem hatte er auch Kapitalien ausstehen, wie sich gelegentlich aus dem Schuldbuche ergiebt, flach dem Wedige v. Maltzan 550 fl, Heinrich v. d. Osten anscheinend 150 fl, Claus v. Oldenburg 400 fl, vielleicht auch der herzogliche Secretair Melchior Dankwart zinsbar von ihm entlehnt hatten. Matz Unger verfügte aber auch über größere Summen, wie unvollständige Acten im Wismarschen Rathsarchive ergeben, da aus denselben hervorgeht, daß er 1576 den Wismarschen Schiffer Heinrich Tapperogge, welcher sich für seinen Bruder Melchior verbürgt hatte, auf 836 Thlr. verklagte und in Schuldhaft bringen wollte, der jener jedoch durch Flucht sich entzog, wegen deren Begünstigung Matz den Rath zu Wismar anschuldigte und verklagte; da der genannte Schiffer 1580 sicher nicht mehr am Leben war, ist es leicht möglich, daß jene Summe verloren worden ist.
Matz Ungers Frau wird 1588 oder 1589 gestorben sein, da er im Frühling des letzteren Jahres sich wieder verheirathet hat. 2 ) Ein alter Mann, erfreute er sich nicht lange des neuen Ehebündnisses und wird wenige Jahre nach dessen Vollzuge sein


|
Seite 165 |




|
Leben geendet haben. Das letzte ihn als lebend voraussetzende Datum ist der 21. Mai 1593, wo Herzog Ulrich ein Schreiben an Herzog Christophers Wittwe wegen einer von jenem 1587 bei Matz Unger contrahirten Schuld ausfertigte.
Von nachgelassenen Kindern ist nichts bekannt. Die Wittwe entschloß sich im Herbste 1594, wieder zu heirathen und bestellte bei Meister Herman Goldberg, welcher vielleicht als Geselle bei dem Verstorbenen gearbeitet hatte, ihm jedenfalls besonders. nahe stand, einen bräutlichen Schmuck: Lanne, Messer und Gürtel, sowie Trauring und Handtrauring, alles von ansehnlichem Werthe. 1 )
Anlage 1.
Mein vnderthenig gehorsam vnnd vorpflicht schuldige diennste seint E. f. g. alles vleiß zuuor. Gnediger Furste vnnd Her. E. f. g. Magk ich vndertheniger meynunge zu gnediger erinnerunge nicht vorhalten, Nachdeme ich Armer mhann E. f. g. fur derselbigen abreisenn vndertheniglich bericht, Wie das mein vorsarnn seliger Peter Meyworm, platenschleger alhie zu Gustrow, dem dorchleuchtigenn Hochgebornnen Fursten vnnd Hern Hern Georgenn etwann Hertzogenn zu Megkelburgk etc. seligenn Hochloblicher vnnd milder gedechtnus, E. f. g. freundlichen geliebten Hern Brodernn, laut seinenn Registern sein furstlichen gnadenn selbst personnlich ahnn Hrnisch vund zugehorigen Rustunge souil gefertigt, das Ime s. f. g. Nach zugelegter Rechennschafft siebenn vnnd sechtzig guldenn schuldig geplieben, Deß izt noch ein krage, ein pagkenel vnnd ein par Henschen vorhannden sein f. g. zugehorig, die in diese Rechenschafft mit getzogen, So hat sein furstlich gnaden auch Christoffer Blixeun halben die Ime fur etzliche Rustunge schuldig geweßenn, zwey vund dreissig guldeun zu betzalen vorheissenn vnnd zugesagt, das also die summa des ganutzenn nachstands sich Newenn vnnd Newentzig guldenn belauffen thete, So habenn E. f. g. damals mir gnedige zusagunge, gethann bey E. f. g. Hernn Brudernn fouil zu vorschaffenn, ich nun, die ich ahn seine Stadt Inn schwere schlulde gekommen, solte betzalt werdenn, Nun ist solichs E. F. g. dienern zum teil die noch vorhanndenn, vnnd Szunderlich Stellann


|
Seite 166 |




|
Wagkenitzen Solichs wissenntlich, das ehr. s. f. g. meinem vorfaren wie gemelt foliche Summam Schuldig geplieben, es haben auch Sein f. g. gemeltem E. f. g. amptman Wakenitzen beuolen daran zu sein, das ob gedachter Meister Peter forderlich Bezalt mochte werden, der mir solichs auch nicht abredig, Sundern Jedertzeit gestenndig sein wirt, Deweile dann, gnediger Furst vnnd Her, Hoch gedachter E. f. g. geliebter Her Broder got erbarmes also vnuorsehentlich vmbkommen, der selen got almechtig geruhe gnedig zu sein, Vnnd ich wie gehort In treffentlichen schuldenn meins vorfarn halben Stegke, auch heftiglichen zu betzalen gedrungenn werde, So ist derhalbenn ahnn E. F. g. Mein ganntz vnnderthenigs vnnd Embsigs Pittenn, E. F. g. Die wollenn mir Armenn Mhann Solicher wissenntlichen vnnd berechneten schuldt halber, wie mir auch hiebeuor von E. f. g. gnedige Vorheissunge geschehenn, vonn Ires geliebten gotseligen Broders gnedige gutwillige Betzalunge thun vnnd vorrichtenn lassenn, Angesehenn das mein seliger Vorfarenn solichs mit schwerer arbeit vordiennt vnnd mit grossem seinem treffenntlichen Schaden das gelt, damit ehr die platen vnnd anderst erkaufft, entlehenet vnnd ich noch teglich vngenossen vortzinsen muß, Der Trostlichenn Hoffnunge vnnd vnderthenigen zuuorsicht, E. F. g. die werdenn mir Armen mhann Jnn solichen grossenn nachteil zu meinem Ewigen vnd genntzlichen Vorderbe nicht stegken ader geraten lassenn, Sundern gnedige schleunige vorrichtunge solicher angezeigten Hauptsumma thun lassenn. Das Erkenne ich mich vmd E. F. g. als ein gehorsamer vnnd getrewer vnderthann meins armen vormugens vndertheniglichen zu uordienen Jdertzeit geflissen vnnd willig. Datum Guestrow, denn 7. Nouembris Anno etc. LII°.
vndertheniger vnd gehorsamer
Mattes Vnger.
Dem Durchleuchtigenn Hochgebornnenn fursten vnnd Hern Hernn Johanns Albrechtenn, Hertzogenn zu Megkelburgk, Furstenn zu Wenndenn, Grauen zu Schwerin, Rostock vnnd Stargardten der Lannde Herr, Meinem guedigen fursten vnd Hern vndertheniglichen.
(Original im Geh. und Haupt=Archiv zu Schwerin.)


|
Seite 167 |




|
Anlage 2.
S. 1.
Die Meister des Goldtschmide Handtwergkes alhir haben sich nachfolgendergestaldt, wie in inuorzeichnetem irem Ampts=Buch befunden wirdt, vorgeleichet, welliches auch von inen vnnd iren Nachkommen stedes vnnd vnwiderufflich sol gehalten vnnd fullenzogen werden. Geschehen vnnd vorgeleichet den 26t. Aprilis Anno etc. zwie vnnd sechtzig durch die Ersamen vnnd vornhemen O[l]terleuthe vnnd M[eistere] mit Nhamen Jacob Groten, Matz Ungern, Hans Kruger, Jurgen Stouer, Nickel Wegkmhan vndt Albrecht Hingken.
S. 3.
Nachfolgender Gestaldt haben sich die Goldtschmide zu Gustrouw, wie es im Romischen Reich durchaufs leussigk gehalten wirdth, furgeleicht, wie folget.
[1.] Erstlich sol keiner keinen Jungen vnter vier Jahren lernen,
[2.] (Sol) auch keiner kein Meister werden, [er] habe den nicht weiniger, den vier Jahr gelert mit dharleggung seines Geburts= vnnd Lierbrieues, vnnd das ehr zu erweisen hadth, [daß] ehr drie Jahr nach einander bei einem Heren gearbeidet, vnd dha ehr in den drien Jaren wurde wegkziehen vnnd darnach zu demselben Heren widerkommen, sol die Zeit des Wekzoges nicht gerechnet werden, fundern vffs Neue vffgesetzte drie Jahr widerurnb ahnfangen zu arbeiten.
[3.] Jtem. Da ein Geselle seine Zeit getreuwlich gedienet vnnd das Ampt eschen wurde, vnnd ßo ime dasselbige zugelassen, sol ehr schuldigk sein denm Ampte alßofordth nach Vorlassunge 1 Thaler zu erleggen.
[4.] Jtem. es sol auch keiner zugelassen werden, besondern es sey danne von den sechs gesetzten Meistern einer gestorben. Idoch sol allewege den Meister=Kindern, Szonen oder Dochtern, fur Fromdden der Vorzogk des Zulassens gestatet vnnd vorgunnet werden.
S. 4.
[5] Jtem. ßo ein Frombder das Ampt gewinnen wurde, sol ehr alßofordth im Ahnfange des Meisterstugkes zu machen achte Thaler dem Ampte erleggen vnnd nach Vorfertigung des Meisterstugkes sol ehr innerhalb Jahrzeit dem Ampte noch achte Thaler entrichten vnd dharleggen. Dho aber eines Meisters Szone, Dochter oder hindergelassene Widtwe freiete vnnd das Ampt forterte, sollen dieselben fur Gerechtigkeit in alles achte Taler erleggen, idoch mit vorbhaldt, das Frombde ßowol alß Meister=Kinder vnnd histde[r]gelassene Widtwen den Meistern des


|
Seite 168 |




|
Goldtschmide=Amptes in Ahnfange des Meisterstugkes zu machen so woll auch nach Vorfertigung desselben eine freie Kollatie zu geben schuldigk sein, vnnd sol vff ider Kollatien notturfftigk Wein vnd Bier nebenst vier guthen Essen Mittag es vnnd Abents, hirinne Butter vnnd Kese nicht gerechnet, gegeben we[r]den. Vnnd sol derjennige, ßo das Ampt furderdth in Ahnfange des Meistertstugkes alßofordth seinen Geburdts= vnnd Lherbrieff dharzeigen, vnnd sol die Kollation in eines Meisters Hause geschehen.
[6.] Die Meisterstugke sollen gemacht werden in einen Dringkschouwer mit einem gedubbelden Bauch vnndt hogen Mundtstugke mit eine Degken, einen gulden Ringk mit einem vorsetzten Stiene vnnd ein Sigel mit Schildt vnnd Helm, welliches vnstrefflich sein soll. Hirinnen sol keines Meisters Szone ßo wol alß frombde befreiet sein, vnnd sol das Meisterstugke innerhalb zwen Monaten gefertiget werden.
Es sol auch derselbe, ßo die Amptkoste thut, keinen Frombden ohne Erlaubnids der andern Meister bitten bei Straffe.
S. 5.
[7.] Jtem. es sol auch das Meisierstugke gemacht werden ahn dem Orthe vnnd Laden, da die Meister der Goldtschmide demselben, ßo. das Ampt geeschet, hinweisen, idoch mit disem Vorbehaldt, das ehr in derselben Zeit, weil ehr das Meisterstugke machet, sol ehr keinen Gesellen noch Jungen halten, vnnd da folliches erfaren, das hirwider gehandeldt, sol das Meistertstugke Nichtes sein vnnd nicht ahngenommen werden.
[8.] Jtem. es sol auch kein Meister der Goldtschmide einem Gesellen Arbeidt geben, der sich aus eines andern Heren oder Meisters Laden alhie, es sie mit Willen oder Vnwillen, gibt, besundern zu wellichem Heren ehr sich in den Laden widerumb begeben wil, derselbe sol des vorigen gewesenen Heren oder Meisters Willen darzu haben vnnd hiruber nicht schreiten bei Straffe eine Margk lodiges Silber.
[9.] Weil es auch leider luffügk vnnd zum Theil warhafftigk erfunden wirdth, das einer vber den Andern im Handtwergke zu seinem Selbst=Nutzen vnnd Befurderunge den Andern vorkleinerdth vnnd Vbels nachredet: dem vorzukommen, das Solliches hinfuro nicht mher geschehen sol, haben sich die Meister der Goldtschmide vorgeleichet vnnd sol auch von inen ßo wol auch von iren Nachkommen stedth, fest vnnd vnwidersprochlich gehalten werben: da nach diser Zeit solliches erfaren, vnnd derselbe, von dem es geschicht, mit Warheit vberzeuget wirdth, sol dem Ampte mit einer Marek lodiges Silber ohne alle Gnade vorfallen sein.


|
Seite 169 |




|
S. 6.
[10.] Es haben sich auch die Meister der Goldtschmide semptlich vorgeleichet, dha einer oder mher vnter inen siraffbar befunden, vnnd ime nach Werde der Strasse eikte Poene von den Olderleudthen vnnd gantzem Ampte erkant wurde, vnd ehr oder dieselben sich hirwider leggen wurden, sol ehr gedubbelte Strasse gewertigk sein. Jdoch sol ehr oder dieselben, dha sie sich gehorsamblich erziegen, durch Bitte nach Gelegenheit der Sachen mit dem Strassen gelinderdth werden.
[11.] Es haben sich auch die Meister der Goldtschmide wegen der Arbeidth vnter einander nachfolgender Gestaldth einhelligklich vorgeleichet vnd beschlossen, nemblich:
Fur ider Lodth Selber Hamer=Arbeidth ahn Bechern 4 ß. Fur schlicht Leffel=Arbeidth von iderem Lode 3 1/2 ß, nicht ringer, sunsten magk ehr wol 4 nhemen, darnach die Arbeidth gemacht wirdth.
Fur reutersche grosse Arbeidth, alß Pocke vnnd Schwerter, fol mhen nicht ringer nhemen alß 4 1/2 ß.
Fur geschnitten vnnd eingelassen Arbeidth, item grotste Arbeidth fol mhen nhemen nicht ringer: alß 6 ß.
S. 7.
Fur Messerschieden sol mhen fur ides Lodth nicht weiniger nhemen alß 5 Schillinge, sunsten magk einer nhemen fur kleine Arbeidth ßo vile ehr bekommen khan, doch sol vnter funff Schillinge nicht genommen werden.
Fur Schussel vnnd Teller ßo[I] einer nicht weiniger nhemen alß fur ider Lodth 3 Schillinge.
Da aber einer oder mher beschlagen wirdth, das ehr es weiniger wie oben gemeldt machet, sol alßo vile zur Straffe ohne jennige Einrede geben vnd vorfallen sein, so vile alse ehr Machethon von der Arbeidth empfangen.
Da auch ein Junge, ßo bei den Meistern alhei lernet vnnd seine 2 Lehergulden in Zeit seiner Lherjahr nicht außgibt, sol ehr in Forderung seines Lehrbreues, ehe ehr denselben bekumpt, dem Ampte 4 fl erleggen, doch nach Gelegenheit der Personen weiniger oder mher, wellches zu des Amples Erkentnus sol gestellet werden.
Dieser Satz ist von derselben Hand wie das Uebrige, aber später hinzugefügt. Im Amtsbuche


|
Seite 170 |




|
Anlage 3.
Anno 76. den 12t Mertii hadt eß sick zw Gustrow befunden, das ein Geßelle Frantz, van Antwerpen gebaren, ist bi ime besagen worden vnawsgermachede Aerbeidth an Golde alße nemelich ein klen Kleinodeken vnd ein Stanck zw einer Medege vnd och ennen Rinck gardeßereth midh 7 Torkes, och etlich Sulber von Kowss vnnd gekowfeth, dar an Meister vnd Geßellen einen großen Vardach[t] awff ime geschupfteth vnd an ime getzeiwelth, das er dar nicht muchte erligen bi gekommen sein, welckes sick ocg in der Dath vnd Warheidth alßo hadth befunden, das er sfeinen Vorkowfer, worher er fulkes midth Rechte hette erlangeth, nichi bewißen koninen etc. vnd befunden, das er seinen Vnderslawff bi Pawel Piggen gehapt, welkes awßerhalb vnßers Amptes geschen ist, welkes gedachtem Goltßmeide och nicht hette gebureth Geßellen bi sick awss ir egene Handt zw aerbeiden zw ßetzen. AIße feinth de Goltßmede bewogen durch sein vile dur Eden vnd Sweheren vnd vilefeldiges Bitten vnd gedach[t], das er velichte muchte vorfureth worden sein vnd van sick Geweißen willen ine weder loben noch lesteren.- Den 19 huius ist obgedachter Geßelle Franß Drimborne? van Antorpen wegen das er beslagen ist und bei im befunden, das er seinem Heren Mattes Vngeren einnen Vngerschen Gulden solte enntferdigeth vnd durch Peter Denen Weib vnd weider durch einnen gutten erligen Man Arenth Haltermanne wi der von gedachtem Weibe vbergeredeth worden, de fulkes an Jacop Großen verkowseth, und do er seines Debstals genuchsasm ist vberweißeth vnd do de Goltßmeide haben willen de Geßellen zwsammenforderen Iaßen das zw erken ge[b]en 1 ) wollen; we er das vorntercketh, ist er van den Goltsmieden awß Albrecht Hincken Howße entwichen vnd alß ein Schelm und Deib entlowfen.
Amtsbuch S. 159.
Anlage 4
Wir Vlrich von Gottes genadenn, Hertzogk zu Meckelburgk, Fürst zü Wenden, Gräue zü Schwerin, der Lande Rostock vnnd Stargart Herr, Thüen kündt vntd bekennen offentlich mit diesem Brieff für Vns vnd vnsern Erben vnd Nachkommen, Als Bns die Ersamen vnsere liebe getrewen das Ampt der Goldtschmiede


|
Seite 171 |




|
alhie zü Güstrow eine schrifftliche Verfassüng ober Rolle, welcher massen Sie sich vntereinander einmütiglich verglichen, Das es hinfürt in vnd vnter Jhrem Ampte in einem vnd anderm übelich gehalten werden solle, vnderthenig fürtzeigen lassen, Welche verfassüng oder Rolle von wortt zü Wortten laütett, wie hernach geschrieben stehet.
Erstlich: Soll keinner keinen Jungen vnter Vier Jahren lernenn.
Züm Andern: Soll auch keinner kein Meister werden, Er
S. 2.
habe dan nicht weinig ║ den vier Jahr gelernet mitt darlegüng seines gebürts vnd Lehrbrieffs, vnd das Er zu erweisen hatt, das Er drey Jahr nach einander bey einem Herrn gearbeitett, vnd da Er in denn dreyenn Jahrenn würde wegkziehen vnnd darnach zu demselben Herrn wieder kommen, soll die Zeitt deß wegkzugs nicht gerechnet werdenn, sondern Er vffs newe vffgesetzte drey Jahr wiederümb anfangenn zu arbeitten.
Züm Dritten: Da ein Gesell seine Zeitt getreülich gedienet vnd das Ampt eschen, vnnd Ihme daßelbige zügelaßen würde, soll Er schuldig sein dem Ampte alsoforth nach verlaßung einen thaler zu erlegenn.
Züm Vierten: Es soll auch keinner zügelaßen werden, es sey dan von den sechs Meistern einner gestorbenn, Jedoch soll der Wittwenn des Handtwergk durch duchtige Gesellenn zu gebrauchen ein Jharlang frey sein vnnd soll allewege denn Meister Kindern, Sohnen oder Töchtern, fur frembde der Vorzug deß zulaßens gestattet vnnd vergonnett werdenn, Jedoch daß frembde, die sonstenn Ihr Handtwergk rädlichenn gelernnet vnnd sich in andernn Puncten dieser vergleichung gemeß verhalten, vmb der einigen Vrsachen willen, das sie mitt Meister=Tochtern sich zu befreien kein lust hetten, nicht abgewiesenn werdenn sollen.
S. 3.
Zum Fünften: ║ So ein frembder das Ampt gewinnen würde, soll Er alsofort im anfange des Meisterstücks zü machenn Vier Tahler dem Ampte erleggenn vnnd nach Verfertigung deß Meisterstucks soll Er Innerhalb Jahreszeitt dem Ampte noch Vier Tahler entrichten vnnd darlegenn. Da aber einnes Meisters Sohnn oder Tochter freiete vnnd das Ampt foderte, sollenn die selben fur gerechtigkeitt in alles Vier Tahler erlegenn, Wölchs geldt in einen gemeinen Amptskasten hinterlegt vnd verwahret werdenn vnnd nach furfallender gelegenheitt zu deß Ampts notturfft angewandt werdenn soll, vnd soll der Jennige, so das Ampt fodert, in anfange deß Meisterstucks alßforth seinen geburts= vnd Lehrbrieff darzeigenn


|
Seite 172 |




|
Zum Sechsten: Die Meisterstück sollen gemacht werden in einem Drinckschower mitt einem gedoppelten Bauch vnnd hohenn Mundtstucke mitt einner Deckenn, Einen gulden Ringk mitt einem versetztenn Steinne vnnd ein Sigill mitt Schildt vnnd Helm, wölchs vnstrefflich seinn soll. Hierin soll keins Meisters Sohn so woll alß frembde gefreiet sein, vnd soll das Meisterstucke Innerhalb zweien Monaten gefertigt werdenn.
Züm Siebenden: So soll aüch das Meisterstücke gemacht werden an dem orte vnd Laden, da die Meister der Goldschmiede
S. 4.
denselben, so das Amptt geeschett, ║ hinweisen, Jedoch mitt diesem vorbehalte, das er in derselben Zeit, weill Er das Meisterstücke machet, keinenn Gesellenn noch Jungen halttenn soll, vnnd da solchs erfahrenn, daß hierwieder gehandeltt, soll das Meisterstücke nichts seinn vnnd nichtt angenommen werdenn.
Zum Achten: Es soll auch kein Meister der Goldtschmiede einen Gesellen arbeitt gebenn, derr sich auß einnes andern Herrn oder Meisters Ladenn alhie ohne deßelbenn guettenn willen begibtt, besondern, zuh wölchem Herrn Er sich in denn Ladenn wiederumb begeben will, derselbe soll deß vorigenn gewesenen Herrn oder Meisters willen darzu haben vnd hieruber nicht schreitten bey straff einer marck lottigs silbers, so dem Ampte zum besten hinterlegtt vnd angewandt werden soll.
Zum Neundten: Weil es leiber auch leüfftig vnd züm theil warhafftig erfünden württ, daß einner vber den andern im Handtwergke zu seinem Selbst nutz vnnd besoderung die andern verkleinnert vnnd denselben vbels nachredet, dem furzukommen, das solchs hinfuro nichtt mehr geschehenn soll, habenn sich die Meister der Goldtschmiede verglychenn vnnd soll auch von Jhnen sowoll auch von Ihrenn nachkommen stett, vest vnnb unwiedersprechlich gehalttenn werdenn: da nach dieser Zeitt solchs erfahrenn,
S. 5.
vnd derselbe, ║ von dem es geschicht, mit warheitt vberzeüget würde, soll er dem Ampte mit einner halben marck lötigs silbers vnachleßig verfallenn seinn.
Zum Zehenden: Es haben sich auch die Meister der Goldtschmiede semptlich verglichen, da einner oder mehr vuter Jhnenn in sachen, so zum Amte gehören, straffbar befunden, vnb Ihme nach würde der straffe eine Poen vonn denn Elterleuttenn vnnd gantzem Ampte erkandtt wurde, vnnd Er oder dieselben sich hierwieder legenn wurden, soll er gedobbelter straaffe gewerttigk sein, JIdoch soll dem oder denselbenn, da sie sich gehorsamblich erzeigenn, durch bitte nach gelegenheitt der Sachenn die straffe gelindert werdenn.


|
Seite 173 |




|
Zum Eilfften: Es sollen auch alle viertheill Jars zwey Meister aus dem Ampte vmbgehenn vnnd eines jedenn Meisters silber probieren, vnnd, bey wölchem keine rechte proba vnnd gewichtt befunden, derselbe soll der Obrigkeitt angezeigett vnnd nach gelegenheitt deß befundenen mangels andernn zum abschew in gebuerende ernste straaffe genommen werdenn.
S. 6.
mit vndertheiniger empfiger vnd vleisiger ║ pitt, das Wir solche vergleichung als der Landesfürst gnediglich Confirmiren vnd bestetten wölten, das wir demnach solche Ihre vndertheinige vleissige pitt genedig erwogen vnd angesehen vnd obinserirte vergleichung oder Rolle in allen Ihren Claüsülen, Articülen, Inhaltüngen, Meinüngen vnd Begreiffüngen vor vns vnd vnsere Erben vnd Nachkommen genedig Confiriniret vnd bestettiget haben, Confirmiren vnd bestetten aüch dieselbe hiemitt vnd krafft dies Brieffs wissentlich, Jedoch vns vnd vnsern Erben vnd Nachkommen an vnser hergebrachten gerechtigkeitt wegen einsetzüng eines freien Goldtschmiedes vnd sonsten vnnachtheilig vdn vnschedtlich. Des zu Vrkündt haben Wir diese vusere Confirrnation mitt vnserm anhang enden Fürstlichen Secret vnd Handtzeichen wissentlich becrefftigt vnnd geben zü Güstrow Mittwochens nach Esto mihi den vierten Monatstagk Martii Nach Christi vnsers lieben Hern vnd seligmachers geburt im tausent fünfhündertt vnd Neüntzigstenn Jahr.
Nach dem Orginal in der Lade des Goldschmiedeamtes zu Güstrow auf zwei Bogen Pergament in Heftform, an dem an einer rot=gelben Schnur in einer Holzkapsel das Ringsiegel Herzog Ulrichs in rothen Wachse hängt.
Ebenda befindet sich auch eine Bestätigung des Herzogs Hans Albrecht vom 24. November 1612 aus Güstrow, gleichfalls aus vier Blättern Pergament in Heftform bestehend, welche aber ein zwölften Artikel hat folgenden Lautes:
Zum Zwolften: Vnnd alßdan anietz schließlich kundt vnnd offenbar, das nicht alleine alhie zu Gustrow etliche vorteilhafftige Leutte erfunden werden, sondern auch die Schotten, Linenwants= Cramer vnnd andere Vmbstreicher das Silber ganz vorteilhaftiger Weise an sich bringen, falsche wicht gebrauchen, auch das gestolenes, geraubtes vnd ander zerschnitten, zerpegeltes vnnd zusammengeschlagenes verdechtiges Silber auffkauffen vnnd aus dem Lande hinwegk fuhren, dardurch dan das Silber zu großem


|
Seite 174 |




|
Schaden vnnd nachteill dem Goltschmide=Amptt in hoben Preiß gesteigertt vnnd fast nichtes zu Kauffe gebrachtt, vnnd auch zu stehlenn vnnd andern vnderschleif starker anlass gegeben wirt, Als soll den sempttlichen Meistern der Goltschmide, vnnd einens Jedem insonderheil hiemit erleubett sein guete achtung vnnd inquisition darauff zu geben vnnd anzustellen, das solche Schotten, Lienen=Kramer vnnd andere Vmbstreicher, so sich obbesagtermaßen des Silber=Kauffens vudernebmen wurden, betretten vnnd angehaltten werden muegen, Welche alßdan nit allein des Silbers verlustig, Sondern auch sonsten nach befindung Jhres verbrechens anderen zum abschew am leibe gestrafft werden soll ! .

Anlage 5.
| Erstlich von ihr empfangen | 68 Loht Silber. | |
| Noch Hanss Henneke mir gedan 20 Daler, ist 40 Loht. Dieses soll zur Lannen, so ich empfangen 108 Loht. | ||
Die
Lanne hatt gewogen, wie sie ist
fertig gewesen, 3
 30 Loht. So ist
von meinem Sulber dartzu
gekommen 18 Loht, ist
30 Loht. So ist
von meinem Sulber dartzu
gekommen 18 Loht, ist
|
9 Daler. | |
| Fur ider Loht zu machen und zu uorgulden 12 ß. ist | 45 Daler 27 ß. | |
| Noch ein halff Stucke zur Lannen gemacht, wicht 2 Loht weiniger 1 q. Fur das Silber, Vorguldent vnd Arbeitslohn fur ider Loht 28 ß., ist zusamen | 1 Daler 16 ß. |


|
Seite 175 |




|
Noch
von Vngerschen empfangen 1
 1 1/2 Loht Silber
zur Messerscheide vnd zum Gurtell.
1 1/2 Loht Silber
zur Messerscheide vnd zum Gurtell.
|
||
| Die Messerscheide hatt gewagenn 27 1/2 Loht, das Gurtell hatt gewogen 20 Loht, worunter sein gewesen 15 Loht vorguldete Sulber. So wicht die Messerscheide sampt dem Gurtell 47 1/2 Loht. | ||
| So ist von meinem Selber dartzu gekommen 14 Loht, ist | 7 Daler. | |
| Die 15 Loht zu machen vnd zu uorgulden, fur ider Loht 12 ß., ist | 5 Daler 15 ß. | |
| Fur die 5 Loht Lillien zum Gurtel, fur ider 4 ß., ist | 20 ß. | |
| Fur die Messerscheide zu machen | 3 Daler 11 ß. | |
| Noch zum Trawringe empfangen einen Engelotten. So wicht er nun 2 Vngersche Gulden. Fur Goldt vnd Arbeitslohn | 1 Daler. | |
| Noch einen Hantruwring gemacht von meinem Golde. Die hatt gewogen 1 1/2 Krone vnd ein Ort. Fur Goldt vnd Arbeitslohn | 2 Daler 10 ß. | |
| Hierauff empfangen 10 Engelott. Rest mir noch 53 Daler 19 ß. |
Harmen Goldtberch.
Anlage 6.
Herzog Christopher bekennt sich Matthes Unger verschuldet mit 100 Thlr. für ein goldenes Halsband mit edlen Steinen, welches er ihm für 300 M. abgekauft hat, und verspricht Zahlung zu Ostern 1587. Güstrow, 1587, Januar 31.
Mattes Unger bittet wiederum Herzog Christopher um Bezahlung der rückständigen 100 Thlr. für das Halsband und einen goldenen Ring mit einem Rubin. Güstrow, 1591, Januar 31.


|
Seite 176 |




|
Mathes Unger, der von Herzog Christopher mit seiner Forderung an Marcus Meyse in Lübeck verwiesen ist, von diesem aber keine Zahlung erhalten hat, bittet die Herzogin Elisabeth um solche. Güstrow, 1592, Juni 19.
Herzog Ulrich, gegen den sich Mathes Unger über die Weigerung der Herzogin Elisabeth, die rückständigen 200 M. zu bezahlen, 1592, November 16, und 1593, April 7, beklagt hat, richtet ein Fürschreiben an die Herzogin zu Mathes Ungers Gunsten. Güstrow, 1593, Mai 21.
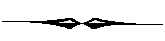


|
Seite 177 |




|



|



|
|
:
|
V.
Die Meklenburgischen Kirchenordnungen.
Ein Beitrag zur Entstehung unserer Landeskirche.
von
Gymnasial=Oberlehrer H. Schnell in Güstrow.
~~~~~~~~~~~~~
G emäß der mittelalterlichen Weltanschauung von der Einheit des imperium und des sacerdotium übertrug Friedrich I. bei der Eroberung des Wendenlandes seinem Vetter und Freund Heinrich dem Löwen die Aufgabe, in kaisersicher Vollmacht die drei alten Bisthümer nicht nur wiederherzustellen, sondern auch nach seinem Gutdünken mit Gütern zu bewidmen. Denn es ist "des Kaisers Pflicht, Gottes Kenntniß und Ehre und Dienst überall zu verbreiten". 1 ) Jndem der Löwe das eroberte und noch zu erobernde Land jenseits der Elbe vom Kaiser zu Lehn hatte, empfing er aus besonderer kaiserlicher Gnade das Investiturrecht in jenen drei Bisthümern für sich und seine Nachkommen, so daß die Bischöfe, wie sie in geistlicher Hinsicht dem Erzbischof von Hamburg unterstellt waren, in Heinrich dem Löwen ihren weltlichen Lehnsherrn zu erkennen hatten. Bereits im Jahre 1558 2 ) weist derselbe dem Bischof von Ratzeburg seinen Sprengel an und, nachdem das ganze Land unterjocht war, im Jahre 1169 allen dreien ihre Gebiete und Rechte. 3 ) Er behält sich dabei seine Lehnsherrlichkeit vor, wenn er ihnen auch die kirchliche Freiheit gewährleistet. Unter letzterer ist die Abgabenfreiheit zu verstehen; sie schließt jedoch die Verpflichtung ein, dem Markding des Herzogs beizuwohnen, Heerfolge und Burgdienste zu leisten, außerdem den dritten Theil der Einnahme für die höhere Gerichtsbarkeit dem Herzog abzugeben. Wie aber zehn Vorwerke


|
Seite 178 |




|
jedes Bischofs vom Burgdienst frei waren, so wurde auch das Markding (seit 1174) wenigstens dem Bischof von Ratzeburg erlassen; wie denn überhaupt in der Folgezeit die eine oder die andere Verpflichtung bis auf die Heerfolge, und zuweilen auch noch diese, abgelöst wurde. Somit sind die drei Bischöfe nicht sofort unmittelbare Reichsfürsten geworden, wenn auch Berno von Schwerin im Jahre 1170 das Bedürfniß hatte, vom Kaiser selbst seinen Besitz sich bestätigen zu lassen. 1 )
Nach dem Fall des Löwen aber erlosch die Lehnsherrlichkeit desselben, die drei Bischöfe wurden unmittelbare Reichsfürsten. Berno ließ sich 1181 sein Stiftsgut vom Kaiser bestätigen; 2 ) Jsfried von Ratzeburg verweigerte mit Erfolg Herzog Bernhard dem Sohne des Löwen, die Lehnshuldigung; Konrad und hernach Dietrich von Lübeck empfingen ihre Investitur vorn Kaiser. 3 ) Als Wilhelm von Holland 1252 die Reichsunmittelbarkeit ihnen nehmen wollte, baten Albrecht von Lübeck, Rudolf von Schwerin und Friedrich von Ratzeburg die Reichsfürsten, sie, als ihresgleichen zu vertreten. 4 ) Wie aber gestaltete sich ihr Verhältniß zu den sie umgebenden Grafen? Diese hatten einst ihre Länder, die zur Dotierung der Bisthümer verwendet werden sollten in die Hand Heinrichs des Löwen zurückgegeben, ohne sich Rechte zu wahren. Nur der Graf von Ratzeburg hatte sich die Gerichtsvogtei und den halben Zehnten als Advokatus des Stiftes vorbehalten; 5 ) von Guncelin und Pribislav wird nichts erwähnt. In der Folgezeit befreite sich das Bisthum Ratzeburg von allen Ansprüchen der Herzöge von Sachsen durch Zahlung Geldsummen (1261, 1271); 6 ) allein was an Gütern im Bezirke des Sächsischen Landes lag, sollte der Hoheit Sachsens unterworfen bleiben. Ueberhaupt suchte das Bisthum auch von dem neuerworbenen Gütern im Lande des Grafen von Schwerin die auferlegten Verpflichtungen durch Kauf zu entfernen und strebte nicht ohne Glück die omnimoda superioritas auch aller Güter an, 7 )


|
Seite 179 |




|
nur daß es den Grafen ein bestimmtes Schirmgeld entrichtete. Nicht wesentlich anders gestaltete sich das Verhältniß des Stiftes Schwerin zur Grafschaft und zum Lande Meklenburg. Pribislav begiebt sich ausdrücklich seiner Rechte an Bützow (1185); ebenso bestätigen unter seinen Nachfolgern Nicolaus und Heinrich Burwin (1232) diesen Verzicht. 1 ) Und Graf Helmold von Schwerin bestätigt 1284 dem Bischof Hermann die vollkommene Freiheit. 2 ) Allein über die Güter, welche durch Schenkung zum ursprünglichen Dotalgut hinzukamen, oder auch im Gebiet der weltlichen Fürsten lagen, behielten sich letztere vor und behaupteten ihre Hoheitsrechte, 3 ) mit größerem oder geringerem Umfange der Verpflichtungen.
Indem die beiden Bisthümer auf diese Weise der Landeshoheit sich entzogen, ist bis ins 13. Jahrhundert hinein eine meklenburgische Landeskirche auch nicht einmal in ihren Anfängen zu erkennen. Zwar war der größere Theil unseres Vaterlandes in seiner Zugehörigkeit zum Bisthum Schwerin, Ratzeburg und Lübeck dem Erzbisthum Hamburg unterstellt; aber der Osten und der Süden gehörte zu Havelberg und Kammin und war somit in die Gesammtheit des Hamburger Erzbisthums nicht einbegriffen. Andererseits umfaßte sowohl das Bisthum Schwerin als auch Ratzeburg Gebiete, welche außerhalb der Grenzen Meklenburgs lagen. Das Land war kirchlich nicht geeint.
Aber es war auch politisch nicht geeint. Wie jedoch vom Jahre 1359 an das Streben nach politischer Einigung offen hervortrat, so mußte auch die Kirche und ihr Besitz davon betroffen werden; das Wachsthum der landesherrlichen Gewalt in dem politisch geeinten Lande hat das immer deutlicher werdende Hervortreten einer Landeskirche im Gefolge; ja es wird sich zeigen, daß es schon vor der Reformation, wie im übrigen Deutschland, 4 ) so auch in Meklenburg eine Art landesherrlichen Kirchenregiments und eine gewisse Form einer Landeskirche gegeben hat. Zwei Linien aber führen zu diesem Endziele; die eine zeigt die Entstehung der landesherrlichen Gewalt durch die Zurückforderung veräußerter Hoheitsrechte und durch die Inanspruchnahme besonderer Rechte auf Grund der alles umfassenden landesfürstlichen Stellung. Die andere Linie zeigt das Wachsen derselben Gewalt der Kirche gegenüber, wie sie aus einzelnen Befugnissen


|
Seite 180 |




|
heraus allmählich zur Landesobrigkeit hinauf schreitet, die als solche Rechte der Kirche gegenüber ausüben kann und darf. Mit dieser haben wir es hier zu thun.
Als die Grafschaft Schwerin 1359 als das Haus Meklenburg kam, nimmt dasselbe das Bisthum Schwerin ist seinen besonderen Schutz, in specialem defeusionem et guardiam. 1 ) Zwanzig Jahre später nehmen die Herzöge Heinrich und Magnus schon das Recht der Beschwerde über unzweckmäßige Verwendung und Haushaltung des Domkapitets für sich in Auspruch, 2 ) sie vertheidigen ihre Lehnsherrlichkeit über die in ihrer Herrschaft gelegenen Stiftsgüter und versteigen sich schon zu dem Ausdruck "ere und erer kercken tho Schwerin wertlicke Overförsten". 1453 wird von Herzog Heinrich der Schutzbrief erneuert, 3 ) aber schon 1468 erscheint der Bischof "unser kerkest Swerin mit mandenste vorplichtet", 4 ) als der Herzog eine Fehde mit Pommern=Stettin auszufechten hatte. Das ist in kurzen Daten die Entwicklung, welche das ius advocatiae und seine Auffassung seitens der Herzöge bewirkte. Ratzeburg hielt sich davon noch frei, aber hatte desto mehr von den Herzögen zu Sachsen=Lauenburg zu leiden, gegen welche. Magnus 1492 dasselbe gern schützte. -Vollends aber mußte die Einigung der meklenburgischen Linien im Jahre 1471, sowie die kraftvolle Regierung des Herzogs Magnus II. 1477-1503 der Hoheit der Stifter gefährlich werden.
Herzog Magnus hielt am Besteuerungsrecht der Geistlichkeit gegenüber fest. Obwohl dieselbe allerdings von allen Beden frei war, so hatten sich doch schon im 13. Jahrhundert die Herzöge außerordentliche Beden bewilligen lassen, wo es die Schuldenabtragung, Auslösung des Landesherrn aus Gefangenschaft, Ausstattung der Töchter oder auch Ertheilung der Ritterwürde an die Söhne galt. 5 ) Zwar war Heinrich der Löwe einmal, 1321, mit seiner Forderung nicht durchgedrungen; er ließ es aber nicht unausgesprochen, daß ihm in Nothfällen ein Besteuerungsrecht zustände. 6 ) Als nun unter der Regierung Kaiser Maximilians die Anforderungen von Reichswegen sich mehrten, wie Besuch der Reichstage, Beiträge zu den Reichs=
 ., Beil. N.
., Beil. N.


|
Seite 181 |




|
steuern, Leistung von Kriegshülfe, forderte Magnus außerordentliche Auflagen. Standen ihm doch Reichstagsabschiede zur Seite, nach welchen keinerlei geistliche und weltliche Unterthanen von diesen sogenannten Kaiser= oder Königsbeden befreit sein sollten. 1 ) So forderte er 1494 vom Stifte Bützow einen Beitrag. 2 ) Auch zur Vermählung seiner beiden Töchter forderte er eine Bede, da "Prälaten, Mannen und Städte Uns in allen ehrlichen und rechtfertigen Dingen verpflichtet sind". 3 )
Tritt hierin schon das Bestreben des Herzogs Magnus hervor, die Landeshoheit auch gegenüber der Kirche aufzurichten, so erscheint diese noch deutlicher, wenn man beachtet, wie die Prälaten bei der Bewilligung der letztgenannten Bede mit Mannen und Städten geeint auftreten. Wir können wohl unbedenklich von Hegel, Geschichte der Meklenburgischen Landstände, Rostock 1856, den Satz uns aneignen, 4 ) daß "in dem Maße, als die Territorialherrschaft selbst mehr und mehr eine bleibende Gestalt annahm, auch die landständischen Verhältnisse sich ausbildeten, und die darauf begründete Verfassung sich befestigte." Nun aber find letztere weithin zu verfolgen. Vertrauen wir der Führung Hegels, so läßt sich der Einfluß der Stände bis in die vormundschaftlichen Regierungen des 13. und 14. Jahrhunderts zurück verfolgen. Zum ersten Male treten alle drei, Prälaten, Mannen und Städte, im Lande Wenden 1437 auf, indem sie sich gegen die Erbhuldigung des Markgrafen von Brandenburg sträuben. Und in den darauf folgenden Friedensverträgen vom Jahre 1442 erscheinen zum ersten Male die gesammten Stände der gesammten meklenburgischen Lande. Wenn auch in der Folge größere landständische Verbände nur im Lande Wenden und Stargard auftreten, so bilden doch die Näthe eine Art ständische Vertretung, und unter diesen erscheinen die Prälaten an erster Stelle, während sie bis dahin unter den Mannen "geistliche und weltliche" mitverstanden wurden. An der Spitze derselben erscheint der Bischof von Schwerin, der von Ratzeburg, aber auch die Vorsteher der Landesklöster und Domstifter, sowie Domherren und angesehene Pfarrer. An den Vergleichsverhandlungen wegen der Rostocker Bede 1480-82 nahmen Prälaten und Räthe von Mannen und Städten theil. In der Rostocker Domsehde sollen Prälaten, Mannen und Städte


|
Seite 182 |




|
entscheiden, 1484. Im Streit des Herzogs Magnus mit den Flotow's sprechen alle drei ihr Erkenntniß, 1494, 1495 ist Rostock damit einverstanden, daß der Hafen Warnemünde Prälaten, Mannen und Städten zur Sequestiration übergeben werde. 1497 citiren zwei Prälaten u. s. w. als verordnete Richter anstatt aller andern Räthe. Es fand also eine landständische Mitwirkung durch mehr oder weniger Rathgeber, die in Vertretung der übrigen Stände einberufen wurden, statt, welche die Herzöge in ihren Streitigkeiten nicht nur, sondern auch bei der Bewilligung von Steuern und Kriegshülfen in Anspruch nahmen 1 ) Indem aber die Prälaten an diesen Handlungen Antheil hatten, bekunden sie nicht ein bloßes Interesse an dem meklenburgischen Staate, sondern zeigen sich als zu gehörige Theile desselben, deren Standschaft auf den Landtagen neben den beiden andern Ständen der erstrebten Landeshoheit der Herzöge zur Seite trat. Und indem solcher landständischer Verband die gesammten Lande umfaßte, ist ein weiterer Ansatz zur Bildung der Landeskirche gegeben.
Ueberhaupt standen auch sonst die Männer der Kirche in naher Verbindung mit der Landesgewalt. Bischof Balthasar von Schwerin, 1473-1479, war ein meklenburgischer Prinz, sein zweiter Nachfolger, Konrad Loste, 1483 - 1503, war schon vor seiner Stuhlbesteigung herzoglicher Rath und Meklenburger, wenn auch von niedrigem Herkommen; auch der Bischof Johann V. von Ratzeburg war aus Meklenburg gebürtig. Außerdem hatten namhafte Geistliche in der herzoglichen Kanzlei gearbeitet 2 ) und hatten Stellen von gelehrten Räthen inne. 3 )
Weitere Ansätze zur Bildung einer Landeskirche bezeugen die Landfriedensbestrebungen der Herzöge. Auf jenem Reichstage zu Worms 1495, dem der allgemeine Landfriede seine Entstehung verdankt, war Herzog Magnus anwesend. Waren so lange die Landfriedensbündnisse nur gegen die öffentliche Unsicherheit auf den Straßen gerichtet und auf die öffentliche Ruhe bedacht gewesen, so tritt jetzt eine Polizeigesetzgebung des Reiches wie der Territorien ein, die "für gute Ordnung und gemeinen Wohlstand zu sorgen hat". 4 ) Der alte mittelalterliche Staatsbegriff, der nur negativ gewesen war darin, daß die Ausgaben des Staates lediglich in Gewährung des Schutzes


|
Seite 183 |




|
nach außen und Abwehr der Friedensstörung nach innen bestanden, mußte sich erweitern, da die Kirche die ihr nach mittelalterliches Anschauung zustehenden Rechte und Pflichten nicht mehr genügend ausfüllte; er mußte positiv werden in der Fürsorge der öffentlichen Gewalt für bürgerliche Wohlfahrt und gute Sitte, und äußerte sich in den bekannten Polizeiordnungen, die in erster Linie vom Reiche ausgingen und also von den Reichsständen gebilligt sind angenommen waren, dann aber auch von ihnen in ihren eigenen Ländern in eigenen Satzungen verfügt wurden. 1 ) Nun liegt allerdings die eigentliche Polizeiordnung Meklenburgs über die Regierung des Herzogs Magnus hinaus. Aber es bestehen doch Anzeichen einer solchen in die Hand genommenen Gewalt. Dazu ist nicht allein der in Veranlassung des Wormser Landfriedens zu Tempzin 1498 geschlossene Landfriede zu rechnen, dazu gehören auch die in den civiloquia der Stadt Wismar gegebenen Bestimmungen, wie Verbot des Verkaufes von Häusern und liegenden Gründen an die Geistlichkeit, 2 ) Verbot der Wallfahrten und des übermäßigen Patengeldes, 3 ) Verbot übergroßer Gelage, 4 ) sowie daß den Geistlichen zu viel vermacht würde. 5 ) Ja, die landespolizeiliche Gewalt auch auf die kirchlichen Dinge auszudehnen, wurde Magnus sogleich beim Antritt seiner Regierung von dem Karthäuser Vicke Dessin aufgefordert, der im Jahre 1477 in einem Briefe 6 ) sowohl dem Herzog selbst rechten christlichen Lebenswandel predigt, als vor allen Dingen von ihm fordert, daß er die Klöster in seinem Lande zurechtsetze und reformire; hierdurch könne er mehr verdienen als durch Fasten und Beten. Das Handeln des Herzogs Magnus entspricht dieser Aufforderung. Bereits 1468 waren in Gegenwart des Herzogs Heinrich die Dominikaner in Wismar reformirt; 7 ) 1492 wurde das Kloster zu Nibnitz auf Anhalten des Herzogs Magnus visitirt und ihm die Wahlordnung vorgeschrieben; mit Hülfe der Bevollmächtigten der Herzöge brachte 1495 Bischof Konrad die Verhältnisse des Klosters Rühn in Ordnung. So gelangte schon das ius inspiciendi cavendi zur Ausübung seitens des Landesherrn.


|
Seite 184 |




|
Es giebt noch andere Anzeichen für das kirchliche Thätigwerden des Landesherrn. 1501 bestimmt der Herzog, daß armen Leuten umsonst die Glocken nachgeläutet werden. 1 ) 1495 nimmt der Herzog eine Klage der Priester zu Grabow über eine gottesdienstliche Angelegenheit entgegen. 2 ) Der Bischof von Ratzeburg hatte nämlich verordnet, daß die Priester nicht mit Wein, sondern mit Malvasier Messe halten sollten. Der Bischof ist angehalten, dem Herzog die Gründe anzugeben, "daß er vorberührte Ordnung in guter Meinung und nicht um den Gottesdienst zu stören, sondern zu vermehren gemacht habe." Diese Thatsache verliert das Auffällige, 3 ) wenn man festhält, daß Herzog Magnus auch sonst die Sorge für die kirchlichen Dinge auf sich nahm. Das zeigt im besonderen die Geschichte der Rostocker Domfehde. 1483 hatte Magnus beschlossen, an der Jakobikirche zu Rostock ein Domstift zu gründen, zur Vermehrung des Gottesdienstes sowohl als zur Unterhaltung verdienter Professoren, die neben ihrer Thätigkeit an der Universität dem Gottesdienste sich widmen, auch in ihrem Alter im Stift eine Versorgung haben sollten. Trotzdem die Rostocker lange sich wehrten, ließ Magnus seinen Plan vom Bischof Konrad und dem Papste sich bestätigen, ja reiste selbst nach Rom, und 1487 konnte die Pfarrkirche zur Domkirche umgewandelt werden. Die Besetzung von acht Dompräbenden behielt der Herzog sich vor. 4 )
Deutlicher erscheinen die Ansätze zur Bildung einer Landeskirche in den beiden ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts, unter der Regierung Heinrichs und Albrechts. Das Bisthum Schwerin kommt in die engste Verbindung mit dem herzoglichen Hause. Bischof Johann von Thun war schon herzoglicher Rath, als er noch Domdechant zu Güstrow war. Auch als Bischof behielt er jene Würde bei. Das Kapitel allerdings, um seine Freiheit besorgt, ließ ihm eine Wahlkapitulation vorlegen, 5 ) daß er die Stiftsgüter nicht mit Beden und Auflagen beschweren lassen wolle, auch keine Abläger duldete, überhaupt das Stift in allen seinen Freiheiten erhielt, und ließ sich ebenso eine Versicherung von den regierenden vier Herzögen geben, welche wie diejenige Heinrichs III. vom Jahre 1453 nicht nur Zusicherung


|
Seite 185 |




|
des Schutzes, sondern auch Bestätigung aller Privilegien besagte. 1 ) Aber schon 1506 begehrten die Herzöge die Stiftshülfe in der Lübecker Fehde. 2 ) Auch der Bischof Petrus Walkow war längst Vertreter der Fürsten zu Rom gewesen, 3 ) als er 1508 den Bischofsstuhl bestieg. Bischof Petrus war es, der sich den Reichssteuern entzog, dadurch, daß er am 31. December 1514 die Verabredung traf, das Stift solle 500 Mark zu einem Erkenntniß= und Schutzgelde zahlen, so oft von den Ständen eine gemeine Landsteuer bewilligt werde. 4 ) Indem die Herzöge vor dem Kaiser ihn vertreten sollen, verzichtet er thatsächlich auf die Reichsunmittelbarkeit des Stiftes. Maximilian hatte dieselbe noch 1506 anerkannt; aber indem er das Ablaßjubiläumsgeld des Stiftes durch Herzog Heinrich einziehen ließ, auch seinem Briefe eine Bedrohung anhängte für den Fall, daß das Stift sich weigern würde, 5 ) mußte er in dem Herzog nur noch mehr den Gedanken der Herrschaft über das Stift erwecken. 1516 hat derselbe Gelegenheit, das Antragsrecht zwischen dem Bischof und Helmold von Plessen üben zu können. 6 ) Aber Heinrich bekam die Regierung des Stifts selbst in die Hände, als nach dem Tode des Bischofs Petrus sein Sohn Magnus vom Kapitel postulirt wurde. Schon die Thatsache der Postulation zeigt, daß auch das Kapitel dem Fürsten gefüge ward. Aus "bestimmten Gründen" 7 ) wählten sie den Prinzen; der herzogliche Vater übernimmt als "natürlicher und gesetzlicher Vertreter seines unmündigen Sohnes" die Verwaltung. Wenn dieser auch alle Freiheiten des Stiftes bestätigt, so bindet sich das Kapitel ihm gegenüber doch die Hände, wenn es ihm die volle Verantwortung und Vertretung für die unkanonische Wahl zuschiebt, die nur "ad complacendum gratiae suae", nämlich des Fürsten, geschehen sei. Indem nun der Herzog die bischöflichen Einkünfte in seine Kammer zog, theils zum Unterhalt und zur Ausbildung des Prinzen, theils zur Vertretung des Stifts hinsichtlich der Reichssteuern, werden die Grenzen des Stifts immer mehr mit denen der herzoglichen Lande und Rechte vermischt, so sehr, daß die Herzöge bis 1561 dasselbe als einen Stand ihres Landes ansehen konnten.


|
Seite 186 |




|
Auch das Bisthum Ratzeburg wurde zu engerem Anschlusse an Meklenburg getrieben. Des Johann von Partentin Nachfolger ward 1511 Heinrich Bergmeier. Am 12. Juni 1513 sind die drei Bischöfe von Lübeck, Ratzeburg, Schwerin im Zuge, um die Hochzeit Heinrichs in Wismar zu feiern. Der Bischof von Ratzeburg traute das fürstliche Paar. Bischof Heinrich und sein Stuhl aber wurden fortwährend von Herzog Magnus von Sachsen angefeindet, der das Bisthum als einen Theil seines Landes behandeln wollte und sich dabei persönliche Vergewaltigungen zu schulden kommen ließ. Am 18. April 1517 rief das Kapitel die meklenburgischen Herzöge zum Schutz an, und auch der Papst forderte sie zur Hülfe auf. 1 ) Darum sendet Meklenburg seine Räthe zum Vergleich nach Buxtehude, 2 ) und Heinrich eröffnet die Vergleichshandlung zu Lenschow am 7. December 1518 3 ) und abermals am 31. März 1519. 4 ) Hier erklärte der Bischof, daß das Stift immer reichsunmittelbar gewesen sei und keinen anderen Schutzherrn als die Herzöge von Meklenburg hätte. In dem endgültigen Vergleich vom 26. November 1519 5 ) gelobt Meklenburg dem Bischof von Ratzeburg seinen Schutz, den lezterer um somehr gebrauchen konnte, als der Herzog von Sachsen seine Angriffe fortsetzte. Ein engerer Anschluß von Ratzeburg an Meklenburg bestand nicht, als er in diesem Schutzverhältniß gegeben ist. Wenn auch Karl V. Herzog Albrecht mit der Entgegennahme des kaiserlichen Lehnseides betraute, 17. März 1521, 6 ) so wahrte doch das Stift besonders unter dem thatkräftigen Bischof Georg seine Unmittelbarkeit.
Inzwischen ist aber auch die landständische Verfassung unter der Mitwirkung der Prälaten fort geschritten. 1504, darauf 1518 und 1520 vermitteln die drei Stände zwischen den herzoglichen Brüdern. 7 ) In der Polizeiordnung von 1516 erscheinen sie zuerst als gemeine Stände, also ist politischer Einheit und Gesammtvertretung des Landes. 8 ) Allerdings heißen die geistlichen Herren "Verwandte des Fürstenthums". Aber in der Union der Stände 1523 sind sie aus diesem Stande herausgetreten, und die fünf Prälatest unterschreiben "alse vullmächtige Befehlhebbere in Stede


|
Seite 187 |




|
und Nahmen aller Prälaten". Ihre Namen sind: Ulrich Malchow, Administrator des Bisthums Schwerin; Nicolaus, Abt zu Doberan; Nicolaus Franke, Senior der Domkirche zu Schwerin; Barthold Müller, Dekan der Domkirche zu Rostock; Heinrich Müller Probst zu Dobbertin. Die Stiftsritterschaft und die Stiftsstädte waren nicht vertreten; denn als 1526 Herzog Heinrich auch diese zum Landtage einlud, erwiderten sie, das sei wider alle Gewohnheit, indem nur der Bischof oder dessen Stellvertreter wegen des Stifts an der Ständeversammlung theilgenommen hätte. 1 ) Die Union "wahrte das bestehende Recht der Verträge der fürstlichen Brüder und sicherte die ständischen Privilegien durch die Vereinigung aller Stände .....; indem die Vereinigung durch einen freiwilligen Akt der Stände selbst hergestellt wurde, gab sich darin das entschiedene Bewußtsein ihrer Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit kund." 2 ) Und wenn nun auch die Union daneben ihre, der Stände, "Privilegien gegenüber der sich aufnehmenden landesherrlichen Gewalt aufrecht erhalten" wollte, so war doch die politische Einheit der meklenburgischen Lande hergestellt, und da die Prälaten "vullmächtig" den ersten Stand bildeten, ist der Boden für eine Landeskirche nicht nur gelegt, sondern auch sicher begründet.
Die Herzöge selbst aber versäumen keine Gelegenheit, als advocati ecclesiae thätig zu werden. Abgesehen von den Ratzeburger Vergleichshandlungen und der fast selbstständigen Verwaltung des Bisthums Schwerin, welch' letztere weit über die Grenzen sonstiger kirchlicher advocatia hinausging, sehen sie ihre Pflicht auch darin, daß sie den Schuldenstand und die Höhe des Zinsfußes herabsetzen, um dadurch den Klagen gegen die Geistlichkeit zu begegnen. Am 29. März 1503 hatten Magnus und Balthasar die Lübecker Geistlichkeit mit den Vasallen des Klützer Ortes verglichen wegen 30000 Mark unbezahlt gelassener Zinsen und hatten den Zinsfuß auf 5 % herabgesetzt. 3 ) Am 17. Juni 1511 verglichen Heinrich und Albrecht dieselben zu Grevesmühlen abermals, ebenso am 6. December 1512 zu Gadebusch dergestalt, daß alle Zinsen niedergeschlagen und die Kapitalien in zehn Jahren abgetragen werden sollten. Am 12. März 1515 sandten die Herzöge dann eine gedruckte Aufforderung an die säumigen zur Zahlung, bei Androhung der Execution. 3 ) Ferner verboten die


|
Seite 188 |




|
Herzöge das Angehen der geistlichen Gerichte in weltlichen Sachen, am 29. Juni 1513 1 ) zuerst in besonderer Verordnung, hernach in der Polizeiordnung noch einmal. Am 25. September 1518 nehmen die Herzöge eine Bitte um Schutz gegen den Offizial des Havelberger Bischofs seitens der Stadt Friedland entgegen. 2 ) Im Frühjahr desselben Jahres hatte sich der Rath von Rostock bei ihnen über den neuen Ablaß beklagt, der das Geld aus den Städten fortschaffe. 3 ) Weiter wachten die Fürsten eifrig über ihre Patronatsrechte, die sie an zahlreichen Kirchen hatten. In achtzehnjährigem Prozeß behaupteten sie Patronats= und Abgabenrecht an der Komthurei Kraak und der Priorei Eixen. 4 )
Als advocati ecclesiae wurden die Fürsten aufgefordert und nahmen Theil an der Visitation der Klöster 5 ) einer Thätigkeit, die dem ius reformandi entspricht. Am deutlichsten wird diese jedoch durch die 1516 publizirte Polizeiordnung. Ein Domherr und Inhaber mehrerer Kirchenlehen, Johann Monnick, ist es, der im Auftrage der Landesfürsten die Städte bereist und den Klagen und Uebelständen nachspürt. Diese betreffen nicht nur Ruhe und Sicherheit des Landes, sondern auch alle Unordnungen auf "brautlachten, kindelbiern, rat und Werckosten", die nicht allein den Einwohnern zum Nachtheil, sondern auch - und das ist das Neue - zur "Schwächung des gemeinen Nutzens" gereichen. 6 ) Die Fürsten erkennen es als ihre Pflicht, mit ihren Räthen zu berathschlagen, das Beschwerliche abzuwenden und andere leidliche und unbeschwerliche Ordnung aufzurichten. Der Unordnung müssen sie zuvorkommen, und sie wollen Gott dem Allrnächtigen zu Lobe und zur Förderung des gemeinen Bestens ihre Ordnung stellen. 7 ) "Ordeninge Statuta unnd settunge dem gemenen nutthe thom besten"; dieser Titel kündet den gegen die mittelalterliche Auffassung erweiterten Staatsbegriff an, der der öffentlichen Gewalt die positive Fürsorge für das Wohl der Unterthanen zuspricht und bei der Ohnmacht der kirchlichen Gewalt vor den kirchlichen Dingen nicht Halt macht, sondern sie einbegreift; denn der Fürst ist Gott verantwortlich, zu seinem Lobe dient die neue Ordnung. Maximilian selbst hatte 1512 durch Reichstagsabschied


|
Seite 189 |




|
es für nothwendig gehalten, daß Fürsten und andere Stände des Reiches sich in solche Sachen schlagen und Wege fürnehmen, wie die Beschwerung in den kirchlichen Verhältnissen am förderlichsten abgewendet und zur Besserung gestellt werden könnte.
Fassen wir zusammen: In Meklenburg ist seit der Erwerbung der Grafschaft Schwerin eine Landeskirche in der Entwicklung begriffen, welche mit der politischen Einigung des Landes gleichen Schritt hält; in eben dem Maße, in welchem die landesherrliche Gewalt sich befestigt, nimmt sie eine Stellung zur Kirche ein, die auch die Sorge für die kirchlichen Dinge unter sich begreift. Oder kürzer: Landeskirchenthum und landesherrliches Kirchenregiment liegen auch in Meklenburg in der Weise vor, daß die Reformation überall nur anzuknüpfen und weiterzubilden hatte.
Die Stellung Heinrichs und Albrechts zur Reformation ist bisher noch nicht in dem Maße klargestellt, daß man ein klares Bild von ihrem reformatorischen und antireformatorischen Wirken erhielt. Die Arbeiten von Lisch in den Jahrbüchern über die Einführung der Reformation in einzelnen Städten, sowie bislang unbenutzte Akten des Archivs zu Schwerin setzen uns in den Stand, die Stellung beider Fürsten wenigstens in den Hauptzügen erkennen zu können. Voran darf der Satz gestellt werden, daß beide bis über den Reichstag zu Augsburg hinaus an den Reichstagsabschieden festhalten und ist insofern eine neutrale Stellung wahren, als sie weder den Katholischen noch den Evangelischen mit Bestimmtheit sich anschließen; Heinrich behält auch dann noch seine neutrale Stellung bei, indem er den Schmalkaldischen sich nicht anschließt, während Albrecht dem Bündniß zu Halle beitritt.
1520 giebt Heinrich dem Erzieher seines Sohnes Magnus, Konrad Pegel, der seiner Zeit schon gegen den Ablaß Areimbolds geschrieben hatte, die Erlaubniß, in Wittenberg Luther aufzusuchen und zu hören. 1 ) Herzog Albrecht besuchte auf seiner Reise nach Worms den Reformator und ließ seinen Kaplan Heinrich Möller in Wittenberg studiren. 2 ) Beide Fürsten unterschrieben den Wormser Reichstagsabschied; hatten sie doch die kaiserliche Belehnung und Heinrich obendrein den Titel eines Reichshofraths bekommen. Allerdings ist von der Publikation


|
Seite 190 |




|
des Abschiedes in Meklenburg nichts bekannt, die, wenn sie erfolgt wäre, ohne Wirkung bleiben konnte, weil im Lande von der Reformation nichts öffentlich bekannt geworden war. So kommt am 14. Januar 1523 das Rundschreiben des Papstes durch den Nuntius Chieregatti gegen die impios sceleratosque schismaticos 1 ) noch zu früh aber doch schon zu spät, indem im Februar 1523 zu Nürnberg beschlossen war, 2 ) das Wormser Edikt abzulehnen, ein Konzil in einer deutschen Stadt unter Mitwirkung der Stände anzustreben, vor allem aber das Wort Gottes nach Lehre der bewährten Schriften lauter zu lehren. Am 18. April 1524 kam es zu dem zweiten Nürnberger Abschied, 3 ) daß bis zu einer Nationalversammlung im November das heilige Evangelium und Gottes Wort gepredigt und "soviel als möglich" das Wormser Edikt gehalten werden sollte. Diese beiden Reichstagsabschiede gaben den meklenburgischen Herzögen den Rechtsgrund, auf dem sie jetzt die reine Lehre fördern. Albrecht mochte außerdem noch durch seine Gemahlin, Anna von Brandenburg, beeinflußt sein, welche bei einem Besuche in Neubrandenburg 4 ) sich evangelisch predigen ließ und gelegentlich ihres Aufenthaltes in Ribnitz recht verächtlich von der alten Kirche sprach. Obgleich Albrecht sich Messe lesen ließ, 5 ) so läßt er durch den Hofbeamten Hans Löser und sein Bruder Heinrich durch den Sternberger Prior Johann Steenwyck Luther um Sendung evangelischer Prädicanten bitten, im Frühjahr 1524. 6 ) Wenn aber Luther am 24. Juli 1524 an den Prior schreibt. "Scripsissem principi ipsi, sed causa aliqua intercessit, ne id auderem, ne forte suspitionem et facerent et ineurrerem", 7 ) so ist das ein Zeichen, daß unsere Fürsten von der Reformation noch frei bleiben wollten; nur das lautere Evangelium ließen sie predig.
Denen sie sind advocati ihrer Kirche und haben außerdem für den Landfrieden zu sorgen. Diese beiden Gesichtspunkte sind für ihr Verhalten maßgebend. Deshalb gebietet Albrecht dem Joachim Kruse, den er doch in Güstrow eingesetzt hat, daß er "sich sunst ungepürlichs unstümigs schmehens enthalte, damit aufruhr


|
Seite 191 |




|
und Widderwylle vorblyb"; 1 ) nur das wahrhaftige Evangelium und Wort Gottes solle er verkündigen. Befremden kann es deshalb auch nicht, wenn Albrecht den Bischof Magnus am 16. August 1526 2 ) auffordert, die neue ketzerische Lehre zu unterdrücken, deshalb nicht befremden, weil er für den Bischofsstuhl seines Neffen besorgt sein mußte. Ebenso verfährt Heinrich, der im Oktober 1525 Slüter entließ, als der Official sich bei ihm über die aufrührerischen Predigten desselben beklagte. 3 ) Und in Friedland befahl er "das heilige Evangelium nach Auslegung der vier Doctorender heiligen Schrift zu predigen, ohne Schelten und Aufruhr, bis er aus kaiserlicher Majestät andere Botschaft erlaffen würde". 4 ) Da Aufruhr zu befürchten ist, so läßt er es eben bei der "alten christlichen Gewohnheit" bleiben. Wo aber das Evangelium von lutherischen Prädicanten gepredigt wird, da soll auch nach Heinrichs Meinung es "Iuther und rein sonder jenigen thosatzt" geschehen, aber ohne Schelten und auch ohne öffentliche Disputationen, weil durch letztere "vele mehrere uprhur den Einigkeit erwassen mochte". So verbietet er in Wismar und Rostock bereits angesetzte öffentliche Disputationen. 5 ) Als advocati hatten Albrecht und Heinrich die Kirche gegen die Verweigerung der Pächte in Schutz zu nehmen. So citirt Albrecht den Joachim von der Osten und Joachim von der Lühe, die vom Domkapitel. zu Rostock der Pacht wegen verklagt wurden; er habe sich mit Heinrich verabredet, "die sulven gebrekert tho vorhorenn und darinne wath temelick gewanlick und billich ist tho vorfugenn, 6 ) Am 8. April 1526 wird denn zu Sternberg nach Berathung mit den Landständen der Zinsfuß von geistlichen Gütern auf 4 % herabgesetzt, mit der Bestimmung, daß Zinsen und Pächte fortan regelmäßig bezahlt werden sollen. Und als der Schweriner Domdechant Johann Knutzen ohne Vollmacht der übrigen beim Kaiser darüber sich beschwerte, versichern die Herzöge, daß sie zur zur Erhaltung des Gottesdienstes in diese gütliche Unterhandlung sich eingelassen hätten, um Nachtheil und Widerwillen wischen Geistlichen und Weltlichen zu verhüten. 7 ) In der That nahmen sie die Geistlichen in Schutz, so am 17. Juni 1526,


|
Seite 192 |




|
als die Rostocker den Klerus mit der Grabenarbeit beschweren wollten. 1 )
So bleiben sie noch 1526 Freunde des Kaisers und erhalten von ihm durch Heinrich von Braunschweig seine Instruction an die, welche "der Luterischen lere nicht anhengig seyn." 2 )
Dieser Stellung scheint nun Heinrichs Verhalten zum Torgauer Bunde nicht zu entsprechen, da sein Name in der Bundesakte vom 13. Juni 1526 zu Magdeburg mitgenannt wird. 3 ) Allein eine nähere Beziehung zu den Bundesgliedern und zu der Entwicklung des Bundes ist nicht nachzuweisen. Daß Heinrich anfänglich mit seinem Schwager Johann, bei Seele des Bundes, übereinstimmen mochte, liegt bei der nahen Verwandtschaft auf der Hand. Gewiß ist er durch seine Theilnahme am Lippeschen Bunde seit dem 16. December 1525 4 ) und derjenigem am Polnischen Bunde seit 13. December 1524, 5 ) jenen Vorläufern des Torgauer Bundes, mit in den letzeren hineingezogen worden, dem er aber hernach ganz sich fern. hielt. Fürs erste paßten die Bestimmungen jenes Bundes Sehr gut zu seiner Stellung, welche besagen, daß "wir von Amtswegen darzu von Gott dem Allmechtigen vorsehen, den unsern schuldig und plichtig seyn auch getreue Fürsehung zu thun, damit dieselben mit dem Worte Gottes weyter gewydembt werden."
Daß Gottes Wort gepredigt werde, war 1524 zu Nürnberg den Ständen zur Pflicht gemacht, und zu Speyer hieß es 1526 am 25. Juni, daß jeder Stand sich so verhalten solle, wie er es verantworten könne vor Gott und Kaiserlicher Majestät; 6 ) ja es ward jeder Obrigkeit, geistlichen oder weltlichen Standes, zur Pflicht gemacht, daß in ihren Landen, Gottes Wort nach rechtem Verstand gepredigt werde, ohne Aufruhr und Aergerniß. So wurden 1527 Oberländer und Faber in Schwerin, Berenfelder in Wismar, 1528 Lönnies in Parchim angestellt; ja Heinrich unterredet sich mit Slüter uttd schenkt ihm 1527 ein neues Priesterkleid. 7 ) Dagegen bitten die Friedländer vergebens um einen Prediger, weil der Rath berichtet hat, daß Geistliche genug da seien und kein Friede bestehen würde. 8 ) Ebenfalls


|
Seite 193 |




|
verbietet Heinrich den Druck des Emser'schen Testamentes, nicht weil der Kurfürst von Sachsen ihn darum ersuchte, auch nicht, weil Luther selbst an ihn schrieb, sondern "weil es vorderblichen schaden pringen mocht", was ihm "als der Oberigkeiten gantz beschwerlich und ghar unleidtlich." 1 )
Wir sehen, daß Heinrich und Albrecht auf den Reichstagsbeschlüssen bestehen, welche ihnen das ius reformandi in der Weise auszuüben verstatten, daß sie für die Predigt des Evangeliums sorgen, soweit es ohne Aufruhr und ohne Abbruch an den Rechten der Geistlichkeit geschieht. Deshalb unterschreiben sie auch die Protestation zu Speier nicht. Auf die Verpflichtung, den Speirer Reichstagsabschied zu halten, wird Heinrich vom Bischof von Ratzeburg hingewiesen in jener Aderpolschen Fehde zu Gressow 2 ): "der Kaiser habe dem Bischof und dem Herzoge befohlen, bei dem alten christlichen Glauben und den alten Cerenlomien zu bleiben, bis durch ein Concil etwas Anderes bestimmt sei." Als der Bischof dann von den Plessen überfallen wird, fordert er gemäß dem Speirer Reichstage von den Fürsten Hülse, 27 December 1529. Denn wenn ein Stand des Reiches überzogen würde, so solle der andere helfen. So schreibt denn Heinrich unter dem 4. Januar 1530 an die Plessen, den Landfrieden nicht zu stören, und Albrecht ist bereit, mit bewaffneter Macht herbeizukommen. Wenn aber beide Fürsten nicht energisch gegen die Plessen vorgingen, so liegt der Grund nicht auf religiösem Gebiete, sondern sie mochten dem hochfahrenden Ratzeburger wohl einen Aerger gönnen. Auf den Speirer Reichstag beziehen die Fürsten sich auch selbst, als sie den vier Domkapiteln, welche am 6. December 1529 über Verunglimpfung sich beklagt hatten, unter dem 4. Januar 1530 antworten: 3 ) "Sie wollen mit gebührlicher Exekution der Geistlichkeit zu den Zehnten, Pächten und Renten verhelfen; die Geistlichen sollen vor kein stadt= oder ander wertlich gerichte gezogen werden; was Gottesdienst und Ceremonien betrifft, so ist der Befehl hiebevor gewest und ist es noch jetzt, das die nach altem gebrauch der heiligen kirchen vnde vermoge des abscheides des jungst gehalten Rechtstags zu Speier, darvor wir zu underricht den artikel cristlich religion unde unsern heiligen Glauben belangent hir in gelegt, gehalten soll werden." Da nach demselben Ab=


|
Seite 194 |




|
schiede Sekten nicht geduldet werden sollen, so verbieten Heinrich und Albrecht am 6. Mai 1530 den Druck der Schriften des zwinglianisch gesinnten Never zu Wismar. 1 )
Es kann deshalb nicht befremden, wenn die Herzöge die Confession zu Augsburg nicht unterschreiben, ja Albrecht die Anrede an den päpstlichen Legaten hält. In der Politik des letzteren ist von diesem Reichstage an eine Wendung der katholischen Seite hin zu bemerken, während Heinrich an seiner bisherigen Stellung festhielt. Albrecht tritt fortan in eine gegensätzliche Stellung zu seinem Bruder, indem er die von diesem nicht gebilligte Landestheilung eifrig betrieb, indem er in die nordischen Angelegenheiten sich einmischte und deshalb die Freundschaft des Kaisers sich wahren mußte, indem er endlich der Ueberredung seines Schwiegervaters, Joachim I. von Brandenburg, Raum gab. In Bezug auf letzteren Punkt sagt Reimar Kock: 2 ) "Hertog Albrecht hest sick van dem Marckgraven overreden lathen, den olden, und ock van Hertog Jürgen van Meißen, dat he de Lehre des Evangelii verlathen und ein Papiste geworden und ock beth in syttem dode gebleven." Auch Herzogin Anna war wieder katholisch geworden. 3 ) Es wird sich jedoch zeigen, wie der katholische Albrecht von1534 an in seiner Politik mit dem Protestantismus rechnete. Einstweilen stand sein Wirken unter dem Einflusse seiner gut katholischen Kanzler, des Joachim von Jetze und des Johann Knutzen. Die veränderte Stellung benutzt das Rostocker Domkapitel, wenn es am 1. April 1531 das Domkapitel zu Schwerin auffordert, es Herzog Albrecht ja nicht ungemeldet zu lassen, wenn ihnen etwas zu gemuthet würde. 4 ) Dem Prädicanten Aderpol verbietet Albrecht die evangelische Predigt in Malchin, Dienstag vor dem 1. November 1531. 5 ) Labes in Güstrow wehrt sich gegen ein äbnliches Verbot und beruft sich darauf, daß Albrecht doch dem Kruse das Predigen gestattet, auch ihn selbst nicht verhindert habe. 6 ) Labes erbietet sich aus der Schrift seine Lehre zu erweisen, und wirklich läßt Albrecht sich auf eine Prüfung derselben ein, ebenfalls so in Friedland und Neubrandenburg, die aber mit der Verjagung der Prediger endete, weil sie nicht glauben wollten, daß "das


|
Seite 195 |




|
Sakrament im Hüseken noch ein Sakrament sei." 1 ) Am 5. Februar 1532 verbietet Albrecht jede Veräußerung von Kirchengütern, 2 ) und am Tninitatisfeste desselben Jahres muß er schon wieder eine Klage des Schweriner Domkapitels entgegennehmen, daß ihm von dem Adel die Pächte nicht gezahlt würden. 3 )
Dieser veränderten Stellung seines Bruders gegenüber bewahrte Heinrich seine ursprüngliche. Der Rostocker Syndikus Oldendorp ist bei ihm Zwinglianischer Ketzerei wegen verklagt; da antwortet Heinrich dem Rathe am 4. November 1530, 4 ) daß er ihn nicht allein der Jrrlehre entgegen, sondern als einen frommen ehrliebenden Christen, der der evangelischen Wahrheit geneigt wäre, erkannt hätte. Besonders aber lobt Heinrich an Oldendorp, daß er "die unsern als der Obrigkeith gepürlichen Gehorsam seines eussersten Vermögens bewegt." Das ist Heinrichs Standpunkt nach wie vor, daß keine Unruhen und Beschwerden vorfallen dürfen. Deshalb setzt er den Aderpol in Malchin, das Heinrich mit seinem Bruder gemeinsam gehörte, wieder ein; er versetzt den Labes aus Güstrow nach Sternberg; in Friedland, wo die Wogen der Unruhen zwischen der Bürgerschaft und dem auf Albrechts Seite stehenden Rathe noch hochgehen, erscheint er persönlich, nachdem zwei Briefe an den Rath mit der Aufforderung, die Bürger glimpflich zu behandeln, nichts gefruchtet hatten. Bei seiner Anwesenheit wies er den Prädicanten Berenfelder, der früher in Wismar gewesen war, in sein neues Amt ein und bittet für denselben den Dominikaner prior zu Pasewalk um eine Wohnung. 5 ) Aus diesem Umstande folgt, daß Heinrich, wo es in Ruhe zugehen konnte, die reine Lehre nicht hinderte, vielmehr zu ihrer Unterstützung selbst die Anhänger der alten anrief. Das bezeugen ihm letztere selbst. Die Rostocker Geistlichkeit gesteht die Predigt des Evangeliums zu, aber in die Veränderung der Ceremonien soll nach Heinrichs Befehl nichts gewilligt werden. So sagen sie vor dem Rathe am 23. März 1531 aus. 6 ) Das bleibt auch Heinrichs Meinung, und in Schwaan, am Abend des 23. März 1531, empfiehlt er der Gesandtschaft der Rostocker Geistlichkeit, die Ceremonien


|
Seite 196 |




|
keineswegs fallen zu lassen. 1 ) Ja, er versichert dieselbe seines Schutzes, daß er nöthigen Falles Gewalt mit Gewalt steuern werde. Auch in Bützow befiehlt Heinrich, daß man sich keineswegs unterstehen solle, in den althergebrachten Ceremonien etwas abzuthun oder zu ändern; denn auf jüngst gehaltenem Reichstage zu Augsburg sei beschlossen worden, bei den alten christlichen Ceremonien zu bleiben und darin vor dem fünften christlichen Concil nichts zu ändern. 2 ) Indem Heinrich einerseits das Evangelium predigen ließ, wo es ohne Aufruhr geschehen konnte, andererseits aber die Ceremonien gemäß dem Augsburger Reichstage beobachtet wissen wollte, konnte es nicht ausbleiben, daß man die Predigt sich gefallen ließ, aber die Ceremonien um so fester behauptete. Daß aber eins das andere mit sich zieht, wurde Heinrich zu Schwaan an jenem 23. März klar. Ueberhaupt ist dieser Märzaufenthalt ist Schwaan für den Fortgang der Reformation recht wichtig. Neben den Gesandten der Rostocker Geistlichkeit war daselbst auch Slüter anwesend; ebenfalls stellte Aderpol aus Malchin sich ein, um sich Bescheid zu holen. Er lautete: "das Evangelium zu Malchin nach wie vor zu predigen". 3 ) Der Rath zu Malchin hatte darauf ihm bedeutet, daß Herzog Heinrich nur die Predigt erlaubt. habe, nicht aber das Sakrament, und hatte deshalb dem Prädicanten weder Meßgewand noch Kelch herausgegeben. Darum fragen die Malchiner Bürger bei Heinrich an, wie sie sich verhalten sollen, denn "dat Evangelium bringeth myt sick den notrostigenn gebruck der Sacrasmenth". 4 ) So mußte Heinrich also eine entschiedene Stellung einnehmen. Einstweilen that er es noch nicht; vielleicht hielt sein papistisch gesinnter Kanzler Caspar von Schönaich ihn zurück. Er begnügte sich damit, die Ruhe im Lande zu wahren. Am 14. August 1531 5 ) begehrt er von den Kirchenjuraten zu St. Jacobi in Rostock, den aufrührerischen Prädicanten abzusetzen, er wolle sie mit einem frommen Manne von guter Lehre versehen. Am 23. Januar 1532 6 ) schreibt er an den Rath zu Parchim: Es sei ihm glaublich berichtet, daß in jüngster Zeit dieselben in eigener Gewalt und ganz unbedächtig


|
Seite 197 |




|
zugefahren sind, alle Gottesdienste und Ceremonien, so von Alters her gehalten sind, niederzulegen, daß sie ferner anstatt denselben viel "ungeschickte und unlöbliche fürnehrnunge" gebrauchen, das mehr zu Beschwerung denn zu gutem Rechte diene; er fordert deshalb mit Ernst, die Amte der Messen und die Ceremonien, welche sie von Alters her halten, auch die Kirchherren und Kapellane in ihren Pfarrrechten nicht zu hindern, und darneben das heilige Wort Gottes und heiliges Evangelium lauter und rein unverhindert predigen zu Lassen. Aus diesem Briefe ergiebt sich die unveränderte Stellung Heinrichs: Das Evangelium soll gepredigt, aber keine Beschwerung irgend welcher Art gemacht werden. Deshalb nimmt er auch die Karthause in Rostock in Schutz, am 23. Mai 1532, 1 ) daß "die armen geistlichen Leute nicht beschwert" werden sollen. Wie sehr er persönlich den alten Ceremonien ergeben war, bezeugt der Umstand, daß er noch Weihnacht 1532 in Schwerin die Messe sich celebriren ließ. Seine evangelischen Unterthanen allerdings, die Bürger von Parchim, Neubrandenburg, Friedland, Malchin und Woldegk, bitten die in Rostock versammelten Landstände um Schutz gegen die päpstlichen Verfolgungen und um Befürwortung ihrer Bitte bei dem Landesherrn. 2 ) Dasselbe that 1533 Rostock, welches in seinem Reformationseifer schon am 1. April 1534 das große Werk der Reformation vollendet hatte.
Das Jahr 1533 bringt nun die wichtige Veränderung, zunächst den Umschlag Heinrichs sodann die offen feindselige Haltung Albrechts gegen seinen Bruder. Wir werden die Beweise für beides sogleich bringen. Vorerst möge einigen Gedanken Raum gegeben werden, welche den Umschlag Heinrichs erklären. Im Schweriner Archiv befindet sich ein Brief des Herzogs Magnus an seinen Lehrer Arnold Büren vom 18. August 1532. Magnus sagt darin, daß er an den Hof des Kurfürsten von Sachsen hätte gehen sollen. Aber als sein Vater mit der Anweisung noch gezögert habe, hätten die Sachsen gesagt: Heinrich warte nur auf den Ausgang des Regensburger Reichstages. Magnus citirt dann den Satz donec eris felix. Daraus geht wohl hervor daß Heinrich allerdings schon im Sommer 1532 den Plan, den Schmalkaldenern beizustehen, mit sich erwog. Zu einem Anschluß ist es damals noch nicht gekommen, ebenso wenig zu einer


|
Seite 198 |




|
veränderten seine Unternahanen gegenüber. Mithin machen die Sachsen unserm Herzog eine Unterstellung, wenn sie ihn auf den Regensburger Abschied warten lassen. Dieser der am 23. Juli 1532 erfolgte, berührte ihn garnicht. Anders liegt es dagegen mit Heinrichs Verhältniß zum Stift Schwerin. Er hatte für seinen Sohn die Wahlkapitulation beschworen und hatte darin versprochen, dafür zu sorgen, ne qua negligentia fiat in spiritualibus et sacramentalibus sive in his quae sunt ordinis episcopalis. 1 ) Dadurch mußte Heinrich sich gebunden fühlen. Als nun Magnus am 16,. September 1532 sein Amt antrat, war Heinrich. von dieser Verpflichtung frei. Und gerade Magnus mochte es sein, der seinen Vater zu entschiedenerm Vorgehen bewog, er, der mit Luther und Melanchthon innig verkehrt, der eine tüchtige Ausbildung durch Pegel und Büren erhalten hatte.Im März 1527 lobt Melanchthon seine wissenschaftlichen Studien und fordert ihn auf, für Luther bei Herzog Georg Fürsprache einzulegen. Im Februar 1530 schreibt Melanchthon an ihn "Non ignoratis vos divinitus in hoc fastigio rerum humanarum collocatos esse, ut conservetis religionem et civilem diseiplinam" und erinnert ihn an das Wort, "Ego dixi dei estis." 2 ) Mußte Magnus also nicht früh schon den Gedanken fassen, in seinen Vaterlande die Reformation zum Siege- zu führen? Bereits am 6. April 1527 bittet er seinen Vater um Anstellung-seines Dieners Otto Ritzerow in Sternberg, der dafür sorgen-würde daß Gottes Wort rechtschaffen gepredigt werde. 3 ) Er beschwor nur die Wahlkapitulation, aber nicht den von Papst Leo vorgelegten Eid. In betreff dieses hatte er indem erwähnten Briefe seinen Freund und Lehrer gebeten, den Eid durchzulesen, ne eo me astringam, quod mihi et animae et corporis detrimento poterit cuiusque me poeniteat. Sein Lehrer konnte ihn von dem Eidschwure nur zurückhalten.Wie eifrig Magnus das Werk der Reformation trieb, werden wir bei dem Jahre 1538 noch sehen; hier nur noch eine Bemerkung: Pfngsten 1533 schrieb er von Weimar aus Klagen über die Lässigkeit dei Reformation der Universität und über Albrechts Feindseligkeiten. 4 ) Die Vermuthung ist also wohl begründet, daß Magnus seinen Vater zu einem entschiedenen Vorgehen bewog.


|
Seite 199 |




|
Die veränderte Stellung Heinrichs ergiebt sich aus seinem Briefe an das Schweriner Domkapitel vorn Jahre 1533, welches sich beschwert hatte, daß die evangelischen Prädicanten in ihren Predigten wider die Ceremonien und geistlichen Personen redeten. 1 ) Da antwortet Heinrich zugleich im Namen seines Sohnes Magnus, daß er "solches nicht zu verbieten wisse, auch nicht in seiner Gewalt stehe, so ferne solches mit Gottes Wort und demselben gemäß geschehe, angesehen, daß auch der Herr Christus selbst vor Zeiten wider Irrthum und Mißbrauch härtiglich geredet habe, wie aus seinem heiligen Evangelium zu lesen und zu finden sei". Nun beschwert sich Albrecht beim König Ferdinand. 2 ) Der Brief bestätigt uns den Wandel im Verhalten Heinrichs. Albrecht klagt, daß das Mandat; wonach niemand den andern wegen der Religion angreifen noch ihm Verhinderung thun solle, von Heinrich ganz und garnicht geachtet und von Rostock und Wismar und anderen Städten garnicht gehorsamet würde, daß vielmehr Heinrich sich vernehmen ließe, "Key. und e. Kh Mat. haben ime in dem das seiner fehelen Seligheit betrift, nicht zu gebieten". Leider ist der Brief ohne Datum. Er muß aber zu Anfang des Jahres 1533 geschrieben sein; denn am 14. April 1533 schreibt Knutzen von Mailand, 3 ) daß er auf die andern Artikel der lutherschen Händel halben, keinen Bescheid und Antwort erhalten könne. Am 30. Juni 4 ) fordert Ferdinand den Rath schon auf, die Neuerungen abzustellen. Und unter dem 29. Juli bekommt Heinrich von Braunschweig den Auftrag von Ferdinand, mit Heinrich zu verhandeln 5 ) Es heißt da: Herzog Albrecht hat ein Urtheil an uns geschrieben, in Sachen die christlich Religion betreffend, darin seiner Liebden von seinem Bruder etwas Beschwerliches zugefügt wird. Ferdinand wünscht, daß died und dergleichen Irrthum und Zwietracht zum möglichsten verhütet und in der Güte verhandelt werden, sondertich auch in der Religion nichts Neues aufgerichtet, noch Röm. Kaiserl. Maj. ausgegangenen Erklärung und Nürnbergschem jüngsten Abschied zuwider gehandelt wird. Ferdinand hat Heinrich von Braunsschweig in Aussicht genommen, wegen dieser Irrungen zu verhandeln und Fleiß zu haben, sie gütlich abzustellen, damit Herzog Heinrich von seinem Fürnehmen abstehe und sich allenthalben dem


|
Seite 200 |




|
Nürnbergischen Abschied und der darüber ergangenen Kaiserl. Publication gemäß verhalte. Dienstag nach Michaelis 1533 schreibt Heinrich von Braunschweig an Albrecht, daß er seine Sache jetzt in die Hände nehmen wolle. 1 ) Inzwischen hat Albrecht schon die Vermittlung Joachims von Brandenburg angerufen Dieser schreibt am 30. Juli 1533 an Heinrich, 2 ) daß Albrecht ihm persönlich gesagt habe, es sei nie seine Meinung gewesen, die Prediger, welche Gottes Wort verkündeten, zu verjagen vielmehr wolle er sie schützen; er. könne nur nicht leiden, daß in Wismar und in einigen Orten umher Prediger von der zwinglichen Sekte lehrten und das Volk verführten; er wolle auch, wo zwei Pfarrkirchen wären, seinem Bruder eine überlassen, wem er ihm die andere gönnen würde. Inzwischen fuhr dennoch Albrecht fort die Prediger zu verjagen, am 23. Auqust 1533 den Labes aus Sternberg, und er schreibt an den Rath dieser Stadt, daß er sonst "gewaldt mit gewalth zu sturenn" bedacht wäre. 3 ) Aber Faber aus Schwerin tröstet den Rath und bittet ihn, die lutherischen Prädicanten zu schützen; 4 ) wenn ihn ein Gottloser anfechten sollte, so "beruff er sich zum Ersten- auf Herczog Heynrich, der ym solchs befolhen hat". Da Faustinus Labes bleibt, so faßt Albrecht seine Klagen noch einmal in einen Brief an Joachim zusammen, am 17. September 1533, 5 ) daß Heinrich die von Albrecht in den gemeinschaftlichen Städten verjagten Prediger wieder eingesetzt habe. Albrecht ist besonders darüber erbittert, daß Faber ein Schmähbuch auf das heilige Blut in Sternberg - Luther schrieb bekanntlich die Vorrede dazu - hatte ausgehen lassen, und es ist in der That seine Meinung, daß in Sternberg zwinglisch gepredigt werde. Dennoch wollte Albrecht es nicht zum äußersten kommen lassen.) Der Auftrag des Kaisers an Rostock vom 30. Juni gab er erst an 10. October ab, und sein ganzer Haß richtete sich gegen Oldendorp, der sich bemühe, das Land gegen ihn aufzubringen. Die Rostocker beschwerten sich deshalb bei Heinrich und den Verordneten der Landschaft. 6 ) Ersterer aber erhielt die Aufforderung Heinrichs von Braunschweig und antwortet demselben, 7 ) daß er


|
Seite 201 |




|
sich dem Nünbergschen Abschied gemäß und gehorsam verhalten hätte, auch ohne das zu keiner Zeit davor oder darnach den Geistlichen an ihrer Habe und Gütern Verhinderung gethan hätte, und habe, was von Alters hergebracht sei, ohne Abbruch gebrauchen lassen, was er auch ferner noch zu thun willig wäre. Man sieht, daß von Heinrich auch nach seiner Entscheidung keine gewaltthige Einwirkung zu Gunsten der Reformation zu erwarten stand.
So kam es am 25. Januar 1534 eine Einigung
zwischen beiden Brüdern zu Stande, welche
hernach im December desselben Jahres bei der
Erneuerung des Theilungsvertrages auf zwanzig
Jahre als zu Recht bestehend vorausgesetzt wird.
Sie bildet also den Grund für Heinrichs
künftiges Handeln. Für Malchin ward z. B.
festgesetzt, daß, da nur eine Pfarrkirche
vorhanden war, jeder Theil zur bestimmten Zeit
sie benutzen sollte; doch solle kein Theil den
andern schmähen.
1
) Die Einigung
bestand also in der Theilung der Kanzeln und
sprach die gegenseitige Anerkennung aus. Auf
Grund derselben wird von beiden Fürsten eine
Aufzeichnung der Kirchen und ihrer Güter, soweit
sie herzoglichen Patronats waren, ins Werk
gesetzt.
2
) Sie begann im Juni 1534 und
dauerte bis ins Jahr 1535. Herr Archivar Dr.
Stuhr zu Schwerin macht mich freundlichst darauf
aufmerksam, daß weder eine Instruction zur
Visitation noch ein Nachwort der Visitatoren
vorhanden ist. Es ist in der That die Visitation
nur eine Aufzeichnung der Kirchen und ihrer
Güter, was der Titel bezeugt: Registrum
ecclesiarum commendarum et beneficiorum ...
conscriptum u. s. w. Die Nachrichten Dietrich
Schröders, 1, S. 274-288, sind also zum
wenigsten irreführend. Eine mir von Herrn Dr.
Stuhr gütigst mitgetheilte Probe ans dem
Originalprotocoll bestätigt die Richtigkeit des
Titels "Registrum". "Pampow, dat
kerklen is der fursten, besitter Ketellerus
Keteller, vorlent van beiden, anno XXVI. Pechte
darttho eine houe landes to der wedeme myt erer
rechtycheyt vnde noch dat drudde parth van II
houen to Holthusen vp dem velde, maket XXI ßl.
IIII
 lub. Miskorne III dromet IIII
schepel. Jtem noch horet dartouyn de kapelle to
Roggan, dar van schal de kerckher jarlick hebben
vor sinen vordenkt, dat he den gadesdenst dar
holt, by VIII M. vngeuelick, hir van entholt eme
Jochum Balges bure to Roggan, Kersten
lub. Miskorne III dromet IIII
schepel. Jtem noch horet dartouyn de kapelle to
Roggan, dar van schal de kerckher jarlick hebben
vor sinen vordenkt, dat he den gadesdenst dar
holt, by VIII M. vngeuelick, hir van entholt eme
Jochum Balges bure to Roggan, Kersten


|
Seite 202 |




|
Heylige genomet, II M.IIII ßl. jarliker rente, vth vorbade Joachym Balges; ytem dat rockhon vthe dem croghe to Roggan boreth de kerckher. Metell, dat kercklen is der fursten, besitter Ludolpus Spick, eme vorlent dorch beide fursten anno XVIII. Pechte darto II houen landes myt aller erer rechticheyt vnde tobehornge to der wedeme vnde III dromet miskorns hyrvan vnde vth der kapellen to Sickhusen, hyr to liggende, to hope, vnde synt in vortyden V dromet gewesen, dat warth eme also entagen". Fragen wir nach den Gründen dieses Entgegenkommens von Allbrecht, so läßt sich wohl vermuthen, daß der Landtag, den einzelne Städte nnd zuletzt noch Rostock um Vertretung ihrer Sache angegangen waren, auf ihn eingewirkt habe. Vielleicht ließen seine nordischen Pläne es ihm jetzt gerathen erscheinen, mit der neuen Lehre sowohl als besonders mit Heinrich und den Seestädten sich zu vertragen. Denn die Bewegung in Dänemark begünstigte den Prostestantismus, so daß Jetze rathen muß, "sich der alten Lehre zu entschlagen und in allen Dingen auf evangelische Weise zu schicken, jedenfalls aber mit der Messe es ganz heimlich zu halten". 1 ) Am 27. October 1534 versucht er auch Heinrich durch ein Schreiben an Schönaich ist sein Interesse zu ziehen, indem er ihn auffordert, Dänemark un Schweden mit ihm zusammen zu erobern. 2 ) Schließlich bindet Albrecht im November 1534 den Seestädten gegenüber sich die Hände ganz und gar, wenn er ihnen verspricht: Gottes Wort und das Evangelium lauter und rein, wider die Lehre der Papisten und der Schwärmer, in Dänemark und in Meklenburg, in gemäß der Nürnberger Ordnung predigen und halten zu lassen und alle dawider bestehenden Mißbräuche abzuschaffen. 3 )
Die Stellung Heinrichs zur Reformation in seinem Lande bis zum Jahre 1534 ist also kurz zusammengefaßt diese: Er stellt sich auf den Boden der Reichstagabschiede; als Stand des Reiches und advocatus seiner Kirche nimmt er dieselbe gegen jede Gewalt in Schutz; er verwehrt aber nicht die Predigt des Evangeliums, soweit der Landfriede nicht gestört wird, und sofern er sein ius reformandi mit den Reichsgesetzen in Einklang setzen kann. Erst seit Anfang des Jahres 1533 nimmt er, vielleicht infolge des Einflusses seines Sohnes Magnus, eine entsschiedenere Stellung für die Reformation ein. Albrecht jedoch entfernt sich


|
Seite 203 |




|
von derselben in demselben Grade mehr und mehr, so daß 1 ) er nicht mehr unses des Evangelii weges is". Heinrich tritt dem Schmalkaldner Bündniß nicht bei, während Albrecht zum Halleschen Bunde gehört.
Bereits im Jahre 1534 finden wir eine Kirchenordnung in Meklenburg verbreitet. Im Haupt=Archiv zu Schwerin befindet sich eine Versendungstifte derselben aus dem Jahre 1534, welche die Kirchen angiebt, wohin die Ordnung versendet werden soll, sowie die Zahl der Exemplare. Die Worte auf dem Zettel lauten:
Wo die Kirchenordeninge hin geteylt sein anno 34 in welche stette.
| Wo die Kirchen=Ordenvngen hinkomen ßind. | ||
| XXXII | er Johann dem prediker 2 ) | |
| XL | Jabriel Wolff nach Brandenborgk | |
| LVIII | ern Heinrich dechent zw Güstrow | |
| XXX | ern Jurgen Behernfelder zw Fredeland | |
| XIIII | noch ern Johan dem prediker | |
| II | dem cantzler vnd Dittherich Moltzan | |
| I | Merthen van Waldenfels | |
| II | Kerßen vnd Jochim Wangelin | |
| I | Jurgen Karlewitz | |
| II | Schencken und stadschribern zw Rostock | |
| I | Lutken Han | |
| L | er Valthin von Rostock | |
| XX | er Johan Wetzk | |
| VIII | er Heinrich zwr Wißmer zw Sanct Jurgen | |
| IIII | Vicken Hillebrand sind betzaldt | |
| XX | keigen Malchin | |
| I | er Antonius Schroder geschenckt | |
| I | noch er Johan prediker verantwurd | |
| am Mithwochen nach Lawrencii. | ||
Ein Bedürfniß für eine solche Ordnung lag vor; hatte doch auch der Rostocker Rath schon 1530 eine Ordnung in Religionssachen und 1531 eine leider nicht mehr erhaltene Ordnung der Ceremonien erlassen. 3 ) Wir erfahren von der herzoglichen Kirchenordung nicht viel; nur in der Instruction für die Visitatoren


|
Seite 204 |




|
vom Jahre 1535 1 ) befiehlt der Herzog, eine "gedructe ordenynge" zu verreichen, "wor sie die nicht vorhin haben". Er setzt also voraus, daß eine Kirchenordnung schon in den Händen mancher Geistlichen ist. Es wird das die Brandenburg=Nürnberger Kirchenordnung vom Jahre 1533 sein; denn die Seestädte lassen sich in der schon erwähnten Zusichernng Herzog Albrechts vom~ November 1534 bestätigen, daß das Evangelium lauter und rein "in gemäß der Nürnberger Ordnung" gepredigt werde. Diese Ordnung also zu verbreiten, war eine der Aufgaben der ersten - evangelischen- Visitation, zu der wir nun konnnen.
Es ist im Vorigen gesagt worden, daß eine Art von Kirchenregiment schon vor der Reformation in den Händen des Landesherrn war; dies ist jetzt näher zu bestimmen. Wird nämlich unter Kirchenregimenr das innerkirchliche Amt der Kirchenregierung in rechter Weise verstanden, so hatten diese die Fürsten allerdiiigs nicht; sie lag in der Hand des Bischofs und seiner Beamten, die potestas ecclesiastlica verbo et vi, die potestas regiminis et coercitivae correctionis ad dirigendum subitos in finem beatitudinis aeternae. Nun übten zwar die Fürsten -wie gezeigt - kirchenregimentliche Thätigkeit hin und wieder aus, ohne daß die mittelalterliche Kirche ihnen solche als Recht zugestand. Aber als die advocati ecclesiae hatten die Fürsten schon immer die Aufgabe, die religiöse Grundlage nicht antasten zu lassen, falschen Gottesdienst zu unterdrücken. Dem sich erweiternden Staatsbegriffe gemäß nahmen sie das ius reformationis nicht bloß als Nothrecht, wenn sie gerufen waren, für sich in Anspruch, sondern dehnten es aus zur Pflicht und dadurch zum Recht, für die kirchliche Versorgung des Landes thätig zu werden, welche ja ein Haupttheil des gemeinen Bestens war. Hier liegt der Anknüpfungspunkt für das rein innerkirchliche Amt vor, wie es im Kirchenregiment des Landesherrn ausgedrückt wird. Denn da nach evgangelischer Grundanschauung das geistliche Amt die potestas ecclesiastica nur verbo hat, wie sie auch nur als verbo den Bischöfen, wenn sie erhalten blieben, in Conf. Aug. Art. XXVIII zugestanden wird, so blieb in jenem Artikel immer noch die Frage offen, wer die eigentliche Kirchenregierungsgewalt, die nicht verbo ist, an sich nehmen sollte. Diese kam auf dem bezeichneten Wege und durch die genannte Anknüpfung in die Hand des Landesherrn.
Auch Herzog Heinrich sehen wir das Kirchenregiment in die Hand nehmen, eben im Jahre 1535. Heinrich verordnet nämlich


|
Seite 205 |




|
Visitatoren für seine eigenen Städte, Aemter und Vogteien, sowie für diejenigen, die ihm seinen Bruder gemeinschaftlich gehörten. In der Instruction beauftragt er die beiden Visitatoren, an erster Stelle, Pfarrer und Prädicanten wegen ihrer Lehre, der Ceremonien und der Sakramentsverwaltung zu "verhoren" und etwaigen Wiedertäufern und Zwinglianern zu befehlen, von ihrem Irrthum abzustehen. Er bestimmt ferner, daß eine gedruckte Ordnung vertheilt werde, der man einträglich folgen solle. Er verpflichtet sich, Gemeinden, die untüchtige Prediger haben, mit "rechten Pastoren" zu versorgen; er befiehlt einen "gemeinen Kasten" aufzurichten für die Armen und Diener des Wortes Gottes, ebenso Schulen zu errichten und Schulmeister anzustellen, damit die Kinder in der heiligen Schrift und andern guten Künsten und Tugenden unterrichtet werden, besonders aber deutsche Psalmen und geistliche Gesänge zu Chor" singen können. Der Herzog unterzieht sich also den Aufgaben des rein innerkirchlichen Amtes, den Aufgaben des Bischofs=, d. i. des Besucheamts. Als der Kurfürst von Sachsen 1527 seine Instruction für die erste Visitation erließ, betonte Luther in der Vorrede zu dem Visitationsbuche, 1 ) daß er den Kurfüsten gebeten habe, das "Besucheamt" aus christlicher Liebe anordnen zu wollen. Als "zur Liebe Amt" nimmt derselbe es in die Hand und bezeugt damit, daß dies sein Thun nicht aus seiner obrigkeitlichen Gewalt als solcher fließt, daß es nicht identisch ist mit dem der christlichen Obrigkeit kraft eigenen Berufes zukommenden Rechte in Betreff der kirchlichen Dinge. Da diese Begründung in der meklenburgischen Instruction fehlt, so kann es allerdings den Anschein haben, als ob Heinrich die Visitiraufgabe unmittelbar aus seiner landesherrlichen Stellung der Kirche gegenüber abgeleitet habe.
Und es finden sich in der Instruction Maßnahmen, weIche aus der letzteren erklärt werden können. Heinrich betont nämlich, daß es ihm "unleidlich" sei, wenn die Leute durch Irrthümer und ungegründete Lehre und falsche Ceremonien von der Wahrheit geführt werden. Das ist der neue Staatsbegriff, welcher die Sorge für die gesammte Wohlfahrt unter sich begreift. Mit der "Verführung" ist aber nicht zuerst und allein der Papismus gemeint, sondern "zwinglischer und wiedertäuferischer Irrthum und sonst viele andere unchristliche ungegründete Ceremonien und Lehren." Es ist bezeichnend, daß der Papismus nicht genannt, sondern nur angedeutet wird; die Visitatoren haben diese Andeutung


|
Seite 206 |




|
hernach verstanden. Wenn sie aber in der Instruction vermieden wird, so will der Fürst sein ius reformandi nur gegen diese allgemein als schädlich anerkannte Irrlehre üben. Er verbietet ferner alles "auszuschütten aus neydigem gemüthe, das ungehorsam der obrigkeiten, widderwille, uneynigkeiten und auffruhr dienet" und gebietet allein zu lehren, "was zu fridt, eynigkeit, gehorsam und guther polizey dienet." Es ist also die Sorge für den Landfrieden, die ihn bewegt. Wenn es aber von den Schulkindern heißt, daß sie gedeihen und erwachsen mögen "dem gemeynen besten zu Dinst und Nutz", so erkennen wir darin die Sorge für das allgemeine Wohl. Aus der Landespolizeigewalt lassen sich auch die Bestinunsungen von der Sonntagsruhe und öffentlichen Aergernissen herleiten, sowie die advocatia der Kirche in der Sorge für die Erhaltung der Einkünfte der Pfarrer wiedererkannt wird.
Allein, es muß wiederholt werden, der Herzog tritt nicht nach seinem der Landesobrigkeit als solcher zustehenden Rechte zu kirchlichem Handeln auf. Dem erstens läßt er nur da visitiren, "da das wort gods zu predigen angefangen ist", also nicht in den katholischen Gegenden; er läßt auch nicht im Dotirungslande des Bischofs, noch in dem Theile seines Bruders visitiren. Würde er sich auf seine obrigkeitliche Gewalt berufen haben, so hätte er seinen Willen durchsetzen können; denn dieselbe hatte er, wie wir gesehen haben. Es ist interessant zu beachten wie der Visitator Faber in Plau den Herzog um die Erlaubniß bittet, "den kircherrn und seinen Caplan czu Schweryn freuntlich anzusprechen". Faber bedarf dazu erst besonderer Erlaubniß; aber er muß in seinem Bericht selbst erzählen, daß ihn das Kapitel nicht für einen Visitator hat ansehen wollen. Die papistische Geistlichkeit zu Schwerin erkennt also keine Vollmacht des Fürsten zu solchem Werke an.
Es ist sodann auch bemerkenswerth, daß der Fürst zwei Tbeologen abfendet, Faber und Kutzke, ohne seine Vögte, ja nicht einmal mit einem Juristen, wie in Sachsen. Sie sollen auch nicht, wie in Sachsen, an einem Ort die Prediger in Gegenwart der Amtleute versammeln, sondern jeden Prädicanten einzeln aufsuchen. Sie sollen ebenfalls nicht absetzen, sondern nur "handelen, freuntlich ermahnen, belehren"; nur wo jemand sein Amt zu verwesen untüchtig ist, da will der Fürst einen andern bestellen; und nur wer sich der Schmähungen Schuldig macht, soll gestraft und vom Amte gesetzt werden. Nur an einem Orte, in Gretze bei Boizenburg, fordern die Visitatoren Landesverweisung


|
Seite 207 |




|
des Pfarrers, weil sie "seingleich" in dieser Visitation nicht gefunden haben. Sonst vermahnen sie nur, das Messelesen einzustellen, das nicht ein aufruhr wider sy entstände, denn das volk were erbittert wider sy"; und sie sprechen es aus: Wollen sie sich nicht unserer Lehre und rechten Gebrauchs der Sakramente bedienen, so "faren sy ymmer dahyn, wo sy hyn gehören." Erst in ihrem Schlußwort zum Bericht fordern sie den Fürsten auf, auch in Doberan, Bützow, Schwerin visitiren zu lassen und überhaupt "nachzudrucken", sonst bliebe diese Visitation, die doch stur ein Schatten der rechten Visitation sei, ohne Nutzen und würde im Gegentheil schädlich sein. Ihr Endvorschlag geht dahin, daß eine große Disputation zwischen den Parteien veranstaltet werde.
Indem Herzog Heinrich durch seine Visitatoren nur freundlich vermahnt, handelt er nicht nach seinem obrigkeitlichen Rechte, kraft dessen er Gehorsam nach göttlichem Rechte beanspruchen kann, sondern er übernimmt ein neues Amt, das "zur Liebe Amt", das innerkirchliche Regiment, die kirchliche Regierungsgewalt, der er aber seine weltliche Strafgewalt noch nicht leiht. Diese Regierung ist kein Attribut seiner obrigkeitlichen Gewalt, ist vielmehr von seinem weltlichen Amt unterschieden. Daß er das neue Amt bekam, ist in seiner Stellung als Landesfürst begründet, in seiner obrigkeitlichen Gewalt und ihrer Beziehung zu kirchlichen Dingen. Herzog Heinrich hat neben seiner Pflicht um die Kirche fortan ein innerkirchliches Amt, aber von ersterer unterschieden. Und wie nach dem Vorgange der Stralsunder Kirchenordnung von 1525 in Verfolg der Visitation von 1528 in Sachsen Superintendenten eingesetzt werden, als die rein innerkirchlichen Organe des Kirchenregiments, so steht nun Heinrichs Sorge auf die Berufung eines Superintendenten.
Diesen fand er in der Person des Johann Riebling, welchen er bei seiner Anwesenheit in Braunschweig hatte predigen hören. Der Brief an den Rath zu Braunschweig wegen seiner vorläufigen Entsendung nach Meklenburg ist zu wichtig, als daß er hier nicht sollte mitgetheilt werden; er findet sich im Haupt=Archiv zu Schwerin und ist bisher noch nicht gedruckt.
An die van Braunschweigk.
Unnsern gunstigen willen zuuorn. Ersamen lieden Besondern. Weyle wir dan hiebeuorn kurtzttorschiener tzeit van dem wirdigen vnserm lieben Besonder Ern Johan Ryblingkh predicanten zu Sanck Catharinen kirchen bey euch In Ewer stadt


|
Seite 208 |




|
eyne predigte oder zwu gehort, vnnd wir daraus viel Christlichs trosts vnd vnderweisunge geschepft vnd entpfangen, So das wir an seiner gnants Ern Ryblings person vnd sonderlich an seynem predigen, guthen Iharn vnd geschicklickeyt Eyne Besondere neigunge vnd wolgefallen haben vnd tragen, vnnd zu surderunge vnd außbreytunge gots lob vnd Ehere vnd seins heutigen Euangety gerne segen vnd wolten, das in den kirchen der -Stette vnd sonst allenthalben anderer orthe vnsers fürslenthumbs solche seyne Eintrechtige Christliche guthe ordnunge wie (got lob) itzt bey euch In Ewer stadt vor augen vnd vorhanden ist, forderlich auffgericht mochte werden, Dartzu wir dan gnants Ewers predicanten Ern Johan Ryblings Raths vnd geschicktickeit als fur Eynen Superadtendent gerne geprauchen wolten. Szo ist demnach an euch Unser mit Besonderm gnedigen vteisse gutlichs begern, Wollet zu fürderunge der Ehere vnd wort gotts vnd angetzeigten vnsers geneigten Christlichen gemuts und furhabens Bns den vilgemelten Ern Johan Ryblingkh sich Eyne tzeit langk zu vns alher Jn vnser Fürstenthumb und Land zut uersugen vnd vns als vnser dartzu verordenter Superadtendent darinne wie gemelt allenthalben In kirchen Eyne guthe Christliche Eintrechtige ordnung aufzurichten gutlich erlauben vnd vergunstigen. Unnd euch darin sonder Beschwerunge, wie wir des Eyne sonderliche zuuorsicht In diesem fhalle zu Euch haben, gutwilligk ertzeigen. Indem thut Ir vns guts gefallen. Das wir wydderumb kegen euch vnd den Ewern gnediglichen vnd in allem guthem zu beschulden geneigt sein. Datum zum ist Stouenhagen, Sampstags nach Vdalriei Anno XXXVII.
Was m. g. h. hertzogk Heinrich Ern Johan Ryblings halben an Rath zu Braunschweigk Jne gegen Michaelis zu erlauben alher zu seyner f. g. zu uerfugen.
Aus diesem für die meklenburgische Kirchengeschichte höchst wichtigen Briefe geht also hervor, daß Riebling als Superintendent nach Meklenburg berufen ward. Rieblings erste Anwesenheit hat nicht lange gedauert. Denn bereits am 29. September desselben Jahres 1537 bedankt sich der Herzog, daß der Rath Riebling erlaubt habe, nach Meklenburg zu kommen. 1 ) In der kurzen Zeit, da er allhier gewesen ist, hat er schon viel gewirkt. Jetzt bittet der Herzog, ihn wieder zu senden; Riebling


|
Seite 209 |




|
hat "wiewohl mit Schwachheit zugesagt, auf Martini schierkünftig auf ein Jahr oder anderthalb wiederzukommen". Der Rath aber antwortet in Briefen vom 29. October, 22. November und 11. December 1537, daß er ihn nicht entbehren könne. Und am 17. April 1539 schreibt Riebling ausweichend. Der Fürst ließ aber nicht nach; am 3. März 1540 schrieb Urban Rhegius, 1 ) der Herzog möge doch Riebling in Braunschweig lassen, er wolle einen andern Mann schicken. Aber in demselben Jahre sehen wir Riebling schon in Parchim, und zwar als Superintendenten oder Generalsuperintendenten, d. h. einzigen Superintendenten. Durch diese Nachrichten erledigt sich der Streit über Rieblings Kommen nach Meklenburg. Er ist nicht, wie Latomus in seinem Geneal. Mekl. und Chemnitz in seinem Chronicoon ist Gerdes' Sammlung, S. 633, auch Masch, S. 114 sagt, schon 1534 in Meklenburg gewesen und hat die berühmte Hostie einen Priester eingegeben. Er ist vielmehr im August 1537 auf kurze Zeit im Lande gewesen, endgiiltig erst 1540 gekommen. So beziehen sich die 17 Jahre seiner Thätigkeit in Parchim, welche auf seinem Epitaphium im Jahre seines Todes 1554 angegeben sind, 2 ) schon mit auf die vorläufige Thätigkeit von 1537.. Riebling soll in Hamburg geboren sein, in Wittenberg studirt haben und seit 1529 Pastor in Braunschweig gewesen sein. Daß Luther in Briefverkehr mit ihm stand, ist aus enem Briefe Luthers an Leupold vom 6. Mai 1540 zu schließen, in welchem ersterer um Übergabe eines Briefes an Riebling bittet. 3 )
Der neue Superintendent sollte vor allem eine Kirchenordnung ausarbeiten. Eine solche war für Rostock von Oldendorp verfaßt und als "Ordnung des Raths in Religonssachen" am 30. December 1530 den beiden Parteien vorgelegt worden, worauf dann Slüter mit seinen Genossen eine Antwort als "Eine korte und doch grüntlicke bericht" abgegeben hatte. 1531 wurde eine Ordnung der Ceremonien, die uns leider nicht erhalten ist, vom Rath festgesetzt. Diese hatte die Billigung Luthers und Melanchthons, auch Bugenhagens, gefunden. Aus dem betreffenden Briefe Luthers vom 10. November 1531 4 ) geht hervor, daß


|
Seite 210 |




|
ein Ordnung äußerst nothwendig war, weil ein Prediger - man vermuthet nicht mit Unrecht, daß Slüter es war - sich gegen die Privatbeichte ausgesprochen hatte. Rostock hatte seine Ordnung gemacht, "in Betrachtung Gottes Ehre und zu Unterhaltung gemeinen Friedens der Bürger und Einwohner dieser Stadt ...
dem umgestümen Vornehmen des gemeinen Volks vorzukommen und eines jeden couscientien in Ruhe zu stellen", und hatte dabei erklärt, "Kayserlicher Majestät, seinen Landesfürsten oder jemand anders in seine gebührliche Gerechtigkeit mit nichten, noch klein noch groß, abzubrechen oder zu verhindern". 1 )
Eine andere Ordnung war in Veranlassung Revers, des zwinglisch gesinnten Wismarschen Predigers, von den Hansestädten festgesetzt worden. Rever nämlich hatte schon 1528 eine Schrift ausgehen lassen: "Vorklaringe und entlick beschet", 2 ) in welcher zwinglische Gedanken hervortraten. Auch wiedertäuferischer Schwärmerei hielt man ihn schuldig,und da man von dieser, die in Meklenburg so selten nicht war 3 ) änliche Wirren wie in Münster befürchtete, hatten die Hansesstädte von Lübeck aus an Wismar geschrieben, daß jede Stadt so lange der Rechte des Bundes verlustig gehen sollte, als sie Wiedertäufer und Sakramentirer in ihren Mauern hätte. damit "eyne dope vnd eynerley Sacramente hebben". 4 ) Es war dieser Beschluß die Folge des Hamburger Conventes, auf dem im Jahre 1535 die Theologen aus Hamburg, Lübeck, Bremen, Lüneburg, Stralsund, Rostock zusammengekommen waren, um Vorgänge wie die Münsterschen zu verhüten. Im Auftrage ihrer Obrigkeiten und im Beisein einiger "Politici" arbeiten dieselben eine Ordnung aus in 17 Artikeln, "so fürnemlich geachtete werthe Einigkeit zu erhalten", und eine Anweisung betreffs der Ceremonien. 5 ) Sie lassen aber jeder Stadt eine gewisse Freiheit, "dieweil sonsten in andern Dingen ein jeder, nach Gelegenheit des Ortes, seine Ordnung hätte". Interessant ist die Begründung, welche die Theologen für solches obrigkeitliche Handeln beibringen. "Nicht allein die Kirche, sondern auch das gemeine Beste befindet Elend wegen der verkehrten Lehre der Wiedertäufer, die in dem gemeinen


|
Seite 211 |




|
Besten und in der christlichen Religion alles in einem Haufen vermengt; da sie wie ein Krebs um sich frißt, so kann sie zum gemeinen Verderbniß der Religion und Städte ausschlagen. Also erachtet es die Obrigkeit der Städte ihrem Amte gemäß, solchem Unglück durch bequeme Mittel vorzukommen." Zur Erhaltung gemeinen Friedens in der Kirche und den gemeinen Besten gehört es auch, wenn die Prediger der verbündeten Städte in der Lehre sind der Ceremonien Gebrauch übereinstimmen. Weil die Wiedertäufer in das gemeine Beste sich einschleichen mögen, so soll die Obrigkeit ein Mandat erlassen und Wiedertäufer als Aufrührer strafen. Dies Recht habe die Obrigkeit nach der Schrift. Etwas gelinder denken die Theologen von den Sakramentirern und Papisten. Diese soll die Obrigkeit bloß nicht dulden, weil sie durch Ausstreuchung ihrer Lehren ebenfalls einen öffentlichen Aufruhr erregen könnten. Man sieht, wie die Städte schon weiter gehen als der friedfertige Herzog Heinrich; sie nehmen schon die Strafgewalt, die in ihrem obrigkeitlichen Amte liegt, hinzu. Das Recht zu solchem Handeln entnehmen sie aus der obrigkeitlichen Pflicht, für das gemeine Beste und den Landfrieden zu sorgen. Wo dieser offensichtlich gestört wird, wie durch die Wiedertäufer, da stehen sie nicht an, Gewalt anzuwenden.
In der Kirchenvisitation hatten die Visitatoren Wiedertäufer in Boizenburg getroffen. Never hatte eine Vertheidigungsschrift, als die Visitatoren auch ihn geprüft hatten, an Herzog Heinrich eingereicht, welcher sie Luther zur Begutachtung übersandte. Der Kurfürst von Sachsen schrieb selbst an Heinrich, 1 ) ebenfalls Luther am 7. Juli 1536, 2 ) daß der Fürst schaffe, daß, dieser Prediger ablasse oder seinen Stab anders wohin setze; denn "Christi Ehre wider solche Teufeulsboten fördern sind wir alle schuldig." War also die Irrlehre im Lande verbreitet, waren auch noch viele Prädicanten da, ungeschickt und untüchtig, war die Verschiedenheit in den Ceremonien besonders groß, so war Hülfe von einer Kirchenordnung zu erwarten. Wiederum ist es Herzog Magnus, der in echt reformatorischem Eifer seinen Vater um eine solche anging -- eine Bestätigung unserer oben vorgetragenen Ansicht. Aeußerst interessant ist sein Brief vom 10. October 1538 an seinen Freund und Lehrer. Das Kapitel


|
Seite 212 |




|
zu Schwerin hat an Herzog Heinrich einen anmaßenden Klagebrief geschrieben, wie vorher auch schon an Magnus. Da hat Magnus gesagt: 1 ) Canonicos esse homines impios et nullius pretii; - inter cetera inserebam -germanice eos appellabam gottlose und heillose Leute. Als Grund habe er in dem Briefe angegeben: quoniam doctrinam verbi divini et evangeliane veritatis eiusque proffessores non aequo animo possent ferre, immo magis praedicatores pios atque doctos odio prosequerentur et iniuria afficerent. Aliam vero causam adiciebam, ne unum quidem ex toto eorum numero vel principibus nostris vel reipublicae nostro vel suis amieis neque ornamento neque usni esse posse. Magnus fährt fort, daß der Kanzler ihm riethe, ut dissimularem et contentus essem, und daß er ihm die Antwort überließe. Aber das Verstellen ist nicht Magni Sache; denn obwohl am andern Tage der Kanzler den fertigen Brief zum Untersiegeln bringt und zur Eile auffordert, so war doch Magnus nicht zufrieden, untersiegelte nicht; denn nolo prius respndere quam satis delibaraqerium. Nun soll Büren rathen; aber Eile hat die Sache durchaus nicht. Wozu Büren rieth, zeigt Magni Auftreten auf dem Landtage am 11 November. Da trägt er den beiden regierenden Fürsten, Heinrich und Albrecht, sammt ihren Landräthen eine Protestation und Petition vor. 2 ) Er hält es für eine wichtige und nöthige Sache, daß man eine "gute Ordinantz in der Religion Sachen in diesem Land und Fürstenthumb habe"; weil er selbst als Administrator des Stifts viele Unschicklichkeiten und Mängel gefunden habe, habe er still mit sich überlegt, ohne die Herzöge um Rath zu fragen; jetzt aber sei sein Gemüth zu sehr beschwert, er müsse sich der Sache entledigen und es frei anzeigen, sintemal es nicht Leib, Gut, Ehre und Schimpf, sondern der Seelen Wohlfahrt und Seeligkeit, welches das theuerste und ewige Gut ist, betrifft. Niemand anders als den Fürsten gebührt es, Anordnung zu machen. Magnus sieht also das Recht des Kirchenregiments in der Hand der Landesherren, welche nach seiner Meinung aber gelehrte Männer hinzuziehen müssen. Er selbst will solche Männer dienstlich fordern und mithelfen. Solche Ordnung wird ja zur Wohlfahrt gemeinen Nutzens und zum Heil der Seelen gereichen; ihr Fehlen umbedeutet göttlichen Zorn und unvermeidlichen Schaden. Wenn aber von den Landständen, allen dreien, wegen "der


|
Seite 213 |




|
geschwinden und sterblichen Läufte" hiermit Versäumniß geschieht, und dadurch die Seelen verwahrlost werden, so ruft er die Fürsten und Räthe, ja Gott selbst zu Zeugen an, daß er seine Pflicht mit dieser Aufforderung gethan und sein Gewissen entlastet habe. Die Antwort der Fürsten lautete ausweichend; sie erkenneten seine christliche Wohlmeinung; da es aber eine wichtige Sache wäre, so wolle mans bedenken und zu gelegener Zeit darauf antworten. Die Vermuthung liegt nahe, daß Albrecht selbst der sofortigen Vefolgung der Bitte Herzogs Magnus widerstanden habe; theils wegen seiner eigenen Angelegenheiten, die ihm räthlich erscheinen lassen mußten, die Freundschaft des Kaisers sich zu erhalten; theils mit seinem Bruder Heinrich zusammen wegen der Folgen, die ein solcher Schritt von dem Bischof für denselben haben konnte. Außerdem war am Hofe Heinrichs eine Partei, welche den Papismus zugethan war; außer Schönaich noch Lindenberg und andere. Wenigstens schreibt Magnus in einem noch zu besprechenden Briefe von Lindenberg: vel alii soarum partium. Aus demselben Briefe (s. u.) erfahren wir auch in betreff der Stellung Heinrichs, daß er ein suspiciosus et nasutus interpres wäre, als ob Magnus von einigen aufgereizt und verführt würde. Magnus hält es deshalb für noth, freimüthig (libere et aperte) seinen Vater zu bitten, jener Partei kein Gehör zu schenken. Magnus giebt sich allerdings mit der Antwort zufrieden, "daß die Sache zu dieser Zeit nicht möchte füglich vorgenommen werden." Aber um für dies und sein sonstiges Handeln Trost zu finden, wandte er sich an Luther, der am 14. Mai 1539 ihm antwortet: 1 ) Er habe mit seiner Protestation auf dem Landtage recht, aber auch sein Theil gethan; da die Herrschaften der Diöcese Schwerin getheilt seien, könne er nicht zwingen, sondern nur erinnern; Magnus solle nur über die Erfüllung des Versprechens seitens der Fürsten wachen. Melanchthon gar gratulirte Herzog Magnus am 13. Mai 1539, 2 ) quod impios abusus ex ecclesia tollere coepit. Auch bei Johann Friedrich von Sachsen holte Magnus sich Rath, und dieser schrieb am 12. Januar 1539 3 ) und rieth ihm sogar, da wo er die Jurisdiction hätte, die Reformation anzufangen, widerspenstige Prediger absetzen oder in den Bann thun; wenn er aber dazu kein Recht


|
Seite 214 |




|
hätte, so solle er lieber abdanken, als durch Versäumung seines bischöflichen Amtes sich versündigen. Diesen Rath scheint Magnus befolgt zu haben, den schon drei Wochen nach Ostern 1540 schrieb er wiederum an Johann Friedrich, diesmal in betreff seines Erfolges in Bützow. 1 ) Ueber sein Thun daselbst berichtete Magnus in einem Briefe kurz vor Ostern 1540 an seinen Freund Büren. 2 ) In Bützow nämlich hatten schon 1535 bei der Durchreise der Visitatoren der Rath und die Einwohnerschaft über die Feindschaft des Domkapitels geklagt und die Kirchensteuer zu verweigern gedroht. Magnus verhandelt vor Ostern 1540 mit den Domherren civiliter et humaniter, "sine ulla acerbitate et ea persuasione qua pro virili potui", und erreicht dadurch, daß die Domherrn von der Messe und den Ceremonien abstehen, bis die neue Ordnung fertig ist; inzwischen soll Magister Techen mit Büren zusammen für Kirchengesänge sorgen.
"Bis die neue Ordnung fertig ist". Diese Worte zeigen uns zugleich, daß Riebling schon bei der Arbeit ist. Die letzten Bedenken des Herzogs Heinrich mögen wohl durch seinen Secretair Simon Leupold zerstreut sein. Dieser hatte acht Jahre in Wittenberg studirt und hatte schon als Lehrer in den Diensten des Hannike v. Holstein aus Ankershagen gestanden, als Melanthon ihn den Fürsten empfahl. Am 25. August 1539 zeigt er sein Kommen nach Meklenburg an; Melanchthon habe gerathen, sogleich nach Meklenburg zu gehen. 3 ) Simon Leupold ist der erste Secretair Heinrichs; Lisch urtheilt mit Recht von ihm, daß er von der höchsten Bedeutung für Meklenburg in kirchlicher Hinsicht gewesen sei. 4 ) Jn der That ist seine Thätigkeit außerordentlich wichtig gewesen, bei der Visitation vom Jahre 1541, in der Herbeiholung bedeutender Männer aus Wittenberg, in regem Briefwechsel mit Luther und Melanchthon. Auch Heinrich selbst bezeugt seine Freundschaft mit Luther dadurch, daß er ihm durch seinen Hofbeamten Henning von Warburg ein Geschenk von vier Brachsen machte. 5 )
Im Jahre 1540 ist zu Rostock eine Kirchenordnung gedruckt worden:


|
Seite 215 |




|
Kercken Or=
deninghe | wo ydth
van den Euangelischen Pre=
dicanten | vnd Kercken deners
mit den Ceremonien vnd Ga=
des densten | jn deme For=
stendome Megkeln=
borch | geholden
schal wer=
den.
Was den Inhalt der Kirchenordnung betrifft, so ist es derselbe wie in der Brandenburg=Nürnberger Kirchenordnung von 1533. Nach Richter 1 ) ist letztere auf Befehl des Markgrafen Georg zu Brandenburg und des Raths der Stadt Nürnberg von Osiander entworfen, von andern Theologen des Landes vermehrt und zur Begutachtung nach Wittenberg gesandt worden. Die Wittenberger waren mit der Ordnung zufrieden, nur riethen sie eine nochmalige Redaktion durch die Hand eines Theologen, damit der verschiedene Stil geebnet würde. Diese Aufgabe fiel wiederum Osiander zu, dem Brenz beigegeben wurde, dem die Kinderpredigten im Anhang gehören. Richter urtheilt, daß nächst dem sächsischen Unterrichte der Pisitatoren keine Kirchenordnung in so weiten Kreisen Geltung erlangt hat. In niedersächsischer Sprache ist diese Kirchenordnung 1534 zu Magdeburg gedruckt worden. 2 ) Letztere Ausgabe ist die meklenburgische Kirchenordnung von 1540, genauer: Der erste Theil dieser Kirchenordnung ist für Meklenburg besonders gedruckt worden als "Kerckenordeninghe".
In der Einleitung wird gesagt, daß die Kirchenordnung als Menschenwerk immer Anlaß zum Mißbrauch geben würde, gerade so wie das Gesetz Mosis den Israeliten zum Nachtheil gereicht habe. Dennoch soll man guter, ordentlicher Zucht wegen Ordnungen nicht unterlassen, nach dem Worte im Korintherbriefe. Und nur deshalb ist diese Kirchenordnung zusammengetragen, nicht in der Meinung, als sollte man mit dem Werke solcher ordentlichen Handlungen die Sünden büßen. Die Zucht möge vielmehr der gemeinen Kirchenversammlung Anreizung und Ursache geben, da sie die Predigt fleißiger besuche und die Sakramente mit größerem Ernste empfange. Von diesen beiden wichtigen Stücken handelt deshalb die Kirchenordnung; zunächst


|
Seite 216 |




|
also von der Lehre, wie man predigen soll. Eine besondere Einleitung in dieses Stück wird gegeben: Nach Paulus müssen die Prediger an der Lehre, die nur aus der Schrift genommen werde, halten, denn ihr dreifaches Amt sei es, die Unwissenden zu lehren, die Leute zu ermahnen, die Widersacher zu strafen. Weil sie die Schrift als ihrer geistlichen Nahrung nöthig hätten, als des Lebens Anfang, Mittel, Ende so sei ihnen die folgende Anweisung gegeben, nicht in der Meinung, daß sie daran hangen sollten, sondern daß sie dadurch in die heilige Schrift geführt würden. Es folgen nun die elf Lehrartikel: 1. Vam Olden vnd Nyen Testamente; 2. Van der Bote; 3. Van dem Gesette; 4. Van dem Euangelion; 5. Van. dem Crütze vnd Lydende; 6. Van dem Christliken Gebede; 7. Van dem Fryen Willen - dieser Artikel ist wörtlich aus dem sächsischen Visitationsbuch entnommen, wie auch 8. Van der Christliken Fryheit; 9. Van mynschen Leren; 10. Van der Döpe - die Taufformel in der angehängten "Ordeninge der Döpe" ist Luthers Taufbüchlein von 1524 entnommen -; 11. Van dem Aventmal, angehängt ist "de Form der Absolution". Das zweite Stück ist "Ordeninge der Misse, wo se geholden schal werden". Nach einer allgemeinen Anweisung der Einleitung des Gottesdienstes folgen die Collecten, "de ein yeder nha synem gevalle vor syck nemen mach", 15 allgemeine und 10 auf besondere Feste. Nachdem weiter die Ordnung von Epistel und Evangelium nebst der Predigt gegeben ist, folgt "Ordeninge des Herrn Aventmals". Hier ist die Partie unter der Ueberschrift "Vnderrichtinge, wo syck de Prester mit Cerernonien ym Aventmal holden schal" in Meklenburgischen Abdruck neu; die weiter folgende "vormanynge" ist aus der Döberschen Messe 1525 herübergenommen. Es folgen Anweisungen über die Consecration und Distribution Abendmahls, denen sich zwei Formen des Dankgebetes anschließen, deren letztere von Luther herstammt. Es folgen vier Formen des Segens; dann Hinweise auf die Abendmahlsverweigerung; auf den Fall, daß keine Abendmahlsgäste da sind; auf den lateinischen Kirchengesang und die Horen; auf die "Ordeninge by den Krancken". Angeschlossen erscheint "Van den Eelüden, wo me de vortruwen schal" und "de Ordeninge des begravendes der Doden", sowie eine Feststellung der kirchlichen Feiertage, alles aus der Nürnberger Ordnung.
Diese Kirchenordnung von 1540 ist also, abgesehen von der genannten "Vnderrichtinge" und einer hin und wieder abweichenden Theilung der Absätze, ein bloßer Abdruck der


|
Seite 217 |




|
Nürnberger Ordnung. Sie bietet nichts, das eine besondere Beziehung auf Meklenburg erkennen ließe. Der Sacramentsstreit des Never in Wismar, der doch 1540 noch gar nicht beendet war, wird nicht erwähnt, geschweige daß auf die Sätze des Never Bezug genommen wird. Andererseits war in betreff der übrigen Lehrpunkte noch keiner in Meklenburg strittig geworden, und wenn man sagen wollte, daß die Kirchenordnung nur im Allgemeinen die Lehre fixiren soll, so ist nicht zu ersehen, warum gerade diese 11 gewählt wurden, und nicht noch andere wichtige.
Die Kirchenordnung bietet außerdem Punkte, die nicht auf Meklenburg passen. Es ist auffällig, daß die Gemeinde aufgefordert wird, das Abendmahl geziemend zu feiern mit dem Hinweis, daß aus der Unordnung viel "tydtlyken vnradt vnnd voruolginge" bewegt werden können, "dawile me fyck tho Augsborch vor Keyserliker Majestät vnd allen stenden des Rykes apenbor hesst hören laten, dath me fölck ordeninge holde vnnd holden wolde." Denn die Meklenburger Herzöge hatten die Confessio Augustana nicht mitunterschrieben. Auch der Name der Ordnung als einer "ordeninge desser Visitation" paßt nur zur Geschichte der Brandenburg=Nürnberger Kirchenordnung, deren Abfassung infolge einer großen Visitation von 1528 beschlossen wurde. Schließlich ist auch die im Schluß angedeutete "up vorgande nodtorsstige Examination vnd vorhoringe der dartho verordneten Visitatorn" für diese Zeit in Meklenburg noch nicht erweislich.
Riebling bezeugt auch selbst, daß die Kirchenordnung von 1540 ohne Zwischenwirken eines Dritten aus der Nürnberger Kirchenordnung abgedruckt ist. Nach dem Visitationsprotocoll von 1541 1 ) hat Riebling zum Wismarer Rath gesagt: S. f.. g. haben etliche Ordnung mit großen Unkosten nach den Mirebergischen Ordnungen drucken lassen, danach es in allen Kirchen, Fürstenthum und Landen soll gehalten werden." Und ebenso sagte derselbe zu Rostock, daß man sich künftig "nach der nach der Nürrenbergischen Ordnung gedruckten Ordnung" halten sollte. Wenn demnach unsere Behauptung richtig ist, daß die Ordnung, welche die Pfarrer schon 1535 hatten und von den Visitatoren noch erhielten, die Nürnbergische ist - eine Behauptung, die wir darauf stützten, daß Herzog Albrecht den Seestädten gegenüber zu derselben sich verpflichten mußte -, so


|
Seite 218 |




|
hat Herzog Heinrich also von dem Gedanken einer neuen Kirchenordnung abgelassen, welche er bei der Berufung. Rieblings plante. Um nicht die vorhandenen Ordnungsbücher überflüssig zu machen, um den Zusammenhang seiner Kirche mit andern zu wahren, machte man bei der alten, schon im Gebrauch befindlichen stehen bleiben, nur daß man des besseren Verständnisses wegen die in Magdeburg herausgekommene niederdeutsche Uebersetzung bei Ludowich Dietz auflegen ließ.
Dieser hat übrigens viel Mühe gehabt, die Druckkosten zu erhalten. Bei der Kirchenvisitation 1541/42 vertheilte Simon Leupold an 97 Kirchen Kirchenordnungen und ebenfalls bei Dietz gedruckte Neue Testamente, und zwar oft beide zusammen, oft auch nur die Kirchenordnung allein; letztere kostete 6 ß. Neue Testamente wurden 60 an arme Prediger vertheilt und geschenkt. 1 ) Montag nach Martini 1541 erhielt Leupold die Aufforderung vom Fürsten, 130 Kirchenordnungen, weIche in Swaen liegen, zu sich zu nehmen; die 50 Testamente soll Dietz erst einbinden. 2 ) Antoni 1542 schreibt Leupold an den Fürsten, 3 ) daß er nach vollbrachter Parchimscher Visitation mit den Testamenten und Gebeten wider die Türken samnst den Ordnungen, "deren noch sechtzig vnd darüber von den 130 vnuerkauft vorhanden sind" an die Orte gehen will, wo solche noch nicht sind. Am 18. Juli 1543 hatte Dietz sein Geld noch nicht erhalten, obwohl Leupold zu Jacobi es zu zahlen versprochen hatte. Der Herzog vertröstete Dietz bis auf die Heimkehr Leupolds, die zum 10. August erwartet wurde. 4 )
Manches ist aus der Kirchenordnung von 1540 in die noch jetzt geltende von 1552 herübergenommen. Abgesehen von der großen Zahl der Collecten findet sich von den 11 Artikeln der Lehre der achte 1552 wieder. Denn die Umarbeitung derselben ist eine vollständige und mußte es auch sein, da die Ordnung von 1552 auf den Verlauf der dogmatischen Streitigkeiten Bezug nehmen mußte. So ist z. B. der Begriff der Buße erst 1552 vollständig, die Theilung des mosaischen Gesetzes genauer gegeben, offenbar weil die Kirchenordnung von 1552 schärfer von den Antinomisten sich scheiden wollte, wozu die Ordnung von 1540 noch keine Veranlassung hatte. Denn wenn auch der antinomistische Streit schon ausgebrochen war, waren doch die


|
Seite 219 |




|
Wirkungen dieses Streites in der Gemeinde noch nicht zu erkennen. Andererseits ist 1552 der evangelische Begriff der Heilsordnung genauer herausgestellt. So wie er 1540 erscheint, ist er osiandristischer Deutung fähig; man vergleiche besonders den vierten Lehrartikel "Vom Evangelium". Wo aber die Kirchenordnung von 1540 alte katholische Gebräuche noch festhielt, z. B. das Westerhemd nach der Taufe, die Elevation der Hostie, den Gebrauch des Meßgewandes, werden auch diese in den spätern Ordnungen weggelassen.
Ebenso wie die Instruction zur Visitation 1535 läßt uns die Kirchenordnung erkennen, wie der Fürst das innerkirchliche Amt des Regiments handhabt. Er vermahnt nur zum Halten an der Kirchenordnung und läßt eine gewisse Freiheit und Spielraum. Den Schluß bildet nämlich eine Vermahnung "an alle Parhern, Predeker und dener der gemener, beyder Herschopen gebedes, je in den Steden, vnd up dem Lande", daß sie nach dem Laut dieser "Visitation" sich halten. Auch die Unterthanen werden ermahnt, ihre Prediger in allen Ehren zu halten; die Prediger insbesondere wiederum, keine Neuerungen einzuführen auf daß Einigkeit und Friede desto stattlicher erhalten werden. Fallen aber Zwistigkeiten vor, so soll die Obrigkeit angerufen werden. Dagegen wird zugegeben, daß es nicht möglich sei, alles in den Buchstaben zu fassen, was in der Kirchenversammlung ausgerichtet werden soll. Darum soll den Kirchendienern unverhalten bleiben, was mehr in den Kirchen christlicher Zucht nützlich zu ordnen ist, und was in zufallenden Nöthen göttlich zu handeln sei, nur daß alles nach dem göttlichen Worte vollbracht werde.
Die Bedeutung dieser Kirchenordnung für unser Land leuchtet ein. Wurde doch die Visitation der Jahre 1541/42 ad normam dieser Ordnung durchgeführt; alle Prediger und Patrone sollen fortan nach dieser Kirchenordnung handeln, z. B. heißt es ausdrücklich in der Bestimmung der Visitatoren 1542 zu Malchin: "Ein Ersam Rath soll vleissigk acht haben, das sich de. predicanten der ordeninge, wie im gantzen lande gehalten sol werden, gleichmessig bezeigenn." 1 ) So wurde eine Conformität der Lehre und der Kirchengebräuche hergestellt. Aber die Kirchenordnung enthielt noch nichts über die Kirchenverfassung im Allgemeinen, sowie über eine Visitations= und Superintendentenordnung im Besonderen. Auch die Lehre, die in ihr wie 1552


|
Seite 220 |




|
den ersten Theil bildet, kommt noch nicht in Betracht als Bekenntniß der meklenburgischen Landeskirche, sondern nur als eine Anweisung und Anleitung, die heilige Schrift desto fleißiger zu gebrauchen, "eine korte Anwysinge". Wie sie als eine "Vermahnung" des Fürsten erscheint, so ist diese doch nur eine "gütliche" und konnte noch nicht von einer Strafandrohung im Uebertretungsfalle begleitet sein, wie Luther für den Kurfürsten von Sachsen schon 1528 beansprucht, weil einerseits die Domkapitel, andererseits der katholische Albrecht Widerspruch erheben konnten. Dieser blieb nicht aus, wie die Kirchenvisitation 1541 in Malchin, Laage und Güstrow bewies, wo man sich gegen die Visitation und damit auch gegen die Annahme der Kirchenordnung wehrte mit dem Hinweis darauf, daß nur Heinrich, nicht auch Albrecht dieselbe verordnet habe. Und wenn Heinrich auch für die Kirchen seines Landestheils und Patronates eine Strafgewalt und Verordnungsrecht noch nicht übte, so zeugt das eben nur sowohl für seine Friedfertigkeit, als besonders für seine Auffassung des "zur Liebe Amtes", welches weltliche Strafen einstweilen verschmähte, wenn auch seine Visitatoren zum "nach drücken" rathen mochten. So, und nur so glaube ich den Titel der Kirchenordnung erklären zu können, sowohl die bloße Bezeichnung "Forstendom Megkelnborch", ohne ein ec., wie 1552, als auch das Fehlen des fürstlichen Namens. Anders erklären der Theologe Aepin, 1 ) Schomer, auch der Verfasser der Bützowschen Ruhestunden. Ersterer meint, die Kirchenordnung sei nicht ans landesfürstlicher Hoheit und Macht vorgeschrieben und publicirt, sondern nur interimsweise von damaliger Priesterschaft, doch wohl nicht sonder Vorbewußt und Consens der Landesherrschaft angenommen, non publica, sed privata auctoritate. Und M. U. L. Unpartheiische Prüfung ec. 1739, S. 152, meint, daß der Fürst bis zur Errichtung einer förmlichen Kirchenordnung sie nur empfohlen habe. Diese Vermuthungen müssen meines Erachtens dahin präcisirt werden, daß, da Kirchenordnungen zu erlassen und zu machen der potestas ecclesiastica des Bischofs zustand, und diese vom Bischof von Ratzeburg und jedenfalls von dem Domkapitel zu Schwerin für sich in Anspruch genommen ward, Herzog Heinrich die Kirchenregierungsgewalt anno 1540 noch nicht in dem Maße in die Hand genommen hat, daß er aus eigenem Rechte solche Ordnung ausrichtete.


|
Seite 221 |




|
Auch dem Landtage hat sie nicht vorgelegen; bei den mangelnden Landtagsnachrichten läßt sich der Beweis dafür nur indirect erbringen, insofern als in den Reversalen von 1621, ebenso in der Kirchenordnung von 1602 immer nur auf die Kirchenordnung von 1552 zurückgegangen wird. Dennoch haben die Visitatoren außer an den schon genannten Orten einen eigentlichen Widerstand nicht gefunden. Da aber das ganze Land noch nicht reformirt war, vielmehr ein Fürst zum katholischen Glauben sich hielt, und deshalb von einer evangelischen Landeskirche die Rede nicht sein konnte, so konnte Heinrich die Kirchenordnung nicht als Landesgesetz ausgehen lassen; sie blieb "Vermahnung" des friedfertigen Fürsten, der sein "zur Liebe Amt" nicht anders üben wollte und konnte.
In Verbindung mit dieser Kirchenordnung steht:
Ordeninge
der Misse | wo de vann denn
Kerckheren vnnde Seelsor=
gern ym lande tho Meckeln=
borch | jm Fürstendom Wen=
den | Swerin Rostock vnnd
Stargharde schal ge=
holden wer=
den.
Ohne Einleitung wird sofort eine Anweisung den Kirchherrn und Küstern auf den Dörfern in Betreff der Sonnabendvesper gegeben. Es folgt die Anordnung des eigentlichen Gottesdienstes, die sich als eine veränderte und wesentlich vermehrte Ueberarbeitung des schon in der Kirchenordnung Enthaltenen giebt. Der Gottesdienst wird mit einer -allgemeinen Beichte und Absolution eingeleitet. Erst dann folgt der Introitus, wobei zwischen Stadt und Land geschieden wird, indem auf dem Lande ein deutscher Psalm genommen werden soll, in den Städten die lateinischen Introitus, die "nicht wedder de hillige Schrifft synt". Es folgt das Kyrie, unter Angabe der Noten, lateinisch und deutsch, wiederum mit der Scheidung von Stadt und Land; darnach das "Allein Gott in der Höhe", sowie die Salutatio. Sodann wird eine ganze Reihe von Collecten angegeben, zuerst die für die Festtage: zwei für Advent, von denen die letztere aus der sächsischen Kirchenordnung genommen ist; auf Weihnacht, dieselbe auf Neujahr, aus der sächsischen entnommen; auf


|
Seite 222 |




|
Epiphanias; auf Purificatio Mariä, aus der sächsischen auf Septuagesimä -- Passah, aus der sächsischen Kirchenordnung; auf Himmelfahrt, aus der Nürnberger; auf Pfingsten, aus der sächsischen; die übrigen stehen alle schon in der Nürnbergschen, mit Ausnahme derjenigen auf Mariä Heimsuchung; ein Gebet Luthers in der Zeit der Pestilenz wird hergesetzt; den Schluß bildet eine Collecte wider den Türken; im Ganzen sind es 36. Es folgt die Verlesung der Epistel und des Evangeliums, so wie in der Kirchenordnung. Hernach aber ist neu vorgeschrieben eine Lection am Weihnachtstage, eine Lection am Johannistage, Epiphanias, Purisicatio Mariä, Verkündigung Mariä, Johannis des Täufers, Visitatio Mariä, die alle dem Alten Testament entnommen sind. Neu ist auch die Gefangordnung; vor der Predigt das Credo, nachher die Präsationen mit Noten, 15 an der Zahl. Unter den folgenden Abendmahlsvermahnungen ist die erste und dritte neu, die zweite schon in der Nürnberger Kirchenordnung. Es folgt das Vaterunser und die Einsetzungsworte mit Noten, nebst drei Danksagungsgebeten, deren erstes von Luther herstammt. Nach dieser "gemeinen Misse" folgt die Anweisung, wenn keine Communicanten vorhanden sind, nebst kurzer Begründung der deutschen Verlesung der Einsetzungsworte; darauf die Form der Taufe, bei der die erste Vermahnung neu, die zweite nebst der ganzen Anordnung aus der Kirchenordnung entnommen ist. Es folgt die deutsche Litanei Luthers, darauf Bestimmungen über die Nothtaufe und über Krankencommunion. Ein Schlußwort des Buches fehlt. 1 )
Aus dieser Inhaltsangabe dürfte zu ersehen sein, daß wir es mit einer vollständigen Gottesdienstordnung zu thun haben; weiter, daß dieselbe nicht die Abschrift einer anderswo gebrauchten sein kann, sondern aus verschiedenen 0rdnungen zusammengestellt ist. Zu den angeführten -- sächischen und nürnbergischen-- kommt noch die papistische Agende von 1521, wofern wir anders den Worten Georg Westphalens in seinem Diplomatarium Mecklenburgicum, S. 1126, dem auch Richter, III, S. 253, folgt, glauben dürfen - die Agende ist sehr rar -, daß "nonnullae quoque preces et ceremoniarum descriptiones" in der Ordnung adoptirt seien. Wir müssen aber noch einzelne bemerkenswerthe Stellen herbeiholen, um auf den Verfasser selbst einen Schluß wagen zu können. Der Ausdruck in den einzelnen Anordnungen ist ein


|
Seite 223 |




|
wechselnder. Sehr häufig findet sich "wy wylle lesen", "wy wyllen nicht tho schaffen hebben". Daraus geht hervor, daß der Schreiber mit den Kirchherren sich zusammenfaßt, selbst also auch dem geistlichen Stande angehört haben muß. "Damit in allen Stücken Ordnung herrsche", wolle man es so oder so halten. Um also eine Uebereinstimmung im Gottesdienst zu erhalten, ist diese Ordnung gestellt worden, nach der die Geistlichen sich halten wollen, wenn ihnen auch hin und wieder Freiheit gelassen ist, diese oder jene Collecte, Vermahnung u. dergl. auszuwählen, z. B. ein yder wert da gebede ordenen na gelegenheit u. s. w. Nichtsdestoweniger heißt es aber auch, "der Kerckherr schall", "me schall ock de Lüde vormanen", "mey schall syngen". Daraus folgt, daß der Verfasser eine autorisirte Person ist, die Macht hat, solche Ordnung als verbindlich hinzustellen. Dieselbe hat an der Visitation theilgenommen. Dies geht aus Folgendem hervor: " Wat nu de Eleuation belanget, syn de Kerckheren jne allen vorsamlyngen, wor de Synodi gehalten syn, vormanet, fat wy uns den andern, inde meisten Kercken, in düssem Lande ock in anderen Fürstendomen wyllen vorgelyken, de vorlangest de Eleuation affgedan hebben".Der Verfasser hat auch amtliche Erfahrungen gesammelt, z. B. daß die Kirchherren am Sonnabend kein Buch zur Hand nehmen, "wo by velen ein gebruk ys", daß die Cantores Gesänge nehmen, die mit den Festen nicht immer sich reimen, daß die Pastoren oft nicht laut und deutlich.genug sprechen. Weil es in Meklenburg "etlyher orsake halven geholden wert", läßt er das Fest Assumptionis Mariä bei Bestand, setzt aber eine andere Epistel und Evangelium fest. Er kennt die Sitte des Landes, daß die Leute am Osterfest zum Abendmahl sich drängen. Weil er erfahren hat, daß besonders auf den Dörfern selten am Sonntage Abendmahl gehalten wird, hat er eine eigene Ordnung für den Fall gestellt, daß keine Comntunicanten da sind. Da manche Pastoren wegen der Litanei Entschuldigungen vorbrachten, hat er Luthers Litanei abdrucken lassen, "unde nemandt orsake hebbe, jnn deme sick tho entschüldygen". Er kennt die Unsitte, daß die "Bademömen hyr jm Lande" die Frucht im Mutterleibe taufen "edder arme, edder vöte" und spricht die Erwartung aus, "de Kerckheren werden de Bademömen flytich vormemen". Die Visitation muß zu einer Zeit stattgefunden haben, wo der lateinische Kirchengesang, wenigstens in den Städten, noch im Gebrauch war, dagegen auf dem Lande auch noch erhalten werden sollte. Aber die Verfasser bringt Gründe bei, warum die verba consecrationis in deutscher Sprache


|
Seite 224 |




|
gesungen werden sollen. Indem er dies in besonderer Ausführung thut, ist ersichtlich, daß er nicht überall Einverständnis vorgefunden haben wird. Die Visitation endlich hat stattgefunden, als das Papstthum in gewissen Kreisen noch in Blüte stand. Denn so heißt es: "De almechtyge geue unde vorlene, dat de Domheren, Mönnicke unde ander umher, de de Prelaten Landes genömet werden, van ehrem svnne unde rnysbruke afftreden". Alle diese Umstände weisen auf die Visitation von 1541 hin Die Commissare waren laut Visitationsprotocoll Riebling, Kückenbieter, der Secretair Leupold und der Rath Court Pentz, auch Parum von Dannenbarch. Wenn nicht auf Riebling allein, so ist die Urheberschaft auf Riebling und Kückenbieter zurückzuführen. Für letzteren spräche wohl, daß er seit 1534 in Schwerin, an der Schelfkirche gewaltig wirkte. Für Riebling spricht dagegen der Umstand, daß er der Generalsuperintendent des Landes war. Auch Ehyträus in seinem Bericht von der Kirchenordnung 1599 1 ) nennt Riebling, wenn es heißt: "Man soll verbleiben bei de Ordnung der Missen, so wenig Jahr zuvor Herr Riebling hatte drucken lassen". Ebenso erklärt das Rostocker Ministerium 1603 in der Schutzschrift gegen den Rath, 2 ) "verfaßt erstlich auf Befehl Herzog Heinrichs durch Superintendent Riebling".
Manches ist aus der Ordnung in diejenige von 1552 herübergenommen worden: Die Anordnnng der Vesper an den Sonnabenden, die allgemeine Beichte vor dem eigentlichen Gottesdienste; die Feste finden sich 1552 wieder vor mit Weglassung desjenigen der Mariä Himmelfahrt; von den Collecten sind vorhanden, die erste Adventscollecte, jedoch verkürzt; diejenige aus Weihnacht, aus Purisicationis, vom Leiden Christi, aus Ostern, aus Pfingsten, die erste auf Trinitatis; manche, die meisten, kehren nicht wieder.
Schwierigkeit macht noch die Angabe der Jahreszahl: Aus dem Titel 1540, hernach am Schluß "Tho Rostock by Ludowic Duetts gedruckt. Anno 1545. Am 16. Junij. Schon Masch (S. 128) macht die Beobachtung, daß sich in der letzten Hälfte eine andere Art Papier findet - vom Bogen M an --, und muthmaßt, daß Riebling diese Ordnung vor 1540 entworfen - aber Riebling kam erst 1540! - und in Druck gegeben habe, den Druck aber einstellen ließ bei Bogen M, da man die


|
Seite 225 |




|
Nürnberger Ordnung drucken wollte, und erst hernach, da in der Kirchenordnung die Cerermonien zu wenig ausführlich enthalten waren,. die Ordnung der Misse zu vollenden befahl. In den Jahrbüchern 4, S. 185, wird vermuthet, daß man nach begonnenem Drucke erst die Resultate der Visitation abwarten wollte; und man stützt diese Vermuthung darauf, daß in der Meßordnung Andeutungen von amtlichen Erfahrungen sich finden. Letzteres ist, wie wir sahen, allerdings der Fall; und die Vermuthung in dieser Form ist richtig. Denn die Ordnung der Misse hat die Elevation der Hostie beseitigt, während sie in der Kirchenordnung noch beibehalten wird; also ist die Ordnung der Misse später als 1540 vollendet.
So hatte nun Meklenburg seine Gottesdienst= und Kirchenordnung. Und es bleibt das Verdienst des edlen Fürsten bei Vestand, das Chyträus in seiner Leichenrede also rühmt: 1 ) Cum seiret deum a gubernatoribus hoe officium praecipue flagitare, nec se populis suae curae ac fidei commissis, ullum aliud posse beneficium amplias impertiri quam verae pietatis doctrinam ... , omni diligentia, studio et labore curavit recte constitui ecclesias, tolli blasphemos et idololatricos cultus, proponi piam doctrinam, erudiri populum de veris vitae offiecis, euravitque ut una vera et consentiens docentium vox esset in ecclesiis et ne locus fanatica opiniones tune passim spargentibus concederetur.
Anmerkung. In der meklenburgischen Litteratur sind beide Odnungen nicht immer gleich und recht bekannt gewesen. Grape (Das ev. Rostock, 1707), S. 313, läßt die Kirchenordnung 1545 von Riebling verfaßt sein; er verwechselt sie also mit der Meßordnung. Thomas (Lutherus bisecl. 1717), S. 26, kennt beide, aber führt sie auf Riebling zurück. Mantzel (De Sup. Parch. 1717), S. 13, bringt den Irrthum Grapes anfs Neue. Dagegen F. N. Aepin (Disput. de constitutionum ecclesiarum necessitate, 1726) hält die beiden auseinander und weiß, baß erstere mit der Magdeburgischen von 1534 übereinstimmt; ebenso in seinem begründeten Bericht, 1738, D. 8. Aber Klüver in seiner


|
Seite 226 |




|
Beschreibung des Herzogthums Meklenburg, I, S. 407, kennt die Kirchenordnung nicht M.= U. L. Unpartheiische Prüfung 1739, S. 152, weiß die Herkunft der Kirchenordnung richtig anzugeben, während Nettelbladt (Succincta notitia 1745), S. 126, die Kirchenordnung von Riebling nach der Magbeburger komponirt sein läßt. Schomer (de libris seu matriculis ecclesiae, 1747) giebt ben Ursprung wieder richtig an. Allein David Frank (Altes und Neues Meklenburg, 1754), S. 208, kennt sie wiederum nicht. Den "Bützowschen Ruhestunden", 1761, ist sie ebenfalls unbekannt, aber 1766, Theil 23, S. 12, ist sie inzwischen bekannt geworden. Masch (Geschichte merkwürdiger Bücher, 1769), S. 112, kennt und beschreibt sie. Das "Handbuch Ehren Geistlichkeit", 1780, S. 13, verwechselt sie, wie Grape, mit der Meßordnung, ebenso wie F. J: Aepin in der "Geschichte Meklenburgs", 1793, S. 137. Santen in seiner Reformationsgeschichte, 1817, sind beide Ordnungen nicht erwiesen. Dietrich Schröder in seiner Kirchenhistorie, 1788, I, S. 359, beruft sich bloß auf Thomas u. s w. Krey "Erinnerungen an Heinrich V. und Johann Albrecht I.", 1817 S. 5, kennt wohl die Kirchenordnung, giebt aber ihren Jnhalt verkehrt an: "nur Agenda enthaltend", eine Angabe, die schon Mank "Einleitung in die Schwerinsche Kirchengeschichte", 1765, S. 24, getadelt hatte.