

|
Seite 42 |




|



|
|
:
|
5.
Acten und Urkunden der Bauleute zu Schönberg.
Die Schriftstücke der hiesigen Bauleute (Ackerbürger), die einen Zeitraum von 200 Jahren umspannen (etwa 1650 - 1850), sind


|
Seite 43 |




|
aus dem Nachlaß des vormaligen Schulzen Spehr in das Verwahrsam seines Schwiegersohnes, des Hotel= und Husenbesitzers Herr Holldorff, übergegangen. Als ich mich bei diesem nach der Hausmarke seiner Hufe erkundigte, erhielt ich zunächst eine negative Auskunft; dagegen ließ Herr Holldorff zu meiner angenehmen Ueberraschung zwei der vier in seinem Besitz befindlichen Urkundenkisten herbeibringen, in deren einer mich sogleich eine umfangreiche Pergamenturkunde des 17. Jahrhunderts fesselte. Der Güte des Inhabers danke ich es, daß ich von sämmtlichen Kisten in einem seiner Privatzimmer eine genaue Einsicht nehmen durfte. Der dürftige Inhalt der einen Kiste, Papiere unsers Jahrhunderts anscheinend, ist allerdings in Folge langen Verschlusses fast völlig vermodert. Von den übrigen drei Kisten beziehen sich zwei ausschließlich auf die öffentlichen Rechte und Pflichten der Bauleute, eine dritte enthält gemeinsame Verabredungen zum Schutze ihres privaten Besitzes. Vereinzelt finden sich noch gedruckte Plakate, die bereits bei Masch, Gesetze, Verordnungen und Verfügungen für das Fürstenthum Ratzeburg, Schönberg 1851, wieder abgedruckt sind, u. a. die Verordnung Adolf Friedrich IV. über die Berechtigung der Schönberger Mühle vom 24. Februar 1763. Ebenso ist dort das Stadtreglement vom 26. April 1822 abgedruckt, das hier in einer beglaubigten Abschrift vorliegt.
Die Uebersicht über die Urkunden gliedere ich so, daß ich zuerst von der Erhaltung und Mehrung des Besitzstandes, dann von den den Bauleuten obliegenden Pflichten, zuletzt von den ihnen zustehenden Rechten rede.
I. Die am Anfang des vorigen Jahrhunderts bestehende Neunzahl der Bauleute verminderte sich im Jahre 1729 um eine Stelle, die des Baumanns Peter Schwartz. Laut Contract vom 9. April 1729 (amtlich bestätigt am 8. Juli 1729) erwarben die übrigen Bauleute seine Ländereien um den Kaufpreis von 833 Thlr. 16 ßl. in gutem Hamburger und Lübecker Courant; sie zahlen weiter nur die jährliche Contribution neben dem Monatsgeld, nebst dem Fruchtzehnten und ein Schneidelschwein; Schwartz behält sein Wohnhaus nebst der darin radicirten Brauerei, nicht weniger davon dependirenden bürgerlichen Pertinentien und denen zween Wiesen ("Herren=Koppel und Sieck=Wisch"); den Bauleuten bleibt für später das Vorkaufsrecht.
Zum Schutze ihrer Wohn= und Wirthschaftsgebäude sind die Bauleute um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der Herrnburger Brand= und Rothgilde beigetreten, die unter dem Vorstande des Mühlenbesitzers Jochim Jeremias Hudemann, und des Einwohners Heinrich Schütte am 27. April 1751 gestiftet und von der Regierung zu Ratzeburg Namens des Herzogs Adolf Friedrich IV. am


|
Seite 44 |




|
13. August 1754 bestätigt wurde; eine abermalige Bestätigung mit der Unterschrift Serenissimi erfolgte durch Großherzog Georg am 8. December 1817. Neben den Statuten, neben einzelnen erhaltenen Rechnungen liegt noch in einem größeren Hefte vor ein "Verzeichniß derer Scheunen, welche sich in der Herrnburger Roth= und Brandgilde haben einschreiben und versichern lassen."
Unter sich allein stiften die Bauleute zu Schönberg später eine Brand= und Feuergilde; die Statuten sind am 1. Februar 1820, der Nachtrag dazu am 16. April 1822 vom Großherzog Georg eigenhändig bestätigt worden.
Um Lebens= und Sterbenswillen errichten die Bauleute eine Todtenlade am 19. Februar 1765, deren Statuten gerichtlich (Unterschr. Schleiermacher) am 11. Juni 1765 bestätigt werden. Berechnungen liegen nur aus diesem und dem nächsten Jahre vor.
II. Hinsichtlich ihrer Pflichten wehren sich die Bauleute mit Hand und Fuß gegen eine Steigerung derselben. So gebietet Adolf Friedrich II. seinem Amtmann bereits am Anfang seiner Regierung 14. Juni 1701: "wir befehlen dir, daß Suppl. bei ihrem alten Herkommen und Gerechtigkeit mit den Fuhren unverändert gelassen werden." Ebenso im Jahre vorher am 23. Juli (und ähnlich früher) Herzog Friedrich Wilhelm von Meklenburg=Schwerin: "daß du nichts mehr und neues aufbringest, als was sie daher praestieret haben." Beschwerden über Fuhren finden sich noch u. a. 23. Juni 1714; eine Bitte um Abstellung der Holzfuhren vom 2. December 1751. Aehnlich sichert Herzog Carl mit seiner Namensschrift (Neustrelitz, den 22. April 1795) den Bauleuten eine Untersuchung ihrer Beschwerden zu. In demselben Jahre aber, 6. November 1795, mahnt sie der gütige Fürst, nachdem vorausgeschickt ist, daß sie anstatt des Natural=Zehnten dem Kammerrath Boccius zu Ratzeburg fortan "nur 200 Thlr. und die bisher gelieferten jährlichen vier Fuder Rockenstroh und ebensoviel Gerstenstroh" zu entrichten hätten, "sich an diesen Gnadenbezeugungen genügen zu lassen und alle ferneren Bitten um weitere Minderung ihrer Abgaben einzustellen." Unter der Regierung des Großherzogs Georg bitten die Ackerbürger um Abminderung der ihnen auferlegten städtischen Abgaben, werden aber am 10. und 20. Januar 1824 abschläglich beschieden. Der Geldwerth des Natural=Zehnten wird aber in einem direct mit der Kammer nach dem Ableben des Kammerdirectors (früheren Kammerraths) Boccius abgeschlossenen Pachtcontract (Trinitatis 1836 - 1848) nicht erhöht; auch die Vertheilung der Summe auf die einzelnen Hufen ist wie es scheint die gleiche geblieben; zu jenen 200 Thlr. tragen bei:


|
Seite 45 |




|
| Joh. Burmeister | 34 | Thlr. | 1 | ßl., | |
| Peter Grevsmühl | 25 | " | 7 | 1/2 | " |
| Matthias Freitag | 20 | " | 6 | 1/2 | " |
| Böckmann | 25 | " | 25 | " | |
| Fick | 26 | " | 14 | " | |
| Joachim Burmeister | 19 | " | 47 | " | |
| Boye | 21 | " | 8 | 1/2 | " |
| Spehr | 27 | " | 34 | 1/2 | " |
| ----------------------- | |||||
| Summa | 200 | Thlr. | N. | 2/3. | |
Aus den gemeinsamen Petitionen der acht Bauleute nenne ich noch den Antrag (21. Februar 1780), dem von ihnen erbauten Flachsofen Gartenland für einen Wärter beigeben zu dürfen; und eine Bitte um schonende Berücksichtigung wegen der Magazinlieferungen für die russischen Truppen vom 24. Juni 1814.
Eine Klage der Nachbardörfer Malzow, Kleinfeld und Siems führt zu einer gerichtlichen Citation 18. September 1754. Eine Klage beider Pastoren wegen unbefügten Hütens liegt vor aus dem Jahre 1799. Mit dem ersten Pfarrer, dessen Wohnhaus an die Straße verlegt ist, wird über einzelne bauliche Leistungen, u. a. über eine neue Mauer unter dem 24. Juli 1831 ein von dem Pastor Marggraff, den Juraten J. P. Böckmann, J. Schleuß, H. Renzow und den sämmtlichen acht Bauleuten (darunter gleichfalls Peter Böckmann) unterzeichneter Vertrag abgeschlossen.
Eine Reihe von Actenstücken bezieht sich auf Differenzen mit den Pächtern des Bauhofes. Mit dem Pensionarius Kniep wird unter dem 16. Januar 1758 ein Vergleich abgeschlossen, wonach Kniep gegen eine jährliche Abgabe der Bauleute auf den täglichen Hofdienst verzichtet; derselbe übernimmt gegen eine Entschädigung auch die Fuhren an den Müller am 27. Februar 1758. Gegen seinen Nachfolger Meyer werden wieder Beschwerden erhoben, in der Regel aber von Neustrelitz aus zurückgewiesen (so 1769 und 1781.)
Ungleich zahl= und umfangreicher sind die Actenstücke, die sich
III auf die Rechte der Bauleute beziehen. Nahe an zwei Jahrhunderte müssen sie ihre alleinigen Ansprüche, insbesondere auf das Galgen= und Köppel=Moor, das ihnen als "Zwinger für ihre Pferde" dient, im Wege des Rechtens gegen die Bürger vertheidigen. Unter den theils im Original, theils in Abschrift, zum Theil auch doppelt vorliegenden Schriftstücke beider Parteien, aus gerichtlichen Entscheidungen und Vergleichen suche ich als Laie, dem überdies die alten Namen der Schönberger Feldmark noch fremd sind, die wichtigsten


|
Seite 46 |




|
herauszuheben. Unbezweifelt sind dies zunächst die Vergleiche von 1617, 1687 und ein Urtheil von 1767, alle drei in feierlichen Formen abgefaßt, die erste und dritte Acte zugleich auf Pergament niedergeschrieben.
Zur Beilegung alter Streitigkeiten zwischen den Bauleuten und gesammten Bürgern und Bürgermeister des Städtleins Schönberg wird unter Vermittelung des "Hauptmanns zum Schöneberge", Hermann Clamor von Mandelschlo, in der Osterwoche 1617 "wegen der umb Schoeneberg liegenden Huede, Holtzungen und Weide" ein eingehender Vergleich abgeschlossen, in zwei Exemplaren ausgefertigt und in das Amtbuch eingetragen. Von diesem wichtigen Actenstück liegt ein von dem Amtmann Peter Flügge beglaubigter Transsumpt auf Pergament mit angehängter Siegelkapsel vom 24. August 1665 vor; daneben findet sich eine vollständige Abschrift dieser letzten Acte auf Papier.
Ein neuer Vergleich - "ungeachtet in ihrem alten Vergleich de anno 1617 eilt anderes enthalten" - wird in Gegenwart des Herrn Pastoris Turlachen [nennt sich im Kirchenbuch Turlag] auf dem fürstlichen Amtshause zu Schönberg am 24. Januar 1687 abgeschlossen (mit Siegel erhalten).
Bei späteren Streitigkeiten sucht Pastor primarius Wischer zu vermitteln, von dem ein undatirtes (etwa 1715) Schriftstück vorliegt. Der Rechtsstreit scheint in letzter Instanz von der Regierungskanzlei zu Ratzeburg am 17. November 1767 entschieden zu sein. Ihr Urtheil liegt in einer von Ernst Rud. Ludw. Ditmar beglaubigten Abschrift auf Pergament vom 19. April 1770 vor; es ist ausgefertigt von dem Oberhauptmann und Kammerräthen v. Knesebeck, Siemssen und Reinhardt und soll als "ein beständiges Regulativ bis zu ewigen Zeiten" gelten.
Aus dem früheren Verlauf des Streites erscheinen mir drei Momente erwähnenswerth.
Unter dem 3. Juni 1728 leisten die zwei alten Bauleute David Mette und Asmus Maaß nach ihrer Erinnerung einen körperlichen Eid (wird vollständig mitgetheilt), und werden demnach die Bürger mit ihren Ansprüchen abgewiesen. Daher ergeht auch an die Bauleute am 12. August 1737 der gerichtliche Befehl, die auf der Koppel befindlichen Bürgerpferde sofort zu pfänden.
Von Seiten der Bürger wird gegen das Urtheil Folgendes eingewandt. Der Eid der alten Bauleute sei ein "juramentum credulitatis und wieder (sic) den klaren Inhalt des Documenti publici, folglich von keiner solchen Würdigkeit dieses umzustoßen,


|
Seite 47 |




|
inmaßen dergleichen Instrumenta noch größeren Glauben und Festigkeit als die besten Zeugen darstellen."
Die Namen der seit 1729 bestehenden acht Hauswirthe finden sich wiederholt, nicht selten eigenhändig, verzeichnet; aber nur in einem einzigen Dokument, einer für einen Rechtsanwalt 1738 ausgestellten Vollmacht sind die Hausmarken neben die Namen gestellt worden. Die beigefügten Hausmarken wären für den Erbgang oder Ankauf entscheidend gewesen, wie ich z. B. noch am gestrigen Palmsonntag an einem alten Plochsick der W. Maackschen Stelle die Leiter von Aßmus Boye gesehen habe, welcher der Schmied Diebmal sechs wagerechte Streifen gegeben hat. Aber auch so ist es möglich, für fünf Hufen mit Sicherheit bis in die unmittelbare Gegenwart oder bis 1850 den ununterbrochenen Erbgang in männlicher oder weiblicher Folge darzuthun, für zwei andere läßt sich dasselbe voraussetzen und vielleicht in naher Zeit aus den Acten der Großherzoglichen Landvogtei und dem Schönberger Kirchenbuch erweisen. Die letzte Hufe ist durch Kauf an den jetzigen Besitzer gekommen; auch die städtische Hufe hat nach Joachim Burmeister noch zweimal den Besitzer (Westphal, Oldenburg) gewechselt. Ich gebe nun noch auf Grund der Acten ein sechsfaches Verzeichniß der Hauswirthe, drei aus dem vorigen Jahrhundert (Kaufcontract 1729, Proceßvollmacht 1738, Todtenrolle 1765); drei aus dem laufenden Jahrhundert (Gerichtsprotocoll 1815, Pachtcontract 1836, die 1895 im Besitz befindlichen Hauswirthe.) Die einstweiligen Lücken in der Geschlechtsfolge wolle die Phantasie der Leser für die fünf ersten Hufen ausfüllen; der unmittelbare Vorgänger von Heinrich Spehr wird ein Paustian gewesen sein; 1765 wurde Spehr's Stiefsohn Behrend Joachim Paustian bestattet, während dessen Minderjährigkeit H. Spehr, vermuthlich nur zeitweiliger Verwalter der Stelle, als zweiter Mann ein sogenannter Jahrenbewohner war.
Die Wohnhäuser der Bauleute sind mit Ausnahme der am Markt belegenen Böckmannschen und Holldorffschen und des in der Siemsserstraße befindlichen Boyeschen Gehöftes, sämmtlich bei Menschengedenken aus dem Innern der Stadt verlegt worden, ihre Stätten aber noch allen älteren Leuten bekannt. Der Hauswirth Oldörp wohnt am Wege nach Petersberg; sein Vorgänger hieß, solange er in der Stadt wohnte, Grevsmähl in de Huern; er wohnte nämlich in einer an einen Bach verlaufenden Sackgasse, der jetzigen Wasserstraße; ein Theil seiner dortigen Ländereien wurde zum Garten der zweiten Pfarre mit verwendet.


|
Seite 48 |




|
Besitzer der Schönberger Hufen:
| I. | II. | |
| 1729 | Johann Jochim Böckmann. | Hans Burmeister. |
| 1738 | Johann Jochim Böckmann. | Hans Burmeister. |
| 1765 | Johann Jochim Böckmann. | Jacob Burmeister. |
| 1815 | vacat Böckmann. | Johann Burmeister. |
| 1836 | J. Peter Böckmann. | Johann Burmeister. |
| 1895 | Wilhelm Böckmann. | Johann Burmeister. |
| III. | IV. | |
| 1729 | Asmus Boye. | Johann Jochim Freytag. |
| 1738 | Asmus Boye. | Johann Jochim Friedag. |
| 1765 | Peter Boye. | Johann Hinrich Freytag. |
| 1815 | Matthias Heinrich Freytag. | Johann Freytag. |
| 1836 | Matthias Heinrich Freytag. | Heinrich Boye. |
| 1895 | Wilhelm Maack. | Joachim Boye. |
| V. | VI. | |
| 1729 | Hans Mette. | Hans Wiese. |
| 1738 | Hans Mette. | Jochim Pasche. |
| 1765 | Hans Jochim Mette. | Joachim Burmeister. |
| 1815 | Heinrich Spehr | vacat Spehr. |
| 1836 | Joachim Burmeister. | vacat Spehr. |
| 1895 | städtischer Magistrat. | Wilhelm Holldorff. |
| VII. | VIII. | |
| 1729 | Jochim Ollrogge. | Hans Grevesmühl. |
| 1738 | Heinrich Wiechmann. | Tietz Platt. |
| 1765 | Caspar Fick. | Peter Grevismühl. |
| 1815 | vacat Fick. | vacat Grevismühl. |
| 1836 | vacat Fick. | Peter Grevismühl. |
| 1895 | Matthias Fick. | Joachim Oldörp. |
Schönberg. Friedrich Latendorf.
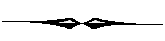
Schwerin, im April 1895.
Der zweite Secretär:
F. v. Meyenn
.
