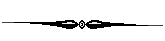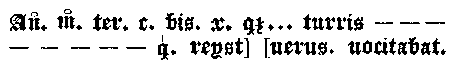|
[ Seite 187 ] |




|



|
|
:
|
IX.
ältern
Geschichte der Stadt Sternberg,
G. C. F. Lisch.
W enn die Stadt Sternberg sich auch nicht zu der Bedeutsamkeit der größern Städte Meklenburgs ausgebildet hat, so sind doch die Schicksale dieses Ortes merkwürdig genug, um demselben für alle Zeiten eine gewisse Wichtigkeit für die Geschichte des Landes beizulegen. Ist daher auch eine zusammenhangende Geschichte dieser Stadt weder möglich, noch notwendig, so ist doch eine Bekanntschaft mit den Hauptbegebenheiten ihres Daseins von so großer Bedeutung, daß die Betrachtung derselben keine Entschuldigung in Anspruch zu nehmen braucht. Die Erhellung der Geschichte der Stadt wird aber um so notwendiger erscheinen, als bei dem Brande derselben kurz vor dem J. 1309 alle ihre alten und während des dreißigjährigen Krieges ihre neuern Urkunden spurlos vernichtet sind 1 ) und die Zeit einer lebhaftern geschichtlichen Forschung benutzt werden muß, um diesen Mangel durch glückliche Zufälle einigermaßen zu ersetzen.


|
Seite 188 |




|
1. Gründung der Stadt Sternberg
Das Jahr der Gründung der Stadt Sternberg ist nicht bekannt, da die Stiftungsurkunde nicht mehr vorhanden ist. Es läßt sich aber die ungefähre Zeit der Gründung durch mehrere Umstände ziemlich genau und mit Sicherheit bestimmen.
Im J. 1222 stand Sternberg noch nicht. In diesem Jahre schenkte nämlich der Fürst Borwin dem Kloster Tempzin bei dessen Stiftung eine Salzpfanne an einem Orte, wo Salz gesotten ward (sartaginem in loco quo sal decoquitur), d. i. zu Sülten zwischen Brüel und Sternberg, und 16 Hufen im Lande Warnow zu Goldbek (in terra Warnowe sedecim mansos in loco qui dicitur Goldbeke), welches unmittelbar südlich bei Sternberg lag 1 ) und von den Bürgern der Stadt lange Zeit in Pacht genommen war. Ohne Zweifel würde die Lage dieser Ortschaften durch die Stadt Sternberg bezeichnet worden sein, wenn sie schon gestanden hätte.
Dagegen läßt sich aber mit Bestimmtheit nachweisen, daß die Stadt von dem Fürsten Pribislav I. von Parchim=Richenberg gegründet worden sei, indem sie nach der Bestätigung ihrer Privilegien vom 24. Febr. 1309 parchimsches Recht hatte 2 ). Nach einer von den Fürsten Johann und Hermann von Meklenburg, Brüdern des Fürsten Heinrich des Pilgers, ausgestellten Urkunde, welche in das Jahr 1266 zu setzen ist, hatte der Vater dieser Fürsten, Johann I. († 1264), die Stadt schon besessen (oppidum Sternenberge, sicut possedit pater noster) 3 ) und ohne Zweifel von seinem Bruder Pribislav I. angenommen. Die Verbesserung der Pfarre zu Wahmkow datirte Pribislav I. im J. 1256 zu Sternberg 4 ), in Zeugengegenwart des Priesters und Vicars Bruno von Sternberg. Dies ist die älteste Urkunde, in welcher die Stadt genannt wird; denn eine andere, von Sternberg im J. 1234 datirte, nur in einer Abschrift von einem beglaubigten Exemplare vorhandene Urkunde, durch welche Pribislav I. die Pfarre zu Rahden verbesserte, giebt
"civibus in Sternberge dedimus judicium - - Parchimmes-Recht, - - quemadmodum illud judicium a nostris progenitoribus liberius habuerunt".


|
Seite 189 |




|
ohne Zweifel ein falsches Datum an, da sie mit der wahmkowschen Urkunde vom J. 1256 in allen Formeln gleichlautend ist 1 ).
Im J. 1256 war also Sternberg noch im Besitze des Fürsten Pribislav I. Da dieser Fürst nun im J. 1238 die Regierung antrat 2 ), so wird er die Stadt innerhalb des Zeitraumes von 1238-1256 gegründet haben. Wahrscheinlich ist die Stadt Sternberg in der Zeit von 1240-1250 gegründet, vielleicht um 1248, in welcher Zeit Pribislav I. auch Goldberg und Richenberg gründete 3 ), deren deutsche Namen auf dieselbe Zeit hinzudeuten scheinen.
Von der frühern Bedeutung der Gegend der Stadt
haben wir keine Nachricht, da der alte Name
nicht bekannt ist. Es ist die Meinung
verbreitet, daß Sternberg an der Stelle der
wendischen Fürstenburg Kutin liege. Man hat dies
daraus geschlossen, daß die Stadt eine
Küter=Straße, ein Küter=Thor und an dem Bache
vor dem Thore einen Küter=Brink hat; dieses Wort
Küter hat man im vorigen Jahrhundert, in der
Zeit der Etymologien nach dem ungefähren
Wortlaute durch Kütiner erklärt, und die
Küterstraße die Kütinerstraße genannt, wie es
mitunter wohl noch heute zu geschehen pflegt,
und flugs aus dieser Etymologie eine Burg Kutin
construirt. Das Wort Küter bedeutet aber nichts
weiter, als Schlachter, und Küterstraße heißt
nichts anders als Schlachterstraße; in den Acten
wird die Straße auch nie anders als Küterstraße
genannt
 . Solche Küterthore und
Küterhäuser giebt es in sehr vielen Städten
4
), da die Schlachter in der
volkreichen Zeit des Mittelalters ihre
Schlachthäuser vor die Thore verlegten, und
diese Küterthore nach den Küterhäusern wegen des
besondern Verkehrs der Schlachter und der
Zahlung der Steuern angelegt wurden. Die
wendische Fürstenburg Kutin oder Kutsin aber lag
am plauer See bei dem jetzigen Dorfe Quetzin
5
); von den beiden andern
Fürstenburgen ähnliches Namens lag Kussin an der
Stelle von Neukloster und Kissin bei Rostock.
. Solche Küterthore und
Küterhäuser giebt es in sehr vielen Städten
4
), da die Schlachter in der
volkreichen Zeit des Mittelalters ihre
Schlachthäuser vor die Thore verlegten, und
diese Küterthore nach den Küterhäusern wegen des
besondern Verkehrs der Schlachter und der
Zahlung der Steuern angelegt wurden. Die
wendische Fürstenburg Kutin oder Kutsin aber lag
am plauer See bei dem jetzigen Dorfe Quetzin
5
); von den beiden andern
Fürstenburgen ähnliches Namens lag Kussin an der
Stelle von Neukloster und Kissin bei Rostock.
Es haben aber die nächsten Umgebungen von Sternberg wegen der Wichtigkeit und Schönheit der Lage in alten Zeiten allerdings eine gewisse Bedeutsamkeit gehabt. Im Norden der
"Im 1446 jahre do leeth herr Euerdt van Huddessen buwen dat Küterdore binnen der mure".
"Dessuluigen jahres do leeth herr Berndt van Zutpheldt de Küterzingel decken mit scheuersteen."


|
Seite 190 |




|
Stadt, am Ausflusse der Mildenitz aus dem Rahdenschen See zur nahen Warnow, liegt ein Meierhof, die Burg, jetzt die Sternberger Burg genannt; in den frühern Zeiten der letzten drei Jahrhunderte heißt sie in den Acten immer die Mildenitzer Burg. Solche "Burgen", wie z. B. um Güstrow herum deren 6 liegen, haben freilich keine große Bedeutung, da sie wohl aus den Wartthürmen entstanden sind, welche an den Grenzen der Stadtfeldmarken an den Landstraßen oder an den Durchgängen durch die Landwehren der Städte lagen. Aber bei dieser Sternberger Burg liegt ein alter "Burgwall", welcher drei Jahrhunderte hindurch in den Acten häufig so genannt wird. Nach den Mittheilungen des Herrn Hülfspredigers Hübener zu Sternberg liegt dieser Burgwall nördlich von der sternberger Burg 1 ) am Einflusse der Mildenitz in die Warnow und legt sich an die beiden Flüsse; er erhebt sich aus den Wiesenufern der Flüsse 20 bis 30 Fuß hoch und hat eine Länge von ungefähr 400 Schritten. - Gegenüber am östlichen Ende des rahdenschen Sees liegt ein anderer, nicht unbedeutender Burgwall, welcher mit drei Seiten in den See hineinreicht, vom festen Lande aber durch eine sumpfige Wiese getrennt ist 2 ). - Der Herr Prediger Hübener weiset aber noch eine zweite Burgstelle bei Sternberg nach. Im Süden des großen rahdenschen Sees, südöstlich von Sternberg, auf dem halben Wege zwischen der Stadt und Pastin, liegt an dem Wiesenufer des Sees der Heidberg, eine regelmäßige, länglichte Erhebung, von 40-50 Fuß Höhe, 60 Schritten Breite und über 200 Schritten Länge, welche von den nahen Hügelketten durch ein etwa 40 Fuß tiefes Thal getrennt ist; diese Erhebung beherrscht die Gegend weithin und gewährt eine reizende Aussicht. - In der Gegend umher stehen noch mehrere Kegelgräber, welche aber meistentheils unter den Pflug gebracht sind. Auch der Judenberg hat in den ältesten Zeiten eine gewisse Bedeutung gehabt. Auf dem Judenberge waren noch zu des bekannten Geschichtschreibers Franck Zeiten, nach einem handschriftlichen Berichte desselben, große "Götzenaltäre", d. h. Hünengräber, wie die bekannten Gräber von Görnow; in den neuesten Zeiten sind am Judenberge interessante steinerne und bronzene Alterthümer gefunden 3 ).
Im J. 1623 hatte der Rath eine Scheure auf der mildenitzer Burg bauen lassen."Acker auf dem Borchwal, welchen der Borchman bei der Mildenitz gebraucht".


|
Seite 191 |




|
Wenn hiernach die Gegend von Sternberg in den heidnischen Zeiten auch von Bedeutung gewesen ist, so läßt sich doch aus den angeführten Umständen kein Schluß auf eine bestimmte, bekannte Burg des wendischen Alterthums ziehen. Nach dem Stadtprivilegium vom J. 1309 wird der damals an die Stadt zum Stadtfelde verkaufte fürstliche Hof Dämelow zu der Burg gehört haben.
In der Theilung hatte der Fürst Pribislav I. von Parchim=Richenberg auch das Land Sternberg erhalten, welches mit den Ländern Parchim, Brenz, Ture und Kutin (oder Parchim, Goldberg, Lübz und Plau) zu dem größern Landestheile Warnow gehörte 1 ). Gegen das Ende seines Wirkens in Meklenburg hielt sich der Fürst mitunter auch zu Sternberg auf und ward auf einer Ausflucht von hier im J. 1256 von dem übermüthigen und kriegerischen Bischofe Rudolph I. von Schwerin gefangen, mit welchem er seit dem J. 1252 in Fehde und in gespannten Verhältnissen lebte, deren Folge war, daß Pribislav das Land verließ, in dessen Besitz er auch nicht wieder kam. Seine Brüder ergriffen sofort die Herrschaft seiner Länder, welche sie auch bald unter sich theilten; das Land Sternberg kam an Meklenburg und blieb bei diesem auch alle Zeiten hindurch 2 ).
Durch diese Abtretung an die mächtigere Herrschaft Meklenburg wird die Stadt Sternberg bedeutend gewonnen haben. In der Gegend gelegen, in welcher die Grenzen der verschiedenen Länder nahe zusammenrückten, ward die Stadt Sternberg und deren nahe Umgegend oft zu Fürstencongressen und andern Zusammenkünften 3 ) gewählt, und hieraus entwickelte sich bis auf den heutigen Tag die Sitte, Landtage auch zu Sternberg zu halten, eine Gewohnheit, welche die Hauptstütze der Stadt geworden ist.
Um die Mitte des 13. Jahrh. wird schon die jetzt noch stehende Kirche 4 ) gebauet sein; der Thurm ward im J. 1320 angebauet. Obgleich die Kirche bei den großen Bränden der Stadt im J. 1659 und 1741 wiederholt ganz ausgebrannt und durch das verheerende Element stark mitgenommen ist, so gehört sie doch in Ansehung des Baustyls zu den schönern Kirchen des Landes. Die Kirche ist ein altes, gefälliges Gebäude in einem


|
Seite 192 |




|
sehr würdigen Style aus der allerersten Zeit des
Spitzbogenstyls. Aus trefflichen Ziegeln
erbauet, bildet sie ein länglichtes Viereck mit
grader Altarwand, ohne Chornische; sie hat ein
Mittelschiff und zwei gleich lange, nicht viel
niedrigere Seitenschiffe. Die runden Gewölbe des
Mittelschiffes sind nach den Bränden neu gebauet
1
); die kräftigen
Gewölbe der Seitenschiffe sind jedoch noch alt.
Die Gewölbe ruhen auf zweimal 4 Pfeilern und 2
Pilastern; die Pfeiler sind achteckig, aus dem
Viereck gebildet, haben Basen und Kapitäler und
an den vier schmalen Seiten schlanke Halbsäulen.
Die leise gespitzten Fenster sind durch
steinerne Säulen dreifach geteilt. Das Fenster
hinter dem Altare ist vierfach getheilt und
gedrückter und minder schön als die übrigen; es
ist neuern Ursprunges, da bei den beiden großen
Bränden der Altargiebel einstürzte. Die beiden
andern Fenster in der Ostwand und die beiden
unten abgekürzten Fenster über den beiden
Hauptpforten in der Südwand haben über ihren
Wölbungen drei kleine runde Fenster oder Rosen,
welche jetzt etwas unregelmäßig sind. Die beiden
hübschen Hanptpforten sind schräge eingehend und
mit Rippen oder Säulen mit kleinen Kapitälern
geschmückt. An dm Seiten der westlichen Pforte
sind Mauernischen mit spitzen Giebeln und
schwarz glasurten Verzierungen aufgeführt; unter
der Nische links ist ein Granitblock mit zwei
Fußspuren eingemauert. An der westlichen Ecke
des südlichen Seitenschiffes ist, über die
Seitenwand der Kirche hinausgerückt, die Heilige
Bluts=Kapelle vorgebauet, welche eine Vorhalle
in der Verlängerung des Seitenschiffes neben dem
Thurme hat. Die Kapelle ist in einem
schwerfälligen Style mit weiten Fenstern
aufgeführt. An alten Geräthen besitzt die Kirche
gar nichts. Am Altare liegt die ehemalige
Altarplatte, mit den fünf bischöflichen
Weihkreuzen bezeichnet, jetzt zum Leichensteine
benutzt, mit der Inschrift
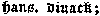 ein Divack war 1572 Burgemeister
zu Sternberg.
ein Divack war 1572 Burgemeister
zu Sternberg.


|
Seite 193 |




|
2. Fürstliche Residenz in der Stadt Sternberg.
Den größten Glanz gewann die Stadt Sternberg in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, namentlich durch die Gunst des gefeierten Fürsten Heinrich des Löwen. Die Residenz der Fürsten von Meklenburg war seit der Mitte des 13. Jahrh. die Stadt Wismar, bei weitem die größte und blühendste Stadt des damals noch kleinen Fürstenthums. Aber schon seit der Wallfahrt Heinrichs des Pilgers hatte die zu einem Gliede der Hanse heranreifende Stadt sich den Fürsten abgeneigt und widerspenstig gezeigt, so daß selbst der greise Pilger ihr den Rücken wenden und auf einem Landhofe bei der ehemaligen Residenz Meklenburg am Abend seines Lebens die ersehnte Ruhe suchen mußte. Sein Sohn, der Löwe, vielfach von Wismar beschränkt, trauete der Stadt nicht, und er hatte Ursache zu seinem Mißtrauen; auch er wandte sich nach und nach von ihr. In den ersten Jahren nach seiner Vermählung weilte er oft und gerne in der Heimath seiner Gemahlin Beatrix, im Lande Stargard, dessen Bewohner sich späterhin auch seinen Söhnen anhänglich und treu zeigten. Bald aber, als die Verhältnisse ernster und verwickelter wurden, zog er sich mehr in die Nähe der verschiedenen Landesgrenzen und der größern Städte und Fürstenwohnungen. Sternberg hatte von allen Städten seines Landes bei weitem die schönste und bequemste Lage und bot für ein Schloß auch Festigkeit genug gegen die damaligen Kriegskünste; die Landesversammlungen an der sagsdorfer Brücke waren schon damals gewöhnlich. Auch war Sternberg im Anfange der Regierung Heinrichs des Löwen, sicher vor dem Februar 1309, wenn sich auch der Zeitpunct nicht genau bestimmen läßt, abgebrannt und ohne Zweifel, vielleicht durch seine Unterstützung, schöner und regelmäßiger wieder aufgebauet. Daher wandte er sich allmählig nach dieser Stadt. Schon seit dem J. 1307 ist Heinrich häufig in Sternberg zu finden.
Bald aber brach Heinrich der Löwe mit Wismar ganz. Als er im J. 1310 die Vermählung seiner Tochter Mechthild mit dem Herzoge Otto von Lüneburg auf seinem Hofe in der Stadt Wismar feiern wollte und den Rath der Stadt um Beistimmung zu dieser Hochzeit ansprach, verweigerte die Stadt dem Fürsten die Erfüllung dieses Wunsches. In E. v. Kirchberg 1 ) lesen wir:


|
Seite 194 |




|
Da antwurten die burgere zu:
Herre, ir sollit wiszin nu,
es mochte komen vns uf arg,
daz ir quemet alzustarg;
es enkomet dyser stad nicht eben,
daz ir uwir tochtir hy wollit vergeben:
zu dem houe vil lude komen,
des moge wir nemen keynen fromen.
Die rostocker Chronik 1 ) berichtet:
It geschach in deme iare vnses heren 1310, dat Hinrick here van Mekelenborch, den men den louwen edder mit der platen plach to nomende, sine dochter Mechilde betruwede hartich Otten van Lunenborch vnnd begerde van dem rade siner stadt Wismer den hoff der hochtidt des byslapendes dersuluen siner dochter in der stadt Wismer tho holdende, des ehm de stadt weigerde vmme vare willen intholatende des velen volckes, dat nha wanlickheit den hoff wart sokende.
Zwar trug der Fürst diesen Schimpf einstweilen mit Ruhe und Würde; aber er faßte den Vorsatz, die Stadt zu züchtigen und zu bändigen. Diese Weigerung Wismars ward bald die Quelle einer langen Reihe höchst merkwürdiger Begebenheiten, welche die wendischen Hansestädte auf längere Zeit stark erschütterten; es giebt in unserer Geschichte kaum größere Begebenheiten.
Heinrich der Löwe aber wandte sich nach Sternberg und beging hier, wahrscheinlich im März 1310, die Vermählung seiner Tochter mit großer Pracht und herrlichen Festen. E. v. Kirchberg sagt, indem er
berichtet:
Syn hochczid wart zu Sterrenberg.
Da quamen zu dem hove gar
von manchin landen lude dar,
fursten, greuen, frowen schon,
rittere, knechte, edele baron,
dy her tugintlich intphing;
furstenlich der hof irging.
Syn tochtir da zu wybe wart
herczogin Otten uf der vart.


|
Seite 195 |




|
Die rostocker Chronik berichtet:
Welck weiernt Hinrick van Mekelenborch swarliken tho sick nam, alleine dat he den inwendigen vnwillen mit manlicheit vnnd grodtmodicheit vtwendichliken thor tidt bedeckede vnnd lade denn hoff der vorbenhomeden hochtidt tho dem Sterneberge, dar he grotlicken geholden warth van forsten vnd van heren vnd van wollgebaren heren vnd luden, de Hinrick van Meckelenborch in dem ende des haues tho samende nam vnd klagede ehn den vnwillen, den ehme de wismarschen hadden bewiset vnd bat bistendigheit van ehn, in einer tidt sin leidt vp den wiszmarschen tho wrekende.
Mit diesem Feste (hôchzît) verlegte der Fürst Heinrich seine Residenz nach Sternberg. Er hatte hier ohne Zweifel schon eine Wohnung, da die Fürsten in den meisten Städten Schlösser besaßen; aber eben so unzweifelhaft wird es sein, daß er das Schloß zu Sternberg seit dieser Zeit mehr ausbauete, vergrößerte und befestigte. Das Fürstenschloß stand der Südseite, der Kirche gegenüber, auf der Anhöhe an der Stadtmauer, zwischen der Mühlenstraße mit dem Mühlenthor, der Ritterstraße und der Stadtmauer. Der Herzog Magnus schenkte im J. 1500 dem neu gestifteten Augustinerkloster zur Errichtung des Klostergebäudes "vnsere verfallene wonunge vnd "hoffestadt" 1 ), wo die Juden die "gemarterte Hostie" vergraben hatten; es kann also über die Lage des Schlosses kein Zweifel herrschen. Man findet auch an der Stadtmauer und auf dem bezeichneten Raume, welcher lange Zeit als Gartenland frei gelegen hat, hin und wieder Reste alter Bauwerke. Daß Sternberg wirkliche Residenz Heinrichs des Löwen ward, geht aus folgender Begebenheit klar hervor. Am 20. Februar 1313 verkaufte der Markgraf Waldemar von Brandenburg dem Könige Erich von Dänemark seine Hälfte der festen Burg zu Warnemünde für 5000 Mark brandenburgischer Münze und es ward bei dem Verkaufe bestimmt, daß der König von dieser Summe 2000 Mark zwischen Martini= und Neujahrstag zu Sternberg zahlen solle; wenn dieses nicht geschehe, so solle der König und sein Bruder Christoph zu Seeborch oder Wordingborch und der Fürst Heinrich von Meklenburg zu Sternberg oder Branden=


|
Seite 196 |




|
burg Einlager halten 1 ); es wird hindurch gewiß, daß die Städte Sternberg und Neu=Brandenburg die Lieblingsstädte des Fürsten in den beiden Landestheilen Meklenburg und Stargard waren. Vom J. 1310 an datirt der Fürst seine meisten Urkunden aus der Stadt Sternberg.
Schon am 24. Febr. 1309, also schon vor dem völligen Bruche mit der Stadt Wismar, setzte der Fürst die Stadt Sternberg in den Stand, daß in derselben ein großer Hof gehalten werden konnte. Er bestätigte der Stadt nämlich ihre in dem Brande verloren gegangenen Privilegien 2 ), namentlich das parchimsche Recht und den dritten Theil der Gerichtsbußen, auch die Fischerei mit kleinen Netzen auf den Seen Rahden und Wustrow; dazu verkaufte er der Stadt den fürstlichen Hof Dömelow zum Stadtfelde, nach parchimschem Rechte, mit dem ganzen Flusse Mildenitz, von dem rahdenschen See bis zur Mündung in die Warnow, und ebenfalls zum Stadtfelde nach parchimschen Rechte das Dorf Lukow, mit der Aalwehre am See Lukow, jedoch ohne die lukowschen Seen, welche dem Fürsten verbleiben sollten; wo die Warnow das Stadtfeld berühren würde, sollte die Hälfte des Stromes der Stadt gehören. Beide Feldmarken, das lukower Feld vor dem lukower Thore und die Dämelow sind noch heute bekannt. Zu dem alten fürstlichen Hofe Dömelow gehörte wahrscheinlich die mildenitzer Burg. Durch diesen Ankauf ward der Wohlstand der Stadt wesentlich begründet.
In jenen Zeiten bildete sich auch das Gemeindewesen in allen Gliederungen sehr bestimmt aus.
Zuerst schlossen die Hauptgewerke Zünfte. Schon am 25. Jan. 1306 errichteten die Schuster und Bäcker zu Sternberg die Statuten 3 ) ihrer Brüderschaft zum Heil. Geist; diese Statuten sind ein seltenes und merkwürdiges Stück zur Geschichte der alten Zunftstiftungen. Die Statuten enthalten wesentlich nur Bestimmungen über Krankenbesuch, Begräbniß und Seelenmessen und einen Strafcodex für Ausschweifungen in den Versammlungen der Brüderschaft. Am 12. Dec. 1365 errichtete auch die Zunft der Schmiede ganz gleichlautende Statuten für ihre gleichfalls dem Heil. Geist gewidmete Brüderschaft 4 ). Noch im 16. Jahrhundert treten die Vier=Gewerke (Schuster, Schneider, Bäcker, Schmiede) amtlich als eine städtische Corporation in Sternberg auf.


|
Seite 197 |




|
Wichtiger aber, als das Zunftwesen, ist das
Wirken gewisser Patricierfamilien in Sternberg,
welche hier im 14. Jahrh. klarer hervortreten,
als in irgend einer andern kleinern Stadt
Meklenburgs. Sie führten meistentheils Namen von
nahe gelegenen Dörfern und waren sicher
Nachkommen von freien Landbesitzern, jedoch
nicht ritterbürtig. Als solche erscheinen im 14.
Jahrh. in Sternberg vorzüglich die von Rüest,
von Wahmkow, Speth, von Parum, von Markow, von
Dämelow, von Pritz, Trendekop. Sie hatten
gewöhnlich Landgüter in Besitz, waren Mitglieder
des Raths der Stadt Sternberg und bezeigten sich
durch milde Stiftungen vielfach wohlthätig.
Dabei werden sie immer nur Bürger von Sternberg
genannt und erhalten nur bürgerliche Ehrentitel,
wie "viri discreti, beschêdene lüde"
 .
.
Von diesen Patriciern spielt Bernhard Rüest eine bemerkenswerthe Rolle. Er wird in den Urkunden Bernhardus Ruyst, auch Růyst oder Růst genannt; diesen Namen führte die Familie ohne Zweifel von dem Dorfe Rüest, an Wahmkow grenzend, zwischen Sternberg und Goldberg, da dieses Dorf zu derselben Zeit ebenfalls Ruyst geschrieben wird 1 ). Am 23. März 1346 kauften dieser Bernhard Rüest und Nicolaus Speth, "Bürger in Sternberg", das Dorf Blankenberg mit dem Hofe, welches den v. Wedel auf Werder gehört hatte 2 ); dieses Gut ging am 30. August 1387 durch Kauf an die Präceptorei Tempzin über, so wie "Clawes Spet vnde Bernd Růst vnde Hinrik van Bulowe, wanaftich to Krytzowe", es besessen hatten. Am 29. Sept. 1366 verlieh der Herzog Johann ihm und dem Thideke von Parum zwei Hufen im Dorfe Zülow, mit der Freiheit, dieselben zu geistlichen Stiftungen zu verwenden 3 ), und am 4. Novbr. 1373 denselben Bürgern 6 1/2 Mark und 2 1/2 Schillinge lübischer Pfenninge aus den Dörfern Pastin und Zülow, mit derselben Freiheit 4 ). In der Zeit 1361-1365 war Bernhard Rüest Rathmann zu Sternberg.
Nicolaus Speth erscheint nur in diesen Verhältnissen zu dem Gute Blankenberg, welches er am 23. März 1346 mit Bernhard Rüst gekauft hatte. Am 28. Junii 1380 überließ (antwarde) "Clawes Spet wonaftech tho deme Blankenberghe" seine Besitzungen in dem Dorfe seinem Oheim ("myneme lêuen ôme) Heinrich von Bülow auf Kritzow für


|
Seite 198 |




|
den Fall, daß seine Tochter, Curd von Bützow's Ehefrau, ohne Leibeserben sterben würde. Claus Spet war am 6. Dec. 1387 gestorben.
Die Familie von Parum muß mit diesen Familien nahe verwandt gewesen sein. Am 29. Sept. 1366 erwarb Thideke von Parum, "Bürger zu Sternberg", zugleich mit Bernhard Rüest zwei Hufen in Zülow 1 ) und am 4. Nov. 1373 mehrere Pächte aus Pastin und Zülow 1 ). Seine Wittwe Margarethe schenkte im J. 1383 der Kirche zu Sternberg einen Acker (vgl. Franck A. u. N. M. VII, S. 18). Am 6. Dec. 1387 aber entsagte "Clawes Parym" allen ihm "angestorbenen" Rechten an dem Gute Blankenberg, nach Claus Spet's Tode, zu Gunsten des Klosters Tempzin.
Bekannter ist die Familie Wahmkow, welche reich begütert war. Schon im J. 1311 stiftete Hermann Wahmkow eine Messe in der Kirche zu Sternberg mit 15 Mark Hebungen aus dem Dorfe Stiten (vgl. Franck A. u. N. M. V, S. 227). Damals waren vier Vicareien in der Kirche zu Sternberg. Im J. 1312 kaufte derselbe das halbe Dorf Rosenow, welches späterhin an den Heil. Geist überging (vgl. Franck a. a. O. S. 226). Darauf verlieh der Fürst Heinrich von Meklenburg dem Pfarrer Conrad Wahmkow auf Pöl und seinem Bruder Hermann, "Bürger zu Sternberg", 3 Hufen und 1 Hofstelle zu Garwensdorf, wie sie der Ritter Dedwig von Oertzen an dieselben verkauft hatte 2 ). Die Wahmkow schenkten diesen Besitz dem Kloster Neukloster nach dem Tode der Gertrud Wahmkow, Tochter des Dietrich Wahmkow, welche Nonne (ancilla Christi in Campo Solis) in diesem Kloster war [H2]. Am 4. März 1317 stifteten Barthold Wahmkow und seine Brüder ("famosi viri, nobis dilecti, cives Sternebergenses") mit 20 Mark jährlicher Hebungen aus dem Dorfe Torgelow (jetzt Forsthof Turlow bei Sternberg) eine Vicarei in der Kirche zu Sternberg 3 ). Hermann Wahmkow war 1306, Barthold Wahmkow 1361 und Nicolaus und Conrad Wahmkow waren 1365 Rathmänner zu Sternberg. Im J. 1357 überließ Nicolaus Wahmkow dem Heil. Geist zu Sternberg 2 1/2 Hufen im Dorfe Pastin, mit denen eine Vicarei gestiftet ward 4 ), und im J. 1359 wiederum 14 Hufen in demselben Dorfe.
Ueber den Güterbesitz der Familie von Markow haben wir nur die Registratur einer verloren gegangenen Urkunde d. d.


|
Seite 199 |




|
Sternberg 1300: "Heinrich Herr zu Mecklenburg hatt verkaufft "das Dorf Schonevelt c. p. sampt der gerichtsgewalt 60 ßl. vnd darunter Johanni vnd Johanni Merchowen Bürgern zum Sternberg für 720 Mk." Johann Merchow war 1306 und 1311 Rathmann zu Sternberg.
Die Familie Bonsack, welche noch zu Sternberg blüht, ist ursprünglich eine rittermäßige Familie. Im J. 1361 gab Henneke Bonsack auf Gr. Rahden zu zwei Altären in der Kirche zu Sternberg die Bede von 6 Hufen in dem Dorfe Kl. Rahden. Henneke Bonsack war in demselben Jahre 1361 herzoglicher Vogt zu Sternberg 1 ).
Johann Gerdes, "borgher to deme Sterneberghe", und seine Frau Adelheid pfändeten im J. 1383 von dem Knappen Martin Zickhusen auf Poverstorf dessen Besitzungen "to Lutteken Pouerstorp dat ok ys ghenomet Gulekendorpe".
Bekannt ist die Familie Trendekop. Am 5. Mai 1307 verkaufte der Fürst Heinrich von Meklenburg dem sternberger Bürger Heinrich Trendekop den fürstlichen Antheil im Dorfe Cobrow, aus welchem dieser die Vicarei am H. Geist=Hospitale mit 15 Mark Hebungen verbesserte. Vgl. Lisch Urk. Gesch. des Geschl. v. Oertzen I, B, S. 48. Franck A. u. N. M. V, S. 193 nennt die Familie irrtümlich "Wendekopp". Im J. 1311 war Heinrich Trendekop Rathmann zu Sternberg. Im J. 1328 kauften Barthold und Heinrich Trendekop 4 Hufen in Rosenow, welche später an die sternberger Vicarien übergingen.
Diese Beispiele mögen hinreichen zur Aufklärung des Ansehens eines vornehmen, güterbesitzenden Bürgerstandes in der Stadt Sternberg im 14. Jahrh.; wahrscheinlich war dieser eine Schöpfung des staatsklugen und kräftigen Fürsten Heinrichs des Löwen, welcher die wahre Kraft des Staates in der Entwickelung aller staatsbürgerlichen Elemente fand. Wenigstens blühte der Bürgerstand in Sternberg vorzüglich zu seiner Zeit.
Unter solchen Umständen ward denn auch viel Tüchtiges geschafft, nach dem Geiste der Zeit. So z. B. fällt in diese Periode der Bau des ganzen Kirchthurms, eines sehr kräftigen und schönen Bauwerkes. Links am Eingange von der Thurmpforte ist in mehrere Ziegelsteine eine Inschrift eingegraben, welche (nach Schröders Pap. Meckl., S. 1000) Latomus in Genealochron. also:
Anno M tr C bis Xque secundo
Turris in octaua Petri Paulique
Templa hec fiunt - - -


|
Seite 200 |




|
Franck im A. u. N. M. VI, S. 30, also:
Ao. M. ter C bis X. M. Juny Turris in octaua Petri et Pauli
Cepta hic strui a quodam
Reystuerus vocitabat.
las. Im J. 1842 konnte ich noch folgendes mit Sicherheit lesen:
So viel ist hiernach gewiß, daß im J. 1320 der
Thurm über der Erde aufgebauet ward. Das Wort
 aber scheint auf die Familie
Rüest oder Ruyst zu deuten und es ist sehr
wahrscheinlich, daß der oben genannte Bürger
Bernhard Rüest in seinen jüngern Jahren den
Thurm entweder als Baumeister oder durch
Herbeischaffung der Geldmittel aufgeführt habe.
- Der obere Theil des Thurmgebäudes ist nach dem
großen Brande von 1741 im J. 1750 neu
aufgeführt, da diese Jahreszahl oben an der
Thurmmauer steht.
aber scheint auf die Familie
Rüest oder Ruyst zu deuten und es ist sehr
wahrscheinlich, daß der oben genannte Bürger
Bernhard Rüest in seinen jüngern Jahren den
Thurm entweder als Baumeister oder durch
Herbeischaffung der Geldmittel aufgeführt habe.
- Der obere Theil des Thurmgebäudes ist nach dem
großen Brande von 1741 im J. 1750 neu
aufgeführt, da diese Jahreszahl oben an der
Thurmmauer steht.
Wie aber jedes Element des Staates in der ersten Hälfte des 14.Jahrh. zur Entwickelung kam, so zog der Fürst Heinrich der Löwe auch eine Menge rittermäßiger Leute in die Stadt Sternberg und band sie hier fester an seinen Hof. Daher entstand neben der Fürstenburg in Sternberg auch eine Ritterstraße (platea militum) und in Sternberg war seit alter Zeit ein Ritterkaland 1 ), welcher noch am Ende des 15. Jahrh. blühete 2 ). Der Ritterkaland zu Sternberg bestand schon im J. 1314; in diesem Jahre hatte Heinrich von Radem den "Calandes= Herren" 4 Hufen zu Kl. Radem (Rahden) verkauft. Im J. 1354 hatte Dietrich Potendorf den Calandsherren 2 Hufen in Zülow und 2 Hufen in Bokholt überlassen und im J. 1399 verkauften die Kalandsherren einem ihrer "Medebruder Heinrich Knakenhawer genannt" ihr Haus an der Ritterstraße 3 ). Es lassen sich namentlich gewisse Familien bezeichnen, welche Häuser in der Stadt eigenthümlich besaßen und vererbten. Schon zu den Zeiten Heinrichs des Löwen wohnten in Sternberg die von Cramon auf Mustin, Zülow und Borkow: 1325 werden "her Syuerd, her Curd vnd her Hermen, riddere, heten von Cremon, tôme Sterneberch, to Mostyn vnde to Tzulow wanaftich", genannt 4 ). Um das J. 1350 ver=
"honorabiles domini fratres kalendarum militum in oppido Sterneberg".


|
Seite 201 |




|
pfändete der Herzog Albrecht dem Claus von
Kardorf und dessen Kindern, welche Vasallen
("vnse leuen truwen"), aber auch
zugleich Bürger zu Sternberg ("borghere to
deme Sterneberghe") genannt werden, die
Vogtei über Stadt und Land Sternberg
1
). Auch die von Barner, auf
Zaschendorf, Sülten
 ., werden schon im 14. Jahrh. als
in Sternberg ansässig genannt, z. B. 1387 und
1397 "Clawes Berner to deme Sterneberge
wanafftich". Bekannt ist, daß die von
Pressentin bis auf die neuern Zeiten ein Haus in
Sternberg hatten: schon im J. 1397 wird
"Hennynk Pressentyn knape wanafftich tome
Sterneberghe" genannt. Im 15. Jahrh. werden
die von Gustävel in Sternberg erwähnt. Die Preen
von Witzin und Lübzin waren lange Zeit in
Sternberg wirksam; schon 1380 und 1383 war
Martin Preen Vicar zu Sternberg und im J. 1427,
neben Curt Scherer, "Merten Pren
borghermester der stad Sterneberch"; noch
im J. 1505 war "Barthold Pren en gadeshuses
man (Kirchenvorsteher) der "kerken thom
Sterneberg". Im J. 1505 war "Borchard
van der Lüe borgermeyster thom Sterneberghe vnd
erffzeten thom Vogelsange"; seine Brüder
wohnten auf Ilow und Panzow. Zu derselben Zeit
war ein Brusehaver Rathmann zu Sternberg; die
Brusehaver waren alte richenbergische Lehnlente.
Außer diesen Familien erscheinen auch die
Sperling auf Thurow und Keetz
., werden schon im 14. Jahrh. als
in Sternberg ansässig genannt, z. B. 1387 und
1397 "Clawes Berner to deme Sterneberge
wanafftich". Bekannt ist, daß die von
Pressentin bis auf die neuern Zeiten ein Haus in
Sternberg hatten: schon im J. 1397 wird
"Hennynk Pressentyn knape wanafftich tome
Sterneberghe" genannt. Im 15. Jahrh. werden
die von Gustävel in Sternberg erwähnt. Die Preen
von Witzin und Lübzin waren lange Zeit in
Sternberg wirksam; schon 1380 und 1383 war
Martin Preen Vicar zu Sternberg und im J. 1427,
neben Curt Scherer, "Merten Pren
borghermester der stad Sterneberch"; noch
im J. 1505 war "Barthold Pren en gadeshuses
man (Kirchenvorsteher) der "kerken thom
Sterneberg". Im J. 1505 war "Borchard
van der Lüe borgermeyster thom Sterneberghe vnd
erffzeten thom Vogelsange"; seine Brüder
wohnten auf Ilow und Panzow. Zu derselben Zeit
war ein Brusehaver Rathmann zu Sternberg; die
Brusehaver waren alte richenbergische Lehnlente.
Außer diesen Familien erscheinen auch die
Sperling auf Thurow und Keetz
 ., die von Plessen auf Müsselmow
., die von Plessen auf Müsselmow
 . und andere der Stadt benachbarte
Familien öfter in Sternberg.
. und andere der Stadt benachbarte
Familien öfter in Sternberg.
Unter solchen Umständen gestaltete sich denn auch das Stadtregiment in Sternberg eigenthümlich. Es mag sein, daß auch in den übrigen kleinen Städten Meklenburgs nur solche Personen im Stadtrathe saßen, welche kraft ihres Geburtsstandes auch zur Besetzung des fürstlichen Rathes fähig waren, d. h. Personen aus dem Ritterstande oder Patriciat; aber es tritt diese Eigenthümlichkeit vielleicht nirgends so deutlich hervor, als in Sternberg. Es ist so eben dargethan, daß die Rathmänner häufig, vielleicht gewöhnlich und immer, dem Patricierstande angehörten; wir finden aber in Sternberg auch Burgemeister und Rathmänner aus dem Ritterstande 2 ). Im J. 1427 war Martin Pren


|
Seite 202 |




|
Burgemeister zu Sternberg; wir finden diesen Zweig der Familie, welcher das bekannte prensche Wappen mit den drei Pfriemen im Schilde führte, mit Familiengliedern dieses Namens auf dem benachbarten Gute Witzin angesessen; im J. 1437 war Henning Tepeling und 1505-1514 war "er Borchard von der Lüe, erffzeten thom Vogelsange, borgermeyster thom Sterneberghe", während "er Nicolaus Brusehaver" 1514 Rathmann und 1505 "Barthold Pren "en gadeshuses man der kerken thom Sternebergh" war.
Die Ansässigkeit so vieler adeliger Familien in Sternberg erzeugte aber wiederum besondere Verhältnisse in Beziehung auf den Gerichtsstand derselben. Die adeligen Familien wohnten wahrscheinlich an der Ritterstraße und bedeckten mit ihren Häusern die Seite des fürstlichen Hofes des nachmaligen Klosters; denn die fürstliche Hofstelle, welche an der Stadtmauer lag, hatte, auch nach der Säcularisirung des Klosters, Thorhaus, Bauhaus, Reitstall und Scheure an der Mühlenstraße. Jetzt stehen an der Mühlenstraße Privatwohnungen und die Ritterstraße an der Klosterhofseite war bis zum J. 1842 leer von Häusern, mit Ausnahme eines Hauses, nicht weit von der Stadtmauer, welche in der Stadt den Namen "Rittersitz" führte; die Gegend dieses Hauses führte noch vor hundert Jahren den Namen "Ritterviertel" und hinter diesem Hause liegt am Stadtgraben eine ziemlich große Wiese, welche "Rüderkoppel" genannt wird. Von diesem Hause ging in der Stadt und im Lande die Sage, es besitze "ständische Rechte mit Sitz und Stimme im Landtage". Dieses Haus war ein altes v. pressentinsches Burglehn, über welches der Geheime Rath J. P. Schmidt folgende Nachrichten 1 ) hinterlassen hat. Es fehlt über diesen Besitz ganz an Urkunden und Acten jeder Art. Im J. 1749 zeigte Claus Otto von Pressentin auf Stieten an, daß seine Vorfahren seit hundert Jahren einen in Sternberg belegenen, von allen Contributionen und bürgerlichen Lasten ganz freien "Rittersitz" besitzen, über den es ihm jedoch an allen Urkunden fehle. Auch der Magistrat berichtete, das Haus sei im Stadtschoßbuche nicht verzeichnet, auch bei Durchzügen nicht mit Einquartirung belegt worden; dieser Rittersitz übe auch seine eigene Jurisdiction aus, obgleich andere in der Stadt wohnende Adelige der Stadt=Jurisdiction in realibus unterworfen seien. Auch Bürger bezeugten das Herkommen nach Hörensagen. Jedoch ward v. Pressentin mit seiner Forderung abgewiesen, bis er die Qualität eines Ritter=


|
Seite 203 |




|
sitzes besser als bisher beweisen könne. - An dieser ganzen Behauptung ist wohl nichts weiter, als daß die Rittersitze und Burglehen, welche in der Ritterstraße an dem fürstlichen Hofe lagen, wie dieser, von der städtischen Gerichtsbarkeit befreiet waren und unmittelbar unter fürstlicher Gerichtsbarkeit standen; daß der Besitzer des v. pressentinschen Burglehns immer zugleich Gutsbesitzer und von seinem Landgute Landstand war, hat ohne Zweifel zu der irrigen Vermuthung Veranlassung gegeben, daß die Landstandschaft an dem Hause klebe, da die Landtage in Sternberg gehalten werden und die v. Pressentin wahrscheinlich in diesem Hause wohnten, wenn sie sich in der Stadt aufhielten. - Seit der Säcularisirung standen der ganze Klosterhof und später die an demselben liegenden Privathäuser in der Mühlenstraße unter dem fürstlichen Stadtvogt und in neuern Zeiten unter dem fürstlichen Domanial=Amte Warin; der Besitzer des "Rittersitzes" soll in neuern Zeiten seine vermeintlichen Ansprüche wegen der mit dem Besitze verbundenen Lasten aufgegeben haben. Seitdem aber seit dem J. 1842 die Gartenplätze an der Ritterstraße mit Häusern bebauet sind, hat durch eine Vereinbarung mit der Stadt die ganze besondere Jurisdiction aufgehört; im J. 1843 gingen die auf dem Klosterhofe belegenen Grundstücke in den Stadtverband über 1 ).
Durch einen verhältnißmäßig so großen Reichthum
und Verkehr blühten denn auch die geistlichen
Stiftungen in Sternberg schon früh auf eine
nicht gewöhnliche Weise. Die Pfarrkirche hatte
viele Vicareien und Lehen, deren Priester häufig
von adeligem Stande waren, was sich bis in das
16. Jahrhundert hineinzieht
2
); es hatten z. B. die von
Bülow auf Rahden
 . und die von Cramon auf Borkow
. und die von Cramon auf Borkow
 . schon früh Vicareien in der
Pfarrkirche. An milden Stiftungen hatte die
Stadt schon im 14. Jahrh. ein S. Georg=
3
)Hospital, ein Heil. Geist=
4
) Hospital, eine S.
Gertruden=Kirche, ein Siechenhaus (domus
leprosorum), ein Elendenhaus (domus exsulum) für
heimathlose (d. i. elende) Wanderer, u. a. m.
Die Franziskaner=Mönche inWismar hatten durch
Vergünstigung des
. schon früh Vicareien in der
Pfarrkirche. An milden Stiftungen hatte die
Stadt schon im 14. Jahrh. ein S. Georg=
3
)Hospital, ein Heil. Geist=
4
) Hospital, eine S.
Gertruden=Kirche, ein Siechenhaus (domus
leprosorum), ein Elendenhaus (domus exsulum) für
heimathlose (d. i. elende) Wanderer, u. a. m.
Die Franziskaner=Mönche inWismar hatten durch
Vergünstigung des


|
Seite 204 |




|
Fürsten Heinrich seit dem J. 1327 eine Terminarei in Sternberg 1 ), welche sie bei der Reformation an die Stadt abtraten.
Unter so günstigen Verhältnissen, welche sich ohne Zweifel alle unter dem Fürsten Heinrich dem Löwen entwickelten, blühte die Stadt Sternberg so rasch empor, daß sie im 14. Jahrhundert die einzige Mittelstadt in Meklenburg war, wie es im Lande Stargard allein Friedland war. Nach dem rostocker Landfrieden vom J. 1354 2 ) sollten Rostock 50, Wismar 40, Parchim 40, Neu=Brandenburg 30, Güstrow 30, Malchin 30, Teterow und Lage jede 5, alle übrigen Städte jede 10, nur Sternberg und Friedland jede 20 Gewaffnete stellen. Im J. 1356 ward zu Sternberg zwischen den meklenburgischen und werleschen Fürsten ein Landfriede geschlossen 3 ). Im J. 1354 ward Sternberg zu einem Landfriedensgerichtsort bestimmt 4 ), wo der Ritter Raven von Barnekow Landfriedensrichter war 5 ), und im Landfrieden von 1366 ward Sternberg wieder zum Gerichtsorte erkoren 6 ). Noch im J. 1506 hatte Sternberg nach den Roßdienstrollen 40 Mann zu stellen, war also damals noch eine Mittelstadt.
Während der Regierung Heinrichs des Löwen erlebte die Stadt Sternberg noch manche wichtige Landesbegebenheit. Zwar feierte der Fürst im J. 1315 nicht in Sternberg seine zweite Hochzeit, wie Franck annimmt, sondern zu Dömitz, da Kirchberg cap. CLIII von der Fürstin Anna ausdrücklich berichtet:
zu Dommitze sy wart eben
hern Hinriche zu wybe gegeben.
Auch seine dritte Hochzeit im J. 1328 mit der Fürstin Agnes von Lindow=Ruppin hielt er wohl nicht in Sternberg, da diese Hochzeiten wohl in den Ländern der Brautväter gehalten wurden. Aber man kann annehmen, daß in Folge der wiederholten Vermählungen jedenfalls große Feste in Sternberg gefeiert wurden.


|
Seite 205 |




|
Eine der bedeutsamsten Begebenheiten für Sternberg aber war, daß Heinrich der Löwe am 21. Jan. 1329 hier im kräftigen Alter sein Leben beschloß 1 ), ein Todesfall, welcher in der weitern Entwickelung der Stadt einen dauernden Stillstand brachte. Die Begebenheit aber war für alle deutschen Ostseeländer so bedeutend, daß die Stadt Sternberg sie tiefer fühlen mußte, als jede andere Stadt; denn mit dem Fall des Löwen ging auch ihr Stern unter.
Im Januar des J. 1329, kurz vor seinem Ende, bestimmte Heinrich der Löwe zu Sternberg noch die Stiftung des Klosters Ribnitz und die Einkleidung seiner Tochter Beatrix in dasselbe 2 ). Er hatte aber auch seiner Stadt Sternberg gedacht, indem er im J. 1328 (die Stephani) zu Sternberg den Kauf von 4 Hufen in Rosenow, welche den Cramon gehört hatten, durch Gerhard v. Radem und Barthold und Heinrich Trendekop bestätigte und diesen das Eigenthumsrecht verlieh; im J. 1350 waren diese Hufen im Besitze der sternberger Vicarien. Ferner gab er im J. 1328 den Vicarien zu Sternberg das Eigenthum des Dorfes Loitz. Am 19. Nov. 1329 bestätigte seine Wittwe Agnes die Urkunden über die Hufen in Rosenow 3 ).
Die von dem Fürsten für seine minderjährigen Söhne Albrecht und Johann eingesetzte Vormundschaft, welche aus 16 ritterbürtigen Räthen und den Rathscollegien der Städte Wismar und Rostock bestand, verlegte auch sogleich die fürstliche Residenz wieder nach der alten Residenzstadt Wismar 4 ). Jedoch behielt Sternberg noch den Trost, daß des Fürsten Heinrich Wittwe Agnes ihre Residenz zu Sternberg behielt. Ihr Gemahl hatte ihr nämlich bei der Vermählung Stadt und Land Sternberg zum Leibgedinge verschrieben:
Dy czid von Mekilnborg Hinrich
zum drytten male wybete sich:
frawen Agneten nam her da,
dy vur hatte fursten Wysla,
der zu Rugyen furste waz;
dy hochczid ging zu sundir haz.
Her gab ir do geringe
Sterrenberg zu libgedinge. (Kirchb. cap. LXVIII.)
Noch im J. 1343 nannte sich die Fürstin Agnes "Herrin von Sternberg" ("coram inclita Agnete, nunc terre


|
Seite 206 |




|
Sternebergensis dominatrice") 1 ). Wahrscheinlich lebte die Fürstin noch im J. 1367, als sie mit dem Herzoge Johann, ihrem Stiefsohne, der Stadt die Mittelmühle verkaufte 2 ). Zwar führte auch die zweite Gemahlin des Herzogs Johann, ebenfalls eine geborne Gräfin von Lindow=Ruppin, den Namen Agnes; aber diese würde in der Urkunde sicher als des Herzogs Gemahlin bezeichnet sein, wenn sie es gewesen wäre.
Im J. 1352 theilten 3 ) die Brüder Albrecht und Johann von Meklenburg die Länder, so daß der Herzog Johann das Land Stargard und die ehemaligen richenbergischen Länder, welche an Meklenburg gefallen waren, Sternberg und Ture erhielt, und im J. 1355 erweiterten sie zu Sternberg diese Theilung in Beziehung auf das Land Stargard 3 ). Seitdem blieb Sternberg bei der Linie Meklenburg=Stargard bis zum Aussterben derselben im J. 1471.
Der Herzog Johann erhielt seine Residenz zu Sternberg und erscheint nach den von ihm ausgestellten Urkunden noch häufig in dieser Stadt. Ja, er lebte noch so sehr im ehrenden Andenken seines Vaters, daß er sich einige Male selbst "Herr von Sternberg" nannte ("her Johan van godes gnaden eyn hertoghe van Mekelborch vnde en here to Stargard vnde to Sternebergh" 4 ). Auch verkaufte er, mit der Herzogin Agnes, vermuthlich seiner Stiefmutter, als Leibgedingsbesitzerin, am 13. April 1367 die Mittelmühle zu Sternberg an die Stadt zu parchimschem Rechte 5 ). Im J. 1361 gab er dem Heil. Geist=Hospitale zu Sternberg den Aalfang im lukower See 6 ). Aber der Glanz der Stadt Sternberg erlosch unter den folgenden Regenten, welche sich nach und nach auf ihre Residenzen im Lande Stargard beschränkten, immer mehr, namentlich seitdem die Stadt im J. 1403 von dem Fürsten Balthasar von Werle in dessen Fehde mit der Stadt Lübeck gestürmt ward 7 ).
Des ersten Herzogs Johann Enkel, der Herzog Johann IV., hielt sich noch häufig in Sternberg auf und ward hier begraben, wie Latomus in seinem Genealochronicon, in v. Westph. Mon. IV, S. 345, nach dem jetzt verschwundenen Leichensteine berichtet:


|
Seite 207 |




|
"Weil ihm aber im Gefengnis die Beine gar erkaltet, ist er fort anno 1435 gestorben und zum Sternberg im Chor begraben worden, unter einem Steine, so noch da liegt und die Jahrzahl zeiget".
Ferner berichtet Latomus, a. a. O. S. 367, von noch einem fürstlichen Begräbnisse in der Kirche zu Sternberg:
"Im selbigen Jahr ist auch gestorben ein junger Hertzog von Meckelnburg und Fürst zu Wenden, Johannes, und zum Sternberg im Chor begraben, bin der Meynung, es sey Hertzog Christoffers, Hertzog Wilhelms Bruder Sohn gewesen";
Chemnitz in seiner Chronik hält diesen "Johannes XXII für Herzog Johansen einzigen Sohn".
Mit dem Aussterben des Hauses Meklenburg=Stargard im J. 1471 verlor Sternberg die fürstliche Residenz selbst dem Namen nach. Im Anfange des 16. Jahrhunderts war das fürstliche Schloß zu Sternberg schon gänzlich verfallen. Jedoch brachte eine unerwartete Begebenheit, die Verehrung des Heiligen Blutes, auf einige Zeit wieder reges Leben und vortheilhaften Verkehr in die Stadt.
3. Das Heilige Blut zu Sternberg.
Wenn auch in der katholischen Zeit überall viel Mißbrauch mit Wunderthätigkeit getrieben ward, so erlangte doch kein Wunder so großes Ansehen, als das "Heilige Blut", welches wiederholt Gegenstand abergläubischer Verehrung ward. Daher ward denn auch das "Heilige Blut" das Ziel weiter und häufiger Wallfahrten und dadurch eine reiche Erwerbsquelle für die Geistlichkeit. Auch in Meklenburg ereigneten sich zu mehreren Malen Wunder, welche gewissen Orten ein bedeutendes Ansehen verliehen. Zuerst geschah im J. 1201 ein Wunder zu Doberan durch eine Hostie, welche ein Hirte im Munde bei sich behalten und zum Schutze seiner Heerde in seinem Hirtenstabe verwahrt hatte; Doberan ward hierdurch auf längere Zeit ein besuchter Wallfahrtsort, und noch heute steht die Heil. Bluts=Capelle vor der nördlichen Pforte der Kirche 1 ). Bald aber lief der Bischofssitz Schwerin dem aufstrebenden Kloster den Rang ab; der berühmte Graf Heinrich I. von Schwerin brachte von seinem Kreuzzuge im J. 1220 aus Jerusalem einen Jaspis mit 2 ), welcher einen Tropfen des wirk=


|
Seite 208 |




|
lichen Blutes Christi enthielt; die Verehrung dieses Heiligen Blutes in der seit der Reformation zur fürstlichen Begräbnißgruft bestimmten Heiligen=Bluts=Capelle hinter dem Altare im Dome zu Schwerin ward am Grünen=Donnerstage 1222 bestimmt und erhielt sich bis zur Reformation in vorzüglichem Ansehen. Ein anderes Heiliges Blut, welches in den Ostseeländern großes Ansehen erlangte und das allgemeine Ziel der Wallfahrten ward, war in der benachbarten Mark Brandenburg zu Wilsnack: drei Hostien, welche bei dem Brande der Kirche zu Wilsnack im J. 1383 unversehrt geblieben waren 1 ) und viele Wunder thaten.
Eine andere Veranlassung hatte das Heil. Blut zu Crakow und Güstrow. Im J. 1325 hatten nämlich die Juden zu Crakow und im J. 1330 die Juden zu Güstrow sich eine Hostie zu verschaffen gesucht und dieselbe durchstochen, worauf denn die Hostie Blut vergossen und bei ihrer Wiederauffindung durch ihre Blutflecken Klage erhoben haben soll. Im J. 1330 mußte die ganze Judenschaft zu Güstrow auf den Holzstoß wandern. Jedoch erlangte hier das Heilige Blut kein bedeutendes Ansehen, obgleich ihm eigene Kapellen gestiftet waren.
Die Geschichte von der Durchbohrung von Hostien durch Juden wiederholt sich im Mittelalter überall in derselben Gestalt. Durch das häufige Vorkommen hat jeder einzelne Fall in den Augen der Welt in der That nicht so große Bedeutung, als für den Forscher die Wiederkehr des Ereignisses. Die Judenverbrennungen im Mittelalter gleichen den Hexenverbrennungen im 16. und 17. Jahrhundert. Man sieht den einzelnen Hexen=Processen grade nicht viel Ungewöhnliches an, weil die meisten einander gleich sind: Anklage, Geständniß und die herkömmliche Strafe des Feuertodes für die Sünde der Ketzerei sind die gewöhnlichen, nüchternen Artikel der Protocolle. Aber forschende Augen erkennen in dem ganzen Wesen der Hexenverfolgungen eine tiefe moralische Verdorbenheit: Finsterniß und Aberglauben durch die Zurückdrängung des Geistes der Reformation bei dem armen Volke, von der einen, und Benutzung der Dummheit zur Kuppelei, von der andern Seite, und dazu die Feigheit der nach dem todten Buchstaben des katholischen Gesetzes urtheilenden Gerichtsgewalt, welche ohne Zweifel viele Schändlichkeiten sah, aber nicht aufzudecken und dem Volke nicht zum Rechte zu verhelfen wagte. Die Hexenprocesse sind die wahren Stempel der Zeit der - Blüthe der Jurisprudenz.
Ähnlich, wenn auch anders, verhält es sich mit den Judenverfolgungen im Mittelalter. Nach allen Forschungen war der


|
Seite 209 |




|
Charakter der Juden im Mittelalter 1 ), wie er noch heute häufig sich zeigt und sich seit Jahrtausenden gezeigt hat; eine Volksindividualität läßt sich in einigen Jahrzehenden nicht verwischen, namentlich wenn der religiöse Aberglaube genährt wird, und "Halsstarrigkeit" ist bekanntlich das alttestamentliche Erbtheil der Juden; kein Mensch geht widerwilliger in die Eigenthümlichkeit einer neuen Heimath ein, als der Jude. - Die Beschäftigung der Juden war auch im Mittelalter der Handel, ihr Ziel war Gewinn durch Wucher; sie waren die Geldmäkler und Pfandleiher und standen als solche grade nicht in Ansehen, wenn man sie auch gebrauchte; sie standen daher unter unmittelbarem fürstlichen Schutze als fürstliche "Kammerknechte". Die allein seligmachende Kirche stand im Mittelalter allein herrschend da; jeder Abfall von ihr, jede Häresie, ward mit dem Feuertode bestraft: die Duldung eines andern Glaubensbekenntnisses war unbekannt, wenn auch mancher seinen besondern Glauben haben mochte. Daher war der unmittelbare fürstliche Schutz der Juden notwendig. Durch diese Lage fühlte sich aber der Jude gedrückt, wenn er auch in großer Unwissenheit lebte; Schlauheit vertrat bei ihm die Stelle der Bildung. Daher haßte er die Christen; es war ihm eine Freude, seiner Bosheit gegen ihren Glauben durch Verhöhnung, Spott und Abwendigmachung Luft zu machen 2 ). Der Christ aber haßte wieder den Juden wegen seiner Uebervortheilung, seiner Kriecherei und seines Unglaubens nach damaligen Ansichten. Daher war das Verhältniß zwischen Juden und Christen im Mittelalter ein durchaus feindseliges, ein Verhältniß, wie es in rohen Ländern und Städten noch heute gefunden wird, und die Juden sind von vielen Schändlichkeiten eben so wenig freizusprechen, als die starre Anwendung des canonischen Rechts gegen die Juden zu billigen ist. Die Judenverfolgungen im Mittelalter sind der ächte Stempel einer allein seligmachenden Kirche, welche lieber bestraft, als belehrt. Aber auch die Juden tragen große Schuld, daß häßliche Flecken auf
"In his deliramentis homiues ignari, ne dicam stulti, redemptorem exspectant, - - quem in foribus inter tonitrua et fulgura frustra exspectant. - - Quorum mos, regi regum Jesui quotidie imprecari, execrari divos, illudere virgini theotoco sanctissimae, mysteriis nostris omnibus et mystis, quos derasulos vocant, coelitibus denique omnibus quos nos patronos adoramus, rogare solemniter, ut imperium romanum intereat. Si e nostris quemquam dolis ceperint, obsequi se putant priscis suis numinibus. Quot infantium generis nostri, non dico paria, sed millia, insontissimos vita exspoliarunt!"


|
Seite 210 |




|
manchen Personen haften; ihre Gemeinheit reizte zum Zorn, und sie waren schlau genug, um die Thorheit ihrer Racheversuche einzusehen. Endlich ergriff denn auch die Geistlichkeit und das Kirchenregiment begierig jede Gelegenheit, um die Lehre von der Transsubstantiation zu unterstützen, weil grade in dieser Lehre die Herrschaft der Kirche lag und fast jede Ketzerei sich in dem Abfall von dieser Lehre offenbarte.
Ein klares Bild von dem Zustande der Juden giebt die Geschichte des Heiligen Blutes in Sternberg, und daher ist dieselbe, wenn auch oft unbewußt ausgezeichnet, als eine Hauptbegebenheit in der Geschichte des Judenthums in Deutschland zu betrachten.
Wir besitzen über die Judenverbrennung zu Sternberg eine umfangreiche Litteratur. Der bekannte herzoglich=meklenburgische Rath und Professor Dr. Nicolaus Marschalk Thurius gab zuerst eine Darstellung dieser Geschichte in lateinischer Sprache mit dem Titel Mons stellarum heraus und putzte sie nach seiner Weise mit vielen lateinischen Redewendungen und allerlei ungehöriger Gelehrsamkeit aus. Er gab sie wiederholt heraus: zuerst ließ er sie im J. 1512 in der Druckerei des Hermann Barckhusen zu Rostock 1 ) und darauf im J. 1522 in seiner eigenen Druckerei zu Rostock drucken 2 ); die letztere Ausgabe hat Johannes Hübner zu Hamburg im J. 1730 neu aufgelegt. Marschalk sagt selbst, daß vor ihm diese Geschichte niemand beschrieben habe (quae res nullo certo adhuc autore in lucem prodiit). Jedoch existirte schon vor ihm über diese Begebenheit eine kurze Reimchronik, welche, mit zwei andern, hinten in die Original=Chronik des E. v. Kirchberg geschrieben ist 3 ); diese ist nur eine deutsche Nachbildung eines lateinischen Originals, welches, nach neuern Entdeckungen, schon im J. 1506 von dem Dr. Heinrich Bogher zu Rostock in dessen Etherologium herausgegeben ward 4 ); die plattdeutsche Nachbildung ist wohl nicht von Marschalk, wie ich früher vermuthet habe. Herausgegeben ist die deutsche Uebertragung dieses kurzen, unbedeutenden Gedichts in Henr. Köpken Memoria Conradi Lostii episc. Suerin., disputatio Rostoch. 1707, und hiernach von J. Hübner in dessen oben genannter Ausgabe von Marschalci Mons Stellarum, beide Male mit sehr schlechtem Texte. Nach Marschalks Arbeit erschien Michael Guzmer's, Predigers zu Sternberg, Kurzer Bericht von den zu Sternberg verbrannten Juden, Gü=


|
Seite 211 |




|
strow bei Joh. Jäger, 1629, hierauf von Jul. Ern. Hahn Dissertatio historica de hostia Sternebergae a judaeis confossa, Lipsiae, 1699, und endlich von dem bekannten Geschichtschreiber und sternberger Präpositus Dav. Franck Gründlicher und ausführlicher Bericht von denen durch die Juden 1492 zerstochenen Hostien.
Alle diese Bearbeitungen sind wesentlich auf die bekannten Bekenntnisse oder die sogenannte Urgicht der Juden gegründet, welche zuerst von Guzmer herausgegeben wurden, und enthalten weiter keine urkundliche Forschung.
Freilich ist diese Urgicht die Hauptquelle der ganzen Geschichte; es sind aber noch andere Nachrichten vorhanden, welche ein besonderes Licht auf die Begebenheit werfen. Die geschichtlichen Quellen sind, außer den in Folge des Ereignisses ausgestellten Urkunden, jetzt folgende:
1) das erste Verhör=Protocoll vom 29. Ang. 1492 1 )
und
2) das Schlußbekenntniß oder die Urgicht der Juden vom 22. Oct. 1492 2 ).
Das erste Verhör=Protocoll ist erst vor kurzem im großherzogl. Archive zu Schwerin aufgefunden und bisher noch nicht bekannt gewesen; es enthält mehrere neue, früher unbekannte Vorkommenheiten. - Die Urgicht der Juden war auf eine hölzerne Tafel geschrieben 3 ), welche im Rathhause zu Sternberg hing, aber in dem Brande von 1659 umkam; sie ist durch Guzmer's Bericht erhalten und in Franck's Bericht wieder abgedruckt. Das hier mitgetheilte Exemplar ist von einer mit der Begebenheit gleichzeitigen oder doch nur wenig jüngern Abschrift im großherzoglichen Archive zu Schwerin genommen. Es ist also jede Hyperkritik, welche die Aechtheit dieser Aufzeichnung verdächtigen will, ohne Grund.
Aus der Vergleichung beider Protocolle geht aber hervor, daß das Complott der Juden sehr verzweigt war und die Treulosigkeit des sternberger Priesters Peter Däne erst bei dem letzten Verhör als eine isolirte Begebenheit ans Licht kam.
Der Zusammenhang der Begebenheit ist folgender:
In Sternberg wohnte ein Jude Eleasar, welcher weit verzweigte Verbindungen im Lande hatte und diese zur Sättigung seiner Rache benutzte. Er versuchte seine Künste zuerst in Penzlin. Hier lebte ein Franziskanermönch als Kapellan in


|
Seite 212 |




|
weltlichen Kleidern. Diesen hatte ein Jude Michael zu Penzlin schon ein Jahr lang zum Uebertritt zum Judenthume bearbeitet. Dies war jedoch vergeblich gewesen, bis Eleasar selbst im Anfange des Monats Februar, um Lichtmeß, 1492, nach Penzlin kam und im Vereine mit Michael und einem Juden Jacob aus Rußland 1 ) den Mönch bewog, daß er Jude ward. Eleasar reiste wieder nach Hause, Michael und Jacob aber zogen mit dem Mönch nach Friedland, wo ihm die Juden eine Mark aus ihrer Opferbüchse zur Zehrung schenkten. Hier bestürmten nun sämmtliche Juden den abtrünnigen Mönch, daß er ihnen eine geweihete Hostie verschaffe, und gaben alle ihre Bereitwilligkeit zu erkennen, den Kauf des Sacraments durch Geld zu unterstützen. Auch die Juden zu Röbel gaben ihre Zustimmung zur Bestechung des Ueberläufers und der Jude Smarghe zu Parchim gab Rath und That und einen Goldgulden. Der Mönch weihete also eine Hostie und brachte sie selbst nach Sternberg, wohin Jacob gereiset war, und nachdem Eleasar und Michael von einer Reise zu dem Herzoge Magnus nach Schwerin zurückgekehrt waren, nahmen diese drei Juden die Hostie in Empfang. Eine zweite große Hostie kauften die Juden von einer Christenfrau zu Teterow für 10 Schillinge und beschnitten sie zu der Form einer kleinen Hostie. Noch eine andere große Hostie erlangten die Juden zu Penzlin, nachdem der Mönch abgereiset war, und behielten sie bei sich.
Hiemit war aber Eleasar noch nicht zufrieden, sondern er suchte noch mehr Leute zum Abfall zu bringen und seinen Muthwillen zu treiben; er bereitete für die nahe bevorstehende Hochzeit seiner Tochter, zu welcher er eine große Zahl gleichgesinnter Genossen erwartete, ein großes Rachefest vor. Es wohnte in Sternberg ein Priester Peter Däne, Vicar an dem Altare Aller Heiligen. Dieser hatte bei Eleasar einen Grapen für 4 Schillinge versetzt. Der Grapen gehörte aber seiner ehemaligen Köchin, welche er nach den kurz vorher von dem Bischofe Conrad Loste zu Schwerin veröffentlichten Synodal=Schlüssen hatte entlassen müssen; das trunksüchtige Weib lag nun dem Priester täglich vor der Thür und forderte ihren Grapen wieder 2 ). Peter Däne bat nun den Eleasar um den Grapen; da aber der Priester kein
Dyn art to Penslyn sek vernyget,
Een mönk der gestlichheit vortyget,
Dorch dy thot he in Rutzen nedder,
Noch twe hostien he dy ghifft,
Dar mede din volck een spott drifft.


|
Seite 213 |




|
Geld hatte, das Darlehn und die aufgeschwollenen wucherischen Zinsen zu bezahlen, so ließ ihm der Jude das Pfand für das Versprechen, ihm das Sacrament geben zu wollen. Der Jude wollte ohne Zweifel ganz sicher gehen und wirklich geweihete Hostien haben. Es würde eine solche Unverschämtheit von der Seite des Juden und eine solche Armuth und Pflichtvergessenheit des Priesters unglaublich erscheinen, wenn man nicht wüßte, daß am Ende des 15. Jahrh. alle gesellschaftlichen Verhältnisse im höchsten Grade zerrüttet waren, und man weiß in der That nicht, was man mehr beklagen soll, die Verirrung des Einzelnen oder die Versunkenheit des Ganzen. Indessen läßt es sich denken, daß sich die Begebenheit anders zugetragen habe, als sie in dem Protocolle ausgezeichnet ist. Die Geschichte mit dem Grapen, also die ganze Verwickelung des Priesters Peter Däne in die Begebenheit, kommt nur in dem letzten Bekenntnisse der Juden vor; es ist auch fast unglaublich, daß P. Däne einen Grapen nicht sollte haben einlösen können, sondern sich zu einer so pflichtwidrigen Handlung haben hinreißen lassen. Bei den Juden lebte noch im vorigen Jahrhundert die Sage 1 ), Peter Däne habe an Eleasar nicht einen Grapen, sondern den Kelch von seinem Altar versetzt; er habe diesen gebrauchen müssen und Eleasr habe seine Noth gemißbraucht. Möglich also, daß die Juden, welche um die Pfandgeschichte wußten und doch ihren Tod vor Augen sahen, diesen Umstand verschwiegen, um vielleicht den Priester zu retten.
Peter Däne ließ sich bereitwillig finden. Am Sieben=Brüder=Tage, den 10. Julius 1492, weihete der Priester auf dem Altare Aller Heiligen zwei Hostien, wickelte sie in ein Stück Seide, welches er von der Decke des Altars der Heil. Drei Könige abgeschnitten hatte und brachte sie am andern Tage dem Eleasar; Eleasars Frau versteckte sie in eine Tonne mit Federn, welche zur Aussteuer ihrer Tochter bestimmt waren.
Am 20. Julius feierte Eleasar die Hochzeit seiner Tochter mit dem Juden Simon und hatte dazu seine Mitschuldigen und außerdem eine große Menge Juden, alle gleicher Gesinnung, aus vielen Städten des Landes geladen. Am Morgen des Hochzeitstages um 8 Uhr holte Eleasars Weib die Hostien hervor, übergab sie ihrem Manne, welcher damit in eine Laube hinter dem Hause ging, wo er dieselben auf einen eichenen Tisch legte. Fünf Juden: Eleasar, sein Schwiegersohn Simon, Michael Aarons Sohn von Neu=Brandenburg, Schünemann aus Friedland und Salomon aus Teterow, nahmen nun Nadeln und durchstachen mit fünf Stichen eine Hostie, aus welcher sogleich


|
Seite 214 |




|
Blut floß. Dies bezeugten späterhin Eleasars Weib und ihr Schwiegersohn Simon. Am Abend des Hochzeitstages stachen die Juden in der Stube mit Messern nach beiden Hostien Eleasars Weib nannte noch fünf Juden als Mitschuldige, nämlich Sitan Kaszeriges aus Franken, David von Parchim, Meister (?) Leispe, Jsrael und Hamburg.
Bei nüchternem Sinne überfiel aber die Juden doch eine große Furcht, obgleich sie sich durch einen Eid zur Geheimhaltung des Vorgefallenen verbunden hatten. Eleasar hieß seinem Weibe, die Hostien zu vernichten; aber es wollte ihr weder mit Feuer, noch mit Wasser gelingen; als sie dieselben bei dem Mühlenthor in den Mühlbach werfen wollte, sank sie mit den Füßen in einen großen Stein, welcher derselbe sein soll, der an der südlichsten Hauptpforte der Kirche eingemauert ist. Jetzt wollte Eleasar mit dem "Gott der Christen" nichts weiter zu schaffen haben; er mochte auch schon Verrath fürchten: daher gab er seinem Weibe die Hostien mit dem Auftrage, sie dem Priester wieder zuzustellen.
Eleasar aber machte sich aus Furcht vor der Strafe, die ihn ereilen könnte, aus dem Staube; er trat eine weite Reise an, nahm die beiden penzlinschen Hostien mit sich und wird nicht weiter in der Geschichte genannt. Sein Weib steckte nun die Hostien in einen hölzernen "Leuchterkopf" und brachte sie am 21. August zu Peter Däne mit den Worten: "Hier habt Ihr Euren Gott wieder und verwahret ihn". Peter Däne gedachte sie wieder in die Kirche zu bringen oder sie auf dem Kirchhofe zu begraben; da er aber diesen seinen Vorsatz nicht ausführen konnte, so vergrub er sie auf dem Fürstenhofe an der Stadtmauer. In der Nacht soll ihm nun ein Geist erschienen sein, welcher ihm fortan keine Ruhe gelassen, und ihn vermocht haben, die Vergrabung des Sacraments, die ihm angeblich durch ein Wunderzeichen offenbart sei, seinen Mitpriestern anzuvertrauen. Er reiste daher nach Schwerin und zeigte den Vorfall dem Dompropst an, in der Hoffnung, Ruhe und Versöhnung zu finden. Das Dom=Capitel trug den Herzogen Magnus und Balthasar die Sache vor; nach eingeholten Bedenken der Bischöfe von Schwerin, Ratzeburg und Camin begaben sich denn am 29. August die Herzoge in Begleitung vieler Prälaten, Geistlichen, Räthe und Lehnmänner nach Sternberg. Peter Däne mußte die Hostien ausgraben, welche darauf in großer Procession in die Kirche gebracht wurden.
Die Herzoge stellten nun ein Verhör an, bei welchem das erste Protocoll 1 ) niedergeschrieben ist. Aus demselben geht nun hervor, daß bei diesem Verhöre Peter Däne's Schuld und über=


|
Seite 215 |




|
haupt der ganze Verlauf der Sache völlig verschwiegen ward. Es wurden nur die Hostien von Penzlin und Teterow erwähnt; Peter Däne wird nur ein "Priester genannt, welcher vielleicht von göttlicher Furcht bewogen, das Sacrament an sich genommen" und von einem Geiste ein "Wahrzeichen" zur Ehrung des Sacramentes erhalten habe. Genannt werden nur der Jude aus Rußland und der verlaufene Mönch aus Penzlin; Eleasar war verschwunden, die Hochzeitsgäste waren wieder zerstreut, und so hoffte man wahrscheinlich, die Sache unterdrücken zu können, da Eleasar's Weib, welches alles wußte und alles mit angesehen hatte, nichts verrieth und auch die Theilnahme des Priesters verschwieg.
Die Herzoge begnügten sich aber hiemit nicht, sondern ließen sämmtliche Juden im Lande gefänglich einziehen, nach Sternberg führen und hier am 22. Oct. peinlich verhören; es waren 65 Mitschuldige: 5 hatten die Hostien durchstochen und 60 (dortich pâer) hatten das Verbrechen mit Rath und That gefördert. In dem letzten peinlichen Verhöre 1 ) gestanden in der "Urgicht" Peter Däne und Eleasar's Frau alles, was in Sternberg geschehen war, und die übrigen Juden alle Vorgänge vor der Mißhandlung der Hostien.
Nach diesem Geständniß der Uebelthaten, welche von so viel Gemeinheit begleitet waren, mußten die Herzoge nach den damaligen Rechtsansichten der Gerechtigkeit freien Lauf lassen. Es ward sogleich das Urtheil gesprochen und am 24. Octbr. 1492 nach den Satzungen des Rechts vollzogen. Es waren 25 Männer und 2 Frauen, die Mütter der Braut und des Bräutigams, welche am 24 Octbr. (Mittwoch vor Simonis und Judä) 1492 vor der Stadt Sternberg auf einem Berge vor dem lukower Thore, welcher seitdem der Judenberg 2 ) genannt wird, in
(Anastasia) Sy vurchte sy worde betrogin
vnd daz dy rede were gelogin;
der bodeschaft hatte sy me virnomen.
Da vur so warin czwene komen
von fremden landen wandirn
ir eyne nach dem andirn.
Jglicher also nante sich
iren man von Mekilnborg Hinrich.
Dy worden beyde gesterbit
vnd iemirlich virterbit:
Zu Borczow by der molen gar
ir eynre wart irtrenkit zwar
in dem waszir Stobenitze:
der tod im quam von synre vurwitze.
Wy wart des andirn tod gewant?
Vor Sterrenberg wart der gebrant.


|
Seite 216 |




|
Gegenwart der Landesherren die Strafe der Ketzer, den Feuertod, erlitten. Freilich mochte der edle Herzog Magnus über eine solche Greuelscene tief gerührt sein; aber er konnte wohl nicht der ganzen Ansicht seiner Zeit entgegenhandeln. Auch stimmte ihn das Benehmen der Juden grade nicht zur Milde. Kalt, vergrätzt und mienenlos gingen sie zum Tode 1 ). Da redete der Herzog Magnus noch einen Juden Aaron, dem er mehr Gefühl als den übrigen zutrauete, mit den Worten an: "Warum folgst Du nicht unserm heiligen Glauben, um durch die Taufe mit uns gleicher himmlischer Seligkeit zu genießen?" Aber Aaron antwortete sophistisch schneidend: "Edler Fürst, ich glaube an den Gott, der Alles kann und Alles geschaffen hat, an ihn, dessen Verehrung unsers Volkes Vater Abraham und sein Sohn Isaak und unsere andern Vorfahren, welche nie von unserem Glauben abgefallen sind, geboten haben. Er, so glaube ich, ließ mich Mensch werden und Jude. Hätte er mich zum Christen haben wollen, so hätte er mich nicht meinem heiligen Bekenntnisse zugewandt. Wenn es sein Wille gewesen wäre, hätte ich ein Fürst sein können, wie Du!" Da schwieg er und knirschte mit den Zähnen. Alle aber gingen mit festem Muthe, ohne Widerstreben und Thränen zum Tode und hauchten mit alten, heiligen Gesängen ihr Leben aus.
Es sollte aber nicht allein die Schaar der Schuldigen, sondern das ganze Judenvolk in Meklenburg die Schuld büßen: man wollte ähnliche Auftritte für immer abwenden. Alle andern Juden, welche an diesem Verbrechen unschuldig befunden waren, wurden mit ihrer Habe, mit Weib und Kind aus Meklenburg verbannt. Der Braut, welche unschuldig befunden war, schenkten die Herzoge das Leben. Eleasar war verschwunden.
Das Haus 2 ) des Juden Eleasar, in welchem die That verübt war, nach der Urgicht an der Ecke der pastiner Straße (vp der Parstynschen strâten ôrde), dem Kirchhofe gegenüber, ward abgebrochen; die Hausstelle lag als ein "verbannter" Platz noch lange wüst. Da das Vermögen der verbrannten Juden den Landesherren anheimfiel, so gehörte ihnen auch die Hausstelle. Bei der Verlegung des Hofgerichts nach Sternberg im J. 1622 erbaueten sie auf der Stelle ein Haus, welches in dem Brande von 1659 eingeäschert ward. Die Stelle, welche von der städtischen Gerichtsbarkeit befreiet war, ward lange Zeit die Präsidentenstelle genannt, bis im J. 1701 der nachmalige Burgemeister Johann Vorast von dem Herzoge die Erlaubniß erhielt, die Stelle gegen Erlegung eines jährlichen Canons wieder


|
Seite 217 |




|
zu bebauen. Im J. 1716 verkaufte Vorast das Haus an den Schulrector und darauf an den Hülfsprediger Franck, der es im J. 1718 noch bewohnte.
Der Priester Peter Däne war nach Rostock gebracht, wo der bischöflich=schwerinsche Official wohnte, und hier durch ein geistliches Gericht ebenfalls zum Feuertode verurtheilt. In Gegenwart der Landesherren, vieler vornehmer Männer und Priester ward er am 13. März (Mittwoch nach Gregor) 1493 seines Priesteramtes entsetzt, geschoren und in kurzen, weltlichen Kleidern dem Büttel übergeben, welcher ihn vom Markte auf einem Karren durch die Stadt führte, an den Straßenecken mit glühenden Zangen zwickte und ihn vor die Stadt zum Richtplatz brachte. Alle diese Marter und den Tod litt er ergeben und reumütig.
In Johann Berckmanns stralsundischer Chronik 1 ) stehen die merkwürdigen Worte:
"He wortt tho Rostog afgewyett vnd vp allen ordenn der stratenn mitt gloyendenn tangenn thobrandt vnd getagen, dar na vorbrandt. Do vorsan sich hertich Magnus darna vnd were nicht vorbrandt gewesen, wen idt nicht geschehen were, he hedde em latenn bothenn, den wor he (?) (ehe?) von forstenn gehort iß".
Hieraus erhellt die milde Gesinnung des Herzogs, welcher wohl dem strengen Eifer der Geistlichkeit nicht trauete. Er hätte, so ist wohl die Ansicht des Chronisten, bei eigenem Verhöre vielleicht andere Erfahrungen gewonnen.
Diese Begebenheit war das letzte Beispiel eines bittern Glaubenshasses zwischen Juden und Christen, welcher vor dem Lichte der Reformation verschwand, wenn auch geringere Plackereien überall bis auf den heutigen Tag fortgedauert haben.
Mit der Verbannung aller andern, an dem Hostienfrevel unschuldig befundenen Juden verschwanden auf fast 200 Jahre alle Juden aus Meklenburg: theils wurden die Juden in Meklenburg nicht geduldet, theils war Meklenburg von den Rabbinen in den Bann gethan 2 ). Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, unter dem Herzoge Christian I. Louis, siedelten sich die ersten Juden wieder in Meklenburg an, und zwar in Schwerin 3 ). In der Stadt Sternberg aber, welche besonders mit dem Banne belegt war, wohnten noch hundert Jahre später, im J. 1769, keine Juden, obgleich sie sich damals schon fast in allen Städten Meklenburgs wieder eingenistelt hatten 4 ).


|
Seite 218 |




|
4. Die Heilige Bluts=Kapelle.
Da nun einmal ein Wunder geschehen sein sollte und dasselbe mit einer so furchtbaren That besiegelt war, so konnte man auch nicht umhin, dem Gegenstande des Fanatismus eine den Begebenheiten angemessene Verehrung zu beweisen; auch mochte die Geistlichkeit ans einer so ungewöhnlichen Geschichte möglichst viel Nutzen ziehen wollen. Für die Stadt Sternberg ward aber die Begebenheit für eine ganze Generation eine reiche Erwerbsquelle, welche sie auch wohl benutzte und um so ruhiger benutzen konnte, als kein christlicher Laie in der Stadt an der ganzen Geschichte thätigen Antheil genommen hatte: die Stadt war unschuldig, wie man in ähnlichen Fällen zu sagen pflegte. Zuerst lockte das geschehene Wunder viele Andächtige und Neugierige herbei. Bald aber that das Wunder wieder Wunder, und so stieg der Ruhm des einstweilen auf dem Hochaltare der Kirche niedergesetzten "Heiligen Blutes" so sehr, daß man auf eine abgesonderte, eigene Verehrung denken mußte. Wahrscheinlich gefiel der Domgeistlichkeit zu Schwerin der ganze Handel nicht sonderlich, weil das schon im Ansehen gesunkene Heilige Blut im Dome zu Schwerin noch weniger besucht werden mußte, wenn ein so gefährlicher Nebenbuhler in der Nähe war. Aber da man von Anfang an mit großer Consequenz und Oeffentlichkeit gehandelt hatte, so mußte man vorwärts.
Die Geistlichkeit beschloß also, eine Kapelle zur Verehrung des Heiligen Blutes zu erbauen. Man wählte dazu das westliche Ende des südlichen Seitenschiffes der Kirche, dem Schauplatze der Geschichte des Heiligen Blutes gegenüber, mit einer eigenen Vorhalle, um den Gottesdienst in der Pfarrkirche nicht zu sehr zu stören. Schon am 19. März 1494 gaben der Bischof und das Domkapitel von Schwerin zum Bau einer Kapelle ihre Zustimmung, bestimmten dabei jedoch zugleich über die Vertheilung der Opfer 1 ). Ein Dritttheil der eingehenden Opfer ward dazu bestimmt, die Kapelle zu bauen und eine Vicarei zur Haltung eines täglichen Gottesdienstes vom Leiden Christi zu dotiren; sobald dies alles geschehen sei, sollte dieses Dritttheil an die bischöfliche Domkirche zu Schwerin gehen, - wahrscheinlich zur Entschädigung für die Entziehung von Wallfahrern. Das zweite Dritttheil sollte an den Pfarrer der Kirche zu Sternberg, das dritte Dritttheil an das vor


|
Seite 219 |




|
kurzem gestiftete und jüngst gesicherte Dom=Collegiat=Stift zu Rostock fallen 1 ). Bald darauf bestätigte auch der Papst Julius II. dem Pfarrer zu Sternberg und dem Collegiat=Stifte zu Rostock diese Anordnung 2 ). An dieser, übrigens nicht grade ungerechten Vertheilung des Opfers, und überhaupt wohl an der Betreibung der ganzen Geschichte, hatte ohne Zweifel den meisten Anteil der in der Urkunde vom 19. März 1494 genannte schweriner Dompropst Magister Johannes Goldenboge, ein angesehener Prälat aus einem meklenburgischen Adelsgeschlechte, welcher zugleich Pfarrherr zu Sternberg war; er war im J. 1503 Dompropst von Schwerin, Domdechant von Bützow, Domherr von Güstrow und Rostock und Pfarrer von Sternberg.
Schon im J. 1496 war die Kapelle fertig, indem am 11. Nov. 1496 Curt von Restorf auf Mustin "den werdigen heren in der nyen capellen tôme Sterneberghe" 12 Mark jährlicher Pacht aus seinem Dorfe Witzin "zu treuer Hand der Herzoge Magnus und Balthasar" verpfändete. Im J. 1506 war das zum Bau und zur Ausrüstung der Kapelle bestimmt gewesene eine Dritttheil der Opfergelder schon an die schweriner Domkirche übergegangen. Die Kapelle steht noch heute, wohl erhalten; sie ist an dem westlichen Ende des südlichen Seitenschiffes, neben der westlichen Hauptpforte der Kirche, an welcher der Stein mit den Fußtapfen eingemauert ist, angebauet und über die Seitenwand der Kirche, um Raum zu gewinnen, hinausgerückt; in der Verlängerung des Seitenschiffes neben dem Thurme hat die Kapelle eine eigene Vorhalle. Nach dem Baustyle der Zeit hat die Kapelle zwei weit geschweifte, etwas gedrückte und schwerfällige, schr große, viertheilige Fenster, welche neben den geschmackvollen Fenstern der Kirche bedeutend abstechen. Auf den gemauerten Schranken der Kapelle nach der Kirche hin stehen noch hohe eiserne Gitter.
Das Heilige Blut von Sternberg gelangte bald zum größten Ansehen nicht allein in Deutschland, sondern in ganz Europa und wirkte unzählige, große Wunder 3 ). Blindgeborne wurden
Die Klassen der Wunder, welche er aber aufzählt, gehen schon ins Wunderbare."Locus totus a tempore eo frequentissimus, non a Germania prima ac secunda, sed Europa tota petitur, miracula maxima praestat, quae longiora sunt, quam ut a me libello hoc comprehendi possint, dignissima certe, quae separatim libro uno referrentur".


|
Seite 220 |




|
in großer Zahl sehend, Taube hörend, Lahme gehend, Ertrunkene lebendig, Kranke jeder Art gesund; ja selbst Kerker thaten sich auf, Ketten zerbrachen, Räuber entflohen!
Unter diesen Umständen hob sich der äußere Gottesdienst in der Kirche rasch. Von einem Theile des Opfers ward der Priester erhalten, welcher täglich die Zeiten von dem Leiden Christi hielt. Nach der Visitation vom J. 1534 wurden durch Vermittelung der Fürsten mit der Zeit sechs Commenden für sechs Priester gestiftet, welche täglich die "Zeiten" in der Heil. Bluts=Kapelle zu singen hatten. Neben diesen war ein sogenannter Ostensor angestellt, welcher täglich zwei Male das Heilige Blut zur Verehrung der Gläubigen zeigen mußte; von den Ostensoren sind bekannt geworden:
| 1503. | Laurentius Stoltenborch (s. Jacobi Rozstockcensis scholasticus et canonicus ac etiam sancti cruoris miraculosi in Sterneberch pro tempore ostensor). |
| 1514. | Johann Wilhelmi, Priester. |
| 1523. | Dietrich Pyl, Priester, † 1523. |
Zur Hebung des Gottesdienstes hatten auch die Herzoge eine Vicarei in der Heiligen Bluts=Kapelle gestiftet: die Fürsten=Commende (perpetua commenda sacelli sacrosancti sanguinis nostri redemptoris, in ecclesia parrochiali Sternebergensi, noviter instaurata, cuius jus patronatus ad nos et nostros heredes pertinet: nach Urkunden der Herzoge Heinrich und Albrecht vom J. 1523). Die Vicarien waren:
| 1514. | Heinrich Wittenburg, Priester. |
| 1522. | Dietrich Pyl, † 1523. |
| 1523. | Johann Crivitz, welcher noch 1541 als Pastor zu Cobrow lebte 1 ). |
Vielleicht waren die fürstlichen Vicarien auch oft Ostensoren.
Im J. 1503 ward von dem schweriner Dompropst und sternberger Pfarrer Johannes Goldenboge und dem Ostensor Laurentius Stoltenborch die Brüderschaft des Heiligen Blutes und S. Annen gestiftet, deren Mitglieder, beiderlei Geschlechts, ununterbrochene Gebete in der Kirche und in der Heiligen Bluts=Kapelle halten mußten ("ad orationes, quae in ecclesia parrochiali, necnon in capella sancti cruoris miraculosi continue fiunt"), um die Gebete der Pilger fortzusetzen und sie in Gemeinschaft mit dem Heiligen Blute zu erhalten.


|
Seite 221 |




|
In demselben Jahre 1503, am Tage der H. Gertrud, stiftete der Ritter Heinrich von Plessen auf Brüel Marienzeiten (horae canonicae ad laudem beatae Mariae virginis), welche im Anfange des 16. Jahrh. häufig in Meklenburg gegründet wurden, für die Kirche zu Sternberg, verbesserte die Commende in der Heil. Bluts= Kapelle und zog seine Stiftungen in eine Vicarei zusammen, welche er mit 97 Mark Hebungen und einem Hause dotirte 1 ).
Außer diesen Hauptstiftungen erhielt die Kapelle häufig kleinere Schenkungen und erfreute sich reicher Gunst von Leuten jeden Standes. Nach dem Visitations=Protocolle vom J. 1534 hatte die Kapelle für die 6 Commendisten, welche die "Zeiten" sangen, 3000 Mark Capital.
Mit der Zeit waren die bei der Kapelle angestellten Personen durch gewisse Hebungen schon so gesichert, daß zu ihrer Unterhaltung die Opfer nicht mehr zu Hülfe genommen zu werden brauchten. Daher erstrebten die Herzoge im J. 1515 durch ihren Procurator in Rom 2 ), den Domherrn Nicolaus Francke 3 ), ein päpstliches Privilegium zur Sicherung der mit den Prälaten des Landes schon einige Zeit lang getroffenen Uebereinkunft, daß von dem bei dem Heil. Blute zu Sternberg gespendeten Opfer der sternberger Pfarrer jährlich die bestimmte Summe von 100 Gulden haben, das Uebrige aber zur Unterstützung und Aufhelfung armer und verfallener Klöster und Kirchen und zur Unterstützung nothleidender Armen verwandt werden solle, und zwar durch die Landesherren mit Beirath der Capitel zu Schwerin und Rostock; fürs erste sollte dem Capitel zu Rostock nach Gutdünken noch etwas zufließen. Auch baten die Herzoge um Ablaß 4 ) beim Heil. Blut, welcher noch nicht verliehen war.
Bei dem großen Zudrange von Gläubigen geschah nun sehr viel für die äußere Ausstattung der Kapelle. Außer der prachtvollen Aufstellung der durchstochenen Hostien ward an einem Pfeiler vorzüglich die eichene Tischplatte befestigt, auf welcher die Juden in der Laube hinter Eleasars Hause die Hostien durchstochen hatten. Sie ward mit folgender Inschrift versehen:


|
Seite 222 |




|
Dit is de tafele dar de joden dat hillige sacrament up gesteken und gemartelet hefft tom Sternberge im jare 1492.
Darunter ward eine kleinere eichene Tafel befestigt, auf welcher die Verbrennung der Juden in erhabenen Figuren geschnitzt war. Diese Tafeln sind merkwürdiger Weise noch vorhanden, wenn auch sehr verstümmelt, obgleich 1659 und 1741 die ganze Kirche völlig ausgebrannt ist 1 ). Auch der verhängnißvolle Grapen, in welchen die Pfriemen gelegt wurden, mit denen die Hostien durchstochen waren, ward an der Mauer aufgehängt und hing hier bis zum J. 1638, wo ihn ein schwedischer Reiter wegnahm 2 ). Die Hostien wurden in einem aus Holz geschnitzten und bemalten und vergoldeten Tabernakel 3 ) aufbewahrt, welches so hoch war, als die Kapelle; es ging in dem großen Brande von 1741 unter: der bekannte Geschichtschreiber Franck kannte es noch 3 ). Den Altar ließen die Herzoge Heinrich und Albrecht 4 ) im J. 1516, wahrscheinlich bald nach der Stiftung der Fürsten=Commende, mit einem kunstreichen Schrein mit doppelten Flügeln verzieren. Auf den äußersten Seiten sollten zwei Patrone des Altars stehen und vor ihnen knieend die beiden Fürsten. Der erste Aufschlag sollte die Geschichte der Hostienmißhandlung, der letzte Aufschlag das Leiden Christi darstellen. Der Fuß sollte von durchbrochener Schnitzarbeit sein mit den Bildern der Patronen, alle Bilder auf Goldgrund. Die Ausführung übernahm der Maler Erhard, wahrscheinlich der Maler Erhard Altdorfer, welcher in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. in des Herzogs Heinrich Diensten 5 ) stand und von diesem im J. 1536 ein Haus in Schwerin geschenkt erhielt. Für die Arbeit, welche in fünfviertel Jahren vollendet sein sollte, erhielt er 150 Goldgulden 6 ). Endlich wurden die Fenster mit kostbaren Glasgemälden von "wunderbarer Schönheit" geschmückt, welche Franck ebenfalls noch im J. 1721 sah 7 ), darnach aber wohl der Brand von 1741 vernichtet hat.
Im J. 1505 hatten die Vorsteher der Kirche zu Sternberg, der Burgemeister Pyl, der Rathmann Brusehaver und der Kirchenvorsteher Barthold Pren, für den Hauptaltar der Kirche einen neuen Altarschrein in Wismar bestellt, worüber ebenfalls der Contract in Schröder P. M. II, S. 2750 gedruckt ist.


|
Seite 223 |




|
Der Zudrang von Gläubigen war während der Zeit der Blüthe des Instituts, an 30 Jahre hindurch, ungeheuer groß; je häufiger die Wunder waren, welche das Heilige Blut wirkte, desto größer ward der Zudrang der Pilger. Die Zahl der Weihgeschenke, Krücken, Abbildungen von geheilten Gliedern in edlen Metallen und Wachs, welche an den Wänden in dankbarer Erinnerung aufgehängt waren, war sehr bedeutend; noch im 17. Jahrhundert war eine Menge von dergleichen Dingen in der Gerwe=Kammer aufgestapelt. Die goldenen und silbernen Geschenke waren auf 6 Tüchern befestigt; außerdem hatte die Kapelle viele silberne Bildsäulen, heilige Gefäße und andere Kostbarkeiten 1 ). So hatte z. B. die Stadt Colberg im J. 1497 zur Dankbarkeit für die Rettung vom Sturme eine kleine Stadt aus Silber 2 ) und der Papst Leo X. im J. 1514 einen vergoldeten Kelch geschickt 3 ). Dazu gewannen die Kirche und das Kloster, welche in das Reich der Verehrung hineingezogen wurden, fast eben so viel an Geschenken, als die Heil. Bluts=Kapelle. Wie bedeutend aber der Verkehr für die Stadt sein mußte, geht aus einem Briefe 4 ) des Landvogts der Niederlausitz, Heinrich Tunkel, Herrn von Berinzkow, hervor, welcher im J. 1521 nach Sternberg wallfahrten wollte und sich dazu von dem Herzoge Heinrich einen Paß erbat; er schreibt, daß er bis in die funfzig Pferde mitbringen würde.
Die Herrlichkeit mit der Heiligen Bluts=Kapelle dauerte aber nicht lange. So wie die Reformation in Deutschland sich ausbreitete, blieben die Fremden aus; und in der nächsten Umgebung ward es auch sehr früh stille. Denn schon im J. 1524 wehrte der Prior des Augustinerklosters zu Sternberg, Johann Steenwyk, ein Freund Luthers, dem Aberglauben und schaffte "Evangelisten" ins Land 5 ). Mit dem Tode des Ostensors Dietrich Pyl 6 ) im J. 1523 erlosch der Glanz des Instituts und bald war das Heilige Blut vergessen. Das Augustinerkloster ward schon im J. 1527 aufgehoben. Am Dienstage nach Palmarum 1532 fragte der fürstliche Capellan Joachim Schünemann bei dem Herzoge Heinrich an, wie er es mit dem ewigen Lichte vor dem Heiligen Blute halten solle, denn es komme weder Opfergeld, noch Wachs: ("wenthe dar kumpth nyen offer, noch was, "offte ichtes wes, vnde de offer, de oltlynges dar kamen


|
Seite 224 |




|
zinth, werden na der tidt szer vorryngert"). Er klagt, daß nicht genug Horisten da waren; es seien noch einige arme Priester in der Stadt, diesen wolle man aber den Gottesdienst nicht gestatten. Seit 9 Jahren war keine Rechenschaft von dem Vermögen gegeben; Zinsen von den Capitalien wurden im J. 1534 von dem "Adel" auch nicht mehr bezahlt.
Die Verehrung des Heil. Bluts hörte im J. 1533
ganz auf. In diesem J. nämlich ward die
Reformation durch den lutherischen Prädicanten
Faustinus Labes vollständig eingeführt. Dieser
hatte nach der Klage des Herzogs Albrecht
"das Sacramenth und Heilig Blut daselbst
einen Teufel geheißen". In demselben Jahre
erschien des schweriner Prädicanten Egidius
Faber zornentbranntes Buch "Vom falschen
Blut und Abgott im Thum zu Schwerin", in
welchem er auch sagt: "Ich habe zu Justraw
vnd Sternberg gemarterte (wie man fürgibt)
Sacrament gesehen, - - woraus sie einen Teuffel
machen"
 . Unter solchen Umständen ging es
denn im J. 1533 mit der Verehrung des Heil.
Blutes zu Ende.
. Unter solchen Umständen ging es
denn im J. 1533 mit der Verehrung des Heil.
Blutes zu Ende.
Viel Aufhebens hat man davon gemacht, wo die mißhandelten Hostien geblieben seien. Ostern 1532 waren sie noch vorhanden und noch einige Geistliche dabei angestellt, aber schon bedeutend in Ungunst, da kein Opfer mehr einging. Bei der evangelischen Visitation im J. 1535 hatten die Visitatoren, Egidius Faber und Nicolaus Kutze, zu Sternberg nach dem "gemarterten Sacrament, wenn es noch vorhanden", zu fragen vergessen. Latomus 1 ) berichtet, der erste meklenburgische Superintendent Johannes Riebling habe im J. 1539 die Hostien dem ersten evangelischen Prediger Faustinus Labes gereicht und dieser sie "mit gebührender Andacht" genossen. Diese Sage ist in allen Schriften vielfach verbreitet. Auch Guzmer erzählt in seiner Schrift von den verbrannten Juden, 1629: "und hat der alte Burgermeister Hans Jordan, ein Mann von 85 Jahren, der ungefähr vor 16 oder 18 Jahren gestorben, berichtet, daß nach der Reformation der erste lutherische Prediger Dominicus genannt gedachte Hostien de novo in S. Marien=Kirche zu Sternberg consecrirt zu sich genommen und empfangen, aber bald darauf gestorben". Andere schreiben, die Hostien seien verbrannt 2 ) worden. Die Wahrheit zu ermitteln, ist beim Mangel an urkundlichen Nachrichten nicht möglich; jedoch ist es nicht glaublich, daß Labes die Hostien sollte genossen haben, nachdem er sie


|
Seite 225 |




|
öffentlich auf der Canzel Teufel genannt hatte. In dem Visitations=Protocolle vom J. 1541 heißt es:
"Er Anthonins Krüger ist verordent vor III jahren, das Sacrament anzuzeigen, welches ihme ein schwer ampt ist, wolte gerne daruon".
Wahrscheinlich waren im J. 1562 die Hostien noch vorhanden, da damals noch die Heil. Bluts=Kapelle in ihrer äußern Einrichtung bestand, allerdings ohne dazu angestellte Priester. Nach Schütz de vita D. Chytraei, 1720, II, p. 424, (vgl. Schröder Ev. Meckl. II, S. 340) sollen sich die evangelischen Prediger M. Thomas Holtzhüter und Johannes Jsensee zu Ribnitz bei den Herzogen Johann Albrecht und Ulrich über eine durch die Aebtissin Ursula begünstigte Wallfahrt nach dem Heil. Blute zu Sternberg ("religiosa peregrinatio a quibusdam Ribnicensium, veteri adhuc superstitione ductorum, Sternbergam ad idolum sanguinis Christi") bitter beschwert haben. Die Sache verhält sich auch wirklich so. Bekanntlich waren die Nonnen zu Ribnitz und Dobbertin auf keine Weise vom Papismus zu bringen, trotz aller persönlichen Bemühungen des Herzogs Johann Albrecht; endlich reisete er im Sept. 1562 noch einmal nach Ribnitz und Dobbertin, um den alten Sauerteig selbst auszukehren. Aber auch dies wollte nichts helfen. Die Nonnen von Dobbertin fanden Schutz bei der Wittwe des Herzogs Albrecht zu Lübz, die Nonnen von Ribnitz bei Herzogs Heinrich Tochter Ursula, welche Aebtissin zu Ribnitz war. In Ribnitz kam es noch zu ärgerlichen Auftritten und heftigen Reibungen, in deren Folge sich im J. 1565 die genannten evangelischen Prediger Holtzhüter und Jsensee schriftlich rechtfertigten; in der Original=Apologie derselben im großherzogl. Archive zu Schwerin heißt es nun:
"Zum dreizehenden hat J. f. g. im Jare 62 im Junio, der tag ist mir nicht eigentlich bewust, eine Walfart sieben Pilgrim gehen lassen nach dem Sterneberge, meiner Pfarrkinder, die nicht anders wissen, denn sei nicht viel daran gelegen. Vnd so es so gar böse gethan were, so solts J. f. g. auch wol wissen. Damit hat J. f. g. abgotterei getrieben, vnd gott an einen sonderlichen ort gebunden, dahin er sich selbs durch sein wort nicht verbunden hat".
Hiernach scheinen allerdings die Hostien noch im J. 1562 vorhanden gewesen zu sein, obgleich auch die alte Heiligkeit des Ortes die Papisten zu einer Wallfahrt veranlaßt haben könnte.


|
Seite 226 |




|
5. Das Augustiner Kloster
Der Herzog Magnus, ein eifriger Beförderer des Gottesdienstes und dessen Glanzes, so wie ein Beschützer der Künste, war aber nicht mit der landesherrlichen Pflege der Verehrung des Heiligen Blutes zufrieden, sondern wollte selbst ein wohlthätiges Opfer zur Verherrlichung des Wunders darbringen, - vielleicht die Härte des Gesetzes durch ein gutes Werk sühnen.
An der Stelle des Fürstenhofes, wo Peter Däne die Hostien vergraben hatte, bauete er bald nach dem Ereignisse aus eigenen Mitteln eine kleine Kirche oder Kapelle, vielleicht "Frohnleichnams=Kapelle (ecclesia corporis Christi)" genannt, und stellte bei derselben, ebenfalls aus eigenen Mitteln, Priester an, welche Massen lesen mußten. Auch an dieser Stelle geschahen häufige Wunder. In dieser Kirche war vorzüglich eine Darstellung des Heiligen Grabes mit einem Altare des Heiligen Grabes 1 ) Gegenstand der Verehrung; der Gottesdienst an diesem Altare drehete sich um einen Cyclus von Darstellungen aus der Geburt und Himmelfahrt Christi und der Jungfrau Maria. Auch führte der Convent des spätern Klosters im runden Siegel ein Grab, aus welchem Christus mit dem Oberleibe sich erhebt, die Wundenmale zeigend, an jeder Seite von einem knieenden Mönch angebetet, mit der Umschrift:
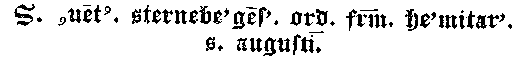
Auch der Prior des Klosters führte im parabolischen Siegel ein Grab Christi, unter welchem ein Mönch knieet.
Die Bulle des Papstes Alexander VI. vom 19. Septbr. 1500 sagt über die Kirche bestimmt:
Magni ducis Magnopolensis petitio continebat, quod ipse olim in opido suo Sterneberch, Swerinensis diocesis, vnam ecclesiam sub inuocatione corporis Christi de propriis bonis sibi a deo collatis alias legittime construi et edificari fecit et ad illam propter crebra miracula, que inibi in dies operatur altissimus, - - certos capellanos presbiteros, qui


|
Seite 227 |




|
missas et alia diuina officia in ipsa ecclesia celebrent, deputauit ac illis de congruo stipendio prouidit.
Hiemit nicht zufrieden, gründete der Herzog Magnus neben dieser Kapelle im J. 1500 ein Kloster Augustiner=Eremiten=Ordens, da er das musterhafte Leben, die Gelehrsamkeit und die bewährten Sitten dieses Ordens vorzüglich hoch verehrte um den Gottesdienst zu fördern und die Bewohner der Stadt und die Pilger durch die Predigten der Brüder zu erheben. Ein Kloster dieses Ordens existirte in Meklenburg und in den nächstgelegenen Ländern noch nicht 1 ); die Stiftung eines Klosters dieses Ordens, dem auch Luther angehörte und aus dessen Gelehrsamkeit zum Theil die Reformation hervorging, hat aber ohne Zweifel wohlthätige Folgen auf die Entwickelung der Reformation auch in Meklenburg gehabt. Da vor kurzer Zeit die Stiftung neuer Bettelmönchsklöster vom Papste Bonifacius VIII. untersagt war, so betrieb die Stiftung des Klosters in Rom mit Eifer und Glück im J. 1500 der bekannte Dompropst Peter Wolckow, später Bischof von Schwerin, welcher damals zu Rom lebte und sogar päpstlicher Secretair war 2 ); unterstützt ward dieser in seinen Bemühungen durch den M. Arnold Boddensem, Lehrer an der Universität zu Rostock, welcher sich damals ebenfalls in Rom aufhielt. Auch der Kurfürst Friederich von Sachsen erließ für den Herzog verwendende Schreiben (d. d. ex augusta urbe imperiali 4 Aug. 1500) an den Papst, das Cardinal=Collegium und den Cardinal Franziscus. Am 19. Sept. 1500 erließ der Papst Alexander VI. die Bestätigungsbulle 3 ), in welcher es im Verlauf der vorstehend mitgetheilten Worte ferner heißt:
Cum Magnus dux, qui ad fratres ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini regularis obseruantie propter earum exemplarem vitam et doctrinam ac alios comprobatos mores gerit singularem deuotionis affectum, consideret, quod si apud dictam ecclesiam construeretur et edificaretur vna domus cum officinis necessariis pro vsu et habitatione perpetuis fratrum ordinis et obseruantie predictorum, ex hoc


|
Seite 228 |




|
inibi diuinus cultus augmentum et religio propagationem susciperet ac ex ipsorum fratrum predicationibus et aliis - - incole - salubria monita - suscipere possent, - - - Nos igitur - - -, mandamus, - - quatenus - - apud dictam ecclesiam vnam domum cum campanili, campana humili, cimiterio, dormitorio, refectorio, claustro, ortis et ortaliciis
. - - pro vsu et habitatione fratrum predictorum construi et edificari
. -- concederet.
Peter Wolckow löste die Bulle ein und übersandte sie dem Herzoge durch den Propst von Broda, welcher sich in Rom eine Bestätigung der Kirchen=Patronate seines Klosters verschafft hatte 1 ). Am 7. Junius 1501 promulgirte der Bischof Johann von Schwerin, als dazu bestellter päpstlicher Executor, die Bulle zu Sternberg, in Gegenwart des bei der Sache sehr betheiligten schweriner Dompropstes M. Johann Goldenboge 2 ).
Für das Kloster interessirte sich besonders der Dr. Johann von Staupitz, General=Vicar des Augustiner=Eremiten=Ordens in Deutschland, Luthers bekannter Freund. Der Herzog ließ zwar den Klosterbau alsbald in Angriff nehmen, wozu er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Balthasar im J. (1502) mit dem tüchtigen Baumeister Andreas Techel einen Contract über den Bau des "Schlafhauses", d. i. des eigentlichen Klostergebäudes, abschloß 3 ), aber es ging mit dem Bau langsam. Am 22. Mai 1503 (d. d. Torgau Montag nach Vocem jocunditatis) schrieb des Herzogs Tochter Sophie († schon 13 Jul. 1503), welche dem Kurfürsten Johann dem Standhaften von Sachsen vermählt war, an ihren Vater: "Er Johannes von "Stawpitz doctor Augustiner ordens Einsideler genent" habe sie gebeten, daß das "Newe closter seins ordens zum Sternberg, von newes zu pawen angefangen vnd das noch merglichen mangel an gebewdt habe, mit nodturftigem gebewde volenbracht werden moge"; es wolle "auch der genant doctor, so erst er ander gescheft halben kan, dahin in das closter komen vnd auch sein Rat dar zu geben, wie solchs closter zu pawen vnd zu erhalten sein möge". Der Herzog Magnus starb aber schon am 20. Nov. 1503.
Der Bau des Klosters, welches noch gar nicht dotirt war, gerieth nun eine Zeit lang in Stocken. Noch im J. (1503)


|
Seite 229 |




|
war der Klosterbruder, Professor Dr. Johannes von Paltz 1 ) von Erfurt nach Meklenburg gekommen und hatte von dem Herzoge Magnus, in Gegenwart seiner Gemahlin Sophie († 26 April 1504) im Kloster Tempzin die Zusicherung erhalten, daß drei Viertheile 2 ) des Opfers (wahrscheinlich des Opfers, welches in der Kloster= oder Fronleichnams=Kapelle gegeben ward, da über die Opfer der Heil. Bluts=Kapelle schon bestimmt war,) zum Bau des Klosters verwandt werden sollten, und falls die Opfer nicht ausreichen würden, der Herzog selbst das Kloster bauen und dotiren wolle. Nach dem Tode des Herzogs Magnus kam (1504) der Dr. von Paltz wiederum nach Meklenburg, um das Kloster in Besitz zu nehmen; bei dieser Gelegenheit hatte ihm der Herzog Heinrich der Friedfertige, welcher fortan die Sache eifrig betrieb und bei der Einführung der Mönche thätig gegenwärtig war, die Vertröstung gegeben, der Orden solle sich auf ihn verlassen 3 ). Da aber der Bau keinen Fortgang nahm, so mahnte am 3. Febr. 1505 der Dr. von Paltz den Herzog an die Erfüllung seines Versprechens. Durch Unordnungen der übel versorgten Mönche war der schweriner Bischof Johannes von Thun, welcher die kirchliche Blüthe Sternbergs wohl neidisch ansah, unwillig geworden und hatte zur Beförderung des Baues grade nicht beigetragen. Zur Entfernung aller Hindernisse sandte Staupitz am 24. April 1505 zwei Väter seines Ordens, die Doctoren der Theologie Johannes Voyt und Johannes von Paltz, wieder nach Meklenburg an die Herzoge Balthasar und Heinrich. Etwas erreichten sie allerdings, indem der Bischof Johannes von Thun am 28. Aug. 1506 4 ) durch die Herzoge Balthasar und Heinrich bewogen ward, für sein Capitel zu Schwerin und das Capitel zu Rostock dem beim Heil. Blute zu Sternberg nach Vollendung der Capelle 5 ) in den Block fallenden Opfer zu zwei Dritttheilen auf ein Jahr zu Gunsten des Klosterbaues zu entsagen 6 ).


|
Seite 230 |




|
Aber erst nach dem Tode des Herzogs Balthasar († 7 März 1507) kam das Kloster völlig zu Stande, wahrscheinlich durch die vereinten Bemühungen des Herzogs Heinrich und seines Canzlers Caspar von Schöneich, welche jetzt für die Stiftung thätig erscheinen. Jetzt erst erhielt das Kloster von den Herzogen Heinrich und Albrecht einen Stiftungsbrief, in dessen leider nicht datirtem Concept 1 ) es heißt:
Wir Henrich vnd Albrecht gebroder
. thun kund, Nachdem vnd also bey zceiten vnsers hern vaters loblicher vnd seliger gedechtnisse hertzogen Magnus als man schreib 1492 die schnoden jodden bynnen vnser stadt Sternbergk das
. sacrament - gemartertt - - haben, - - zum letzten durch hern Peter Dehen - - vorkauffet, auff unserer vorfallenen wonunge hoffestadt vnerlich begraben worden ist, - so hadt vnser her vater obgenant auff die stede vorgedachts begrepnisse eyne capelle gebawet vnd die selbige capelle mit vnserer hoffstadt, sampt andern hoffstetten vnd reumen dortzu gekomen, dem heiligen orden vnd broderen sancti Augustini zu einem nyen klostere in krafft einer bebstlichen bullen, gothe dem allmechtigen, dem heiligen sacrament, sanct Marien, sanct Augustin vnd allen heiligen zu ewigem lob vnd eren gegeben vnd geeigent, mit zcusage, den selbigen brüderen zum bawde vnd aller irer nodturfft beh
lfflich zu wesen, daz dann vnser her vater vnd wir vnsers vormugens gethan haben vnd noch furder zu thun willigk seint, - - so haben wir den Raum vnd platz, dar auf sie wonendt, - - entledigt vnd frey, loess dem orden der einsedelerbrudere sancti Augustini vbergegeben.


|
Seite 231 |




|
Zugleich verliehen die Herzoge den Mönchen die Freiheit des Marktes, des Wassers und der Weide und alle Bürgerfreiheit, den Mühlenkamp vor der Stadt, die Leitung des Stadtgrabens durch das Klostergebiet ("das waszer hindere deme klostere im stadgraben flieszend in daz kloster zcu bawen, wan sie daz vormugen"), die Metzenfreiheit von ihrem Mahlkorn, die Goldbeck zum Aalfange und alle Quatember 4 Pfd. Wachs von den Opfern des Heil. Blutes von dem Ostensor desselben.
Jetzt ging der Bau rascher. Die Herzoge thaten wohl dazu das Ihrige, der Block in der Heil. Bluts=Capelle ward zum Bau geöffnet (da "prior vnd couent des klosters etzlichen mangel zu dem furgenommenen baw" hatten,) und das Kloster schickte zwei Mönche mit herzoglichen Empfehlungsschreiben nach Dänemark, um dort zur "Aufnehmung" des Klosters zu sammeln.
So ward das Kloster denn auch bald fertig. Es lag nach den oben angeführten Stiftungs=Urkunden an der Stelle des verfallenen fürstlichen Schlosses und Hofes zwischen der Mühlenstraße, der Ritterstraße und der Stadtmauer, am Mühlenthore, der Pfarrkirche schräge gegenüber. Nach den Inventarien vom J. 1621 1 ) bestand das Kloster aus folgenden Gebäuden. Im Hofe stand die Klosterkirche oder Kapelle, an der Stelle wo die Hostien vergraben gewesen waren, ein starkes massives Gemach, mit einem westlichen Giebel thurmartig wie eine Kirche aufgemauert 2 ). Daneben stand das eigentliche Kloster, auch wohl Wohnhaus oder Schlafhaus genannt, ein massives Gebäude von 2 Stockwerken, mit 6 Kellergewölben unter und 6 Gewölben über der Erde; im ersten Stock war der gewölbte Reventer mit 6 Fach Fenstern; darüber im zweiten Stock, zu welchem eine steinerne, gewölbte Treppe führte, 12 Zellen ("Gemächerchen"), 6 an jeder Seite. Im J. 1621 war das Haus für den fürstlichen Beamten Hans Joachim Grabow durchgebauet und eingerichtet. Nach der Reformation muß der Herzog Ulrich das Gebäude an sich genommen und erweitert haben; denn im J. 1621 stand "Herzog Ulrichs Gemach auf der Stadtmauer 3 ) übergebauet". Neben dem Kloster waren Wirthschafts=


|
Seite 232 |




|
gebäude, wie die Küche vor dem Kloster am Platze. Der Garten erstreckte sich an der Stadtmauer gegen Osten hin bis an das Mühlenthor und die Thorbude. An der Mühlenstraße neben der Thorbude stand der "Lange Stall". An der Ritterstraße stand von der Mühlenstraße her zuerst das "Bauhaus", etwas eingerückt, dann an der Straße der "Lange Reitstall", ein großes Gebäude von 17 Gebinden, welches zugleich Thorhaus war, und die Scheure bei der Stadtmauer. Die Wirthschaftsgebäude waren zum Theil wohl von dem Herzoge Ulrich aufgeführt; so hatte das Bauhaus an jedem Giebel "zwei meklenburgische Wappen".
Ungefähr vom J. 1510 an war das Kloster vollständig eingerichtet. Im J. 1513 stiftete Margarethe von Quitzow, des Vicke von Quitzow auf Gr. Voigtshagen Gemahlin, mit ihren Kindern, namentlich ihrer Tochter Margarethe, Gemahlin Jaspars von Oertzen auf Roggow, Messen und Lichter 1 ) in der Klosterkirche. Beide Frauen hatten die Kirche reich mit Meßgewändern beschenkt 2 ).
Nach einem Berichte des Visitators vom J. 1520 3 ) lebten in dem Kloster 15 Mönche unter einem Prior. Von den Prioren sind nur bekannt geworden:
| 1513-1514. | Dietrich Kaltofen. |
| 1524. | Johann von Steenwyk. |
Wahrscheinlich hat das Kloster anch nicht mehr Prioren gehabt.
Im J. 1513 waren die Klosterbeamten 4 ):
| 1513. | Dietrich Kaltofen, Prior. |
| Heinrich von Immenhusen, Subprior. | |
| Johann von Steenwyck, Küster. |
Das Kloster blühete nun so rasch auf, daß es den Neid der übrigen Geistlichkeit in dem Maaße erregte, daß es zu heftigen Auftritten kam. "Aus der prister zu Sternberg altem haß und auch wolbekanter abgunst" hatte die sternberger Geistlichkeit den Schulmeister Andreas Windbek (genannt auch "An-


|
Seite 233 |




|
"dreas Libory de Gardeleue, clericus Haluerstadensis diocesis, rector scolarum in Sterneberg"), einen wilden Menschen aufgehetzt, welcher den Prior und die Klosterbrüder überall mit Schmähungen und Drohungen, ja mit Waffen verfolgte. Als der Klosterconvent ihn bei seinen geistlichen Vorgesetzten verklagte und einen Tadel seines Benehmens erwirkte, drang er um die Mitte Junius 1514 trunken und bewaffnet in die Klosterkirche, als der Convent eben Vesper hielt, und störte mit den fürchterlichsten Drohungen den Gottesdienst. Die Mönche aber ergriffen ihn, torquirten ihn ein wenig und legten ihn in Fesseln in den Thurm. Gegen Leistung der Urfehde kam er frei. Der Bischof Peter Wolckow von Schwerin nahm sich der Geistlichkeit an und that das Kloster wegen geübter Gewalt gegen einen Geistlichen am 15. Julius ohne Untersuchung in den Kirchenbann. Der Orden aber, namentlich der General=Vicar Staupitz, protestirte gegen das offenbar gereizte Verfahren des Bischofs und appellirte an den Papst. Auch der Herzog Heinrich nahm sich der Mönche an, die er achtete, machte dem Bischofe Gegenvorstellungen, forderte die Bewohner der Stadt Sternberg auf, die Klosterbrüder, als "fromme geistliche Personen", nach wie vor zu achten und ihren Gottesdienst ungestört fortzusetzen, vertröstete den Prior auf kurze Zeit, wandte sich an den Erzbischof von Magdeburg, als vom Papste geordneten Conservator des Ordens in deutschen Landen, mit der Bitte, den kurzen Proceß zu cassiren und den Bischof, der "vielleicht aus einem verhetzten oder hitzigen Gemüthe" gehandelt habe, auf dem Wege geistlichen Rechtes zu belangen, und instruirte über alle Schritte den Dr. Staupitz. Wie gewöhnlich, gelang es dem Herzoge Heinrich dem Friedfertigen, den Zwist in Güte beizulegen, und am 10. Sept. 1514 hob der Bischof den Bann wieder auf.
Am 25. Nov. 1520 visitirte 1 ) der Vicarius Wenzeslav Linck das Kloster, fand es mit 15 Mönchen besetzt und wohlgeordnet und bat den Herzog Heinrich um fernere Gunst und um Anzeigung der etwanigen Mängel.
Nach wenigen Jahren machte sich auch in Meklenburg die Kirchen=Reformation geltend, welche, wie durch den Augustiner Orden überhaupt, so in Meklenburg auch durch das Kloster zu Sternberg befördert ward. Der Prior Johann Steenwyk war strenge reformatorisch gesinnt und suchte den Aberglauben auszurotten. Luther schickte ihm daher am 24. Julius 1524 einen Prädicanten, Hieronymus von Enkhusen, für den Herzog Heinrich, welcher Luther um "Evangelisten" gebeten hatte 2 ). Da in


|
Seite 234 |




|
Sternberg die katholische Geistlichkeit noch lange in ihrer alten Verfassung bestand, die Reformation erst im J. 1533 durchdrang und hier nicht gewaltsam durchgeführt ward, so muß die Reformation von dem Kloster selbst ausgegangen sein. Der Prior heirathete, da nach der Fortsetzung des Inventarium von 1534 1 ) des "Priors Frau" im J. 1537 aus dem Kloster gewiesen ward. Schon im J. 1527 1 ) ward das Kloster aufgehoben, oder wahrscheinlich von den Mönchen freiwillig verlassen, und der gesammte bewegliche Besitz desselben aufgezeichnet und in Sicherheit gebracht. Im J. 1535 beorderte der Herzog Heinrich, "etzlich geschütz nach dem Sternberg zu fhuren und in die Mönchkirch zu stellen".
So ging das Kloster nach 25 Jahren seines Daseins unter. Auch die Gebäude gingen unter widrigem Geschick rasch ihrem Untergange entgegen. Nach der Reformation war das Kloster zunächst Wohnung der herzoglichen Beamten. Im J. 1608 gab der Herzog Carl dem Zöllner Georg Lehmann das Vorhaus auf dem Kloster zur Bewohnung auf Lebenszeit unter der Verpflichtung, die übrigen Gebäude in Aufsicht zu haben. Im J. 1621 wurden die Gebände inventirt 2 ); jedoch ward schon im J. 1625 berichtet, daß das Kloster sehr verfallen sei. Der Reitstall fiel im J. 1632 über die Hälfte ein; bei dieser Gelegenheit wurden die Spoliationen an den Häusern, Zäunen und Gärten verboten. Im Winter desselben Jahres lagen die Gebäude voll Schnee, da sie keine Fenster mehr hatten: sie sollten mit Luken versehen werden. Die fürstlichen Beamten hatten ihren Rückzug nach dem nahen Dorfe Pastin 3 ) genommen. Im J. 1637 sollten die Wohngemächer und Ställe auf dem Klosterhofe gereinigt werden, da sie zum Landtage benutzt werden sollten. In dem großen Brande der Stadt von 1659 brannte auch das Kloster mit allen zur Wiederherstellung desselben angeschafften Materialien ab. Die Prediger nahmen nun ihre Zuflucht auf einige Zeit in das Gebäude, nachdem es notdürftig eingerichtet war. Seit dieser Zeit stand das Kloster unter der Aufsicht des fürstlichen Stadtvogtes. In den Jahren 1691 und 1695 schlug der Blitz in das Gebäude und das Dach herunter. Hiedurch ward das Kloster völlig Ruine. Im J. 1697 wollten die in der Stadt Sternberg wohnenden adeligen Personen den Klosterhof umpflügen und mit Leinsamen besäen, auch die einzelnen


|
Seite 235 |




|
Stellen umzäunen lassen, da ihnen dies der Pfandträger des Amtes, der Oberstlieutenant v. Zülow, erlaubt hatte. Der Stadtvogt Heinrich Achilles Schaller mußte dies aber untersagen, um so mehr da die Beackerung auch "Abbrechung der Steine aus dem Kloster" mit sich führen würde. Als den fürstlichen Beamten im J. 1715 ein neues Amtswohnhaus zu Pastin erbauet 1 ) ward, nahm man die Steine dazu von den Klostergebäuden. Seit dieser Zeit lagen nur noch geringe Ueberreste von dem Kloster auf dem Klosterhofe. In den J. 1724 und 1736 wurden von sternberger Einwohnern verschiedene Versuche gemacht, auf dem Klosterhofe Gebäude aufzuführen; erst im J. 1737 ward der alte Klosterplatz zur Bebauung an der Mühlenstraße unter dem Herzog Christian Ludwig von der Kammer dem Mühlenpächter Grosse verkauft, welcher hier zuerst eine Scheure aufführte. Seitdem ward der Platz an der Mühlenstraße und seil 1843 an der Ritterstraße mit Häusern bebaut. Mit demselben J. 1843 gingen alle auf dem Klosterhofe liegenden Grundstücke, welche bis dahin unter fürstlicher Amtsgerichtsbarkeit gelegen hatten, in den Stadtverband über, und hiemit verschwand jede Spur von dem ehemaligen Dasein eines Schlosses und Klosters in Sternberg.
6. Die sternberger Geistlichkeit
im 16. Jahrhundertund
die Reformation.
Katholische Pfarrer.
Bei dem großen Ansehen, welches Sternberg im Anfange des 14. Jahrh. durch die fürstliche Residenz, und seit dem J. 1492 durch das Heil. Blut erlangte, war es sehr natürlich, daß die Stadt eine große und reiche Geistlichkeit hatte und die Geistlichen vorherrschend angesehenen adeligen oder Patricier=Familien angehörten oder sonst verdiente und bedeutende Männer waren. Daher nahm aus diesen Gründen auch die Reformation in Sternberg einen eigenthümlichen Charakter an.
Im J. 1450 war Heyne von Lewetzow Pfarrer zu Sternberg (dominus Heyno de Leuezowe rector parrochialis ecclesie in Sternberg).


|
Seite 236 |




|
Vielleicht unmittelbar darauf folgte der Magister Johann Goldenboge, ebenfalls aus einem rittermäßigen Geschlechte Meklenburgs, Dompropst zu Schwerin, Domdechant zu Bützow, Domherr zu Güstrow und Rostock, ein Mann, welcher in der Geschichte des Heiligen Blutes bedeutend wirkte 1 ). Er kommt sicher 1479-1503 vor, zuerst als Domdechant zu Bützow und Domherr zu Güstrow, als Pfarrer zu Sternberg jedoch nur im J. 1503.
Im Anfange des 16. Jahrh. wird ein gewisser Christoph Pfarrer zu Sternberg (er Christoffer kerkhere tom Sternberge) in einem nicht datirten Schreiben genannt. Dieser Pfarrer Christoph hatte "eynen capellan er Peter Slise genant, de touorn to Groten-Dessin kerkhere gewest".
Im J. 1511 wird Michael Hildebrand, wieder ein bekannter Mann, als Pfarherr von Sternberg genannt. Er war im J. 1509 des Herzogs Albrecht Capellan und Secrctair und besorgte für diesen Geschäfte aller Art, selbst Waareneinkäufe. Im. J. 1509 ging er für den Herzog nach Rom 2 ), wo er noch im J. 1513 sich aufhielt (vgl. Jahrb. IV, S. 195) und während dieser Zeit die sternberger Pfarre zugesichert erhielt. Am 1. Sept. 1510 war er, "Michael Hiltprand, clericus Constanciensis diocesis", zu Rom beim Cardinal Bernhardin Zeuge in einigen Ablaßbriefen für Achim Hahn auf Basedow. Im J. 1511 und 1513 wird er Pfarrherr von Sternberg genannt. Im J. 1511 war er, "ytzund zum Sternberg kircherr", in Rom verschollen. Schon am 25. Jan. 1511 halten daher die Herzoge dem bekannten Peter Sadelkow 3 ), Domherrn zu Schwerin und Güstrow, die sternberger Pfarre unter der Bedingung verliehen, daß er sie auf Begehren einem andern wieder abtrete 4 ). Am 2. Julius 1511 kam auch der Dr. Busso von Alvensleben aus Calwe, welchem die Herzoge bei einem Besuche der brandenburgischen Markgrafen zu Schwerin, in deren Gefolge er gewesen war, ein Lehn versprochen hatten, und bat um die Pfarre, ebenfalls unter der Verpflichtung zur Resignirung, nämlich
"dat j. f. g. my de karken tome Sterneberghe, dewile dat me nicht weidt, wer j. f. g. cappellan, de na Rhome is vpge-
"I c XL gulden her Michael Hildebrandt, hertich Albrechts Capellan, therynghe nach Rome vnd anders dar van vttorichten. Donredages na Quasimodogeniti".


|
Seite 237 |




|
tagen, ifft he leuendich efft dodt is, gnedich muchten vorleghen, wolde ick vp syn ansokendt, soverne he noch im leuende were, de karken wedder gans vorlaten, - - - vnde so befunden worde, dat j. f. g. cappellan, dem de kerke is togesecht, im leuende were vnde de karken van j. f. g. vorderde, will ick j. f. g. de kerken van stund sunder alle myddel gans wedder fry vorlaten".
Beide kamen jedoch nicht zum Besitze der Pfarre; denn Michael Hildebrand erschien wieder unter den Lebendigen und war schon im J. 1515 1 ) und noch im J. 1532 als herzoglicher Secretair am Leben. Im J. 1514 war Heinrich Wahmkow "Capellan anstatt des Kerkherrn". Noch im J. 1524 hatte Michael Hildebrand, "als Kerkherr zu dem Sternberge", Streit 2 ) mit einem seiner Vicare, dem Antonius Schröder, welcher Pfarrer zu Parchim war, wegen versprochenen Lohns; dieser Streit ward jedoch in demselben Jahre durch herzogliche Commissarien beigelegt.
Auf Michael Hildebrand folgte im J. 1527 der Dr. Heinrich von Bülow. Er war im J. 1505 zum Scholaren des Stiftes Schwerin aufgenommen, auf der Universität zu Frankfurt a. O. von dem Bischofe Dietrich von Bülow zu Lebus bis zum J. 1514 unterhalten und darauf von diesem zu Vollendung seiner Bildung nach Rom geschickt, wo er Doctor der Rechte ward 3 ). Er ward darauf Domherr zu Schwerin; im J. 1533 wird er als solcher namentlich aufgeführt. Die Pfarre zu Sternberg ward ihm im J. 1527 4 ) von dem Herzoge Albrecht verliehen. In der Zeit von 1534-1538 war er auch Propst des Klosters Malchow, nachdem der alte Propst Johann Grabow resignirt hatte. Nach der evangelischen Visitation vom J. 1535 war "Doctor Bülow ein ungeschickter Kirchherr zu versorgen und zu speisen seine Schafe, und ein offenbarer Hurer, wie ganz Sternberg wisse". Da unter ihm die Reformation in Sternberg vor sich ging, so war seine Stellung allerdings von Wichtigkeit. Er starb nicht lange vor Ostern des J. 1538.
"Nachdeme dasselb jüngst bey Er Micheln nicht ausgericht ist wurden, wirt befolhen, ein solch priuilegium zu irlangen".


|
Seite 238 |




|
Der letzte katholische, oder halbkatholische, Pfarrherr war Johann Sperling aus der bekannten adeligen Familie, ein Mann nicht ohne historische Bedeutung, da er der Erzieher und Lehrer der Söhne des Herzogs Albrecht, also der Prinzen Johann Albrecht und Ulrich, gewesen war 1 ). Sowohl dies, als die Person des Johann Sperling ist bisher nicht bekannt gewesen 2 ). Am 25. Mai 1538 verlieh ihm der Herzog Heinrich auf Bitten seines Bruders Albrecht die durch den Tod des Dr. v. Bülow erledigte Pfarre, obgleich er dieselbe einem andern zugesagt, weil Johann Sperling von Adel und des Herzogs Albrecht "junger Herrschaft Zuchtmeister und Präceptor" sei. Er wird hierauf in der Visitation vom J. 1541 und noch 1552 genannt: "Johannes Sperling, habitat in Sterneberg, vicarius ecclesiae Swerinensis"; er war also zugleich Vicar am Dome zu Schwerin 3 ). Johann Sperling war also bis zur völligen Durchführung der Reformation Pfarrer zu Sternberg.
Während der Zeit des Pfarrers Johann Sperling kommen noch zweiVicare vor, welche aus der katholischen Zeit herüberstammten und mit der Zeit wenigstens äußerlich, wie der Pfarrherr, dem Drange der Reformation folgten, aber keineswegs lutherischen Geist und lutherische Bildung hatten: Antonius Schröder und Johannes Crivitz.
Antonius Schröder war zuerst Pfarrer an der S. Georgen=Kirche zu Parchim, welche ihm nach der Visitation vom J. 1534 im J. 1511 verliehen war; er hatte zugleich, sicher im J. 1529, eine rostocker Dompräbende. Schon im J. 1521 hatte ihn der Herzog Heinrich nach Rostock versetzen wollen 4 ). Er war der Reformation im Herzen nicht geneigt, sondern suchte im Stillen die katholische Lehre zu bewahren und im Falle der Einführung der Reformation, welcher der Rath zu Parchim sich zuneigte, Aufruhr zu stiften. Bei der evangelischen Visitation vom J. 1535 5 ) gab er aber noch im letzten Augenblicke nach und erklärte, er wolle alles annehmen und sich mit Rath und Bürgern brüderlich und christlich vertragen. Der Herzog Heinrich hielt aber die Wirksamkeit eines Mannes, welcher nur der Gewalt nachgegeben hatte, in einer so großen Stadt, wie Parchim, für sehr bedenklich. Er vermochte also am 18. Sept. 1537 den


|
Seite 239 |




|
Antonius Schröder zur freiwilligen Entsagung und pensionirte ihn mit 25 Gulden jährlichen Gehalts und einem Hofkleide, mit dem Versprechen, ihm die Pfarre wiedergeben zn wollen, wenn sein Nachfolger vor ihm sterben sollte 1 ). Die parchimsche Pfarre aber gab der Herzog dem zum ersten Superintendenten des Landes berufenen Johann Riebling. Antonius Spröder ging nun nach Sternberg, wo er eine Vicarei besaß; schon im J. 1524 hatte er mit dem sternberger Pfarrherrn Michael Hildebrand, dessen Capellan und Vicar er war, Streit über seine Besoldung 2 ), und im J. 1534 hatten ihn die Herzoge neben dem Priester Johann Meyne, Pfarrer zu Malchin und Vicar zu Sternberg, zur Aufhebung des Klosters nach Sternberg geschickt 3 ). Im J. 1545 war er neben Johannes Crivitz wirklicher Vicar des Pfarrers zu Sternberg 4 ).
Johannes Crivitz war zu gleicher Zeit mit Antonius Schröder, im J. 1511, als Pfarrer zu Cobrow bei Sternberg angestellt 5 ). Ungefähr seit dem J. 1522 besaß er auch eine der herzoglichen Commenden in der Heil. Bluts=Kapelle und das Lehn des S. Johannis=Altars in der Kirche zu Sternberg 5 ). Bei der Visitation im J. 1541 ward er ziemlich gelehrt befunden; er hatte aber noch eine Concuine, die er jedoch zu heirathen versrach 6 ). Im J. 1545 war er neben Antonius Schröder wirklicher Vicar des Pfarrers zu Sternberg 7 ).
Aus der Conservirung dieser beiden Capellane oder Vicare zu der Zeit des Johannes Sperling ging die spätere Anordnung der Geistlichkeit zu Sternberg 8 ) hervor, welche aus einem Pfarrer, einem Capellan (oder zweiten Prediger) in Sternberg und einem zweiten Capellan, welcher zugleich Pfarrer zu Cobrow war, bestand, bis späterhin die Pfarre zu Cobrow einging.


|
Seite 240 |




|
Die Reformation in Sternberg.
Durch die besondere Bedeutung, welche die Stadt Sternberg durch das Heilige Blut während der Entwicklung der lutherischen Reformation gewonnen hatte, erhielt hier die Reformation auch einen besondern Charakter. Nirgends, außer in Rostock, entwickelte sich die Reformation in Meklenburg früher, fast nirgends hielten sich Papisten länger, als in Sternberg. Bevor aber der Verlauf der Reformation in Sternberg erzählt werden kann, müssen die bisherigen Angaben geprüft werden.
Die bisherige Literatur über die Reformation in Sternberg ist äußerst dürftig. Als der erste evangelische Prediger wird von Franck ein gewisser Georgius Pren angegeben; dieser soll im J. 1537 neben Faustinus Labes an der Pfarrkirche gestanden haben, welchem der Superintendent Riebling die gemarterten Hostien gereicht haben soll 1 ). Diese Angaben des ehemaligen sternberger Predigers Franck sind allgemein angenommen und in die übrigen geschichtlichen Werke übergegangen. Georg Pren soll Armuth halber die Stadt verlassen haben. Franck leitet ihn von der adeligen Familie Pren her. Franck schließt also: "Es war in Sternberg ein evangelischer Prediger "Namens Georg Pren (Herr Jürgen), der alhie zu Hause gehörete. Es war damals hier ein Burgermeister Namens Simon Pren, welcher das adeliche Wappen der Preenen geführet und vielleicht dieses Georgii Bruder gewesen. Das Haupt der papistischen Priesterschaft hieß Nicolaus Giesenhagen, der sich Ao. 1505 schon Pastor nannte, endlich aber doch auch auf die evangelische Seite trat; wie solches alles aus einem Visitations=Protocoll von 1572 erhellet". Auf Georg Preen läßt Franck unmittelbar den Dr. David Bramerus folgen, welcher erst 1568 Prediger ward.
Diese ganze Geschichte ist ein reines Luftschloß. Abgesehen davon, daß Nicolaus Gisenhagen um das J. 1555 (nicht 1505) der erste wirkliche lutherische Pfarrer und durch und durch lutherisch war, besteht alles übrige aus Schlüssen, welche kaum glaublich erscheinen. Georg Preen hat nie existirt! Er wird nirgends genannt, weder in gedruckten, noch in ungedruckten Acten. Franck zieht alle seine Schlüsse allein aus dem - Visitations=Protocolle


|
Seite 241 |




|
von 1572. Hier steht nun zwar die Stelle, auf welche allein Franck sich stützt, wo von 8 ßl. Hebungen aus den Marienzeiten die Rede ist:
"Dieß ist außgeloset vnd Gisenhagen vnd her Jürgen gegeben worden".
Eine andere Bemerkung lautet:
"Zu den Lehnen S. Gertrudis, exulum vnd ander, so - Jürgen behendigt".
Wahrscheinlich ist von einem Stipendiaten die Rede; sicher aber darf man nicht aus einer Rentenverwendung im J. 1572 auf das Jahr 1532, also 50 Jahre, rückwärts schließen. Allerdings hatten die Preen auf Witzin in frühern Zeiten viel Einfluß in der Stadt Sternberg; aber es gab hier auch eine bürgerliche Familie Preen: ein Bürger Hans Preen führte 1572 im Siegel ein von zwei Pfriemen im Andreaskreuze durchstochenes Herz.
Diese ganze Geschichte mit dem Namen Pren ist also reine Einbildung von Franck. Die Sache verhält sich in der That auch ganz anders.
Die Reformation in Sternberg ging von dem Augustinerkloster aus. Die Augustinermönche waren überhaupt eifrige Reformatoren, wie ihr ehemaliger Ordensbruder Dr. Martin Luther. In Friedland und Neu=Brandenburg predigten 1525 zuerst Augustinermönche 1 ) aus Anklam lutherisch 2 ), auch bei den Rieben zu Galenbeck hielt sich ein "verlaufener Mönch" auf; im August 1524 waren die Augustinermönche Johann Kalpfleisch oder Schreiner zu Grimma und Wolfgang Zeschow weltliche lutherische Prediger geworden und wurden von dem Bischofe von Merseburg aus der Clerisei gestoßen 3 ).
In Sternberg war es vorzüglich der Prior des Augustinerklosters, Johann Steenwyck, welcher die Reformation in Meklenburg beförderte. Schon am 11. Mai 1524 schrieb Luther an Spalatin: die beiden Herzoge von Meklenburg bitten um evangelische Prädicanten (petunt evangelisias), der eine durch Hans Löser 4 ), der andere durch den Prior zu Sternberg 5 ). Am 24. Julii 1524 schrieb nun


|
Seite 242 |




|
Luther selbst an den Prior und sandte ihm den "Bruder" Hieronymus von Enckhusen für den Herzog und gab ihm seine Freude darüber zu erkennen, daß er dem Aberglauben das Maul stopfe, mit dem Wunsche, daß die Erkenntniß Christi in seinem Kreise wachsen möge 1 ). Der Prior wirkte für den Herzog Heinrich.
Schon im J. 1527 ward ein Inventarium des Klosters aufgenommen; die kostbaren Altargeräthe wurden in die Sakristei der Pfarrkirche in Verwahrung gesetzt, die Meßgewänder und Bücher wurden im Chor des Klosters verschlossen, das baare Geld behielten die Mönche 2 ). Die Mönche blieben also einstweilen, wenigstens zum Theil, im Kloster wohnen, gaben aber ihren Gottesdienst und das Klosterleben auf. Nach dem Inventarium von 1534 hatte der noch im Kloster wohnende Prior geheirathet, da der Rath des Priors Frau im J. 1537 aus dem Kloster wies, als es völlig geschlossen ward. Diese Aeußerung der Reformation ist in Meklenburg einzig in ihrer Art.
Um diese Zeit äußerte sich die allgemeine Theilnahme der Laien "von Adel und Bürgern" an der Reformation in Meklenburg durch die - Zurückhaltung der Zinsen und Pächte von den geistlichen Capitalien und Gütern! Dies ward allerdings bedenklich, und die Herzoge mußten ein landesherrliches Einsehen thun. Aber diese Zurückhaltung war schon so tief eingerissen, daß mit den Einzelnen gar nicht mehr zu verhandeln war, so groß war ihre Zahl. Die Herzoge beriefen daher ihre Landstände nach Sternberg zu einer Art von Convocationstag zusammen und vermittelten hier am Sonntage Quasimodogeniti, am 8. April 1526, einen Vergleich auf den compromissarischen Spruch der Herzoge: daß der Zinsfuß von geistlichen Gütern auf 4 Procent herabgesetzt, dann aber die Zinsen und Pächte regelmäßig gezahlt werden sollten. Trotz des Vergleiches protestirten jedoch hinterrücks die "gemeine Clerisei und Priesterschaft des Fürstenthums Mecklenburg und anderer dazu gehörender "Lande" bei Kaiser und Reich gegen die Herabsetzung des Zinsfußes, als eine widerrechtliche Spoliation. Die Herzoge sagten aber dem Kaiser, sie hätten sich zur Erhaltung des Gottesdienstes in diese gütliche Unterhandlung eingelassen, um in diesen schweren Zeitläuften zwischen den Geistlichen und Weltlichen Widerwillen und Nachtheil zu verhüten, und die Geistlichkeit habe den Vertrag freien, guten Willens angenommen; nach alter Weise habe es nicht mehr gehen können, denn die Geistlichkeit habe mit mannigfaltigen, harten und wucherischen Contracten und unbilligen,


|
Seite 243 |




|
ungewöhnlichen Zinsen viele Jahre her wider Recht
und alle Billigkeit die Leute beschwert, habe
alle Verschreibungen ohne Wissen der Obrigkeit
auf die Grundstücke ausgeschrieben, dazu noch
Bürgen stellen lassen
 . Uebrigens habe sich nicht die
Geistlichkeit über die Herabsetzung des
Zinsfußes beklagt, sondern der schweriner
Domdechant Dr. Johann Knutzen
1
) habe ohne
Auftrag eigenmächtig im Namen der Clerisei die
Klage angebracht.
. Uebrigens habe sich nicht die
Geistlichkeit über die Herabsetzung des
Zinsfußes beklagt, sondern der schweriner
Domdechant Dr. Johann Knutzen
1
) habe ohne
Auftrag eigenmächtig im Namen der Clerisei die
Klage angebracht.
Dieser sternberger Vergleich ist freilich höchst interessant; aber er kam schon zu spät: es halfen nicht Vergleiche und Klagen mehr. Es ging in dieser Zeit bei weitem der größere Theil des später erworbenen geistlichen Vermögens, welcher in Privathänden war, spurlos verloren; den großen Grundbesitz der Klöster, welcher meist von den Landesherren gekommen war, nahmen diese bald darauf wieder an sich und suchten das feste Vermögen der Pfarren bei Zeiten möglichst zu retten. Auch in Sternberg gab es bald keine Renten und Opfer mehr, wenn auch der Vergleich in Sternberg geschlossen war. Noch im J. 1845 fanden sich sternberger geistliche Obligationen in Hamburg wieder 2 ).
Die Reformation machte in den nächsten Zeiten in Sternberg keine bedeutenden Fortschritte. Die Augustinermönche schwiegen und gingen davon, und im J. 1527 erhielt Sternberg in dem Dr. Heinrich von Bülow einen strenge papistischen Pfarrherrn. Aber die Theilnahme am Alten verlor sich ganz; im J. 1532 gab es kein Opfer mehr bei dem Heiligen Blute.
Da begann in dem wichtigen Jahre 1533 die gründliche Reformation auch in Sternberg durch den Prädicanten Faustinus Labes. Der Herzog Albrecht war wieder vom lutherischen Glauben abgefallen; im J. 1532 vertrieb er, wo er es konnte, die lutherischen Prädicanten, im J. 1533 verband er sich zur Erhaltung des altkatholischen Glaubens. Da erschien Faustinus Labes in Sternberg. Faustinus Labes aus Treptow war ein vom Bischofe geweiheter Priester. Er predigte das Evangelium Anfangs in Güstrow. Hier hatte zuerst Joachim Kruse 3 ) in der Heil. Geist=Kirche und auf dem Kirchhofe seit 1524 das Evangelium gepredigt und bis 1531 gewirkt. Sein Nachfolger war Faustinus Labes, "Prediger zu Güstrow am Heiligen Geist".


|
Seite 244 |




|
Kaum hatte er jedoch sein Amt, zu welchem er von
den Einwohnern berufen war, angetreten, als er
beim Herzoge Albrecht wegen ketzerischer und
unchristlicher Lehre angegeben ward; dieser
verbot ihm daher den bisherigen Gottesdienst,
die deutsche Messe, die deutsche Taufe
 . Faustinus vertheidigte sich am
14. Nov. 1531 schriftlich bei dem Herzoge
1
), mit dem Ersuchen, ihn
ferner thun zu lassen, wie es seinem Vorgänger
erlaubt gewesen sei, da er nur das reine
Christenthum predige. Faustinus ließ sich nicht
stören, sondern predigte auch in der
Pfarrkirche. Da aber in Sternberg die
Reformation keine Fortschritte machte, so
versetzte ihn der Herzog Heinrich nach
Sternberg. Am 12. Julii 1533 sollte Heinrich
Techel oder Techent an Faustinus Stelle in die
güstrowsche "Pfarre" verordnet werden
und Faustinus hatte fürstliches Geleit
("versigelt hern Faustins gleidt"), d.
i. Entlassung von Güstrow erhalten; am 20.
August 1533 erließ der Herzog Albrecht ein
Schreiben an den "neuen Prediger in seiner
Stadt Güstrow". Am 23. Aug. 1533 befahl der
Herzog Albrecht dem Rathe der Stadt Sternberg,
dem "martinischen Prädicanten" den
deutschen Gottesdienst zu verbieten, wie es der
Rath mündlich versprochen, aber nicht gehalten
habe, bis der Herzog sich mit seinem Bruder über
den Gottesdienst verglichen habe; ein gleiches
Verbot erging an demselben Tage an den
"Prädicanten" Faustinus Labes
2
). Faustinus ließ sich aber
nicht irre machen, und den Rath der Stadt
Sternberg tröstete des Herzogs Heinrich
Hofprediger M. Egidius Faber damit, daß der
Prediger zu Sternberg "mit Gunst seines
Herrn Herzogs Heinrich predige, der ihm solches
befohlen habe und auf den er sich berufen
könne", mit der Bitte, daß der Prediger
fortfahren möge im Predigtamt und in allem was
das Evangelium mit sich bringe"
3
). Dem
Egidius Faber mußte an der Standhaftigkeit
seines Collegen Faustinus viel gelegen sein, da
Faber so eben (1533) sein Buch vom falschen Blut
und Abgott im Dom zu Schwerin hatte ausgehen
lassen und Faustinus in Sternberg in ähnlicher
Lage war, wie Egidius Faber in Schwerin. Als
Faustinus standhaft blieb, beklagte sich der
Herzog Albrecht bei dem Kurfürsten Joachim von
Brandenburg am 17. Sept. 1533 über seinen Bruder also:
. Faustinus vertheidigte sich am
14. Nov. 1531 schriftlich bei dem Herzoge
1
), mit dem Ersuchen, ihn
ferner thun zu lassen, wie es seinem Vorgänger
erlaubt gewesen sei, da er nur das reine
Christenthum predige. Faustinus ließ sich nicht
stören, sondern predigte auch in der
Pfarrkirche. Da aber in Sternberg die
Reformation keine Fortschritte machte, so
versetzte ihn der Herzog Heinrich nach
Sternberg. Am 12. Julii 1533 sollte Heinrich
Techel oder Techent an Faustinus Stelle in die
güstrowsche "Pfarre" verordnet werden
und Faustinus hatte fürstliches Geleit
("versigelt hern Faustins gleidt"), d.
i. Entlassung von Güstrow erhalten; am 20.
August 1533 erließ der Herzog Albrecht ein
Schreiben an den "neuen Prediger in seiner
Stadt Güstrow". Am 23. Aug. 1533 befahl der
Herzog Albrecht dem Rathe der Stadt Sternberg,
dem "martinischen Prädicanten" den
deutschen Gottesdienst zu verbieten, wie es der
Rath mündlich versprochen, aber nicht gehalten
habe, bis der Herzog sich mit seinem Bruder über
den Gottesdienst verglichen habe; ein gleiches
Verbot erging an demselben Tage an den
"Prädicanten" Faustinus Labes
2
). Faustinus ließ sich aber
nicht irre machen, und den Rath der Stadt
Sternberg tröstete des Herzogs Heinrich
Hofprediger M. Egidius Faber damit, daß der
Prediger zu Sternberg "mit Gunst seines
Herrn Herzogs Heinrich predige, der ihm solches
befohlen habe und auf den er sich berufen
könne", mit der Bitte, daß der Prediger
fortfahren möge im Predigtamt und in allem was
das Evangelium mit sich bringe"
3
). Dem
Egidius Faber mußte an der Standhaftigkeit
seines Collegen Faustinus viel gelegen sein, da
Faber so eben (1533) sein Buch vom falschen Blut
und Abgott im Dom zu Schwerin hatte ausgehen
lassen und Faustinus in Sternberg in ähnlicher
Lage war, wie Egidius Faber in Schwerin. Als
Faustinus standhaft blieb, beklagte sich der
Herzog Albrecht bei dem Kurfürsten Joachim von
Brandenburg am 17. Sept. 1533 über seinen Bruder also:
"Desgleichen hat er (vnser Bruder Herzog Heinrich) itzo einen Predicantenn zum Sternbergk verordenth, der sich vnterstehet, nicht allein lutterisch zu


|
Seite 245 |




|
predigenn, sonder auch auff zwinglichse Meynung zu predigenn vorgenomen, heist das Sacramenth vnd heiligk bluth daselbst ein Teuffell, darzu ein Marien=Bildt, so inn der kirchenn kegenn dem Predigstull vber stehet, auch offentlich vor dem volck auff dem predigstull ein teuffell, spricht, es sein zwey teuffell inn der kirchenn, einer wirdt denn andernn austreibenn, Wie denn vnnsers Bruders Prediger, den er stedts zu hoff hat, Egidius gnanth, inn gleicher Meynung wider das heiligk Bluth zu Swerin vnnd Sternbergk ein schnw Buch hatt lassenn außgehen. Mittwoch nach exalt. s. crucis ao. 1533".
Die nächste Folge der Predigt des Faustinus Labes war, daß das Augustinerkloster am 18. April 1534 durch Commissarien beider Herzoge, zwei sternberger Capellane, geschlossen ward 1 ). Die Meßgewänder wurden nach Schwerin gebracht, das Bettzeug der Mönche ward vom Rathe der Stadt im Reventer verschlossen und als im J. 1537 des Priors Frau ausgewiesen ward, wurden die Mobilien des Klosters, welche der Prior benutzt hatte, zu den übrigen gelegt. Bei der katholischen Kirchen=Visitation vom J. 1534 ward Faustinus Labes als gar nicht vorhanden betrachtet. Damals waren in Sternberg noch: der Pfarrherr Dr. Heinrich von Bülow, zwei Kapellane: Johann Crivitz und Otto, die 6 herzoglichen Commendenpriester in der Heil. Bluts=Kapelle: Simon Drepenicht, Steffen von Stene, Caspar Friederich, Antonius Krevet, Georg Schankepyl (und als der sechste Johann Crivitz), und folgende Vicare: Barthold Sandow, Michael Andreae, Heinrich Möller, Joachim Kröpelin, Martin Jagow, Johann Reyneke (ehemals Propst zu Neukloster, welcher im J. 1529 geheirathet hatte: vgl. Mekl. Urk. II, S. 257), Michael Gildehof, Johann Güstrow und Jacob Meyne, welcher zu Malchin als Prediger wohnte: immer noch genug für eine kleine Stadt. Aber in den Block kam nichts mehr, und Zinsen blieben auch aus.
Die evangelischen Visitationen durch die Prädicanten Egidius Faber und Nicolaus Kutzke traten im J. 1535 schon kräftiger auf 2 ). Sie ließen die Pfaffen, welche noch heimlich Winkelmesse hielten, vor sich kommen und verboten ihnen den "Greuel"; übrigens beklagte sich Faustinus über den Pfarrherrn Dr. v. Bülow, der ein ungeschickter und ausschweifender Mann sei, daß er ihm


|
Seite 246 |




|
von seinem Solde jährlich 10 Gulden abziehen wolle, weil kein Opfer mehr eingehe.
Im J. 1538 verloren die Papisten durch den Tod des Dr. v. Bülow ihre letzte Stütze. Sie zogen sich zurück, aber ließen nicht von ihrem Glauben. In dem Visitations=Pprotocolle vom J. 1541 1 ) wird ausgesprochen, daß keine Hoffnung vorhanden sei, daß die Vicare ihr gottloses Leben verließen und das Evangelium annähmen. Als Pfarrer figurirte Johann Sperling mit seinen beiden Vicaren Antonius Schröder und Johann Crivitz. Die Schule ward von einem ungelehrten Papisten besorgt. Faustinus Labes, ein gelehrter, frommer, christlicher evangelischer Prediger, der jedoch etwas lange und unvorsichtig redete, stand als "Capellan" allein. Er hatte eine Frau und fünf Kinder, aber so geringe Einkünfte, daß er nicht davon leben konnte. Er bat deshalb um seine Entlassung. Ueberdies hatte er in der Kirche niemand, der ihm singen half, und mit dem papistischen Schulmeister konnte er auch nichts anfangen.
Dennoch blieb Faustinus noch in Sternberg, mußte bleiben seiner Kinder wegen. In einem Verzeichniß der Einnahmen der sternberger Kirche vom J. 1545 2 ) steht er unter den Vicaren und Stipendiaten aufgeführt; nach dem Visitations=Protocolle von 1541 waren ihm jedoch 50 Gulden Gehalt zugesichert.
Auf einem Landtage zu Sternberg ward im J. 1550, nach dem Tode des Herzogs Albrecht, die Annahme der lutherischen Lehre für das ganze Land feierlich beschlossen 3 ).
Mit dem J. 1545 verschwindet Faustinus Labes aus der Geschichte. Er ist der eigentliche Reformator der Stadt Sternberg, hat jedoch weder bei seinem mühseligen Leben irdischen Lohn, noch nach seinem Tode die ihm gebührende Anerkennung empfangen. Seine Wittwe lebte noch im J. 1569. Zwar wird sie nicht mit Namen genannt, aber es lebten damals in Sternberg zwei Prädicanten=Wittwen, und Faustinns Labes hatte nur Einen Nachfolger, Nicolaus Gisenhagen, welcher 1568 starb.
Daß ihm der Superintendent Riebling die wunderthätigen Hostien zum Genusse gereicht habe, ist ohne Zweifel unbegründete Sage 4 ).
Das Kirchensilber, welches beim Rathe und dem Pfarrer in Verwahrung gewesen war, ward erst im J. 1572 zu Gelde gemacht 5 ).


|
Seite 247 |




|
Protestantische Pfarrer.
Erst mit dem Tode des Pfarrers Johann Sperling, welcher noch im J. 1552 lebte, verschwindet unter dem Herzoge Johann Albrecht I. jede Spur des Katholicismus.
Zuerst war nur Ein protestantischer Prediger in Sternberg:
Nicolaus Gisenhagen wird zuerst im J. 1556 als Pfarrer zu Sternberg genannt. Er war aus Pritzwalk gebürtig und hatte zu Wittenberg studirt, wo er am 11. Oct. 1540 immatriculirt ward. In der Matrikel der Universität Wittenberg 1 ) heißt es:
| 1540. Oct. 11. | Pauperes gratis inscripti: |
| Nicolaus Gisenhagen Britzwalkhensis. |
Von seinem Leben und Wirken ist wenig bekannt geworden. Am Tage Laurentii 1556 wird er zuerst genannt, als Helmold von Plessen zu Brüel ihn, "Ern Nicolaum Gisenhagen parhern thom Sterneberge", mit einem Lehn erfreut. Am Johannistage 1558 giebt er seinem Sohne Johann ein Stipendium oder Lehn, dessen Patronat dem Pfarrherrn zu Sternberg gehörte, und nennt sich dabei: Nicolaus Gisenhagen divina providentia ecclesiae Sternbergensis animarum pastor. Er starb im J. 1568. Helmold v. Plessen gab in diesem Jahre das Lehn, welches Nicolaus Gisenhagen gehabt hatte, dem Sohne des Verstorbenen. Die Wittwe lebte noch im J. 1572.
Von Interesse sind seine Söhne Johann und Nicolaus Gisenhagen, welche hier um so mehr eine Erwähnung verdienen, als sie oft unter einander und mit ihrem Vater verwechselt sind.
Johann Gisenhagen war der ältere Sohn des sternberger Predigers Nicolaus Gisenhagen. Am 24. Jun. 1558 verlieh sein Vater ihm ein sternbergisches Pfarrstipendium (studioso adulescentulo Joanni Gisenhagen, filio meo charissimo, cum bonis litteris addictus sit). Am 29. Sept. 1568 gab


|
Seite 248 |




|
Helmold von Plessen auf Brüel ein Lehn, welches der verstorbene Prediger Nicolaus Gisenhagen ("dewile her N. G. lange tidt trwiich gedienet") einem seiner Söhne, Johann Gisenhagen, welcher sich dem Studio ergeben. Johann Gisenhagen genoß diese Stipendien noch im J. 1571. Im J. 1592 ward er Prediger zu Proseken. Im Visitations=Protocolle von 1595 heißt es: "Pfarher heißt Johanneß Gisenhagen von Sterneberg bürtig, Anno 92 anhero vocirt".
Nicolaus Gisenhagen war des im J. 1568 verstorbenen sternbergischen Predigers Nicolaus Gisenhagen als ein minderjähriger Knabe nachgelassener jüngerer Sohn. Im J. 1573 war er, 14 Jahre alt, bei der Besamung der rosinschen Tannen gegenwärtig (Thomas Anal. Gustr. p. 168). Da er die Schule zu Güstrow besuchte, nahm sich der Herzog Ulrich seiner an und im J. 1575 in seine Hofcapelle ("in des Herzogs seitenspill und Musica zu singen"), gab ihm auch die nötige Hofkleidung. Der Herzog wollte ihn nun an seine Tochter, die Königin Sophie von Dänemark, "befördern", behielt ihn jedoch bei sich und nahm ihn am 24. Jul. 1577 "für einen Discant" förmlich in die Hofcapelle, um im Chor und bei Hofe auf Erfordern des Herzogs zu singen; der Herzog gab ihn bei dem fürstlichen Cantor Menkinus als Jungen in die Kost, damit er seine Studien ordentlich fortsetzen könne. Darauf schickte ihn der Herzog auf die Universität Rostock mit Empfehlungsschreiben an die Professoren. Nach Vollendung seiner Studien ward er Schullehrer zu Sternberg. Obgleich er nur noch Lehrer zu Sternberg war, nahm ihn der Herzog im Mai 1588 mit nach Dänemark, zum Begräbniß des Königs Friederich II., seines Schwiegersohnes. Als im August d. J. der Prediger Johannes Rederus zu Proseken einen Ruf nach Danzig erhielt, berief der Herzog zu dieser Pfarre den Nicolaus Gisenhagen, weil er "im Reiche Dänemark dermaßen aufgewartet, und sich nicht allein im Predigen, sondern auch sonst also verhalten, daß der Herzog ein gnädiges Wohlgefallen daran gehabt, und ihn über Verdienst verehrte und begabte". Rederus besann sich jedoch und blieb; Nicolaus Gisenhagen konnte die Pfarre späterhin seinem Bruder Johann zuwenden. Dagegen nahm der Herzog den Nicolaus Gisenhagen als Hofprediger in Dienst und trug ihm am 22. Jan. 1589 dazu die Dompfarre in Güstrow an. So blieb Nicolaus Gisenhagen bis an des hochgebildeten, wackern Herzogs Ulrich Tod dessen "Hofprediger und Seelsorger", und ging nach des Herzogs Ableben mit dessen Wittwe, der Herzogin Anna, auf deren Wittwensitz Grabow als Hofprediger.


|
Seite 249 |




|
Seit Nicolaus Gisenhagen's Tode wurden an der Kirche zu Sternberg immer zwei Prediger angestellt, welche gleiche Stellung hatten und deren Verhältniß sich nur durch die Anciennetät unterschied.
David Bramerus, der unmittelbare Nächster des Nicolaus Gisenhagen, war zu Braunschweig geboren und ward am 25. Sept. 1558 auf der Universität Wittenberg immatrikulirt 1 ):
| 1558. 25 Sept. | David Bramerus Brunswicensis. |
Schon am 1. April 1568 erhielt er als Pastor zu Sternberg ein geistliches Lehn. Er wird damals eben nach Sternberg gekommen sein, da er in dem Rechnungsjahre 1571/2 sagt: "vor 3 Jaren in meiner ersten ankunft". Er blieb in Sternberg bis zum Ende des J. 1572; in dem Rechnungsjahre Michaelis 1572/3 kommt er zuletzt vor und zwar so, daß er mit seinem Nachfolger Johannes Fabricius das Jahrgehalt theilte:
| "1572/3 | Ausgabegeld den kerckendienern zu besoldunge. |
| 150 Mk. Magister Johannes und M. Dauit. | |
| 150 Mk. M. Simon Gotmerus". |
Von Sternberg soll er am Ende des J. 1572 nach Wittenberg gegangen sein 2 ). Die Ursache dieser Ortsveränderung lag vielleicht im Kryptocalvinismus, welcher damals in Wittenberg seinen Hauptsitz hatte. Am 14. April 1575 ward er nach Saalfeld in die erledigte Superintendentur berufen; am 30. Julius hielt er seine Probepredigt und am folgenden Tage ward er als Superintendent eingeführt (Lieben Salfeldographia Mspt. Cap. XXII; Magistrats=Acten). Im J. 1576 ließ er eine große Renovation der Stadtkirche zu S. Johannis in Saalfeld vornehmen und sich eine lateinische Inschrift in derselben setzen. Am 12. Aug. 1577 unterschrieb er mit den übrigen Geistlichen der Saalfelder Diöcese auf dem Rathhause zu Saalfeld in Gegenwart der kurfürstl. Sächsischen Commissarien Dr. Jacob Andreae und Dr. Nic. Selneccer die Concordienformel. Da er aber nicht nur die dem Kryptocalvinismus ergebenen Männer sehr verehrte, sondern auch die halleschen Kryptocalvinisten besuchte, ja endlich sogar laut werden ließ, daß es ihn reue, die Concordienformel unterschrieben zu haben, so ward er kurz vor Pfingsten des J. 1578 durch ein fürstliches Rescript von Weimar aus seines Dienstes entsetzt (Lieben a. a. O.; Magistrats=Acten). Hieraus erhielt


|
Seite 250 |




|
Bramerus eine Pfarre zu Felsberg im Hessischen, wo er seinen "Ecclesiastes oder Namen, Titel und Eigenschaften der wahren, reinen und getreuen Prediger und Diener Christi, Schmalkalden 1587", herausgab; ein Exemplar davon sandte er seinem alten Freunde, dem Archidiaconus M. David Aquila zu Saalfeld (Salfeld. Magistrats=Acten). Nach Georgi Bücher=Lexicon gab er noch "Angesichts=Schweiß=Predigten von allen Ständen, 1594, zu Zerbst" heraus. Sein Todesjahr ist noch nicht bekannt.
Zugleich mit David Bramer ward im J. 1568 Simon Gutzmer als zweiter Prediger in Sternberg angestellt; nach Bramers Abgange ward er im J. 1572 Hauptprediger. Er war aus Colberg in Pommern und soll eines "Salzjunkers" (d. i. eines patricischen Salzpfannenerben) Sohn gewesen sein (vgl. Mecklenb. Gelehrten=Lex. St. VI, S. 18); im J. 1570 ward er, "Simon Gutzmerus, artium magister" zu Rostock (vgl. Schütz de vita Chytraei II, p. 304). Er starb wahrscheinlich im Jan. 1581, nachdem er volle 12 Jahre Prediger in Sternberg gewesen war.
ward nach Bramers Abgange im J. 1572 als zweiter Prediger angestellt. Er war aus Jessen in Kursachsen, und im April 1565 bei der neu organisirten Domschule zu Schwerin als Cantor angestellt (vgl. Hederich Schwerin. Chron., z. J. 1565, und Schröder Ev. Meckl. III, S. 129). Er, Joannes Fabricius, Jessensis, ward zugleich mit seinem Amtsbruder Gutzmer Magister (vgl. Schütz de vita D. Chytraei, II, p. 304). Im J. 1572 ward er von beiden Landesherren zum Prediger in Sternberg berufen und rückte nach Gutzmers Tode im J. 1581 in die erste Predigerstelle auf. Er starb, nach 30jähriger Amtsführung, zu Sternberg am 24. Nov. 1602 und ward am 25. Nov. begraben (vgl. Franck Bericht von den Hostien, S. 44).
oder Bernhard Orestes ward nach Gutzmer's Tode im J. 1581 als zweiter Prediger angestellt. Er war ein Westphale, aus dem Münsterschen (Monasteriensis), aus Horstmar (?) (= Horstiensis) gebürtig, und war zuerst, noch 1565, Conrector zu Lippe. Er war ein ausgezeichneter Kenner der hebräischen und griechischen Sprache und dem Professor David Chytraeus wegen seiner Gelehrsamkeit sehr befreundet.


|
Seite 251 |




|
"Bernhardus Orestes, Horstiensis, conrector scholae Lippensis, vir in graeca et imprimis hebraea lingua versatus et doctori Chytraeo propter excellentem linguarum cognitionem et doctrinam charus". H. Hamelmanni Liber sextus virorum Westphaliae doctrina et scriptis illustrium, qui continet claros viros comitatus Lippiae, Lemgoviae, 1565, C.
In einem Stammbuche eines sächsischen Edelmannes D. Franciscus von Domstorf, der viel auf Gesandschaftsreisen war, aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, steht:
"M. Bernardus Orestes sua manu scribebat nobili et erudito iuueni D. Francisco a Domstorff veteri suo condiscipulo. Anno 1570 die omn. sanct."
Leider ist diese Schrift ohne Angabe des Ortes; die nächsten Stammbuchblätter sind vom August 1570 aus Braunschweig datirt. Wirklich war Orestes auch eine Zeit lang Rector der Schule zu Braunschweig:
"1568. Martinus Chemnitius - - habuit d. 28. Junii disputationem solemnem (Rostochii). - Aderat quoque comes Chemnitii in itinere Bernhardus Orestes, Monasteriensis, scholae Martinianae, quae Brunswigi colligitur, rector, qui postridie Petr. et Paul. a decano Andrea Weslingio philosophiae doctor renunciatur". Schütz de vita D. Chytraei, I, p. 312.
Darauf ward er, wahrscheinlich durch David Chytraeus Vermittelung, Conrector an der Domschule zu Güstrow, sicher erst nach dem J. 1572, nachdem Oemichius Rector dieser Schule geworden war:
"Nicolao Vorstio. - -De Gustrouiensi schola cum superintendente proximis diebus locutus sum, qui suum et rectoris Oemichii animum tibi addictum esse ostendit. Narrauit enim inter caetera, te nescio ad quem scripsisse, meas quasdam litteras dimissionem tuam accelerasse, quod si ita est, sane doleo. - - Mihi etiam fides et diligentia non defutura est, tametsi de Wernero Oresto antea dictum, sed nichil adhuc decretum esse memini". Davidis Chytraei epistolae, Hanoviae, 1614, p. 302.


|
Seite 252 |




|
In einem eleganten Gedichte zeigt ihm Nathan Chytraeus (Poemata, Rostochii, 1579, Silvarum III, fol. 78) seine bevorstehende Erhebung zur Magisterwürde im J. 1573 an, und sagt dabei z. B.
Sic quoque Pieridum sincerus cultor Orestes,
Vir pius, et triplicis quem clara scientia linguae
Exornat, Musaeque prius cui serta pararunt
Myrtea, Varnaidum roseas concessit ad undas,
Confecto insignem vt capiat certamine laurum.
Nunc quoque doctrinae specimen linguaeque diserta
Edidit ipse scholae, vitamque ita labe carentem
Nouimus, vt tanto dignus credatur honore.
Orestes gratulirt ferner dem Nathan Chytraeus zu dessen Hochzeit und dieser jenem wieder zu dessen ehelichen Verbindung ("Bernhardo Oresti et Fortunae Hesychiae") (Nathan Chytraei Amorum conjugal. Lib. III, fol. 269, et Lib. I, fol. 231). Im J. 1580 war Orestes noch Conrector zu Güstrow (Thomas Anal. Gustrov. p. 63 im Anhange). Im J. 1581 war er nach Gutzmers Tode zweiter Prediger zu Sternberg, neben Johannes Fabricius; um Ostern 1604 war er über 24 Jahre Prediger zu Sternberg gewesen. In demselben Jahre 1602, in welchem sein Amtsbruder Fabricius starb, resignirte Orestes. Er lebte noch im J. 1606 ("Wernerus Orestes senior emeritus") und wird um das J. 1669 gestorben sein.
Im J. 1662 wurden zugleich
und
als Prediger zu Sternberg angestellt.
Bernhard Caloander, ein "Sternberger" 1 ), war Bernhard's Orestes Stiefsohn und 1589 auf der Universität Rostock 1 ), als er ein sternbergisches Lehn erhielt. Im J. 1593 ward er Schullehrer zu Boizenburg; der Rath und die Prediger opponirten sich dagegen, aber der Herzog befahl dem Superintendenten Neovinus die Einführung.
Michael Gutzmer, wahrscheinlich Simon Gutzmer's Sohn, war ein Schwiegersohn des Johannes Fabricius.


|
Seite 253 |




|
Chronologische Uebersicht
|
Katholische
Pfarrherren. |
|||
| 1503 - - - | M. Johannes Goldenboge. | ||
| 1511 - 1527. | Michael Hildebrand. | Lutherische | |
| 1527 † 1538 | Dr. Heinrich von Bülow. | Prädicanten. | |
| 1538 - 1552. | Johann Sperling. | 1533 - 1545. | Faustinus Labes |
| Lutherische | Lutherische | ||
| Hauptprediger. | zweite Prediger. | ||
| 1556 † 1568. | Nicolaus Gisenhagen. | ||
| 1568 - 1572. | M. David Bramerus. | 1568 - 1572. | M. Simon Gutzmer († 1581). |
| 1572 † 1581. | M. Simon Gutzmer. | 1572 - 1581. | M. Johannes Fabricius († 1602). |
| 1581 † 1602. | M. Johannes Fabricius. | 1581 - 1602. | M. Wernerus Orestes (emer. 1602). |
| 1602. | Bernhard Caloander. | 1602. | Michael Gutzmer. |


|
Seite 254 |




|
7. Neuere Geschichte der Stadt Sternberg.
Die neuere Geschichte der Stadt Sternberg enthält, bis auf die neuesten Zeiten, fast nur betrübende Erinnerungen. Durch die Aufhebung des katholischen Gottesdienstes verlor die Stadt allerdings viel. Jedoch erhielt sie sich in der Aufregung und Bildung des 16. Jahrhunderts einigermaßen. Ersatz für die erlittene Einbuße erhielt sie im J. 1572 durch die Bestimmung, daß fortan die Landtage auf dem Judenberge bei Sternberg gehalten werden sollten, eine Bestimmung, welche der Grund zum Wiederaufblühen der Stadt geworden ist.
Das 17. Jahrhundert führte aber namenloses Unglück über die arme Stadt. Im J. 1621 ward in Verfolg der Landestheilung ihr ein Theil ihres Gutes wieder genommen durch die Bestimmung, daß die Landtage abwechselnd in Sternberg und Malchin gehalten werden sollten. Zwar sollte die Stadt dadurch Ersatz erhalten, daß im J. 1622 in derselben das Hof= und Land=Gericht 1 ) als beständiger, höchster Gerichtshof angeordnet ward. Aber zuerst wollte es mit dieser neuen Einrichtung nicht recht vorwärts, und gleich darauf brach der dreißigjährige Krieg herein. Wallenstein versetzte den Gerichtshof auf einige Zeit nach Güstrow. Die Noth des Krieges und der Pest 2 ) wütheten so furchtbar, daß im J. 1638 3 ) die ganze Stadt ausgestorben war und ein halbes Jahr lang ohne Einwohner 4 ) wüst stand. Um das Unglück voll zu machen, brannte die Stadt am 23. April 1659 bis auf eine Scheure ab, und da es an den nötigen Mitteln und Gelegenheiten fehlte, ward im J. 1667 das Hof= und Landgericht von Sternberg nach Parchim verlegt. An dem verhängnißvollen 23. April des J. 1741 brannte wiederum die ganze Stadt ab; nur das Hospital blieb stehen und jene Scheure, welche auch der Brand von 1659 verschont hatte.
In den neuern Zeiten hob die Stadt sich dadurch, daß es im J. 1721 der Sitz einer geistlichen Präpositur und im J. 1774 der Sitz einer Superintendentur ward. Vorzüglich aber hat der Umstand den Flor der Stadt befördert, daß in


|
Seite 255 |




|
neuern Zeiten die Landtage länger dauern und zahlreicher besucht werden, als früher. Die Chausseen, welche in den neuesten Zeiten durch Sternberg geführt sind und das Innere des Landes mit Wismar und Schwerin, über den Paulsdamm, verbinden, haben ein viel regeres Leben in die Stadt gebracht, welche einer bessern Zeit entgegenzugehen scheint.
Nachtrag
"Des jares 1492 haben die Juden zum Sternberge in Mekelburgk das heilige sacrament des altars geschampfiret, das sie von einem gotlosen pfaffen gekawfft, darvmb sie hertzog Magnus von Mekelburgk hat brennen lassen, vnd die andern aus dem lande gejaget. Vnd nachdem man solcher mißhandlung viel von den juden inne geworden, vnd auch irer viel in Pomern gewest, als zum Dham bei Stettin, den sie schyr gantz inne gehapt, zu Bard, vnd schyr in allen kleinen flecken, auch in etlichen dörffern: hat sie hertzog Bugslaff auch in seinem lande nicht leiden wollen, vnd hat inen darvmb genhomen alles was sie hetten, vnd zum lande hinaus gewiesen. Dho seint zween Juden man vnd weib gewest, die haben nicht wollen wegziehen, vnd haben sich tawffen laßen zum scheine, vnd sind gen Tribseß gezogen. Vnd so oft sie jungen gehapt, hat das kint ein hant vul bluts mitgepracht. Do das die bürgerinnen gesehen, haben sie gedacht, sie mosten sich nicht recht bekhert haben, sonder weren noch Juden, vnd haben nicht gerne mit inen zu thunde gehapt. Darvmb seint sie nach Laßan, darnach nach Vßedhom gezogen; aber weil die jüdin allewege mitginck zu den christinnen zu den kindesnötten, hat sie einsmals sampt irem manne bekhant, das sie sich nicht bekheret, vnd sein gute christen geworden. Es liessen sich auch mehr juden tawffen, die nicht gerne aus dem lande wolten, welche sich einsteils zum Colberge vnd anderswohin setzten. Vnd syder zeit sein keine juden mehr im lande gewest, sonderlich die sich dafür bekhenen."
Thomas Kantzow Pomerania, herausgegeben von Kosegarten, 1817, II, S. 221.


|
Seite 256 |




|
Anhang
Geschichte der Stadt Sternberg.
Anno
. LXXXXII° vmme Johannis Baptiste im Sommer.
Item eyn yôde vth Ruslande is gewest bynnen Pentzelin; dâr was eyn monnyck grawes ordens, die denne mit deme suluen yôden âuergegeuen die ostien consecrêret vnde sîns ordens vth sînen gêstliken clêderen in wertliken geclêdet, [so hie bynnen Fredelande gesên wart, vort gewandert is: ausgestrichen].
Item dâr na hebben die yôden dâr sulues to Penzelin, so die monnick van dâr was, eyne grôte consecrêrde hostie, alse man plecht in der hilligen misse to gebrûkende, by sick behollden.
Item furder hebben die yôden noch eyne hostien, die was cleyne, vth eyner grôten ostien an henden vnde vôthen midden vth besneden, so hîr na gescreuen steyt, van eyner cristen frowen bynnen Tetrow gekofft vor X s. [clegelik genoch: gleichzeitiger Zusatz von anderer Hand].
Item sodâne beyde hostien hebben die valschen yôden samptliken in die stad Sterneberch gebracht vnde die dâr gemartellt unde mit natelen gewundet; der


|
Seite 257 |




|
grôten hostien hebben sie vîff steke gegeuen, so âpenbâr noch dat blôt wârliken an vîff steden an der suluen ostien gesehn wert.
Item die ander hostie hebben sie an henden vnde vôthen besneden in gestallt vnde figûren, so vôr ôgen is vnde man âpenbârlik sehn mach, wârafftig blôt dâr vth geflâten vnde ôck vth der syden der ostien, so die mit natelen gesteken wart, wârafftich blôt gesprungen is.
Item sodâne martelinge vnde vnêre an deme hilligen sacramente wo vôrberôrt geschên hebben die yôden dâr sulues tôm Sterneberge gedân in eyner kost edder lôffrâtinge, wo denne ere yôdesche ârt vthwîset.
Item die suluen yôden sint in sodânem handell to besmittunge vnses cristliken gelôuen mistrôstich vnde angestrvruchtich geworden vnnde sick beduncken lâten, so vele orer gewest is, dat sie to stênen werden vnde van affgrunde gân schollden.
Item dar na hefft eyne iôdesche frôwsnâme beyde hostien des sacramentes in eynem dôke gewunden, eynem prêster dâr sulues vam Sterneberge gebâden vnnde gesecht: "Hir is dyn got", is die sulue prêster, vîlliciite vth gotliker fruchte, bewâgen, vnde hefft die sacramente to sick genâmen vnde verborgen, wo hîr na geschreuen is.
Item sint die ostien dorch den suluen prêster in deme ôuersten dêle der liuernn in die erde begrâuen worden.
Item na vermeldinge dessuluen prêsters hefft hie vôrgegeuen, wo em bynnen der nacht eyn geyst to gekâmen is vnde van der ôrsâke wegen des sacramentes eyn wârteyken gegeuen.
Item hyr an vnnde âuer sint ghewesen de
irluchtigen hôchgebôrnen
 ., de by sulker . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . geseten vnde
in iegenwardicheit etliker gêstliker prelâten.
., de by sulker . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . geseten vnde
in iegenwardicheit etliker gêstliker prelâten.
Item der iôden, de dâr also ghemartelt hebben, was vyue, item de dâr râdt vnde dâet mede hadden, was dortich pâer.
Nach dem öfter während des Schreibens corrigirten Original=Concept von einer bekannten gleichzeitigen Canzleihand auf einem halben Bogen Papier im großherzogl. Geh, u. Haupt=Archive zu Schwerin. Ohne Zweifel ist dies das Concept des in Gegenwart der Herzoge gehaltenen ersten Verhörsprotocolls. Das Blatt ist in Oktav zusammengefaltet gewesen und daher die Schrift am Ende sehr abgescheuert. - Von der Hand des Canzlers Caspar von Schöneich


|
Seite 258 |




|
aus den ersten Zeiten seiner Amtsführung steht auf der Rückseite die Registratur: "Von dem heiligen Sacramente zum Sternberg. - Das Datum dieses Protocolls ist wahrscheinlich der 29. Aug., also der Tag der Enthauptung S. Johannis des Täufers, da der Tag "Johannis baptistae im Sommer" genannt wird, zur Unterscheidung von Johannis d. T. Geburtsfest am 24. Junius.
Anno domini M°CCCCXCII amme dâghe Seuery vnde Seueryny (Oct. 22.) hebben âpenbâr de quâden, bôsen yôden sunderghen vorvolghers der hylghen crystenheyt dorch ere bôsheyt to hône vnde to smâheyt deme almechtygen gade vnde to wâraftyghen des crysten ghelôuen klârlyken bekant suâre myshandelynghe vnde ghescheffte an deme benedyeden wâren hylghen lychamme vnses heren Yhesu Christi, so gheschên vnde myshandelt yn mâten alzo hyr na schreuen steydt.
Item eyn prêster ghenômet her Peter Dene bekennet, dat Eleazar yôde bynnen deme Sternebarghe hefft eynen syner grâpen by syck ghehadt, de em vôr IIII s. vorpandet was, vnde de sulue her Peter Dene quam to Eleazar to deme yôden vp der parstynschen strâten ôrde vnde beghêrde van deme suluen yôden synen grâpen, dâr vp Eleazar van her Peter boghêrde, effte he nycht konde scycken dat hyllyghe sacramente, he wolde em synen grâpen wedder dôen vnde dâr to synen wyllen hebben. Vp sulker erer beyder vordrach hefft her Peter Dene II hostyen to deme Sternebarghe yn der kerken vp deme altare aller gades hylghen an deme dâghe VII brôder (10. Jul.) ghebenedyet vnde consecrêrt, vnde des anderen dâghes hefft hee see Eleazar antwardet an eyneme syden dôke, den he afghesneden hadde van deme altare der hylghen drê kônynghe.
Item secht vnde bekennt Eleazars wyff, ene amme dynxtedâghe vôr Bartholomei (21. Aug.) yn eyneme holtene luchtenkoppe hefft wedder ghebracht dat sacramente vnde heff ghesecht: "Per Peter Dene, sêth,


|
Seite 259 |




|
dâr hebbe gy jwuen got wedder vnde vorwâret
den": so hofft her Peter de suluesten
benedyeden hostyen wedder to syck ghenâmen in
mêninghe, se wedder in de kerken to brynghende
effthe vp den kerkhoff to begrâuende, welkere he
do nênerley wys do by brynghen konde vnde mochte
myt nychten van deme hâue vnser gnedighen heren
van Mekelenborch, dâr de yôden by wêren, wech
brynghen, alszo begrôff he de yn den suluen hoff
in de erden, wo sze wedder vp ghegrâuen synt
vnde vôr ôghen kâmen synt, des vnsen gnedighen
heren van Mekelenborch, vele mêr anderen heren
prelâten vnde gôde manne wol bewêten ys
 .
.
Item in dat êrste hefft bekant eyn jôdynne
Eleazars wyff, dat Eleazar ere man myt hulpe
vnde râde der anderen hefft ghekofft vnde to
syck ghekreghen IIII benedyghede hostyen, de II
kortes vôr Yacoby vorganghen vp eynen vrygdach
(20. Jul) des morghens frô to VIII in der
klocken stunde, alze Eleazars dochter byslêp,
bynnen deme Sternebarghe vnder êner lôuynghen
erer V myt nâtelen ghesteken hebben, dâr dat
blôt vth ghelôpen ys, alzo benômede dat sulue
wyff: Eleazar eren êghenen man, Mychael Aarons
sone van Brandenborch, Schunemann to Fredelande,
Symon erer dochter man vnde Szalomon to Teterow,
vnde de sulue erer dochterman bekent myt
Eleazars wyue, dat sze beyde vnde eyn yêwelyck
van em besunderghen dat szo vôr wâre gheschên ys
 .
.
Item secht vurder Eleazars wyff, dat de beyden sacramente, szo alzo Jacob yôde bekent hefft, des âuendes by lychte myt messen ôck ghesteken worden in Eleazars hûsze in der dorntzen, dâr sze ôck mede weset hefft.
Item Eleazars wyff secht vnde bekent, dat Eleazar
II hostien mede wechghenâmen heff, eyn grôt vnde
eyn kleyne, alzo dat Yacob ôck wol wuste; ôck
bekent, dâr bâuen de vpghenanten V to erer
dochter kost gheweset synt nômelyken Sytan
Kaszeryges yn Francken, Dauyd van Parchym,
mêster Leyspe, Ysrahel vnde Hamborch
 .
.
Item vurder hefft bekant eyn yôde ghehêten Yacob, dat Eleazar van deme Sternebarghe mâkede eyn êndracht bynnen Pentzelyn myt deme monnyke, de dâr kappelan was, dat he em dat sacramente scholde


|
Seite 260 |




|
âuergheuen yn byuesende Jacob vnde Mychael iôde, vnde Eleazar lâuede deme monnyke I gulden; vnde vp de tyth, alzo de monnyck dat sacramente scholde brynghen to deme Sternebarghe, so rêth Jacob iôde dâr hen vnde de monnyck quam dâr vnde brochte II parte, de entfenck Eleazar vnde Yacob vnde Mychael, vnde ys geschên twyschen paschen (April 22.) vnde pynxten (Jun. 10.) in der wedderreysze, don se gheweseth weren by vnszen gnedyghen heren to Zweryn.
Item vurder bekent Jacob, dat Mychael wol I iâr myt deme monnycke vorhandelt hadde, dâr de monnyck wolde eyn iôde werden, szo ys yd gheschên, dat Jacob iôde, Eleazar vnde Mychael to sâmende wêren to Pentzelyn vmme lychtmyssen (Febr. 2), alzo dâr syck gaff de monnyck to erer sâmmelynghe vnde lâuede eyn êwych iôde to blyuende, szo rêth Jacob vnde Mychael to Fredelande vnde de monnyck quam dâr ôck, szo ghêuen em de iôden dâr I marck vth erer offerbussen to syner têrynghe.
Item bekennt eyn iôde ghenômet Smarghe van Parchym, dat he hefft râth vnde dâth vnde vulbôrth ghegheuen vnde hefft dâr tho gheuen I rynschen gulden, dat me dat sacramente scholde kôepen.
Item hebben bekant de iôden to Fredelande to sâmende, dat se alle vulbôrt vnde wyllen dâr tho ghegheuen, dat me dat sacramente scolde kôepen vnde pynnyghen; don sze dat hôrden, dath yth szo wêre gheschên, do weren sze vrô vnde mênden, en wêre wol ghelunghen.
Item des suluen ghelyken hebben bekant de iôden to Roebel, dat sze al vulbort hebben ghegheuen, dat yth szo scholde schên.
Item de iôden worden ghebrant to deme Sternebarghe des mydwekens vôr Symonis et Jude der twyer apostelen (Oct. 24): der iôden wêren XXV myt II frowen.
Item de prêster wort ghebrant des mytwekens na
Gregorio (März 13) anno
 . XCIII°.
. XCIII°.


|
Seite 261 |




|
Die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg schließen mit dem Maurermeister Andreas Techel einen Contract über die Erbauung des Klostergebäudes zu Sternberg.
Wy Magnus vnnd Baltasar vonn gotts gnaden
hertogen to Meckelnborch, fursten to Wenden,
grauen to Swerin
 ., bokennen, dat wy vnnsen lieuen
besundern Drewes Teicheln vor vnnsen murmester,
dat slaphus vnses nigen closters tom Sternberg e
to murende vnnd vullenbringende vp
schirstkunfftigen samer hebben angenamen, in der
meninge vnnd gestalt, dat wy ehme von iederer
rode lang vnnd hoch souen gulden rinsch, eyn vat
biers vnd eynen vetten hamel, dor to vppe allen
arbeit den gantzen samer lang twe wispel mels,
twe vette ossen, eynne tunne botteren, eyne
tunne rotschar, eyne tunne heringes, eyne tunne
kesen, eyne tunne dorssches, XVI siden specks,
IIII schepel soltes vnd IIII schepel erwetten
willen geuen vnd vorreken, vnnd effte ehm wes
von den vpgemelten vittalien ouerigk bleue,
schal vns wedder togekert werden, wollen ehme
ock fryge furinge vnd beddewant mit all synen
knechten, dor to frye v
., bokennen, dat wy vnnsen lieuen
besundern Drewes Teicheln vor vnnsen murmester,
dat slaphus vnses nigen closters tom Sternberg e
to murende vnnd vullenbringende vp
schirstkunfftigen samer hebben angenamen, in der
meninge vnnd gestalt, dat wy ehme von iederer
rode lang vnnd hoch souen gulden rinsch, eyn vat
biers vnd eynen vetten hamel, dor to vppe allen
arbeit den gantzen samer lang twe wispel mels,
twe vette ossen, eynne tunne botteren, eyne
tunne rotschar, eyne tunne heringes, eyne tunne
kesen, eyne tunne dorssches, XVI siden specks,
IIII schepel soltes vnd IIII schepel erwetten
willen geuen vnd vorreken, vnnd effte ehm wes
von den vpgemelten vittalien ouerigk bleue,
schal vns wedder togekert werden, wollen ehme
ock fryge furinge vnd beddewant mit all synen
knechten, dor to frye v
 r vnd wagen vth vnd in Ruppin
schicken vnnd vorschaffen, in crafft dusses
brieues, der twei gelikes ludes vthenander sin
gesneden, de ehne by vns vnnd de andere by
Drewes Techeln, wollen ehm ock alle dage, dwyle
hie bynnen der erden arbeidet, sosz manne to
hulpe schicken.
r vnd wagen vth vnd in Ruppin
schicken vnnd vorschaffen, in crafft dusses
brieues, der twei gelikes ludes vthenander sin
gesneden, de ehne by vns vnnd de andere by
Drewes Techeln, wollen ehm ock alle dage, dwyle
hie bynnen der erden arbeidet, sosz manne to
hulpe schicken.
Das Original auf einem halben Bogen Papier, mit dem Wasserzeichen einer Hand, in Querfolio, unten durch das Wort Meckelnburg in Schlangenlinie aus dem andern halben Bogen geschnitten.
Auf der Rückseite steht von des Canzlers Caspar von Schöneich Hand geschrieben:
"Bestellung eynem maurermeister, das kloster zum Sternberg zcu mawern".
Der vorstehende Contract ward wahrscheinlich gegen das Ende des J. 1502 abgeschlossen. Die Fundation des Klosters ward am 19. Sept. 1500 durch die Bulle des Papstes gesichert; am 20. Nov. 1503 starb der Herzog Magnus, der eigentliche Stifter; der Herzog Balthasar starb am 7. März 1507). Der Bau ging aber wohl langsam fort; denn noch zur Zeit des Canzes Caspar


|
Seite 262 |




|
von Schöneich ward gebauet, und dieser ward im J. 1507 Canzler.
Der Maurermeister Andreas Techel, wohl zu Ruppin ansässig, bauete seit
1503 das Kloster zu Sternberg,
1509 den Schloßthurm zu Lübz,
1513 die Plassenburg (für den Bischof von Havelberg),
1515 die Schloß=Capelle zu Schwerin.
Vgl. Jahrb. V, S. 48.
Der Dr. Johannes von Paltz vom Augustiner=Orden bittet den Herzog Heinrich von Meklenburg um die Beförderung des Klosterbaues zu Sternberg.
In dem Hern Jhesu sin schuldigs vnd demutigs gebeth. Gnedigster furst vnd her. Mir ist leyt der abgang uwer fürstlichen gnaden allercristlichen eldern vnd swester; so aber nyemant dar vor gesin mag, mussen wir das got ergeben vnd getruwelich vor die selen bitten, vnd dan kommet vnser gebeth den eldern kreffticlich czu trost, wan wir irem gutten willen gegen der ere gots vnd sele selikeit getruelich nachkommen. So nu uwer furstlichen gnaden seligs gedechtnis cristliche eldern got dem allemechtigen vnd sancto augustino czu ere vnd dem gleubigen volck czu nucz vnd selikeit haben vnsers ordens eyn closter begunt czu sternberg, der glichen keyns in uwer f. g. landen ist vnd auch in vil landen vmbher ist, czu gleuben, daz sye daz nit haben gethan an sunderlich yngabe des heiligen geist, ist es billich vnd fordert daz auch kintliche truwe, daz uwer f. g. getrulichen helffe, daz solch gude meynong vollenbracht werde. Da wir daz closter czu sternberg in babstlicher gewalt solden vff nemen, da wolde ich wyssen nach dem beuele myns obersten, war vff ich solt die stat czu sternberg vff nemen, da saget mir vwer f. g. vater czu in gegenwertikeit uwer f. g. muter czu dem sant anthonius hoff, daz wir solden haben czu dem closter drye teyele des opffers vnd inkommens czu sternberg, also lang bis das closter gebuwet wurde, vnd auch etliche czyns dem closter gemachet wurden czu cleydern vnd den dingen, die man nit mag betteln, vnd sagte dar czu, wo daz opffer wurde abgen, da got vor sy, so wolde sin f. g. glichwol daz closter buwen vnd versorgen, desglichen da wir solden daz closter innemen czu sternberg, da uwer f. g. auch gegenwertik waz vnd


|
Seite 263 |




|
personlich vns halft infuren, da vermant ich sin f. g. der czusagung, da sprach sin f. g., ich solde den glauben vff sin f. g. seczen, er wolde vns glauben halden. Hyr vmb ist myn demutig beth czu uwer f. g., daz sye wolle an sehen die andacht vnd gute meynung syner frommen eldern vnd wolle helffen, das daz closter gebuwet werde vnd in eyn stant gesaczt nach irer seligen meynong, wirt got an czwifel durch die vorbeth sancti augustini uwer f. g. an libe vnd an sele genyessen lassen. Das vierde teyl nam vs uwer f. g. vater gen rostock czu dem thome, des warn wir wol czu fryde. Gnedigster herr, ich wer gern vff daz begengnis kommen vnd mocht nit von kranckheit; ich wer auch gern ezu uwern f. g. gen kunberg kommen vnd mocht nit vor kelde vnd kranckeit. Ich sende uwer f. g. czu eym nuwen jar eyn hymelische funtgrube, nit me, dan spar uwer furstlich gnade lang gesunt czu syner ere vnd der lande nutz. Datum erfordie ao. dni. M. D. V, vff montach nach vnser lieben frauwen tag purificacionis.
|
uwer
furstliche gnade capellan
vnd schuldiger vorbeter |
|
|
bruder
johan von palcz
doctor augustiner ordens. |
|
Aufschrift.
Dem durchleuchten hochgebornen fursten vnd herren hern Heinrichen herczogen czu Mekelburg  . sym gnedigsten
gun=
. sym gnedigsten
gun=
stigen herren. (L. S.) |
Nach dem Originale im großherzogl. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin, besiegelt mit einem kleinen runden Siegel, auf welchem Johannes d. T. in halber Figur mit einem Agnus Dei im rechten Arme; zu beiden Seiten stehen die Buchstaben: i. p.
Der Dr. Johannes von Staupitz, General=Vicar des Augustiner=Eremiten=Ordens in Deutschland sendet Abgeordnete zur Visitation des Klosters zu Sternberg und zur Beförderung des Klosterbaues.
Durchlauchten hochgepornen Fursten, Gnedigen lieben herren. Meyn vndertänige gepeth vnd dinste seyn E. f. g. beuor. Gnedigen, lieben herrnn. Ich hab durch etzliche meyner väter vornohmen, wie daß new angefangen Closter zw Stern=


|
Seite 264 |




|
berg E. f. g. Stifft eyns tayis durch vngnädigen willen des hochwirdigen hern vnd vaters bischoffs zw Schwerin vnd villeycht anders taylß durch meyner bruder vnordnung biß her vorhindert, also daß wenig daranne gebawet: hette die phlicht meyns ampts erfordert, daß ich meyne bruder visitiret vnd E. f. g. in diemütiger bethe ersuchet hette zu gnediger hulff vnd rate angeruffen, ist bißher durch andere ordens not vnd mergliche gescheffte nachbliben: mag auch dißmalß durch mich in aygner person nicht gescheen. Derhalben han ich vorordent zwene väter vnsers ordens, bayde der heyligen Schrifft doctores, Johannem Voyt vnd Johannem Paltz, mit vndertänigem fleyß bittende, E. f. g. wolle die in gnaden horen, ine helfen vnd raten, daß wollen wir in aller vnser sampnung mit geflissenem gepethe gegen gote vordynen, in hofnung, got sulle E. f. g. vmb sulche wolthat ann leyb, leben, gute vnd eren reychen. Damit beuele ich mich in aller demütickayt E. g. in gnedigen fürstlichen willen. Geben zw Wymar dornstag nach Cantate 1505.
|
vndertanigster
Capplan
Bruder Johannes von Staupitz Reformirter augustiner gemayner vicarius. |
|
(L.
S.)
Aufschrift. Den durchlauchten hochgepornen fursten vnd hern hern Balthasarn vnd hern Haynrichenn gefettern herzogen zw Meckelenburg  . meynen gnedigen
lie=
. meynen gnedigen
lie=
benn hern. |
Nach dem eigenhändigen Originale im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin. Das elliptische Siegel auf grünem Wachs hat ein Marienbild in einer Glorie; die Umschrift ist unklar.
Der Domherr Peter Sadelkow verpflichtet sich, die ihm verliehene Pfarre zu Sternberg auf erfordern wieder abzutreten.
Ick Petrus Sadelkow domhere to Gustrow bokenne vnnd botughe offentlich mit disser myner handtschrifft,


|
Seite 265 |




|
nachdeme my de durchluchtigen hochgebornen
fursten vnnd heren heren Heinrick vnnd Albrecht
gebruder hertogen to Mekelmburg, fursten to
Wenden
 . de parrekerken tome Sterneberghe
der gestalt geleghen, dat ick eren gnaden vp ere
erforderent, wenne sie willen, eynem anderen nha
eren willen vnde gefallen to uorligende
tostellen schall, dat ick dar vp eren f. g. mit
hande vnnd munde togesecht, gelauet vnnd
vorsprakenn, tosegge, gelaue vnnd vorspreke hyr
mit in crafft disser myner hantscrifft, eren F.
G. wo borurt gemelten parre enem anderen na
ereme willen to uorligende, vppe ere erforderent
ane alle behelp thotostellende, Alles by mynen
guden truwen vnnd waren worden. Des to orkunde
hebben ik dessen breff mit myner handt
gescreuen, Signett boseghelt vnnd gheuenn to
Gustrow amme dage conuersionis Pauli anno domini
. de parrekerken tome Sterneberghe
der gestalt geleghen, dat ick eren gnaden vp ere
erforderent, wenne sie willen, eynem anderen nha
eren willen vnde gefallen to uorligende
tostellen schall, dat ick dar vp eren f. g. mit
hande vnnd munde togesecht, gelauet vnnd
vorsprakenn, tosegge, gelaue vnnd vorspreke hyr
mit in crafft disser myner hantscrifft, eren F.
G. wo borurt gemelten parre enem anderen na
ereme willen to uorligende, vppe ere erforderent
ane alle behelp thotostellende, Alles by mynen
guden truwen vnnd waren worden. Des to orkunde
hebben ik dessen breff mit myner handt
gescreuen, Signett boseghelt vnnd gheuenn to
Gustrow amme dage conuersionis Pauli anno domini
 . vndecimo.
. vndecimo.
Nach dem eigenhändigen Originale des Domherrn im großherzogl. Archive zu Schwerin. Untergedruckt ist sein Siegel: Auf Wellen oder Zinnen ein umgekehrtes Herz aus dessen Spitze drei Blumen wachsen, wie es scheint; zu den Seiten D. P. | S.
an magister Niclas Franken
von meynen gnedigen hern
gbrudern den herzogen zu Meckelnburg.
Jrstlich eyn irbietung vnsers gunstigen willens, vnd wo er volgender Zceit in vnsern furstenthumb kommen vnd doryn zcu bleiben willen werden, das wir ine fur andern gerne in gnedigen befelich haben wolten.
Ferrer zcu irczelen, das wir zcum offtern bericht, das er vns als eyn gutter meckelnburger in allem gutten wol zcugethan, auch in kunst, lere, vbung vnd practicke alzo erfaren sey, das er vns fur andern wol dienen konde, dar durch wir, auch aus eynem besundern gnedigen vertrawen, das wir fur andern zu ime haben, bewogen, zcu irsuchen lassen, sich vmb zcimliche belonung in vnsern adir vnserer vndirthanen geschefften, die wir am hoffe zcu Rome haben adir vns ferrer zcufallen mochten, zcu gebrauchen,


|
Seite 266 |




|
vnd im fall do er sich seiner gelegenheit adir geschefften nach her abe zcu reisen wenden wurde, er den vnser gescheffte, die wir ime befolhen hetten, vngeendigt weren, eynem andern gelerten, erfarnen, fleisigen vnd getrewen procuratori mit den acten, schrifften, zcusampt gnugsamen muntlichen vnderricht zcu vbirgeben, die vmb zimliche belonung zcu uorsehen, vnd wie sich geburt, vns zcum besten doryn zcu handeln, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -derhalben wir vorschiner Zceit vnsern Capellan Er Micheln Heleprant, kirchern zcu Sternberg, abgefertigt: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ferrer so sollet ir ine berichten, das in eynem Stetlein Sternberg genant, im Swerinischen Stiffte belegen, doch vns ane allen mittel zcustendig in der pfarkirchen doselbst, dar ane wir vnd volgend alle vnsere Erben das Jus patronatus, ein groser Concursus ist von Cristgleubigen leuten von wegen des heiligen bluts, das wunderbarlich aus eyner eukaristien, das vor zcwanzcig jaren vngeferlich nu vorgangen die schnoden Juden erbermiglich durchstochen vnd verachtet haben, wunderbarlich geflossen ist, wie das noch heut des tags dar ane sichtbarlich zcu irkennen ist, Do denne des Jahres eyn merglich opfer in die block adir Stock, die dar zcu geordent vnd gesatzt sein, als des Jares zcwe, drey, vier hundert fl. mher vnd weniger, ye nach gelegenheit der Zceit, mit dem wir is vnd demnach mit rat vnd wissen vnserer prelaten dermasen gehalten, das man jerlich von solchem opfer, des sey wenig adir vil gefallen, dem pfarrer berurder kirchen I C fl. fur seine gebur gegeben, des alle kerckhern, auch diser kegenwertiger gesetigt gewest ist, in masen der itzig besitzer desselben auch wol benugig ist, vnd das vberige haben wir in arme kloster der juncfrawen vnd bruder, der vil in vnsern landen ist, vnd auch in arme, vorfallene gotsheuser zcu widerbrengung vnd erhaltung derselben wenden vnd keren, vnd weil wir denne got dem almechtigen zcu lobe vnd vff das die verarmten kloster vnd kirchen mit solchen gemeynen jerlichen almusen hinfur adir so lange die wereten, bedacht, in wesen erhalten, vnd wo die im fall weren, in gebeuden vnd anderm widerbracht mochten werden, szo begern wir, er vns dar vff von bebstlicher heilikeit eyne Confirmacion dar vff irlangen vnd ausbrengen mochten, der gestalt, das wir als die landesfursten vnd vnser Erben adir nachkommende fursten, die beiden Capitel Swerin vnd Rotstock vnd der


|
Seite 267 |




|
kerckher zcu Sternberg ider teil eyn Slossel zcu berurten blocken haben, so das keyn teil ane des andern Slossel solche block nicht offenen, das wir vnd sie semptlich solche block jerlich offenen, dem kerckhern I C fl. fur seyne gebur vnd das vbrige nach irer irmessung vnd bey iren Consciencien in arme kloster, Clausen vnd kirchen wenden vnd keren mochten, alles wie oben berurt, doch alzo das sie das Capittel zcu Rotstock, nach deme sulchs eyne newe Erecion ist, nach iren gutbeduncken eyne Zceit lang war mit do von versehen, domit is deste bas vffkom, vnd das er mit solcher handelung heimlich wil vmbgehen, vff das dar ane von etzlichen vmb ires eigenmutigs willen, wie wol solchs mit pillikeit nicht geschen kan, jo nicht zcugefurt wurde. Jtem nach deme auch zcu solchen Concurß keyne Indulgencien erworben, das er von bebstlicher heilikeit Indulgencien, vnd groß als moglich, auch von etzlichen Cardinalen irlangen vnd die vff die folgenden fest als ostern, pfingsten, Corporis Christi, Michaelis, Martini vnd Weinachten vnd derselben octauen stellen wolte lassen. Was auch von gelde zcu ausrichtung solcher Confirmacion vnd Indulgencion not sein wil, wollen wir im durch die Fucker bang vff das anzceigen, das er dar vff durch euch thuen magk, forderlich vbirsenden.
Nach dem Originale von der Hand des Canzlers Caspar von Schönich. Dieser Entwurf ward, mit den übrigen für Rom bestimmten Aufträgen, nach dieser "Handschrift von Doctor Marschalk in latein gebracht vnd durch Johansen abgeschrieben". Die Concepte der nach Rom geschickten lateinischen Briefe und Instructionen von der Hand des Dr. Marschalk Thurius sind ebenfalls noch vorhanden. Der Dr. Marschalk hatte am Hofe die Ausfertigung der auswärtigen Correspondenz, namentlich in der lateinischen Sprache.
Eine Disposition für die Ausführung der Geschäfte zu Rom sagt, von des Canzlers Hand:
Vom Blocke zu Sternberg. Wirt befolhen auffzurichten den fursten ein priuilegium, das sie, mit Zcuthat der Capittel Swerin vnd Rotstock, vnuorhindert zcu ewigen Zceiten das gelt, das dar gefellig wirt, jerlich zcu entpfaen vnd nach irem gutbeduncken in gots ere vnd die hende der armen zcu wenden.


|
Seite 268 |




|
Contract zwischen den Herzogen Heinrich und Albrecht von Meklenburg und dem Maler Erhart (Altdorfer) über die Anfertigung eines Altarschreines für den Altar in der Heil. Bluts=Kapelle zu Sternberg.
Tzu gedencken, das Erhart Maler hat angenomen vnd
bewilliget ein Taffel zum Sterneberge inn der
pfarrkirchen vff den alltar in der Capelle, da
das heylig Sacrament in verwaringe wirt
entholtenn, zu malen vnd machen zugesaget, in
massen wie hiernach folget: Jtem die taffel soll
so breyt vnd hoch sin, wie der Raum des selbigen
Alltars nach schinlicheit erleiden kan, vnd mit
tubelten vffflegen. Jtem vff den alleräussersten
vffschlegen, ehr sie vffgeslagen wirt, sollen
sein gemalt zwen Patron des selben altars vnd
dar für mit gebögten knyen vor itzlichen ein
fürsten. Jtem so die ersten vffschlege
vffgeschlagen werden, so soll man gemalt
befinden den anfange, wie das heylig Sacrament
von den Juden gestochen vnd furter darmit bis zu
ende gehandelt. Jtem so die andern vffslage
vffgeslagen werden vnd die recht taffell sein
soll, darin soll gemalt befunden werden die
passion vnnd das leydenn Cristi vnsers herrnn
von Anfang seins Abendtessens bis zu ende, wie
das aufs formlichst sein marter wirt geteylt vnd
pflegt gemalt zu werden. Vnd solch malwerck soll
aufs subtilst vnnd reynest gemacht vnnd gemalt,
an vilen enden auffs scheinbarlichst verguldet
vnd die taffel soll steen vff einem außgestochen
vnd durchgraben fuße, oben mit verguldten
patronern, alles nach welschem monyer, in form
vnnd allermaße, wie der selbig Erhart maler
solchs den durchleuchtigen fursten herrn
Heinrichen vnnd herrn Albrechten gebrudern,
hertzogen zu Meckelnburg, Fürsten zu wennden
 . nach irem bericht zu thun
zugesagt, auch das solche taffel inwendig funff
vierteil Jars nechst nach dato bey pene seins
verdingten gelts gemacht vnnd by yme bereytt
befunden. Darfur habenn ime gemelte Fursten
geben zu lassen anderhalb hundert gulden
Reynisch an muntze zugesaget, die ime in den
selben funff vierteil Jars mit der Zeit
verreicht vnnd genntzlich betzalt werden sollen.
Wo auch eincherley gebrech durch die fursten ann
der taffel irer gnaden vergebens ermergkt, hat Erhart
. nach irem bericht zu thun
zugesagt, auch das solche taffel inwendig funff
vierteil Jars nechst nach dato bey pene seins
verdingten gelts gemacht vnnd by yme bereytt
befunden. Darfur habenn ime gemelte Fursten
geben zu lassen anderhalb hundert gulden
Reynisch an muntze zugesaget, die ime in den
selben funff vierteil Jars mit der Zeit
verreicht vnnd genntzlich betzalt werden sollen.
Wo auch eincherley gebrech durch die fursten ann
der taffel irer gnaden vergebens ermergkt, hat Erhart


|
Seite 269 |




|
maler bewilliget, solchs irer gnaden gefallenns
zu uerbessern. Des zu vrkundt sein dieser
Zceddeln zwenn gleichs lauts gemacht, mit einer
handt geschriben, aus ein annder geschnitten,
eyner bey denn fursten vnnd der annder bey
Erhart maler verwardt. Gescheen zum Sterneberg
am Sambstag nach dem heiligen ostertag, Anno
 . decimo sexto.
. decimo sexto.
Nach dem Originale auf einem durch große Schnörkelzüge am Ende durchschnittenen halben Bogen Papier. Auf der Rückseite steht die Registratr von des Canzlers C. v. Schöneich Hand: "Erhart malers ausgeschnitten Zcedel der taffel halben zum Sterneberg".
Der Augustiner=Ordens=Vicarius Wenzeslav Linck visitirt das Kloster zu Sternberg.
Heylsamenn friden, den Christus seynenn getrewenn gab, wünsch ich mit meynem vntertenigenn dynst E. f. g. allezeyt bevor. Gnediger furst. Nach ordenlycher gewonheyt vnd meyns ampts verpflycht hab ych itzundt das closter czu sternberg visitiret vnd auß gotlicher gnadenn myt funffczehen personen beseczt alßo befunden, das ych got meynem herren billichenn dangk sage: verhoffe, der almechtige got werde seine gnad weyter verleyhenn czu besserunge vnd auffnehmunge der mangell vnd vnvolkommenheyt. Byt hyr vmb, ob E. f. g. yrgenterley fehell bemelts closters halbenn hette, darczu ych ersprißlych magk seyn, wolle myrs nyt verhaltenn, wyl ich nach meyner vermügenn czu furderunge e. g. stiffts beflissenn erfundenn werden, so doch das E. f. g. nyt handt abeczihe, szundern vmb gottes wyllenn helffe czu vollezihenn angehabenn guts, nemlych der fundacionn verschreybunge mytszampt andern anligenn, darannen der vater prior e. g. wol vnterrychtenn wyrdt. Wollet auch nyt in vngnaden auffnehmen, das ych mych nit perszonlich E. f. g. presentirt habe, dann ych nyt eygentlich gewost, wo ich e. g. fünde, auch dy vngelegenheyt der czeyt mych fürder getriben hat. Hyr befelh ych e. g. gottes barmherczikeyt in szeligenn schutz. Datum Sternberg am tag katharine 1520 iar.
| E. f. g. | |
| vnterteniger Cappellan |
|
bruder Wenzceslaus
Linck
Augustiner vicarius. |


|
Seite 270 |




|
|
Aufschrift.
Dem durchleuchtigenn hochgebornenn furstenn vnd herren herren Hinrich Herzogen czu Megkelenburgk meynem gnedigen herren. (L. S.) |
Nach dem Originale im großherzogl. Geh. u. H. Archive zu Schwerin, besiegelt auf rothem Wachs mit einem elliptischen Siegel mit einem Marienbilde in einer Glorie; Umschrift unklar.
Heinrich Tunkel Herr von Berinzkow, Landvogt der Niederlausitz, bittet um Geleit zur Wallfahrt nach Sternberg.
Durchlauchter hochgeborner Furst vnd her. Mein gantzwillige dinste seint E. f. g. zuuorn bereyt. Gnediger Herr. Ich bitt E. f. g. wissen, das ich willens, wilgott, kurczlich gein der Welsnagk vnd dannen weitter nach Sternbergk zu walfartten, vnd dweil mein reyß also dohin in E. f. g. Landt gefeldt, ist an E. f. g. mein dinstlich bitt, dieselb E. f. g. geruche mir mit dießem meinem bothen ein schrifftlich geleyt durch E. f. g. Landt hin vnd wider sicher durch zu zcyhen, sampt allen den meinen, bis in die funffzcigk pferdt, zu schigken, vnd in deme sich gein mir gnedigs willens erzceigen, Das wil ich widerumb E. f. g. vormogens zu uordienen geflissen sein. Bitte des E. f. g. gnedige antwort. Datum Lubben Sontags Quasimodogeniti Ao. 1521.
| E. f. g. | |
|
williger
Heinrich Tunckel her von Berintzko  .
.
des Marggraffthumbs Nyderlausitz landvoit. |
|
Aufschrift.
Dem durchlauchten hochgebornen fursten vnd hern, Hern Heinrich Herzcog zu Megkelburgk  . meinem gnedigen
hern.
. meinem gnedigen
hern.
(L. S.) |
Nach dem Originale im großherzogl. Geh. u. H. Archive zu Schwerin. Das Siegel ist undeutlich.


|
Seite 271 |




|
Nr. 11.
1523.
Inventarium
vber die Cleynodien,
die zu der Capellen des Sacraments
in
der Kirchen zum Sternberg
nach
tödtlichem abgang des Ostensoris Ern
Diderick Piels
vorhanden
und
durch Verordente als Georgen von
Karlewitz
und Nicolaum Bauman
in
beywesen
beyder Burgermeister
Hansen Rappen und Hansen Poppenhagen
sampt etzlicher des Radts daselbst,
vffm Mitwochen nach dem heiligen
Ostertage
Anno domini
 . XXIII
. XXIII
verzeichent
sein,
und itzlichem teyl ein
Jnuentarium vberantwurt
worden.
Eyn gros silbern Creutz, hat Christoffer
goltschmidt zu Sweryn gemacht.
Eyn Marien
silbern bilde.
Eyn Johannes silbern
bilde.
Eyn Bartholomeus silbern bilde.
Eyn klein Marien silbern bilde.
Eyn klein
Jhesus silbern bilde.
Eyn klein Creuz mit
eynem fuß, silbern.
Eyn Monstrancien mit
einem Straus=Eye, silbern.
Eyn kleyn
silbern Apollen. Eyn silbern Bilde hat Marggraff
Johans geopffert, mit einer silbern vbergulten
ketten am hals.
Zwey par Appollen, eins
verguldet, silbern.
Eynn Wirauchfaß,
silbern.
Zwene silbern kelche vnd zwu
patenen vberguldet.
ist von golt vnd Silber wie volget:
Das erste tuch wigt vier pfundt, mit silbern vnd gulden


|
Seite 272 |




|
stucken, darunter zwey gulden stucke, das grosse geachtet vff vierhundert marckh vnnd das cleyne vff hundert marck vngeuerlich, vnd zwey vnnd dreyssig stucke Silbers kleyn vnd gros, ein vergulter Halsringk vnd ein berlen bendeken.
Das ander tuch wigt drey pfundt, darauf ein vnd achtzigk stucke Silbers, cleynn vnd gros.
Das dritte tuch wigt drey pfundt, darauf neun vnd achtzigk stucke Silbers, cleyn vnd gros.
Das vierde tuch wigt zwey pfundt, darauff neun vnd sechtzigk stucke Silbers, cleyn vnd gros.
Das funfte tuch wigt vier pfundt, darauff vier vnd sibentzigk stucke Silbers, cleyn vnd gros.
Das sechste tuch wigt viertehalb pfundt, darauff acht vnd neuntzigk stucke silbers, cleyn vnd gros.
Jtem neuntzehen stücke Silbers, cleyn vnd gros, sind bey dieses Ostensors zeyten dohin khomen, vnd sein noch nicht vfgemacht, vnd ein Corallenn Schnuer.
Jtem zwei Pacifical, silbern vnd vergult.
die vber dem Sacrament ist,
seint diese folgende Kleinodien:
Vff der einen seitten sindt sieben vnd virtzigk gulden vngerisch, reinisch, hamburgisch, lübisch vnd ander, vnd ein gulden span vnd funf gulden ringe.
Vf der ander seitten seindt sechs vnd virtzigk guldenn, wie obstehet, ein gülden Hefftlein, ein gulden Creutz, sechs gulden ringhe, noch ein klein gulden Creutz, ein Perlen bendeken, ein Soffir steht oben vf der Cappen, ein kleyn gulden ketgen, ein klein silbern kethgen, ein korallen Pater Noster, wigt alles zwey pfundt vnd ein viertheil mit der Cappen.
Jtem am Altartuch sindt drey vnd viertzig stucke spangen, weis vnd vberguldet, vnd sechs vnd funfzigk knopffe, alles silbern vnd verguldet.
Nach 4 verschiedenen in den Hauptsachen übereinstimmenden, in den Nebenangaben oft abweichenden Ausfertigungen im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin. - Auf der Rückseite einer Original=Ausfertigung steht: "Jnuentarium vber die Cleynodien in des Sacraments Capellen zum Sterneberg".


|
Seite 273 |




|
Servo dei fideli, D. Georgio Spalatino, Evangelistae
. 1 )
Gratia et pax. Doctor Schwertfeger, optimus vir, heri placida morte defunctus est, et dormit in Domino, mi Spalatine. Nunc scis, hic esse Joannem Apellum 2 ) alias Principi commendatum, qui suffici possit ad lectionem illius, et optat. Quid autem opus sit, eum tibi commendari, qui noris hominem non solum idoneum pro ea lectura, sed et pium et christianum? Ut taceam, quam sit hactenus re familiari et nominis injuria jactatus, degitque in summa paene penuria, urgeturque egestate domestica. Quam ob rem vides, quam pie collocaturus sis operam tuam, si illum Principi commendaveris et autor fueris, ut refricetur ejus commendatio et spes data bona antea. Quod si uxorcula obstat, quo minus palam adscisci possit, poterit alieno nomine profiteri, stipendio clam tributo. Quamquam quid prosit, ut vos perpetuo dissimuletis, cum nihilominus inaccusatos vos illi non dimittant, et jure possint, quod haereticos foveatis et alatis.
Bremenses proficiunt in verbo, ut jam vocarint nostrum Jacobum Iperensem pro Evangelista in alteram ecclesiam. Duces Mekelburgenses ambo, alter per Hansen Loser, alter per Priorem Sternbergensem, petunt Evangelistas. Dux Henricus Brunsvicensis, teste Cordo Rucio, incipit Evangelion amplecti, vocato quodam nostri ordinis ex Helmsted in concionatorem, quem, postquam Senatus Brunsvicensis recusasset, ipse constituit in domo sua Brunsvigi, ut praedicet. Nam Wilhelmum fratrem ipse captivum quidem, sed christianissimum praedicat. Vratislaviae disputatio Joannis Hessi processit feliciter, frustra resistentibus tot legatis Regum et technis Episcopi. Haec sunt nova. Bene vale in Domino et Apelli ne obliviscaris. 11 Maji, anno MDXXIV.
Martinus Lutherus.


|
Seite 274 |




|
Bei Aurifaber II. 204. b. Vgl. Cod. Jen. a. Fol. 187. Deutsch bei Walch XXI, 895.
Nach De Wette Sammlung der Briefe
 . Luthers, II, S. 510.
. Luthers, II, S. 510.
Luthers Brief an den Prior des Augustiner=Klosters Johann Steenwyck zu Sternberg über die Beförderung der evangelischen Lehre.
Gratiam et pacem in domino. Mi venerabilis pater. Mittimus hic fratrem Hieronymum de Enchusen, si dominus fecit, quod sperauimus. Commendo igitur bonum hominem paternitati tuae et per te principi. Scripsissem principi ipsi, sed causa aliqua intercessit, ne id auderem, ne forte suspitionem et facerem et incurrerem. Gaudeo, quod obstruxeritis os superstitionis et impiae alimoniae vestrae. Dominus det, vt crescat apud vos cognitio Christi vsque in perfectum et regnet apud vos verbum gratiae in omni abundantia spiritus. Amen. Salutate fratres et amicos et orate pro me. Wittembergae dominica post Margarethae 1524.
Martinus Luther.
Johanni Sternwych
priori Augustinensi apud Sternbergam
suo in domino.
Auf einem Quartblatte Papier, mit Luthers bekanntem Siegel mit grünem Wachs versiegelt. Unter der Aufschrift steht von des meklenburg=schwerinschen Canzlers Caspar von Schöneich Hand geschrieben: "24. Luther".


|
Seite 275 |




|
Briefwechsel über den Streit des sternberger Pfarrers Michael Hildebrand mit seinem Vicar dem Pfarrer Antonius Schröder zu Parchim.
Zu gedencken, den Cantzler zu vermanen, och doctor Marschalck, das mit dem official von Rostock geredt werdt vß beuelch myns gnädigen herrn, das er nit wölle wytter procediren cum censuris in der sach zwyschen her Anthonium Schröder betreffend kerckhern zu Barchim vnd myr alß eym kerckherrn zu dem Sternberg vnd mynm Capplanen her Peter Lobelow vnd her Joachim Märtens, sonder Commissarien zu setzen vff bestimpte zeit, in der sach güttlich zu handeln oder wider zue recht wyßen, angesechen das m. g. h. hertzog Heinrich etlich gelt by synen fürstlichen gnaden hat ad depositum die sach betreffend.
|
Michael
Hiltprand,
kerckher zu dem Sternberg. |
Durchluchtige, hochgebarner Furste, gnediger
Herre. Vnse gantzwillige, vnderdenighe vnde
vorplichte denste sinth J. F. G. altzit voran
bereyth. Gnediger Herre vnd Furste, so J. F. G.
vns in krafft eyner Commission den twistighen
saken des kerckherren thome Sterneberghe eins
vnd sins Cappellans de ander deyls orsake
vordent lons in der fruntschop to uorhoren vnd
to slyten vorordent, deme beuelhe gutwilligen
nagekamen hebben wy na vele vorhalinge der
parten behilpes die sake entliken gesleten vnd
gantzliken vordragen, dat wy J. F. G. hirmit
vnderdenigher meyninghe to erkennen geuen. Wuste
wy Juwer F. G. in deme vnd andern vele
gehorsamer vnd vnderdaniger densthe to ertogen,
bekennen wy vns allethidt schuldich. Datum
Temptzin Fridages nha Jacobi Anno
 . XXIIII.
. XXIIII.
| J. F. G. | |
| willigen vnd vnderdanigen | |
|
Johannes Wellendorp,
Preceptor tho Temptzin.
Henningk Halberstadt, Ritter. |
|
Dem durchluchten,
hochgebarnen Fursten vnd
Herrn, Herrnn Hinricke hertoge tho Mecklen= borch  . vnsen gnedigen leuen
herren.
. vnsen gnedigen leuen
herren.
(L. S.) |


|
Seite 276 |




|
vber das Silber,
so auß dem Closter zu Sternberge vntfangen
vnd
in die Sacristie in die pfarkirche daselbist
in vorwarung gesetzt
vnd
von beiden meinen gnedigen hern
vorflossen ist worden.
Anno
 . XXVII.
. XXVII.
Jnuentarium was von Silber im Closter zu Sterneberge befunden vnd in eyner kisten vorflossen in die Sacristie in die pfarkirche in vorwarung gesetzt ist worden:
I grosse silberne Monstrancie.
I klein silbern Viaticum.
IIII vorgulte kilche mit pathenen.
I silbern Nap.
II silberne apollen.
V klein silbern leplin.
II pfundt I vierteil eins pfunds vilerley silber opffer in eyn dock gebunden.
VI silberne pacificalia klein und groß,
II silberne Lepel,
I Cristal in Silber gefast, alles in einem nasch.
II kralenschnore,
I bernsteinschnor,
I parlen platte.
I parlen schnor.
I klein kralen pater noster mit etzlichen silbernen steinen.
I klein gulden hefftlin.
I parlen schilt uff eyne khorkappe gehorig mit eynem grossen silbernen knopfe.
Jtem nachuolgends golt, Silber vnd gelt haben die Monniche bey sich behalten:
II vngerische gulden.
III rinsche gulden.
XXIIßl. alt gelt.
XVI ßl. munte.


|
Seite 277 |




|
III pfundt minus I Vierteil zubrochen pfennige.
I vorgulden silbern kelich mit einer patenen.
I klein silbern viaticum.
II gulden vngeferlich an schreckenberger vnd stendelische pfennige.
Jtem nachuolgende Misgewandt ist im Closter uf dem Chor vorslossen.
I blaw samyts korkappe sampt einer Casel vnd II dinstrocken mit aller zubehorung sampt eynem gulden schilde mit eyner gefasten kristallen, von Herzog Magnus geben.
I syden stucke mausfal to einer Casel mit seiner zugehorung, von Frawen Sophien zeligen gegeben.
I ornat mit II dinstrocken von braun samloth, von Fraw Vrseln gegeben.
I gulden swartz vorblomet Sammit zu eyner korkappen; item der parleschilt vnd amitte dar zu gehorig licht in der kisten bey dem Silber.
I Casel II dinstrocke von siden atlaß grun vnd weiß sampt aller zuhorung, von Caspar Ortzen Frowen zelige gegeben.
II dinstrock von siden atlaß, von Caspar Ortzen Frowen geben.
I Casel II dinstrock von weissen Drellick mit zubehorde, von der Quitzowschen geben.
I vormalde kiste.
I flamisch decke mit VI Stulkussen.
XV altar laken.
V antependia.
XXXII hantdwelen.
III Corporalfuther.
II gradual.
II antifonien.
III Missalia.
I antifonie in vier parte gebunden.
III psalteria.
I grot brevier pro lectoribus chori.
VIII Missings Luchter up die altar.
IIII Luchter mit pfiffen.
(
. allerlei Haus=, Küchen= und Tischgeräth, wie z. B.)
II Missings hantfaße.
I kopfern Becken vnder dem hantfaße.


|
Seite 278 |




|
XII kopfern stulpfen uf dem pipauen.
IX Bedde mit Decken vnd Laken.
XI grapen lutik vnd grot.
Der Kapellan Joachim Schünemann berichtet über den Gottesdienst in der Heiligen Bluts=Kapelle zu Sternberg.
Durchluchtiger, hochgebarner furste, gnediger here. Myn innighe beth to gade allemechtich sampth alles vnderdaniges horsamigen denstes zinth j. f. g. alle tidt bereit. G. H. H. F. Ick arme j. g. Cappellan do j. f. g. demodigen bericht, wo ick dath holden schal myt deme ewyghen lichte to bernende dach vnde nacht vor deme hochwerdigen hilligen Sacramente in der Capellen in j. g. kerken tome Sterneberge, wenthe dar kumpth nyen offer, noch was, offte ichtes wes, vnd de offer, de oltlynges dar kamen zinth, werden na der tidt szer verrynghert, dat sulue bernende licht mede to holende. G. h. de horisten, de myt der tyde vorlenth zinth, der wanen weynicht tor stede vnd ein van den suluen in godt den hern vorfallen, dar ock noch nement myt der Commende boleneth is; ock zinth wellyke, de kerspelkerken vorstan vppe den dorpen vnd in hilligen dagen de suluen tyde nicht waren känen, grote negligentie van kumpth, vnd besundergen, wenn dat hillige Sacramente schal tegeth werdenn na der misse, szelden tor stede zinth dar to syngende uan. G. h. ock etlike de pechte vpbaren, wo vele sze vorlangen känen, vnd den andern weynich gheuen, vnd zinth aller traghest vnd vorsumelick tom loff gades to holende. Ock in IX jaren nene rekenschop van gheschen ist. Hyr zinth etlike arme prester, de de suluen tyde myt flyte waren wolden, de willen fze dar nicht to staden vmme eres beholden geldes willen. G. h. hochgebarner f., bidde j. f. g., j. g. wil my szo gnedich weszen vnd lathe my anthegen scrifftlick, wo ick my dar ane holden schal, vnd my Jr gnedich bouel gheuen, etlike officianten dar tho orden mochte, szo lange J. f. G. dar to geschyckket were, de commenden to vorlenende na jw. g. ghefal, vppe dyt anstande fest nyne negligentie sehen mochte vnd vele lude dar szyck nicht ane ergern mochten, deme hochwerdigen hilligen Sacramente to laue vnd eren to denende, my sunder schryft=


|
Seite 279 |




|
lick antwerde nicht loten mochten vnd dat lon
nemen van gade dem hern, deme szodane loff to
vorbeydende alle tidt sunth to eyme lucksamegen
regemente bouelen. Datum Sterneberch des
dinxtedages na palmarum anno
 . XXXII.
. XXXII.
| J. f. g. | |
| gehorsamige | |
|
Cappelan
Er Joachim Schuneman. |
|
|
Dem durchluchtigen,
hochgebarnen fursten
vnd hern hern Hinrick hertoch to Mekelen= borch  . m. g. h.
. m. g. h.
|
|
|
horsammigen denstliken
g. sc.
(L. S.) |
Nach dem Originale im großherzogl. meklenb. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin.
Fursten vnd herren Herren Albrechten
Hertzogen zu Meckelnburgk
 .
.
Faustini Labeßen,
predicanten zu Gustrow,
schriftliche Antwort,
warumb Er predigt, Teutsche meß helt Teutsch tewfft,
vnd wer ime solichs zu thun beuolhen habe
 .
.
|
Das ist das Ewige leben
(spricht Christus
zum Vater) das sie dich, das du allein warer got bist vnd den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Joan. 17. |
Gnadt vnd Barmhertzigkeit Gottes vnsers lieben himelschen vaters vnd Ewigen fridt durch Jesum Cristum vnsern einigen heilandt vnd gnadenthron von got dem vater nach seiner veterlichen liebe vns, die wir erben sollen das ewige leben, von Ewigkeit zugeordnet vnd geschenckt, sampt meinen vnderthenigen, gehorsamen vnd geburlichen willigen diensten vnd Cristgleubigen gebeth zu Godt durch Cristum sein e. f. g. voran bereith.
Durchleuchtiger, hochgeborner Furst vnd herr. E. f. g. brieff, in welchen e. f. g. anzeigen, wie e. f. g. mich Teutsch


|
Seite 280 |




|
Meß halten vnd teutsch tauffen vnd anders zu enthalten verpoten, darneben auch grund vnd vrsach vnd wer mir solchs zu thun erlaubt, von mir forderth, hob ich des andern tags nach Simonis vnd Jude der heiligen Aposteln billigem gehorsam nach vnderthenigklich vnd mit aller ereerbietunge entpfangen, auch durch lesende verstanden.
Auffs erst, hochgeborner Furst, gnediger herr,
hab ich noch nie gewust, das mir von e. f. g.
Teutsch meß halten vnd Teutsch tauffen solte
verboten gewest sein, deweil ich noch e. f. g.
brieue, wie itzt, noch durch e. f. g. amptleute
muntlich beuelh daruon nie gesehen oder gehort,
hob ichs darumb so nach gehalten, gleich wie ehr
Er Joachim kruse (welchem denn e. f. g. auf
anregen vnd cristliche supplication e. f. g.
lieben getreuen vnderthannen, Amptleuthe, der
auslender vnd anderer mer zu Gustrow daselbst
das heilige Euangelien Jhesu Christi zu der Ehre
gottes vnd heyl der menschen zu predigen
vergunth) vorhin gehalten hat, Wolte sunst G. f.
vnd herr ane e. f. g. willen vngerne was thun,
nachdem ich aus gots gnaden wol weiß, das man
der Obrigkeit, von gots gnaden in die weltlichen
empter gesetzt, in allen iren gepoten an erhe,
leibe vnd gudt treffende billich vnd christlich
soll gehorsam sein
 .
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diß alles g. h. als vom Euangelio, von glawben vnd guten wercken hab ich e. f. g. nicht darumb geschriben, das e. f. g. itzt allererst in Cristum lerne glewben, denn ich weiß jo wol, daß e. f. g. gleich allen Cristen in Cristum Jesum getaufft sein vnd darumb ane zweiuel den heiligen geist in der tauffe entpfangen, durch welchen e. f. g. got wol erkennet im glawben, ane diß mein schreiben, sundern darumb g. h. das e. f. g. meinen Cristlichen vnd in die heilige gotliche schrifft gegrunthen glauben hirauß moge erkennen, denn ich weiß wol g. h., das vil seind, die beide meine lere vnd Ceremonien vor ketzerisch vnd vnchristlich achten vnd e. f. g. vorbringen, aber g. h. hochgeborner furst, e. f. g. konnen aus dissem meinem schreiben leichtlich ermessen, ob meine lere vnd Ceremonien der heiligen schriftt gleichmessig ist oder nicht, Warlich g. h. ich wolte ja lieber nie geboren sein, denn das jennige vnchristliche vnd der heiligen schrifft nicht gleichmessige lere in der Warheit bey mir solte befunden werden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


|
Seite 281 |




|
Zum Dritten. G. h. fordert e. f. g. bescheid, wer mir sollichs alles zu thun erleubt hat. Auffs erste, gnediger hochgeborner furste, seinds e. f. g. lieben getrewen vnderthanen zu Gustrow, die mich zum predigampt inen das heilige Euangelien Cristi zu predigen beruffen haben. So haben auch e. f. g. inen einen prediger vergunth zu der zeit, als Philips Doringk e. f. g. vogt war zu Gustrow, itzundes wol vber siben Jarn. Deß haben sie auch noch g. here e. f. g. brieue, so e. f. g. an Philips Doringen, die gantze cleresey, den gantzen Rath vnd gemein zu Gustrow geschriben haben, das sie das heilige Euangelien zu Gustrow in den kirchen vnd auff dem kirchoue zu gelegener Zeit zur ere gotts, der menschen selicheit, zuneminge deß Cristlichen glaubens, liebe vnd hoffnunge vnuerhindert sollen predigen lassen.
Demnach so hat mich auch der Bischoff, da er mich
zum priester ordinirte, geheissen, das heilige
Euangelien zu predigen, gleich wie Cristus
seinen heiligen Aposteln auch beualhe mit
sollichen worten Marci im letsten beschriben:
Geht hin
 . - - - Vber vnd on das alles hat
mich auch vnser lieber herr Jesus Cristus
selbst, gleich wie allen christgleubigen,
sunderlich so dazu ordentlich beruffen, sein
heilige gnadenreiche Euangelien zu predigen
beuolhen vnd ernstlich gebotten, Mathei vlt.,
Marci im letsten
. - - - Vber vnd on das alles hat
mich auch vnser lieber herr Jesus Cristus
selbst, gleich wie allen christgleubigen,
sunderlich so dazu ordentlich beruffen, sein
heilige gnadenreiche Euangelien zu predigen
beuolhen vnd ernstlich gebotten, Mathei vlt.,
Marci im letsten
 .
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Derhalben g. h. hab ich das heilige Euangelien nach prophetischer, euangelischer vnd apostolischer schrifft außgelegt vnd zu gottes eren vnd der menschen selicheit gepredigt, daneben auch die heiligen Sacramente, nach Inhalt der heiligen gotlichen schrifft vnd angezeigter vrsach, zu gottes eren vnd der selen selicheit, sterkunge vnd zunemunge des glaubens, liebe vnd hoffnunge, mit deutlichen vnd verstendigen Worten in der Cristlichen gemein, wie es bißher mein vorfarer gehalten hat, gehandelt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entlich g. h. hochgeborner furste bitte ich sampt meinen lyeben euangelischen Cristlichen brudern, e. f. g. lieben getrewen vnd gehorsamen zu Gustrow lautter vmb gots willen, e. f. g. wollen doch diese mein geringe schrifftliche antworth auff e. f. g. ansinnen von wegen beide meyner lehr vnd Ceremonien, auch wer mir solchs zu leren vnd zu thun beuolhen hat, gnedigklich


|
Seite 282 |




|
vberlaßen oder horen, mir zu gute halten vnd wie
ein loblicher Cristlicher Landsfurste das
heilige Euangelien zur ere gottes vnd e. f. g.
vnderthanen selen salicheit, wie denn bißher
stets gethan, nach Cristlicher vnd furstlicher
pflicht helffen handthaben. Darzu gebe der
almechtige got vnser lieber vater e. f. g. seine
gotliche gnade vnd spar e. f. g. zu gottes eren
vnd nutze e. f. g. vnderthanen in gluckseligem
Regimente lange gesundt an leib vnd sele
ewigklich durch Jesum Cristum vnsern herren, der
da sey gebenedeyet in Ewigkeit Amen. Datum
Gustrow Dinstages nach Martini Episcopi Anno
domini
 . XXXI.
. XXXI.
| E. F. G. | |
|
vndertheniger,
gehorsamer
vnd williger Capplan |
|
Faustinus
Labeße
prediger zu Gustrow in dem Heiligen geist. |
Der Herzog Albrecht von Meklenburg verbietet dem Prediger Faustinus Labes die evangelische Predigt in Sternberg.
Von gots gnaden Albrecht
Hertzogk zu Meckelburgk.
Ersamenn liebenn getrawenn. Wie wir am jungestenn vonn wegenn der martiniskenn prediccanten deutiske Messenn zu haltenn, zu tauffenn vnd tottenn zu begrabenn vnderredunge mit euch gehabt, auch vnns dabenebens die Zusage, das irs inn keinenn wegenn vergonnen, noch zulassenn woltenn, gethaenn habenn, biss solannge wir vnns mit vnserm liebenn brudernn derhalbenn vereiniget vnnd vertragen hetten. Nhu seindt wir doch inn glaublicher erfharung gekommen, das ir solhes noch vergonnenn vnnd zulassenn vnnd doch nicht straffenn sollet, welckes vnnß dann ewrn Zusagen nach vonn euch nicht ein weinigk thuet befrembdenn. Derhalbenn nochmals an euch vnnser ernste beuelh vnd bogerenn, Jr wollet solhes noch entlich dennselbigen prediccantenn verbietten, das sie sich des, wie obstehet, genntzlichen enthaltenn vnd abstehenn. Wue aber diss vnnser schreibenn vnnd verbiettenn abermals bey euch verechtlich gehaltenn wirth


|
Seite 283 |




|
vnnd vonn demselbigen ewrn furnehmen nicht
abstellenn, seindt wir bedacht, gewaldt mit
gewalth zu sturenn, dann wir entlich willenns,
in dem da wir auch zu regiren vnnd zu gebiettenn
habenn, keines Weges solhes zu leittenn oder zu
uorgonnen. Das wir euch also ferner vor schadenn
zu huettenn wissenn nicht habenn woltenn
verhaltenn. Datum Swerin Sonnabenns nach Agapiti
Anno
 . XXXIII.
. XXXIII.
Denn Ersamenn vnnsernn liebenn getrewenn Burgermeistern vnnd Rathmannen vnnser Stadt Sterneberge.
Ein Schreiben gleichen Inhalts erließ der Herzog, d. d. Swerin Mitwochs nach assumptionis Mariä
 XXXIII, an
XXXIII, an
Vnnsernn liebenn besonndernn
N. prediccantenn inn vnnser
Stadtt Sterneberge.
(L S.)
Dieses Schreiben enthält im Wesentlichen nichts anderes, als was das vorstehende Schreiben besagt, etwa mit Ausnahme der Clausel:
"biß so lang wir vns des mit dem hochgebornen furstenn vnnserm liebenn bruder hern Heinrichenn Hertzogk zu Megkelburgk
., welchs dann vnsers verhoffens kurtzlich gescheen soll, voreiniget vnnd vertragen habenn".
Der schwerinsche Hofprediger M. Egidius Faber ermant den Rath der Stadt Sternberg, an der evangelischen Lehre festzuhalten und den evangelischen Prädicanten daselbst zu schützen und zu ermuntern.
Gnad vnd fryd durch Cristum. Ich byn angesprenget
vnd gebetten worden von euch, lyeben herren vnd
freundt yn Cristo, durch Clauß Fentter
munczergeselle zu Gustrow Ewres predigers
halben, weyl ym zu predigen verbotten yst
 . Darumb, lyeben brueder ynn
Cristo, verman ych vnd bytte euch durch Cristum
Jhesum, myt welchem yr ynn der tauffe bekleidet
vnd angeczogen seyt, last euch das worth nicht
nemen, hanget fest daran, kempfet durch den
glauben frisch vnd frölich, wider welt vnd
teuffel, denn es sind vyl mehr myt vns, dann myt
yhnen, vnd obs got gefellet, waget hyran, was yr
habt, leibe vnd leben, gueth vnd
. Darumb, lyeben brueder ynn
Cristo, verman ych vnd bytte euch durch Cristum
Jhesum, myt welchem yr ynn der tauffe bekleidet
vnd angeczogen seyt, last euch das worth nicht
nemen, hanget fest daran, kempfet durch den
glauben frisch vnd frölich, wider welt vnd
teuffel, denn es sind vyl mehr myt vns, dann myt
yhnen, vnd obs got gefellet, waget hyran, was yr
habt, leibe vnd leben, gueth vnd


|
Seite 284 |




|
Ehre, ehe yr wollet vom wort tretten, daran all vnser heyl, trost vnd salikeyt ligt, sonderlich weil Ewer prediger mit gunst meynes g. h. bey euch prediget, gedencket vnd haltet yn auch für Ewren cristenlichen landsfursthen, Erbheren vnd beschyrmer, welcher ynn gar kurczen tagen bey euch odder nachend vmb euch seyn wyrd; forderlich ruffet vnd byttet zu goth, das er euch dy trewen arbeyter des Ewangelii nicht woell nemen lassen. Dem nach haltet fest ym Wort gottes, last euch nicht schrecken vnd saget Ewerm predicanten, das er fortfare ym predigtampt vnd myt allem was das ewan[ge]lium mit sich [brin]get, wye er bys her gethan hatt, wird er aber weytter etwa durch eynen gotlosen angefochten, so beruff er sich zum Ersten auff Herczog Heinrich, der ym solchs befolhen hat, vnd sol ynn keynerley weys abstehn, bys ym Herczog Hehnrich eyn ander befelh thue; wo er, Ewer prediger, anders thutt, so hatt er Cristum verleucknet. Darnach so berueffe er sich auff dy heylige schrifft vnd auff dy heylligen doctores, welche vnserer lere zustendig seyn, auch auff des bapst decret, welchs auch ynn den grosesten stücken vnsers glaubens myt yns yst. Wer aber sache, das er vber das alles weytter angryffen werd myt disputiren, so wyl ych denn, so weytt meyn g. h. myr das zugestet, ym nach müglichem vleys vnd gottes hülff beystand thun, wo man meyner begeret. Für allen dingen aber seyt eyntrechtig vnd der oberkeyt gehorsam, so weyt leyb vnd gneth belanget; vber Ewr seele aber last nyemand herschen, denn den alleyn, der seyn heilig blutt für euch vergossen hatt, welcher euch sterck ynn seinem erkenntnis. Amen. Dy gnade gottes sey myt euch allen. Amen.
M. Egidius H. H. hoffprediger.
|
Dem Ersamen weyssen N.
Rapp burger=
meister vnd ganczen Ewangelischen gemeyn ynn Sternberg, meynen sonderlichen lye= benn freund vnd brueder ynn Cristo. (L. S.) |
Nach dem von des evangelischen Hofpredigers M. Aegidius Faber eigenhändig geschriebenen Originale, besiegelt mit dessen Siegel: ein Schild, auf welchem ein mit einem bauschigen Oberärmel bekleideter Arm mit einem Hammer auf unregelmäßige Stücke schlägt; über dem Schilde die Buchten: E. [F.]


|
Seite 285 |




|
welch gefunden sinth worden
ihm Closter tom Sterneberge
ihnn jegenwardicheit
Ern Anthonius Schroder und
Ern Johan Meyne,
geschickeden der durchluchtigen vnd hochgebarnenn
Fursten vnd Hern
Hern Heinrichen vnd hern Alberten
hertzogen tzu Mecklenborch
 .
.
ahm Sonnauende nach Quasimodogeniti
Anno
 . XXXIIII.
. XXXIIII.
Item ein Sammith gell ornath ingesprengtt mith II
deinströcken.
Ein ornath mörmelsteins wyse
mith eyner aluen.
Item eyn alue mith
szuarth besetteth.
Eyn alue mith brun
besettet.
Item noch IIII aluen.
Ein
gell kasell mith eyner aluen.
Item XX
dwelen.
Dith alls wenyge angetekenth hebben
dhe geschickeden mith sich gen Sweryn genamen.
Item II bedde mith eynem houetpole, II kussen
mith II paer laken.
Noch IIII bedde mith
IIII kussen, II par laken vnd eyn deken.
Noch I bedde, I houetpoell, II kussen vnd II
decken.
Noch I bedde vnd I eyn
houetpoele.
Item eyn deckebedde mith eynem
houetpoele.
Item XV grapen kleyn vnd
grodtt.
Eyn handuath vnd eyn Seyger.
Noch eyn bedde mith II houetkussen.
Ein
handuath mith eynem vnderbecken.
(Folgt noch allerlei Hausgeräth.)
Item eyn nye schapp vherseygelth.
Item I grodt bedde, dhar de prior vppe lach, mith eyner flameschen buren.
Item Summa dis alle ys in dem Closter tom Sterneberghe in bewarynghe bleuen in bywesende des Er=


|
Seite 286 |




|
samen Rads vth beuell vnser gnedigen hern von Mecklenborch, Anno vt supra.
Item dis ander nauolgende is ock gefunden worden
ymme closter tom Sterneberghe ahm dage Antonii
confessoris, dho de Rath des priors frouwe
vthwysede vth beuell vnser gnedigen hern tho
Mecklenborch, Anno
 . XXXVII°.
. XXXVII°.
Item eyn bedde vnd 1 scap.
Eyn Spunge dhar
suluest gebleuen.
VII tynnen potte.
II
groth kethell, IIII kleine kethell.
Item
noch II ludtke bedde.
II Emmern.
I
rösthe vnd I dreuoth.
I ploch ysern mit
eynem schaer iseren
II paer Schenen vnd I
plochwede mith eyner plochwacht.
I
kethelhake vnd II schotfoerke.
Dyt suluighe Thomas Preyn entfangen vnd in dath Reuenter beslaten in jegenwardicheit des Ersamen Rads tom Sterneberghe.
Auf der Rückseite steht:
Inventarium was bey dem priore in der sternberg hefft inventirtt geworden. 34.
per Sebast. Schenk pptum Gustrowen.,
M. Detleuum Danckwardi thesaur. Rostocke.
et Nicol. Bockholt clericum Swerin dioc. et notarium
vt commissarios principum Hinrici et Alberti
ducum Megapolensium
anno 1534.
Dat kercklen is ein furstlen, besitter Doctor
Hinricus Bulow, van Hertich Hinrick myt wethen
vnde willen hertoch Albrechten, so he sede,
vorlent Anno
 . 27. Pechte darto XXI gude mk. in
den dorpen Pastin, Sülow vnde van der feltmarke
to Sparow, vnde was vthe dem blocke nu kumpt, is
vnseker, wo wol hefft in vortiden hundert gulden
jarlick dar vth gehath, vnde noch LX morgen
ackers
. 27. Pechte darto XXI gude mk. in
den dorpen Pastin, Sülow vnde van der feltmarke
to Sparow, vnde was vthe dem blocke nu kumpt, is
vnseker, wo wol hefft in vortiden hundert gulden
jarlick dar vth gehath, vnde noch LX morgen
ackers
 .
.


|
Seite 287 |




|
Item noch eyn len in der suluen kerke ad altare sancti Johannis baptiste, dat hefft de kerkher to presenterende, de besitter nu her Johannes Kriuitze.
Item noch eyn len sunte gerdruden, dar to hefft de kercher ius denominandi vnde de radt dar suluest presentandi, besitter her Otte Capellan ibidem.
In disser suluen kerken sind VI geistlike
Commenden vor VI Commendisten, dorch de fursten
vth deme blocke fundert vnde maket vor VI
presters, de dar singen de tide dagelick in des
hilligen blodes Capellen, dar dat werdige
hillige sacramente steyt, vnde ghan van beyden
fursten to lenen, vnde wes se dar van boren,
gelt em gelick, vnde is dar to by III dusent mk.
hovetstols vnde belecht - - by den adel, de dath
meyste del van den pechten an sick holden vnde
nycht botalen noch pechte offte rente den
commendisten
 .
.
Besitter disser bauenscreuen commenden nu thor tydt syt disse:
1) her Simon Drepenicht, vorlent van hertoch Magnus vnde hertoch Balthasar auer XXX jaren;
2) de ander her Johan Criuitze, vorlent dorch beide fürsten auer XIIII vorgangen jaren;
3) de drudde Steffen van Stene, vorlent dorch hern hertoch albrechten;
4) de IIII Caspar Frederick, vorlent dorch hertoch Hinrick auer VI vorgangen jaren;
5) Antonius Kreuet de voffte, vorlent dorch beide fursten auer VIII vorgangen jaren;
6) de soeste is noch vnuorlent vnde hefft gehath Georgius Schankepyll, auer IIII jaren vorstoruen.
Item geystlike vicarien vnde lene, so de fursten in disser suluen kerken to vorlenende hebben, folgen hir nha:
Simon Drepenycht hefft eyn len, dar to dorch
beide fursten vorlenth Anno
 . XII
. XII
 .
.
Noch eyn len hefft Bartoldus Sandow dar suluest
vorlenth
 .
.
Her Jacob Meyne hefft dar suluest ock eyn len,
wonafticht to Malchyn, vorlenth dorch seligen
hertoch magnus vnde baltasar Anno
 . VCII
. VCII
 .
.
Her Michael Andree hefft dar ock eyn furstenlen,
vorlenth, wie konden nen boschet krygen dar van
de wile de bositter affsinnych vnde venkelick
syth
 .
.
Her Hinrick Moller hefft ock eyn furstlen, dar
van beyden fursten vorlenth auer XX jaren, so he
secht
 .
.


|
Seite 288 |




|
Joachym Kropelin hefft dar ock ein fürstlen, em
vorlenth dorch beide fursten anno XI
 .
.
Martinus Jagow hofft dar ock eyn fürstenlen, em
vorlenth dorch hern hertoch Albrecht Anno XI
 .
.
Her Johan Reynecke prawest geweset thom Nienkloster hefft ock eyn furstenlen, dar suluest vorlent. Pechte dar to eyne wuste veltmarke Torgeloge genomet; de veltmarke hefft nu hertich Hinrick thor vogedie thom sterneberge. Van dissem lene hefft her Johan Reyneke vorkofft Tonnies Jorden eyne schunestede thom Sterneberge by der vischerstraten belegen.
Item noch sint II furstenlene in disser suluesten
kerken by also beschede, dat dar to hebben dat
slechte de Bockholte genomet thom sterneberge
wanende de denomination vnde bede vnde de
fursten de vorlenynghe, so lange dat blodt des
fundatoris doet is. Pechte dar to VI huuen
landes im Dorpe Lütken=Raden. Bositter nu
Michael Gildehoff vnde Johannes Gustrow
 .
.
In der vagedie buthen dem Sterneberge. Kobrow de
perkerke is eyn furstenlen, besitter her Johan
Criuitze, vorlenth dorch beyde fursten Anno
 . XI
. XI
 .
.
durch die evangelischen Prediger Egidius Faber und Nicolaus Kutzke.
Faustinus prediger klagte vber eynen pfaffen, der heimlich beicht höret ynn der statt, vnnd lieffe hyn vnd her auss der statt ynn dy dorffer, hielt heimliche winckelmesse vnd verleitet dy schafflin, so ym dem faustino beholhen seyn, solchs haben wyr dem selben weitter zu thun verbotten, ym vnd andern pfaffen den greul und misbrauchs des sacraments entdecket vnd sy von vns gelassen.
Des gemarterten sacraments (ob noch das selbe vorhanden) haben wyr mit eynem worth nicht gedacht aus vergessenheit.


|
Seite 289 |




|
Faustinus beklaget sich für vns vnd dem ganzen ratt, wye doctor bülow (der doch eyn vngeschikter kyrcher ist zu versorgen vnd spesen seine schaffe) ym järlich an seinem solde fl. X entzyhen wil, darumb das nu forthyn keyn opffer gefallet ynn seyner kyrche, da mag E. g. auch zu sehen.
Auch yst gancz sternberg bewust, das obgemelter bülaw eyn offenwarer hurer yst, wye auch dy thumpfaffen zu schweryn; noch muß es alles recht gethan vnd gelebet seyn, was sy leren vnd thun, vnd sünde, wer da wider mucket nach gottes befehl. Ach got von himel wye blinde yst dy welt, das sy gottes wort vnd befehl binden wil, so es doch nicht gebunden wil seyn, sondern ym auffürn werden wyr fehen vnd auch füelen, wy wyr gottes ehre vnd sein heiliges wort haben gemeynet.
Der Herzog Heinrich von Meklenburg pensionirt den Pfarrer Antonius Schröder an der S. Georgen=Kirche zu Parchim, Vicar zu Sternberg, zu Gunsten des Superintendenten Johann Riebling.
Wir Heinrich v. g. g. hertzogk zu Meckelnborgk
 . - - Nachdem vns vnser diener vnd
lieber getrewer Er Anthoni Schröder kircher in
sanct Jürgens kirche in vnser Stadt Parchym vf
vnser gutlichs - ersuchen - freywilliglich - -
gemelte vnsere pfarkirche - - gentzlich
resignirt - hat, das wir derhalben Ern Anthoni
Schrödern - - jerlich vffen achten tagk Trium
Regum - - jerlich die tzeit seins lebens fünff
vnd zwentzik gulden Muntze aus vnser Cammer zu
entrichten vnd dartzo jerlich eyn gewenlich
hoffgewant - - zu geben, mit dieser sonderlichen
- darneben gethaner zusage, ops sichs - - also
begeben würde, das derselb, dem wir dieselb
vnser pfarkirche vorleihen, vor ime gnanten Ern
Anthoni Schroder mit todte apgehen würde, das
wir ime genanten Anthoni Schrodern alsdan vor
allen andern mit derselben vnser pfarkirchen
gnediglich belehnen wollen.
. - - Nachdem vns vnser diener vnd
lieber getrewer Er Anthoni Schröder kircher in
sanct Jürgens kirche in vnser Stadt Parchym vf
vnser gutlichs - ersuchen - freywilliglich - -
gemelte vnsere pfarkirche - - gentzlich
resignirt - hat, das wir derhalben Ern Anthoni
Schrödern - - jerlich vffen achten tagk Trium
Regum - - jerlich die tzeit seins lebens fünff
vnd zwentzik gulden Muntze aus vnser Cammer zu
entrichten vnd dartzo jerlich eyn gewenlich
hoffgewant - - zu geben, mit dieser sonderlichen
- darneben gethaner zusage, ops sichs - - also
begeben würde, das derselb, dem wir dieselb
vnser pfarkirche vorleihen, vor ime gnanten Ern
Anthoni Schroder mit todte apgehen würde, das
wir ime genanten Anthoni Schrodern alsdan vor
allen andern mit derselben vnser pfarkirchen
gnediglich belehnen wollen.
Swerin am Dinstage nach Lamperti. Anno
. sieben vnd Dreyssigk Jhar.


|
Seite 290 |




|
Der Herzog Heinrich verspricht die Pfarre zu Sternberg dem Johann Sperling, dem Erzieher und Lehrer der Söhne des Herzogs Albrecht.
Vnnser freuntlich vnnd bruderlich dienst vnd was
wir liebes vnd guts vermugen alletzeit zuuorn.
Hochgeborner Furste, freuntlicher lieber Bruder
vnd Gefatter. Wir habenn Ewer liebe schreibenn,
dorin sie begern, dem Erbarn vnserm lieben
getrewenn Johan Sperlingen, Vnserer
freuntlichenn lieben Vettern preceptorn, die
kirche zum Sterneberge, die nun durch Doctor
Heinrichen von Bulowen seligen vacirt vnd
vorlediget ist, zu lehenen, allenthalbenn
freuntlich vornhomen, Vnnd so wir dan soliche
kirche bereit, souil vns die zu uorleyhen
zukumpt, einem andernn zugesagt, so habenn wir
doch, vnangesehen des, das wir die, souil vns
des gepurt, vorsaget, gemeltem Johan Sperlinge
soliche kirche vff Ewer liebe freuntlich
ersuchenn vnnd in ansehunge, das der vom Adel
vnd Ewer Liebe jungen Herschafft Zuchmeister vnd
Preceptor ist, zugesagt vnnd vorliehenn, Doch
also, wenn sich nun widderumb eine kirche ader
ander leben, so Ewer liebe vnd vns semptlich zu
uorleyhen zukumpt, vacirn vnd vorledigen wurde,
das Ewer liebe die Einem vnserm Diener auch
vorleihen vnd dorinn bewilligen vnd consentiren
wollten, Das wir Ewer Liebe also, der wir
freuntlich vnd bruderlich zu dienenn gneigt
sein, hinwidder freuntlicher meynunge nicht
wolltenn verhaltenn. Datum zu Plawe am Sonnabent
nach dem Suntage Cantate Anno
 . XXXVIII.
. XXXVIII.
Heinrich vonn gots gnaden hertzogk zu Meckelnborgk, Furste zu Wenden, Graue zu Swerin, Rostogk vnnd Stargardt der Lande herre.
|
Aufschrift.
Dem hochgebornen Furstenn vnnserm freuntlichen lieben Bruder vnd Ge= fattern hern Albrechten hertzogen zu Meckelnborgk, fursten zu Wenden, Grauen zu Swerin, Rostogk vnnd Stargardt der Lande herrnn. (L. S.) |
Nach dem besiegelten Originale im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin.


|
Seite 291 |




|
Erstlich sind dem Rathe, Kerckgeschworen, Predigern, Calandeshern vnd Vicarien E. F. G. Credentz vnnd Instruction furgelesen vnnd darnach die Artickel wie den Gustrowischen furgehalten worden. Haben der Rath, kerckher vnnd kerckgeschworne geantwortet, sie wollen demselben allenthalben Got zu ehren vnd E. F. G. zu wolgefallen gehorsamlich nachkomen.
Was die geistlichen Guter im Gotshause an lehnen, brieuen, heuptstuel vnnd Renthe belanget, wil ein Rath gut acht daruff haben, was sie vnderhanden haben, das nichts dauon entkomen, entzogen vnd verrückt werden möge.
Was aber die vicarien vnnd Calandeshern vnderhanden haben, da konnen sie keyne rechenschafft von geben, denn sie wollen ihnen nicht dazu gestatten, noch die rechenschafft an heuptstuel vnnd renthe anzeigen.
Aber die vicarien vnnd Calandesherren sind erbuttigk, wen E. F. G. sampt derselben Bruder etlich darzu verordenen werdenn, wollen sie guten bescheidt daruon geben.
Das sich aber die vicarien bessern vnd das gotlos leben verlassen vnd das heylige Euangelium annehmen muegen, ist keyne grosse hoffnunge. Got mag Ihnen helffenn.
Er Johan Sperlingk. Ist nicht inheimisch gewesen, aber der Rath hat angezeigt, er habe frey Fischerey (de beiden dike vor dem pastiner doer).
XXI marck lubecks jerlich.
So viel acker, da er so viel vff bawen kan, das er seyn haus erhalten kan.
Seyn anteyl aus den kummen.
Er Faustin Labeß. Ist ein gelerter fromer christlicher evangelischer prediger, eins ehelichen lebens, lehret christlich.
Hat jerlich:
|
X fl. vom
kerkhern.
VIII fl. vom lehn S. Gertrudis. |
(Hat nu alle jar 50
gülden
vnde seine thohering. |


|
Seite 292 |




|
Jtem XI marck lubecks vom beneficio exulum, ime vom kuchmeister zu Swaen resigniret.
Hat V kleine Kinder. Jst ihme vnmuglich, das er sich hier mit erhalten konne.
Er hat biß anher von den vicarien nichts von den consolationes vberkomen, aber sie haben zugesagt, sie wollen hinfurder ihme seinen geburenden teyl folgen lassen.
Bittet vmb einen gnedigen verleub: erstlich das er so ein geringe besoldung, zum andern das er niemands in der Kirchen hat, der ihm helffe singen, den der Schulmeister ist noch ein grosser papist.
Die Schule ist mit einem vngelerten Schulemeister versehen, der auch noch ein Papist ist. Es zeiget ein Rath, das E. F. G. gnedige vertrostungen gegeben, das sie jerlich aus gnaden wolle X fl. geben dem Schulemeister zu hulffe, so wolle der Rath auch X fl. darzu geben, damit er XX fl. jerlich zu besoldung habe. Daruff kunte man wol einen gelerten gesellen vberkomen, der die jugent in guten kunsten, ehrlichen sitten vnd gotselickeit vnderweysen moge. Der Rath bittet vndertheniglich E. F. G. wollen Derselben Ihrer gnedigen vertrostunge gnediglich eingedenck. E. F. G. hat solche gnedige Zusage gethan zum Sterneberge am Freitage nach Letare nechstuerschienen.
Er Joannes Criuitz pastor, hat ein Concubin, ist sust zimlich gelert, hat zugesagt, er wolle sein Concubin zur ehe nehmen.
Nach dem Originale von der Hand des M. Simon Leupold; die ( ) Stellen sind vom Superintendenten Johann Riebling eigenhändig beigeschrieben.
1541.
Nach dem Manuale des Visitations=Secretairs M. Simon Leupold.
Er Faustin Labess: cupit discessum: I propter penuriam sui praecii, II propter neglectum scholae; est enim ludimagister papista.


|
Seite 293 |




|
Johan Sperlingk pastor. Frey fischerey. 21 marck lübesch bar gelt. acker daruff et so viel bawett, als er vor sein haus bedarf.
Faustinus Labess. X fl. vom kerkhern. VIII fl. vom lehen s. Gertrudis. Item XI marck lubecks vom beneficium exulum. Sie wollen vleis nemen, das ime die boringe gebessert muge werden. Habet V liberos; non potest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sustentare. Necesse igitur est vt inopiae succurratur. Testimonium optimum habet suae doctrinae et uitae, nisi in sermone longus et incautus.
Die Schule ist nicht wol versorget. E. f. g. hat gnedige vertrostung gegeben, das sie aus gnaden jerlich X fl. geben wolle, damit dem Schulmeister geholfen werden mochte, so wolle der Rath seiner zusage nach auch X fl. geben. Bitten e. f. g. wolle Ihrer gnedigen vertrostung gnediglich eingedenk sein, am freitag nach Letare. Die artikel sindt hier wie zu Gustrow fürgenhomen worden. Was die belanget, wil ein Rath denselben nach seinem vermögen gehorsamlich nachkomen.
Was die geistliche güter im gotshause an lehnen belangent, wil ein Rath gut achtung druff haben, das die guter, so sie itzt in der kirchen vnder handen haben, nicht verkommen sollen. Was aber die Vicarien vnd Calandsherrn vnder handen haben, da konnen sie keyne rechenschafft von geben, denn sie wollen ihnen nicht darzu gestatten, noch die rechenschafft vom heuptstuel vnd renthe anzeigen. Aber die Vicarien vnd Calandeshern sind erbottig, wen J. F. G. sampt Dero Bruder darzu schicken werden, wolten sie gerne guten bescheid darvon geben.
Primo gratias agunt. Es ist ein Erbar Rath erböttig, sie wollen den artikelln gehorsamlich nachkomen allenthalben nach irem vermugen, wie Ihnen furgehalten worden.
Er Anthonius kruger ist verordent vor III jaren, das Sacrament anzuzeigen, welchs ihme ein schwer ampt ist, wolle gerne daruon; sie bitten gnedigs Verleub.
Henricus Lutke der Custer zu Sternberg wehr wol tüchtig zu einem Predicanten.
Johannes Criuitz. Non habet legitimam vxorem, sed vult eam concubinam ducere. Est aliquo modo doctus.
II
 dromet korn. II hufen, die
verhürt er, krigt jerlich II fl. VI marck
lubecks jerlich pacht. 1 fl. wegen virzeiden
dromet korn. II hufen, die
verhürt er, krigt jerlich II fl. VI marck
lubecks jerlich pacht. 1 fl. wegen virzeiden
 .
.
Kerkenguder. Kelcke. 1 monstrantzien. (Das Uebrige ist nicht zu lesen.)


|
Seite 294 |




|
Vorstehende Aufzeichnungen sind den im J. 1841 aufgefundenen Manualien, nach denen der Seeretair M. Simon Leupold das Original=Visitations=Protocoll ausgefertigt hat, entnommen. Das Heft hat schon in frühern Zeiten bedeutend durch Regen gelitten und es ist daher vieles nicht mehr zu lesen.
ecclesie Sternebergensis
anno
 . 45.
. 45.
In villa Lotze.
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - |
In villa Rosenowe.
- - - - - - - -
 .
.
|
Ex ciuitate Sternebergensi.
| Prepositus Bremensis | I floren. |
| Filius Hans Jorden | IIII m. |
| Faustinus Labis | IIII m. |
| Gerhardus Secher | IIII m. |
| Faustinus Labis | IIII m. |
| Henricus Lutken | IIII m. |
| Jacobus Piel | II m. |
| Consulatus ex parte Steffani Stens | I floren. |
Prescriptorum vicariorum predecessores fraterne inierunt, singulis annis (si adessent) de emolumentorum eorum benefitiis predictam summam ad vtilitatem vicariorum expendere, vt in distributione chori cum aliis residentibus essent equales.
| Antonius Schroder | VIII s. |
| Joannes Kryuitze | II s. |
| Gildehoff | VI s. |
| Consulatus Ster | II m. |
| ex parte pastori Verchowen. | |
| Hans Rap | V flor. |
| Idem Rap | I m. |
| Claves Fanter | IIII s. |
 .
.
|


|
Seite 295 |




|
De omnibus prescriptis absque vicariis sunt documenta.
Sunt adhuc multi alii in libro debitorum scripti, de quibus testimonium non constat.
Summa summarum omnium prescriptorum:
II
c
XIII mr. II s. IX
 .
.
anno
 . 45.
. 45.
Ad consolationes in choro:
| In die animarum post Remigii | I m. |
| In profesto Luce | VI s. |
| In profesto vndecim milium virginum | VI s. |
| In vigilia Simonis et Jude | VI s. |
| In vigilia omnium sanctorum | VI s. |
| In die animarum | XXVI s. |
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - -  .
.
|
|
| In vigilia penthecostes | VIII s. |
| Consolatio Vergowen. | |
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - -  .
.
|
|
| In profesto assumptionis Marie | VIII s. |
| Consolatio Vergow. | |
| In vigilia Bartholomei | VI s. |
| In profesto natiuitatis Marie | VIII s. |
| Consolatio Vergow. | |
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - -  .
.
|
|
| Summa pecuniarum omnium consolationum | XLI m. |
| Pastori | XX s. |
| Anthonio Scroder | XVI s. |
| Joanni Kryuitze | XII s. |
| Pauperibus existentibus in xenodochio diui Georgi | I flor. |
| Pastori | IIII s. |
| Anthonio | IIII s. |
| Kryuitze | IIII s. |


|
Seite 296 |




|
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - -  .
.
|
Summa VI
m. X s. VIII
 .
.
|
| Custodi siue editui | III m. |
| Ad exactionem Turcarum | X flor. |
| In die Galli cum rustici precariam portant, procurator exposuit ad refectionem | II m. |
| Cum a rusticis ex villisLotze et Rosenow pactus per procuratorem et consulatum subleuatur in die Catharine pro tunna cereuicie | XXVI s. |
| In reditu ad ciuitatem | XII s. |
| Cum Matheus Blomenberch archimachirus in Rune redditus exsoluebat, procurator exposuit | VIII s. |
|
- - - - - - - - -
- - - - - - - -  .
.
|
Nach dem Originale auf Papier in 4 im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin.
des Silbers
aus der Kirchen zum Sternberge
den 8. Juni 1572.
Vorzeichnus des silbers, so beim Rathe vorhanden:
dies ist dem Rath widervmb vberandtwortet:
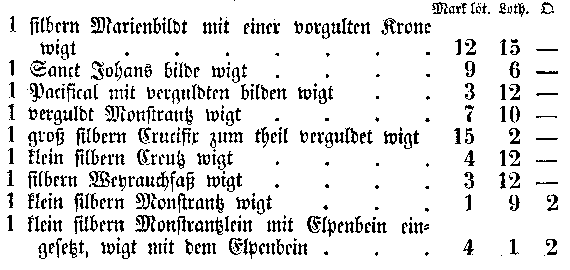


|
Seite 297 |




|
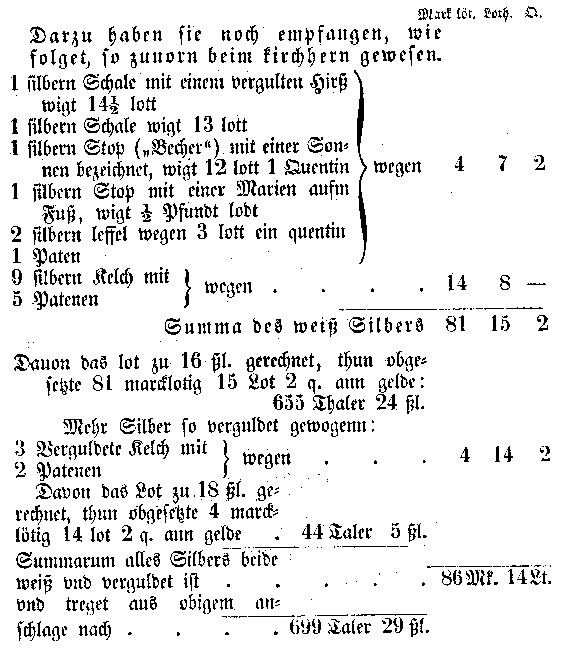
Darauf hob ich von Jochim Plessenn zum Sternberge
gegen mein Q. den 9. Junii Ao.
 . 72 empfangen:
. 72 empfangen:
vnd dieselbe gegen einnehmung der stuck laut vorgesetzts vertzeichnus ohne wieder einwegenn betzalt mit 700 Talern in beisein Johannis Molini, Johannes von Hagen, zweyer Predicanten, zweier burgermeister, des Oeconomi vnd furstender, Vnd ist beiden Predicanten dauon 60 Taler zu Ihrem vnterhalt gelihen, welchs der Oeconomus widerumb gegen Michaelis oder wenn daß gelt außgethan wirt, von irer besoldung dartzulegen. Die vbrigen 640 Taler seindt durch Johannes von Hagenn vnd mich vorsiegelt vnnd in die Gerbkammer geleget den 11 Junii Ao. 1572.
Heinrich Schrader.


|
Seite 298 |




|
seint drei vorgulte kelcke auß= vnd inwendig
mit dergleichen Patenen gelassen:
| weget der grosseste | 1 |

|
11 | lot. |
| der ander | 1 |

|
2 | lot. |
| der dritte | 1 |

|
1 | lot. |
Ein Antipendium ist vngewogen geplieben mit 13 grossen vorgulten vnd 13 halb vorguldete, halb vnvorguldete spangenn. Ahnn demselbigen hangen 32 silbern knopffe halb vorguldet, halb vnvorguldet.
Nach drei Ausfertigungen im großherzogl. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin. In den Visitations=Verhandlungen vom J. 1572 heißt es weiter:
Noch vom Silber zu nehmen 43 Thaler, darvon der Gisenhagenschen 30 Mark entrichtet werden sollen.
Ferner: Noch sollen von des verkaufften Silbers gelde der kirchen zum besten 400 fl. auf Zinse außgethan werden.
was von den herrn Visitatorn
einem jedern Kirch= vnd Schuldiener
zum Sterneberge
zur jerlichen Unterhaltung
vorordenet.
(1572.)
Dem Pastor jerlich 100 fl. vnd das Pfarlehen, darzu sechs morgen gerst= vnd sechs morgen Roggen=Acker.
Cappellan 100 fl., darzu sechs morgenn gersten= vnd sechs morgen Roggen=Acker.
Dem ander Cappellan vnd Pastorn zu Kobrow 30 fl. vnd 40 scheffel Roggen, auch II huefe landes.
Dem Rectori Scholae 50 fl.
Dem Conrectori 30 fl.
Dem Oeconomo 20 fl. vnd sechs morgen Ackers, sol ein Pferdt halten.
Dem Organisten 10 fl.
Dem Custer 10 fl.
Holtzgeldt zur Schulen 10 fl.


|
Seite 299 |




|
Die Gebewte auf dem Klosterhoefe:
1) ein alt stal von 16 gebind, mit rohr gedecket.
2) das Bawhauß von 7 Gebind, 2 stender hoch, mit rohr gedecket, die Gebeln gemauret.
3) ein Stal von 16 Gebind, worunter das Pforttohr, mit Ziegel gedecket, die eine seite gemauret auß der grund.
4) eine neue Scheune von 9 Gebind.
5) Das Closter oder Wonhauß ist von 21 Gebind, oben das bind auf 8 fueß verbunden, sein in demselbigen 16 geschlossene Gewelbe, darunter 8 vnter vnd 8 ober der erden. Oben demselbigen sein 12 Gemächerken, auf jeder seite 6, vnd ist das hauß fest gemauret vnd mit dem holtze oben stark verbunden, ist dachlos.
6) Das Closter ist mit fertigen Glinden vnd mauren vmbringst vmbfangen, auch ein Garten dabey gelegen.
1) Daß Principall=Closterhauß allenthalben mit Ziegelsteinen starck auffgemaurett, ist von 13 gebinten. Der Giebel ins Westen wie eine Kirche aufgemaurett, oben mit einer Wetterfahne, oben am gibel eine lufft, darin 22 tafel glasefenster, das tach mit doppelten holen Ziegel in Kalk belegt.
Das hinterste Gemach, so Hertzogk Vlrichs gemach genandt wirdtt, ist vf der Stadtmauern vbergebawet, mit einem einfachen flomentach, in Holtzwerck außgemaurett.
Folgen die Losamenter vnd Cammern nach dem Gartenwerts vnd
- daß EckLosament, negst dem Jfg. bemeltem Gemachen, - - gehört Jochim Grabowen Hauptman zu.
-
in dem ander Losament
 .
.
-
in dem dritten Losament
 .
.
-
in dem vierten Losament
 .
.
-
in dem fünfften Losament
 .
.
Folgen ferner die Cammern vnd Gemächer gegen vber vff der andern seiten:
a. die Cammer vf der Ecken nach dem Süden.


|
Seite 300 |




|
b. das gemach danegest, darinne ein Schornstein, vber welchem zwei fürstliche Wapen.
c. auf dem wüsten Losament vber dem Treppengewölbe.
d. in der Stauben dabei ein fertiger Kachelofen.
e. in der Cammer.
Der Gang zwischen diesen Gemächern vnd Cammern mehrentheils beallstracket.
An diesem gange für der gemaurten Treppen ein starke thuere.
Vber dieser Treppen ein gewelb.
Kegenüber im Vorgemache, so oben gewelbet vnd vnter beaelstracket, die Küche vnd Speisekammer. Eine Thüre nach dem hofewerts.
In dem großen Reuenther, so gewelbett vnd vnten mit Allstrack, 6 Luffte mit 18 eisern stangen.
Kegenüber die hinterste abgeschaurte Staube ins Norden, 1 Luffte von 9 Tafeln, 1 Kachelofe.
In der Hofe Stauben 3 Luffte, darin ein fertiger Kachelofen. Oben gewelbet vnd abgeweiset, theils roett angestrichen.
Der Keller allenthalben gewelbet. - Oben fürm Platze ein Kellerheusechen.
Die Küche dafür am Platze.
Der Baumgarte ist nach dem Osten mit der Stadtmauren befestiget bis ans Mühlenthor, dafür zu ende die thorbude, daran stost ein gelind von 7 gebinten von dem langen Stalle.
2) Derselbe lange Stall
von 15 gebinten, der
giebel nach dem Mühlentohr in holzwerck
gekleiment, der ander in Westen aber mit einem
alten starken Maurwerk, oben abgebrochen. Daran
ein gelind von 9 gebinden biß an die Ecke, dabei
dan noch ein Neuw gelind biß an das Bawhauß von
10 gebinten, dabei ein abgezeunter garte.
3) Daß Bawhauß
von 7 gebinten,, der
Vorgiebel, daran 2 Meckelburgische Wapen, wie
auch der hintergiebel in holtzwerck gemauert,
nach dem garten mit einem alten Block=, nach der
gassen mit einem neuwen schachttach, die seite
nach der gassen, daran zwei Meckelburgische
wapen, dabei eine neue Maure an das Pforthauß.
(zu nichts nütze.)
Darin: eine Staube, eine Küche, eine kleine Staube, eine Cammer, ein abgeschauerter Kelberstall.
Zwischen diesem Bawhause vnd dem großen Gebeuwte fürm Garten 1 Gelind von 7 gebinten.


|
Seite 301 |




|
4) Der lange Reitestall an der gasse
von 17
gebinten bei der strassen, die seite nach dem
hofewerts geklemeet. Vnter diesem Stalle der
thorweg, dabei ein Pforte, darnegst ein Cammerchen.
5) Die Scheune
ganz neuw, von 9 gebinden,
nach der gassenwerts mit einfachen flachen
Ziegel behenget. Für der Scheunen nach dem hofe
2 flügell vnd nach der strassen 2 flügel.
Hinter dieser Scheunen ein gelind von 15 gebinten, so an die Stadtmauren gehet.
Durchleuchtiger, hochwürdiger, hochgeborner,
Gnediger Fürst vnd Herr.
In waß für einen jämmerlichen vnd erbärmlichen zustande dieß E. F. G. Stedtlein durch die langwirige einquartir= vnd verpflegung der Kayserlichen gegen Wißmar stehenden Troupen, sowoll durch die dabeuor alhie logierte Leib=Compagney Dragoner vnd Ihres Excell. herrn General=Leutenambts Graffen von Gallas zehenwochiges Haubtquartier leider gebracht vnd geraten, Solches werden E. F. G. nicht allein aus dem Landtkundigen geschrey, sondern auch aus vnsern eingeschickten vnterschiedlichen vnterthenigen supplicationibus in frischem andencken sich annoch gnedig erinnern.
Weill wir dan nun glaubwürdig erfahren, das in kurtzer Zeit ein General vffbruch der Kayserlichen Armee geschehen vnd vorgehen werde vnd dabey befahren mußen, do dieß E. F. G. Stedtlein bei solchem vffbrnch mit keiner salva guardia vnd etzlichen Soldaten versehen würde, das sich etzliche Parteyen von den Regimentern abthun vnd daßelbe vollends außplundern, berauben vnd die weinige noch lebende vnd vorhandene burgerschafft, so alle ihre zeitliche wolfahrt, bis vffs leben, zugesetzt, in meinung noch bei ihrer wohnung zu verbleiben, gar ins elend veriagen muchten, vnd solches so viel mehr, weil sich itzo die liebe Erndtezeit herannahet, da sich die meiste Arbeits= vnd handwercksleute auß hochtringender noth vnd eußerster armuett an andere örter in die Erndte begeben vnd ihr brodt erwerben müßen vnd also gar weinig im Stedtlein verbleiben, - - Alß gelangt an E. F. G. vnsere vnterthenige vnd hochfleißige bitte, Dieselbige ----- etwa 40 oder 50 gute


|
Seite 302 |




|
Mußquetirer - - zur Salua Guardia anhero schicken - - muge.
Sternbergk den 10 July Anno 1638.
| E. F. G. | |
| vnterthenige vnd gehorsame |
| Burgemeistere vnd Raht daselbst. | |
Dem durchleuchtigen
 . Fürsten vnd
herrn
. Fürsten vnd
herrn
herrn Adolph Friedrichen Hertzogen zu Mecklenburgk  .
vntertheniglichen.
.
vntertheniglichen.
(L. S.) |
Durchleuchtiger, hochwürdiger, hochgeborner Fürst,
Gnediger Herr.
E. F. G. können wir arme, wollgeplagte vnd auffs eußerste ausgemattete leute in vnterthenigkeit zu berichten nicht vmbgehen, welchergestalt die in Wißmar logierende Reuterey nicht allein am 27. July negsthin alles Rindtviehe vnd Schaffe, so dieses Stedtleins einiger vberbliebener vorraht gewesen, vom felde hinwegk genommen, besondern auch am 3. Augusti mit gewalt in dies Stedtlein gefallen, des herrn Landrichters Jochim Luetzowen vnd vnterschiedlicher bürger heuser, deren nahmen sie vfgezeichnet bei sich gehabt, ausgeplundert, auch noch heute etzliche Pferde, ochsen vnd Schweine für dem Stedtlein hinwegkgenommen, Dahero, vnd wegen des teglichen streiffens vff hiesigem felde, erfolget, das wir das geringe Korn, so der liebe Gott bescheret, nicht einärndten können, sondem daßelbe stehen vnd verderben laßen müßen, vnd also vnter den weinigen noch lebenden leuten nichts gewißers, als große Teurung vnd hungersnoth zu vermuten, Zudem können wir auch nicht absehen, do dergleichen täglicher raub vnd abnahme fur denThoren nicht abgeschaffet würde, wie sich dieses orts hinfuro jemandt vffhalten konte, zumal viele heuser vnd weit über die helffte schon wuest vnd die leute noch teglich schleunig vnd plötzlich an den eingerißenen contagiosischen Seuchen dahin fallen vnd sterben, Vnd obwol E. F. G. gnediges Schreiben wegen restituirung des abgenommenen Viehes wir dem herrn Commendanten geburlich einhendigen laßen, So hat doch daßelbe weinig geholffen, den die Reuter das Viehe ihres gefallens verpartieret, verkaufft vnd verschencket vnd weinig burger etzliche heubter rindtviehe gegen


|
Seite 303 |




|
entrichtung anderthalben Reichstaler vnd 2 ßl. fur ein Schaff wider bekommen, so ihnen doch heute mehrentheilß wider abgenommen worden, wie wir dan auch glaubwürdig erfahren, das diesem Stedtlein noch ferner mit Plünderungen vnd andern vngelegenheiten in Wißmar gedrawet wirtt, Gelangt demnach an E. F. G. vnsere vnterthenige vnd hochfleißige bitte, dieselbige wollen vns arme, ausgemattete leute in vnserm itzigen armseligen vnd jämmerlichen Zustande nicht hülff= oder trostloß laßen, sondern vnß an den herrn Commendanten dero abermaligen gnedige intercessionales mittheilen, des einhalts, das er vns hinferner nicht mehr beschweren laßen, sondern mit einer schrifftlichen vnd geringen lebendigen Salua guardia von etwa zweyen Porsohnen versehen muge, Solches wirt Gott belohnen. - -
Datum Sternebergk den 7 Augusti Ao. 1638.
| E. F. G. | |
| vnterthenige vnd gehorsame | |
|
Burgermeistere,
Rath
vnd weinig noch vorhandene vnd lebende Burger daselbst. |
Dem durchleuchtigen
 . Fursten vnd
herrn
. Fursten vnd
herrn
herrn Adolph Friedrichen Hertzogen zu Mecklenburg  .
vntertheniglichen.
.
vntertheniglichen.
(L. S.) |
Durchleuchtiger, hochwürdiger, hochgeborner Fürst,
Gnediger Herr.
E. F. G. werden leider mehr, dan Ihr lieb, erfahren haben, wie offt vndt viellfältig dieße Statt Sterneberg baldt von Keyserl., baldt Schwedischen Parteien außgeplundert vnd entlich der Rath undt meiste Burgerschafft daraus vertrieben, vndt nicht allein ihr gantzer Vorrath, besondern auch die meisten heußer verrißen vndt zu nichte gemacht, Wiewoll auß hochtringender Nohtt vndt bitterer Armuth unßer etzliche uns zu denen, welche in der Statt geplieben, hinwieder verfueget, des Vorsatzes, unßere ruinirte häußer nach muegligckeit in etwas zu repariren, so befinden wir doch an schutz vnd lebensmitteln großen mangel, dan was wir nur zu unßerm vndt unßerigen kümmerlichen auffenthaltt an weinig Brodt aus den benachbarten Stätten auffm halße anhero tragen, das wirt uns fur dem Maull weggerißen,


|
Seite 304 |




|
- - - Alß gelanget an E. F. G. unßere vnterthänige hochfleißige Pitte, die geruhen, sich vnßerer gnedig anzunehmen vndt bei den Herren Commendanten in Wißmar seine Reutter von weitern eigenwilligen Exactionen abzumahnen, in Gnaden vorsehung zu thun, damit nicht dieße alte vndt vormals wolbewohnt geweßene Statt gahr zur Wustenei gebracht vndt grundtlich uerstöret werden möge. - -
Datum Sterneberg den 16 Febr. Ao. 1639.
| E. F. G. | |
|
vntertähnige undt
gehorsame
in gantzer geringer Zahll anweßende blutharme Burgerschafft. |
Dem durchleuchtigen
 . Fürsten undt
Herrn
. Fürsten undt
Herrn
Herrn Adolph Friedrichen Hertzogen zu Meckelnburg  . vnterthäniglichen.
. vnterthäniglichen.
|
Adolph Friedrich.
Ersame Liebe getrewen, Ob wir wol zu Euch das gnedige Vertrawen gesetzet, Ihr wurdet weil Gottlob nun bereits fur etlichen Wochen die Armeen von Vnsern Grentzen sich begeben, Euch wieder an Euren orth eingestellet, vnnd was zu erhalt vnd Vortsetzung der Statt Bestem ersprießlich in Acht genommen haben, So erfahren wir doch mit mißfallen das wiederspiel vnd das sowol die in Vnsere Statt geflogene Pauren, alß auch sich alda befindende Bürger der Erbaren billigkeit zuwieder dasjenige so von den Soldaten sonderlich in Vnsern vnnd der Hofgerichtsverwanten Heusern vbergelaßen, furters darauß zuentwenden, vnnd die zimmer niederzureißen sich vnternehmen, Befehlen Euch derhalben hiemit gnedig vnd ernstlich, das Ihr Euch nicht allein für Eure Personen mit den Eurigen wieder inVnsere Statt Sternberg vngeseumbt verfuget, besondern auch die vbrige noch abwesende Burgerschafft sich dahin zu begeben, auch wen Ihr die Jenigen, welche wie obgedachte Vnsere vnd der Gerichts Bedienten Heuser beraubet haben, auffragen konnet, dieselben zu restitution der sachen ernstlich anhaltet, vnnd sie geburlich bestraffet, Damit wir nicht künftig Jegen Euch zu verfahren anlaß erlangen, Ihr habet Euch hiernach zu richten, vnnd fur Vnsere wilkürliche straffe zu huten. Datum Schwerin den 16. February Ao. 1639.


|
Seite 305 |




|
An
Bürgermeister vnd Rath zu Sterneberg.
An
den Stattvoigt Anthonium Jordan
daselbst.
Durchleuchtiger, hochwürdiger, hochgeborner Fürst,
Gnediger Herr.
Das E. F. G. vff vnser vntertheniges suppliciren vnd anhalten gnedig geruhen vnd einen Sersianten neben Sechs Mußquetirern zur lebendigen Salua guardia anhero verordnen wollen, dafur thuen gegen dieselbige wir vns vntertheniges fleißes bedancken; ob wir nun woll nichts liebers sehen vnd wunschen wolten, alß das gemelte sieben persohnen zusammen verbleiben muchten, so ists doch leider zu einem solchen elenden zustande mit diesem Stedtlein geraten, das nichts dan große bittere armuet mehr alhir vorhanden, Sintemal das jenige, was ein jedweder an andern örtern eingekaufft vnd mit großer vngelegenheit mehrentheils vffm Rugken anhero getragen in negster plünderung hinwegkgegangen, auch weinig leute in negster Pest alhie vbrig geblieben, dahero die heuser mehrentheils ledig vnd wuest vnd vber 40 Wohnungen klein vnd groß nicht bewohnet sein, vnd zwar guten theils von nachgebliebenen witwen vnd weisen, so nichts in der welt als das bloße leben haben, hingegen aber der vnterhalt der sieben persohnen sich - - alle zehen tage vff 24 fl. belaufft, - - - - Gelangt demnach an E. F. G. vnsere vnterthenige vnd hochfleißige bitte, dieselbige geruhen gnedig, den Sersianten neben zweyen guten Soldaten alhir zur Salua guardi verpleiben - - zu laßen. -- -
Datum Sternebergk den 11 Mai 1639.
| E. F. G. | |
|
vnterthenige vnd
gehorsame
Bürgermeistere vnd Raht daselbst. |
Dem durchleuchtigen
 . Fürsten vnd
herrn
. Fürsten vnd
herrn
herrn Adolph Friedrichen Hertzogen zu Mecklenburgk  . vntertheniglichen.
. vntertheniglichen.
|


|
Seite 306 |




|
Durchleuchtiger, hochwürdiger, hochgeborner Fürst,
Gnediger Herr.
E. F. G. können wir arme, woll geplagte, so viel mahl ausgeplunderte vnd auff den eußersten grad ausgemattete leute in vnterthenigkeit nicht verhalten, Wasmaßen die wenige alhie noch lebende vnd vorhandene leute, so sich nach der alhie logirten Schwedischen Regimenter auffbruch furm Jhare wieder anhero in dieß sehr verwuestete Stedtlein begeben, siethero des herrn Commendanten zur Wißmar Völckern, alß vorerst dem Majorn Lucas Schrödern, so in Bützow logirt, hernacher der Leib=Compagney zu Roß vnd letzlich der vff Plaw logirenden Compagney monatlich ein gewißes, alß vorerst 30 Rthlr., hernacher 20 vnd zuletzt 15 Rthlr. entrichtet, vngeachtet wir selbst keine Lebensmittel, ja das liebe treuge brodt nicht haben vnd vns des hungers nicht können erwehren, Sintemal leider alle nahrung alhie gar danider ligt vnd kein heller zu verdienen ist, zudem im vergangnen ihare alhie nichts ist geseihet oder eingeerntet worden, dahero die Einwohner sich immer mehr verringern vnd wegen großer armut in andere Länder begeben, theilß aber zu Lübeck vnd Rostock sich in allerhandt arbeit gebrauchen laßen, ein stücke brodts zu erwerben, vnd also sehr weinig in diesem Stedtlein mehr vorhanden, wie sich dan auch wegen hiesigen elenden zustandes keiner von andern örtern anhero zu wohnen begiebt, - - - Gelangt demnach an E. F. G. vnsere vnterthenige vnd vmb Gottes willen hochfleißige bitte, dieselbige geruhen gnedig, vns - - mit der contribution hinfuro verschonen muge. - - -
Datum Sterneberg den 30 July Anno 1640.
| E. F. G. | |
|
vnterthenige vnd
gehorsame
Bürgermeistere vnd Raht daselbst. |
Dem durchleuchtigen
 . Fürsten vnd
herrn
. Fürsten vnd
herrn
herrn Adolph Friedrich Hertzogen zu Meklenburgk  . vntertheniglichen.
. vntertheniglichen.
|