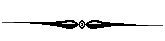|
[ Seite 3 ] |




|



|
|
:
|
I.
Die Frau Fineke.
Von
Dr. Crull
zu Wismar.
Das Behr'sche Gut Grese, eine Stunde südöstlich von Wismar, ist überaus anmuthig am Eingange eines Grundes gelegen. Anhöhen, welche theilweise mit Holz bestanden sind, begrenzen letzteren im Norden und schließen auch den fernen Hintergrund, während südwärts das Gelände allmählig ansteigt. Ein von Levetzow herabkommender Bach, der weiter abwärts, dort, wo er die Feldmark der Stadt Wismar erreicht, in zwei Arme sich spaltet, - der südliche ist jetzt freilich verödet -, um in den Wismar'schen Mühlenteich sich zu ergießen, durchfließt den Grund und trieb ehedem dicht vor dem Hofe eine Mühle, die man jedoch vor etwa hundert Jahren gelegt hat. Ihr Teich umgab bis so lange den Hügel, auf welchem der Hof liegt, nunmehr aber nehmen seine Stelle üppige Wiesen ein, inmitten derer die unregelmäßig, wie das Terrain es mit sich brachte, errichteten Baulichkeiten, umgeben von prächtigen alten Bäumen, einen reizenden Anblick darbieten. Der Teich diente aber ehemals nicht allein dem Betriebe der Mühle, sondern vermuthlich noch früher und vorzugsweise zur Sicherung des Hauses und seines Hofes, eine Befestigung, welche schon 1425 bestand, da bereits in diesem Jahre der Mühle Erwähnung geschieht. Es ist daher fraglich, wofür man eine zweite Befestigung anzusehen hat, deren Reste sich aufwärts am Bache zu Ende des heutigen Gartens finden und in einer theilweise noch von einem Graben umgebenen, nicht ganz kreisrunden,


|
Seite 4 |




|
flachen Erhebung von ungefähr 180 Fuß Durchmesser bestehen, in deren Boden der Spaten sofort auf Mauerwerk stößt. Möglicherweise befand sich an dieser Stelle eine Art Außenwerk, doch spricht gegen diese Annahme allerdings, daß die Communication mit demselben bei aufgestautem Wasser schwierig wurde und die Entfernung vom Eingange der Burg nicht unerheblich ist, nämlich ungefähr 112 Schritte. Eigentliche Baulichkeiten aus dem Mittelalter haben sich zum Grese aber freilich nicht erhalten, doch gehört ein Theil des jetzigen Wohnhauses und zwar die nordwestliche Ecke desselben mindestens einer Zeit an, aus welcher in Meklenburg nicht eben viele ländliche Bauten übrig sind. Es besteht diese Partie in einem Hochparterre, welches zwei nach Norden sehende Gemächer enthält, deren vorderes bei einer Tiefe von 22 Fuß Rh. eine Breite von 16 Fuß, das hintere und äußere aber eine Tiefe von 25 Fuß bei 10 Fuß Breite hat. Jedes derselben ist von zwei Kreuzgewölben überspannt, die sich auf knollenartig gebildete Kragsteine stützen und Rippen von traubenförmigem Profile und rechteckige glatte Schlußsteine haben. Das Aeußere anlangend, so sind die westliche, die Giebelseite, sowie die Längsfacade durch je drei ohne Sockel unmittelbar vom Boden sich erhebende Lissenen in je zwei Compartimente getheilt, die an der Giebelseite wenig breiter sind, als jene Wandstreifen selbst. Letztere verbinden sich durch einen Zahnfries, über dem sich der durchaus glatte Giebel erhebt. Die Fensteröffnungen scheinen mit flachen Stichbogen überwölbt, die Fensterluchten selbst mit der Mauerfläche bündig gewesen zu sein. Demnach gehört der Bau also jedenfalls dem sechzehnten Jahrhundert an und vermuthlich dem dritten Viertel desselben.
Es wäre wunderbar, wenn ein so alterthümliches und romantisch gelegenes Haus, welches mindestens schon neun Generationen diente, keiner Sage sich rühmen könnte, keinen unruhigen Geist beherbergen sollte, und in der That heißt es denn auch, daß eine frühere Besitzerin, eine Frau Fineke in demselben umgehe. Der hoffährtigen Frau, so erzählt man, ward verboten, in ihrem besten Kleide auf eine fürstliche Hochzeit zu kommen. Erbost, daß ihr dadurch die Gelegenheit entging, vor aller Welt ihren vollen Glanz zu entwickeln, dachte sie darauf, diesen Wunsch trotzdem zu verwirklichen, wenn schon erst später, erst nach ihrem Tode, auf dem Paradebette, und befahl, um sich eine Vorstellung zu machen, wie sie sich ausnehmen würde, ein solches herzurichten, legte sich im höchsten Staate auf dasselbe und bewunderte


|
Seite 5 |




|
in einem Spiegel ihre glänzende Erscheinung. Da aber kam der Tod und machte Ernst aus dem frevelhaften Spiele. Ruhelos irrt nun die unvorbereitet Geschiedene nächtlich im Hause umher. Also die Sage.
Als früheste Besitzer des Hofes Grese oder, wie man vormals sagte, to deme Goredze, d. h. zum kleinen Berge, Hügel, Bühel, kennt man die Pren. Werden sie als solche dort im Jahre 1306 zuerst genannt, so ist wahrscheinlich der Besitz derselben doch schon sehr viel früher und allermindestens vor 1279 zu datiren, da sie in diesem Jahre das angrenzende Dorf Dargetzow an die Stadt Wismar verkauften. Auch noch hundert Jahre später, 1379, saßen Prens, vier Gebrüder, zum Grese, aber von vor 1420 bis 1469 war im Besitze des Gutes die öfter besprochene Familie von Bützow - nicht die mit den von Zepelin stammverwandte -, aus welcher ein Martin dasselbe mit einer Erbtochter, wie es scheint, Anna Pren, verheirathet hatte. Sicher von 1476 ab finden wir dann wieder einen Pren, Vollert, im Besitze. Dieser hat 1506 oder 1507 an Klaus von der Lühe veräußert, der in letztgedachtem Jahre, sowie noch im Januar 1509 als zum Grese gesessen bezeichnet wird, und von dem wiederum Jürgen Fineke das Gut erworben hat. 1 )
Jürgen Fineke wird ein Sohn Günthers zu Karow in der Vogtei Güstrow gewesen sein. Er erscheint zuerst 1490 als Nachfolger der von Axekow zum Gnemer, dann aber erst wieder im Jahre 1500 und zwar unter dem Hofgesinde, welches zur Hochzeit der Herzogin Sophia mit dem nachmaligen Kurfürsten Johann dem Beständigen zu Sachsen nach Torgau befohlen wurde. Hernach findet er sich im beweglichen Gefolge auf dem glanzvollen Turniere zu Neu=Ruppin am 23. Februar 1512 und zwar als Theilnehmer am ritterlichen Spiele und wiederum als solcher am 5. Juli desselben Jahres während der Hochzeit der Herzogin Katharina mit Heinrich zu Sachsen=Freiberg. Auch stach er mit auf dem Turniere zu Wismar im Juni 1513, welches zur Feier der Vermählung des Herzogs Heinrich mit Helena von


|
Seite 6 |




|
der Pfalz veranstaltet wurde, sowie endlich bei dem, welches man ebendort am 6. September desselben Jahres abhielt. 2 ) Auf der Wismar'schen Hochzeit war Jürgen Fineke mit seiner Hausfrau, und da die Liste der Geladenen keinen zweiten Fineke, geschweige denn ein zweites Ehepaar aus diesem Geschlechte aufführt, so leidet es keinen Zweifel, daß Jürgens Frau gemeint ist, wenn Reimar Kock, der aus Wismar gebürtige Lübische Chronist, bei seiner Beschreibung der Festlichkeiten, welche durch das fürstliche Beilager 1513 veranlaßt wurden, von dem unerhörten Aufwande spricht, den eine Frau Fineke oder, wie er sich für unsere Gewohnheiten sehr despectirlich, aber der Sitte unserer Vorfahren gemäß ausdrückt, Finekesche bei jener Gelegenheit gemacht habe. Kock erzählt: "Die Edelfrauen aus dem Lande Meklenburg hatten sich mit Schmuck und Kleidern herrlich angethan. Unter ihnen befand sich eine Frau Fineke. Dieser war die Weisung zugegangen, nicht ihr bestes, sondern nur das nächstbeste Kleid anzulegen, und doch konnte man nicht sagen, ob die fürstliche Braut eine prächtigere Figur machte oder die Finekesche. Es war das ein ausbündig hoffährtiges Weib, welches große Summen für ihren Putz ausgab, und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, daß sie bei der Trauung eines unbedeutenden Edelmanns in S. Jürgens Kirche (zu Wismar) einen Rock anhatte, der von Perlenstickerei so steif war, daß sie, als in der Stillmesse alle Frauen niederknieeten, in ihrem Rocke wie in einer Tonne stehen bleiben mußte."
Jürgen Finekes Hausfrau war Katharina von der Lühe, die jüngste Tochter des Ritters Heinrich von der Lühe zur Buschmühlen († 150 0/2) und dessen zweiter Gattin Beata aus dem Lande Holstein 3 ) einziges Kind. Ihre älteren Geschwister waren Anna, seit vor 1501 Wittwe eines Wedege


|
Seite 7 |




|
von Buggenhagen, und Armgard, welche von 1497 bis 1519 Priorin zu Neukloster gewesen ist. Katharina hatte in erster Ehe Kord von Alvensleben, der auch an dem obenerwähnten Torgau'schen Turniere im Jahre 1500 theilnahm, hernach aber nicht wieder begegnet, und heirathete zum zweiten Male und zwar zwischen 1509 und 1513 Jürgen Fineke, wobei sie sich mit Genehmigung der Landesherren, Herzog Heinrich und Herzog Albrecht, gegenseitig zu Erben einsetzten und insbesondere Jürgen unter Zustimmung seiner Brüder und Heinrichs von Wangelin seiner Frau Grese zum Leibgedinge verschrieb. War Jürgen ohne Zweifel eine hervorragende Persönlichkeit am Hofe, wie man aus seiner Theilnahme an den oben gedachten Festlichkeiten und aus dem Umstande schließen kann, daß er auch herzoglicher Kammermeister gewesen ist, so war auch die Wittwe von Alvensleben eine, wie man zu sagen pflegt, große Partie. Herr Heinrich von der Lühe ist ein sehr reicher Mann gewesen. Das ergiebt sich nicht allein aus den Stiftungen von Marien=Zeiten zu U. L. Frauen und zum H. Geiste zu Wismar, zu denen er 1850, beziehentlich 720 Mr. Lübisch hergab und zu denen die vermuthlich gleichfalls begüterte Wittwe noch 750 Mr. hinzufügte, Summen, die nach damaligen Verhältnissen sehr beträchtlich waren, sondern auch aus dem Umfange des Besitzes, über welchen sich die Frau von Alvensleben nach dem Tode ihres Vaters unter Vermittelung des späteren Ritters Mathias von Oertzen und Siverts von Buchwald mit den Nachfolgern im Lehn, Kord und Otto von der Lühe, auseinandersetzte. Derselbe bestand aus der Buschmühlen, Spriehusen, Neu=Garz, der Gerwensmühlen, Mesekendorf, Alt=Karin, den beiden Simen, dem Altenhagen, Gerdshagen und Warnkenhagen, doch werden freilich bloß die drei oder vier ersten Güter reines Eigenthum gewesen sein, während an den übrigen vermuthlich nur Pfandrechte bestanden. Mit ihren Schwestern hat die Frau von Alvensleben offenbar schon vorher sich geeinigt und galt nunmehr als alleinige Erbtochter zur Buschmühlen. Ehrenrechte, wie das Patronat einer Vicarie zu Neubukow, 4 ) haben die Geschwister aber noch in Gemeinschaft behalten.
Ob die Fineke'schen Eheleute nach dem Sommer 1513 zur Buschmühlen ein zurückgezogenes Leben geführt haben,


|
Seite 8 |




|
oder ob sie noch wieder zu Hofe gegangen sind, können wir nicht sagen und nur vermuthen, daß sie sich zeitweilig zum Grese aufhielten, da sich sonst wohl kaum die Verbindung mit dem Wismar'schen Gardian, Nicolaus Finke, gemacht haben würde, der im Mai 1524 eine Summe Geldes der Frau Fineke zu treuen Händen übergab. Jürgen war am 6. November 1529 noch am Leben: später sind wir ihm nicht wieder begegnet. Als er todt war, traten seine Erben mit Forderungen an die kinderlose Wittwe heran, die sich theils auf Silberzeug bezogen, welches von Hardenack von Bibow (von Westenbrügge?) stammte, theils auf Jürgens Nachlaß überhaupt, theils aber auch auf das der Wittwe zum Leibgedinge verschriebene Gut, welches man ihr streitig machen wollte. Das Silber gab die Frau Fineke, wenn auch erst auf fürstliche Anordnung, her und kehrte die Legate aus, die ihr verstorbener Ehegatte in seinem Testamente ausgesetzt, aber den weiter gehenden Ansprüchen der Fineke, von Quitzow, von der Schulenburg und von Wangelin setzte sie einen energischen Widerstand entgegen und wehrte sich mit Rechtsgutachten, die sie von Ingolstadt, Tübingen, Leipzig und anderen Universitäten kommen ließ. Der Streit nahm indessen einen so bösen Charakter an, daß sie trotz erhaltenen fürstlichen Geleits vor Gewalt draußen auf dem Lande, wenn nicht Leib und Leben, so doch Hab und Gut und vielleicht ihre Freiheit gefährdet hielt und deswegen nach Wismar hineinzog, wo sie noch das Haus haben mochte, welches ihrer Mutter vormals zum Wittthume verschrieben worden war. Von hier aus fand sie dann unter Vermittelung Herzog Heinrichs die Verwandten ihres Eheherrn mit 4000 Fl. ab und machte damit dem weiteren Drangsaliren derselben ein Ende. Trotzdem ist sie aber nicht wieder hinausgezogen sondern hat vielmehr, wie der Anwalt der Stadt Wismar sagt, auch ferner alldort "mit ihrem Habe und Guttern gewonet und hauß gehalden, zu der Kirche und zu Marckte gangen, gekaufft und verkaufft, und sich aller anderen bürgerlichen Freyheiten, Nutzung und Gerechtigkeit gebraucht." Ein Sivert von Buchwald stand ihr als "Diener" zur Seite. 5 )
Frau Katharina Fineke starb 1540 oder 1541 und zwar ohne ein Testament errichtet zu haben. Als Erben


|
Seite 9 |




|
meldeten sich Martin von Waldenfels, Parum von Plate und Chrysostomus von Maltzan, alle drei von wegen ihrer Frauen, der Vormund Heinrichs und Hennings von Bülow Kinder, Benedict und Hans Gebrüder von Pogwisch von Farve, Hans von Pogwisch zu Hamburg, Katharina von Pogwisch, Wittwe Friedrichs von Alefeld zu Haseldorf, Michel Heist und Johann, Benedict und Christopher Brüder, und Margareta, Helena, Ursula, Brigitta, Agatha und Elisabeth, Schwestern, des alten Hans von Pogwisch Kinder von Vresenborg, und sonstige Ansprüche machten Kord und Otto von der Lühe, Klaus Fineke und sein Bruder zum Grese, Karin Moltke im Namen seiner Schwester Kerstine, einer Rostocker Klosterjungfrau, Heinrich von Stralendorf, Bürgermeister und Rath zu Wismar 6 ) und das Schweriner Domcapitel. 7 ) Eine stattliche Reihe von Prätendenten, fürwahr! Stattlich genug war aber auch die Erbschaft, um selbst die aussichtslosesten Ansprüche in Bewegung zu setzen. Der Wismar'sche Rath schlug den Werth des gesammten Nachlasses auf 80000 Mr. Lübisch und das Baarvermögen allein auf 60000 Mr. an, eine Schätzung, welche jedoch hinter dem wahren Betrage ansehnlich zurückbleibt, über den zwei Inventarien uns glaubwürdige Auskunft geben. Das eine derselbe * ) welches offenbar bald nach dem Tode der Erblasserin aufgenommen worden ist, verzeichnet 17819 Mr. in klingender Münze und 53700 Mr. in Schuldverschreibungen,
 vor Wall= vnd Grabe[n]=Geldt,
dass ist Summa von iderm hundert Marckhen
viij Lüb.
vor Wall= vnd Grabe[n]=Geldt,
dass ist Summa von iderm hundert Marckhen
viij Lüb.
 dass ist von tausent Marcken
funff Lubsche Marck -, darzu alle Jar von
dem Hausse
viij
Lüb. Schilling
Wachtgeld u. s. w." Als servitia
personalia werden genannt: Thor hüten,
Graben reinigen, Wälle bessern, Wacht
bestellen und Anderes, "so zur Zeit
verfolget"
dass ist von tausent Marcken
funff Lubsche Marck -, darzu alle Jar von
dem Hausse
viij
Lüb. Schilling
Wachtgeld u. s. w." Als servitia
personalia werden genannt: Thor hüten,
Graben reinigen, Wälle bessern, Wacht
bestellen und Anderes, "so zur Zeit
verfolget"


|
Seite 10 |




|
während das andere vom Jahre 1572 - denn damals war die Sache noch nicht geordnet und Hippolyta, des Chrysostomus von Maltzan und der Margareta von Bünow Tochter auch noch 1576 nicht befriedigt - die letzteren zu 67900 Mr. angiebt, so daß also an Geld und, wie man jetzt sagen würde, Papieren allein schon rund 80000 Mr. nachgeblieben wären.
Zu diesen 80000 Mr. kommt dann aber noch der ansehnliche Werth der gesammten fahrenden Habe, welche im ersten Inventarium aufgezählt ist. Darnach fanden sich zunächst an Silberzeug 3 große und 1 kleine Schale, 20 größere und kleinere Trinkgefäße, 3 Kännchen, 24 Löffel und 1 Forke. An Pretiosen waren vorhanden 3 Kleinode, (Medaillons, Breloques) und 3 Riechbüchsen, 6 Halsbänder, 4 Ketten, 2 Rosenkränze, 21 Ringe, sowie 2 Hauben und 3 Brusttücher oder Bruststücke, jene Dinge selbstverständlich durchaus massiv von feinem Golde - nur ein Halsband und die beiden Rosenkränze waren von vergoldetem Silber - und Alles mehr oder minder mit Diamanten, Smaragden und anderen edlen Steinen und mit Perlen geziert. Außerdem fanden sich noch einige kleinere Werthsachen und eine große Menge ungefaßter Perlen und Edelsteine. Die Garderobe der Frau Fineke aber anlangend, so hat man verzeichnet 3 Röcke von Goldstoff, 2 von Sammet, 1 von Dammast, 2 von schillerndem Seidenstoffe, 1 von "Kartek" und 2 von Tuch, ferner 1 "saien" und 1 dammastenes Unterkleid, 1 Leibrock von Atlas, 3 sammetne, 2 dammastene, 1 taffetne und 1 Tuch=Joppe, sowie 1 dammastenen und 2 Tuch=Mäntel. Der Rock von Kartek war blau, der eine schillernde Rock braun und der eine Tuchrock weiß, sonst waren alle Kleidungsstücke, natürlich die Röcke von Goldstoff ausgenommen, schwarzer Farbe und meist mit Marder, Grauwerk, auch Hermelin gefuttert, vielfach mit Sammet verbrämt.
Die Betten verzeichnet das Inventarium vielleicht nicht vollständig, Leinenzeug aber, Zinn und Kupfer, Wirthschaftsgeräth überhaupt und das Mobiliar leider ganz und gar nicht. Daher also, und weil bei den annotirten Gegenständen keine Schätzung angegeben ist, sind wir außer Stande, den Werth der fahrenden Habe mit einiger Sicherheit festzustellen. Das Mobiliar kann nicht groß gewesen sein, da die Häuser in Wismar jener Zeit außer der an der Straße gelegenen Dorntze oder Wohnstube selten mehr als noch ein ordentliches Zimmer im Hintergebäude hatten, falls ein solches überhaupt vorhanden war, und mag auch keinen er=


|
Seite 11 |




|
heblichen Werth gehabt haben, da es nur aus ein paar eichenen Bänken, Tischen, Laden, Bettstellen, vielleicht ein paar Hängeschränkchen und einer Schenkscheibe bestanden haben kann und nach alten Bildern aus jener Zeit und einzelnen Ueberbleibseln von großer Einfachheit gewesen sein wird. Leinenzeug hat sich wohl nach unsern Begriffen in ungenügendster Menge vorgefunden, denn der Bedarf an Leib= und Bettwäsche, sowie an Tischtüchern - Servietten kannte man nicht und ihre Stelle vertrat ein neben einem Waschbecken aufgehängtes Handtuch - war im Mittelalter sehr geringe und noch nach der Kleiderordnung der Stadt Lübek von 1619 erhielten dort die reichsten Bräute z. B. an Leibwäsche nicht mehr zur Aussteuer als 30 Schürzen, 20 Hemden, 12 Kragen und 12 Mützen; die "Koffer voll Leinenzeug" sind eben erst im vorigen Jahrhundert aufgekommen. Verhältnißmäßig wertvoll mag aber dasjenige gewesen sein, was an Kissen zum Belegen der Bänke und Stühle, an Teppichen zur Bekleidung der Wände, was an Zinn, Kupfer, Messing, Grapengut vorhanden war, da Geräthe aus diesen Metallen in großer Zahl gehalten wurden und nicht allein die Küche, sondern auch und vorzugsweise die Hausdiele schmückten.
Der Wismar'sche Rath hat, wie bereits angegeben ist, das Baarvermögen der Frau Fineke auf 60000 Mr. Lübisch geschätzt. Wenn er mit dieser Schätzung jedoch, wie wir gesehen haben, um ein Viertel hinter dem wahren Betrage zurückgeblieben ist, so berechtigt uns das wohl, diejenige des "Geschmucks und Geräthes", wenn auch nicht für eben so zurückbleibend, so doch für nicht übertrieben zu halten, und es würde demnach, da jene Dinge auf 20000 Mr. taxirt sind, das gesammte nachgelassene Vermögen der Frau Fineke rund 100000 Mr. Lübisch betragen haben. Diese Summe aber kommt, wenn wir den Preis des Roggens zum Grunde legen, von dem man derzeit für dieselbe 200000 Scheffel kaufen konnte, gegenwärtig einer Million Mark preußisch gleich. Vermögen von dieser Größe sind nun freilich heute in Meklenburg so selten nicht, indessen wenn wir berücksichtigen, daß sich 1557 Hans von der Lühe zu Madsow auf 9000 Mr., 1564 Vicke von Koppelow zu Möllenbek auf 7500 und Mathias von Restorf zu Wessin auf 5000, 1565 Achim von Lesten zu Gottin auf 15000, 1572 Heinrich von der Lühe zur Buschmühlen auf 30000 und Jochim von Stralendorf zu Trampz auf 6000 Mr. Lübisch schätzten - Beispiele, die sich eben bieten und nicht gesucht sind -, so ist jeden=


|
Seite 12 |




|
falls das Vermögen, welches die Finekesche nachließ, als höchst bedeutend und ausnahmsweise groß anzusehen. Sehr ungewöhnlich würde es aber in unseren Tagen sein, wenn jemand, wie diese Frau, den fünften Theil seines Vermögens in fahrender Habe anlegte, im Mittelalter jedoch und auch noch später waren Kleidungsstücke von weniger vergänglichem Werthe als jetzt und erbten als geschätzte Nachlaßtheile auf Kind und Kindeskind, Zinn und Kupfergeräth behielten ihren Werth, und was die edlen Metalle anlangt, so waren solche so sehr beliebt, ja Bedürfniß, daß man oft unter nahezu armseligen Nachlässen doch einen silbernen Napf, einen silbernen Becher oder dgl. findet. Immerhin erscheint die Garderobe der Frau Fineke, erscheinen ihre Pretiosen und das Tafelgeschirr als sehr reich und kostbar, wenn es uns bis dahin auch an ähnlichen Verzeichnissen über die Habe von Frauen vom Adel aus jener Zeit zum Vergleiche vollkommen fehlt, 8 ) und es ist wohl denkbar, daß die Toilette der Dame bei der adeligen Hochzeit in Wismar so großes Aufsehen erregte, daß Reimar Kock diese Erinnerung aus seiner Knabenzeit in frischem Gedächtnisse behielt. Wenn er insbesondere die kostbare Perlenstickerei des Kleides hervorhebt, welche die Frau Fineke hinderte, gleich den anderen Frauen andächtig niederzuknieen, so fehlt dafür allerdings eine directe Bestätigung im Inventar, insofern in demselben kein perlengestickter Rock aufgeführt wird, doch war die Menge von großen und kleinen Perlen in ihrem Nachlasse so bedeutend, nämlich außer "etzlichen großen Perlen" noch 34 3/4 Loth, daß sie wohl hingereicht haben könnte, um die Herstellung einer ganz besonders prächtigen Stickerei zu gestatten. In der That müßte auch der Pastor Kock ein außerordentlich leichtfertiger Mann gewesen sein, wenn sein Bericht, den er als Augenzeuge giebt, nicht in der Wahrheit begründet gewesen sein sollte; insofern er aber den Charakter der Frau Fineke überhaupt in einem üblen Lichte erscheinen läßt, darf man wohl seinen puritanischen Amtseifer mit in Rechnung Ziehen, dessen lebhaftesten Ausdruck wir oben sogar unterdrückt haben, obschon andererseits auch einiger Grund zu der Annahme vorzuliegen scheint, daß die Interessen dieser Frau ein wenig zu sehr auf Putz und Staat und Geld und Geldeswerth gerichtet waren, als daß man sie


|
Seite 13 |




|
hätte besonders liebenswerth und achtungswürdig finden können.
Bei alledem mag übrigens nur der Schein gegen sie sein. Die Localsage darf keinenfalls zur Bekräftigung des schlechten Nachruhms herangezogen werden. Sehr wohl kann das Andenken an die reiche und prächtige Frau in Grese sich erhalten haben, aber wenn nicht Alles trügt, so ist die Erzählung von der fürstlichen Hochzeit dem Berichte eines Historikers des vorigen Jahrhunderts 9 ) entnommen und die Angabe über Art und Weise ihres Todes ein willkürlicher Zusatz, der schon wegen der Rolle, welche dem Spiegel darin zugetheilt ist, seinen neueren Ursprung an der Stirne trägt; im sechzehnten Jahrhunderte hatte man nur erst kleine, meist metallene Handspiegel und mittelst eines solchen hätte Frau Fineke schwerlich ein einigermaßen genußreiches Abbild ihrer Erscheinung sich verschaffen können. Erwägen wir dazu, daß die Sage Ereignisse zusammenbringt, welche beinahe dreißig Jahre auseinander liegen, nämlich das fürstliche Beilager und den Tod der Frau Fineke, und daß das Herrenhaus zum Grese allem Ansehen nach erst im dritten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts, also nach ihrem Tode, erbaut worden ist, Gespenster aber, so viel man weiß, nicht umziehen, so dürfen wir uns wohl der Hoffnung hingeben, das so heimliche Haus von der Nachtgestalt befreit zu wissen, wenn freilich auch noch in Zukunft dort manchem bei nächtlicher Weile ein knackender Schrank oder eine offengebliebene Thür, die der Zugwind rührt, die Sage in unbehagliche Erinnerung bringen mag.


|
Seite 14 |




|
Anlage.
Inventarium über den Nachlaß
der
Frau Katharina Fineke,
geb. von der Lühe.
(1541.)
A) In der breffladen.
- V c gülden Lauyn von Bulow. 1 )
- I m mr. Lippolth von Ortzen. 2 )
- I c gulden Lutke von Quitzow. 3
- I c gulden noch Lutke von Quitzow. 3 )
- II c gulden noch Lutke von Quitzow. 4 )
- XV c gulden Cordt Rhor. 5 )
- VIII c gulden her Henninck Haluerstadt. 6 )
- VII m mr. Johan von Powisch. 7
- V m mr. Henninck Powisch. 7 )
- II c gulden Hans von Bulow thor Symen.
- I breff hertoch Albrechtes tho Mekelnborch, darynne Jurgen Fineke der Phinikesschen eyne auergaue gedan hefft. 8 )
- I breff noch, hertoch Hinriches tho Mekelnborch, vordracht twisschen der Phinikesschen vnnd Jurgen Phineken eruen vpgerichtet. 9 )
- Im gulden Jurgen Moltzan. 10 )


|
Seite 15 |




|
- II c gulden Jurgen Moltzan.
- VI m II c mr. Hans Kock tho Lubeck. 11 )
- III c gulden Chrisostomus Moltzan. 12 )
- I m gulden Chrisostomus Moltzan.
- II c gulden Chrisostomus Moltzan.
- II c gulden noch Chrisostomus Moltzan.
- II m gulden hertoch Albrechten. 13 )
-
II
 m gulden Hinricke Plessze.
14
)
m gulden Hinricke Plessze.
14
)
- IIII c gulden Hennike Plessze.
- IIIIc mr. Hennike Plessze.
- I m gulden Otto von der Lue. 15 )
- VII c gulden Otto von der Lue.
- I m gulden Cordt von der Lue. 16 )
- VI c gulden Cordt vnd Otto von der Lue.
- III c gulden Cordt von der Lue.
- III c gulden 17 ) Cordt von der Lue.
- IIII c gulden Eggerdt Quitzouwen. 18 )
- I m gulden Eggerdt von Quitzow.
- I c gulden Eggerdt von Quitzow.
- I c gulden noch Eggerdt von Quitzow.
- II c gulden Parum von Plathe, de loss syn scholen. 19 )
- II c gulden Ludeloff von Aluenslegen. 20 )
- VI c mr. 21 ) Werner Bulouw.
- V c gulden Vicke Basseuisszen, so in eynem wedderkopesbreue vorpandeth. 22 )
- I c gulden Clawes Bernher. 23 )


|
Seite 16 |




|
- V c gulden Hinrick Smecher, scholen affgeloseth syn. 24 )
- I m gulden Parum von Plathe.
- II m gulden Parum von Plathe.
- I m gulden Parum von Plathe. 25 )
- Eyn vordracht twisschen der Phinekeschen vnde den von der Lue des gudes tho der Buschmolen. 26 )
- Jurgen Phineken eruen quitanz auer IIII m gulden vor ere gerech[t]icheit vnd thosprache, die se von der Phineckesschen entpfangen hedden. 27 )
- Jurgen Phineken eruen quitanz von wegen ethliches suluers entpfangen. 28 )
- Jurgen Phineken eruen quitanz von wegen ethliches suluers entpfangen. 29 )
- Der Wangelyn quitanz von wegen eres entpfangen legates vth dem testamente zeligen Jurgen Phineken. 30 )
- Christoffer von Quitzow von wegen synes entpfangen legates vth demsuluen testament. 31 )
- I erleddigt breff im gudhe thom Gredezee vp XII c M. 32 )
- I orfeyde Tomas Suchow.


|
Seite 17 |




|
- I pandtbrieff auer den Dienst tho Charow, schal affgeloseth syn. 33 )
- I schultbrieff Jaspar Fineken, darynne he Jaspar von Ortzen III c mr. schuldich. 34 )
- I quitanz der Fineken, darynne sie bekennen, dath Jurgen Fineke enen III c mr. entrichtet, darup sie eme den schultbrieff thostellen wolden.
- I pandtbrieff, darynne Johan Phineke Jurgen Phinicken ethlich gudt vorpandeth, dath doch wedder geloseth syn schole. 35 )
- I schultbrieff vp XXX gulden Johan Meyners. Ys betalth durch Quitzouwen vnd Johan Plesszen.
- L mr. Lutke Moltke.
- LXX mr. Johan Moltke.
- I kopbrieff der Bernekouwen, darynne sie Cordt von der Luy tho Buttelckow Mulszouwen vnd andere guder vorkofft hebben.
- I auergaue hern Hinrichs von der Lue. 36 )
- I auergaue hern Hinrichs von der Lue, darynne he gifft syner huesfrouwen Beaten II huszer thor Wismar, (yn) suluer, gelth vnd ander.
- II auergaue gleichs ludes von beiden fursten tho Mekelnborch vpgerichtet vnd vorsegelth, darynne Jurgen Phineke syne husfrouwen eyns des andern vp ere


|
Seite 18 |




|
- eyns fall myth alle synem gudhe reciproce vnnd remuneratorie bogaueth hebben.
- Der Phinickesschen liffgedinge vp den Gredesze von hertoch Albrechte vorsegelth.
- Hertoch Hinriches lyffgedingsbrieff, gleichformlich vorsegelth vp dem Gredesze.
- Hertoch Albrechtes vorschriuing vp die veltmerckede tho Liskow, Jurgen Phineken vnd syner husfrouwen V jar lanck thogestelleth myth boseyende vnd konyngsbede, szo syne F. G. darane hedde tho gebruchende.
- III consilia der vniuersiteten Ingelstadt, Tibing vnd Lipsyg, darynne sie concorderen vnd bosluthen, dath angetogede auergabe vth bowerten rechten, de sie antzehen, gegrundt vnd bestendich syn.
- Ethliche consilia vnd radtsleghe vth ernenneten vnd sunst andern vniuersiteten.
- I vordracht durch hertogen Magnus vnd hertogen Baltzar vpgerichtet twisschen Cordt von Aluesslegen (von wegen syner) zeligen husfrouwen Catharinen von der Lue an eynem vnd (vnd) Anne Buggenhagens wedewen vnd der priorynnen thom Nyenkloster, her Hinrich von der Lue dochter, syner nhagelaten guder haluen vpgerichtet.
- I vordracht, szo twisschen der Buggenhagesschen vnd priorynnen thom Nyenkloster an eynem vnd der frouwen Jurgen Phineken nhagelathenen wedewen ander diels beider sith nagelathene gudere haluen vordragen syn vpgerichtet.
- Der priorynnen vom Nyenkloster bowilling vp de itzen vormelthe vordrach.
- Auergaue hern Hinriches von der Lue, de he gedan hefft Cordt von Aluenslegen, syner dochter man vnd Catharinen von der Lue.
- Inwisingbrieff der Phinickesschen, szo sie in ere liffgeding thom Gredezee ingewiseth yst.
- I vordrach twisschen Jurgen Phineckesschen an eynem vnd ethlichen burgern thor Wismar anderdiels von wegen ethlicher pechte im gude Gredeze vorschreuen.
- Jasper Fineken thom Gnemher, Gunther vnd Claws Fineken tho Charow und Hinrich Wangelyns bewilling, dath Jurgen Fineke syne huesfrouwen Catharinen von der Lue moge boliffgedingen vnd bogauen.
- Der Buggenhagesschen bekenthnisse, dath ehr schwester, de Finekessche, er den vordrach, darinne sie erer


|
Seite 19 |




|
- gebreche haluen durch de fursten enthscheiden, vorreicht hebben.
ethliche vngeleßene breue nychte, wie sie geacht, von werden.
ethliche nasschen offte schrine myth olden breuen. Vngeleszen.
Darynne gefunden Jurgen Phineken rekensschop, vnd ethlich gantz weinich gelth, bolangende beide fursten tho Mekelnborch, alsze hie camermeister geweszen yst.
Darynne de register vnd rekensschup Jurgen Phineken densuluen handel bolangendhe.
Darynne ethliche vngeleßene breue befundhen, darane nycht gelegen, vnd tom dele erleddigt syn mogen, wie men sich vorsuth.
- Ethliche erleddigede vnd andere breue. Vngeleszen. Doch
- breff, darynne de Fineken bokennen, dath sie eres broders Jasper Fineken de gudere thom Gnemher eme thom erue gegeuen vnd, dath hie Axschouwen dochter nycht genhamen, keyn action hebben wolde.
- I quitanz Jasper Fineken vnmundigen sons, darynne sie Jurgen Phineken vnd syn husfrouwe erer vormundschop haluen leddich vnd loes schelden.
- I pandtbrieff, darynne Viuians von der Lue vor L mr. houetstols IIII mr. vorsetteth hedde hern Hinriche von der Lue.
- Jurgen Fineken ehestiffting myth Catharinen von der Lue.
- Noch ethliche breue mher vngeleszen vnd, we men sich vorsuth, thom diele, darane nycht gelegen yst. 37 )
Ein Breff Clawess Berner zu Schimme, Jochim Stralendorff zu Tramptz, Otte Berner zu Neperstorff, ( ... )


|
Seite 20 |




|
myct ethlichen kleynen lynnen doken.
ethliche fruwen coller, goldene armelen offt mouwen myth bopariden listen vnd funst ethliche megede thowindelssche vnnd ander doke.
vele stucke lynnen gerede vor fruwen vnd junckfruwen.
viele fruwen mutzen, huuen vnd sunst.
- III m VI c vnd LXX mr. an golde in munthe gerekenth vnd myth der Phinikesschen pitschir vorsegelth.
- I c LXX mr. mynus VI s. an munthe.
- Noch VII mr. in demsuluen budel vnder Phinickesschen pitzer.
- VIII c daler in eynem budel.
- V III c daler noch in eynem budel.
- VIII c daler noch in eynem budel.
- I m mr. in dubbelden schillingen.
- I m mr. in dubbelden schillingen.
- Im gulden an munthe noch in eynem budel.
- III m mr. in dren secken, ys in eynem idern I m mr.
- Jtem III c mr. affgetelleth vor de arme lude, alsze Bochholt berichtet.
- II c mr. vngeferlich, de nycht getelleth vnder der handelers (!) pitzer vorsegelth in V budelen.
- IIII c mr. von Hans Coche tho Lubeck, de Bockholt ent=
Eine Vorwilligung zwischen Benedicts vnd Hanss Powisch ahn einem vnd der Finekeschen ahm ändern Deill dass kein Deill den ändern vff 5000 Mr., so de Powischen der Finekeschen schuldich, loßkunding thun soll.


|
Seite 21 |




|
- pfangen vnd ene qwitert hedde, in I sacke vnder synem pithschir vorsegelth, den eruen vorhandtreichet.
- XL gulden renthe, hofft Bockholt von der Haluerstadesschen entfangen.
- I c gulden renthe, hefft Bockholt entpfangen von Lauyn von Bulow, in eynem bigordelhe vnder synem pitschir vorsegelt vnd den eruen vorhandtreichet.
- L mr. renthe, hefft Bockholt entpfangen von her Mathias von Ortzen vnd vnder synem pitschir vorsegelth den eruen auerandtwerdeth.
- V gulden renthe von Claws Berner hefft Bockholt entfangen, in welcher renthe alle Bockholt ock desuluen geqwitert.
Sunst synth keyne renthe vppn erflathen vmbflach vthgegeuen edder vpgeborth, sunder Jurgen Moltzan, dar werth Bockholt och rekensschop von donde.
Item von Duriar hebben de eruen entpfangen eyne kisthe, darynne gefunden VII m vngeferlich in V budelen, we hir bauen vormelth, vnd dewile he der Phinikesschen zeligen myth vorwaring der kisten vnd andern in syneme husze truwlich gedenth vnd sie ene edde[r] syneme szone, e[r]me paden, wormyth tho bedenckende vortrosting gedan, szo hebben de eruen Bockholte befalen eme och daruor vp der vorigen Phineckesschen vortrosting vofftich gulden tho uorhandtreichen, dathsulue neuen anderen synen innhamen vnd vthgauen tho uorrechnen.
- I runth kleinodt, darynne mydden eyn diamandt myth ethlichen parlen, andern eddelen stenen vnd I granatsch hengelyn.
- I guldene desemesber myth steinen vnd parlen.
- I runth klenoth myth steinen vnd parlen, darynne mydden in eyne smaragd.
- I rinck myth I spisszen diamandt.
- I gulden rinck myth eynem insetteden stuck eynhorne.
- I gulden rinck myth I cardiol.
- I rinck myth eynem groten turckescen, vp beiden syden I rabyn, kleyn.
- Noch I gulden rinck myth eynem kleynen turkisch, vp beiden syden I groth rabyn.
- I rinck myth I rabyn vnd saphir.
- I rinck myth III spisszen diamanten.
- I rinck myth eyner smar[a]gd vnd II rabinen.


|
Seite 22 |




|
- I dubbelth rinck, darynne III diamante vnd II rabyn.
- I drefechtich rinck daryn I diamant, I saphir vnd I rabyn.
- II grothe gulden keden gleichformlich, allewege twisschen II knopen I lith.
- I lange guldene kede myth runden ryngen.
- I lange gulden kede we eyne thomkhede.
- I gulden halsbandt von IX leden, vp jeder lith I eddelstein.
- I lanck halsbanth myth XIIII runden leden myth eddelen stenen vnd parlen twisschen den geleden.
- I kleyn halsbandt gleichformich mit VI runden leden.
- I huue myth gulden spangen vnd in ithlicher spangen I eddelgestein vnd dar tusschen grote linyen geschrenckt.
- I brustdoch myth parlen vnd flittern.
- I brustdoch bosticketh myth parlen myth I narren vnd wyue.
- I sulueren vofftich myth dorsteken suluern stenen vnd I groten desemsknope.
- I suluern halsbandt vorguldeth.
- V sulueren vorguldede vofftichsteyne myt eynem desemsknope vnd ethlichen cardiolen an I sulueren drade.
- VI mr. rhedes geldes in eynem roden hulleken.
- Etlich kleyn lynnentuch.
- I grote schale bynnen vorguldet.
- II vorguldede koppe, de in eynander fluthen.
- I suluern getkenneken.
- VI beker, de in eynander sluthen myth I deckels.
- I vorguldeth gewunden beker myth I decke.
- II suluern gewunden beker myth I decker vnd vorgulden streche.
- I gewunden suluer beker myth I decker, darup I menlyn.
- I suluern kenlyn myth I lede.
- I suluern beker myt III louwvothen.
- I vorguldeth beker vnder myth III louwenvothen.
- II bukede suluern beker, de in eynander sluthen.
- I buketh suluern kenneken myth I ledhe.
- IIII kleine gleichformige becher.
- II suluern schruffothe, der I vorguldet vnd de ander vnuorguldeth, darup II glesze.
- I sulueren schale myt der Hanen wapent.
- I suluern schale myt der Powisch wapen.
- I frouwen suluern schaleken.


|
Seite 23 |




|
- I suluern forkeken.
- XXIIII suluern lepel.
- I Venedisch glas.
- I breff ludende vp XV c gulden Lauyns von Buloumen.
- I halssbanth myth ethlichen steinen, parlen vnd II anhangenden berlogen.
- I halsbanth von XII leden myth eddelen steinen vnd parlen.
-
VI kleyne keden, darvnder I mith I
anhengenden klenode myth eyner rosen van
rabynen. Wegen thosamende III
 lodige mr. myn
lodige mr. myn
 loth goldes.
loth goldes.
- I boparleth stecket brustdoch myt II vorguldeden rosen vnd parlen.
- I boparlede bostickede platte vp I huuen.
- VI gulden knope myth ingesatheden rhabinen.
- VI grote parlen gefatet in golt.
- Ethliche grote parlen in I swarten zindeldoke.
- Ethlich kleyn suluer boslach vp I boslagen gordel myth II kleinen knopen.
- LVI eddele steine kleyn vnd groth, darvnder XI saphir.
- XI gulden ringe, darvnder I myt V spitzen diamanten.
- Eyn hupen parlen in eyneme lynnen budel thosamende gewagen, kleyn vnd groth, wegen XXXV loth myn I quentyn.
- I swart syden atlas rock myth martenkelen gefodert.
- I swart sammyt frouwen rock myt marten vndergefodert.
- I with brun schelert frouwen rock myth marten vnd grawerck gefodert.
- I blaw carteken wyth frouwen rock myth hermelen gefoderth.
- I swarth sammith frouwen rock myt marten vnd grawerck gefodert.
- I swart dammasch with frouwen rock myth I sammit dalslage, bauen vnd nedden schir szouele alsze der dammasch vpgeslagen.
- I swart schelert vor myth hermelin vnd hynder myth bundtwercke gefoderth.
- I with fruwen rock von I gulden stucke, vnder vnd auer myth sammith vorbrempth.
- I with fruwen rock von I gulden stucke de auer myth syden s . . ken vthgesticket.


|
Seite 24 |




|
- I with fruwen rock von getagen golde vnder rnyth rodem sammyt vorbremth.
- I swarth dammasch vnderrock myth swartem sammyth vorbrempt.
- I swarth sagen vnderrock myth sammyth vorbrempt.
- I swarth wantmantel myth bundtwerck gefoderth.
- I swart atlas liffrock myth bundtwercke gefodert.
- I swarthe dammasche mantel myth sammith vorbremth vnde marten gefodert.
- I swarte wanth mantel myth sampt vorbremth.
- I swarth jopken, sammit. Noch
- I swarth sammyth jopken.
- I dammasch swarth jopken.
- I swarth wanth jopken myt sammyt vorbrempt.
- I swart sammyts jopken, darane de armelen thosneden.
- I swarte tafft jope ane arme.
- I dammasch jope myt marten vnd grawercke gefoderth.
- I caszel von roden dammasch myt I crutze syden stucks.
- I with wanthrock myth sammyth vorbrempt.
- I enge swarth wanthrock.
- II grote bedde vnd II arote pole.
- VI stolkusszen, nyge.
- II wagenpole. Noch
- II bedde myt II houetpolen vnd
- I dundeken. Noch
- II dunbedde vnd
- I grothe dundeke.
- VI houetkusszen.
- I grothe stickede deke.
- I kleyn bedde.
- II lutke vnderbedde.
- II grote pole.
- IIII olde banckpole
- II bencke myth flassze, vmbosichtigt.
- II stucke grawes louwendes.
- I groth myssinges krusel.
- II dunbedde.
- II houetkussen.
- II stucke drels.
- I stucke beddeburs.


|
Seite 25 |




|
- II ruggelaken.
- I toppeth dislachen.
- II dunbedde.
- I olde deke.
- III deken.
- I olde deke.
- I groth dedde myt II groten polen.
- II vnderbedde.
- III deckebedde.
- III pole.
Original im Wismarschen Raths=Archive.