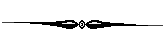|
[ Seite 3 ] |




|



|
|
:
|
I.
Bericht des Ibrahîm ibn Jakûb
über die Slawen
aus dem Jahre 973,
mitgetheilt von Dr. F. Wigger .
N achdem ich im Jahre 1859 in dem ersten Hefte meiner "Meklenburgischen Annalen" alle mir bis dahin bekannt gewordenen Nachrichten über die meklenburgischen Wenden bis zum Jahre 1066 vereinigt hatte, habe ich 20 Jahre lang vergeblich nach irgend nennenswerthen Nachträgen ausgeschaut. Jetzt ist aber endlich in einem akademischen Vortrage des Herrn de Goeje, Professors der arabischen Sprache an der Universität zu Leiden, * ) ein neuer Bericht über die wendischen Völker aus dem zehnten Jahrhundert an den Tag getreten, der sowohl durch seinen Ursprung, als durch seinen Inhalt so merkwürdig erscheint, daß ich nicht unterlassen kann, die Freunde der meklenburgischen Geschichte mit demselben - mit Genehmigung des Herausgebers - bekannt zu machen.


|
Seite 4 |




|
Nämlich in einer Handschrift von einem geographischen Werke des spanisch=arabischen Schriftstellers Abû Obeid al=Bekri (aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts), welche Ch. Schefer in einer Bibliothek zu Constantinopel entdeckte und abschrieb, fand der Professor de Goeje unter vielen Auszügen aus den Werken des Mas'ûdî., der um 948 schrieb, auch andere aus anscheinend nicht mehr erhaltenen Schriften, und namentlich einen umfänglichen Bericht über die Slawenvölker, welchen ein sonst nicht bekannter Jude Namens Ibrahîm ibn Jakûb (d. h. Abraham Jakobs Sohn) zur Zeit Kaiser Ottos I., zum Theil offensichtlich aus eigener Anschauung, erstattet hat.
Den vereinten Bemühungen des Professors de Goeje und zweier Petersburger Gelehrten, Kunik's und Frh. von Rosen, ist es nun gelungen, manche Verderbnisse des arabischen Textes, besonders in den Namen, aufzudecken und zu verbessern; und de Goeje hat darauf in der erwähnten akademischen Abhandlung eine holländische Uebersetzung mit vielen Erläuterungen veröffentlicht, welcher wir bei eigener Unkenntniß der arabischen Sprache folgen.
Das Räthsel, wie ein arabisch schreibender Israelit des 10. Jahrhunderts zu den Wenden im Nordosten Deutschlands gelangt sei, hat Herrn de Goeje vielfach beschäftigt. Aus mehreren sprachlichen Spuren in dem Berichte schließt er, daß Ibrahîm Heimath Spanien gewesen sei, und da es feststehe, daß Bekri, der diesen Theil seines Werkes 1066 geschrieben, officielle Actenstücke in Cordova zu benutzen Gelegenheit gefunden habe, so möge er dort diesen Bericht Ibrahims entdeckt haben. Nun wissen wir freilich aus dem Widukind (III, 56), daß der König Otto I. nach seinem großen Siege über die Magyaren im Jahre 955 auch eine Gesandtschaft von Saracenen empfing; aber de Goeje glaubt doch nicht, daß Ibrahim an dieser theilgenommen habe. Und mit Recht; denn Ibrahîm nennt in seinem Berichte Otto schon "den römischen König" (oder "Kaiser", denn auch den oströmischen Kaiser bezeichnet er als "König"), er hat denselben also sicher erst nach 963 gesprochen; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß ein Mitglied jener Gesandtschaft 10 Jahre lang in Deutschland zurückgeblieben sein sollte. Der holländische Gelehrte entscheidet sich vielmehr dafür, daß Ibrahîm als ein ansehnlicher Kaufmann in Handelsangelegenheiten Deutschland aufgesucht habe, daneben jedoch von dem spanischen Herrscher auch mit diplomatischen Aufträgen betraut gewesen sein möge.


|
Seite 5 |




|
Mit dem terminus a quo, welchen de Goeje hier annimmt, sind wir einverstanden, in die Jahre des "römischen Kaisers Otto" I., 963-973, fällt gewiß die Reise Ibrahîm's nach Deutschland, wo er nach seiner eigenen Angabe "die bulgarischen Gesandten in der Stadt Merseburg gesehen" hat, "da sie zum Könige Otto kamen". Dann begrenzt sich die Zeit aber noch näher dadurch, daß der Kaiser nach seiner Rückkehr aus Italien erst im Juni 965 Sachsen wiedersah und, nachdem er im August 966 noch in Merseburg verweilte, abermals nach Italien aufbrach, nachher aber erst im Frühling 973 nach Sachsen zurückkehrte, wo er zu Quedlinburg das Osterfest (23. März), in Merseburg (1. Mai) das Himmelfahrtsfest beging. Nun entscheidet sich de Goeje für den ersten Zeitraum, indem er äußert, Ibrahîm sei zu Merseburg "um 965" gewesen. Dieser Ansicht können wir jedoch darum nicht beipflichten, weil wir von einer bulgarischen Gesandtschaft an Kaiser Otto I. aus dem Jahre 965/966 keine Nachricht haben; wir entscheiden uns vielmehr für den Frühling 973.
Denn die Hildesheimer Annalen, Lambert und Thietmar (II, 20). berichten einstimmig, daß dem Kaiser, als er das Osterfest 973 zu Quedlinburg feierte, Gesandte der Griechen, der Beneventaner, der Ungarn, der Bulgaren, der Dänen und der Slawen Geschenke überbrachten, Lambert nennt auch noch italische und "russische" Gesandte, und nach Thietmar waren auf des Königs Geheiß auch die Könige von Böhmen und von Polen, Boleslaw II. und Mießko (bei Ibrahîm Boreslaw und Misjko) dorthin gekommen. Widukind (III, 75) begnügt sich freilich damit, anzugeben, daß in Quedlinburg "eine Menge verschiedener Völker zusammengekommen" seien, fügt dann aber, was für uns von Wichtigkeit ist, hinzu, der Kaiser sei schon nach einem Aufenthalt von nur 17 Tagen aus Quedlinburg wieder aufgebrochen, um in Merseburg das Himmelfahrtsfest zu feiern. In tiefem Schmerze über den Tod seines getreuen Herzogs Hermann von Sachsen († am 27. März 973) habe er jene Orte durchwandelt. Hernach habe er Gesandte aus Afrika, die ihm ihre Erfurcht zu bezeugen und Geschenke zu überbringen gekommen seien, empfangen und bei sich behalten (Post susceptos ab Africa legatos, eum regio honore et munere visitantes, secum fecit manere); jedoch schon am Dienstag vor Pfingsten (6. Mai) sei er nach dem - unweit Merseburg belegenen-Orte Memleben gegangen, dort sei aber bereits am nächsten Tage sein unerwartetes Ableben erfolgt.


|
Seite 6 |




|
Es erscheint uns hiernach nicht zweifelhaft, daß die bulgarischen Gesandten auf ihrem Heimwege von Quedlinburg in Merseburg mit der Sarazenengesandtschaft aus Afrika zusammengetroffen sind, und daß Ibrahîm sich bei der letzteren befand, sei es als Arzt (wofür seine medicinischen Bemerkungen gegen das Ende seines Berichtes sprechen), oder als Secretair, oder in welcher Stellung es sonst gewesen sein mag. Zu beachten ist auch, daß er einen polnischen Rechtsbrauch mit einem ähnlichen bei den Berbern zusammenstellt, den er vermuthlich kannte, weil Nordafrika seine Heimath war.
Vielleicht hat er damals auch den Polenkönig "Misjko" (Mießko) persönlich kennen gelernt, oder dessen Begleitung ausgefragt. Denn daß Ibrahîm das Land Polen selbst gesehen hätte, das darf man bezweifeln, wenngleich er nur von Bulgarien ausdrücklich sagt, daß er es nicht besucht habe; Alles, was er von Polen berichtet, kann er sehr wohl auch aus Mittheilungen Anderer wissen. Dagegen zeugt die Angabe der verschiedenen Stationen und deren Entfernungen dafür, daß er in Meklenburg und in Böhmen selbst gewesen ist. Wahrscheinlich unternahm er aus Wißbegier von Merseburg aus eine Reise nach dem "nördlichen Ocean" (der Ostsee) und kehrte später über Böhmen, die von Wenden bewohnten Ostalpen und durch das "große Land" (Italien) in seine Heimath zurück. - Wir lassen nun seinen Bericht, so weit er uns interessirt, hier folgen, wie er sich bei al=Bekri findet:
"Ibrahîm ibn Jakûb, der Israelit,
erzählt: Die L
 nder der Slawen erstrecken
sich von der Syrischen See (Mittelmeer) bis
an den nördlichen Ocean (Ostsee). Doch haben
sich Volksstämme ans dem Norden eines
Theiles dieser Lande bem
nder der Slawen erstrecken
sich von der Syrischen See (Mittelmeer) bis
an den nördlichen Ocean (Ostsee). Doch haben
sich Volksstämme ans dem Norden eines
Theiles dieser Lande bem
 chtigt und wohnen bis auf den
heutigen Tag zwischen jenen."
chtigt und wohnen bis auf den
heutigen Tag zwischen jenen."
"Die Slawen bestehen aus vielen
verschiedenen St
 mmen. In früherer Zeit waren
sie alle vereinigt unter einem K
mmen. In früherer Zeit waren
sie alle vereinigt unter einem K
 nig, der den Titel Mâcha
führte und zu einem Geschlechte gehörte,
welches Walînbâba hieß und in hohem Ansehen
unter ihnen stand. Hernach wurden sie
uneinig und ward das gemeinsame Band
zerrissen, w
nig, der den Titel Mâcha
führte und zu einem Geschlechte gehörte,
welches Walînbâba hieß und in hohem Ansehen
unter ihnen stand. Hernach wurden sie
uneinig und ward das gemeinsame Band
zerrissen, w
 hrend sich die St
hrend sich die St
 mme zu verschiedenen Gruppen
formirten, jede von diesen von einem eigenen
K
mme zu verschiedenen Gruppen
formirten, jede von diesen von einem eigenen
K
 nige regiert".
nige regiert".
Wie de Goeje anmerkt, ist dieser zweite Absatz dem Mas'ûdî entnommen und vielleicht erst eine Einschaltung (oder Randbemerkung?) Bekri's. Wir lassen diese Sage ebensowohl unerörtert, als die von dem polnischen Schriftsteller


|
Seite 7 |




|
Boguchwal, welche wir in Jahrb. 27, S. 126 mitgetheilt haben. Den Titel Mâcha deutet unser der slawischen Sprachen kundiges Mitglied Dr. Kühnel zu Neubrandenburg aus dem altslawischen Worte mogat (spr. mogont) = dominus, δυν´αστης von dem Verbum moga = ich kann (vgl. das gothische magan = können). Den Namen Walînbâba möchten wir nicht wie de Goeje mit Wollin oder Jumne in Beziehung setzen. Dr. Kühnel möchte lesen: Walnî Bâba, "der treffliche Baba". "Denn das Adjectiv walni (poln. walny, a, e = 1)Haupt=, 2) vortrefflich, herrlich, recht gut) steht in Masculinform, und bei der Häufigkeit des Namens wäre eine Dynastie mit Oberhaupt Baba nicht undenkbar". -
Ibrahîm fährt fort:
"Gegenwärtig sind da vier K
 nige: der K
nige: der K
 nig der Bulgaren; Boreslav,
der K
nig der Bulgaren; Boreslav,
der K
 nig von Frâga (Prag), Bowîma
(Böhmen) und Krakau; Misjko, der K
nig von Frâga (Prag), Bowîma
(Böhmen) und Krakau; Misjko, der K
 nig von dem Norden, und
Nâcû[n] in dem westlichsten Theile der
Slawenl
nig von dem Norden, und
Nâcû[n] in dem westlichsten Theile der
Slawenl
 nder".
nder".
"Dies letzte Reich grenzt gegen Westen
an Sak[s]ûn (Sachsen) und einen Theil von
Mermân. Die Kornpreise sind dort niedrig,
und das Land ist reich an Pferden, so daß
davon nach andern L
 ndern ausgef
ndern ausgef
 hrt wird. Die Bewohner sind
gut bewaffnet mit Panzern, Helmen und
Schwertern. Von [Merse]burg nach dem daran
grenzenden Bezirksorte reist man 10 Meilen,
[von dort] nach der Br
hrt wird. Die Bewohner sind
gut bewaffnet mit Panzern, Helmen und
Schwertern. Von [Merse]burg nach dem daran
grenzenden Bezirksorte reist man 10 Meilen,
[von dort] nach der Br
 cke [über die Elbe] 50 Meilen,
und diese Br
cke [über die Elbe] 50 Meilen,
und diese Br
 cke ist von Holz und eine
Meile lang. Von der Br
cke ist von Holz und eine
Meile lang. Von der Br
 cke bis zur Burg des Nâcû[n]
sind ungefähr 40 Meilen. Diese Burg heißt
[Wîli=]Grâd, welcher Name "Große
Burg" bedeutet. Wîli=Grâd ist in einem
S
cke bis zur Burg des Nâcû[n]
sind ungefähr 40 Meilen. Diese Burg heißt
[Wîli=]Grâd, welcher Name "Große
Burg" bedeutet. Wîli=Grâd ist in einem
S
 ßwassersee erbauet, sowie die
meisten Burgen der Slawen. Wenn sie n
ßwassersee erbauet, sowie die
meisten Burgen der Slawen. Wenn sie n
 mlich eine Burg gründen
wollen, so suchen sie ein Weideland, welches
an Wasser und Rohrs
mlich eine Burg gründen
wollen, so suchen sie ein Weideland, welches
an Wasser und Rohrs
 mpfen reich ist, und stecken
dort einen runden oder viereckigen Platz ab,
je nach der Gestalt und dem Umfange, welche
sie der Burg geben wollen. Dann ziehen sie
darum einen Graben und h
mpfen reich ist, und stecken
dort einen runden oder viereckigen Platz ab,
je nach der Gestalt und dem Umfange, welche
sie der Burg geben wollen. Dann ziehen sie
darum einen Graben und h
 ufen die ausgehobene Erde auf.
Diese Erde wird mit Brettern und Balken so
fest gestampft, bis sie die H
ufen die ausgehobene Erde auf.
Diese Erde wird mit Brettern und Balken so
fest gestampft, bis sie die H
 rte von Pisé (tapia) erhalten
hat. Ist dann die Mauer (der Wall) bis zur
erforderten H
rte von Pisé (tapia) erhalten
hat. Ist dann die Mauer (der Wall) bis zur
erforderten H
 he ausgeführt, so wird an der
Seite, welche man ausw
he ausgeführt, so wird an der
Seite, welche man ausw
 hlt, ein Thor abgemessen und
von diesem eine h
hlt, ein Thor abgemessen und
von diesem eine h
 lzerne Brücke über den Graben
gebauet. Vor der Burg [Wîli=]Grâd bis an den
Ocean betr
lzerne Brücke über den Graben
gebauet. Vor der Burg [Wîli=]Grâd bis an den
Ocean betr
 gt die Entfernung 11 Meilen.
Die Kriegs=
gt die Entfernung 11 Meilen.
Die Kriegs=


|
Seite 8 |




|
heere dringen in das Gebiet Nâcû[n]s nur mit
großer M
 he vor, da das gesammte Land
niedriges Weideland, Rohrsumpf und Morast ist".
he vor, da das gesammte Land
niedriges Weideland, Rohrsumpf und Morast ist".
Zu diesem für uns wichtigsten Abschnitte aus dem Berichte Ibrahîms bemerkt de Goeje zunächst schon, daß der Name Nacûr verschrieben sei, und er hat in demselben den Wendenfürsten Naccon, welcher anderweitig bekannt genug ist, wiedererkannt. Wir zweifeln nicht an der Richtigkeit dieser Wahrnehmung, zumal auch (im Mekl. Urk.=Buch I, 244, 254 und 255) in den Jahren 1218 und 1219 wieder ein edler Wende mit dem Namen "Nacon" erscheint, und ein nach Nacon benanntes Dorf Naquinstorp und Nacunstorp (Nr. 385) genannt wird. Wahrscheinlich ist also Nakun eine Nebenform von Nacon oder Naccon, und von Bekri oder dem Abschreiber nur r für n verschrieben. Naccon erscheint in den bisher bekannten Geschichtsquellen * ) zuerst mit seinem Bruder Stoignew im Jahre 954. Der Graf Wichmann empörte sich damals gegen seinen Oheim, den Markgrafen Hermann Billung von Sachsen, und gegen seinen Verwandten, den König Otto, ward aber von Hermann über die Elbe (trans Albiam) getrieben und verleitete Naccon und seinen Bruder zum Kriege, während gleichzeitig der Markgraf Gero einen siegreichen Kampf gegen die Ukerer führte. Naccon und Stoignew bezeichnet Widukind unbestimmt (III, 50) als "duos subregulos barbarorum", d. h. als Wendenfürsten; denn andere nicht deutsche Völkerschaften als Wenden gab es an der Unterelbe, in der Nachbarschaft Hermanns, nicht; und es können, genauer gesprochen, hier nur Fürsten der Obotriten, Polaben und Wagrier gemeint sein, gegen welche die sächsische Mark errichtet ward. Darauf unternahm der Markgraf Hermann um Fastnacht 955 einen Zug gegen sie, und suchte sie in der Burg "Suithleiscranne" zu überraschen; es gelang ihm aber nur, etwa 40 Mann vor der Burg zu tödten. Die Slawen vergalten nach Ostern diesen Angriff mit einem Zuge unter Wichmanns Führung nach der Burg "Cocarescemiorum", in welche Hermann, weil er sich zum Widerstande zu schwach fühlte, seine Leute sich hatte zurückziehen lassen, gewannen dieselbe durch eine Capitulation und tödteten dann die ganze Besatzung wegen angeblichen Friedensbruches. Im August schlugen die Wenden einen Angriff des Markgrafen Dietrich glücklich ab. Die Lage Deutschlands war eine sehr gefährdete, da gleichzeitig die Ungarn einen großen


|
Seite 9 |




|
Einfall machten. Da gelang es bekanntlich am 10. August dem Könige Otto den Ungarn in Baiern eine große Niederlage zu bereiten, so daß er sich nun mit vereinter Kraft gegen die nördlichen Slawen wenden konnte. Wichmann und Ekbert wurden geächtet. Gesandte der Slawen verstanden sich zu nichts weiter als zum üblichen Tribut; der König begehrte aber zugleich Genugthuung für die erwähnte Niedermachung der "Cocarcscemier". Als sich die Slawen hierauf nicht einließen, rückte er mit Feuer und Schwert (ohne Zweifel von Havelberg her) in ihr Land ein; er fand unter Stoignews Führung die Obotriten und Witzen (Circipaner und Tolensaner) vereinigt sich gegenüber an der "Raxa" (der Reke, dem Oberlaufe der Elde östlich vom Plauersee * ) und besiegte sie am 16. October mit Hülfe der Rujaner in einer sehr schweren Schlacht, wobei Stoignew sein Ende fand. Doch war die Macht der Wenden damit noch nicht gebrochen, 957, 959 und 960 sah sich König Otto noch zu neuen Feldzügen genöthigt, und im Nordosten, in den neugegründeten Bisthumssprengeln von Havelberg und Brandenburg, setzte hernach, als der König Otto nach Italien zog, der Markgraf Gero noch seine Kämpfe gegen die Wenden fort, während dem Markgrafen gegen die Obotriten, Polaben und Wagrier, dem nunmehrigen Herzog von Sachsen, Hermann Billung, der Schutz des nordwestlichen Deutschlands anvertrauet war.
Der Wendenfürst Naccon tritt nun, einstweilen wenigstens, in unsern bisherigen Quellen ganz zurück; 967 werden uns als "subregulus" der Wagrier (Waari) Selibur, als "subregulus" der Obotriten Mistaw von Widukind (III, 68) genannt. Sie waren mit einander in Zwiespalt; Selibur verband sich mit dem obengenannten Aufrührer Wichmann, ward aber vom Herzog Hermann bezwungen, und seine Herrschaft seinem Sohne übergeben. Hieraus könnte jemand den Schluß ziehen, daß damals schon Mistaw Herrscher der Obotriten gewesen wäre; allein, wo Adam (II, 14) von den ersten Zeiten des erst um 968 gegründeten Bisthums Oldenburg in Wagrien spricht, dessen Sprengel östlich bis Demmin reichen, also etwa die slawische Mark Herzog Hermanns umfassen sollte, nennt er als damalige Wendenfürsten innerhalb dieses Gebietes "Missizlaw, Naccon und Sederich". Aus dem Berichte Ibrahîms ersehen wir nun mit Bestimmtheit, daß im Jahre 973 Naccon noch als "König" die nordwestlichen Wenden regierte und in der alten Hauptburg der


|
Seite 10 |




|
Obotriten, Wîligrâd, d. i. Meklenburg, seinen Sitz hatte. Sederich mag, ihm unterthänig, Fürst der Wagrier gewesen sein; denn Ibrahîm stellt den Naccon, indem er ihn dem Mießko von Polen und dem Boleslaw von Böhmen zur Seite setzt, als den obersten Fürsten der nordwestlichen Wenden hin. Dem Missislaw begegnen wir anscheinend noch später bei Helmold (I, 13) als einem Sohn des "regulus Obotritorum nomine Billug", welcher Letztere sich in zweiter Ehe mit einer Schwester des Bischofs Wago von Oldenburg vermählt hatte und sich zum Christenthum bekannte, während sein Sohn demselben abgeneigt war und auch den bereits altersschwachen Vater verleitete, von jener Ehe zurückzutreten. Es scheint uns hiernach, daß Naccon bei seinem Uebertritt zum Christenthum den Namen Billug (wohl = Billung, von dem Herzog) annahm, wie später Gottschalks Vater Pribignew (Saxo X, 523) den deutschen Taufnamen Uto; in dem Namen Mistaw aber scheint uns der Name Mississlaw oder Mistizlaw zu stecken.
Leider giebt Ibrahîm nicht an, wie weit gegen Osten Naccons Reich sich erstreckte, und auch die Namen der Westgrenze sind uns nicht unentstellt überliefert. Der Vermuthung de Goeje's, daß statt Saknûn vielmehr Saksûn (Sachsen) zu lesen sei, wird man ohne Bedenken zustimmen; schwieriger ist dagegen der andere Name: "Mermân" zu deuten. Kunik und v. Rosen möchten " G ermân" = Germanien lesen; allein wo sollte Ibrahîm diesen Namen gehört haben? Jirecek hat "Mormân" vorgeschlagen, weil so später die Normannen in slawischen Büchern genannt werden (wie poln. M ikolai für N ikolai); aber die Normannen nennt später Ibrahîm selbst "Russen". Am annehmlichsten erscheint noch de Goeje's Vermuthung, daß H ermân zu lesen und das Gebiet, die Markgrafschaft Hermanns, des Sachsenherzogs, zu verstehen sei, wenngleich der Herzog gerade um dieselbe Zeit, als jene afrikanische Gesandtschaft Merseburg erreichte, am 27. März verstorben, und sein Sohn Bernhard sein Nachfolger geworden war. Der Kern der Markgrafschaft war das südliche Lauenburg (das Sadelband), allerdings hier die Westgrenze des Obotritengebietes (insonderheit Plabiens); unter den Sachsen an der Westgrenze des Wendengebietes dürften dann die Sachsen in Holstein, die Grenznachbarn der Wagrier, zu verstehen sein.
Da Ibrahîm von Merseburg auf dem gewöhnlichen Wege nach Meklenburg gezogen sein wird, möchte es von Interesse sein, wenn sich aus seinen Bemerkungen diese Straße


|
Seite 11 |




|
mit einiger Sicherheit ermitteln ließe. Nun ist erstens aus seinen Angaben, nach welchen er die Entfernung von Merseburg bis zum Orte Meklenburg (1 Meile von Wismar), die in grader Linie 42 geographische Meilen beträgt, auf 100 Meilen schätzt (obwohl er zunächst fast ganz in gerader Linie längs der Saale und Elbe nordwärts zog, auch hernach eine bedeutenden Umwege zu machen hatte), so viel klar, daß seine Meilen kaum halb so lang zu rechnen sind, als die geographischen. Seine erste Station von Merseburg, die also fünf geographische Meilen nördlich von dieser Stadt zu suchen ist, nennt er nicht; denn in "majalîh" steckt, wie de Goeje bemerkt: "mà jalîhi = wat er aan grenst"; darum übersetzten wir oben "nächst angrenzenden Bezirksort". Zu beachten wird aber weiter sein, daß nach Ibrahîm die Entfernung von Merseburg bis zur Brücke (über die Elbe) 60, von der Brücke bis Meklenburg 40 seiner Meilen betrug. Nach dieser Proportion (3 : 2) darf die Brücke nicht in der Gegend von Dömitz, etwa bei der alten Fährstätte Broda, auch nicht in der Nähe von Lenzen gesucht werden, sondern nur unweit Havelberg und Werben, etwa bei Quitzöbel, unterhalb der Einmündung der Havel. Dieses liegt nämlich in gerader Linie von Merseburg 25, von dem Orte Meklenburg 17 geographische Meilen entfernt, so daß wir damit wieder auf die Proportion 3 : 2 gelangen. Werben kommt auch sonst als ein Ort vor, wo die deutschen Fürsten mit den wendischen Zusammenkünfte hielten; und aus der Gegend von Havelberg führte schon zur Römerzeit, wie das Römergrab bei Gr.=Kelle a. d. Müritz unweit Röbel und manche Münzfunde beweisen, durch die Wittstocker Heide nach der Müritz und weiter nach Demmin und der Peene eine Verbindungsstraße zwischen Elbe und Ostsee. Auf dieser Straße muß 955 auch König Otto I. nach der Raxa, wie oben erwähnt, gezogen sein, und die von Ibrahîm etwa 1/2 deutsche Meile lang geschätzte hölzerne Brücke, über deren Entstehung und Beschaffenheit uns anderweitige Nachrichten fehlen, mochte noch aus den Jahren 955-960 stammen, vielleicht aber auch erst aus den folgenden, aus denen uns (bis 967) Kriegszüge gegen die Redarier * ) berichtet werden. Als Otto III. im Jahre 995 seinen großen Zug gegen die meklenburgischen Wenden unternahm, finden wir ihn am 16. August in Magdeburg, am 18. in Leizkau; am 10. September gab er über eine zu "Michelenburg" verhandelte Sache eine Urkunde, am 3. Oct.


|
Seite 12 |




|
eine andere über eine im Tollenserlande geführte Verhandlung (actum in pago Tholensani), und die nächste, vom 6. Oct. zu Havelberg * ), wie dann später auch der heil. Otto die Straße von Havelberg nach der Müritz einschlug, und 1147 die Kreuzfahrer von Havelberg aus durch die Wittstocker Heide nach Malchow ** ) und weiter nach Demmin zogen. Es ist hiernach kaum zweifelhaft, daß auch Ibrahîm im Jahre 973 diese Hauptstraße wählte; ob er aber auch noch die "Reke" (bei Eldenburg a. d. Müritz) überschritt und dann nordwestlich nach Meklenburg abbog, oder ob sich etwa von der großen Straße schon vorher ein näherer Weg nach der "Großen Burg" abzweigte, müssen wir bei dem Mangel an Nachrichten über die Verbindungswege in unserm Lande aus jener Zeit dahingestellt sein lassen.
Der Name der "Großen Burg" lautet in dem uns überlieferten Texte an der ersten und der dritten Stelle freilich bloß Grâd, an der zweiten Stelle jedoch vollständig Wîli-Grâd; und die Uebersetzung "Große Burg" beweist an der ersten Stelle und der Zusammenhang an der dritten Stelle, daß Ibrahîm selbst auch hier Wîli-Grâd geschrieben haben muß. Die Bedeutung des Namens macht es unzweifelhaft, daß diese Burg keine andere ist, als diejenige, welche mit dem ins Deutsche übersetzten Namen "Michelenburg" (d. h. Große Burg) zuerst in der oben erwähnten Urkunde K. Ottos III. vom Jahre 995 erscheint und dann bei allen bisher bekannten Schriftstellern und in allen Urkunden ausschließlich diesen deutschen Namen führt - Meklenburg bei Wismar. Dazu paßt dann auch ganz Ibrahîms Angabe über die Lage der "Großen Burg" in einem ,,Süßwassersee". Denn gewiß war die heutige, selbst nach der schwierigen Einschüttung des Eisenbahndammes noch sehr feuchte "große Sumpfwiese" südlich vom Kirchdorfe Meklenburg, aus welcher der mächtige wendische Burgwall hervorragt, vor 900 Jahren noch ein See. Und wenn dieser Wall in seiner Ausdehnung von etwa 200 Schritt Länge und 150 Schritt Breite *** ), wie man ihn von der nahe vorüberführenden Eisenbahn aus erblickt, noch jetzt die Bewunderung der Reisenden erregt, obwohl unsere Zeitgenossen doch gewohnt sind große Erdarbeiten zu sehen, so kann man sich


|
Seite 13 |




|
vorstellen, welchen tiefen Eindruck dieser in den See eingeschüttete Wall auf den fremdländischen Wanderer machte; und man begreift, daß er sich bewogen sah, gerade hier eine auf Erkundigungen bei den Eingebornen beruhende Beschreibung des wendischen Burgbaues einzuschalten.
Diese Ansicht von der Identität Meklenburgs mit WîIigrâd kann auch nicht dadurch erschüttert werden, daß Ibrahîm die Entfernung der "Großen Burg" vom "nördlichen Ocean" auf 11 seiner, also auf etwa 5 geographische Meilen berechnet, während in Wirklichkeit Meklenburg kaum eine geographische Meile von der Wismarschen Bucht entfernt liegt. Denn wenn der Reisende von Wißbegier getrieben ward, von Merseburg aus nordwärts bis an den "Ocean", die Ostsee, vorzudringen: so bot ihm beim Dorfe (Alt=)Wismar die von der Insel Poel dem Auge fast verschlossene Bucht keinen rechten Ausblick in die offene See, und er mag, um solchen zu genießen, längs des Salzhaffs nördlich bis Alt=Gaarz oder gar bis zu der "Landzunge Buch" (zwischen Meschendorf und Arendsee) gewandert sein, wo an letzterer Stelle er die weiteste Aussicht auf das Meer fand.
Jedenfalls widerlegt auch Ibrahîm die ohnehin unglaubwürdige Angabe des (1253 verstorbenen) Bischofs Boguchwal von Posen (Jahrbuch 27, S. 128), wonach der in Rede stehende Burgwall von den Wenden nach dem 1/2 Stunde entfernten Dorfe Lübow ("Lubowe"), von den Deutschen aber nach dem Wendenkönige Mikkol - er meint Niklot, den im J. 1160 gefallenen Wendenfürsten - Mikelborg benannt wäre. Eine Beziehung der Ortschaft Meklenburg zu Lübow mag in christlich er Zeit dadurch entstanden sein, daß bei der alten romanischen Kirche zu Lübow Meklenburg, bevor es selbst eine Kirche erhielt, eingepfarret war; dem Namen Michelenburg aber begegneten wir oben schon mehr als ein Jahrhundert vor Niklots Regierungszeit. - Eine in Wismar ansässige, ohne Zweifel aus dem Dorfe Meklenburg stammende und, wie so häufig, nach der Heimath benannte Familie führt (nach Mittheilung Dr. Crull's) noch jetzt den Namen Willgroth (d. i. Wiligrod = Wîligârd, wie Starigrod neben Starigard vorkommt). Diesen Familiennamen hatte Dr. Beyer schon richtig gedeutet, und aus demselben (Jahrb. 37, S. 142) auf den wendischen Burgnamen "Wiligrod" geschlossen - eine Vermuthung, welche jetzt durch Ibrahîm eine glänzende Bestätigung gefunden hat.
Von Meklenburg scheint Ibrahîm gerades Weges nach Merseburg zurückgekehrt und den Heimweg durch Böhmen


|
Seite 14 |




|
und über die von Wenden bewohnten Steyrischen und Krainer Alpen genommen zu haben; wenigstens sind, wie wir schon oben bemerkten, seine Nachrichten über Polen so kurz und unbedeutend, daß man annehmen muß, sie beruhen nicht auf eigener Anschauung. Immerhin werden auch die Abschnitte des arabischen Berichtes über die Böhmen und die Polen und deren Nachbarn hier, schon der Vergleichung halber, nicht unwillkommen sein. Ibrahîm wendet sich nun zunächst nach Böhmen:
"Was Boreslaws Land betritt, so
erstreckt sich dieses der L
 nge nach von der Stadt Prag
(Frâgâ) bis zur Stadt Krakau, eine
Entfernung von drei Wochen; und es grenzt in
der L
nge nach von der Stadt Prag
(Frâgâ) bis zur Stadt Krakau, eine
Entfernung von drei Wochen; und es grenzt in
der L
 nge an die Lande der T
nge an die Lande der T
 rken (d. h. Magyaren). Die
Stadt Prag ist von Stein und Kalk gebaut und
ist der größte Handelsplatz in den
Slawischen L
rken (d. h. Magyaren). Die
Stadt Prag ist von Stein und Kalk gebaut und
ist der größte Handelsplatz in den
Slawischen L
 ndern. Russen und Slawen
kommen mit ihren Waaren dahin von der Stadt
Krakau, und Moslems, Juden und T
ndern. Russen und Slawen
kommen mit ihren Waaren dahin von der Stadt
Krakau, und Moslems, Juden und T
 rken kommen aus dem türkischen
Gebiete mit Handelswaaren und Byzntinischen
M
rken kommen aus dem türkischen
Gebiete mit Handelswaaren und Byzntinischen
M
 nzen (mithkâls) und empfangen
dafür von den Slawen Biberfelle und anderes
Pelzwerk. Dieses Land ist von allen L
nzen (mithkâls) und empfangen
dafür von den Slawen Biberfelle und anderes
Pelzwerk. Dieses Land ist von allen L
 ndern des Nordens das beste
und an Nahrungsmitteln reichste. F
ndern des Nordens das beste
und an Nahrungsmitteln reichste. F
 r 1 Peñsê
*
) kauft man so vielen Weizen,
als ein Mann auf einen Monat bedarf, und um
denselben Preis so viel Gerste, als man
braucht, um ein Pferd 40 Tage lang zu
füttern. Zehn H
r 1 Peñsê
*
) kauft man so vielen Weizen,
als ein Mann auf einen Monat bedarf, und um
denselben Preis so viel Gerste, als man
braucht, um ein Pferd 40 Tage lang zu
füttern. Zehn H
 hner gelten gleichfalls nur 1
Peñsê. In der Stadt Prag macht man die S
hner gelten gleichfalls nur 1
Peñsê. In der Stadt Prag macht man die S
 ttel, Z
ttel, Z
 ume und Schilde, welche in
diesen L
ume und Schilde, welche in
diesen L
 ndern gebraucht werden. Im
böhmischen Lande verfertigt man d
ndern gebraucht werden. Im
böhmischen Lande verfertigt man d
 nne, sehr lose wie Netze
gewebte T
nne, sehr lose wie Netze
gewebte T
 chlein, die man zu nichts
brauchen kann, die jedoch bei ihnen den
festen Werth von 1/10 Peñsê haben und im
Handel und Verkehr gebraucht werden. Sie
gelten bei ihnen als baares Geld, und man
bestizt davon Kisten voll. Um dieSe T
chlein, die man zu nichts
brauchen kann, die jedoch bei ihnen den
festen Werth von 1/10 Peñsê haben und im
Handel und Verkehr gebraucht werden. Sie
gelten bei ihnen als baares Geld, und man
bestizt davon Kisten voll. Um dieSe T
 chlein sind die kostbarsten
Gegenst
chlein sind die kostbarsten
Gegenst
 nde zu kaufen, wie Weizen,
Sklaven, Pferde, Gold und Silber. Eine
merkwürdige Erscheinung ist es, daß die
Einwohner Böhmens von dunkler Hautfarbe sind
und schwarzes Haar haben; der blonde Typus
kommt nur wenig unter ihnen vor."
nde zu kaufen, wie Weizen,
Sklaven, Pferde, Gold und Silber. Eine
merkwürdige Erscheinung ist es, daß die
Einwohner Böhmens von dunkler Hautfarbe sind
und schwarzes Haar haben; der blonde Typus
kommt nur wenig unter ihnen vor."
"Der Weg von Merseburg nach Boreslaws Land ist folgender: von dort nach Burg Faliwi 10 Meilen, von dort nach Irb=grâd (Nóbo-Grád = Naumburg verbessert de Goeje) 2 Meilen. Diese Burg ist von Stein


|
Seite 15 |




|
und Mörtel [erbauet] und liegt
 hnlich (wie Merseburg) an dem
Flusse Saale (Çalâwa), und in diese f
hnlich (wie Merseburg) an dem
Flusse Saale (Çalâwa), und in diese f
 llt der Fluß Nûda. (oder Nauda
= Unstrut?). Von der Burg Nwb=Grâd bis zur
Salzsiederei der Juden, die auch an dem
Flusse Saale liegt, 30 Meilen; von dort nach
der Burg Nûrandjîn, die am Flusse Moldâwa
liegt . . ., und von dort bis zum Ende des
Waldes 25 Meilen. Dieser Wald ist von hier
bis zum andern Ende 40 Meilen lang; der Weg
geht
llt der Fluß Nûda. (oder Nauda
= Unstrut?). Von der Burg Nwb=Grâd bis zur
Salzsiederei der Juden, die auch an dem
Flusse Saale liegt, 30 Meilen; von dort nach
der Burg Nûrandjîn, die am Flusse Moldâwa
liegt . . ., und von dort bis zum Ende des
Waldes 25 Meilen. Dieser Wald ist von hier
bis zum andern Ende 40 Meilen lang; der Weg
geht
 ber Berge und durch Wildnisse.
Am Ende dieses Waldes liegt ein Morast von
ungefähr 2 Meilen,
ber Berge und durch Wildnisse.
Am Ende dieses Waldes liegt ein Morast von
ungefähr 2 Meilen,
 ber welchen eine Brücke bis an
die Stadt Prag geschlagen ist."
ber welchen eine Brücke bis an
die Stadt Prag geschlagen ist."
Wir enthalten uns aller weiteren Bemerkungen zu diesem Abschnitt und müssen namentlich die Bestimmung der "Salzsiederei der Juden" und anderer geographischer Namen ortskundigen Forschern überlassen. Bei den die Leinentüchlein betreffenden Worten erinnert de Goeje an Helmolds Angabe (I, 38), wonach die Ranen (Rujaner) keine Münzen hatten, sondern auf dem Markte als Tauschmittel Leinewand brauchten (quicquid in foro mercari volueris, panno linteo comparabis); und er findet für den ausgedehnten Flachsbau bei den Wenden auch darin einen Beweis, daß zu ihrem alten Bischofszins auch "quadraginta resticuh (restes) lini" von jedem Pfluge gehörten Helmold I, c. 10 und 14). - Da dem Ibrahîm die dunkle Gesichtsfarbe und das schwarze Haar bei den Böhmen auffiel, mag er bei den Wenden an der unteren Elbe überall oder doch vorherrschend eine helle Gesichtsfarbe und blondes Haar gefunden haben. -
Er fährt fort:
pMisjko's Land (Polen) ist das gr
 ßte der slawischen L
ßte der slawischen L
 nder. Da herrscht Ueberfluß an
Korn, Fleisch, Honig und [Fischen]
*
). Dieser Fürst fordert die
Steuern in byzantinischen Münzen (mithkâls)
und bezahlt damit seine Mannen, jedem eine
feste Summe monatlich. Er hat n
nder. Da herrscht Ueberfluß an
Korn, Fleisch, Honig und [Fischen]
*
). Dieser Fürst fordert die
Steuern in byzantinischen Münzen (mithkâls)
und bezahlt damit seine Mannen, jedem eine
feste Summe monatlich. Er hat n
 mlich 3000 geharnischte
Krieger, von welchen hundert so viel werth
sind wie tausend andere. Von ihm empfangen
sie ihre Kleidung, Pferde und Waffen und
Alles, was sie brauchen. Wird einem von
ihnen ein Kind geboren, so empfängt er von
dem Augenblicke der Geburt an eine Zulage
f
mlich 3000 geharnischte
Krieger, von welchen hundert so viel werth
sind wie tausend andere. Von ihm empfangen
sie ihre Kleidung, Pferde und Waffen und
Alles, was sie brauchen. Wird einem von
ihnen ein Kind geboren, so empfängt er von
dem Augenblicke der Geburt an eine Zulage
f
 r den Unterhalt desselben,
gleichviel, ob es männlichen oder weiblichen
Geschlechts ist. Wenn der
r den Unterhalt desselben,
gleichviel, ob es männlichen oder weiblichen
Geschlechts ist. Wenn der


|
Seite 16 |




|
Bursche ausgewachsen ist, verheirathet ihn
der Fürst und bezahlt für ihn das Ehegeld
(das er nach Kazwîni von dem Vater des
Bräutigams nahm) an den Vater des M
 dchens. Wenn das M
dchens. Wenn das M
 dchen mannbar ist, so
verschafft der Fürst ihr einen Mann und
giebt an ihren Vater das Ehegeld. Das
Ehegeld ist nun bei den Slawen sehr groß,
gerade so wie es bei den Berbern gebr
dchen mannbar ist, so
verschafft der Fürst ihr einen Mann und
giebt an ihren Vater das Ehegeld. Das
Ehegeld ist nun bei den Slawen sehr groß,
gerade so wie es bei den Berbern gebr
 uchlich ist. Bekommt also ein
Mann zwei oder drei Töchter so werden diese
Ursache, daß er reich wird; hat er hingegen
zwei oder drei Söhne, so wird er arm."
uchlich ist. Bekommt also ein
Mann zwei oder drei Töchter so werden diese
Ursache, daß er reich wird; hat er hingegen
zwei oder drei Söhne, so wird er arm."
"An Misjko's Reich grenzen im Osten die
Russen und im Norden die Preußen (Brûs).
Diese letzteren wohnen am Meere und sprechen
eine besondere Sprache, w
 hrend sie die ihrer Nachbaren
nicht verstehen. Sie sind bekannt wegen
ihrer Tapferkeit. Kommt ein feindliches Heer
in ihr Land, so warten sie nicht auf
einander, bis sie vereinigt sind, sondern
jeder stürmt auf den Feind los ohne sich um
jemand zu k
hrend sie die ihrer Nachbaren
nicht verstehen. Sie sind bekannt wegen
ihrer Tapferkeit. Kommt ein feindliches Heer
in ihr Land, so warten sie nicht auf
einander, bis sie vereinigt sind, sondern
jeder stürmt auf den Feind los ohne sich um
jemand zu k
 mmern, und hauet mit seinem
Schwerte, bis er f
mmern, und hauet mit seinem
Schwerte, bis er f
 llt, oftmals kommen namentlich
die Russen (d. h. Normannen) von Westen her
zu Schiff in ihr Land, um zu pl
llt, oftmals kommen namentlich
die Russen (d. h. Normannen) von Westen her
zu Schiff in ihr Land, um zu pl
 ndern.
ndern.
Westw
 rts von den [B]rûs liegt die
Stadt der Frauen. Diese besitzen Aecker und
Sklaven. Sie werden von ihren Sklaven
geschw
rts von den [B]rûs liegt die
Stadt der Frauen. Diese besitzen Aecker und
Sklaven. Sie werden von ihren Sklaven
geschw
 ngert, und wenn eine von ihnen
einen Knaben gebiert, so t
ngert, und wenn eine von ihnen
einen Knaben gebiert, so t
 dtet sie denselben. Sie reiten
zu Pferd, f
dtet sie denselben. Sie reiten
zu Pferd, f
 hren selbst Krieg und sind
voll Muths und Tapferkeit. Ibrahîm ibn
Jakûb, der Israelit, sagt: "Und dieser
Bericht
hren selbst Krieg und sind
voll Muths und Tapferkeit. Ibrahîm ibn
Jakûb, der Israelit, sagt: "Und dieser
Bericht
 ber diese Stadt ist wahr; Otto
der römische König (Kaiser), hat es mir
selbst erz
ber diese Stadt ist wahr; Otto
der römische König (Kaiser), hat es mir
selbst erz
 hlt."
hlt."
Wir bemerken hierzu nur, daß, wie de Goeje anführt unter Rûs bei den arabischen Schriftstellern des neunten Jahrhunderts ausschließlich die Normannen zu verstehen sind, später auch die Russen. Er verweist dabei auch auf Liutprand, der in seiner Antapod. I,11 (Pertz, Scr. III, p. 277) bemerkt: Constantinopolitana urbs - habet - ah aquilone Hungarios, Picenacos, Chazaros, Rusios, quos alio nomine Nordmannos apellamus, atque Bulgarios -. Hernach hat de Goeje Rûs in Brûs verbessert; er erinnert an König Aelfreds "Maegdà-land" im Norden der "Horithi", und vermuthet nach dieser Sage, daß später "Frauenburg" auf einer alten Tempelstätte der Siwa erbauet sei.
Ibrahîm erzählt weiter:
"Im Westen von dieser Stadt wohnt ein slawischer Stamm, welcher das Volk der Ubâba heißt. Das Gebiet


|
Seite 17 |




|
derselben ist sumpfig und liegt im Nordwesten an Misjko's Reich. Sie haben eine große Stadt am Ocean mit 12 Thoren und einem Hafen. Für diesen Hafen besitzen sie vortreffliche Verordnungen. Sie sind im Kriege mit Misjko begriffen, ihre Macht ist groß. Sie haben keinen König und sind niemandes Unterthanen; ihre Aeltesten sind ihre Herrscher".
Kunik und de Goeje stimmen darin überein, daß mit jener Stadt Danzig gemeint sei; für Ubâba aber möchte letzterer lieber Kûjàba setzen, während Kunik an die Kassuben denkt. Uebrigens beschließt hiemit Ibrahîm seine Nachrichten, welche sich auf die Nordslawen allein beziehen; die Pommern kennt er offensichtlich nicht, auch von den Liutizen weiß er nichts, wenn er sie nicht mit zu Naccons Reich zählte. Er geht nun zunächst zu den Südslawen über:
"Was das Reich der Bulgaren betrifft, so
sagt Ibrahîm ibn Jakûb: Ich bin nicht in
ihrem Lande gewesen; aber ich habe die
bulgarischen Gesandten in der Stadt
Merseburg gesehen, da sie zum K
 nige Otto kamen. Sie trugen
dicht anliegende Kleider und waren mit
langen G
nige Otto kamen. Sie trugen
dicht anliegende Kleider und waren mit
langen G
 rteln umg
rteln umg
 rtet, die mit goldenen und
silbernen Kn
rtet, die mit goldenen und
silbernen Kn
 pfen verziert waren" u.
s. w.
pfen verziert waren" u.
s. w.
Von den Bulgaren wendet sich Ibrahîm westwärts zu den Slawenstämmen, welche im Norden der "See von Venetien (Banàdjia)" "ein hohes Bergland mit schwer zu passirenden Wegen" (die Alpen) bewohnen und von allen Nachbarvölkern als die tapfersten gefürchtet werden. Dann giebt er schließlich allgemeine Bemerkungen über die Wenden, welche wir hier vollständig folgen lassen:
"Im Allgemeinen sind die Slawen
unverzagt und streitlustig; und wenn sie
nicht unter einander uneins w
 ren, in Folge der
mannigfaltigen Verzweigung ihrer St
ren, in Folge der
mannigfaltigen Verzweigung ihrer St
 mme und Zersplitterungen ihrer
Geschlechter, so würde sich kein Volk auf
Erden mit ihnen messen k
mme und Zersplitterungen ihrer
Geschlechter, so würde sich kein Volk auf
Erden mit ihnen messen k
 nnen. Die von ihnen bewohnten
L
nnen. Die von ihnen bewohnten
L
 nder sind die fruchtbarsten
und reichsten von allen, und sie legen sich
mit Eifer auf den Ackerbau und andere Zweige
von Betriebsamkeit dazu, worin sie alle
nordischen Völker
nder sind die fruchtbarsten
und reichsten von allen, und sie legen sich
mit Eifer auf den Ackerbau und andere Zweige
von Betriebsamkeit dazu, worin sie alle
nordischen Völker
 bertreffen. Ihre Waaren gehen
zu Lande und
bertreffen. Ihre Waaren gehen
zu Lande und
 ber See zu den Russen und nach Constantinopel".
ber See zu den Russen und nach Constantinopel".
"Die meisten St
 mme aus dem Norden"
[welche sich zwischen die Slawen eingedrängt
haben] "sprechen slawisch in Folge
ihrer Vermischung mit ihnen; die
mme aus dem Norden"
[welche sich zwischen die Slawen eingedrängt
haben] "sprechen slawisch in Folge
ihrer Vermischung mit ihnen; die


|
Seite 18 |




|
vornehmsten von diesen sind die Trsjkîn, die Ongliîn * ), die Petsjenegen, die Russen und die Khazaren".
"In dem ganzen Norden ist Hungersnoth
nicht die Folge vom Ausbleiben des Regens
und von anhaltende Dürre, sondern vom
Ueberflusse an Regen und von anhaltend hohem
Wasserstande. Regenmangel gilt bei ihnen
nicht f
 r sch
r sch
 dlich, indem sie der
Feuchtigkeit des Bodens und der großen K
dlich, indem sie der
Feuchtigkeit des Bodens und der großen K
 lte halber deswegen kein Sorge
hegen. Sie s
lte halber deswegen kein Sorge
hegen. Sie s
 en in zwei Jahreszeiten, im
Sommer und im Frühling, und ernten zweimal.
Dasjenige, was sie am meisten bauen, ist
Hirse. Die K
en in zwei Jahreszeiten, im
Sommer und im Frühling, und ernten zweimal.
Dasjenige, was sie am meisten bauen, ist
Hirse. Die K
 lte ist bei ihnen der
Gesundheit zutr
lte ist bei ihnen der
Gesundheit zutr
 glich, auch wenn sie heftig
ist
**
)
die W
glich, auch wenn sie heftig
ist
**
)
die W
 rme dagegen sch
rme dagegen sch
 dlich. Sie können in die
Langobardischen Lande nicht reisen wegen der
Hitze, welche dort groß ist und die Slawen
umbringt. Denn sie befinden sich allein wohl
bei derjenigen Temperatur, bei welcher die
Mischung
[der vier Elemente des
Körpers]
in geronnenem Zustande ist.
Schmilzt diese und wird sie heiß, dann
ger
dlich. Sie können in die
Langobardischen Lande nicht reisen wegen der
Hitze, welche dort groß ist und die Slawen
umbringt. Denn sie befinden sich allein wohl
bei derjenigen Temperatur, bei welcher die
Mischung
[der vier Elemente des
Körpers]
in geronnenem Zustande ist.
Schmilzt diese und wird sie heiß, dann
ger
 th der K
th der K
 rper in Auszehrung, und der
Tod ist die Folge. Sie haben zwei Seuchen,
von welchen fast Keiner verschont bleibt,
homra und an-nawâcîr. Sie vermeiden den
Genuß junger H
rper in Auszehrung, und der
Tod ist die Folge. Sie haben zwei Seuchen,
von welchen fast Keiner verschont bleibt,
homra und an-nawâcîr. Sie vermeiden den
Genuß junger H
 hner, weil derselbe ihrer
Meinung nach sch
hner, weil derselbe ihrer
Meinung nach sch
 dlich ist und homra bef
dlich ist und homra bef
 rdert; aber sie essen
Rindfleisch und G
rdert; aber sie essen
Rindfleisch und G
 nsefleisch, und dies bekommt
ihnen gut. Sie tragen weite Kleider, aber
die Aermel sind unten enge".
nsefleisch, und dies bekommt
ihnen gut. Sie tragen weite Kleider, aber
die Aermel sind unten enge".


|
Seite 19 |




|
Die beiden Benennungen der unter den Slawen endemischen Krankheiten wagen wir nicht zu übersetzen. Baron Rosen erklärt homra = Rose, und de Goeje schließt sich ihm an, bemerkt jedoch, daß in Spanien die Masern noch den arabischen Namen alfombra tragen, und nach Dozy homra wohl vorzugsweise Rose, aber auch eine Art von ekelhaften Geschwürchen bezeichne. Das Wort an-nawâcîr ist dem Professor de Goeje nicht anderweitig bekannt; nach Dozy bezeichnet es Eitergeschwüre, besonders am anus. Rosen vermuthet al-bawàcîr und versteht darunter Hämorrhoiden; doch ist es kaum glaublich, daß die Wenden bei ihrer damaligen Lebensweise an diesem Uebel schon allgemein gelitten hätten. Von der Verbreitung der Hautkrankheiten bei den Slawen zeugt vielleicht auch, was Mas'ûdî bei de Goeje a. a. O. S. 27 von den Bädern derselben erzählt: "Bäder haben die Slawen nicht; aber sie machen eine Stube von Holz, und verstopfen die Fugen mit etwas, was auf ihren Bäumen wächst und dem Wassermoos gleicht, und was sie moch "[altslav. muchu, altböhm. (Hanka p. 14) meh, in der Lausitz moch = Moos] "nennen. Sie gebrauchen dies auch zu ihren Schiffen anstatt des Pechs. In einer Ecke dieser Stube erbauen sie einen Feuerheerd von Steinen und lassen darüber eine Oeffnung, um den Rauch hinauszuleiten. Wenn dann der Heerd erhitzt ist, so machen sie das Luftloch dicht und schließen die Thüre. In dieser Stube sind Wassergefäße, woraus sie nun Wasser auf den glühenden Heerd gießen, so daß die Dämpfe aufsteigen. Jeder hat ein Bündel Heu in der Hand, womit er die Luft bewegt und zu sich heranholt. Dann öffnen sich die Poren, und das Ueberflüssige (Auszuscheidende) ihrer Körper kommt heraus und läuft in Strömen an ihnen herunter, sodaß dann keine Spur von Ausschlag oder Geschwür mehr an einem von ihnen zu sehen ist. Sie nennen diese Stube itba" [altsl. istuba, altböhm. (Hanka p. 45) gystba, in der Lausitz istwa].
Ibrahîm setzt seine vermischten Nachrichten fort:
"Die Könige halten ihre Frauen abgeschlossen und sind auf dieselben sehr eifersüchtig. Bisweilen hat Einer 120 und mehr Gattinnen".
"Ihre vornehmsten Fruchtb
 ume sind Apfel=, Birn= und
Pflaumenb
ume sind Apfel=, Birn= und
Pflaumenb
 ume".
ume".
Statt "Pflaumenbäume" giebt de Goeje: perzikenboomen; doch wählte Ibrahîm wohl nur das entsprechende Wort, weil


|
Seite 20 |




|
ihm eine Benennung für die gewöhnliche Pflaume fehlte. Pfirsiche gediehen wohl schwerlich in den Slawenländern.
"Es giebt dort einen [schwarzen] Vogel
mit grünem Schimmer, der alle T
 ne von Menschen und Thieren
nachahmen kann. Man f
ne von Menschen und Thieren
nachahmen kann. Man f
 ngt ihn und man jagt ihn"
(mit ihm?). "Sein Name ist im
Slawischen sbâ. Ferner ist da ein Feldhuhn,
welches im Slawischen tetra heißt. Das
Fleisch desselben schmeckt vortrefflich. Es
l
ngt ihn und man jagt ihn"
(mit ihm?). "Sein Name ist im
Slawischen sbâ. Ferner ist da ein Feldhuhn,
welches im Slawischen tetra heißt. Das
Fleisch desselben schmeckt vortrefflich. Es
l
 ßt sein Balzen aus den Wipfeln
der B
ßt sein Balzen aus den Wipfeln
der B
 ume auf 1 Parasang Entfernung
und weiter hören. Von diesen Vögeln giebt es
zwei Arten, schwarze und gefleckte, welche
sch
ume auf 1 Parasang Entfernung
und weiter hören. Von diesen Vögeln giebt es
zwei Arten, schwarze und gefleckte, welche
sch
 ner als Pfauen sind".
ner als Pfauen sind".
Daß der erste der genannten Vögel: sbâ der Staar sei, darf man aus dem Namen schließen. Denn dieser heißt nach Kühnel im Polnischen noch jetzt szpak (schpak), und im Litthauischen spaka-s (nach Fick, Wörterbuch der indogerm. Sprachen). Da diese Benennung in den südslaw. Sprachen nicht nachgewiesen ist, so darf man annehmen, daß Ibrahîm den Staar hier im Norden kennen gelernt hat. De Goeje verändert, weil auch er den Staar versteht, garib (= fremd) in girbîb (= schwarz), und vermuthet auch, daß Ibrahîm nicht geschrieben habe, man fange und jage den Staar, sondern man fange ihn und jage mit ihm, d. h. brauche ihn als Lockvogel auf der Jagd. Das Wort tetra ist an sich vieldeutig. Denn im Altslawischen bedeutet tetrevi (fem. tetrja) den Fasan (Fick II, 566), im Litthauischen teterva-s das Birkhuhn, tytara-s den Truthahn, dagegen nach Kühnels Mittheilung im Russischen teterev (ferm. teterja), im Polnischen cietrzew (spr. tschetrscheff) den Auerhahn. Daß dieser hier mit dem "schwarzen" Feldhuhn (richtiger: Waldhuhn) gemeint ist, geht aus der Beschreibung hervor. Dagegen lassen wir dahin gestellt, ob das "gefleckte" Huhn etwa das von C. L. Brehm (Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands, Ilmenau 1831, S. 504) beschriebene "gefleckte Auerhuhn" (Tetrao maculatus), oder das Birkhuhn (Tetrao tetrix) oder eine andere verwandte Art oder Gattung sein mag.
Die Slawen haben verschiedene Saiten= und
Blaseinstrumente. Eins der letzteren ist
 ber zwei Ellen lang. Eins
ihrer Saiteninstrumente hat 8 Saiten und ist
innen (unten?) flach, nicht gebogen".
ber zwei Ellen lang. Eins
ihrer Saiteninstrumente hat 8 Saiten und ist
innen (unten?) flach, nicht gebogen".
"Ihr Wein und kr
 ftiger Trank wird aus Honig bereitet."
ftiger Trank wird aus Honig bereitet."