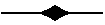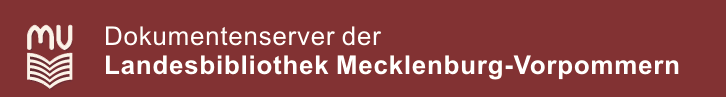|




|


|
|
|
-
Jahrbücher für Geschichte, Band 89, 1926
- Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht
- Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400
- Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage
- Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924/1925
- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1924 bis zum 30. Juni 1925 : Schwerin, 1. Juli 1925
Jahrbücher
des
Vereins für mecklenburgische Geschichte
und Altertumskunde,
gegründet von Friedrich Lisch,
fortgesetzt
von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.
Neunundachtzigster Jahrgang.
herausgegeben vonArchivdirektor Dr. F. Stuhr,
als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schwerin, 1925.
Druck und Vertrieb der
Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.
Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.


|




|


|




|
Inhalt des Jahrbuchs.
| Seite | ||
| I. | Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht. Von Archivar Dr. Werner Strecker | 1 |
| II. | Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400. Von Dr. Werner Burmeister | 229 |
| III. | Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage. Von Generalmajor z. D. Julius von Weltzien, Rostock | 321 |
| IV. | Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin. Von Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Stieda, Leipzig | 325 |
| V. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924-1925. Von Archivdirektor Dr. Friedrich Stuhr | 357 |
| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 371 | |



|




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht
- Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400
- Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage
- Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III) in Berlin
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1924/1925



|


|
|
:
|
I.
Das vormalige
Küstengewässer
(Strand)
und die
Rechtsverhältnisse
in der Travemünder Bucht
von
Archivar Dr. Werner Strecker.



|
[ Seite 2 ] |




|
Die nachstehenden Ausführungen sind als Gutachten des Schweriner Geheimen und Hauptarchivs am 29. August 1925 dem Mecklenburg=Schwerinschen Ministerium des Innern eingereicht worden.


|
[ Seite 3 ] |




|
Inhalt.
| Seite. | |||
| Vorbemerkung | 5-7 | ||
| I. | Das Küstengewässer (Strand) an der Ostsee als landesherrliches Hoheitsgewässer | 8-86 | |
| Unterschied zwischen dem Rechtsstreit um die Travemünder Bucht und dem um die Binnengewässer (Dassower See usw.). Angebliche methodische Fehler unseres Gutachtens von 1923 | 8-10 | ||
| A. | Mittelalterliche Zeit | 10-29 | |
| Die Urkunde für Wismar von 1260, S. 10 f. Privilegien für Rostock von 1252, 1329 und 1358; landesherrliche Meereshoheit, S. 11-13. Verleihung von Seefischerei an das Kloster Neukloster 1219, S. 13-15. Der rügische Strand, S. 15-23. Die holsteinische Urkunde für Lübeck von 1252, S. 23 f. Hoheitsgewässer und Seefischereiregal an der pommerschen Küste, S. 24 bis 27. Desgl. am Doberaner Strande, S. 27 f. Seefischereiabgaben im Amte Ribnitz, S. 28 f. | |||
| B. | Neuere Zeit | 29-70 | |
| Ergebnisse der Akten über den Strandrechtsprozeß zwischen dem Grevesmühlener Amtmann und Wismar von 1595 ff. Strandhoheit bis zum schiffbaren Strom, S. 29-37. Angebliche Begrenzungen des Strandregals (Reitgrenze usw.); dem gegenüber tatsächliche Strandrechtsübung, S. 37-46. Harkenseer Zeugenverhör von 1616 (Strand bis zum Strom), S. 46-48. Erklärung für die Reitgrenze usw., S. 48-52. Irrige Behauptungen Rörigs über Befugnisse und Aufsichtsbezirke der Seestädte am mecklenburgischen Strande, S. 52-66. Strand bis zum Strom im rügischen Landrecht, S. 66 f. Analoge Verhältnisse in Mecklenburg noch im 18. Jahrhundert, S. 67-69. Ergebnisse. Strandhoheit abhängig von Küstenhoheit, S. 69 f. | |||
| C. | Die Fischerei im Küstengewässer | 70-86 | |
| Meeresfischereiregal im Mittelalter und in neuerer Zeit (Rügen) laut Abschnitt A, S. 70. Im mecklenburgischen Küstengewässer für die neuere Zeit nachgewiesen aus Streitigkeiten zwischen Rostock und den Ämtern Bukow und Ribnitz, 1618 ff., 1674/5, S. 71-80. Ferner | |||


|
[ Seite 4 ] |




|
| nachgewiesen aus dem Streit zwischen der Landesherrschaft und der Stadt Ribnitz (17. und 18. Jahrhundert), S. 80-85. Bericht des Amtes Grevesmühlen über das Strandregal von 1773, S. 85. Fortdauer der mittelalterlichen Rechtsverhältnisse am Strande noch im 18. Jahrhundert, S. 86. | |||
| II. | Gebietshoheit und Fischerei in der Travemünder Bucht | 87-189 | |
| A. | Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse | 87-122 | |
| Die custodia illius brevis maris, S. 87-89. Barbarossa-Privileg von 1188. Vergleichung mit dem Privileg für Rostock von 1252, S. 89-99. Fahrwasser und Reede, Lage der alten Reede, S. 100-103. Reede "im weiteren Sinne" S. 103 f. Fälle von 1455 und 1516, S. 104 f. Die Aussage von 1547, S. 105 f. Mecklenburgisches Strandregal bis zum Strom, S. 106-112. Fahrrecht, S. 112-122. | |||
| B. | Die angeblichen Reedegrenzen | 122-137 | |
| Peillinie Berg-Mühle, S. 122-128. Harkenbeck als interne Fischereigrenze, S. 128 f. Westgrenze, S. 129-135. Reede gleich Bucht, S. 135. Mangel einer Reedegrenze, S. 136 f. | |||
| C. | Die Fischerei | 137-189 | |
| Die Fischerei in der Lübecker Bucht bis 1500, S. 137 bis 144. Lübecker Fischereiverordnungen, S. 144-147. Die Bülowsche Wadenfischerei, S. 147-149. Fischreusenstreit, S. 150 ff. Schreiben Lübecks von 1616, S. 165 bis 170. Schriftsatz von 618, S. 171-177. Warnemünder Aussagen von 1618, S. 177 f. Nicht nur mecklenburgischer Krabbenfang, S. 178 f. Fall von 1658, S. 180 f. Lübecker Seefischereiabgaben?, S. 181 f. Mecklenburgische Fischerei und Verordnungen in neuerer Zeit. Küstenmeer, nicht Eigengewässer, S. 183-189. | |||
| Zusammenfassung | 190-191 | ||
Anlagen.
| I. | Der Wismarer Hafen | 192-208 | |
| II. | Urkundliche Nachrichten über Hoheitsgewässer und Meeresfischerei an der Küste von Rügen, Pommern und Pommerellen (Westpreußen) | 209-214 | |
| III. | Schiffsstrandungen an der mecklenburgischen Küste | 215-217 | |
| IV. | "Usque in" in der Bedeutung von "bis zu" in Urkunden der Reichskanzlei und anderer Kanzleien | 218-221 | |
| V. | Exzeptionsschrift des Lübecker Anwalts beim Reichskammergericht von 1618 | 222-227 | |
| Berichtigung zu S. 68 f. (Ausdruck "Räve") | 228 | ||
| Nachtrag zu S. 131 f. (Kämmereiprotokoll von 1804) | 228 | ||


|
[ Seite 5 ] |




|
I n unserem Bericht vom 31. August 1923 nebst dem Nachtragsberichte vom 12. Oktober desselben Jahres 1 ) haben wir gegen das Gutachten Stellung genommen, das Prof. Dr. Rörig unterm 11. Oktober 1922 über die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Lübecker Bucht erstattet und dessen wesentlichen Inhalt er in seinem Aufsatz: Hoheits- und Fischereirechte in der Lübecker Bucht, insbesondere auf der Travemünder Reede und in der Niendorfer Wiek (Zeitschrift für lübeckische Geschichte XXII, 1, 1923) veröffentlicht hat. Gegen unseren Bericht ist Prof. Rörig mit einem weiteren Gutachten aufgetreten, das vom 4. April 1924 datiert und "Mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede, rechts- und wirtschaftsgeschichtliches Gutachten" genannt ist. Auch diese zweite Abhandlung ist inzwischen in der Zeitschrift für lübeckische Geschichte XXII, 2 (1924) abgedruckt worden und zugleich als Sonderheft erschienen.
Wir bedauern, unsere Erwiderung darauf mit einigen persönlichen Bemerkungen eröffnen zu müssen. In seinem Vorwort erwähnt Rörig, daß wir die Absicht gehabt hätten, unseren Bericht von 1923 im Jahrbuche für mecklenburgische Geschichte zu veröffentlichen. Dies ist deswegen nicht geschehen, weil seither aufgefundenes Quellenmaterial uns in die Lage versetzte, unsere Darlegungen viel stärker stützen zu können, als es 1923 möglich gewesen war; ohne Verwertung dieses Materials kam also eine Veröffentlichung für uns nicht mehr in Betracht 2 ). Außerdem


|
Seite 6 |




|
hatten wir inzwischen das neue Rörigsche Gutachten erhalten, das manche bisher nicht berührte Fragen anregt. Wenn Rörig jetzt erklärt, daß wir den Abdruck nach Kenntnisnahme seines Gutachtens ganz aufgegeben hatten, so könnte dadurch der falsche Anschein erweckt werden, als ob wir uns besiegt fühlten. Dem soll hier ausdrücklich widersprochen werden, übrigens ist seinerzeit nach Lübeck mitgeteilt worden, daß wir nach dem Abschlüsse unserer weiteren Arbeiten eingehend und zusammenfassend im mecklenburgischen Jahrbuche berichten wurden. Daß dies im letzten Bande (1924) noch nicht geschehen ist, liegt lediglich daran, daß die Zeit bis zu dessen Ausgabe nicht genügte, um unsere Untersuchungen zu vollenden 3 ).
Es mag sein, daß unser Bericht von 1923 an einigen Stellen etwas lebhaft ist 4 ). Das ist erklärlich genug, weil Rörigs Darlegungen keineswegs nur wissenschaftlich zu bewerten sind. Sie haben durchaus den Zweck, angebliche Lübecker Rechte gegenüber Mecklenburg zu vertreten und, auf Grund einer Hypothese über die Grenzen der Travemünder Reede, eine Meeresfläche als Eigengewässer für Lübeck zu fordern, die dieses selbst in einem solchen Ausmaße bisher nicht beansprucht hatte. Eine ungerechtfertigte Schädigung der mecklenburgischen Fischerei ist denn auch die tatsächliche Folge gewesen.
Gegen eine temperamentvolle Erwiderung hätten wir nichts einzuwenden gehabt. Rörigs Ausführungen aber fallen durch eine Sprache auf, die nur noch als gereizt bezeichnet werden kann und sich an einigen Stellen zu persönlichen Ausfällen steigert, die wir aufs schärfste zurückweisen. Es richtet sich selbst, daß unsere Ab-


|
Seite 7 |




|
weisung der absurden Grenzlinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle- Harkenbeckmündung als "Pseudoakribie und Spiegelfechterei" bezeichnet und der Versuch gemacht wird, die von uns veranlaßte Bemerkung darüber im Januar/Februar-Hefte der Mitteilungen des deutschen Seefischerei-Vereins von 1924 als "bedauerliche Irreführung der öffentlichen Meinung" zu diskreditieren (S. 250). Wir werden den Unwert der Linie noch näher beleuchten, und unsere Darlegungen darüber möchten vielleicht geeignet sein, den Glauben an diese sonderbare Grenzhypothese in Rörigs eigener Brust zu erschüttern. Wenn weiter S. 225, Anm. 12, gewisse Aktenauszüge, die wir vorgebracht haben, als "zweifellos tendenziös" bezeichnet werden, so hindert uns nur der Umstand, daß wir einen amtlichen Bericht zu erstatten haben, daran, auf diese Bemerkung, die sich auch in den Ausführungen auf S. 224 kenntlich macht, die passende Antwort zu erteilen. Schließlich finden sich in dem Gutachten sehr ungerechtfertigte Angriffe gegen unsere Methode, auf die wir im Laufe unserer Untersuchungen noch näher eingehen werden. Es wäre ein Leichtes, solche Angriffe zurückzugeben. Auf welcher "historisch-induktiv vorgehenden" Methode beruht z. B. die unwahrscheinliche Behauptung, daß die Bewohner der mecklenburgischen und holsteinischen Küste bis etwa 1500 nicht in der Lübecker Bucht gefischt hätten, obwohl schon die wendische Zeit den Heringsfang kannte 5 ), oder die Behauptung, daß die Peillinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle "uralt" sei? Gleichwohl haben wir das Gutachten, unter Ausscheidung alles Persönlichen, sachlich geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in den folgenden Ausführungen enthalten. Es gereicht uns dabei zu besonderer Genugtuung, daß wir die von Rörig so heftig bekämpften Resultate unserer Untersuchung vom vorigen Jahre mit neuem Beweisstoff erhärten können.
Wir bemerken noch, daß beim Zitieren der Rörigschen Gutachten eine römische I die erste gedruckte Abhandlung von 1923, eine II die zweite von 1924 bezeichnet. Aktenzitate gelten für das Schweriner Archiv.
Übrigens sind wir uns keinen Augenblick darüber im Zweifel, wie die gut gemachte und siegesgewiß gehaltene Kampfschrift Rörigs von 1924 auf ihre Leser wirken muß, - solange bis wir darauf geantwortet haben.


|
Seite 8 |




|
I.
Das Küstengewässer (Strand) an der
Ostsee
als landesherrliches Hoheitsgewässer.
In seiner Abhandlung von 1923 ist Rörig davon ausgegangen, daß zu Beginn der Lübecker Schiffahrt und Seefischerei an den Küsten der Lübecker Bucht überall freies, herrenloses Meer gewesen sei. Die Lehre vom Küstengewässer und einer Herrschaft der Uferstaaten über dieses Gewässer habe sich erst viel später ausgebildet, als Lübeck an gewissen Teilen der mecklenburgischen und holsteinischen Küste bereits wohl erworbene historische Rechte besessen habe, die durch diese Lehre nicht mehr hätten beseitigt werden können. Infolgedessen nimmt Rörig unter Berufung auf Schücking und Rehm an, daß bei der Beurteilung der Rechtsverhältnisse in der Lübecker Bucht - von der uns hier nur ein Teil, die Travemünder Bucht, angeht - die völkerrechtlichen Regeln versagten und nur das örtliche Gewohnheitsrecht als maßgebend anerkannt werden könne. Um diese seine Meinung zu stützen, hat er auf den Schiedsspruch des Reichsgerichts über das Hoheitsrecht am Dassower See, der Pötenitzer Wiek und der Untertrave von 1890 hingewiesen, der dem historischen Gewohnheitsrechte gefolgt sei. Indessen ist gar nicht zu verkennen, daß sich dieser Spruch ganz wesentlich auch auf das Barbarossaprivileg von 1188 gründet, das damals noch für echt gehalten und vom Reichsgericht in einem für Lübeck günstigen Sinne ausgelegt wurde.
Zur Abweisung der von Rörig gezogenen Parallele haben wir in unserem vorjährigen Bericht bemerkt, daß es sich bei der Entscheidung von 1890 um Binnengewässer gehandelt habe und daß ein Hoheitsrecht über solche ohne Rücksicht auf Ufereigentum an sich möglich sei, über das Meer an der Küste dagegen nicht. Damit haben wir den Unterschied zwischen der Rechtsnatur des damaligen und des jetzigen Streitgegenstandes hervorheben wollen. Mag das Gewohnheitsrecht über den Besitz eines Binnengewässers entscheiden können, für ein Meeresgewässer trifft dies deshalb noch nicht zu. Es ist daher auch unzulässig, die Rechtsgutachten von Schröder und Laband über den Dassower See usw. ohne weiteres auf die Travemünder Bucht anzuwenden, wie Rörig es getan hat 6 ). Wenn nach Laband "historisch begründete Rechtstitel unbedingt die nur dispositiven Sätze des Völkerrechts über Grenzgewässer unwirksam


|
Seite 9 |




|
machen", so handelt es sich doch im jetzigen Streite überhaupt nicht um Grenzgewässer im Sinne vom Dassower See, Pötenitzer Wiek und Trave.
Daß anerkannte Grundsätze des Völkerrechts rechtsändernd gewirkt haben, ist nicht zu bestreiten. Im vorigen Jahre haben wir gesagt: "Drang, wie Rörig annimmt, der Begriff des Küstengewässers in Gestalt eines ganz neuen Rechtssatzes durch, so wäre es sehr zweifelhaft, ob nicht dieses neue Recht die bisherigen Verhältnisse in Hinsicht auf die Fischerei hätte beseitigen können." Dieser hypothetische Satz läßt nach Rörig (II, S. 219) "kaum eine ernstliche Erörterung zu". Es genüge, auf den dispositiven Charakter des modernen Rechtes am Küstengewässer hinzuweisen, von dem Rörig ebenso fasziniert ist, wie wir es von dem A-priori- Bestande des Rechtes am Küstengewässer sein sollen. Um die Richtigkeit unseres Satzes zu prüfen, müßte man die Fischereiverhältnisse an den Küsten verschiedener aneinander grenzenden Staaten historisch zu verfolgen suchen, und wir möchten glauben, daß sich Ergebnisse herausstellen würden, die uns recht geben.
Indessen kann es nicht unsere Aufgabe sein, die juristische Frage zu erörtern, ob in dem obwaltenden Streite das Völkerrecht oder das Gewohnheitsrecht zu entscheiden habe. Sondern wir wenden uns gegen die Behauptung, daß sich aus der gewohnheitsrechtlichen Entwicklung für Lübeck ein Anspruch auf Gebietshoheit am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Bucht bis zur Harkenbeck herleiten lasse, indem wir diese Behauptung mit historischem Beweismaterial widerlegen. Entschieden weisen wir den Vorwurf zurück, daß wir uns "allzu schnell auf vermeintlich allgemein gültige Normen" festgelegt hätten, und daß unser Ausspruch, Hoheitsrecht am Küstengewässer sei ohne Uferhoheit nicht möglich, "letzen Endes die theoretische Grundlage" unseres Gutachtens sein soll (II, S. 219). Wir kommen hiermit zu den beiden methodischen Fehlern, die Rörig (II, S. 233) in unseren Ausführungen entdeckt haben will. Der eine, schon angedeutete, soll darin bestehen, daß wir versucht hätten, "den modernen Begriff des Küstengewässers im Rechtssinne in die historische Entwicklung hineinzutragen". Damit werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Nicht wir haben a priori angenommen, daß es im Mittelalter ein Hoheitsgewässer an der Küste der Ostsee gegeben habe, sondern Rörig hat es a priori geleugnet. Weil er davon ausgegangen war, daß dem Strandherrn im Mittelalter kein Recht auf einen Teil der See zugestanden habe, so hatten wir es unternommen, die Richtigkeit seiner Ansicht zu prüfen. Wir fanden, daß verschiedene Urkunden


|
Seite 10 |




|
und Aktenstellen nicht mit ihr im Einklang stehen, und auf Grund dieser Queuen kamen wir zu der Überzeugung und glauben bewiesen zu haben, daß in der Tat bereits im 13. Jahrhundert die Strandhoheit einen Teil der See mit umfaßte. Das nennen wir induktive Methode. Dabei haben wir keinen Zweifel darüber gelassen, daß das, was wir als Küstengewässer bezeichnet haben, sich an Ausdehnung mit dem modernen Küstengewässer nicht vergleichen kann, wie ja auch Rörig (II, Anm. 51) wohl verstanden hat.
Der Ausdruck "Küstengewässer" allerdings kommt in unseren Quellen nicht vor. Das Gewässer, über das die Strandhoheit sich ausdehnte, gehörte eben zum Strande und fiel mit unter den Begriff des Strandes. Ob man diesen Meeresgürtel als Küstengewässer, Strandgewässer, Strand oder Strandmeer (vgl. Rörig II, Anm. 51) bezeichnen will, ist einerlei. Wir haben den Ausdruck "Küstengewässer" gewählt, weil die Rechtsbasis für die Hoheit darüber dieselbe war wie für die Rechte am modernen Küstengewässer, nämlich die Hoheit über die Küste. Daher läßt sich der überflutete Strand als ein Vorläufer des heutigen Küstengewässers bezeichnen, obwohl er in die schiffbare See nicht hinausreichte und obwohl die Rechte daran umfassender waren als die am modernen Küstenmeer.
Als zweiten methodischen Fehler unseres Gutachtens glaubt Rörig feststellen zu können, daß wir "Exzerpte aus Urkunden sehr verschiedener räumlicher Unterlagen einfach als Zeugnisse für einen vermeintlich einheitlichen Rechtsbegriff, das Recht am Küstengewässer," zusammengestellt hätten. Dieser Vorwurf wäre berechtigt, wenn wir uns auf Quellen wirklich fernliegenden Ursprungs berufen hätten. Daß aber die Rechtsverhältnisse an der holsteinischen, mecklenburgischen und rügisch-neuvorpommerschen Ostseeküste nicht gar so verschieden waren, ist von vorneherein wahrscheinlich und wird durch die Quellen vollkommen bestätigt.
Rörigs Polemik nötigt uns, auf die Urkunden, die wir angeführt haben, noch einmal einzugehen.
Da ist zunächst die Urkunde vom 26. September 1260 7 ), worin die Fürsten Johann und Heinrich von Mecklenburg der Stadt Wismar einen von ihr gekauften Heringszug bestätigten. Die Urkunde ist als Abschrift im Wismarer Privilegienbuche enthalten, das als zuverlässig anzusehen ist. Eine Hand des 15. Jahrhunderts


|
Seite 11 |




|
hat am Rande vermerkt: De heringtoge in Golvisse. Die Richtigkeit dieser Note steht dahin. Folgt man ihr aber, so würde es sich allerdings um Fischerei in fast eingeschlossenen Gewässern handeln. Es mag daher von dieser Urkunde abgesehen werden 8 ).
Die beiden folgenden Urkunden, die wir angeführt haben, sind das Privileg des Fürsten Borwin III. von 1252 für die Stadt Rostock, wodurch die Bürger mit dem Lehn der Fischerei (beneficio piscature) auf der Unterwarnow und im Meer (in marinis fluctibus), soweit sie sich hinauswagen wollten, ausgestattet wurden 9 ); weiter die Urkunde des Fürsten Heinrich II. von 1323, die eine Bestätigung des Lehns der Seefischerei (nur dieser) und die Beschränkung des Fischfanges auf das Meer am Strande des Stadtgebietes enthält 10 ).
Rörig weist darauf hin, daß alle diese Urkunden den Bürgern der beiden mecklenburgischen Städte ausgestellt seien, "die frühzeitig durch ihre Schiffahrt in mancherlei rechtliche Beziehungen zu den Gewässern vor ihrer Stadt getreten waren". Immerhin erscheint Rostock zuerst 1218 und ist nicht viel älter 11 ); Wismar wurde zwischen 1222 und 1229 gegründet und 1256 zur Residenzstadt gemacht 12 ). Die Urkunden zeigen, daß die städtische Entwicklung von den Landesherren gefördert worden ist. Fürst Borwin III. bestätigt 1252 den Rostockern zugleich das Privileg seines Großvaters von 1218 13 ), das das früheste Zeugnis für das Bestehen der Stadt bildet. Dieses erste Privileg von 1218 umfaßt be-


|
Seite 12 |




|
reits die Fischerei (piscationibus); und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch damals schon sowohl Seefischerei wie Binnenfischerei gemeint war. Wegen der ursprünglich absoluten Stellung der slavischen Fürsten, von denen all und jede Gerechtsame ausging, gab es um jene Zeit keinerlei Recht, das nicht durch landesherrliche Zugeständnisse erworben wurde. Außerdem verkaufte Borwin III. 1252 der Stadt die Rostocker Heide, verzichtete auf das Strandrecht im Hafen, sicherte die Berechtigung zur Einfuhr und Ausfuhr zu unter Vorbehalt des etwa zu erhebenden Zolles und verlieh das Stadtrecht für die Markscheide. 1264 gewährte er dann das Stadtrecht über den Warnemünder Hafen 14 ). Ganz deutlich läßt sich hier erkennen, daß die landesherrlichen Verleihungen mit der Entwicklung der schnell aufblühenden Stadt Schritt hielten. Es ist daher auch nichts darauf zu geben, daß Rörig (II, Anm. 37) annimmt, es habe sich bei der Urkunde von 1252 um eine nachträgliche Legalisierung eines bestehenden Zustandes gehandelt, ganz davon abgesehen, daß dies nicht beweisbar ist und daß auch aus einer nachträglichen Legalisierung ein landesherrliches Recht zu entnehmen wäre. Als 1358 der Herzog Albrecht II. Rostock die volle Gerichtsbarkeit verkaufte, wurde deren Ausdehnung auf das Meer rings an der Küste des Stadtgebietes ausdrücklich ausgesprochen:
tam intra eandem civitatem quam extra in terris et in mari circumquaque , prout in suis terminis et campispaciis, wlgariter markedschede dictis, se extendunt 15 ).
Wie wären denn die landesherrlichen Übertragungen solcher Rechte wie der Seefischerei und der Jurisdiktion auf dem Meere überhaupt zu erklären, wenn nicht der Landesherr sie und also eine Gebietshoheit besessen hätte! Es ist ganz unbegreiflich, wie angesichts der Urkunden von 1252 und 1323 behauptet werden kann, daß im Mecklenburgischen Urkundenbuche nicht eine einzige Verleihung von Fischereirecht im "Küstengewässer" anzutreffen sei (Rörig II, S. 231). Mit der Behauptung von "ausgesprochenen Sonderbildungen" (II, S. 225) wird nichts bewiesen und die Tatsache der landesherrlichen Verleihungen nicht aus der Welt geschafft. Eben dieses Recht, dessen der Landesherr sich am Meeresufer des Rostocker Stadtgebietes entäußerte, hat ihm an seiner ganzen Küste zugestanden. Dafür sind Zeugnisse aus dem Mittel-


|
Seite 13 |




|
alter und der neueren Zeit in hinreichender Zahl vorhanden. Wie hätte sonst auch Fürst Heinrich 1323 dazu kommen sollen, den Rostockern einen begrenzten Bezirk für ihre Seefischerei zuzuweisen? Soll es sich dabei etwa auch um einen ganz unbestimmten "Zubehör zur Warnow" (II, Anm. 37) handeln, obwohl die Flußfischerei diesmal gar nicht erwähnt wurde?
Bei seiner Erörterung der von uns vorgebrachten Urkunden ist Rörig auf die Geschichte des Wismarer Hafens eingegangen, in dessen Rechtsverhältnissen er eine "vollkommene Parallele" zu denen der Travemünder Reede erblicken will 16 ). Um nicht zu weit abzuschweifen, haben wir unsere Erwiderung in die Anlage I verlegt. Hier soll nur das Ergebnis ausgesprochen werden, daß Wismar weder, wie es beanspruchte, die Gebietshoheit noch die alleinige Fischereigerechtigkeit auf der ganzen Wismarer Bucht bis zur Insel Lieps besessen hat. Übrigens leitet Rörig, indem er den Ausführungen Techens folgt, ein Recht Wismars auf das Gewässer bis zur Lieps aus dem Privileg des Fürsten Heinrich von 1266 ab, also aus einer landesherrlichen Verleihung. Will man aber diese Ansicht Techens, die wir nicht teilen, adoptieren, so kann von einer Parallele zwischen dem Wismarer Hafen und der Travemünder Reede schon deswegen nicht gesprochen werden, weil Lübeck niemals Seegebiet verliehen worden ist; denn das Barbarossaprivileg von 1188, auf das wir noch eingehen werden gibt dafür schlechterdings nichts her. -
Wir kommen zu der Urkunde von 1219, die Fürst Heinrich Borwin von Mecklenburg über die Gründung des Klosters Sonnenkamp (Neukloster) ausstellte, dem er darin u. a. 30 Hufen und die halbe Meeresfischerei zu Brunshaupten überwies:
in Indagine in villa, que dicitur Bruneshovede, XXX mansos et piscaturam dimidiam etiam iuxta mare 17 ).
Hier handele es sich, so sagten wir, um den Fischfang im Küstengewässer, das zum Strandgebiete gerechnet wurde und deswegen iuxta mare, neben, dicht beim eigentlichen Meere, lag. Dabei ist iuxta in der gewöhnlichen Bedeutung übersetzt. Daß Seefischerei ge-


|
Seite 14 |




|
meint ist, wird auch im Wort- und Sachregister des Urkundenbuches (Band IV, S. 426, Sp. 1: Fischerei an der Küste der Ostsee) und ebenso von Techen (Hansische Geschichtsbl. XII, S. 276) angenommen. Indessen hat Rörig auf dem Meßtischblatte ein jetzt völlig ausgetrocknetes Wasserloch (Blänk) an der Küste Brunshauptens festgestellt, das er als einen "heute zurückgegangenen, früher größeren, seeartigen Teich" bezeichnet (II, S. 226). Es ist zwar möglich, daß dieses Wasserloch 1219 umfangreicher war als 1877, dem Ursprungsjahre des Meßtischblattes, jedoch kann es sich nach der ganzen Lokalität nur um ein bescheidenes Gewässer gehandelt haben. Darauf kommt es aber nicht an. Rörig glaubt, daß Fischerei in diesem Teiche, also Binnenfischerei gemeint sei, obwohl der Teich gar nicht in der Urkunde erwähnt wird. Es ist ganz unzulässig, aus der piscatura iuxta mare einfach eine piscatura in stagno iuxta mare zu machen, wie es sicher heißen würde, wenn die von Rörig angenommene Binnenfischerei hätte verliehen werden sollen. Das Wort stagnum (= See, aber auch für Teiche gebraucht) kommt in der Urkunde zweimal vor und dient zur Bezeichnung der Teiche bei Wichmannsdorf (A. Doberan) und Techentin (A. Lübz) 18 ), die dem Kloster verschrieben wurden. Auch lacus kommt vor. Mit der piscatura dimidia iuxta mare ist in der Urkunde dasselbe gemeint wie mit der dimidietas piscaturae prope mare bei Malpendorf, die ebenfalls verliehen wurde 19 ) und worunter nur Fischerei im Salzhaff verstanden werden kann 20 ). Natürlich aber bedeutet mare hier das große Haff selbst und nicht etwa die offene See dahinter.
Wir haben also alle Ursache, an unserer Auffassung festzuhalten und die Erklärung Rörigs abzulehnen, der nun einmal eine landesherrliche Meereshoheit für das Mittelalter nicht gelten läßt. Daß es sich um die halbe Fischerei handelt, spielt keine Rolle und weist nicht auf ein Binnengewässer hin. Denn die Abgrenzung von Seefischerei nach einem Strandbezirk kommt auch in dem Rostocker Privileg von 1323 vor (und in manchen pommerschen, siehe Anlage II). Außerdem genießt man die halbe Fischerei auch, wenn keine Grenze abgesteckt, sondern mit einem andern zu gleichen Rechten gefischt wird.


|
Seite 15 |




|
Das iuxta übrigens haben wir im vorigen Jahre wohl zu wörtlich übersetzt. Mit lateinischen Präpositionen in mittelalterlichen Urkunden kann man es nicht allzu genau nehmen; sie stehen oft nicht in der klassischen Bedeutung, so daß mitunter eine gewisse Verschwommenheit des Ausdrucks festzustellen ist. So kommt apud vor in der Bedeutung von "in" 21 ), per in der Bedeutung von "an - entlang" (bei Grenzbeschreibungen), und piscatura prope mare, iuxta mare heißt einfach Fischerei am Meere, Meeresfischerei, wobei sich in dem iuxta der Begriff "an (der Küste) entlang" mitfühlen läßt.
Weiter hatten wir uns berufen auf die Urkunde von 1225, in der Fürst Wizlaw von Rügen dem Ratzeburger Kapitel abgabenfreien Heringsfang für eigenen Bedarf verlieh. Die Stelle lautet:
Dedimus etiam eidem ecclesie, quantum ad sua victualia, per omnem terram nostram liberam capturam de allec sine theloneo et absque molestia et impedimento 22 ).
Hier meint Rörig (II, S. 233), unsere Interpretation erledige sich "durch den Hinweis auf die geographische Eigenart der Rügenschen Gewässer. Die Bodden der Insel und das schmale Gewässer zwischen ihr und dem Festlande, das demselben Fürsten untersteht, gehören zu seinem Machtgebiet, seiner terra; sie werden eben wie Binnengewässer behandelt". Zwar trifft es zu, daß die Gewässer, die Rörig im Auge hat, auch der Rügische Bodden, als landesherrliche Binnengewässer galten 23 ), aber schließlich haben ja Insel und Festland Rügen (Neuvorpommern) auch offene Küste und Buchten, wo ebenfalls gefischt wurde, genau so wie in der Travemünder Bucht. Und auf die Rechtsverhältnisse an der offenen Küste und den offenen Buchten Rügens wollen wir einen Blick werfen.
"Obendrein," sagt Rörig (II, S. 233 f.), "enthält gerade das Rügische Landrecht eine Bestimmung, die, weit entfernt, ein landes-


|
Seite 16 |




|
herrliches Recht am Küstengewässer zu normieren, nur den Strand als solchen dem zuspricht, "deme dat land edder över hörede". Der Binnenstrand soll dem Herrn des Landes so weit gehören, "als ein man mit einer bindexe (Axt) konde int water werpen"; aber auch das nur dann: wo nicht de strom darvor was, d. h.; wenn nicht das einer andern Herrschaft gehörende Wasser aus irgendeinem Grunde noch näher an das trockene Ufer heranreicht!" Soweit Rörig. Gemeint ist eine Stelle in dem Landrecht, auf die Techen 24 ) aufmerksam gemacht hat, die aber von Rörig mißverstanden und unvollkommen benutzt ist. Es handelt sich bei diesem rügischen Landrecht um ein Werk des Matthaeus Normann, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Gerichtsschreiber rügischer Landvögte wirkte und dabei das alte hergebrachte Recht, das bereits im Rückgange begriffen war, kennen lernte und aufzeichnete. Er hat sein Werk später überarbeitet, einige Jahre bevor er selber Landvogt wurde. Wir halten uns an die ursprüngliche kürzere Fassung 25 ), die auch Techen zitiert hat, und berücksichtigen den erweiterten Text 26 ) nur, wenn er zur Ergänzung dient 27 ).
Kapitel 5 des Landrechtes handelt "Van stranden, strömen, stranddrifden (Strandrührungen), visklagen (Fischlagern) und watergerechtigheiten, so vele meines gnedigen heern sonderbare gerechtigheit belanget". Es heißt da:
- It sind tweierlei strande, de eine de grote strand, so umme dat land gehet, die ander de kleine binnenstrand.
- Des groten strandes nimpt sik meines gnedigen heern amptman an; it si denne, dat etliche sonderbare privilegien up den Strand edder fredesamen besitz desulven hedden, als Pudbusck, die Jaßmunde vom Spiker (auf Jasmund), und wer sonst im besitz is, de nemen sik des strandes an, so wit ere güder reiken.
. . . . . . . .
- Alle bröke (Rechtsbrüche, Verschuldungen) und undat, so up angetagenen stranden upme lande und water, van den vischern edder sonsten geschuet, dat strafen und richten furstlicher gnaden amptleude.
Halten wir fest, daß hier in Ziffer 1 unterschieden wird zwischen


|
Seite 17 |




|
dem kleinen Binnenstrand und dem großen Außenstrand, auf den es für uns allein ankommt. Nach dem erweiterten Text ging der Außenstrand vom Neuen Tief (zwischen Mönchgut auf Rügen und der Insel Ruden am Osteingange des Greifswalder Boddens) an nach Norden um Jasmund und Wittow herum bis zum Bugerort an der Südspitze des Bugs, dann nördlich um Hiddensee und an dessen Westküste entlang bis zu den Dünen vorm Gellen 28 ). Dieser Außenstrand stand dem Landesherrn zu, es sei denn, daß andere für bestimmte Strecken, an die ihre Besitzungen stießen, damit privilegiert waren. Er umfaßte nach Ziffer 4 Land und Wasser, trockenen und überfluteten Strand; diese Stelle möchte noch zweifelhaft sein, aber hören wir weiter. Kapitel 135 handelt "van bergegelde der strandeden und stranddriftigen guedern". Da heißt es in Ziffer 7 (der von Techen angezogenen Stelle):
De olden weren etwes der binnen- und butenstrande twistich wolden, dat de binnenstrand hörede, deme dat land edder över hörede, so wit int water, wo nicht de strom darvor was, als ein man mit einer bindexe (Axt) konde int water werpen, de butenstrand dem overe up 3 sehewagen 29 ) nahe, ist deme fast eines döndes (ist dem fast einerlei Tuns), dat ander furstlichen gnaden binnen und buten, wor keine sonderlike privilegia vorhanden.


|
Seite 18 |




|
Also man war sich nicht einig darüber gewesen, ob nicht dem Grundherrn 30 ), dessen Besitz ans Ufer stieß, ein kleiner Anteil am Strande zustehe. Es hatte sich also nicht um geltendes, sondern um strittiges Recht gehandelt. Und für die Abmessung des grundherrlichen Anteiles am Binnenstrande, aber nur an diesem, wollte man sich der Wurfgrenze des alten deutschen Rechtes bedienen, die sich durch den Wurf mit der Axt, dem Hammer oder anderen Gegenständen bestimmte. Doch nur dann, "wo nicht de strom darvor was", d. h. wenn nicht das tiefe Wasser zu weit ans Ufer ging, so daß überhaupt kein flacher Binnenstrand vorhanden war 31 ). Und nun die entscheidende Stelle, die Rörig nicht berücksichtigt hat:
dat ander furstlichen gnaden binnen und buten, wor keine sonderlike privilegia vorhanden.


|
Seite 19 |




|
Mit den Worten "dat ander" kann nur der Strand gemeint sein, der noch jenseits der kurzen Strecke am Ufer lag, die man


|
Seite 20 |




|
den Grundherren zuschreiben wollte. Und die "besonderen Privilegien"beziehen sich auf Verleihungen des ganzen Strandes, wie wir sie oben aus Kap. 5 Ziffer 2 für die Herren von Putbus und Jasmund kennen gelernt haben. Daß aber dieser weiter nach dem tiefen Wasser, dem Strome, zu gelegene Strand, abgesehen von besonders Privilegierten, dem Landesherrn allein gebühre, darüber war kein Streit. Übrigens geht aus dem erweiterten Text hervor, daß sich die grundherrliche Axtwurfweite für den Binnenstrand durchsetzte, nicht aber die Drei-Seewogen-Weite für den Außenstrand 32 ), der in seiner vollen Ausdehnung seewärts landesherrlich blieb.
Die Erklärung, die Rörig der Stelle hat angedeihen lassen (oben S. 15 f.), geht also in die Irre. Vermutlich kennt er sie nur durch Techen, der den Anfang weggelassen hat. Man vergleiche zu unserer Interpretation die Urkundenauszüge, die wir in der Anlage II bringen und die das Gewässer an der offenen Küste Rügens und Pommerns betreffen. Könnte auch in den dort unter Nr. 1 angeführten Urkunden über rügische Besitztümer an sich zweifelhaft sein, ob die Bestimmungen über Küstengewässer und Fischereigerechtigkeit auch für den Außenstrand gelten sollten, so läßt doch das rügische Landrecht, wie wir gesehen haben, erkennen, daß sich die Hoheit des rügischen Landesherrn in der Tat über einen Teil der See auch am Außenstrande erstreckte. Und von vorneherein spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese Hoheit das Fischereiregal einschloß; denn der Rechtszustand am Außenstrande Rügens war offenbar dem an der offenen Küste Pommerns analog. Immerhin muß dies näher untersucht werden. Das Landrecht sagt in Kap. 5, 3, wohl mit Beziehung auf den Außenstrand allein:
It mot up niene (keine) vischerlage edder vitten (Niederlassung) jennige bode gebuwet werden ane furstlicher gnaden


|
Seite 21 |




|
edder deren amptlüden consens, und darvor werd mathering und stedegeld genamen.
Also Stättegeld für die Buden und außerdem eine Abgabe vom Fang. Wurde beides etwa nur für die Ufernutzung gefordert, oder ist der Mathering ein Entgelt für die Ausübung der Fischerei selbst? Für das letzte spricht ein Zusatz des erweiterten Textes, wonach sich die Abgabe nach der Ergiebigkeit des Fanges beim jedesmaligen Auswerfen der Netze bestimmte 33 ). Und daß in der Tat nicht nur Ufernutzung in Betracht kommt, wird durch Titel 183 der erweiterten Fassung (S. 171) bewiesen. Darin tadelte der Verfasser, daß die Stralsunder Fischer die Ströme und Bodden binnen Landes befischten, was früher nicht erlaubt gewesen sei, "angesehen dat ock ere Water- Privilegium sick nicht binnen Landes deit erstrecken". Gleich darauf heißt es: "Item, dat mag sin, dat de vom Sunde (Stralsund) etlike Privilegia up den Heringfang-Legen (Lagern) umb Wittow und andern Örden am Butenstrande an Ruigen anthen (anziehen) . ." Das Wasser - privileg bezieht sich also auf den Außenstrand 34 ), woraus hervorgeht, daß der Landesherr dort nicht nur Ufergerechtsame zu vergeben hatte.
Dies erhellt auch aus einem Vertrage zwischen dem Herzog Philipp Julius von Pommern und der Stadt Stralsund vom 10. Mai 1606, in dessen 15. Artikel gesagt wird;
"Ferner . . sollen sich . . die vom Stralsunde der freyen Fischerey in ihren Grentzen und Scheiden und dazu in unserm großen Strande und umb das Land herumb, so viel unser Intereße betrifft 35 ), wie dann auch insonder-


|
Seite 22 |




|
heit des Heringsfangs auf Wittow und Hiddensehe und des dazu gehörigen Fischlagers und unser Vitten ungehindert gebrauchen und derwegen mit keinem Erdtgelde noch einigem Mattfisch beschweret werden, und wollen wir ihnen die Herberge daselbst nicht verbieten lassen . . ." 36 ).
Hiernach verfügte der Landesherr über die Fischerei im großen Strande, dem Außenstrande Rügens. Und es ist bezeichnend genug, daß es heißt: in unserm großen Strande, daß also der Ausdruck "Strand" auf das Gewässer an der Küste angewendet wird. Dieses Gewässer stellt der Vertrag dem "in ihren Grentzen und Scheiden" an die Seite, womit nur das Binnengewässer zwischen dem Festlande und der Insel Rügen gemeint sein kann, in dem schon 1240 Fürst Wizlaw I. der Stadt Stralsund Fischereigerechtigkeit innerhalb bestimmter Grenzen verliehen hatte 37 ). Demgemäß wird in einer Resolution des Herzogs Philipp Julius von 1612 unter Beziehung auf den Vertrag von 1606 gesagt, daß die Fischerei "in den Stralsundeschen Grentzen und Scheiden" unstreitig und auch "im großen Strande" der Stadt freigelassen, daß aber der Fischfang "im Binnen-Waßer" 1606 streitig befunden worden sei; doch solle jetzt die freie Fischerei auf allen landesherrlichen Strömen und Wieken (d. h. Binnengewässern) zugestanden werden 38 ). Freie Fischerei im Außenstrande und in den Binnengewässern wird also gleichgestellt. Nicht nur um eine Ufernutzung handelt es sich am Außenstrande, sondern die Dinge lagen hier genau so wie an der pommerschen und mecklenburgischen Küste, und der Mathering - in seiner rechtlichen Bedeutung wohl zu unterscheiden von dem Stättegeld oder "Erdgeld" für die Fischerbuden - ist eine Abgabe für die Ausübung der Fischerei selbst, analog dem mecklenburgischen Zollhering, auf den wir noch zurückkommen werden.
Unsere Beweisführung für ein rügisches Küstengewässer bedürfte also gar nicht mehr der Urkunde des Fürsten Wizlaw für das Ratzeburger Domkapitel von 1225, von der wir ausgegangen sind (oben S. 15). Per omnem terram nostram liberam capturam de allec, diese Worte nur auf die Binnengewässer zu beziehen,


|
Seite 23 |




|
geht nicht an; denn auch der Außenstrand umfaßte Meeresgebiet und auch er gehörte zur omnis terra. -
Schließlich die letzte Urkunde, auf die wir uns berufen haben, die vom 6. Februar 1252, worin die Grafen Johann I. und Gerhard I. von Holstein den Lübecker Fischern die Berechtigung zum Fischfange an der holsteinischen Küste und zu gewissen damit verbundenen Nutzungen auf dem festen Lande erteilten:
. . piscatoribus Civitatis Lubicensis ea concessimus libertatum iura in perpetuum duratura, quod per totum districtum dominii nostri apud maria piscatione libere frui debent et cum navibus suis, ubi eis utile visum fuerit, ad litus accedere et retia sua in terra apud littora siccare et lignis infructibilibus, tam ad siccanda retia quam ad edificandas casas et ad ignem competentibus, sine qualibet contradictione frui debent 39 ).
Per totum districtum dominii nostri apud maria, das heißt doch wohl, sagt Rörig 40 ), im ganzen Gebiet unserer zwingenden Gewalt andem Meere (entlang). Sehr möglich, aber wenn so übersetzt, wenn also per = "in"gefaßt wird, dann kann man nicht mehr mit Rörig folgern: "Also: das Herrschaftsgebiet liegt an dem Meere, schließt es aber nicht ein." Denn dann müßte mit dem districtus dominii eine Wasserfläche gemeint sein, weil ja auf dem festen Lande nicht gefischt werden kann. Über das apud wollen wir keine Vermutungen anstellen; es ist zwar nicht ausgeschlossen, daß es "in" bedeutet 41 ); aber es läßt sich nicht beweisen. Was jedoch heißt per? Entweder "an - entlang", wie in einer Urkunde von 1167 (per litus maris, vgl. oben Anm. 22), oder "hindurch", das Gebiet hindurch = überall in dem Gebiet. Es steht hier ja nicht in Verbindung mit terra, sondern in Verbindung mit districtus dominii, womit etwas anderes gemeint sein kann als das feste Land. Schließlich aber ist es einerlei, ob man übersetzt: "in unserem Herrschaftsgebiete am Meer" und darunter das Hoheitsgewässer an der Küste versteht, oder ob man sagt: längs unserem ganzen Herrschaftsgebiete am Meer. Denn es kommt weniger auf diese Stelle an als auf das, was verliehen wurde. "Die spezialisierten Bestimmungen


|
Seite 24 |




|
der Urkunde," meint Rörig, "sprechen ja ganz eindeutig von Freiheiten, welche die Lübecker Fischer auf dem festen Ufer selbst eingeräumt bekamen." Gewiß; aber nicht nur von solchen Freiheiten, und es heißt ausdrücklich, daß die Rechte, die Rörig im Auge hat, in terra ausgeübt werden sollten.Die Lübecker dürfen an der Küste fischen, mit ihren Booten ans Ufer fahren und ihre Netze auf dem Lande am Ufer trocknen sowie das Holz von Bäumen, die keine Früchte tragen, zum Netzetrocknen, Hüttenbau und zur Feuerung verwenden. Fischerei also und Nutzungsrechte auf dem Lande werden zugestanden und ausdrücklich in der Urkunde unterschieden. Nur die Worte piscatione libere frui debent, fährt Rörig fort, könnten zweifelhaft sein. Gar nicht zweifelhaft! Denn auf der Küste kann man schlechterdings keinen Fischfang betreiben, also wurde Fischereigerechtigkeit an der Küste erteilt, woraus wiederum zu schließen ist, daß den Holsteiner Grafen ein landesherrliches Seefischerei-Regal zustand. Aber unsere "Interpretation durch Analogie zu den vermeintlichen Ergebnissen für die mecklenburgische Küste ist in sich haltlos, ganz zu schweigen, daß sie dem Wortlaut Gewalt antut". Wir brauchen hier gar keine Analogie, weil die Urkunde selbst klar genug ist. Und wieso und warum "in sich" haltlos? Abgesehen davon, daß wir nicht bloß "vermeintliche" Ergebnisse aufzuweisen haben, darf man doch wohl die Verhältnisse an der holsteinischen und mecklenburgischen Küste in Parallele stellen. Ja, wenn über die holsteinische Urkunde noch irgendein Zweifel bestehen könnte (den wir nicht hegen), so müßte er angesichts der Rechtslage an den Küsten Mecklenburgs und Pommerns schwinden. Es ist merkwürdig, wie verschieden die Ansichten sind: Wir erinnern uns, daß im vorigen Jahre hier im Archiv die Meinung laut wurde, Rörigs Interpretation (I, S. 6) tue dem Wortlaut der Urkunde "Gewalt an". Diese seine Interpretation widerspricht sich selbst; denn einmal soll "freier (d. h. abgabenfreier) Fischfang" durch das Privileg gewährt sein, und hernach heißt es: "Von dem Fischereibetrieb selbst, soweit er sich auf dem Wasser abspielt, enthält das Privileg nichts" usw. Ist denn der freie Fischfang etwa kein Fischereibetrieb auf dem Wasser?
Der Schluß, den wir 1923 aus den mitgeteilten Urkunden gezogen haben, daß nämlich schon im Mittelalter an der mecklenburgischen, holsteinischen und rügischen Küste die Uferhoheit einen Teil des Meeres umfaßte, bleibt unerschüttert. Und er erhält neue, starke Stützen durch das bereits erwähnte Material, das wir inzwischen dem ommerschen Urkundenbuche entnommen und in der


|
Seite 25 |




|
Anlage II zusammengestellt haben. Aus diesem Material ergibt sich folgendes:
- Ein Teil der Ostsee an der Küste, und zwar nicht nur in den Buchten und Bodden, sondern auch an der offenen Küste, war landesherrliches Hoheitsgewässer. Das ist für Rügen ausgesprochen in der Urkunde Barnims I. von Pommern vom Jahre 1249 (Anl. II, Nr. l): cum mari salso predictas terras et bona ubique attingenti, mit der an die genannten Lande und Güter überall rührenden salzigen See (solten see, wie oft in niederdeutschen Quellen gesagt wird), was auch für den rügischen Außenstrand gilt. Für die pommersche Küste ist es wörtlich ausgesprochen in der Urkunde desselben Herzogs von 1265 (Nr. 2): in mari salso terre nostre dominio adiacenti; das heißt: in der zu unserer Landesherrschaft belegenen, ein Zubehör unserer Landesherrschaft bildenden salzigen See; denn in dieser Bedeutung kommt adiacere oft vor und adiacentia sind Pertinentien 42 ). Weiter wird es bezeugt durch die Urkunde Barnims von 1266 (Nr. 3): allecia . . capere valeant in locis predictis, quantum ad nostram pertinent dominationem, was sich auf die Wasserflächen des Persantehafens und an der Küste des Kolberger Stadtgebietes bezieht, wo der Heringsfang den Bürgern von Kolberg erlaubt wurde.
- In diesem Hoheitsgewässer ist, was sich schon aus A ergibt die Fischerei ein landesherrliches Regal gewesen. Daher heißt es in der Urkunde Bogislaws IV. für Kolberg von 1268 (Nr. 4), daß die Bürger den Fischfang von Kolberg bis zur Swine in omni loco, ubi nostrum est sollten ausüben dürfen, d. h. wo die Fischereigerechtigkeit dem Landesherrn zustehe.
Dreierlei fällt außerdem beim Studium dieser Urkunden in die Augen:
a) die Verleihung von Seefischerei auf nach Küstenstrecken begrenzten Wasserflächen (Nr. 1, 3-6, 8. 10, hier an der


|
Seite 26 |




|
Küste von Oxhöft), meistens nach dem Uferbesitz des Privilegierten bemessen; z. B. für Kolberg an der Küste des Stadtgebietes (Nr. 3), genau so wie in dem Privileg für Rostock von 1323 43 );
b) die Gewährung des Gebrauches einer bestimmten Zahl abgabenfreier Schiffe zum Fischfange auf der See (Nr. 2, 7, 9-12);
c) Beschränkungen auf Fischerei mit bestimmten Netzen Nr. 4, 11).
Außerdem haben wir oben gesehen, daß das Ratzeburger Domkapitel 1225 freie Fischerei überall im rügischen Hoheitsgewässer erhielt.
Für gewöhnlich also erhob der Landesherr Abgaben vom Fang, wie sie in der Urkunde Barnims I. für Kolberg von 1266 (Nr. 3) des näheren angegeben sind (18 Pfennige vom Ruder und 1 massa (eigentlich = Klumpen) Hering vom Schiffe; auch nach Netzen wurden sie berechnet, Nr. 6). Als Bezeichnungen solcher Angaben erscheinen die Ausdrücke pensio (Pacht, Zins, Nr. 2), theloneum (Zoll, Nr. 2, 3 und in der Urkunde Wizlaws von Rügen von 1225, oben S. 15), exactio (Abgabe, Nr. 2), portio (Anteil, Nr. 5) und einfach solucio (Zahlung, Nr. 6). Auch kommt in Pommerellen die Lieferung des zehnten Fisches und der zehnten Last Hering vor, die mit Jagdabgaben und Gerichtsgefällen, also aus Hoheitsrechten herrührenden Einkünften, zusammen genannt werden (Nr. 9). Die Freiheit von diesen Fischereiabgaben, das Recht, abgabenfrei zu fischen, heißt libertas (Nr. 4, 5, 6) = Privilegium; daher wird die privilegierte Fischerei "piscatio libera" (Nr. 10) und das privilegierte Fischerfahrzeug "navis libera" genannt.
Die Bezeichnung der Abgabe als Zoll (teloneum) in Nr. 2 und 3 könnte zunächst darauf schließen lassen, daß es sich um einen bloßen Zoll bei der Einfuhr der Fische handele. Indessen geht gerade aus diesen beiden Urkunden Barnims I. die Existenz eines Hoheitsgewässers an der Küste besonders klar hervor (Barnim war seit dem 17. Mai 1264 Herr ganz Pommerns, also auch Herr der ganzen offenen Küste des Landes). Und in der Urkunde Nr. 2 von 1265 für das Kloster Dargun erscheint neben theloneum der Ausdruck pensio, der unbedingt auf Meereseigentum schließen läßt. Auch ist der Wortlaut der Urkunde ganz eindeutig:
indem wir bewilligen, daß das Schiff samt den Fischern und Netzen, die sich darauf befinden, frei und ledig sei von allem Zins, Zoll und irgendwelcher anderen Abgabe, zu


|
Seite 27 |




|
denen uns andere Schiffe, die zum Schollenfang in See gebracht werden, wegen der Fischerei (ratione piscationis) verpflichtet sind.
Überdies wird in einer Urkunde aus dem folgenden Jahre (1266), in der Barnim Besitzungen und Privilegien desselben Klosters, darunter auch die abgabenfreie Seefischerei mit einem Schiffe, bestätigte (vgl. Nr. 2 am Schlusse), Zollfreiheit im ganzen Herzogtume extra gewährt 44 ). Desgleichen zeigen die Urkunden Nr. 5 von 1268 und Nr. 11 von 1312, daß es sich bei den Fischereiabgaben nicht um Zoll im eigentlichen Sinne gehandelt hat; denn in Nr. 5 (für Kloster Bukow) wird den Klostersassen Zollfreiheit außerdem erteilt 45 ), ebenso in Nr. 11 den Lokatoren und Bürgern von Rügenwalde, und zwar gerade auch Freiheit vom Zoll bei der Einfuhr vom Meere aus 46 ).
Das für die Fischerei entrichtete teloneum ist eben kein eigentlicher Zoll, sondern einfach eine Abgabe, wie denn auch der Zoll, der an der skandinavischen Küste für den Heringsfang erhoben wurde, nichts weiter ist als eine Abgabe für den Fang selbst 47 ).
Und diese Abgabe für Seefischerei kommt auch in einer von zwei mecklenburgischen Urkunden vor, die wir zum Schlusse an-


|
Seite 28 |




|
führen wollen. Zwar ist die erste davon (angeblich von 1189, tatsächlich im Anfange des 13. Jahrhunderts geschrieben) sicher falsch und auch die Echtheit der anderen wird bezweifelt, doch kann dies die rechtsgeschichtliche Bedeutung des Inhalts nicht berühren. Es handelt sich um ein Privileg des Fürsten Nikolaus II. von Rostock für das Kloster Doberan, worin der Zoll vom Heringsfang, das Strandrecht und jede Nutzung (Frucht, Auskunft) des Meeres an der Küste des Abteigebietes verliehen wurde (1189):
teloneum in captura allec et aplicationem navium, necnon et omnem proventum maris, quod in aquilonari parte abbatie situm est . . . 48 ),
und um ein ähnliches Privileg des Fürsten Heinrich Borwin I von Mecklenburg aus dem Jahre 1192, ebenfalls für das Kloster Doberan:
Omnem eciam proventum maris vel utilitatem (Nutzung) infra hos terminos racionabiliter distintcos ( die Grenzen sind vorher beschrieben), tam in captura allec quam in periclitatione navium (Schiffsstrandung, eigentlich Schiffsverderbung) concessimus . . 49 ).
In der ersten Urkunde wird also sowohl das Strandrecht wie die Abgabe von der Heringsfischerei übertragen, in der zweiten das Strandrecht und, allgemein, die Nutzung des Heringsfanges. Und beide Privilegien, über deren Bedeutung wir uns im vorigen Jahre noch nicht schlüssig waren, zeugen von einem landesherrlichen Fischereiregal im Küstengewässer.
Zollhering, so heißt auch die an den Landesherrn zu leistende Abgabe, die seit 1614/15 in lückenhaft erhaltenen Rechnungen des Amtes Ribnitz aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erscheint und (nach Wall = 80 Stück berechnet) von Waden und Reusen, auch Pfählen (zur Befestigung von Reusen) und "Korfsticken" (zur Befestigung von Netzkörben) gegeben wurde, mit denen man den Fischfang an der Küste des Amtes betrieb. In den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts wurde von hier aus die Güstrower Hofhaltung mit Hering versorgt und der Fang genau beaufsichtigt. 1665 findet sich die von den Reusen zu zahlende Abgabe geradezu als "Strandgerechtigkeit" bezeichnet. Daneben kommen, außer Heringszoll, die Ausdrücke: Heringsgelder, Heringsgefälle, Heringsintraden vor, die jetzt in bar (6 Pfg. für den Wall) entrichtet


|
Seite 29 |




|
wurden und beträchtliche Einnahmen brachten 50 ). Also noch im 17. Jahrhundert wurde die alte Bezeichnung "Zoll" für die Abgabe vom Heringsfange gebraucht.
Wir wollen unsere Untersuchung hier abbrechen, soweit es sich um die mittelalterliche Zeit handelt, über die wir, zumal im Hinblick auf Rügen, schon haben hinausgreifen müssen. Überall, von Holstein bis Pommerellen, dasselbe Bild, überall landesherrliche Meereshoheit und landesherrliches Fischereiregal, ohne jedoch, daß sich aus dem urkundlichen Material erkennen ließe, wie weit das Hoheitsgewässer seewärts gerechnet wurde. Ist also die kühn unterstrichene Behauptung Rörigs (II, S 231) berechtigt, daß "vollkommener wohl kaum eine vermeintliche Beweisführung in sich zusammenbrechen" könne als unsere für ein mecklenburgisches Hoheitsrecht am Küstengewässer im Mittelalter? Zwar gehören zu den Urkunden, die wir in unserem Bericht von 1923 verwertet haben, die Rostocker Privilegien von 1252 und 1323, beides unwiderlegliche Zeugnisse für landesherrliche Rechte; zwar sagt Rörig, daß sich die Worte iuxta mare "höchstwahrscheinlich" (also doch nicht ganz sicher) auf den Teich bei Brunshaupten bezögen, zwar meint er selber hernach, daß in der holsteinischen Urkunde von 1252 die von der Fischerei handelnde Stelle, die am wichtigsten in dem Privileg ist, zweifelhaft sein könne; trotzdem: auf das vollkommenste zusammengebrochen, und "auch nicht eine Quellenstelle" soll übrig bleiben! "Es ist geradezu ausgeschlossen," fährt Rörig fort, "daß etwa neues Beweismaterial im Sinne der These des M. G. (unseres Gutachtens) überhaupt zutage kommen könnte" (haben wir oben bereits reichlich vorgebracht). "Einmal nicht aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen, da ja auch dem 16. und 17. Jahrhundert ein Rechtszustand solcher Art unbekannt war" (das Gegenteil haben wir für Rügen bewiesen und werden es auch für Mecklenburg beweisen). Sodann: das Mecklenburgische Urkundenbuch enthalte keine Verleihungen von Fischereirechten im Küstengewässer (was außer Rörig niemand behaupten wird).
Den Ergebnissen, die wir über das Küstengewässer an der Ostsee und im besonderen am mecklenburgischen Strande für das Mittelalter gewonnen haben, entsprechen - sehr im Gegensatze zu Rörigs Behauptung - Nachrichten der späteren Zeit. Wir


|
Seite 30 |




|
gehen zunächst ein auf die in unserem vorigen Berichte angeführten beiden Fragen, die in dem Prozesse, den Wismar gegen den Grevesmühlener Amtmann Thurmann wegen des Strandrechtes an der Lieps führte, von dem Anwalt Thurmanns, also dem Vertreter der landesherrlichen Rechte, den Zeugen vorgelegt wurden (1597):
- Ob nicht der regierende Herzog Ulrich und seine Vorfahren ihre Lande "mit denen daranstoßenden und in deren territorio,auch Enden und Scheiden belegenen Waßern, Strömen und Sehen und derselben Üfern und Stranden" nebst allen Regalien usw. vom Reiche zu Lehn trügen.
- Ob nicht "das Ambt oder Voigtey Grevißmüehlen nebenst der daran rührenden offenbaren Sehe und derselben respective Grundt und Bodem, auch Üffer und Strandt" zum Herzogtum gehöre.
Wir haben aus diesen Fragen geschlossen, daß der Begriff des Küstengewässers jener Zeit durchaus geläufig gewesen sei, wobei wir selbstverständlich nicht die moderne Drei-Seemeilen-Zone im Auge hatten. Für Rörig (II, S. 224) freilich sind die Fragen "anmaßender Schwulst", obwohl er doch wissen müßte, daß diese in unseren Auszügen nicht einmal sehr hervortretende "Schwulst" dem Stile der Zeit zur Last fällt. Und ihre Bedeutung werde völlig niedergeschlagen durch Zeugenaussagen, die Techen in seinem Aufsatz über das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste in den Hansischen Geschichtsblättern XII (1906) veröffentlicht hat, einem Aufsatze, den im vorigen Jahre nicht herangezogen zu haben, wir um so mehr bedauern, als uns dadurch Arbeit erspart worden wäre. Weil Rörig seine Verwunderung darüber ausgesprochen hat, daß wir nur so wenig aus den Akten über den Strandrechtsprozeß gebracht haben, wollen wir bemerken, daß es zwar schon im vorigen Jahre unsere Absicht war, den ganzen Bestand unserer Strandrechtsakten daraufhin zu prüfen, ob sich für ein Recht auf Meeresgebiet etwas daraus ergäbe. Wir mußten jedoch diese Untersuchung zurückstellen, weil Monate dazu erforderlich sind und diese Zeit uns fehlte 51 ). Daher haben wir uns auch mit den Akten über den Prozeß wegen des Strandrechtes an der Lieps mit seinen dickleibigen Zeugenprotokollen (Hunderte von Fragen, die 35 Zeugen vorgelegt wurden) nur zum Teil bekannt machen können. Was wir aber daraus entnommen haben, halten wir vollkommen aufrecht.


|
Seite 31 |




|
Wissenschaftliche Forschung wird sowohl die angeführten Fragen wie die Zeugenaussagen prüfen, nicht aber, wie Rörig es tut, die von Techen beigebrachten Zeugenaussagen, die nicht einmal zueinander stimmen, ohne jede nähere Aktenkenntnis als allein maßgebend bezeichnen und die in den Fragen zutage tretende Rechtsanschauung beiseite werfen. Bleiben wir zunächst bei den Fragen. Wir fügen noch eine dritte hinzu:
Ob nicht das Bergerecht "neben andern des Strandes und Sehewaßers hohen Obrigkeit und Gerechtigkeit eine Landesfürstliche sonderliche Hoheit und Regale" sei und dem Herzoge von wegen des Amtes Grevesmühlen an dem strittigen Orte zustehe?
Natürlich kann eine Prozeßpartei irrige Behauptungen aufstellen, aber doch wohl nur, soweit das geltende Recht nicht geleugnet und nicht verlangt wird, daß statt dessen die Rechtsgültigkeit irgendwelcher Hirngespinste anerkannt werde. Zum mindesten müßte man doch erwarten, daß die Gegenpartei Widerspruch erhoben hätte.
Die Stadt Wismar klagte 1595 beim Güstrower Hofgericht gegen den Amtmann Thurmann wegen Verletzung des Strandrechtes an der Lieps bei der Strandung eines Danziger Schiffes. Der Anwalt des Beklagten übergab darauf eine Exzeptionsschrift, die gleich damit beginnt, daß der Wismarer Rat eine nichtige Klage wegen angeblicher Störung des doch dem Landesherrn zustehenden "Regale und Landesfurstlichen Hoch- Ober- und Gerechtigkeit an der Sehe und Strande, in specie aber der Bergung der gestrandeten Schieffe und Guter" angestrengt habe. Und von dieser Gerechtigkeit der See und des Strandes ist in dem Schriftsatz fortwährend die Rede. Den 30 Wismarer Beweisartikeln wurden 80 Defensional- und Peremptorial-Artikel entgegengestellt, die später den von Thurmann aufgebotenen Zeugen und etwas verkürzt auch den Wismarer Zeugen zur Beantwortung vorgelesen wurden. Diese Artikel sind also mit den Zeugenfragen identisch und enthalten in ihrem ersten Teile alle die Behauptungen, die wir oben aus den Fragen entnommen haben.
Was antwortete hierauf der Wismarer Anwalt? In seiner Replik, der 170 Elisivartikel angeschlossen waren, heißt es: Die Kläger seien keineswegs geständig,
"daß ihre Klage schlechter Dinge und allein dahin sollte gerichtet sein, daß E(uer) F(ürstl.) G(naden) sie in dero I. F. G. Regal und landesfurstlichen Hoch- Ober- und Gerechtigkeit der Sehe und des Strandes, in specie aber der


|
Seite 32 |




|
Berginge der gestrandeten Schiffe und Gueter und andern darzu gehörigen Gerechtigkeit einen allerdings verbottenen und wiederrechtlichen Eingriff thuen oder daßelbige alles disputirlich machen mochten."
Und hernach, als Entgegnung auf die Artikel, auf die es hier ankommt: Obwohl es zutreffe, daß die Herzöge ihr Land nebst allen dazugehörigen Pertinentien und Regalien vom Reiche zu Lehn trügen, so könne dies doch nur verstanden werden "cum certa qualificatione, limitatione et modificatione salvis cuiusque civitatis prvilegiis et consuetudine praescripta". Die Seegerechtigkeit an sich wurde also ausdrücklich von Wismar zugegeben; nur dagegen erhob es Einspruch, daß sie sich auf den angeblichen Stadthafen erstrecke, auf den Wismar kraft seiner Privilegien und seines Besitzstandes glaubte Anspruch machen zu dürfen und in dem die Lieps seiner Meinung nach lag 52 ). Denn es handelte sich in dem Prozesse darum, festzustellen: Wem steht das Strandrecht auf der Lieps zu und wem gehört die Insel? Gehört sie zu Wendisch-Tarnewitz im Amte Grevesmühlen, oder ist sie Eigentum der Stadt Wismar und im Wismarer Hafen gelegen? Das wurde untersucht. Das Strandrecht an sich als Hoheitsrecht und die Ausdehnung des Strandes waren kein Gegenstand des Streites, wenn auch einige Zeugen darauf eingingen. Wie etwas Selbstverständliches erscheint die Verbindung von Strand und Meeresgewässer als allgemeiner Rechtsgrundsatz in den Artikeln des Thurmannschen Anwalts und wie etwas Selbstverständliches wird sie von Wismar anerkannt. Von "Lehrmeinungen" 53 ) kann ja hier - lange bevor die Diskusston über das moderne, sich in die fahrbare See ausdehnende Küstengewässer durch Hugo Grotius überhaupt erst in Fluß gebracht wurde - gar keine Rede sein. Ein modernes Küstengewässer wird eben nicht in Anspruch genommen, sondern nur das Uralte, Hergebrachte, der Strand.


|
Seite 33 |




|
Ganz abgesehen von dem konkreten Fall des Strandrechtes an der Lieps, sollte etwa die allgemeine Rechtsanschauung, die sich in den Artikeln oder Fragen offenbart, keinen historischen Quellenwert haben, obwohl sie einem rechtsgelehrten Gegner und rechtsgelehrten Richtern vorgebracht und von dem Gegner nicht angefochten wurde? Und entspricht etwa diese Anschauung nicht dem, was wir für das Mittelalter als geltendes Recht festgestellt haben? Wo steckt also die von Rörig, der in seinen Angriffsformen nicht wählerisch ist, bemängelte "staunenswerte Interpretationskunst"? Wir wollen keinen besonderen Wert darauf legen, daß der Ausdruck "daran rührend" (oder "daran stoßend") sich schon in der Urkunde des pommerschen Herzogs Barnim von 1249 über rügische Besitztümer findet: cum mari salso predictas terras et bona ubiqui attingenti 54 ) Denn diesen Ausdruck anzuwenden, lag so nahe, daß er kein stehender Ausdruck der Rechtspraxis gewesen zu sein braucht. Aber daß 1249 und 1595 dasselbe damit gemeint wurde, ist klar, und wenn in einer weiteren Urkunde Barnims von 1265 über das Meer an der pommerschen Küste gesagt wird: in mari salso terre nostre dominio adiacenti 55 ), so liegt die Analogie mit den betreffenden Artikeln des Thurmannschen Prozeßvertreters auf der Hand.
Nun die Zeugenaussagen. Wir wollen versuchen, ein Bild davon zu geben, soweit es hier nötig ist. Die beiden Fragen, die wir oben im Auszuge wiedergegeben haben, gehören zu den ersten Defensionalartikeln, die 1) die unvordenkliche Belehnung der Herzöge mit ihren Landen durch das Reich, 2) die unvordenkliche rechtmäßige Erlangung und 3) den heutigen Besitz der Lande, 4) den unvordenklichen Besitz des Amtes Grevesmühlen, immer mit dem daran stoßenden Wasser oder der daran rührenden See, mit allen Regalien, Jurisdiktionen usw. und allem Zubehör betreffen und schließlich auf den Besitz von Wendisch-Tarnewitz samt der Lieps zuführen, um so in reichlich umständlicher Weise Gebietshoheit und Strandrecht an dem strittigen Orte festzustellen. Und es ist wahrhaftig kein Wunder, daß sich in dem Vernehmungsprotokoll sehr oft bei den beiden ersten Fragen und wiederholt auch bei der dritten ein Nescit findet zum Zeichen, daß der Zeuge nichts zu antworten wußte. Denn Aufbau und Rechtsinhalt dieser ersten Defensivartikel, die in Frageform gebracht wurden, ist mehr für den Richter bestimmt und ganz ungeeignet, den Zeugen, lauter einfachen Leuten (Bauern, Fischern, Schiffern, einem Brauer und


|
Seite 34 |




|
Seehandelsmann) vorgelegt zu werden. Viele Zeugen halfen sich damit, daß sie z. B. sagten:
"Die itzo noch lebende Hertzogen zu Megkelnburgk, die hetten das Landt in Besitz, wie und welcher Gestalt, konne Zeuge nicht sagen."
Oder:
"Ihme gedencke noch wol, daß unßerm gnedigen Fürsten und Herrn, Herzog Ulrichen, alß einem regierenden Landtßfürsten gehuldigt und daß I. F. G. noch itzo Landtßfürst seie, reliqua nescit."
Solche Antworten kommen auch bei der vierten Frage, betr. den Besitz des Amtes Grevesmühlen mit der daran rührenden See, vor, z. B.:
" Sagt war (wahr), wie lange aber die Hertzogen zu Megkelnburgk (das Amt) innegehabt, nescit."
Oder auch:
"Das Ambt Greveßmühlen seie Zeugen wol bekandt, reliqua nescit."
Dieses Reliqua nescit ist ein Zusatz, der in dem Protokoll bei unzähligen Antworten über alle möglichen Dinge wiederkehrt, wenn die Zeugen keine erschöpfende Auskunft geben konnten. Und man kann es bei den Aussagen über die hier interessierenden Frageartikel ebenso wenig wie das reine Nescit speziell auf das Küstengewässer beziehen, sondern nur auf den gesamten Rechtsinhalt dieser meist eine Folioseite füllenden Fragen, auf die Unvordenklichkeit, die Regalien usw., lauter Dinge, denen die Zeugen hilflos gegenüberstanden. Dasselbe Mißgeschick hatte Wismar mit ebenso ungeeigneten Fragen. Auf seine ersten acht Elisivartikel z. B" die die Gebietshoheit innerhalb der städtischen Grenzen, auch im Hafen, und die Wismarer Privilegien betreffen, hat es von sämtlichen 12 Wismarer Zeugen, die die Stadt selbst aufgeboten hatte, nur zwei Antworten auf je einen Artikel erhalten, so daß das Nescit hier fortwährend im Protokoll erscheint. Es gilt dies auch von anderen Artikeln, von denen manche schon das Urteil vorwegnehmen wollten, und es ist ganz unbegreiflich, daß man sie alle, nebst einer ungeheuren Zahl von Spezialfragen, die von der Gegenpartei bei den einzelnen Artikeln gestellt wurden, den Zeugen vorlegte, so daß sich die ganze Vernehmung höchst qualvoll gestaltet haben muß.
Einige Zeugen bejahten Fragen, in denen von der anstoßenden See die Rede war, ohne sich näher darüber auszulassen. Andere erklärten, nicht zu wissen, wie weit die Grenzen des Herzogtums


|
Seite 35 |




|
zur See (auch zu Lande) reichten oder wie weit sich die Gerechtigkeit des Amtes Grevesmühlen an der See erstrecke. Folgende Aussagen, die bei diesen und anderen Artikeln gemacht wurden, seien hervorgehoben:
- Der Fischer Asmus Holste zu Wismar: "Er wiße nicht anders, dan das im Fall der Nott unsere gnedige Fürsten und Herrn den Seestrom verbitten, wie von Herzog Johanß Albrechten . . . in der Schwedischen Vehde uf jenseit deß Landts zu Pöle geschehen. Wie weit sich nun daßelbe erstrecke, wiße Zeuge nicht."
Dem stehen einige Aussagen gegenüber, die den Strom, d. h. die tiefe See, dem Könige von Dänemark zuschrieben, eine dunkle Vorstellung von einem dänischen Dominium maris Baltici, die noch 1666 auf dem Fischlande wiederkehrt.
- Der Seemann Claus Schönefeldt aus Wismar: Er habe von seinem Vater gehört, "daß alle Gründe, so umb die Lypze liegen, auch zur Lypze gehören sollten". - Wenn das Danziger Schiff, um das es sich handelte, "uff der Lypze Grundt gelegen, . . so gehörte derselbe Ort mit zu der Lypze . . " Weiter sagte er, daß der Strandungsort "von der Lypze ab in die See schöße, aber nicht weit davon, und gehöre mit zu der Lypze, weil er davon abschöße."
- Fischer Jacob Meißner aus Wismar: Der Strandungsort und der Wismarer Hafen "wehren unterschiedene Örter, und gingen die Gründe von der Lypze ab in daß Wißmarische Tief". - Auf die Frage, ob die landesfürstliche Gerechtigkeit "des offenbahren Seestrandes" bei der Lieps je Wismar zugestanden habe: "Oldings hatten die Wißmarischen die Gerechtigkeit gehabt, daß sie die Lypze mit den Gründen verpitten köndten, itzo aber wehre es ihnen genommen."
- Chim Bandow, Bauer aus Wendisch-Tarnewitz: "Von Triwalck (Priwall) an biß an das Wißmarische Tief gehe der Strand, so u. g. Fürst und Herr in Vorbiet habe, welches er gehoret, auch gesehen und selbst dabei gewesen, das die Hauptleute daherumb Schiffe geborgen . . ." - Unter Tief versteht er, wie aus seinen sonstigen Aussagen hervorgeht, nur das Fahrwasser der Bucht (z. B.: "die Lypze liege nicht im Wißmarischen Tief, den(n) Zeuge achte, das das das Tief heissen muß, da die Schiffe ein- und außlaufen").
- Kossate und Fischer Peter Qualmann zu Wendisch-Tarnewitz (auf die Frage nach dem Besitz des A. Grevesmühlen): "Sagt


|
Seite 36 |




|
wa(h)r, den (denn) hochgedachter unser g. F. und Herr hette ja das Landt in Vorbieten, und weil I. F. G., wen(n) umbhehr Schiffe stranden, dieselbigen bergen lasset, wie Zeuge selbst gesehen, hielte Zeuge dafür, das I. F. G. auch die daran stoßende Sehe gebuhre, soweit die Schulde oder seuchte Grundt, do ein Schiff stranden konte, gehe. Sonsten aber do Strome sein, do man siegeln konte, hette Zeuge wohl gehoret, das sie Konigsstrome genennet wurden."
- Fischer und Kossate Dewes Baumgarten aus Boltenhagen (auf eine Frage, betr. die unvordenkliche Nutzung des A. Grevesmühlen): "Soviel die offenbahre Sehe belangete, habe Zeuge von seinem Vater und andern Leuten sagen gehoret, das, waß disseit des Wissmarischen Stroms nach Wendischen Tarnewitzer Lande zur Suderseiten Landtruhring thuet und strandet, das solches die Hertzogen zue Meckelnburg allezeit bergen lassen . ." Unter Strom verstand er das Fahrwasser, wie aus seiner Aussage hervorgeht: das gestrandete Schiff habe "ein Flach vom Strom gelegen, gegen die Liepze an den Sandrefen, do keine Schiffe fließen konten . . ."
- Kossate und Fischer Drewes Qualemann aus Boltenhagen (auf Fragen, betr. A. Grevesmühlen und Wend.-Tarnewitz):". . wisse Zeuge nicht anders, habe es anders auch nicht gehoret, den(n) das G. F. G. die Sehe biß an den Strom zugehoren soll, und was die Liepze umbher begreift, wen daselbst Schiffe stranden . ." - Er habe nicht gehört, daß den Herzögen "andere Gerechtigkeit an der Liepze oder offenbahren Sehe zustehe dan allein, wan disseit des Stroms auch umb die Liepze herumb Schiffe Landtruhring thuen, das sie dieselbe bergen lassen". Unter Strom verstand auch dieser Zeuge das tiefe Wasser.
- Gerd Oualemann, Kossate und Schulze zu Boltenhagen: "Bei Zeugens Zeiten sei es nicht anders gehalten, dan waß disseit des Stroms landtfeste worden, das die Hertzogen zu Mecklenburgk bergen lassen, und habe Zeuge auch nicht anders von seinen Eltern und sonsten andern gehort."
Von diesen Zeugen rechneten also Nr. 2 und 3 die Gründe, die von der Lieps ab in das Tief schießen, mit zur Lieps. Und wie weit sollten denn diese Gründe reichen, wenn nicht bis zur fahrbaren See, bis zum Tief, das "binnen den Gründen" ging! Dem entspricht es vollkommen, daß weitere fünf Zeugen (Nr. 4


|
Seite 37 |




|
bis 8) den Strand bis zum Strom rechneten, womit immer das schiffbare Tief gemeint war 56 ). Und wenn der Zeuge Nr. 7 und mit ihm zwei andere, ein Fischer aus Wendisch-Tarnewitz und ein Beckerwitzer Bauer, nicht wußten, daß der Landesherr außer dem Bergerechte noch weitere Gerechtigkeit an der See habe, so erklärt sich dies daraus, daß am Strande des Amtes Grevesmühlen wie auch an anderen Teilen der mecklenburgischen Küste, wahrscheinlich schon seit langer Zeit, für die Fischerei keine Abgaben erhoben wurden. Im Amte Grevesmühlen lassen sich solche Abgaben erst seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts feststellen; sie wurden damals den Fischern zu Tarnewitz und Boltenhagen auferlegt 57 ) (je 6 Rtlr.) und finden sich seitdem längere Zeit in den Amtsregistern. - Die Zeugen wußten eben immer nur, was sie selbst beobachtet oder zufällig gehört hatten. Von der Schiffsbergung wußten sie alle und gingen bereitwillig darauf ein. Mehr als ein Dutzend aber sagten ausdrücklich, es sei ihnen unbekannt, daß dieses Recht zur landesherrlichen Hoheit gehöre. Selbst der Tarnewitzer Strandvogt Claus Both wußte hiervon nichts, wie die Zeugen denn überhaupt von Regalien und Gebietshoheit nichts verstanden.
Nun die Zeugenaussagen, auf die Rörig sich beruft, zunächst drei, die in dem Prozesse wegen des Strandrechtes an der Lieps von Zeugen, die Wismar aufgeboten hatte, gemacht wurden:
- Fischer und Pilot Claus Brun aus Hoben, der sehr für Wismar eintrat, erklärte, daß die Herzöge "an der See nicht mehr Gerechtigkeit hetten, alß so weit einer mit einem Pferde in daß Waßer reiten und alßdan mit einem Pflugeisen hinein von sich werfen köndte, und daß der Strom dem Köning zue Dennmarcken und den Wißmarischen gehöre".
- Brauer und Seehandelsmann Jasper Tabbert aus Wismar war "von etlichen Leuten, die er nicht zu nennen gewust, wol berichtet worden, daß die Hertzogen zum Meckelnburgk wie auch die vom Adel an der Strandgerechtigkeit nicht weiter Recht hetten, alß wan einer mit einem Pferdt in daß Waßer reite, biß ihm die Hüeffe bedeckt würden und er alßdan mit einem Hueffeisen von sich inß Waßer werfen köndte."
- Schiffer Heinrich Bumgarde aus Wismar: "Waß dem rechten


|
Seite 38 |




|
festen Strande anlangte, habe er wol gehört, daß unser gnediger Fürst und Herr sich deßelben solle gebrauchen, und dan von Tarnewitz biß an die Bake (die auf der Lieps stand), wie er solches von Clauß Bruen (einem mit 90 Jahren verstorbenen Wismarer Fischer) oft gehört, wie auch daß unßer gnediger Fürst und Herr keine mehr Gerechtigkeit an der See hetten, dan man mit einem Pferdt darein reiten köndte." Zur Erklärung sei wegen des "festen Strandes" hinzugefügt, daß der Zeuge Wismar die gesamte Strandgerechtigkeit südlich von der Bake zuschrieb. Hernach sagte er, daß sich der Hafen nach Poel zu bis an die Poeler Brücke erstrecke" und biß an Pöle umbher, so weit einer mit einem Pferdt inß Waßer reiten köndte, und also hette Zeuge vom alten Jürgen Schönefelde gehört". Damit widerspricht er aber seiner eigenen Aussage, wonach Hafen und Tief dasselbe seien und "biß an die Gründe, do ihre Schiff auß- und einsiegelten", gingen. Sein Gewährsmann Jürgen Schönefeld ist offenbar identisch mit dem gleichnamigen Vater des Zeugen Schönefeld, eines Wismarer Schiffers, der sich bei seinen Aussagen verschiedentlich auf seinen Vater berief, aber von einer durch Hineinreiten ins Wasser bestimmten Grenze nichts erwähnte.
Techen hat weitere Aussagen aus späterer Zeit hinzugefügt:
- 1621 wußten Wismarer Zeugen nicht, daß die fürstlichen Beamten "sich weiterer Bottmessigkeit solten angemasset haben, alß so weit man von Lande biß an das Tief mit einem Spießstaken gründen könne" 58 ).
- 1678, Schreiben Wismars an den Gutsherrn zu Zierow und Eggerstorf: "Es ist wohl nicht ohnbekandt, das den Angrenzenden, so weit mit einem Pferde zu reiten, auch gewissermaßen etwas kompetieren könte; aber an Örthern die schon tiefer seien, hat dieses eine Endschaft 59 ).


|
Seite 39 |




|
Für die räumliche Abgrenzung des Bergerechtes durch Ritt und Wurf (mit dem Langeisen, Schießeisen, Hickeisen) hat Techen noch Behauptungen des gräflich Steinbergischen Amtmannes auf Poel 60 ) von 1668 und des Beckerwitzer Strandvogtes von 1669 sowie Aussagen Tarnewitzer Zeugen von 1728 angeführt.
Dies sind die Quellen, die nach Rörig (II, S. 223) beweisen, daß Hoheitsrechte von den Anliegern nur soweit hätten ausgeübt werden dürfen, als die Anlieger selbst oder ihr Pferd den festen Boden berührten. Dies werde "in der symbolischen Ausdrucksweise des Mittelalters mit dem Bilde des Hineinreitens in das Wasser in zahllosen Variationen" ausgedrückt (II, S. 232). Indessen wäre es ja nach der Mehrzahl dieser Angaben erlaubt gewesen, von der Stelle aus, wo die letzte Möglichkeit des Gründens bestand, noch weiter zu werfen, so daß die körperliche Berührung des Bodens dort, wo das geworfene Eisen hinfiel, natürlich ausgeschlossen war. Und wenn zur Ausübung des Bergerechtes mit Booten an das gestrandete Schiff hinangefahren wurde, wie es z. B. bei dem 1595 an der Lieps aufgelaufenen Danziger Fahrzeug der Fall war und auch sonst oft in den Akten erwähnt wird, so kann doch keine Rede davon sein, daß die Strandhoheit sich nur so weit ausgewirkt hätte, als "die körperliche Berührung mit dem Strande selbst im flachen Wasser bei Handlungen solcher Art aufrecht erhalten bleibt" (Rörig II, S. 231 f.). Die "zahllosen Variationen" ferner müßten doch zunächst einmal stutzig machen. Hineinreiten ins Wasser, soweit es geht, und Werfen vom Sattel aus, Hineinreiten, bis die Hufe des Pferdes vom Wasser bedeckt seien (was selbst bei wenig bewegter See ein wahres Kunststück wäre) samt Werfen, bloßes Hineinreiten, Gründen mit einem Spießstaken, - wie weit ging denn nun eigentlich der Strand, und woran sollte man sich in praktischen Fällen halten?
Eine Wurfgrenze kommt in den Zeugenvernehmungen wegen des Strandrechtes an der Lieps auch sonst einmal vor. Claus Qualemann nämlich, ein Fischer aus Tarnewitz, hatte von alten Leuten gehört, daß die Wismarer "soviel Gerechtigkeit im saltzen Have haben solten, alß so ferne zwey Manspersonen, wen(n) sie auf dem Bollwerck stunden, eine Kuhe werfen konten". Techen hat an dieser Aussage Anstoß genommen, weil er sie nicht erklären konnte. Offenbar ist der Kuhwurf auf eine Entstellung des ursprünglichen


|
Seite 40 |




|
Wurfgegenstandes zurückzuführen 61 ). Die Hauptsache aber ist die Wurfweite, die auch hier erscheint und sicher keine praktische Bedeutung gehabt hat.
Sind die übrigen Aussagen als Zeugnisse für einen tatsächlich bestehenden Rechtszustand am landesherrlichen Strande zu bewerten, obwohl sie unter sich nicht einmal im Einklange stehen und vielen anderen Angaben über die Ausdehnung des Strandes widersprechen?
In unseren Akten über unzählige Strandungsfälle an der ganzen mecklenburgischen Küste ist noch ein weiteres Mal von einer Wurfgrenze die Rede. Es handelte sich um ein schwedisches Schiff, das 1699 am Boiensdorfer Langen Werder, also in der Golwitz, aufgelaufen war, so daß es "nicht 4 Ellen hoch Wasser" hatte 62 ). Trotz einer vom Amte Redentin ausgestellten Wache ließen die Wismarer Kaufleute, die das Schiff gechartert hatten, die Fracht in Boote ausladen und das Schiff durch Winden abbringen. Nach dem Berichte des Amtmannes zu Redentin erklärten die Wismarer Schiffer dabei, es habe der Herzog "so woll an dem langen Warder wie auch an andern Kanten der See keine weitere Praetension zu machen, alß mit einem Pflug-Eisen vom Lande zu hineingeworfen werden köndte, daß übrige gehörte der Königl. Mayest. von Sueden zu" (was doch nicht zutraf, da die Golwitz nie schwedisch gewesen ist). Also diesmal nur nach Pflugeisenwurf und somit wieder eine neue Variation, die aber nur von den Wismarer Schiffern vorgebracht wurde und nicht der Strandrechtsübung des herzoglichen Beamten, dem diese Behauptung vermutlich ganz neu war, zugrunde lag.
Im übrigen haben wir in den Strandungsakten des 17. und 18. Jahrhunderts öfter Angaben über die Lage der verunglückten Schiffe und ihre Entfernung vom Ufer gefunden, nirgends aber eine Bemerkung darüber, daß Ritt und Wurf exerziert seien, was man doch erwarten müßte, wenn es die Voraussetzung für das Bergerecht gewesen wäre.
Wir wollen hier zunächst auf einen Fall von 1728 eingehen, bei dessen Gelegenheit Zeugenaussagen gemacht wurden, auf die Techen hingewiesen hat.


|
Seite 41 |




|
In der Nacht auf den 11. Januar 1728 war ein Lübecker Schiff, St. Johannes genannt, bei Tarnewitz gestrandet und lag "eine ziemliche Distance vom festen Lande" und "ohnstreitig auf Hochfürstl. Strandt" 63 ). Die Wismarer schwedische Verwaltung aber, deren Ansprüche auf das Buchtgewässer noch weiter gingen als früher die der Stadt Wismar, machte geltend, daß der Strandungsort schwedisches Gebiet sei. Dem widersprachen nach einem Vernehmungsprotokoll vom 29. Januar sämtliche Tarnewitzer Untertanen. "Zudem - so fährt das Protokoll fort - wäre ja die alte Strand-Gerechtigkeit von der Art, daß wann von Seiten Mecklenburg einer an das gestrandete Schiff so weit reiten, biß er mit einem Zickeisen 64 ) an daßelbe werfen könte, das Strandungs-Recht von Mecklenburg exerciret werden müste. Nun könten sie ja nicht nur bey stillem Wetter an das Schiff, sondern auch gar bis auf der Lieps reiten", weswegen der Strandungsort dem Herzoge zustehen müsse. Wieviele von den Tarnewitzern dies angaben, läßt sich nicht erkennen, weil das Protokoll die Aussagen nur summarisch wiedergibt. Nun hatte allerdings das Schiff, nachdem der Sturm, der es ans Land geworfen hatte, abgeflaut war, nur 2 1/2 Fuß Wasser, so daß man hätte heranreiten können, wie denn die Zeugen ausdrücklich erklärten, daß dies bei stillem Wetter möglich sei. Aber als es strandete, herrschte so starker Sturm und die See ging so hoch, daß am 12. Januar zwar eine Wache aufs Schiff gebracht werden konnte, die Leute aus Tarnewitz und Boltenhagen aber außerstande waren, die Löschung mit ihren Fischerbooten vorzunehmen. "Weil aber - sagt ein Bericht des Amtes Grevesmühlen vom 20. Januar - das hohe Waßer, auch der beständig anhaltende starcke Wind und das üble Wetter continuiret, daß ohne Lebens-Gefahr mit solchen kleinen Böthen (weil man keine größere habhaft werden können) weder nach dem Schiffe, noch wieder zu Lande zu kommen gewesen, alß hat mit der Löschung nicht ehender alß den 15ten dieses, da der Wind sich in etwas geleget und das Waßer kleiner geworden, der Anfang gemacht werden können." Also hat offenbar am 12. Januar gar nicht die Möglichkeit bestanden, an das Schiff so weit hinanzureiten, daß es mit einem schweren Eisen, womit nicht gerade weit geworfen werden kann, zu treffen war. Wäre dies aber die Bedingung für die Ausübung des Strandrechtes gewesen, so hätte sie natürlich, diesmal wie in anderen Fällen, vorher erfüllt werden


|
Seite 42 |




|
müssen, und es konnte nicht etwa die Annahme genügen, daß sie bei ruhigem Wetter möglicherweise zu erfüllen sei. Denn die mittlere Wassertiefe am Strande ist ja nach dessen Beschaffenheit verschieden und bei bewegter See in einiger Entfernung von der Küste gar nicht zu berechnen. Darauf eben wäre es angekommen, dem Schiffsführer den Beweis zu liefern, daß das Strandrecht in Kraft zu treten habe, um so mehr als die Handhabung, wie die Akten zeigen, sich oft nur unter Konflikten vollzog. Nun wurde aber im vorliegenden Fall das Strandrecht schon am 12. Januar, also während des Sturmes, durch die Besetzung des Schiffes mit einer Wache tatsächlich ausgeübt, und auch die Löschung wäre vorgenommen worden, wenn größere Boote zur Verfügung gestanden hätten. Als dann am 3. März Tarnewitzer und Boltenhäger Zeugen wegen des Streites mit der Wismarer schwedischen Verwaltung noch einmal eingehend vernommen wurden, legte man ihnen auch die Frage vor: "Wahr, daß die Hochfürstl. Unterthanen an dieses gestrandete Schiff St. Johannes reiten und zur Noht zu Fuße gehen wollen und können? 65 ) Und aus der Form dieser Frage ist zu schließen, daß solch ein Ritt oder Gang auch nach dem Sturm nicht unternommen war. Übrigens reiht sich die Frage verschiedenen anderen an, wonach der Strandungsort in Vorzeiten festes Land und Weide der Tarnewitzer Bauern gewesen sein sollte, die ihr Vieh sogar bis auf die Lieps gejagt hätten; so hatten nämlich die Tarnewitzer schon vorher ausgesagt. Also diente die Frage sicherlich nur dazu, die Möglichkeit eines solchen früheren Zustandes durch die Flachheit des Wassers in jener Gegend zu erläutern, ohne daß auf eine Strandrechtsgrenze angespielt werden sollte. Demgemäß setzten auch Beauftragte des Amtes Grevesmühlen am 3. April in Wismar dem Vizepräsidenten des schwedischen Tribunals die vormalige Zugehörigkeit des Strandungsortes zum Dorfe Tarnewitz auseinander und erwähnten aus den Zeugenaussagen, daß ein nicht weit davon aus dem Wasser ragender Stein (Kellingsstein) nach einem Bauern genannt sei, dessen Weide dort gelegen habe. "Ja, der Notarius adjunctus bezeugete dem Herrn Vicepraesidenten, daß er dem letzten Ostertag den Stein und Stelle des gestrandeten Schiffes in Augenschein genommen und sich unterstehen wollen, mit


|
Seite 43 |




|
Stiebeln an solchen zu gehen." Darüber aber, daß diese Worte sich auf eine Strand grenze beziehen sollten, findet sich in dem Protokoll über die Unterredung kein Wort, ebenso wenig etwas über eine Grenzbestimmung durch Ritt und Wurf, die doch in erster Linie hätte hervorgehoben werden müssen, wenn wirklich etwas darauf gegeben wäre. Auch in den Aufzeichnungen über die langen Auseinandersetzungen mit dem schwedischen Fähnrich, der am 16. Jan. mit einer Truppe das Schiff besetzt hatte, ist nicht die Rede davon. Offenbar hat das Amt Grevesmühlen diese Abgrenzung nicht anerkannt, und da sie in dem Protokolle über die erste Vernehmung der Tarnewitzer (zwischen 13. und 17. Januar) noch nicht erwähnt wird, so scheinen die betr. Zeugen vom 29. Januar einige Zeit gebraucht zu haben, um sich darauf zu besinnen.
Ein weiterer Fall, der sich fünf Jahre vorher in derselben Gegend ereignete, lehrt ebenfalls, daß man sich keineswegs an einer durch Ritt und Wurf zu bestimmende Strandweite hielt. 1723 nämlich meldete der Tarnewitzer Strandvogt dem Amte Grevesmühlen die Strandung eines Lübecker Schiffes, eines sogenannten Kreiers, der bei Tarnewitz, und zwar nach dem amtlichen Protokoll "beynahe eine halbe Meile vom Lande und nahe an dem Wißmarschen Haafen, dennoch aber auf Hochfürstl. Strande und Gebiete" aufgelaufen war. Die Grevesmühlener Beamten ließen die Ladung durch Boote ans Land schaffen und das dadurch wieder flott gewordene Schiff mit einer Wache besetzen. Lübecker Kaufleute, denen Fahrzeug und Ladung gehörten, baten ihren Rat um Vermittlung; das Schiff habe nicht Schiffbruch erlitten, sondern sei auf einer kleinen Sandbank am Klützer Ort "nur etwas feste zu sitzen kommen". Darauf berief sich der Lübecker Rat auf das Verbot des Strandrechtes im Reich sowie auf die mecklenburgischen Strandrechtsprivilegien für Lübeck und ersuchte um Freigabe gegen Entrichtung eines angemessenen Arbeitslohnes. Die mecklenburgische Regierung in Dömitz entschied, daß Schiff und Waren aus nachbarlicher Freundschaft unter Vorbehalt des Strandrechtes gegen Erlegung von 10 Rtlr. Ad pias causas außer dem Bergelohn citra consequentiam für diesmal ausgeliefert werden sollten, eine Form, die auch sonst gewählt wurde. Unterdessen hatte die schwedische Verwaltung, ebenso wie fünf Jahre später, vorgebracht, das Schiff liege auf ihrem Gebiete, ließ aber nach einer Besichtigung der Örtlichkeit nichts mehr von sich hören 66 ).


|
Seite 44 |




|
Daß man übrigens bei der Ausübung des Bergerechtes nicht gerade "im flachen Wasser" operierte, geht auch aus Akten von 1732 hervor, wonach eine einmastige Stettiner Galliote bei Tarnewitz diesseits des nach Poel zu gelegenen sog. Kellingssteines, "gegen der Haffbeck" strandete. Als sie festsaß, hatte sie fünf Fuß Wasser und bedurfte nur eines Fußes mehr, um loszukommen. Die Grevesmühlener Beamten ließen eine Wache auf das Schiff befördern, weil es auf den landesfürstlichen "ohnstreitigen Grunde und Strande feste geblieben" sei. Boote zum Löschen waren bereits unterwegs, als die inzwischen angestiegene See dem sehr ungebärdigen Schiffer die Abfahrt ermöglichte 67 ).
In der Anlage III haben wir acht weitere Strandungsfälle an verschiedenen Teilen der mecklenburgschen Küste zusammengestellt. Sie geben ein Bild der tatsächlichen praktischen Übung und sind daher beweisend 68 ). In den meisten dieser Fälle ist die Möglichkeit, das Schiff durch den Ritt ins Wasser und den Wurf mit dem Eisen zu erreichen, ganz ausgeschlossen gewesen, in den übrigen auch nicht anzunehmen. Einige der Strandungen geschahen um die Zeit der von Techen veröffentlichten Aussagen von 1668 und 1669, andere in den Zeiten des 18. Jahrhunderts, wo man das Strandrecht mit größter Milde, mehr als einen Akt der Hilfeleistung, ausübte; aber als landesherrliches Regal wurde es gleichzeitig immer wieder scharf betont und der Anspruch auf Bergegeld aufrecht erhalten, wenn dieses auch öfter erlassen wurde. Dabei ist das Bergegeld als Gebühr von dem Arbeitslohn für die Bergung zu unterscheiden. 1789 (90) wurde es von dem Schweriner Regierungsfiskal Bouchholtz in einem Gutachten über das Strandrecht mit den Kosten für die Haltung der Strandvögte begründet 69 ). Dem Rechte nach war die Handhabung noch im 18. Jahrhundert dieselbe wie im 17. und 16., wo ebenfalls, wenigstens im allgemeinen, nicht mehr als ein Bergegeld gefordert wurde, wenn man auch noch nicht grundsätzlich von der alten Anschauung lassen wollte, daß gestrandetes Gut dem Strandherrn verfallen sei 70 ). Ja, diese alte Anschauung klingt noch aus den Berichten hervor, die von herzoglichen Beamten über Strandungen von 1762 und 1781 erstattet wurden (Anlage III, Nr. 4 und 6), wenn man es auch


|
Seite 45 |




|
nicht mehr recht ernst damit meinte. Zudem war sich der Begriff des Strandes vollkommen gleich geblieben 71 ).
Was haben nun aber jene Behauptungen und Zeugenaussagen zu bedeuten, nach denen der Strand durch den Ritt in die See, den Eisenwurf usw. bemessen werden sollte? Techen hat darauf aufmerksam gemacht, daß in J. Grimms Deutschen Rechtsaltertümern 72 ) unter den Maßbestimmungen auch der Pflugeisenwurf und das Hineinreiten belegt seien. Es sind von Grimm sehr mannigfaltige, dem alten deutschen Recht entstammende Gebräuche gesammelt worden, die zur Abgrenzung von Gebiet auf dem Lande und im Wasser dienten. Mehrfach erscheint der Ritt ins Wasser in Verbindung mit einem Hufhammerwurf oder Speerschuß, so zur Bestimmung der Gebietshoheit des Erzbischofs von Mainz im Rhein; daneben der bloße Wurf mit allerhand Gegenständen. Unter den Beispielen für die Reichweite durch Berührung mit Werkzeug verschiedener Art finden sich Angaben, wonach Gebietsrechte soweit gelten sollten, als man vom Pferde aus mit einem Speer das Wasser berühren könne. Es erinnert dies an die Wismarer Aussagen von 1621 über das Gründen mit einem Spießstaken (oben S. 38). Grimm hat (in seinen Bemerkungen zu den Wurfmaßen) die Meinung geäußert, daß bei diesen Bestimmungen alles auf ein hohes Altertum hindeute. "Das anfangs Ehrwürdige," so fährt er fort, "wird hernach nur halb verstanden, zuletzt erscheint es unverstanden und lächerlich." Von ihm benutzte Zeugenverhöre lehrten, "wie schon im 14. Jahrhundert der Hammerwurf in den Rhein einigen gar nicht mehr, den ältesten bloß von Hörensagen, durchaus aber nicht als ein praktisches Recht bekannt war. Traditionell können sich Rechtsgewohnheiten, nachdem sie längst aus der wirklichen Übung verschwunden sind, noch geraume Zeit fort verbreiten."
Man wird also gut tun, solchen Zeugenaussagen mit einiger Kritik zu begegnen. Auch bei den Vernehmungen in dem Prozesse wegen des Strandrechtes an der Lieps haben nur drei Zeugen - drei von 35 - etwas von einer Strandbemessung durch Ritt oder Ritt und Wurf erzählt. Zwei davon gründeten ihre Kunde auf Hörensagen. Bei dem dritten, Claus Brun, ist es wahrscheinlich, wenn auch, wie Techen bemerkt hat, nicht sicher, daß seine Kenntnis auch hier auf seinen angeblich 127 Jahre alt gewordenen Großvater zurückging. Hätte es sich tatsächlich um eine aner-


|
Seite 46 |




|
kannte, bei der praktischen Übung vorkommende Begrenzung gehandelt, so wäre es auffallend, daß von den übrigen 32 Zeugen keiner - ebenso wenig wie der Wismarer Rat - in diesem Prozesse ein Wort darüber verlor. Gelegenheit dazu hätte sich genug geboten, da sich das Verhör außer auf den strittigen Fall auch auf andere Strandungsfälle und auf die Schiffsbergung an der Küste des Amtes Grevesmühlen überhaupt erstreckte. Auch die seltsame Frage, die Wismar den Zeugen der Gegenpartei vorlegen ließ, ob nicht "das allein heist gestrandet, wan das Schiff in Stücken schleiht", hätte doch leicht den einen oder anderen dieser 23 Zeugen reizen können, sich über die Strandbemessung auszusprechen, wenn er über Ritt und Wurf etwas zu sagen gehabt hätte. Aber die Zeugen verneinten immer nur die Frage und erklärten ganz richtig, ein Schiff strande, wenn es "Landruhring" tue. Vor allem gibt es zu denken, daß den genannten drei Aussagen sieben andere, von Zeugen beider Parteien gemachte gegenüberstehen, wonach der Strand bis zum Ende der überfluteten Gründe oder bis zum Strom ging! (oben S. 35 f.).
Ganz vereinzelt erscheint auch bei dem Zeugenverhör wegen des Fischereistreites mit Lübeck von 1616 73 ) die Aussage eines gegen 80 Jahre alten Harkenseers, die wir schon in unserem vorigen Berichte erwähnt haben. Dieser Zeuge hatte gleich die erste Frage, ob nicht den Herzögen Strand und Strandgerechtigkeit, "so weit die Schiffe und die rechte Tiefe des Meeres gehet" (also bis zum Strom) von Travemünde an seit undenklicher Zeit zustehe, voll bejaht:
"Affirmat, und weiß es nicht allein vor sich, sondern habe es von seinen Eltern und andern alten Leuten, insonderheit von seines Vaters Bruder Heinrich Bosen, welcher bey 100 Jahr alt gewesen, woll gehöret."
Dann aber wurde er gefragt (Frage 5): Ob nicht wahr, das der Ort, alda die von den Lübischen aufgerißene Fischreuse gestanden, unstreitig meckelnburgisch Grundt und Strandt sei und alda die letzte Pfale gestanden, nicht über vierdtehalb Faden tief Wasser, bißweilen auch wann das Wasser klein ist, nicht so tief? Und als Antwort hierauf notiert das Protokoll:
"Affirmat, und habe von andern Leuten, so theils von 100 Jahren, woll ehe gehöret, das der Strandt so weit den Herrn von Meckelnburgk zugehöre, alß man mit einem wehligen


|
Seite 47 |




|
Pferde hinein reiten und schwimmen und von demselben mit einem Pflugeisen weiter werfen könne, und also viel weiter, dan diese Reuse gestanden."
Diesmal also berief er sich nur auf Hörensagen, nicht auch auf eigene Kenntnis. Und da er dem Reiten das - sonst nicht bezeugte - Schwimmen hinzufügte, mochte er den Strand so weit rechnen, wie er wollte, selbst noch über eine Tiefe von 3 1/2 Faden (6,30 m) hinaus, wo die letzten Reusenpfähle gestanden haben sollten. Natürlich war hier schon Strom. Das Gegenteil haben auch die mecklenburgischen Kommissare, die mit der Untersuchung der Angelegenheit betraut waren, gar nicht behauptet, sondern nur bestritten, daß die Schiffahrt durch die Reuse behindert werden könne, weil das eigentliche Fahrwasser noch weit ablag.
Außer diesem alten Harkenseer wurden 1616 noch 10 Zeugen vernommen. Keiner aber sagte etwas vom Reiten und Werfen, auch nicht der Sohn eines Wendisch-Tarnewitzer Strandvogtes und ein weiterer Zeuge aus demselben Dorfe, wo man sich doch noch 1728 solcher Grenzbestimmung erinnern wollte. Sondern alle bejahten die Frage, wonach der Strand bis zur rechten Tiefe des Meeres reichen sollte 74 ). Und auf die Frage 5, die der eine Harkenseer Zeuge mit der erwähnten Aussage beantwortete, erwiderte ein Zeuge aus Wilmsdorf ausdrücklich: "Er habe solchs von menniglichen gehöret, auch von seinem Vater, der bei 100 Jahren alt gewesen, das der Strandt biß an den Strom, da die Schiffe gehen, den Herrn von Meckelburgk zugehöre". Während also auf die drei Aussagen in dem Prozesse mit Wismar


|
Seite 48 |




|
sieben kommen, nach denen der Strand bis zum Strom ging, stehen der einen Aussage von 1616 sowohl die eigene vorher abgegebene Erklärung desselben Zeugen wie die Aussagen aller übrigen entgegen.
Die früheste uns für Mecklenburg bekannt gewordene Erwähnung des Hineinreitens in ein Gewässer zur Gebietsbemessung findet sich in den Akten über den langwierigen Streit mit Lübeck wegen des Priwalls, Dassower Sees usw. 1570 nämlich sagte ein Dassower Zeuge über das Eigentum am Priwall aus:
Den Buchwalds "gehöre Grundt und Boden, hohestes und fidest (d. h. Gericht) bis an die Fher (Fähre), so weit man mit einem gesadelten Pferde an die Trave hineinreiten kan. Item er habe gehoret von Otten und Claußen den Bochwalden, dieser ihrer Grosvater, das hinter der Schanzen auf dem Priwalck ein Busch stehen soll, bis an denselbigen hetten sie das Anstranden, vorten bis zur Fher gehoret es Hertzog Heinrichen von Meckelnburgk, in der Wick und offenbaren See hatten die Buchwolt auch des Strants Gerechtigkeit" 75 ).
Mag hier nun die Rittweite praktische Bedeutung gehabt haben oder nicht, jedenfalls könnte diese Zeugenaussage zu einer Erklärung aller jener Behauptungen ähnlicher Art verhelfen, die den Meeresstrand betreffen. Denn in dieser Aussage von 1570 bezieht sich das Hineinreiten nur auf den Grund und Boden und die Gerichtsbarkeit der Buchwalds bis an die Fähre, nicht auf das Strandrecht, das ja gerade nicht bis zur Fähre reichen sollte 76 ); es bezieht sich also überhaupt nur auf eine grundherrliche Grenze. Der Landesherr dagegen nahm 1581 ebendort eine Grenze in Anspruch, die von Schlutup an "mitten durch die Trave, ja auch ferner durch die Hafe zu Travemunde" führte 77 ). Seine Gebiets-


|
Seite 49 |




|
hoheit sollte sich also weiter erstrecken, als es für das grundherrliche Recht bezeugt wurde. - Ferner galt die Bemessung durch den Ritt nur für das innere Priwallufer, bis zur Fähre, nämlich für die Trave und auch wohl für die Pötenitzer Wiek, also für Binnengewässer. Wie wir in der Anlage I entwickelt haben, sprechen gewisse Anzeichen dafür, daß auch die Wismarer Bucht, ebenso wie die Bodden Rügens, als Binnengewässer angesehen wurde. Nun sagte einer der drei Wismarer Zeugen von 1597, der Brauer Tabbert, ausdrücklich, daß die von ihm angegebene Strandbemessung auch für den Adel gelte (oben S. 37); und er hatte dabei doch wohl die Verhältnisse in der Bucht im Auge, auf die es in dem Prozesse ankam. Wenn ferner der Wismarer Rat 1678 einem an der Buchtküste angesessenen Gutsherrn schrieb, daß "den Angrenzenden, so weit mit einem Pferde zu reiten, auch gewissermaßen etwas kompetieren könnte" (Rörig II, S. 223), so waren ja überhaupt nur grundherrliche Rechte gemeint.
Nachrichten über grundherrliche Strandberechtigungen sind für Mecklenburg aus älterer Zeit sehr selten. Techen hat diese wenigen Quellen zusammengestellt 78 ). Ohne im einzelnen darauf einzugehen, wollen wir bemerken, daß es ein grundherrliches Berge- recht ohne besondere Privilegien und bloß kraft Uferbesitzes an der mecklenburgischen Küste nicht gegeben haben kann, auch nicht in der Wismarer Bucht. Wieweit etwa grundherrliche Strand nutzungen in Frage kommen, ist für das Mittelalter kaum noch aufzuklären. In neuerer Zeit sind solche Nutzungen ausgeübt 79 ), aber Übergriffe der anliegenden Gutsherrn in die


|
Seite 50 |




|
landesfürstliche Strandhoheit stets zurückgewiesen worden 80 ). Möglich wäre es zwar, daß die grundherrlichen Strandgrenzen, wie sie in der Aussage des Brauers Tabbert von 1597 oder des Wismarer Rates von 1678 erscheinen, als bloße Nutzungsgrenzen aufzufassen sind. Dann könnten sie aber nicht an der offenen Küste gegolten haben, weil hier in der Zwischenzeit eine Anliegerfischerei, wie der Streitfall mit Lübeck von 1616 lehrt, viel weiter seewärts betrieben wurde, und zwar unter Duldung des Landesherrn. Und weil 1773 auch in der Wismarer Bucht schon seit langer Zeit von ritterschaftlichen Gütern aus gefischt wurde, ohne daß eine Abgabe an die landesherrliche Kasse gezahlt wäre 81 ), so müßten solche Nutzungsgrenzen bald ihre Bedeutung verloren oder überhaupt nur der Form nach bestanden haben. Wahrscheinlicher ist es, daß in Mecklenburg etwas Ähnliches erstrebt wurde wie in Rügen, wo sich am Binnenstrande die Axtwurfweite durchsetzte, innerhalb deren dem anliegenden Grundherrn das volle Strandrecht zustand, während am Außenstrande die Drei-Seewogen-Weite vergebens gefordert wurde 82 ). Auch in Mecklenburg könnte man sich dabei auf Maßbestimmungen des alten deutschen Rechtes besonnen haben, wahrscheinlich nur am Binnenstrande, worauf die erwähnte Dassower Zeugenaussage von 1570 hindeutet. Faktisch hat es allerdings ein solches grundherrliches Recht auch am Binnenstrande des Meeres in Mecklenburg kaum je gegeben. Zum mindesten könnte das Bergerecht nicht einbegriffen gewesen sein. Eben der Gutsherrschaft zu Zierow und Eggerstorf, an die jenes Schreiben des Wismarer Rates von 1678 gerichtet war, ist 1734 und 1744 Eigentum und Jurisdiktion am Eggerstorfer Strande vom Amte Grevesmühlen energisch bestritten worden, und die Akten hierüber ergeben, daß auch schon vor Jahrzehnten die herzoglichen Beamten das Strandrecht bei Eggerstorf oder sonst am Strande von Gütern desselben Grundherrn voll ausgeübt hatten 83 ).
Auffällig ist es jedenfalls, daß sich die Zeugenaussagen über Strandbemessungen in ihren verschiedenen Spielarten in der Gegend der Wismarer Bucht so häufen. Von hier stammt wohl letzten Endes auch die ganz vereinzelte Harkenseer Angabe von 1616, zumal da die Fischer aus Harkensee und den umliegenden Dörfern leicht mit Wismarer Fischern zusammentreffen konnten.


|
Seite 51 |




|
Vom Standpunkte Wismars aus ist ja die Bucht rechtlich sicher nichts anderes gewesen als ein Binnengewässer, weil die Stadt sich hier den Strom, das tiefe Wasser, zuschrieb. Da kam es denn freilich darauf an, die Anliegerberechtigungen zu bestimmen und möglichst zurückzudrängen. Wenn man die aus Wismar herrührenden Aussagen vergleicht, so läßt sich auf die Neigung schließen, immer weniger zuzugestehen, ohne daß man damit durchgedrungen wäre. Zwar hat der Wismarer Rat selbst, soweit wir sehen, sich dem Landesherrn gegenüber nicht auf eine durch Ritt und Wurf zu bestimmende Strandgrenze berufen, aber doch den allgemeinen Wunsch der Seestädte geteilt, das Strandrecht einzuengen. Darauf läßt schon seine Behauptung schließen, daß ein Schiff nur strande, wenn es zerschelle. Und daß einfache Zeugen den landesherrlichen Strand mit einem angeblichen grundherrlichen, von dem sie irgendwo gehört hatten, verwechselten, wäre leicht erklärlich. Gerade in Wismar möchte sich das Gerede von derlei Strandbemessungen am längsten erhalten haben und von dort aus die Überlieferung in den Anliegerdörfern der Bucht wie Tarnewitz immer wieder befruchtet sein.
Am hervorstechendsten ist wohl auf den ersten Blick die von Techen mitgeteilte Angabe des Beckerwitzer Strandvogtes von 1669. Sie findet sich in einem Wismarer Notariatsprotokoll, wonach eine finnische Schute in der Eggerstorfer Wiek sich mit dem Heck im Sande festgefahren hatte. Auf Anordnung des Amtes Grevesmühlen wurde, nach einer Art von Gefecht mit dem finnischen Schiffer, ein Teil der Ladung gelöscht, worauf das Fahrzeug loskam und absegelte. Der Schiffer beschwerte sich in Wismar, und der schwedische Lizentinspektor ließ die Sache durch eine Kommission untersuchen, die sich an Ort und Stelle begab und mit dem mecklenburgischen Strandvogt in Beckerwitz verhandelte. Dabei erklärte dieser: "Ob gleich wahr, das der Schiffer an seiner Schute keinen Schaden gelitten, sich auch selbst wieder loß geholfen und der Pauern Hülfe nicht begehret, so wehre doch der alte Gebrauch, wan ein Schiff fest zu stehen kehme, das die Obrigkeit, an deren Gegend das Schiff lege und so weit sie mit dem Pferde hinan reiten und mit einem Schießeißen werfen konten, daß fest stehende Schiff und Guht zukehme" 84 ). Wir haben hier die Angabe des Protokolls vor uns, das im allgemeinen richtig sein wird, aber die Äußerung in der Redaktion des Notars zusammenfaßt und sie sicher nicht dem


|
Seite 52 |




|
genauen Wortlaute nach wiedergibt. Offenbar liegen die Dinge so, daß der Strandvogt, dem die sechsköpfige Kommission samt dem finnischen Schiffer ins Haus kam, um ihm Vorwürfe zu machen, sich in seiner Not einmal auf das berufen hat, was die Wismarer sonst immer selbst behauptet hatten. Es wäre das begreiflich genug, zumal da dieser an sich geringfügige Strandungsfall zu so erregten Konflikten geführt hatte, daß der Landreiter auf den sich mit einer Latte wehrenden Schiffer schoß und auch der Amtsschreiber "erhitzet" wurde. Denn der Strandvogt wußte natürlich, wie schwierig die Ausübung des Strandrechtes an der Buchtküste für das Amt Grevesmühlen geworden war, seit Wismar zu Schweden gehörte und in allen solchen Fällen an der schwedischen Verwaltung einen Rückhalt hatte. Diese pflegte sich auf den Artikel X des Osnabrücker Friedensvertrages zu berufen, wonach der Hafen cum terris utriusque lateris ab urbe in mare Balthicum abgetreten war. Zwar sind die Buchtküsten außer den kurzen Strecken des Wismarer Gebietes nie schwedisch gewesen, auch wollte man in Mecklenburg keineswegs das ganze Buchtgewässer zugestehen, aber die Fassung des Artikels gab der schwedischen Verwaltung eine Handhabe, das mecklenburgische Strandrecht in Frage zu stellen. Dies geschah auch im vorliegenden Falle von 1669, und die herzogliche Regierung verfuhr dem mächtigen Nachbar gegenüber sehr vorsichtig, indem sie den Grevesmühlener Hauptmann zwar wegen seiner "Vigilantz" belobte, ihn aber zugleich wissen ließ, daß Streitigkeiten mit dem schwedischen Tribunal in Wismar zu vermeiden seien. Auch später ist man solchen Streitigkeiten, mit einigen Ausnahmen, gerne ausgewichen.
Daß man sich bei der Schiffsbergung nicht nach dem angeblichen alten Gebrauch richtete, den der Beckerwitzer Strandvogt erwähnte, zeigen die in der Anlage III, Nr. 1-3, mitgeteilten Strandungsfälle von 1662, 1665 und 1688, also aus derselben Zeit. Bemessungen durch Ritt und Wurf haben mit dem landesherrlichen Strande nichts zu tun. Sondern dieser reichte bis zum tiefen Wasser, dem Strom. Zeugnisse hierfür haben wir bereits in den vorstehenden Untersuchungen gebracht. Ehe wir weitere hinzufügen, müssen wir uns mit den Auseinandersetzungen Rörigs (II, S. 228, 310 u. Anm. 60) über vermeintliche Rechte der Städte am landesherrischen Strande in Mecklenburg beschäftigen.
Es sind dabei zunächst dreierlei Quellen, aus denen Rörig seine Schlüsse zieht:
- Die 1597 in dem Strandrechtsprozesse mit Wismar gemachte


|
Seite 53 |




|
Aussage des Wismarer Schiffers Claus Schönefeldt, die wir in unserem Bericht von 1923 angeführt haben. Er erklärte auf die Frage, ob nicht das Amt Grevesmühlen mit der daran rührenden offenbaren See, auch Ufer und Strand, dem Herzoge gehöre: Das Amt liege im Lande zu Mecklenburg, "soviel aber den Seestrohem und offenbare See belangte", habe sein alter Vater von anderen alten Leuten gehört 85 ), "daß die Lübischen den Seestrohem biß an Clüßhövede gebraucht und die Wißmarischen weiters von Clüßhövede biß zur Wißmar den Seestrohem gehabt hetten, aber die Hertzogen zu Meckelnburgk gebrauchten sich itzo des Strandts . ."
- Die in demselben Prozesse gemachten Aussagen verschiedener Wismarer Zeugen, wonach diese davon gehört hatten, daß Wismar vormals die Strandgerechtigkeit von der Steinbecker Mühle (oder lüttken Clüßhövede) an bis zur Doberaner Wiek (Kägsdorfer Haken, Brunshaupten) gehabt und zwei Strandvögte gehalten habe. Techen hat diese Aussagen erwähnt 86 ), und
- ein Zeugnis des Wismarer Ratmannes Jürgen Grotekurd von 1558 hinzugefügt, daß dessen Vater erzählt habe, es seien noch zu seinen Zeiten bei der Steinbecker Mühle und halbwegs zwischen Wismar und Rostock Pfähle eingestoßen gewesen, um die Scheiden zwischen Lübeck und Wismar und Wismar und Rostock zu bezeichnen.
Über die angebliche Wismarer Strandgerechtigkeit hat Techen ein Non liquet ausgesprochen; wahrscheinlich sei so weit Seepolizei geübt worden. Rörig geht weiter. Er meint, nach diesen Quellen müßten "die Städte bis tief ins 16. Jahrhundert hinein weitgehende Funktionen nicht nur auf dem gesamten ÂSeestrohm', sondern sogar am Strande selbst vor der ganzen mecklenburgischen Küste vorgenommen haben. Höchst wahrscheinlich bestand um 1500 eine die ganze mecklenburgische Küste umfassende Vereinbarung zwischen den Seestädten Lübeck, Wismar und Rostock, welche die gesamte Küste in Abschnitte für Nutzungs- und Aufsichtsrechte nicht mehr näher festzustellenden Umfangs zu Händen der einzelnen


|
Seite 54 |




|
Städte aufteilte" 87 ). Also nicht nur die Nutzung des mecklenburgischen Strandes hätten die Städte gehabt, sondern dort sogar die Aufsicht, die Kontrolle (Rörig S. 310) geführt, als ob die Landesherren und deren Strandhoheit gar nicht vorhanden gewesen wären oder von den mächtigen Städten als etwas ganz Nebensächliches hätten beiseite geschoben werden können.
Wenn Rörig fortfährt, daß ein Zustand solcher Art für den nichts Überraschendes habe, der "das vollkommene wirtschaftliche und politische Übergewicht der Städte zur See während des ganzen Mittelalters gegenüber den noch ganz zurückgebliebenen Territorien dieser Zeit" kenne, so geben wir zwar das Übergewicht zur See zu, die Städte selbst lagen ja aber auf dem Lande, waren dort angreifbar, und auch der Strand ließ sich vom Lande aus beherrschen. So ganz "zurückgeblieben" waren die Territorien denn doch nicht. Der erste Versuch der wendischen Seestädte, gegen den landesherrlichen Stachel zu löcken, endete mit ihrer vollkommenen Niederlage und der Unterwerfung Wismars und Rostocks (1311/12). Lübeck, das diesem Kampfe fernbleiben mußte, hatte sich 1307, selber von den Nachbarstädten verlassen, vor Holstein und Mecklenburg unter dänischen Schutz geflüchtet. Dann ist in der Teilherrschaft Mecklenburg, zu der Wismar gehörte und mit der 1317 auch Rostock vereinigt wurde, die landesherrliche Gewalt fast das ganze 14. Jahrhundert hindurch so stark gewesen, daß die beiden Seestädte gar nicht dagegen aufkamen. Man müßte schon vor der nordischen und deutschen Politik des Fürsten Heinrich II. von Mecklenburg (1287-1329) und seines Sohnes Albrecht II. (gest. 1379), des ersten mecklenburgischen Herzogs, die Augen verschließen, wenn man hier von zurückgebliebenen Territorialgewalten reden wollte. Und als Albrecht II. gegen Ende seines Lebens im dänischen Thronstreite nach dem Tode des Königs Waldemar Atterdag darauf ausging, seinem Enkel die dänische Krone zu verschaffen, hat die gesamte Hanse mit Lübeck an der Spitze seinem Wirken, das sich mit den Interessen der Städte durchaus nicht vertrug, nahezu tatlos und wie gelähmt zusehen müssen 88 ). Im 15. Jahrhundert führte die zweite große Machtprobe zwischen Rostock und der Landesherrschaft in der Domfehde wiederum zu Rostocks schwerer Niederlage (1491), ein Kampf, dessen Ausgang gerade einer der bekanntesten hansischen Historiker mit den Worten gekennzeichnet hat: "Das Prinzip moderner Fürsten-


|
Seite 55 |




|
gewalt hatte obgesiegt, das Prinzip städtischer Selbständigkeit war erlegen" 89 ).
Sollten trotzdem die Städte eine Art von Herrschaft über den mecklenburgischen Strand ausgeübt haben, und zwar "bis tief ins 16. Jahrhundert hinein", also noch die Regierung des Herzogs Magnus II. († 1503) überdauernd, des Siegers in der Domfehde, eines der bedeutendsten Fürsten, die Mecklenburg gehabt hat, und erbitterten Gegners städtischer Vorrechte?
In seiner Anm. 60 (S. 258 f.) hat Rörig sich über die von ihm angenommenen städtischen Kompetenzen näher ausgesprochen. Indem er sich auf die Abhandlung Techens über das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste und einen weiteren Aufsatz desselben Verfassers über Marktzwang und Hafenrecht in Mecklenburg 90 ) beruft, kommt er zu dem Ergebnisse, daß "man die Kompetenzen der drei Seestädte innerhalb des der einzelnen zugewiesenen Küstenabschnittes für das 15 Jahrhundert in Unterdrückung angemaßten mecklenburgischen Strandrechtes, für das 15. und 16. in der Unterdrückung der Klipphäfen sowie Beaufsichtigung der Seefischereinutzungen zu erblicken haben" werde. Indessen hat Techen selbst viel vorsichtiger geurteilt und gar nicht behauptet, daß eine Beherrschung des fürstlichen Strandes durch die Städte - denn etwas anderes ist doch in Rörigs Auffassung nicht zu erblicken - bestanden habe. Eben mit Hilfe von Techens Arbeiten läßt sich das, was Rörig mit so großer Sicherheit verkündet, leicht auf seine tatsächliche Bedeutung zurückführen. Worum handelte es sich? Um Streitigkeiten, nicht um städtische Kontrollbefugnisse.
Gehen wir zunächst auf das Strandrecht ein. Die ganzen Aussagen von 1597 über eine Wismarer Strandgerechtigkeit von der Steinbecker Mühle bis Brunshaupten gehen zurück auf einen im 15. Jahrhundert gemachten Versuch, die Beachtung von Strandrechtsprivilegien und der vom Reiche erlassenen Verbote des Strandrechtes zu erzwingen, weil die Herzöge das Strandrecht wieder in schärferer Form als nutzbares Recht verwerten wollten. Dies mußte die Städte um so mehr erbittern, als früher ganz andere Anschauungen von mecklenburgischen Landesherren vertreten waren. Techen hat die von diesen erteilten Strandrechts-


|
Seite 56 |




|
privilegien zusammengestellt 91 ). Sie beginnen mit einer allgemein gehaltenen Abschaffung des Strandrechtes durch Heinrich Borwin I von 1220 und enden mit einem Privileg Albrechts II. für Lübeck von 1351. Selbstverständlich sind sie, ebenso wie die Verleihungen von Seefischereigerechtigkeit, die wir oben angeführt haben, ein Beweis für die landesherrliche Strandhoheit. Und wenn Heinrich Borwin III., Fürst von Rostock, 1252 den Rostockern nur sein Strandrecht im Hafen preisgab, so läßt diese Einschränkung erkennen, daß er nicht gemeint war, seinen Ansprüchen überall zu entsagen. Ein Aufsichtsrecht können die Städte damals jedenfalls nicht gehabt haben. 1377 beschlagnahmte der Grevesmühlener Vogt Strandgut an der Küste von Schwansee, die zu dem vermeintlichen Lübecker Kontrollbezirk gehört haben würde 92 ), tatsächlich aber wie eben dieser Fall zeigt, von dem landesherrlichen Vogt beaufsichtigt wurde. Und da es zwei Jahre währte, bis ein herzoglicher Befehl die Rückgabe des noch vorhandenen Gutes veranlaßte, so scheint sich eine schärfere Übung des Strandrechtes schon damals allmählich angebahnt zu haben.
Auch später treten durchaus die herzoglichen Beamten als die Machthaber am Strande hervor, z. B. 1420, als Lübeck sich über die Wegnahme von Strandgut in der Ribnitzer Wiek durch die Vögte beschwerte. Der Ton von Briefen, die in dieser Angelegenheit von der Stadt entsendet wurden, deutet darauf hin, daß man nicht allzu viel Vertrauen zu dem guten Willen der Herzöge hatte. Es war ein Fall von vielen, die sich in Mecklenburg und anderswo ereigneten. Strandraub hatte es immer gegeben, jetzt aber wurde die Beachtung der Strandrechtsfreiheit durch die Fürsten selbst und ihre Beamten in Frage gestellt. Deswegen hatten die wendischen Hansestädte schon im selben Jahre 1420 den gewagten Beschluß gefaßt, daß Seefund von der nächstgelegenen Stadt gewaltsam in Verwahrung genommen werden solle; ein Beweis dafür, daß ihnen bisher eine Kontrolle des Strandes nicht zugestanden hatte. Ob nach diesem Beschlusse gehandelt worden ist, steht dahin. 1482, als schon die Zwistigkeiten


|
Seite 57 |




|
Rostocks mit Herzog Magnus II., die hernach in der Domfehde ihren Austrag fanden, begonnen hatten, kam es zu einem Bündnisse zwischen den beiden mecklenburgischen Seestädten, das auch die Abwehr der Strandrechtsübung bezweckte. 1483 und 1484 ist von Verhandlungen mit den Herzögen wegen Rückgabe von Strandgut die Rede, was durchaus nicht aus eine Bergung durch die Städte schließen läßt. Als dann aber in einem besonders krassen Fall die Vögte von Bukow und Schwaan wertvolles Gut vom Strande weggeführt hatten, wurde 1485 auf einem Hansetage in Lübeck eine noch schärfere Vereinbarung als 1420 getroffen: Die Städte wollten die Bergung von Strandgut gegen Bergegeld selber vornehmen, und es sollte gegen die Landesherren und deren Vögte im Notfalle von der nächstgelegenen Stadt Gewalt gebraucht werden; gemeinsam wollte man tragen, was danach komme, gemeinsam auch für die Folgen des schwerstwiegenden Beschlusses einstehen, des Beschlusses nämlich, die Vögte von Bukow und Schwaan zu ergreifen und Gericht über sie zu halten. Es war ein Verzweiflungsschritt, und um diese Zeit wird auch Wismar seine beiden Strandvögte bestellt haben, von denen noch nach 112 Jahren Wismarer Zeugen als von etwas längst Entschwundenem berichteten; auch der 88jährige Claus Brun wußte davon nur durch seinen Vater und Großvater, und nicht ohne Komik ist seine Angabe, daß die Strandvögte "darumb abgeschaft sein solten, daß sie viel verzehret und bißweilen wol ganze Wochen außer der Statt in den Krüegen gelegen und viel verthan hetten". Beschäftigung hatten sie ja auch weiter nicht. Das Ganze war eine vorübergehende Episode, ja, nicht einmal das, sondern im wesentlichen kaum mehr als die Absicht und einige Anstalten, sich der Schiffsbergung zu bemächtigen, jedenfalls ein fehlgeschlagener Versuch 93 ); denn die Städte haben ihr Ziel nicht erreicht, bis eine


|
Seite 58 |




|
mildere Zeit ihren Wünschen von selbst entgegen kam. Erst viel später, als Wismar sich hinter der schwedischen Verwaltung verstecken konnte 94 ), taucht wieder ein Wismarer Strandvogt auf. Es müßte eine sonderbare Kompetenz gewesen sein, die die Städte im 15. Jahrhundert zur Unterdrückung des Strandrechtes an der mecklenburgischen Küste gehabt haben sollen, wo doch das ganze Material über Strandungsfälle aus dieser Zeit, auch nach 1485, voll ist von städtischen Klagen und Bitten um Auslieferung beschlagnahmten Gutes!
Rörig ist in seiner Anm. 60 auf diese Streitigkeiten kurz eingegangen, gibt aber von der Machtstellung der Städte ein einseitiges und verkehrtes Bild. Wenn er Techens Satz zitiert (S. 292):"Es ist jetzt Regel geworden, daß die herzoglichen Beamten das Strandrecht wahrnehmen wollen, sowie sie nur die Strandungsstelle als herzoglicher Gerichtsbarkeit unterstehend ansehen können", und hieraus schließt, daß der landesherrliche Anspruch erst seit dem 16. Jahrhundert allmählich durchgedrungen sei, so übersieht er, daß Techen dabei nur den Wismarer Hafen im Auge hatte, wo "die Grenzen dieser Gerichtsbarkeit nicht sicher fest gelegt" gewesen und daher öfter Streitigkeiten entstanden seien. Gerade das, was Techen aus dem 15. Jahrhundert bringt, zwingt ja zu dem Schlusse, daß dieselbe Regel schon längst an der mecklenburgischen Küste galt. Wenn Rörig ferner meint, daß die Aussage des Schiffers Schönefeldt von 1597, wonach die Herzöge "itzo" die Strandgerechtigkeit ausübten, so aufzufassen sei, daß dies erst neuerdings geschehe, so irrt er auch hierin; denn der Zeuge gab gerade an, daß nach Erzählungen seines von alten Leuten darüber unterrichteten Vaters Wismar "oldings" einen Strandvogt gehalten habe. Das "itzo" erklärt sich also einfach daraus, daß der Zeuge von einer vormaligen Strandgerechtigkeit der Stadt hatte reden hören. Ohne nähere Aktenkenntnis kann man diese Aussagen nicht so pressen.
Gemäß den ungeheuerlichen Beschlüssen der Städte von 1485 wich Rostock in der Tat nicht davor zurück, den Schwaaner Vogt Gert Drese aufheben und ihn und seinen Bedienten an gewöhnlicher Stelle, d. h. auf dem Richtplatze für Missetäter, als Strandräuber enthaupten zu lassen 95 ). Dies soll nach Rörig "am schlagendsten" beweisen, daß "um 1500 selbst die mecklenburgische Strandgerech-


|
Seite 59 |




|
tigkeit, soweit sie sich auf Ausübung des Strandrechts bezog, höchst problematisch" gewesen sei. Als problematisch aber kann man das Strandrecht nicht wegen der Enthauptung des Vogtes bezeichnen, sondern nur deswegen, weil es vom Reiche und durch päpstliche Erlasse untersagt war und weil die Städte sich auf alte Privilegien berufen konnten. Die verzweifelte Selbsthilfe gegen den Schwaaner Vogt, der keiner städtischen Gerichtsbarkeit unterstand, ist nichts weiter gewesen als ein mit dem Scheine des Rechtes vergebens umkleidetes Verbrechen, ein Mord, der samt den übrigen Unbotmäßigkeiten Rostocks den Landesherren gegenüber dadurch gesühnt wurde, daß Rat und Bürgerschaft den Herzögen Magnus und Balthasar am 11. Juni 1491, dem Tage ihres Einzuges nach siegreicher Beendigung der Domfehde, vor dem Stadttore fußfällig Abbitte leisten mußten 96 ). Das war eine der Bedingungen des Vergleichs, als dessen Mittler und Zeugen auch Lübecker und Wismarer Ratsmitglieder erscheinen, und es ist gar nicht zu verkennen, daß diese Niederlage Rostocks eine Niederlage für das Ansehen der Städte überhaupt gewesen ist.


|
Seite 60 |




|
Nicht anders als mit der vermeintlichen Unterdrückung des Strandrechtes durch die Städte verhält es sich mit dem von Rörig (Anm. 60) erwähnten Hafenzwang. Das "ganz Wenige", das er darüber bringt, gibt ebenfalls ein höchst schiefes Bild der tatsächlichen Verhältnisse 97 ). Überhaupt hat das Hafenrecht und der


|
Seite 61 |




|
damit in enger Verbindung stehende Marktzwang, d. h. das Verbot des sog. Vorkaufes unter Umgehung der üblichen Märkte, mit der Strandgerechtigkeit und dem Küstengewässer nichts zu tun. Und wenn Rörig gar annimmt, daß auch Lübeck im 15. und 16. Jahr-


|
Seite 62 |




|
hundert eine Kompetenz zur Unterdrückung mecklenburgischer Klipphäfen gehabt habe, so ist das doch wohl sehr unwahrscheinlich, weil ja aus den von Rörig angezogenen Aufsätzen Koppmanns und Techens gerade hervorgeht, daß die Lübecker sich das ganze 16. Jahrhundert hindurch und schon früher des Vorkaufes und der Klipphäfen in Mecklenburg, sehr zum Ärger Rostocks und Wismars, eifrig bedienten und von ihrem Rate darin verteidigt wurden 98 ).
Wegen dieser Haltung Lübecks kommen die 1558 und 1597 erwähnten Scheiden zwischen den drei Städten (Steinbecker Mühle, Brunshaupten) nicht als Grenzpunkte für Küstenabschnitte zur Bekämpfung der Klipphäfen in Betracht. Einer solchen Annahme widerstreitet auch, daß Rostock 1534 gegen Verschiffung von Korn in der Golwitz einschritt 99 ), die zu dem Wismarer Bezirk gehört haben würde. Andererseits hat Wismar 1581 und später Beschwerden an den Doberaner Hauptmann ergehen lassen 100 ), dessen Amtsküste in den Rostocker Abschnitt gefallen wäre. Wenn aber die Pfähle nicht Aufsichtsbezirke abtrennen sollten, hätten diese einsamen Zeichen am Strande für das ganze Hafenrecht keinen Zweck gehabt.
Es ist auch nicht richtig, daß die Steinbecker Mühle "als Westgrenze des Bereiches, in welchem Wismar über die Unterdrückung der Klipphäfen zu wachen hat, eine Rolle" spielte. Rörig konnte das allerdings nach einer Stelle bei Techen 101 ), auf die er sich beruft und die leicht mißverstanden werden kann, annehmen. In den Wismarer Bürgersprachen von 1435 und 1480 aber, auf die Techen


|
Seite 63 |




|
hier eingeht, kommt weder die Steinbecker Mühle noch irgendein anderer Grenzpunkt vor, sondern es wurde darin den Bürgern nur verboten, neue Häfen in der Umgegend der Stadt aufzusuchen 102 ). Im 19. Jahrhundert, nach seiner Rückkehr zu Mecklenburg, hat dann Wismar den Anspruch verfochten, daß es zwischen dem Klützer Orte und der Doberaner Höhe fremde Schiffahrt überhaupt nicht oder doch nur gegen Zahlung der städtischen Akzise zu dulden brauche 103 ). Unter der Doberaner Höhe ist wahrscheinlich die Bucher Hucke bei Kägsdorf zu verstehen, denn bald darauf nannte Wismar das noch etwas weiter buchteinwärts gelegene Gaarz und den Klützer Ort als die Grenzen, innerhalb deren zur Verschiffung bestimmte Waren mindestens in Wismar klariert werden müßten 104 ). Diese Grenzen stimmen etwa zu den 1558 und 1597 angegebenen; auch 1597 erscheint ja der Kägsdorfer Haken. Und sie möchten auch ungefähr das umfassen, was man in den Bürgersprachen von 1435 und 1480 mit der Umgegend der Stadt meinte. Aber einen zwischen den drei Seestädten vereinbarten Bezirk, der Wismar zur Unterdrückung der Klipphäfen zugewiesen sei, können sie aus den angeführten Gründen vormals nicht gebildet haben. Sondern sie ergeben sich aus der Betrachtung der Landkarte von selbst, weil sie die Endpunkte des großen Küsteneinschnittes bezeichnen, vor dem Wismar liegt, d. h. die Endpunkte der Wismarer Bucht im weitesten Sinne.
Die letzte Kompetenz am mecklenburgischen Strande, die Rörig den Städten zuerkennen möchte, die Beaufsichtigung der Seefischerei, ist eine bloße Annahme, für die Gründe überhaupt nicht zu entdecken sind. Rörig stützt sich dabei auf die Nachricht von den drei Küstenabschnitten und auf die Aussage des Wismarer Schiffers Schönefeldt von 1597 (oben S. 53), der sich eine Aussage des Lübecker Prokurators Johann Pretreius von 1615 oder 1616 anreiht, wonach die Lübecker den Fischfang bis zum Klützer Orte und weiter betrieben 105 ). Dazu kommen spätere Angaben über eine Lübecker Fischerei an der mecklenburgischen Küste östlich von der Harkenbeck (1783 bis 1890) 106 ). Für eine Fischerei aufsicht aber vermissen wir jeden Nachweis.


|
Seite 64 |




|
Auf die Aussage des Schiffers Schönefeldt von 1597 legt Rörig großen Wert und folgert daraus eine Lübecker Funktion sogar auf dem "Seestrom", worunter er freilich wohl das Gewässer bis an den trockenen Strand versteht. Was hat es mit dieser Aussage auf sich? Der Zeuge war gefragt worden, ob nicht das Amt Grevesmühlen mit der daran rührenden offenbaren See, auch mit Ufer und Strand, in Mecklenburg liege. Mit "See" kann hier nur der überflutete Strand, mit "Strand" nur der Strand in seiner ganzen Ausdehnung gemeint sein. Der Zeuge hörte beide Wörter vorlesen und machte offenbar zwischen See und Strand einen Unterschied, der dem Sinne der Frage gar nicht entsprach. Da gab er denn an, was sein Vater von anderen alten Leuten gehört und ihm erzählt hatte, daß nämlich die Lübischen den "Seestrom" bis Klützer Höved gebraucht hätten, die Wismarer von da bis zu ihrer Stadt. Aber die Herzöge "gebrauchten sich itzo des Strands" 107 ). Daß Rörig das "itzo" zu genau genommen hat, haben wir bereits dargelegt. Der Seestrom aber an der offenen Küste bis Klützer Höved war "gemeines" Meer, wo niemand etwas zu sagen hatte. Diesen Seestrom, den er unter "See" verstand, stellte der Zeuge dem Strande gegenüber. Und da er nach dem Eigentums- und Besitzrecht über das Amt Grevesmühlen nebst See und Strand und aller Gerechtigkeit gefragt war, so wird er angenommen haben, daß der Strom bis Klützer Höved vormals den Lübeckern gehörte, was natürlich nie der Fall gewesen ist. Der Irrtum des Zeugen aber geht, wie wir schon in unserem vorigen Bericht gesagt haben, zurück auf eine Verwechselung von Nutzung und Gebietsrecht. Denn was soll mit dem Gebrauch des Seestromes bis Klützer Höved hier weiter gemeint sein als die Fischerei! Solche Verwechselungen durch einfache Leute, denen jede feinere Kenntnis der Rechtsbegriffe abging, sind doch wahrhaftig möglich und einleuchtend. Wenn man sich die Mühe machen wollte, so könnte man aus Vernehmungsprotokollen gewiß viele Beispiele feststellen. Wir wollen hier nur eines geben, das gut paßt: Auf die Frage, unter welchem Schein Wismar seinen Hafen bis Tarnewitz rechne, antwortete


|
Seite 65 |




|
1597 der Wismarer Fischer Asmus Holste: "Er wiße es nicht, sonsten hetten sie, die Vischer, ihre Vischzüge umb der Boltenhager Wyck, Tarnewitz und daherumb bilangher in allen Wycken, biß gen Redewisch und Clüßhovede". Nun hat aber Wismar nie behauptet, daß die Boltenhäger Wiek zu seinem Hafen gehöre.
An sich wäre es natürlich denkbar, daß die drei Seestädte sich über die Abgrenzung von Fischereigebieten geeinigt hatten, damit ihre Fischer sich nicht in die Quere kämen. Das wären reine Nutzungsgrenzen gewesen, wie Rörig sie ja, neben den Aufsichtsgrenzen, annimmt. Aber stimmen kann auch das höchstens für viel kürzere Zeit, als Rörig glaubt. Möglich, daß Klützer Höved einmal eine Fischereigrenze gegen Lübeck gewesen ist; um 1600 war es sicher nicht mehr der Fall 108 ), und man möchte eher vermuten, daß es sich um eine Gewohnheitsgrenze, nicht um eine wirklich vereinbarte gehandelt habe. Auch kommt nur das kleine Klützer Höved in Betracht, das weiter westlich liegt als das große; denn einmal wird Lütken Clüßhöved 1597 ausdrücklich neben der Steinbecker Mühle als Scheidepunkt genannt, und des weiteren fischten die Rostocker Fischer um 1394 bei beiden Höveden 109 ). Daraus ergibt sich zugleich, daß zwischen Rostock und Wismar 1394 solche Fischereigrenzen überhaupt nicht bestanden.
Drei Aufsichtsbezirke gab es nicht. Und wenn die sagenhaften, 1558 längst verschwundenen Scheidepfähle Nutzungsbezirke abgetrennt haben sollten, so hätte dies nur im Einverständnisse mit der Landesherrschaft geschehen können, auf deren Grund und Boden die Pfähle errichtet waren. Ferner könnten diese Bezirke nur nach 1394 und langevor 1558 bestanden haben. Bildeten aber die Pfähle keine Fischereischeiden, so bleibt nur übrig anzunehmen, daß sie 1485 eingestoßen wurden, als die Städte einen Anlauf nahmen,


|
Seite 66 |




|
den Herzögen das Bergerecht zu entwinden. Und wer anders sollte die Pfähle dann wieder entfernt haben, wenn nicht die herzoglichen Beamten!
*
Nach dieser längeren Abschweifung, die nötig war, um die von Rörig in den vormaligen Rechtsverhältnissen am mecklenburgischen Strande angerichtete Verwirrung zu beseitigen, wollen wir die Untersuchung über die Ausdehnung des Küstengewässers wieder aufnehmen.
Kehren wir noch einmal zu dem rügischen Landrecht des Matthaeus Normann zurück. Da heißt es in Titel 11 (S. 11) der erweiterten Fassung:
"Äverst allen Bröke, de dar geschüth up den Water, up den Strömen edder ock Undade, so vele man des konde uthrichten, dat up den Strömen und an dat Landt (ad differentiam des wilden Meeres und Stromes, denn dat hielten de Olden commune, up den binnen Stranden, dar men des Stromes unwiß, hört F. G. (Fürstl. Gnaden) de Düpe wente (bis) ein Exenworpe vom Lande int Water; dat na Lande richtet de, dem de Vorstrandt höret, hoc probatum inter Willeken von Platen undt Gödtke von der Osten) 110 ) schehen, straffet und richtet allein F. G."
Diese Stelle bedarf der Interpretation. Der ganze Titel 11 ist eine Erweiterung des Kap. 5 der ersten Fassung, wie sich schon aus den im Einklange stehenden Überschriften beider ergibt. Und beide handeln von landesherrlichen Gerechtsamen hauptsächlich am Außenstrande. Die neuere Fassung hat dann im folgenden Titel (Nr. 12) den Binnenstrand samt landesherrlichen und grundherrlichen Rechten daran noch besonders behandelt. Fast unmittelbar vor der von uns zitierten Stelle in Titel 11 steht der Satz: "Allen Brocke und Undadt, so up angetogenden Stranden, upm Lande und Water, von den Fischern edder sonst geschüth, dat straffen und richten F. G. Amptlüde (und die dar, immaten wie vor, befreyet sein von F. G.)", was bis auf die von uns eingeklammerten Worte, die sich auf besondere Privilegien der Putbus, Jasmund usw. beziehen, wörtlich aus dem ersten Text übernommen ist. Weil es aber außer der Jurisdiktion über Binnenstrand und Außen-


|
Seite 67 |




|
strand noch eine landesherrliche Stromgerichtsbarkeit auf den Binnenströmen gab, fügte der Verfasser die ganze oben zitierte Stelle hinzu und hob in der Parenthese den Unterschied zwischen Außenstrom und Binnenstrom hervor. Wo man am Binnenstrande des Stromes ungewiß war, d. h. wo es flachen Binnenstrand gab 111 ) und sich die Grenze zwischen Strom und Strand schwer aufzeigen ließ, gehörte dem Landesherrn "de Düpe", das Tief, also die ganze Wasserfläche bis zu der vom Lande aus zu rechnenden grundherrlichen Axtwurfgrenze. Diese Grenze des Grundherrn kann sich natürlich nur in den seltensten Fällen mit dem Beginn des Tiefs zufällig gedeckt haben. Es gehörte denn auch der vor dem grundherrlichen Anteil liegende landesherrliche Strand, genau genommen, noch nicht zur "Düpe" und wird hier von Normann nur der Einfachheit halber dazu gerechnet. Wir werden diesem niederdeutschen Ausdruck "Düpe" in seiner eigentlichen, an dieser Stelle des Landrechtes etwas verwischten Bedeutung gleich noch einmal in Mecklenburg begegnen.
Wie wir gesehen haben (Anm. 31), meint das Landrecht mit "Strom" immer das tiefe Wasser. Wenn also in der angeführten Parenthese der Strom des Außenstrandes als "gemein" bezeichnet wird, so galt das eben nur für die tiefe, schiffbare See. Bis zu ihr reichte der Strand. Binnenstrand und Außenstrand hatten dieselbe Ausdehnung, die am Binnenstrande freilich für den Landesherren praktisch nicht von Bedeutung war, weil ihm die Binnenströme auch gehörten. Zu diesem Ergebnisse paßt ja auch alles, was wir oben über den Außenstrand festgestellt haben.
Genau so wie an der rügischen Küste lagen die Rechtsverhältnisse auch an der mecklenburgischen. Noch im 18. Jahrhundert! 1734 pfändete der Landrat von Negendanck auf Zierow und Eggerstorf an der Wismarer Bucht einem Bauern sein Pferd, weil er "binnen meiner Gräntze, von meinem an und biß in dem tiefen Waßer hinein liegenden Eggersdorfischen Lande und Sande, und also von meinem Eigenthumb" Seetang abgefahren habe. Die herzoglichen Beamten in Grevesmühlen aber machten das landesherrliche "Strand-Regale"geltend; es sei "dergleichen Anmaßen aufm Strande niemahlen von denen Adelichen unternommen, noch viel weniger aber der Strand so gar nichtig gemachet worden ist, als nun geschehen soll, da der Herr Land-Rath von Negendanck in seinem Briefe dasjenige, was bishero ohne einige Contradiction der wahre Strand gewesen ist, von seinem Lande und Sande


|
Seite 68 |




|
an bis ins tiefe Waßer hinein, zu seiner Gräntze und Eigenthum rechnen will 112 ).
Zehn Jahre später hat der Landrat von Negendanck nur noch den bei niedrigem Wasser trockenen Strand in Anspruch genommen. Der Graf Bothmer dagegen schrieb sich ein Recht auf den für gewöhnlich, also bei mittlerem Wasserstande, trockenen Strand zu.
Er war 1756 mit dem Amte Grevesmühlen wegen der Jurisdiktion am Strande seines an der offenen Küste gelegenen Gutes Elmenhorst in Streit geraten, weil das Amt das vormals sogenannte Fahrrecht über eine dort gefundene Leiche ausgeübt hatte. Es kam deswegen 1757 zu einem Prozesse zwischen dem Regierungsfiskal und dem Grafen 113 ). Dessen Anwalt behauptete, daß das Strandrecht nur bis an die Linie des gewöhnlichen Gestades gehe; er wollte überhaupt nur einen beflossenen Strand zugestehen. Dabei berief er sich auf ein Notariatsprotokoll über den Leichenfund und über eine Besichtigung des Elmenhorster Strandes, das der Graf Bothmer hatte aufnehmen lassen. Bei dieser Besichtigung waren zugezogen worden ein Hausmann aus Rankendorf, der früher Seefischer in dem lübeckischen, an Elmenhorst grenzenden Dorfe Warnkenhagen gewesen war, und ein Hufner aus Redewisch an der Boltenhäger Bucht, der "von Jugend an auf dem Strande (bey der Fischerey) Umgang gehabt" habe, beides Leute, die der gräflichen Jurisdiktion nicht unterstanden. Sie erklärten, daß zur Zeit halbe Fluthöhe sei, und schätzten "die Breite des jetzo befloßenen Strandes auf fünfzig Ruthen ohngefehr zu seyn, wo die Schiffe erst an- und Gefahr laufen können, indem sie näher nicht heraufzubringen wären". Bei gewöhnlicher Fluthöhe reiche der trockene Strand noch etwas weiter seewärts, "wo erst eigentlich der Strand sich anfange und dann noch auf vierzig bis fünfzig Ruthen breit sey, ehe sich das Ufer der See oder, nach hiesiger Leute Mund-Art, das Räve oder die Düpe und Hölung anhebe, oder das fahrbare Gewässer der See an der Küste des mecklenburgischen Landes hinstreiche". Bei den Akten liegen zwei Exemplare einer Zeichnung der Elmenhorster Küste, die der Bothmersche Anwalt eingereicht hatte. Darauf wird eine breite, vom Meere überspülte Fläche als "der Strand" bezeichnet, bis zu einer Linie seewärts, die als "das Räve, die Hölung oder die Düpe, wo das Fahr-Waßer zuerst beginnet", kenntlich gemacht ist.


|
Seite 69 |




|
Nun war allerdings eine so scharfe Trennung zwischen trockenem und überspültem Strande, wie sie der Anwalt des Grafen Bothmer vertrat, nicht haltbar. Der Regierungsfiskal hatte ganz recht, wenn er in seiner Erwiderung sagte: "Es ist zwar nicht zu leugnen, daß auch der Sand, welchen das Gewäßer der See bespühlet und befließet, noch mit zum Strande gerechnet werde; es ist aber auch ebenso unstreitig, daß der neben dem Meer liegende Sand gleichfalls dahin gehöre, und alsdann nennet man zum Unterschied jenen den befloßenen, diesen aber den trockenen Strand." Ferner erklärte er: "Soweit nun das Strand-Recht gehet, soweit kann auch die darinnen begriffene jurisdictio littoralis tam civilis quam criminalis exerciret werden."
Nach den erwähnten Angaben reichte der überspülte Strand bis zum "Räve" an der Elmenhorster Küste 40-50 Ruten (183 bis 229 m) weit. Mißt man eine solche Strecke auf der Seekarte ab, so kommt man auf eine Wassertiefe von etwa 4 Metern. Am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Bucht ist die Entfernung bis zur 4 m-Wassergrenze größtenteils über doppelt so groß, weil der Strand dort flacher ist.
Der 1757 erscheinende Ausdruck "Räve" (rêver, fließendes Wasser) bedeutet dasselbe wie "Strom"; "Düpe" ist = Tief. Begriff und Ausdehnung des Strandes waren sich noch im 18. Jahrhundert völlig gleich geblieben. Was 1757 als Strand bezeichnet wurde, stimmt genau mit dem überein, was die 7 Zeugen von 1597 und die 11 Zeugen von 1616 bekundeten. Es ist die "anrührende" See der Beweisartikel, die in dem Strandrechtsstreit zwischen Wismar und dem Amte Grevesmühlen aufgestellt wurden, es ist auch der Strand des rügischen Landrechts und ohne Zweifel schon der Strand, das mare dominio terrae adiacens des Mittelalters, eben das, was wir Küstengewässer genannt haben. Die mecklenburgischen Kommissare in dem Fischereistreit mit Lübeck von 1616 waren völlig im Recht mit ihrer Erklärung, daß die herzogliche Strandgerechtigkeit am Ufer der Travemünder Bucht so weit reiche, als "die Schiffe und die rechte Tiefe des Mehres gehet" oder "so weit die Schiffe im Meer ihren Lauf und Gang halten". Wie sollte sich denn auch der schon im 13. Jahrhundert erscheinende Ausdruck "Vorstrand" (Anl. II, Nr. 1), den man heute noch auf den trockenen Strand anwendet, deuten lassen, wenn es nicht noch einen überfluteten Strand gegeben hätte!


|
Seite 70 |




|
Daß dieser bespülte Strand, das Küstengewässer früherer Zeiten, zur Küste gehörte, versteht sich von selbst und geht ja auch aus unseren bisherigen Ausführungen hinreichend hervor. Gebietshoheit über die Küste ist Voraussetzung für das Hoheitsrecht am Küstengewässer.
Nun ist allerdings die schiffbare Meerestiefe ein relativer Begriff 114 ). Aber überall dort, wo Schiffe aus dem tiefen Wasser, wo sie schwimmen konnten, herausgeworfen wurden und an der Küste strandeten, war "Grund und Boden" des Küstenherrn. So wird der Strand oft bezeichnet. Auch in Holstein; denn wenn der Cismarer Amtmann 1577 die Lübecker "auf seines Ambtes Gepitte" keine Seefischerei treiben lassen wollte, weil sie dazu "in eines Fürsten Jurisdiktion oder Grundt und Boden" nicht berechtigt seien (Rörig I, S. 8), so meinte er eben den Strand. Wismar hat sogar das Tief der Wismarer Bucht für seinen "Grund und Boden" ausgegeben 115 ).
Wahrscheinlich hat sich das Recht am Küstengewässer, wie wir es zuerst für das 13. Jahrhundert feststellen konnten, aus dem uralten Strandrecht im engeren Sinne, dem Rechte auf gescheiterte Schiffe und angetriebene Güter, entwickelt. Es ist jedenfalls nicht zu bezweifeln, daß die Ausdehnung dessen, was man Strand nannte, damit zusammenhängt 116 ).
Daß die Fischerei im Küstengewässer in mittelalterlicher Zeit ein landesherrliches Regal gewesen ist, haben wir für einen beträchtlichen Teil der Ostseeküste bereits oben (Abschnitt A) nachgewiesen. Ebenso, daß es am rügischen Außenstrande auch noch in neuerer Zeit der Fall war. Dieses Regal ist vormals durch Erhebung von Abgaben wahrgenommen worden (oben S. 26 ff.), was jedoch in Mecklenburg hernach, vielleicht schon im Mittelalter, nicht mehr überall geschah.


|
Seite 71 |




|
Ein alter Warnemünder Seefischer, Peter Kroße, der seit mehr als fünfzig Jahren sein Gewerbe ausübte, sagte bei einem Zeugenverhör am 11. November 1618 aus, daß die Warnemünder auf Wittow (Rügen) ebenso wie in Dänemark der Obrigkeit von jedem Ruder ein Wall (80 Stück) Hering gegeben hätten 117 ). An der mecklenburgischen Küste dagegen sei der Fang, so lange er denken könne, frei gewesen; dies versicherten auch sieben andere Fischer aus Warnemünde, die gleichzeitig vernommen wurden. Und zwar war die ganze mecklenburgische Küste gemeint; die Frage des Protokolls, auf die diese Antworten erteilt wurden, betrifft die Warnemünder Fischerei "in der offenbaren Sehe zischen dem Daße (Dars) und der Trave" 118 ).
Nun sind allerdings um dieselbe Zeit und später am Fischländer Strande, den man von der Scheide des Rostocker Stadtgebietes bis zur pommerschen Grenze, also bis zum Dars rechnete, Abgaben erhoben worden 119 ), aber nur von den Dorffischern, die dort für gewöhnlich Wadenfischerei betrieben oder Reusen hielten. Daß in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Reusenfischerei hier offenbar besonders genau kontrolliert wurde, mag sich durch die Ergiebigkeit erklären, die den Heringsfang am Fischländer Strande damals auszeichnete; wurden doch vom 3. März bis zum 6. Juni 1669 39 262 Wall gefangen, in der Zeit vom 18. Februar bis zum 10. Juni 1671 34 528 Wall 120 ).
Ob die Rostocker um 1600 häufig diesen Teil des Strandes aufsuchten, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist - nach jenen Zeugenaussagen von 1618 - ihre Fischerei an der ganzen Küste Mecklenburgs freigelassen worden.
Das Zeugenprotokoll vom 11. November 1618 hängt mit einem Streite zusammen, der sich über zwei Jahre hinzog und den wir in unserem vorigen Bericht erwähnt haben. 1618 nämlich hatten die zum Amte Bukow gehörenden Gaarzer Bauern drei Warnemünder Fischer "aus der offenbaren Sehe" ans Land geholt und ihnen ihr Boot und Fischergerät weggenommen. Warum, ergibt sich aus der Aussage des schon genannten Peter Kroße, es sei ihm in der Gegend von Brunshaupten und Gaarz "niemals


|
Seite 72 |




|
etwas Boses gesagt, sondern ihm alle guth gethan, und noch anitzo, wan er da keme, würden sie ihme alle guth thun; er, Zeuge, aber hette vermerkt, das etzliche leichtfertige Gesellen, so Warnemunder, alda den Leuten an Netzen und sonsten Schaden gethan, dahero diese Ungelegenheit den Warnemundern verursacht . . ." Hierzu stimmt die Aussage eines anderen Warnemünder Fischers:"Gott solle es denen vergeben, die Ursach dazu gegeben, das den Warnemundern ihre Nahrung der Orter nach Brunßhoveden wolle genommen werden . . ." Das Protokoll fügt dem hinzu: "Wie Zeug gefragt, wer solchs gethan, hat er, ungeacht ich (der vernehmende Rostocker Gewettsekretär) in ihne getrungen, dieselben nambkundig zu machen, dennoch nichts anders darauf bekennen wollen, den das er solchs nicht wiße, wurde sich aber in kurtzen wol geben."
Noch zwei Jahre später (15. Dezember 1620), als einige Warnemünder Fischer vor Alt-Gaarz ihre Netze ausgeworfen hatten und dann mit ihren beiden Booten oder Jollen ans Land gefahren waren, trat ihnen der Dorfschulze mit einer Anzahl Leuten entgegen und erklärte, vom Amtshauptmann strikten Befehl zu haben, den Warnemünder Fischern, wenn sie bei Alt-Gaarz oder sonst auf fürstlichem Gebiete ans Land kämen, Boote und Gerätschaften zu beschlagnahmen; was auch geschah 121 ).
Nun nahm sich Rostock der Fischer an. Unter den Gravamina, die die Stadt auf einem Landtage im Februar 1621 überreichte, findet sich eine Beschwerde, wonach "unsere arme Fischer zu Warnemunde und deren Vorfahren der Fischerei nach Heringk, Dorsch, Tobias und andere Fische im offenen gemeinen Mehr von Warnemunde an biß naher Lubeck, auch weiter an der andern Seiten nach Pommern sich ruhig gebrauchet, auch ihre Bohte ihrer Gelegenheit nach an den Orten, da sie ufgetzogen, angelandet und ihre Garn, Tau und Netze am Ufer des Meerß feste gemachet und solches auch an E. F. G. zwischen Rostogk und Lubeck belegenen, daß Meer beruhrenden Embtern ihnen ohne Contradiction und Eintrag iederzeit frei gelassen". Nun aber hätten die Fischer geklagt, "daß sie in den nehisten weinig Jahren am Gebrauch der Fischereien unterschietlich mit Abnehmung ihrer Bohte und Fischer-Geräthes sein turbiret". Dabei wurde auf den Fall bei Alt-Gaarz vom 15. Dezember 1620 verwiesen, über den ein Protokoll beiliegt. Weil "auch frembde Potentaten die Anlandung der Bohte und Uftzugk der Fischer-Netzen in littore maris den armen Fischern


|
Seite 73 |




|
gestatten, E. F. G. . . . Vorfahren, wie wir berichtet, auch wol frembden Fischern vergönnet" 122 ), so wurde gebeten, "E. F. G. wollen ihrer gehorsahmen Stadt den biß anhero auf dem offenen Mehr empfundenen Vorschub und Hülf" nicht entziehen, sondern die Fischer bei ihrem alten Gebrauche lassen.
Die Dinge lagen gar nicht so, wie Rörig (II, S. 229), dem allerdings das Material nur sehr unvollständig bekannt war, annimmt, daß nämlich "den landesfürstlichen Beamten dieser Zeit, die erfüllt waren von dem Gedanken der Omnipotenz des Fürsten und seiner Jurisdiktion, der Gedanke der freien Strandnutzung durch die städtische, diesmal Rostocker Seefischerei zuwider" gewesen sei. Sondern einige Warnemünder hatten die Fischerei der Amtsuntertanen in der Gegend von Gaarz durch Beschädigung von Netzen gestört, und daraufhin hatte der Hauptmann zu Doberan und Bukow, Joachim Vieregge, sich die ganze Warnemünder Seefischerei in jener Gegend verbeten. Es handelt sich also nicht um eine grundsätzliche Haltung der Beamtenschaft, sondern um ein singuläres, aus besonderen Gründen verfügtes Verbot des Amtshauptmannes Vieregge, das nur gegen die Warnemünder Fischer gerichtet war 123 ). Die Herzöge selbst zeigten sich sehr nachgiebig, wie aus einer Resolution vom 20. Februar 1621 hervorgeht, auf die wir zurückkommen werden.
Nach Rörig ergäbe sich aus der Rostocker Beschwerde, von deren Wortlaut wir 1923 die erste Hälfte angeführt haben: "1. das Meer vor den Ufern der mecklenburgischen Ämter zwischen Rostock und Lübeck gilt Âals offen, gemein meer'.
2. dem Herzog steht der Strand (wie Rörig ihn auffaßt), zu; jedoch stellt die Verhinderung der ungestörten Strandnutzung durch die Seefischer zur Ausübung ihres Berufes einen ungerechtfertigten Übergriff der mecklenburgischen Beamten dar" 124 ).


|
Seite 74 |




|
Das zweite kann man zwar aus einer Rostocker Behauptung allein noch nicht mit solcher Sicherheit schließen, es ist jedoch Tatsache, daß eine hergebrachte Nutzung bestand.
Zu der ersten Folgerung Rörigs bemerken wir, daß allerdings aus dem Text der Beschwerde nicht hervorgeht, daß es ein Küstengewässer gab, aber auch nicht das Gegenteil. Die Warnemünder fischten im gemeinen Meer, befuhren jedoch auch den Strand und kamen ans Ufer. Hätte wirklich das Meer bis an den trockenen Strand als "gemein" gegolten, so hätte dieser Rechtsgrundsatz allbekannt sein müssen, und es wäre dann eigentlich überflüssig gewesen, daß die Stadt Rostock 1618 acht Warnemünder darüber vernehmen ließ, ob die freie Fischerei an der mecklenburgischen Küste und im besonderen "am Seheschlage bey Brunßhoveden, Gartz und dero Orter" einem alten Gebrauche entspreche. Denn es handelte sich bei dem Verhör durchaus um die Fischerei auf dem Wasser selbst; das ergibt sich sowohl aus den Frageartikeln, die den Zeugen vorgelegt wurden, wie aus den Aussagen 125 ). Auch
Von den Aussagen auf die Artikel 3 und 4, in denen das Wort "Strand" vorkommt, wollen wir die folgenden anführen, mit denen durchaus die Gesamtheit der Aussagen auf diese Artikel wiedergegeben ist: 1. Zeuge, der über 70 Jahre alte Gert Boddeker: Zu 3: "Sagt Zeuge, in seiner Jugend wiße er nicht, das die Warnemunder dero Orter Waden hingeführt und gezogen, alleine nun eine zwantzig Jahr hero ungefehr hetten die Warnemunder, wie auch Zeuge selbst am Buker Orte die Tobiarswade fast jerlich gezogen und noch." Zu 4: "Sagt wahr, so viel die offenbare Sehe betrifft, sonsten aber wie zum 3. Artikel, und hab Zeug es nie anders gesehen, gehört noch erfahren, allein daß ( ... )


|
Seite 75 |




|
betraf das Verbot des Hauptmannes Vieregge keineswegs nur die Nutzung des Ufers; ausdrücklich heißt es in dem Protokoll von 1618, daß einige Warnemünder von den Gaarzer Bauern in der See selbst gepfändet seien, "auch ihnen dero Orter weder in der Sehe zu bestechen, noch ans Land zu kommen, öffentlich verbotten worden were" ("bestechen" in der Bedeutung wie "nach Dorsch gestochen", siehe Anm. 125, Abs. 2, Zeuge 2).
Ferner sagte 1618 der Warnemünder Fischer Gert Boddeker aus, "in der offenbaren Sehe fischeten sie nach wie vor, aber die Pauren zum Arendtssehe, Brunßhöveden und der Orter hetten Zeugen und andere Warnemunder gewarnet, sie solten alda gegen ihrem Lande keine Schnöre werfen, weiniger alda ans Land
Das feste Land betreffen nur wenige Aussagen, die nebenher und zur Erläuterung der Angaben über die Fischerei gemacht wurden: Auf Art. 1 und 2 erwiderte Gert Boddeker: "Affirmat, dan seine Eltern hatten also gefischet und er auch von Jugend auf die Sehe also entlengst gefischet, auch zum Arendssehe und zu Mesekendorf hetten seine Nachbarn Backheuser geheuret, darin gelegen und ihrer Fischerey abgewartet, wie dan auch etzliche Holsteinische bey Brunßhoveden vor ungefehr achtunddreißig Jahren nicht allein ein, sondern woll zehen Jahr alda gefischet und funf Buden alda am Strande gehabt, darin sie gelegen und ihre Holtzung auß dem Dobbranschen Wolde gehabt, dafur sie den Beambten alda etwas geben mußen; ob sie ihn Gelt oder Fische gegeben, nescit." Die Mietung von Backhäusern (die natürlich ( ... )


|
Seite 76 |




|
kommen . ." 126 ). Der Zeuge machte also einen Unterschied zwischen dem Fange in der "offenbaren" See und dem am Strande, ein Unterschied, der sich übrigens nur aus dem ganzen Inhalt der Aussage, nicht schon aus dem Ausdruck "offenbar" ergibt. Denn die Adjektiva "offen, offenbar, frei" erscheinen öfter als Epitheta des Meeres, ohne daß gerade das herrenlose Meer im Gegensatze zum Strande gemeint ist. Sie sollen also keineswegs immer ein rechtliches Verhältnis des Meeres ausdrücken, sondern oft nur dessen äußerliche Beschaffenheit bezeichnen 127 ).
Am 14. Februar 1621 bat Rostock noch einmal im Hinblick auf "die Fischerei im freien Meer und Anlendung der Böte, Ufziehung und Befestigung der Fischer-Netze": Ew. Fürstl. Gnaden "wollen die von unß eingeführete Motiven und insonderheit dieses in Gnaden behertzigen, daß je durch die obgedachte Fischerei unsere arme Fischer E. F. G. oder ienigen Menschen nicht präjudiciren, sondern nur daßjenige suchen, waß E. F. G. wol Frembden zulaßen . ."


|
Seite 77 |




|
Darauf gaben die Herzöge in einer Resolution vom 20. Februar, in der sie zu allen Rostocker, auf dem Landtage vorgebrachten Beschwerden Stellung nahmen, die Erklärung ab, daß die
"Stadt Rostock und dero Fischer zu Warnemunde bei dem Gebrauch der freyen Fischerei im offnen Meer an Unsern anß Meer stoßenden Ämbtern (jedoch Unser Gerechtigkeit daran vorbehaltlich) nach wie vor ruhig verbleiben" sollten, "dergestalt, das gemelte Fischer mit ihren Böthen anlenden, ihre Netze und Garn aufziehen, feste machen, trucknen und also obgesagter Maßen der Fischerei gebrauchen mugen".
In dieser Erklärung bezieht sich der eingeklammerte Vorbehalt gewiß auf die Strandfischerei. Wenn Rörig 128 ) glaubt, mit der Rostocker Beschwerde von 1621 seine Auffassung des holsteinischen Privilegs für Lübeck von 1252 (oben S. 23) stützen zu können, so ist er im Irrtum. Zu den Worten der Beschwerde "im offenen gemeinen Meer" haben wir im vorigen Jahre den Zusatz gemacht, daß das Meer freilich nur außerhalb des Küstengewässers gemein gewesen sei. Rörig (II, S. 230) bemerkt dazu: "Auf diese Weise lassen sich historische Quellen nun einmal nicht ausbessern". Die Antwort hierauf wollen wir ihm durch Rostock selber erteilen lassen.
Im Jahre 1674 nämlich schlug der Amtshauptmann Moltke zu Ribnitz dem Herzoge Gustav Adolf vor, am Strande der Rostocker Heide Heringsreusen zu setzen, weil dort das "littus und die Strandgerechtigkeit an der offenbahren See längst dem Strande Ew. Hochfürstl. Durchl. als ein hohes Regale sonder Zweifel zukommen" müsse, ein Regal, von dem Moltke annahm, daß es den Rostockern nicht zugleich mit der Heide abgetreten sei 129 ). Als dann im nächsten Jahre eine Reuse durch Wustrower Untertanen aufgestellt war, erschienen nächtlicher Weile, während die Wustrower in ihrer Hütte schliefen, Rostocker Fischer, rissen die Reusenpfähle heraus und zerschnitten das Tauwerk, darauf befahl der Herzog, eine neue Reuse zu setzen, und schickte Militär zu ihrer Bewachung.
Gleichzeitig beschwerte er sich beim Rostocker Rate, worauf sich herausstellte, daß dieser die Entfernung der Reuse angeordnet hatte. Allerdings erklärte der Rat, nicht gewußt zu haben, daß die Reuse auf herzogliche Anordnung gesetzt worden sei. Rostock habe aber die fürstliche Strandgerechtigkeit nicht angetastet und


|
Seite 78 |




|
"die unter E. F. Durchl. Lande gesetzte Rüsen in keine Wege turbiret", sondern die weggerissene Reuse sei "unter unserm eigenthümblichen Lande und Üfer" aufgestellt gewesen, wo Fischereigerechtigkeit und Jurisdiktion der Stadt vermöge ihrer Privilegien zuständen.
Näher begründete dann Rostock sein Recht durch einen aus 17 Artikeln bestehenden Schriftsatz. Darin heißt es:
"Wan dan nun zwar in mari libero die piscatura jederman licita ist, so hat es doch mit denen Anschüßen an das Üfer gar eine andere Bewandnus, zumahl der Augenschein beweiset, das die Rüsenpfahle bist an das Landt müßen gesetzet werden, und zwar so nahe, das ein Kerl bis an den Bauch kan hinein waden, und also dieses nicht gesaget werden kan, das in libero mari gefischet werde."
Dabei bezieht sich das Hineinwaten natürlich nur auf die Strecke bis zum ersten Reusenpfahl nach dem Lande zu. Die übrigen Pfähle standen viel weiter seewärts; denn die Heringsreusen waren von beträchtlicher Länge. So hatte die 1616 bei Harkensee in der Travemünder Bucht aufgestellte Reuse, die über 100 Gulden gekostet hatte, mehrere hundert Meter in die See, und zwar bis in den Strom hinein gereicht. Zur Anfertigung der von den Rostockern weggerissenen Reuse hatte die Wustrower Fichergesellschaft oder "Mascopei" über 400 Gulden (nach einer späteren Angabe 500 Gulden) aufgewendet; trotzdem war diese Reuse nach Aussage der Fischer kürzer als die übrigen, die weiter östlich am fürstlichen Strande standen. Es "beschläget", sagte Rostock, "solch eine Rüse einen gahr großen Platz".
Was sind nun die "Anschüsse an das Ufer", die in dem Schriftsatze vom mare liberum unterschieden wurden, womit an dieser Stelle nur das herrenlose Meer gemeint sein kann?
Nach dem mittelniederdeutschen Wörterbuche von Schiller und Lübben bezeichnet "anschot" die an ein Grundstück anschießenden Zubehörungen, zumal am Wasser. In einer der dort mitgeteilten Quellenstellen erscheint das Wort in der übertragenen Bedeutung "Fischereigerechtigkeit", bezeichnet also die Nutzung des Anschusses. Auch im rügischen Landrecht wird es im Zusammenhange mit Fischereigerechtigkeit gebraucht 130 ).


|
Seite 79 |




|
Wie die von der Insel Lieps in die See schießenden "Gründe, die nach Zeugenaussagen von 1597 zu Lieps gehörten (oben S. 33), nichts weiter sind als der Strand der Insel, so sind auch die "Anschüsse" am Meeresufer mit dem Strande identisch. Dem entspricht es, daß Rostock sich in seinen Darlegungen auf die "iurisdictio littoralis oder Strandgerechtigkeit", und zwar ausdrücklich auf das Schiffsbergerecht berief, das ihm am Ufer des Stadtgebietes zustand; eine Jurisdiktion, die, wie wir gesehen haben, bis zur schiffbaren See reichte. Auch Akten über Streitigkeiten zwischen der mecklenburgischen Landesherrschaft und der Stadt Ribnitz wegen des Strandrechtes und der Fischerei an der Meeresküste des städtischen Gebietes zeigen, daß "Anschuß" und Strand ein und dasselbe sind. Wir werden auf diese Streitigkeiten noch eingehen.
Rostock führte in seinem Schriftsatze die Privilegien von 1323 und 1358 für sich ins Feld, die Heinrich II. und Albrecht II. ihm erteilt hatten 131 ). Daraus erhelle, daß der Stadt "die iurisdictio littoralis so wol als das ius piscandi privative zustehe, kraft welcher sie nicht verstaten mugen, das ihnen daselbst Eintrag geschehe, cum unicuiqui iuxta sua littora competat Dominium maris, Stpm., De iure marit., cap 5 n. 55., marisque partes eius sint civitatis, quae proxima est, Klock, Cons. 5, n. 3; unum enim et idem est ius, quod imminet super aquas et immergitur aquis, concessaque terra mari adiacente conceditur iurisdictio in mari, Klock, Cons. 29, n. 41." Rostock stützte sich hier also, um Althergebrachtes zu beweisen, auf damals neue juristische Literatur, obwohl das Völkerrecht schon im Begriffe war, auf das moderne Küstengewässer zuzusteuern, das über den alten Strand hinausgeht 132 ).
Weiter erklärte Rostock: "Siehet man auch nur das bloße ius piscandi an, so der Stadt unleugbar an ihrem Ufer zustehen mus, so findet es sich, daß diese außsetzende Rüsen solches ius gentzlich verhindern, zumahl, woselbst die Pfahle stehen, unmüglich gefischet


|
Seite 80 |




|
werden mag, und beschläget solch eine Rüse einen gahr großen Platz, welchen der Stadt Fischere nicht würden gebrauchen können, so doch ausdrücklich den Privilegien zuwiedern". Endlich:
"Und gleich wie I. F. Durchl. nicht wurde gestaten, daß unsere Fischer unter dero Üfer die Rüsen setzen solten, ob sie gleich vermöge Vertrages de anno 1621 unter dero Lande mit Netzen zu fischen und die Wade zu trecken befuget seyn, also werden auch I. F. D. reciproce nach der Regul der Natur, quod tibi non vis fieri, nicht begehren, das die Stadt an ihren Rechten eine Diminution empfinden solle."
Hiermit ist eine klare Interpretation der (oben S. 77) angeführten landesherrlichen Resolution vom 20. Februar 1621, die Rostock mit dem Vertrage meinte, gegeben. Wir hatten völlig recht, zu der Beschwerde, die die Stadt auf dem Landtage vom 5. Februar 1621 überreichte, zu bemerken, daß das "gemeine Meer" nur außerhalb des Küstengewässers gemein gewesen sei.
Nun zu den schon erwähnten Streitigkeiten zwischen der Stadt Ribnitz und der Landesherrschaft. 1622 strandete eine Schute am Wiesengelände der Stadt, das, an Wustrow grenzend, sich auf der Landenge zwischen der offenen See und dem Bodden hinzieht. Der herzogliche Amtmann in Ribnitz bestritt das städtische Bergerecht. Unter den Beweisen, auf die sich die Stadt stützte, finden sich Zeugenaussagen vom 6. Mai 1622. Danach erklärte der Fischeraltermann Hans Teßmar, "was kegen der Stadt Wische (Wiese) und sonsten auf der Stadt Grundt und Bodem Anschosse je und allewege gestrandet", habe "die Stadt Ribnitz sich angemasset. Was 133 ) aber sonsten kegen I. F(ürstl.) G(naden) Anschosse, so wol kegen des Closters Grundt und Bodem 134 ) gestrandet und angekommen, solchs hette I. F. G., so wol das Closter zu sich genommen". Ebenso sagt der Schulze zu Körkwitz aus (Was aber sonsten kegen I. F. G.Anschosse, Grundt und Bodem angestrandet, haben I. F. G. Beambten zu sich genommen) 135 ).
In Klagepunkten, die der Ribnitzer Stadtvogt 1627 gegen den Magistrat aufstellte, heißt es: "Wollen ein Rath F. G. oder deren Statvogte an dem Strande, soweit ihr, der Stat, Anschoß geht, weder an Jurisdiction noch an Cognition caußarum, noch an Bruchgefellen oder angestrandeten Gutern nichtes gestendig


|
Seite 81 |




|
sein. Verheuren auch I. F. G. Oeconomien Unterthanen wie auch des Closters Unterthanen die Strantreusen und Fischerey umb etliche Gulden jerlich, unangesehen I. F. G. den Zollhering am Strande haben" 136 ).
1664 verbot der Amtshauptmann Moltke den Dierhäger Fischern, der Stadt Reusenpacht zu geben, weil Ribnitz nur auf der Binnensee Fischereigerechtigkeit habe und die Privilegien der Stadt auf den Außenstrand nicht anwendbar seien. Die Ursachen des Streites interessieren hier nicht. Hervorheben wollen wir aber, daß aus den Akten darüber mit aller Klarheit hervorgeht, daß Meeresfischerei in der Strandgerechtigkeit inbegriffen war. So bekämpfte Moltke (24. Juni 1664) die "von der Stadt praendirte Strandtgerechtigkeit zum Dierhagen, deßfalß die Supplicanten (d. h. Bürgermeister und Rat) jährlich an Hering und an Reusen-Geld etwas de facto sich angemaßet." In seinen Ausführungen setzte er den (von ihm bestrittenen) Fall, daß die Ribnitzer vermöge eines von ihnen angezogenen Privilegs das "Regale, das sie im offenen Meer fischen und Reusen setzen laßen möchten", besäßen. Dagegen schrieb der Ribnitzer Rat (8. Nov. 1664), er habe niemals "einige Wasserpacht gehoben alß an den Ohrten, da die Stadtwiesen und andere Gränzen anschießen und die Rüsen und Waden gebrauchet werden, wie dann die Derhäger selbst anzeugen werden, daß wir die Ohrter allemahl befischet und die Strandtgerechtigkeit, auch die Rüsenpacht genoßen, ihnen auch die Strandfischerey auf Vorbitten der Furstlichen Beambten umb eine geringe Recognition von gemeiner Stadt wegen concediret haben". Zum Beweise legte der Rat Auszüge aus Registern bei, die ergeben, daß die Stadt von 1568 bis 1663 Bergegeld für gestrandete Güter "wie auch Vaden- und Rüsenheuer auf der Stadt Riebbeniz Anschöße im offenen Strande 137 ), wohl (= wie auch) in der Binnen-See und Reckenitz" eingenommen hatte; z. B. "2 fl.16 B Ý die Dehndörfer für die hohen Wadenzüge bey offenen Strande. Anno 1612".
Am 29. Dez. 1665 beschwerte sich der Ribnitzer Rat wieder über Moltkes Maßnahmen gegen "die unß und unsere Bürgerschaft vor undencklichen Jahren her zustehende und durch rechtmäßige Possession geruhlich gebrauchte Strand- und


|
Seite 82 |




|
Fischerey-Gerechtigkeit." Man habe erfahren, "daß noch andere turbationes wieder unß und unsere wollhergebrachte Fischer-Gerechtigkeit vorgenommen werden will, indem einigen Einliegern und freyen Leuten in Wustrowischen und andern Fischer-Dörfern . . will erlaubet werden, gegen unsern Anschuß beim Neuen Hause (Stadtgut Neuhaus, Niehusen), woselbsten unsere Stadtfischere und Bürger ihre Fischernahrung von undencklichen Jahren her mit Waden und ander Fischergerähte gehabt und noch haben, neue Reusen zu setzen, und auch wir ie mehr und mehr an unser wollhergebrachten Strand- und Fischer-Gerechtigkeit würden beeinträchtiget werden".
Zu dieser Streitsache berichtete der herzogliche Rat Dr. Andreas Curtius am 26. März 1666: "Anlangend die praetendirte Strandtgerechtigkeit und daher rührende Fischerey und Reusenpächte, ist gleichfalß zwar ex iure feudali et consuetudinario bekannt, quod litora maris et piscationum reditus inter regalia referantur, aber dabey auch dieses gewiß, quod eiusmodi regalia privatis concedi et ab iis possideri, immo praescribi possint." Ferner liegt bei den Akten das Konzept zu einem rechtlichen Gutachten, verfaßt von dem Mecklenburg-Güstrowschen Kanzler Dr. Johann Schlüter, vormaligem Assessor am schwedischen Tribunal in Wismar 138 ). Danach waren zu unterscheiden:
1) Litorum maris portuumque usus, qui est iuris gentium et accedentibus omnibus, tam peregrinis quam accolis et subditis, communis atque ita publicus, ut litora in nullius, nedum privati alicuius dominium cadant.
2) Litorum portuumque et adiacentis seu confinis maris utilitates atque proventus, et hi pertinent ad regalia superioris, ita tamen, ut sint vel per concessionem superioris vel per praescriptionem [Verjährung] etiam civitati municipali et privatis communicabiles, atque sic exercitium horum regalium aliquando etiam inferiori magistratui competere queat.
3) Jurisdictio et protectio litorum, potuum et maris finitimi, quae superioritati atque adeo iuri


|
Seite 83 |




|
territoriali inhaeret, ut sine dispendio superioritatis communicari haud possit.
"Es wird aber," so heißt es dann in dem Gutachten, "allhie in actis die iurisdictio litoralis improprie und abusive die Strandtgerechtigkeit genant, denn allein von dem, was an dem Ufer des Meers oder in vicino mari strandet, wird die Strandtgerechtigkeit denominiert, und ist dieselbe nur iuris litoralis sive maritimi pars, cum universalis iurisdictio et protectio litoralis wann des Strandens halber etwas zu decidieren oder zu statuieren vorkommet, applicert wird; dahero die Strandtgerechtigkeit ad solum casum naufragii gehörig, die Ufergerechtigkeit aber in genere und weiter sich erstrecket, wie diese dann auch in genere in litorali protectione et iurisdictione bestehet. Und obgleich auch die fructus et proventus eiusmodi tam generalis quam specialis iuris litoralis dem Superiori als Regalia zustehen und solche reditus unter dem iure litorali begriffen, als im Hafen, am Ufer des Meers und in mari vicino (wie dann die leges communes und durchgehende consuetudo litora maris eodem iure cum mari adiacente censieren) zu fischen, item Strandgeld oder vielmehr Barggeldt zu nehmen etc., per concessionem superioris aut praescriptionem auf inferiores magistratus und Unterthanen gebracht werden können, so bleibet doch der hohen Landesobrigkeit darüber die Jurisdiction und Protection, so dem iuri territoriali et superioritatis anhängig und davon nicht divelliert werden mag" 139 ).
Der Kanzler Schlüter wollte also den Ausdruck "Strandgerechtigkeit" auf das Bergerecht, d. h. auf das Strandrecht im engeren Sinne beschränken. Dieses wurde denn auch in erster Linie darunter verstanden, vermutlich weil es die Wurzel des ganzen Rechtes am Strande gewesen ist, eine Ursprünglichkeit, die am Begriffe des Wortes "Strandrecht" haften blieb. Die Summe aber der Hoheitsrechte am Strande, einschließlich des Fischereirechtes, faßte Schlüter unter dem Begriff der Ufergerechtigkeit oder des ius litorale zusammen. Auch für ihn ist die Hoheit über das mare vicinum oder mare adiacens, das er ausdrücklich zum Ufer rechnete, abhängig vom Besitze des Ufers oder der Küste. Neue theoretische Lehrmeinungen über das Küstenmeer sind in seinen Darlegungen nicht zu erblicken; denn er berief sich auf die "durchgehende consuetudo", und die Bezeichnung


|
Seite 84 |




|
"mare adiacens", die er anwendete, erscheint ja schon im Jahre 1265 (Anl. II, Nr. 2). Die Terminologie Schlüters übrigens ist allzu peinlich; der Ausdruck "Strandgerechtigkeit" kommt oft in weiterem Sinne vor, alle Hoheitsrechte am Strande umfassend. Ein Jahrhundert später entstand zwischen dem Amte und der Stadt Ribnitz von neuem ein Streit wegen der Fischerei an der Küste des Stadtgutes Neuhaus. Das Amt berichtete darüber am 7. März 1776 an den Herzog Friedrich:
"Ew. Herzogl. Durchl. hiesiges Amt befindet sich seit undencklichen Jahren notorisch in dem ruhigen alleinigen Besitz, die Heerings-Fischerey in der Ost-See, von der Rostockschen bis zu der Pommerschen Scheide oder den Darß, auszuüben, wie denn die des Behuef am Strande stehende 14 Rüsen an Daendorfer, Dierhaeger und Fischländer Hausleute gegen jährliche Erlegniße verpachtet sind." Zu diesen Reusen habe auch eine bei Neuhaus gehört, die aber, weil die Ergiebigkeit des Fanges im ganzen und besonders in der Neuhauser Gegend abgenommen habe, vorderhand eingezogen worden sei. Diesen Umstand suchten Bürgermeister und Rat in Ribnitz "dahin zu benutzen, daß sie wegen des an Strand stoßenden Stadt-Guths Niehuß intendiren, in der Ost-See mit der Wade, die Zeit des Heerings-Fangs über, fischen zu können". Das Amt habe "zur Erhaltung der herrschaftlichen Rechte" die nötige Vorkehr getroffen.
Beigefügt ist dem Schriftstück ein Auszug aus der Ribnitzer Amtsrechnung von 1745/46, wonach unter den Pachtgeldern (Pensiones) eine Einnahme von 126 Rtlr. "von den Hering- Zoll" aufgeführt war 140 )
Bald darauf beschlagnahmte der Amtslandreiter den Ribnitzer Fischern bei Neuhaus ein Boot samt der Wade und den gefangenen Heringen.
Die herzogliche Kammer in Schwerin erwiderte dem Ribnitzer Oberamtmann am 9. März 1776:
"Es findet unsere völlige Genehmigung, daß Du die von der Stadt Ribnitz wegen ihres Guths Niehuß intendirte Fischerey auf der Ost-See. . . hintertreibest. Da aber solches Unternehmen der Stadt als eine Verletzung unserer Hoheits-Rechte über den Strand und nicht als ein bloßes Spolium anzusehen ist, so hast Du


|
Seite 85 |




|
wann die Commune die Absicht würcklich vollführet, das Protocollum bey Unserer Regierung einzusenden . ." 141 ).
Nun wurde es allerdings an anderen Teilen der mecklenburgischen Küste mit der Fischereihoheit nicht so genau genommen. In einem Bericht des Amtes Grevesmühlen von 1773 heißt es: Die Strandgerechtigkeit sollte "als Regal in ihrem ganzen Umfange von dem Amte allein ausgeübet werden. Durch die Observanz aber ist sie dergestalt eingeschränket worden, daß an den wesentlichen Vortheilen der Fischerey und der Abfuhre des Tankes die adelichen Güter Theil nehmen und als eine ausschließende Befugniß dem Amte weiter nichts als das Strandrecht im engeren Verstande übrig geblieben ist. . . . Wir kommen auf die Fischerey. Hufen, Fliemstorf, Wolenberg, Redewisch, Haffhaven Steinbeck, Brock, Schwansee, alles adeliche Dörfer, und das nach Lübeck gehörende Dorf Warnkenhagen, auch vielleicht andere Dörfer mehr, machen sich in diesem Stücke die Nachbarschaft der See zu Nutze, ohne dafür das mindeste an die Herrschaft zu bezahlen. Diese Last trifft allein die Amtsdörfer Tarnewitz und Boltenhagen, welche jährlich 60 Rthlr. entrichten müssen, ohngeachtet von ihren Nachbaren der Fischfang geschmälert oder ihnen wenigstens der Markt verdorben wird. Wenn das nicht so seyn, sondern dem Amte allein der Fischfang zustehen sollte, wenn es gewiß ist, daß die adelichen Güter sich nicht bis in die See erstrecken, sondern von dem Ufer begrenzet werden, und wenn gleich in den Lehnbriefen von der Fischerey wohl nichts anzutreffen seyn mögte, so sind doch die adelichen Güter seit so langer Zeit im Besitz, daß ihnen diesen Vortheil zu entreißen, verlorne Mühe seyn dürfte" 142 ).
Nutzungen am Strande ritterschaftlicher Güter also hatten sich ausgebildet. Auch die Seefischerei der Warnemünder an der ganzen mecklenburgischen Küste entlang war solch eine hergebrachte Nutzung.
Deswegen aber erlosch nicht die Strandhoheit des Küstenherrn. Wie beim Streite zwischen der Landesherrschaft und der Stadt Ribnitz, so tritt auch aus dem Berichte des Amtes Grevesmühlen der Rechtsgrundsatz hervor, daß das Fischereiregal zur Strandhoheit gehöre. Und immer wieder wurde, von den Städten Rostock und Ribnitz sowohl wie von der Landesherrschaft, die Ausübung


|
Seite 86 |




|
des Bergerechtes als ein Beweis für das Recht auf Meeresfischerei angeführt.
Er handelte sich eben, auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, immer noch um das alte, auf die Strandhoheit gegründete Fischereiregal des Mittelalters. Noch war der Strand unberührt geblieben von der Lehre des Hugo Grotius, daß die Herrschaft des Uferstaates über das Meer sich so weit erstrecken solle, als sie von der Küste her ausgeübt werden könne; eine Lehre, auf der die Kanonenschußweite beruht, die schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erscheint, 1703 von C. van Bynkershoek in der Schrift De domino maris gefordert wurde und auch der Drei-Seemeilen-Grenze zugrunde liegt, die 1793 zuerst erwähnt wird 143 ).
Freilich war es schwer, in jedem Falle zu erkennen, wo der Meeresstrom (ein Ausdruck, mit dem man heute noch den Begriff der Tiefe verbindet), das "Räve", die "Düpe", d. h. das gemeine Meer aufhörte und der Strand begann. Auf diese Schwierigkeit deutet eine Stelle des rügischen Landrechtes hin (oben S. 66). Die kleinen Fahrzeuge, die im 14. Jahrhundert in Pommern für die Seefischerei privilegiert wurden 144 ), konnten wohl, ebenso wie die Fischerboote, den Strand befahren. Im allgemeinen aber wird man als Strandfischerei den Fischfang in unmittelbarer Nähe der Küste angesehen haben.


|
Seite 87 |




|
II.
Gebietshoheit und Fischerei in der
Travemünder Bucht.
Die Darlegungen des ersten Berichtsteiles über das Küstengewässer oder den Strand bilden die Grundlage, von der bei der Untersuchung der vormaligen Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht ausgegangen werden muß. Denn es konnten sich hier nicht, wie Rörig angenommen hat, Lübecker Rechte auf einer in ihrem ganzen Umfange herrenlosen Wasserfläche entwickeln. Sondern herrenlos war nur der Strom der Bucht, während das übrige Gewässer dem Strandregal dessen unterworfen war, der die Hoheit über die Küste innehatte. Dieses Strandregal ist zweifellos älter, als aus den Quellen seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts hervorgeht, auf die wir unsere Beweisführung gestützt haben. Sicher ist jedenfalls, daß es zu einer Zeit bestand, aus der von einer Lübecker Reede auf der Bucht keinerlei Anzeichen überliefert sind. Ob trotzdem Lübeck die Gebietshoheit am mecklenburgischen Ufer bis zum trockenen Strande erlangen, ob es ferner die gemeine See bis weit über die Bucht hinaus sich aneignen konnte, soll im Folgenden geprüft werden. Wir wollen dabei zunächst die hoheitsrechtlichen Verhältnisse unter Ausschließung der Fischerei behandeln, sodann die von Lübeck heute, auf Grund der Rörigschen Forschung, beanspruchten Reedegrenzen, schließlich die Fischerei.
In seinem ersten Aufsatz (I, S. 2) meint Rörig, daß schon in 13. Jahrhundert "die Verbindung von Hoheitsrechten der Stadt mit ihrer maritimen Vormachtstellung in der Lübecker Bucht nachweisbar sei". Lübeck habe die Wasserfläche vor dem Ausfluß der Trave militärisch beherrscht. Er beruft sich dabei auf ein Schreiben des Königs Hakon von Norwegen an die Stadt aus der Zeit zwischen 1247 und 1250. Darin beschwerte sich der König darüber, daß die norwegischen Händler von den Lübecker Untertanen und Söldnern gleichsam in den Häfen Lübecks geplündert würden, unter Duldung der Stadt, die an jener Meeresbucht die Wacht habe 145 ). Nach Rörig wäre diese Wacht (custodia) "der Ausfluß


|
Seite 88 |




|
eines allgemeinen Obrigkeitsrechts auf dieser Wasserfläche". Das ist ein kühner Schluß. Der König wollte nichts weiter sagen, als daß es den Lübeckern an gutem Willen fehle, Räubereien ihrer eigenen Leute dicht bei den Häfen zu verhüten, wozu sie doch um so fähiger seien, als sie an der Bucht die Wacht hielten. Nun aber war diese Wacht bisher von den Grafen von Holstein gehalten worden, denen das Städtchen Travemünde nebst einem dabei gelegenen starken Festungsturm (turris, auch castrum oder castellum genannt) gehörte, der älter war als das Städtchen selbst. Und solange dieses mit Wall und Graben umgebene Festungswerk, das den Schlüssel zur Trave bildete, in fremder Hand war, konnte von einer militärischen Beherrschung der Flußmündung oder der Bucht durch Lübeck natürlich nicht die Rede sein. Noch 1234 hatten Holsteiner und Dänen die Trave gesperrt, so daß der Papst sich ins Mittel legte, um den nach Livland ziehenden Pilgern die Benutzung des Lübecker Hafens zu ermöglichen 146 ). Es war daher das Bestreben der Stadt, den Turm in ihre Gewalt zu bringen. Endlich trat sie unter die Schirmherrschaft der Grafen und schloß 1247 (22. Febr.) mit ihnen einen Vertrag, wonach den Lübeckern für die Dauer der Schirmherrschaft gestattet wurde, den Turm unter ihrer Bewachung zu halten (turrim . . sub eorum custodia possidendam.) und ihn nach Gefallen auszubauen 147 ). Dadurch war die Stellung der Stadt am Traveauslauf fürs erste sehr stark geworden. Die Nachricht hiervon hat sich wegen der großen Wichtigkeit des Festungswerkes sicher alsbald bei allen verbreitet, die mit Lübeck Handel trieben. Und ohne Zweifel ist es der Besitz des Turmes, worauf König Hakon hinweisen wollte 148 ). Der Ausdruck custodia in seinem Briefe bedeutet dasselbe wie in der Urkunde der Holsteiner Grafen: Bewachung, Wacht 149 ). Die Häfen aber, die der König meinte, lagen auf der


|
Seite 89 |




|
Trave selbst 150 ). Eben weil er sagte: quasi in portubus vestris, so ist ja ganz klar, daß auf der Bucht, dem breve mare selbst, kein Hafen war. Ein Obrigkeitsrecht Lübecks auf dem Buchtgewässer ist aus dem Schreiben nicht zu folgern. Es würde ja auch eine militärische Beherrschung der Bucht noch kein Hoheitsrecht voraussetzen. Die Lübecker haben dann das Kastell wieder ausliefern müssen, und erst 1320 kauften sie es von dem Grafen Johann von Holstein unter der Bedingung, daß es geschleift werde 151 ).
In seinem neuen Gutachten 152 ) ist Rörig bei seiner Auffassung von König Hakons Schreiben geblieben (Wacht auf, nicht an jenem kleinen Meere), aber ohne auf unsere Beweisführung einzugehen. Da es sich um eine vereinzelte, sehr knappe Aktenstelle handele, habe er ihr keine allzu große Bedeutung beigelegt und sie nur gewissermaßen nebenher erwähnt. Indessen konnten wir dies aus der Bestimmtheit, mit der er sich 1923 darüber ausgesprochen hat, nicht entnehmen.
Es ist die Meinung Rörigs, daß bereits im Mittelalter eine "räumliche und rechtliche Einheit" zwischen Trave und Travemünder Bucht (Reede) bestanden habe. Gegen die räumliche Einheit hätten wir nichts einzuwenden; sie besteht ja zur Not zwischen der Trave und der ganzen Ostsee. Die rechtliche Einheit aber halten wir in der Tat für eine Konstruktion 153 ), die freilich nicht erst von Rörig, sondern schon früher vom Lübecker Rate vorgenommen worden ist.
Rörig hat diese rechtliche Einheit nicht (wie einst der Lübecks Rat) abgeleitet, aber doch in Verbindung gebracht mit dem Privileg von 1188, das Kaiser Friedrich I. der Stadt ausstellte 154 ).


|
Seite 90 |




|
Dieses sog. Barbarossaprivileg ist anerkanntermaßen eine Fälschung. Wir haben deswegen erklärt, daß sich nichts damit beweisen lasse. "Solche Behauptungen," meint Rörig, "können jedenfalls nur auf Laien in Fragen der Urkundenkritik Eindruck machen." Wir sind dagegen der Ansicht, daß man schon über viel juristisches Laientum verfügen muß, wenn man glauben wollte, daß die juristische Beweiskraft einer Urkunde, deren Unechtheit nachgewiesen ist, nicht gebrochen sei. Hierfür ist die Tatsache der formalen Fälschung allein vollkommen entscheidend. Handelt es sich, wie im vorliegenden Falle, um die Verfälschung einer echten Urkunde und läßt sich nachweisen, daß Teile der Fälschung aus dem Original übernommen sind, so liegt die Beweiskraft dieser Teile natürlich in den anderweitig darüber gemachten Darlegungen, nicht in der unechten Urkunde.
Nun behauptet zwar Rörig, in einer früheren Arbeit von 1915 nachgewiesen zu haben, worum es sich bei der Verfälschung ausschließlich handele 155 ). Es sei darauf angekommen, die seit 1188 gefestigte Stellung des Lübecker Rates gegenüber dem königlichen Stadtvogte zu sichern, der nach Beseitigung der dänischen Herrschaft (1225) wieder aufgenommen werden mußte. Daher sei das Privileg in den betreffenden Bestimmungen den tatsächlichen Verhältnissen angepaßt worden. Das Ergebnis seiner Untersuchungen habe sich in der Forschung durchgesetzt; Rörig 156 ) beruft sich dabei auf v. Below, Hofmeister und Hampe, die seine Arbeit zustimmend besprochen, sich aber auf die Verfolgung der verfassungsrechtlichen Kontroverse beschränkt und den weiteren Inhalt des Privilegs wohl sicher keiner Prüfung unterzogen haben. Als Zeugnisse für die Ausschließlichkeit des von Rörig angenommenen Fälschungszweckes können diese Besprechungen nicht aufgefaßt werden.
Wir müssen bestreiten, daß er die Tendenz der Fälschung festgestellt hat. Ob es überhaupt möglich sein wird, den echten Teil aus dem Privileg zuverlässig herauszuschälen, bleibt vorderhand im Zweifel. Mit Wahrscheinlichkeiten muß sich zwar die historische Wissenschaft unter Umständen begnügen, die juristische Beweiskraft einer Urkunde aber beruht auf der Echtheit von Brief und Siegel; ist diese nicht vorhanden, dann nur auf dem Material, womit sich etwa Teile der Fälschung decken lassen.


|
Seite 91 |




|
Hofmeister 157 ) hat die Frage aufgeworfen, ob bei Anerkennung der Ergebnisse Rörigs von 1915 "die Gründe für die zwingende Annahme einer sachlichen Verfälschung noch ausreichen." Über die formale Fälschung, für die schwerwiegende Beobachtungen geltend gemacht seien, könne erst nach weitere Studien völlig abschließend geurteilt werden. Indessen ist an der Tatsache der Verfälschung, die ja auch von Rörig anerkannt wird, kaum noch zu zweifeln. Das Siegel ist nachgemacht und die Schrift ist die eines Schreibers, der 1222-25 in Lübeck tätig war 158 ). Und für die sachliche Verfälschung liegen eben noch andere Gründe vor. Denn seit die Echtheit des Privilegs dahingeschwunden ist, fällt Licht auf die Rätsel, die es aufgegeben hat und an denen man vergebens herumgedeutet hatte. Wir meinen den ersten Teil der Fälschung, wonach Lübeck beträchtliche Gebiete, die es nie besessen hat, nämlich ein großer Teil des Fürstentums Ratzeburg und die Wälder bei Dassow und Klütz, dazu der Wald bei Brodten, das erst 1804 an Lübeck gekommen ist, zur Nutzung überwiesen wurden. Bestimmungen, die sich mit den tatsächlichen territorialen Verhältnissen nicht in Einklang bringen lassen. Prof. Dr. H. Ploen hat 1924 in einer Abhandlung: Der Streit um den Dassower See und die Barbarossa-Urkunde 159 ) die Unmöglichkeit dieser Bestimmungen dargelegt. In ihnen erblicken wir den Hauptzweck der Fälschung.
Von Lübecker Seite wird uns vorgehalten, daß wir in einem Archivbericht von 1922 geäußert haben, die Verfälschung berühre nur die in der Urkunde enthaltenen Bestimmungen über die Lübecker Ratsverfassung 160 ). Aber wir nehmen an dem allgemeinen Menschenrechte teil, eine Ansicht zu ändern. 1922 hatten wir uns mit dem Privileg noch nicht näher beschäftigt, sondern waren nur über die Rolle unterrichtet, die es in der Kontroverse über den Ursprung der Ratsverfassung gespielt hatte. Schon 1923 aber haben wir gesagt: "Wieweit die Einschaltungen oder Veränderungen gehen, ist noch nicht genügend geklärt worden, da die bisherigen Untersuchungen sich auf die verfassungsrechtlichen Bestimmungen beschränkt haben, die in der Fälschung enthalten sind."


|
Seite 92 |




|
Damit hatten wir unseren Standpunkt von 1922 bereits verlassen 161 ). Nun ist die Fälschung 1226 von Kaiser Friedrich II. bestätigt worden. Eben zu diesem Zwecke ließ Lübeck sie kurz vorher anfertigen, wie allgemein, auch von Rörig, angenommen wird. Und durch die Bestätigung soll ihr Inhalt, der in die Urkunde Friedrichs II. wörtlich übernommen ist, formale Rechtskraft erlangt haben. Wir bestreiten auch das. Denn die Bestätigung ist zweifellos in der Voraussetzung geschehen, daß die Vorlage echt sei; sie ist also erschlichen und deswegen rechtsungültig 162 ). Übrigens müßte die Urkunde von 1226, die in zwei Exemplaren vorhanden ist, von einem Kenner der Kanzlei Friedrichs II. geprüft werden, bevor ihre Echtheit als unbedingt feststehend zu gelten hat.


|
Seite 93 |




|
Die praktische Auswirkung des Barbarossaprivilegs ist für Mecklenburg höchst schädlich gewesen. Immer wieder, die Jahrhunderte hindurch, hat Lübeck sich darauf berufen. Noch 1890, bei der Entscheidung des Prozesses um den Dassower See, die Pötenitzer Wiek und die Untertrave hat die Urkunde, deren Unechtheit damals noch nicht bekannt war, verhängnisvoll mitgewirkt. Wenn man in Mecklenburg findet, daß es an der Zeit sei, das Privileg aus dem Spiele zu lassen, so wird Lübeck sich hierüber nicht wundern dürfen.
Im Streite um die Travemünder Bucht freilich brauchte man eigentlich über die Fälschung gar nicht zu reden. Aber sie ist nun einmal zur Stützung der Lübecker Ansprüche herangezogen worden. Es handelt sich um folgende Stelle des Privilegs:
Insuper licebit ipsis civibus et eorum piscatoribus piscari per omnia a supradicta villa Odislo (Oldesloe) usque in mare preter septa (Fischwehren) comitis Adolfi sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt 163 ).
Danach wurde Lübeck keine Gebietshoheit auf dem Wasser, kein Fischereiregal verliehen, sondern nur die Fischereinutzung auf der Trave von Oldesloe bis zum Meere. Rörig 164 ) aber übersetzt die Worte usque in mare mit "bis ins Meer", in dem Sinne, daß ein Stück des Meeres inbegriffen sein solle. Darüber lasse der "festzustellende Sprachgebrauch" kaum einen Zweifel. Er verweist dabei auf eine Bestimmung in dem Freibriefe Kaiser Friedrichs II. für Lübeck von 1226, wonach an den Ufern der Trave bis zum Meere keine Befestigungen angelegt werden sollten. Da dies nur bis zur Mündung möglich sei, heiße es denn 1226 usque ad mare. Jedoch sind zwei Urkundenstellen noch kein hinreichendes Material, um einen Sprachgebrauch daraus zu ermitteln. Wir haben dem 1923 nur eine holsteinische Urkunde von 1329 entgegengestellt, worin usque in viermal in der Bedeutung von "bis zu" vorkommt 165 ). Rörig verlangt Beispiele aus der Reichskanzlei. Wir geben sie ihm in der Anlage IV, darunter zwei Urkunden Friedrichs I. 166 ). Auszüge aus Urkunden anderer Kanzleien haben


|
Seite 94 |




|
wir hinzugefügt. Zweifellos ließen sich diese Beispiele sehr vermehren. Oft genug erscheint darin usque in mare = bis zum Meere. Daneben kommt usque ad (auch usque ad mare) viele Male vor, wie denn schon einige der Auszüge, die wir in der Anlage mitteilen, zeigen, daß der Gebrauch von usque in und usque ad in der gleichen Bedeutung durcheinander geht. Weil die Präposition in c. acce. nicht nur "in . . hinein" heißt, sondern auch "nach . . hin", findet sich usque im Sinne von "bis zu" oft bei Grenzbeschreibungen.
Feierlich fragt Rörig (II, S. 238), ob wir etwa leugnen wollten, "daß in dem Privileg Friedrichs II. von 1226 für die Bezeichnung Âbis ans Meer' ausdrücklich die Worte Âusque ad mare' gebraucht" seien. Als ob unser Einwurf damit getroffen wäre. Wie kann man das leugnen! Aber gerade dieses Privileg bietet ein Beispiel für die Anwendung von usque in und usque ad in der nämlichen Bedeutung 167 ). Ebenso - worauf bereits Ploen aufmerksam gemacht hat - das Barbarossaprivileg selbst, das wir hier aber nicht für die kaiserliche Kanzlei in Anspruch nehmen können, weil wir die betreffende Stelle für interpoliert halten 168 ). Jedenfalls unterscheidet sich die kaiserliche Kanzlei im Gebrauch der beiden Ausdrücke nicht von den übrigen Kanzleien. Es musste 1226 bei der Bestimmung über den Bau von Befestigungen durchaus nicht usque ad heißen. Eine pommersche Urkunde von 1294 verwendet bei derselben Gelegenheit usque in (Anl. IV, Nr. 5). Wir verweisen auch auf die brandenburgische Urkunde von 1313 (Nr.6) und die holsteinische von 1329 (Nr. 9)
Usque in mare in dem Barbarossaprivileg heißt: bis zum Meere, bis ans Meer. Das ist unsere Ansicht von vornherein gewesen. Wir haben 1922 und 1923 gesagt, daß die Stelle durch die Chronik des Arnold von Lübeck (gest. um 1213) gedeckt werde. Rörig führt das an 169 ). Aber gerade in den Worten der Chronik haben wir einen Beweis für die Richtigkeit unserer Auffassung


|
Seite 95 |




|
erblickt. Arnold 170 ) berichtet von einem Streit zwischen dem Grafen Adolf von Holstein und Lübeck. Auch das Barbarossaprivileg geht zu Anfang von Streitigkeiten aus, die zwischen der Stadt und dem Grafen schwebten 171 ). Nach Arnold hatten die Lübecker sich geweigert, den Travemünder Zoll zu zahlen, dessen Erhebung unberechtigt sei 172 ). Darauf hatte der Graf ihnen ihre Nutzbarkeiten in seinem Lande genommen:
Ob hanc igitur contradictonem, quicquid commoditatis in suis terminis cives ante videbantur habere in fluviis , in pascuis, in silvis comes omnino abstulit.
Auf Vermittlung des Kaisers kauften dann die Lübecker sich von dem Zolle los, leisteten auch eine Geldzahlung für die Weidegerechtigkeit im Holsteinischen und erhielten ihre Nutzbarkeiten zurück:
et sic a mari usque Thodeslo (Oldesloe) libere fruerentur fluviis , pascuis, silvis . .
Hierüber empfingen sie ein Privileg des Kaisers 173 ), zu dessen Händen - nach der Barbarossaurkunde - Graf Adolf sich der strittigen usus et commoditates begeben hatte.
Also Flußnutzung war es, was den Lübeckern zugesprochen wurde, und zwar vom Meere, d. h. von der Travemündung an bis Oldesloe, eine Nutzung, die sie schon vorher gehabt hatten. Damit ist denn alles gesagt. Das Barbarossaprivileg bietet im Hinblick auf die Fischerei nicht mehr, als Arnold angibt 174 ). Natürlich aber deckt die Chronik das Privileg nur dem Sinne nicht dem Wortlaute nach. Ob in der echten Urkunde usque in oder usque ad gestanden hat, ist nicht mehr nachweisbar 175 ).


|
Seite 96 |




|
Wir bleiben dabei, daß das Privileg aus Rörigs Beweisführung ausscheiden muß, und brauchten auf die Vermutungen, die er darüber anstellt, eigentlich nicht mehr einzugehen. In seinem ersten Aufsatz gibt er zwar zu, daß sich aus der Urkunde, die ja nur Fischereinutzung gewährt, ein Hoheitsrecht Lübecks auf der Travemünder Bucht nicht nachweisen lasse, sucht aber beides Hoheit und Privileg, trotzdem miteinander in Zusammenhang zu bringen 176 ). In dem neuen Gutachten (S. 238) behauptet er, daß wir "wieder selbst das Material" geliefert hätten, um unsere "eigenen Aufstellungen zu widerlegen". Er meint das Privileg des Fürsten Borwin für Rostock von 1252, in dem Seefischerei verliehen wurde (oben S. 11), und setzt es in Parallele zu der Barbarossaurkunde. "Sollte," so fragt er, "das angesehene Lübeck, das doch honestissima iura erhielt, schlechter dagestanden haben als das jüngere und bescheidenere Rostock?" Als ob man 1188 schon auf eine Verleihung habe Rücksicht nehmen können, die der damals überhaupt noch nicht gegründeten Stadt Rostock 64 Jahre später von ihrem Landesherrn gewährt wurde! Dann bringt Rörig eine Gegenüberstellung: Auf der einen Seite, im Hinblick auf Lübeck und die Trave, den Satz des Barbarossaprivilegs: piscari . . usque in mare, dazu eine Stelle aus der Lübecker Fischereiordnung von 1585, wonach die lübischen Fischer des Rates Strom, die Trave, befahren und "auch ferner hinaus bis in die wilde See, soweit sie kommen und ihre Hälse wagen wollen, jahraus und Tag für Tag die Fischerei" gebrauchen sollten; auf der anderen Seite, im Hinblick auf Rostock und die Warnow, die Stelle in dem Privileg von 1252, wonach Rostock Flußfischerei und, mit klaren Worten, Meeresfischerei verliehen wurde (a ponte aquatico proximo ecclesie sancti Petri, et sic per alveum fluminis Warnowe usque Warnemunde, necnon extra portum in marinis fluctibus eos tanto dotamus beneficio piscature, quantum 177 ) pre intemperie aeris audeant attemptare).


|
Seite 97 |




|
Indessen sind die beiden Privilegien in dem entscheidenden Punkte nicht gleichzustellen, sondern sie weichen hier gerade voneinander ab. Die Übereinstimmung besteht nur darin, daß beide Städte Fischereirecht auf einer begrenzten Flußstrecke erhielten, Lübeck auf der Trave von Oldesloe bis zum Meere, Rostock auf der Unterwarnow vom Wassertore nächst der St. Petrikirche, also von der Stadt an bis zur Flußmündung. Dazu aber erhielt Rostock Meeresfischerei, und zwar ausdrücklich außerhalb des Hafens, der am alten Tief, östlich vom heutigen Warnemünder Hafen lag 178 ).
Erinnern wir uns, daß 71 Jahre später (1323) den Rostockern das Lehn der Meeresfischerei vom Fürsten Heinrich II. unter Anlehnung an den Wortlaut des Privilegs von 1252 und unter Festsetzung von Küstengrenzen erneuert wurde (oben S. 11, 13). Die Stelle in der Urkunde von 1323 lautet:
Insuper in marinis fluctibus inter Zarnestrom et Diderikeshagen eos tanto dotamus beneficio piscature, quantum pre intemperie aeris et corporis periculo audeant attemptare.
Die Flußfischerei wird diesmal nicht erwähnt. Warum ist nur von Seefischerei die Rede? Weil es sich darum handelte, ihren Bezirk zu bestimmen. In derselben Urkunde übertrug Fürst Heinrich den Rostockern das Dorf Warnemünde, dessen Küste also, die im Westen bis zur Diedrichshäger Grenze ging, fortan zum Stadtgebiete gehörte. Bisher hatte das Rostocker Gebiet am Meeresufer nur vom Stromgraben (Zarnestrom) in der Heide bis zum alten Tief gereicht. So war es seit dem Privileg von 1252 gewesen, weil darin die Rostocker Heide an die Stadt verkauft wurde. Diesen Verkauf bestätigte Fürst Heinrich 1323. Und entsprechend dem gleichzeitig durch die Überlassung von Warnemünde vergrößerten Küstenbesitz der Stadt gab er als Grenze des Seefischereibezirkes den Stromgraben (im Osten) und die Diedrichshäger Scheide (im Westen) an. Es handelte sich um die Strandfischerei, die Rostock noch 1674 eifersüchtig an seiner Küste hütete (oben S. 77 f.). Auch 1252 kann nichts anderes gemeint sein als der Fischfang am Strande, für den damals noch keine bestimmte Uferstrecke angegeben wurde. Seewärts findet sich weder 1252 noch 1323 eine Grenze bezeichnet. Aber es war ja auch die Scheide zwischen Strand und herrenloser See schwer zu ziehen, und man wird unter Strandfischerei den Fischfang in der Nähe der Küste


|
Seite 98 |




|
verstanden haben 179 ). Darum wohl wählte man in beiden Privilegien eine Umschrteibung: soweit die Fischer den Unbilden des Wetters Trotz zu bieten wagten. In der herrenlosen See stand der Fang ja ohnehin jedermann frei. Auch in den übrigen mittelalterlichen Urkunden über Meeresfischerei, die wir in Teil I angeführt haben, ist nirgends von einer Fischereigrenze seewärts die Rede.
In der Lübecker Fischereiverordnung, meint Rörig, erinnere "der altertümlich anmutende Wortlaut deutlich an die Rostocker Urkunde" von 1252. Wir finden nicht, daß der Wortlaut für das Jahr 1585 altertümlich anmutet, wissen auch nicht, was damit bewiesen werden könnte, daß er zufällig an das Rostocker Privileg erinnert. Ein tatsächlicher Zusammenhang ist doch gar nicht anzunehmen. Und warum sollte der Lübecker Rat seine Fischer nicht verpflichten, außer auf der Trave auch in der See zu fischen? Das konnte um so eher geschehen, als die Lübecker am holsteinischen Strande seit 1252 privilegiert waren (oben S. 23) und man ihnen auch an der mecklenburgischen Küste keine Schwierigkeiten machte. Kann man aus der Stelle der Fischereiordnung etwas schließen, so ist es dies, daß man in Lübeck zwischen "eines erbarn Rats Strom", der Trave, und der See wohl zu unterscheiden wußte.
"Wenn nun," fährt Rörig fort, "die beneficio (!) piscature in Rostock von einem bestimmten Punkte des Warnowlaufs usque in marinis fluctibus (!), soweit die Fischer ihre Hälse wagen wollen, auf eine einheitliche Verleihung zurückgeht, so sind wir berechtigt, die wesentlich knapper gehaltene Urkundenstelle für Lübeck von 1188 einmal mit der auf ähnlichen Voraussetzungen beruhenden Rostocker Verleihung, sodann mit Zeugnissen der späteren Rechtsentwicklung Lübecks in Vergleich zu setzen." Wo aber steht in der Rostocker Urkunde etwas von usque in marinos fluctus? Das Privileg unterscheidet ganz scharf zwischen Warnowfischerei (usque Warnemunde) und Seefischerei (extra portum in marinis fluctibus). In dem von 1323 wird überhaupt nur Seefischerei verliehen. Dieses Privileg darf hier nicht unberücksichtigt bleiben, denn es beweist gerade, daß der Landesherr über Seefischerei verfügte und sie für Rostock nicht "nur insoweit" legalisieren konnte, "als man das in Betracht kommende Gewässer seewärts vom Warnemünder Hafen als Zubehör zur Warnow behandelte". Diese Konstruktion eines Zubehörs zur


|
Seite 99 |




|
Warnow durch Rörig 180 ) hat ihre Wurzel darin, daß er ein Küstengewässer für jene Zeit nicht gelten läßt. Aber gerade das Küstengewässer, der Strand war gemeint.
Die "Parallele mit Rostock", durch die das Barbarossaprivileg im Hinblick auf das usque in mare "noch größere Bedeutung" gewonnen haben soll, besteht überhaupt nicht. Wo sollte der Kaiser auch Meeresfischerei verliehen haben? Der Strand gehörte zu jener Zeit sicher schon den anliegenden Territorialherren. Und auf dem herrenlosen Meer war das Fischen jedermann erlaubt. Wo sind Beispiele einer Verleihung von Seefischerei an der deutschon Küste durch den Kaiser?
Rörig möchte annehmen, daß die Barbarossa-Urkunde in der Fischereigerechtigkeit nur eines der von Lübeck bereits tatsächlich wahrgenommenen Rechte anerkannte. Der Nachweis des Vorhandenseins weiterer Rechte sei allerdings nicht durch das Privileg, sondern durch die Prüfung des Besitzstandes zu führen. "Wenn also das Privileg auch nicht im Sinne einer unmittelbaren Begründung der Hoheit auf der Trave von Oldesloe bis einschließlich des Reedegebiets zu verwerten" sei, so neige er "jetzt der Vermutung zu, daß der wirkliche Rechtszustand um 1188 auf Trave und Reedegebiet über das im Privileg allein erwähnte Fischereirecht hinausging." Das müsse "der Natur der Sache nach problematisch bleiben". Also lohnt es sich auch nicht, auf diese Vermutung einzugehen, für die sich gar keine Anhaltspunkte ergeben. Wo ist denn auch nur der Schatten eines Beweises für eine Lübecker Reede auf der Travemünder Bucht um 1188?
Als Quellenzeugnis, fährt Rörig fort, habe er die Stelle des Privilegs ja nur für den Zusammenhang von Trave und Reede verwendet. Das halte er aufrecht. Indessen glauben wir die Unmöglichkeit dieser Verwendung nachgewiesen zu haben. Was soll man sich überhaupt unter einem solchen "Zusammenhang" vorstellen, wenn die "rechtliche Einheit" nicht gemeint ist? 181 )


|
Seite 100 |




|
Auch die spätere Entwicklung gibt Lübeck keinen Anspruch auf Gebietshoheit am mecklenburgischen Ufer der Bucht.
Nach Rörig hätte sich solche Lübecker Hoheit auf der "Reede" im Anschlusse an den wirtschaftlichen Betrieb, Schiffahrt, Fischerei, entwickelt. Er unterscheidet dabei zwischen dem, was eigentlich die Reede ist, nämlich der Reede im nautischen Sinne, also dem Ankerplatze, und einer Reede im weiteren Sinne, die das gesamte Buchtgewässer (bis ans Ufer) und mehr noch umfassen soll.
Auf die Lübecker Fischerei, in der Rörig eine Betätigung der Gebietshoheit erblickt, werden wir später eingeben. Für die Schiffahrt kommt in Frage das Fahrwasser und die Reede (im nautischen Sinne). Das Fahrwasser, soweit es durch Seezeichen festgelegt ist, nähert sich mehr der heutigen Lübecker Buchtküste und wird von Mecklenburg gar nicht in Anspruch genommen. Durch Maß-


|
Seite 101 |




|
nahmen auf dem Fahrwasser werden also mecklenburgische Rechte nicht betroffen, weil diese Maßnahmen nicht auf die Wasserfläche übergreifen, die als mecklenburgischer Buchtanteil gelten muß. Seit wann aber gab es eine Reede und wo lag sie?
Ein Hafen zu Travemünde ist zuerst 1226 nachweisbar 182 ). Er lag wie noch heute binnen der Travemündung 183 ). Daß es gleichzeitig schon einen Reedebetrieb auf der See gab, ist unwahrscheinlich; denn bei der Kleinheit der Fahrzeuge, die im Lübecker Schiffsverkehr eben dieser Zeit erscheinen 184 ), konnten ungünstige Tiefenverhältnisse des Fahrwassers noch keine Rolle spielen. Hundert Jahre später war es vielleicht schon anders. Denn wenn auch überhaupt im Mittelalter die kleinen Schiffe im Lübecker Verkehr vorgeherrscht haben 185 ) und obwohl eine Travemünder Reede erst seit dem 15. Jahrhundert erwähnt wird 186 ), so dürfte es doch schon um 1329 vorgekommen sein, daß Schiffe auf der Bucht ankerten. Hiermit scheint uns eine Bestimmung der Urkunde, worin Graf Johann von Holstein den Lübeckern Travemünde verkaufte (1329), im Zusammenhange zu stehen; es sollte nämlich zu Travemünde ein Gebietsstreifen von 10 Ruten Breite gehören, der sich am Meere entlang bis zur Brodtener Grenze hinzog und das hohe


|
Seite 102 |




|
Ufer mit umfaßte 187 ). Wir möchten glauben, daß das Gewässer vor diesem Streifen als Reede benutzt wurde und daß es Lübeck darauf ankam, das Ufer dieser Reede zu besitzen, hauptsächlich wohl wegen des Strandrechtes bei Schiffsunfällen. Jedenfalls ist sicher, daß die Reede hier, dicht vor der Travemündung nach der westlichen Buchtküste zu, vielleicht auch noch gegenüber dem Priwall, nicht aber nach der mecklenburgischen Seite hin, jahrhundertelang gelegen hat. So war es 1547, im 17. Jahrhundert und noch 1792 188 ). Diese alte Reede muß ungefähr bis zum Möwenstein am Westufer gereicht haben. Das haben wir schon 1923 vermutet. Es läßt sich allerdings nicht aus dem Fischereivergleich von 1610 erschließen, den Rörig jetzt vollständig abge-


|
Seite 103 |




|
druckt hat 189 ), aber wenn die Lübecker Wettebehörde 1823 von einer etwa beim Möwensteine anfangenden Außenreede sprach 190 ), so muß die Binnenreede, worunter doch wohl die alte nautische Reede zu verstehen ist, sich etwa bis zum Möwenstein erstreckt haben.
Alles, was auf dieser alten nautischen Reede geschah, was Lübeck dort an Maßregeln ergriffen haben mag, geht Mecklenburg nichts an, weil dieser Buchtteil von ihm nicht beansprucht wird, auch auf Grund des Küstenbesitzes nicht beansprucht werden kann.
Die Reede im weiteren Sinne, d. h. eine über die Bucht noch hinausreichende Wasserfläche, hätte nach Rörig 191 ) zu den "Strömen" der Stadt Lübeck gehört und mit ihnen eine rechtliche Einheit gebildet. Der Ausdruck "Strom" sei im 16. und 17. Jahrhundert bevorzugt worden. 1616 erscheine das Wort "Reede" zum ersten Male im weiteren Sinne zur Bezeichnung des ganzen Gewässers bis zum Ufer. Dann finde sich die Doppelbezeichnung "Reede und Strom" (1658), schließlich, im 18. Jahrhundert, werde der Ausdruck "Reede" allein angewendet.
Dabei vertritt Rörig die Meinung, "Strom" bedeute ein Hoheitsgewässer. Das ist zwar nicht der Fall 192 ), ist aber schließlich


|
Seite 104 |




|
einerlei, weil es nicht auf die Bezeichnungen für die Wasserfläche ankommt, sondern auf den Lübecker Anspruch, der sich ja ohnehin in den Quellen kenntlich macht (1616, 1658). Wenn aber Rörig (I, S. 26) sagt: "Durch ihren Charakter als Strom, d. h. als öffentliches, der Gebietshoheit Lübecks unterworfenes Gewässer, ist die juristische Einheit von Reede und Binnentrave gegeben," so muß es statt dessen heißen: Indem Lübeck die ganze Travemünder Bucht für seinen Strom ausgab, erhob es eine Forderung, die von mecklenburgischer Seite bestritten wurde.
1455 verwahrte sich der Wismarer Rat in einem Schreiben an Lübeck gegen den Vorwurf, daß er ein Schiff von der Travemünder Reede 193 ) als feindliches Gut zu Unrecht habe wegnehmen lassen. Lübecker Ratssendeboten hatten die Rückführung des Schiffes verlangt, doch war mit ihnen vereinbart worden, daß die Eigentümer von Fahrzeug und Ladung in Wismar Beweise dafür vorlegen sollten, daß es sich nicht um feindliches Gut handele. Bis dahin hielt Wismar an der Beschlagnahme fest. Es erklärte sich bereit, seine Tat dem Urteil der Hansestädte zu unterwerfen. Ist hiernach anzunehmen, daß Wismar eine Gebietshoheit und Jurisdiktion Lübecks auf der Reede anerkannte?
1516 beschwerten sich die Herzöge Heinrich und Albrecht von Mecklenburg beim Lübecker Rate über den Travemünder Vogt. Sie hätten Nachricht, daß zwei Schuten gestrandet seien, eine am Priwall, die andere bei Rosenhagen, und daß der Vogt "trotziglich zugefaren" sei und die Bergung vorgenommen habe, "alles ungezweifelt on euern Wißen und Willen". Die Herzöge forderten die Rücksendung der gestrandeten Güter und verbaten sich solche Eingriffe "in unserer furstlicken Oberkeit". Der Rat erwiderte, daß nach seiner Erkundigung beide Schuten "up unser Stadt Stromen und Gebede" Schiffbruch erlitten hätten, die eine hart am Hafenbollwerk und dem Priwall, die andere jenseit des Bollwerks auf der Reede. Dann ging der Rat dazu über, Lübecks Recht auf den Priwall zu erörtern. Die Herzöge faßten das zum mindesten sehr mißverständliche Schreiben so auf, daß beide Schiffe am Priwall gescheitert sein sollten, und bestritten dies 194 ). Auf den Gedanken, daß Lübeck das Gewässer vor Rosenhagen zu seiner Reede rechnen könne, ist man in Mecklenburg überhaupt nicht verfallen. Es läßt sich ja auch der Rosenhäger Strand, der von


|
Seite 105 |




|
der Travemündung etwa 3 km entfernt ist, nicht gut als jenseit des Bollwerks gelegen bezeichnen. Weil aber gar kein Zweifel darüber aufkommen konnte, ob ein Schiff vor Rosenhagen oder vor dem Priwall gestrandet sei, die beide nicht aneinander grenzen, sondern durch das Pötenitzer Gebiet getrennt werden, so lagen die Dinge offenbar so, daß Lübeck seinen Vogt decken wollte und den Strandungsort der zweiten Schute absichtlich unbestimmt angab.
Ernstlich war ja auch das mecklenburgische Strandregal gar nicht in Zweifel zu ziehen. Konflikte wegen des Schiffsbergerechtes aber mögen noch häufiger vorgekommen sein, als die Quellen erkennen lassen. Und die Gefahr solcher Konflikte lag in der Travemünder Bucht besonders nahe, weil jede Strandung, die hier geschah, sofort in Travemünde bekannt werden mußte und die Verlockung groß war, Schiff und Gut schnell in Sicherheit zu bringen, bevor die herzoglichen Beamten imstande waren, einzugreifen. Überdies konnten sich die Lübecker auf das Strandrechtsprivileg des Herzogs Albrecht II. von 1351 berufen, das ihnen die selbständige Bergung bei Schiffbrüchen an der mecklenburgischen Küste erlaubte 195 ). Allerdings wollten die Herzöge später solche Freiheiten nicht mehr anerkennen 196 ). Die erbitterten Streitigkeiten mit Magnus II. lagen ja 1516, zur Zeit der Beschwerde über den Travemünder Vogt, noch nicht sehr lange zurück.
Man muß sich diese Verhältnisse vor Augen halten, wenn man die von Rörig angezogene Aussage des Zöllners vor dem Holstentor Hans Tydemann und eines anderen Zeugen, eines Bürgers zu Travemünde, von 1547 beurteilen will, wonach der Lübecker Rat von jeher über Strom und Strand von der Reede bis zur Harkenbeck zu gebieten gehabt habe 197 ). Vernommen wurden die Zeugen (es waren im ganzen acht) darüber, ob Lübeck das Strandrecht am Priwall zustehe. Gegen die Aussage erhebt sich zunächst das Bedenken, daß in ihr zwischen dem Strand am Priwall, wo Lübeck sich das feste Land zuschrieb, und dem Strande von da bis zur Harkenbeck kein Unterschied gemacht wurde. Selbstverständlich aber konnte Lübeck das Strandrecht bis zur Harkenbeck nicht besitzen. Insofern widerspricht der Aussage denn auch das eigene Verhalten des Lübecker Rates, der noch im 17. Jahrhundert das mecklenburgische Strand-


|
Seite 106 |




|
regal am Buchtufer nordöstlich vom Priwall nicht bestritten, sondern sich nur gegen die Auswüchse des Bergerechtes verwahrt hat.
Die Aussage samt der darin enthaltenen Bezeichnung der Harkenbeck als einer Grenze erklärt sich aus zweierlei: aus den Meinungsverschiedenheiten wegen des Bergerechtes und aus dem Lübecker Fischereibetrieb am mecklenburgischen Ufer. Diese Fischerei war nichts weiter als eine hergebrachte Nutzung 198 ). Soweit sie Buchtfischerei war, die gewiß als besonders ergiebig betrachtet wurde und wegen der Nähe der Trave unter besonders günstigen Bedingungen ausgeübt werden konnte, endete sie an der Harkenbeckmündung. Zwar ist die älteste Lübecker Fischereiverordnung, die Rörig anführt und in der die Harkenbeck als Fischereigrenze erscheint, erst von 1585, aber es wird in ihr eine frühere Verordnung von 1557 erwähnt, die in Travemünde ausgehängt war, und die Annahme, daß solche Regelungen der Fischerei schon vor der Zeugenaussage von 1547 vorgenommen waren, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Mehr als eine interne Lübecker Fischereigrenze, und zwar eine von mehreren, ist die Harkenbeckmündung nie gewesen. Allein schon aus dieser Nutzung der Buchtfischerei an der mecklenburgischen Küste bis zur Harkenbeck konnte die irrige Annahme entstehen, daß Lübeck dort die Gebietshoheit habe. Beispiele für solche Verwechselung von Nutzung und Gebietshoheit haben wir oben S. 64 f. angeführt. Zieht man ferner in Betracht, daß an dieser selben Küstenstrecke Übergriffe Lübecks in das mecklenburgische Bergerecht vorgekommen waren - wie der Fall von 1516 lehrt, der vermutlich nicht der einzige geblieben ist-, so wird die Aussage vollends begreiflich. Vielleicht ist gar der Zöllner Tydemann, der früher als Vogt in Travemünde gewirkt hatte, eben der Beamte gewesen, über dessen "trotzigliches Zufahren" die Herzöge sich 1516 beklagt haben. Vom quellenkritischen wie vom juristischen Standpunkte aus ist es unmöglich, die Aussage als einen Beweis für die Lübecker Gebietshoheit zu werten. Mecklenburgische Zeugen und die mecklenburgischen Kommissare in dem Fischreusenstreit von 1616 haben genau das Gegenteil erklärt. Und die Rechtsanschauungen jener Zeit über Strand und Strom des Meeres, wie wir sie im ersten Berichtsteile dargelegt haben, entscheiden vollkommen für Mecklenburg und gegen Lübeck.
Es lassen sich denn auch genügend Fälle nachweisen, in denen das Amt Grevesmühlen (Santow) das Strandrecht an der Strecke


|
Seite 107 |




|
bis zur Harkenbeck ausübte. Im Archivbericht vom 12. Mai 1922 199 ) haben wir Zeugenaussagen zusammengestellt, die bei Gelegenheit des Fischreusenstreites von 1616 über Bergungen durch das Amt gemacht wurden, und einige weitere Fälle aus den Strandrechtsakten hinzugefügt. Rörig (II, S. 267 f.) verwertet diese Angaben, indem er sagt: "Sind die Fahrzeuge am Mecklenburger Strande Âangeschlagen', so daß vom Strand aus die Bergearbeiten vollzogen werden konnten, dann ist den Mecklenburger Beamten ein Bergegeld zu zahlen. Strandet aber, wie 1665, eine lübische Schute Âfast kegen Travemünde über unter Pötenitze' und liegt sie zu weit vom Lande entfernt, so berichtet der Santower Amtmann: es sei nicht möglich gewesen, sie zu bergen und die mecklenburgische Strandgerechtigkeit zu wahren. Sie sei dann von Travemünde aus gelöscht und geborgen worden." 200 ). Nun bezieht sich aber das aus dem Zeugenprotokoll von 1616 zitierte Wort "angeschlagen" nur auf Holz, das von einem etwa 1596 "uf der Reide zu Travemunde" gesunkenen Prahm weggeschwemmt war, und auf eine um 1604 bei Rosenhagen angetriebene Leiche. Überhaupt verwendet das Protokoll meistens den Ausdruck "stranden", mit dem "anschlagen" gleichbedeutend ist. Güter, die aus verunglückten Schiffen stammten, sind gewiß häufig auf den trockenen Strand oder dicht ans Ufer geworfen worden. Wie weit vom Lande aber die Fahrzeuge gelegen hatten, die von den Zeugen 1616 erwähnt wurden - darunter zwei Schuten, die über 30 Jahre früher am Harkenseer (Rosenhäger) Felde gestrandet waren -, läßt das Vernehmungsprotokoll gar nicht erkennen. Eine Ausnahme macht höchstens ein großer, am Priwall gescheiterter Spanienfahrer; das Holz dieses Schiffes war zerschlagen und verkauft worden, der Kiel bei niedrigem Wasser noch zu sehen. Auch sonst ergibt sich aus den Aussagen, daß die mecklenburgischen Beamten das Bergerecht am Priwall ausgeübt hatten. Wenn dort Schiffe oder Waren strandeten, erhoben sich aber für gewöhnlich Streitigkeiten mit Lübeck, und zwar Streitigkeiten gebietsrechtlicher Art, weil beide Parteien den Priwall beanspruchten, auf den Mecklenburg erst 1803 verzichtete, als es infolge des Reichsdeputationshauptschlusses die Lübecker Hospitaldörfer im Lande erhielt. Östlich vom Priwall war das Bergerecht nur deswegen


|
Seite 108 |




|
strittig, weil die Städte es als nutzbringendes Regal überhaupt nicht anerkannten, weder an der mecklenburgischen Küste noch anderswo.
Den Fall von Pötenitz im Jahre 1665 haben wir in der Anlage III, Nr. 2, wiedergegeben. Daß Rörigs daraus geschöpfte Meinung über die räumliche Begrenzung des Strandrechts nicht richtig ist, zeigt deutlich eine Vergleichung mit dem Strandungsfall von 1662 (Nr. 1 der Anlage). Man hatte eben auf mecklenburgischer Seite keine geeigneten Boote zur Hand, höchstens kleine Fischerboote, die bei Sturm nicht brauchbar waren, wie 1728 erklärt wurde (oben S. 41). Auch 1762 hat niemand gewagt, an ein bei Arendsee gescheitertes Schiff heranzufahren (Anl. III, Nr. 4).
Außer über die beiden schon erwähnten Schuten, die um 1585 Schiffbruch erlitten, wurde das mecklenburgische Strandrecht an der Strecke vom Priwall bis zur Harkenbeck 1658 über ein Fahrzeug ausgeübt, das ebenfalls vor Rosenhagen aufgelaufen war 201 ).
Aus den Akten über einen Fall von 1660 will Rörig (II, S. 266) nehmen, daß das Strandrecht nur in Kraft getreten sei, wenn man an die gescheiterten Schiffe habe heranreiten können. Es ist dies das einzige Zeugnis für die von ihm angenommene Reitgrenze 202 ), das er aus dem Lübecker Archiv vorgebracht hat. Aber er hat seine Quelle mißverstanden. Nach der uns erteilten Abschrift des betreffenden Aktenstückes handelt es sich um einen Bericht aus Travemünde, den ein Hinrich Schulte, in dem wir den Travemünder Vogt zu erblicken haben werden, dem Lübecker Rat am 20. November 1660 erstattete. Der Bericht geht auf einige damals geschehene Strandungsfälle ein und handelt besonders von zwei in der Bucht vor Rosenhagen gesunkenen Schiffen. Am Tage vorher seien Segel und "Tregge" (wohl Tauwerk) von den Schiffen "anhero" (d. h. nach Travemünde) geholt worden. Der Herzog von Mecklenburg 203 ) habe zwei Einspänner, nach heutigem Begriff berittene Gensdarmen, geschickt, um zu fragen, warum man ihm Gewalt antue und von den Schiffen, die auf herzoglichem "Grunt und Bodden" lägen, etwas abhole. Der


|
Seite 109 |




|
Vogt hatte erwidert, daß im Gegenteil die Mecklenburger Gewalt geübt hätten, durch Wegnahme gestrandeter Branntweinfässer, was "wyder Gott und alle Landesrechten" sei.
"Ja, wen man in Barbarien queme, kunte kenen Christen ken Argers wyderforen. Wat den Schypen anlanget, sytten up 3 Faden (5,4 Meter) Water gesuncken, dat Holt is darinne leyder Gottes vorwedert, mit einen Perde kan man dar ock nicht by ryden, wat afthohallen (abzuholen). De Schipers befinden syck mit ihren Folckeren tho Schepe, bergen ihre Sygel (Segel) und Tregge, worzu wir ihnen von hyr af christlicher Lybbe nach ihren Begeren mydt sehfarende Lutte (Leute) werden und musen (müssen) behulplich syn. Den (denn) Ruters (Reiter) und Buren (Bauern) werden up den Schiffen nichtes nutze, de werden man vor dodde Lute (also als überflüssig) up den Schifen angenahmen, worup de beiden Einspenner wyder ihren Wech gereyset, sagende, I. F. G. wurden hutte ock sych by den Schiffen fynden lasen." 204 ).
Von einer Strandgrenze ist hier gar nicht die Rede, sondern der Vogt wollte sagen: Die Schiffe liegen in einer Tiefe von drei Faden. Zur Bergung braucht man Boote und sachverständige Seeleute. Wollt ihr etwa mit Euren Pferden (auf denen ja die beiden Einspänner gekommen waren) die Bergung vornehmen? Reiter und Bauern sind dabei nichts nutze.
Hierzu stimmt denn auch das im Schweriner Archiv vorhandene Protokoll vom 20. November über die Untersuchung der Strandungsfälle durch den Herzog selbst. Es heißt darin: "Weiter hin," (hinter einem nahe am Lande liegenden Boote) "etwan ein groß Mousqueten-Schuß, lagen 2 große tieffahrende Schiffe, welche von dem Wind zerschlagen und in Sand gesetzet worden. Sie seynt zwar zimlich weit in dem Wasser gestrandet, sie scheinen aber noch auf dem Uffer und Strande zu liegen, und kann man nicht alß mit Kahnen oder Boten, deren aber keines vorhanden gewesen, zu ihnen kommen." Man hatte also auf mecklenburgischer Seite in der Tat keine Boote zur Stelle.
Auf eine Beschwerde des Herzogs antwortete Lübeck am 23. November 1660. Diesem Schreiben entnehmen wir das folgende:


|
Seite 110 |




|
"Ob nun wohl den 16. dieses abermahl Schiffe im großen Sturmwinde zu Unglück kommen und nicht auf dem unsern" (d. h. nicht am Priwall) "angetrieben, sondern an Seiten E. F. Durchl. Lande beschädiget, so sind sie doch nicht an den Strandt kommen, sondern drey Klafter tief in See geblieben. Und die Böete und Gütter, so den Strandt berühret, sind billig loß gegeben 205 ), also daß keine Strandtgerechtigkeit mag praetendiret werden, sondern E. F. Durchl. ist bekannt, das für dergleichen Gütter nichts als ein billiges Barggeldt oder Arbeitslohn an diejenige, so die Gütter bergen helfen, darf abgestattet werden, und die Obrigkeit deß Orths sich nicht darbey zu interponiren hat." Folgt diesmal eine Berufung auf Cod. 11, 5: De naufragiis.
Also wieder wies Lübeck, wie so oft, darauf hin, daß das Strandrecht als nutzbares Regal nicht ausgeübt werden dürfe. Warum aber sagte es nicht einfach: Nur soweit steht euch der Strand zu, als ihr hineinreiten könnt? Einfach deswegen, weil es solche landesherrliche Strandgrenze nicht gab. Dagegen machte der Rat darauf aufmerksam, daß die Schiffe in einer Tiefe von 3 Klaftern oder Faden (5,4 m) geblieben seien. Solche Tiefe gehörte denn auch nicht mehr zum Strande, sondern schon zum schiffbaren Meer. Ist die Angabe Lübecks richtig, so waren die Schiffe eben nicht aufgelaufen, sondern gesunken. Diesen Ausdruck gebrauchte ja auch der Travemünder Vogt. Wie wir sahen, hatte man auf mecklenburgischer Seite selber Zweifel gehabt, ob das Strandrecht in Kraft trete. Und daß der Herzog hernach eine Hundert-Meilen-Grenze geltend machte, die in der völkerrechtlichen Theorie der Zeit eine Rolle spielte 206 ), war unhaltbar, weil sie mit dem praktischen Rechte nichts zu tun hatte.
Es steht also für 1660 durchaus nicht, wie Rörig meint, "fest, daß Lübeck einen Strandrechtsfall im Rahmen der mecklenburgi-


|
Seite 111 |




|
schen Kompetenz nur anerkannte, wenn das gestrandete Schiff vom Ufer her reitend erreicht und die Ladung auf diese Weise, nicht mit Booten, geborgen werden konnte." Sondern wenn aus dem Fall von 1660 auf eine Strandgrenze geschlossen werden kann, so ist es gewiß die bis zum schiffbaren Strom. Wir besitzen manches Schreiben Lübecks über Strandrecht und Strandungen, in der Travemünder Bucht sowohl wie anderswo an der Küste, haben aber nie das mindeste über eine Reitgrenze darin gefunden, weder in Lübecker Briefen noch in denen anderer Städte. Und daß man in der Tat mit Booten an gescheiterte Schiffe heranfuhr, um das Bergerecht auszuüben, geht aus den oben S. 39, 41 ff. und in der Anlage III beigebrachten Beispielen hervor. Auch 1660 würde man sich auf mecklenburgischer Seite der Boote bedient haben, wenn welche zur Verfügung gestanden hätten. Das lehrt ja das erwähnte Protokoll vom 20. November. Wie sollte man auch anders verfahren? "Reitend" war niemand imstande zu bergen. Höchstens konnte man Wagen benutzen, wenn ein Schiff nahe genug am Ufer lag.
Es ist gar nicht so, daß der Fall von 1660 Gelegenheit "zur Erörterung der Abgrenzung der gegenseitigen Hoheitssphären" gab; denn es handelte sich ganz allein um die Reichweite des mecklenburgischen Strandregals. Nach Rörig hätten beide Parteien in dem sich anschließenden Briefwechsel ihren alten Standpunkt verlassen. Das kann man aber nur von dem Herzoge sagen, weil er die Hundert-Meilen-Grenze ins Feld führte, während Lübeck nur die Rechtsanschauung betonte, die seit Jahrhunderten von den Städten verfochten wurde. Hervorzuheben aber ist, daß der Lübecker Rat erklärte, die Schiffe seien "nicht auf dem unsern" angetrieben; denn wenn auch hiermit ein Gegensatz zwischen dem Priwall und der mecklenburgischen Küste bezeichnet werden sollte, so hätte doch der Rat diese Wendung kaum gebrauchen können, wenn er sich damals dem Herzoge gegenüber die Gebietshoheit auf der Bucht, wo die Schiffe lagen, hätte zuschreiben wollen.
Den mecklenburgischen Anspruch auf die Hundert-Meilen-Zone mochte der Lübecker Rat getrost "ignorieren". Wenn er aber, wie Rörig angibt, gleichzeitig beschloß, dem Herzoge "höchstens gelegentlich einmal ein kaiserliches Mandat zu übersenden", so würde ein solches Mandat gewiß nicht das Strandregal überhaupt geleugnet, sondern eben nur daran erinnert haben, daß die rücksichtslose Ausübung des Bergerechtes durch Reichsgesetze untersagt sei.


|
Seite 112 |




|
Daß der Strand, gerade auch in der Travemünder Bucht, sich bis zur schiffbaren See erstreckte, haben 1616 bei dem Fischreusenstreit mit Lübeck die mecklenburgischen Kommissare sowohl wie die elf von ihnen vernommenen Zeugen erklärt 207 ). Wir verweisen noch auf eine Nachricht von 1792. Damals war ein Schiff dicht vor Travemünde auf der Reede gekentert, nicht gestrandet. Der mecklenburgische Strandreiter gab zu Protokoll, es "läge unter den auf der Rheede liegenden Schiffen, wohl 400 Schritte vom Lande innerhalb der Tonne, oder von hier zu rechnen, jenseit der Tonne, so daß zwischen dem Ufer und dem Schiffe die Tonne deutlich zu sehen wäre". Bezeichnenderweise forschte der Grevesmühlener Amtmann noch einmal nach, "ob er seiner Sache gewiß wäre, daß das Schiff über die Tonne hinaus läge". Denn jenseit der Tonne war kein Strand mehr, sondern Fahrwasser. Und als der Strandreiter bei seiner Aussage blieb, so galt damit als bewiesen, daß das Strandrecht nicht in Frage komme. Auch der Travemünder Hafenhauptmann hatte (nach Angabe des Strandreiters) "geäußert, daß, da das Schiff innerhalb der Tonne auf dem Lübschen Fahrwasser läge, das Amt (Grevesmühlen) daran keine Ansprache machen könne" 208 ).
Es ist also gar kein Zweifel, daß Mecklenburg sein Strandrecht in der Travemünder Bucht bis zum tiefen Meeresstrom oder der "Düpe" (oben S. 68) vertreten hat.
Nun aber beruft sich Rörig auf Lübecker Hoheitshandlungen, die unmittelbar vor der mecklenburgischen Küste vorgenommen seien. Wir gehen hier ein auf das Fahrrecht, die gerichtliche Leichenschau bei unnatürlichen Todesfällen. Nach Rörig 209 ) ließen die Lübecker 1615, 1792 und 1799 den mecklenburgischen Strand vor Rosenhagen nach Ertrunkenen absuchen und die Leichen nach Travemünde schaffen; 1804 sei das Suchen nach einem Verunglückten ergebnislos geblieben.
Über den Fall von 1615 besitzen auch wir Akten 210 ). Weil Rörig sich auf ihn besonders beruft, müssen wir näher darauf eingehen. Ein Schneider Hans Dechow aus Harkensee fing am Rosenhäger Strande zusammen mit der Tochter des Harkenseer Bauern Veldtmann Krabben. Dabei sah er eine Leiche im Wasser treiben, holte sie weiter ans Ufer und band sie an zwei großen Steinen fest. Am übernächsten Tage stellte sich heraus, daß die Lübecker


|
Seite 113 |




|
frühmorgens den Leichnam abgeholt hatten. Dann erfuhr der Gutsherr von Harkensee und Rosenhagen, Jürgen von Bülow, der verreist gewesen war, nach seiner Rückkehr von dem Vorfall, erstattete alsbald dem Hauptmann des Amtes Grevesmühlen Meldung, und auf dessen Bericht hin beschwerte sich der Herzog Adolf Friedrich beim Lübecker Rate wegen Verletzung seiner Strandgerechtigkeit.
Der Rat ließ den Travemünder Vogt, der die Abholung der Leiche angeordnet hatte, und seinen Beauftragten vernehmen. Der Vogt sagte aus, es sei ihm von dem Bauern Veldtmann aus Harkensee angezeigt worden, daß ein toter Körper in der See treibe. In der Vermutung, daß es sich um einen kurz vorher bei Travemünde ertrunkenen Lübecker Schiffskoch handele, habe er Befehl gegeben, die Leiche zu holen, wenn sie in der See treibend vorgefunden würde. Sein Beauftragter bestätigte dies; er habe den Toten nach Travemünde bringen sollen, "darmit er konte begraben werden, dieweil er lubscher Burger gewesen", und als er mit seinem Kahn "dißeit der Fischzuge, da die lübischen Fischer ihre Heringsnetze auszuwerfen pflegen", angekommen sei, habe er die Leiche im Meere treiben sehen und mitgenommen.
Das Protokoll hierüber schickte der Lübecker Rat an den Herzog. Jedoch war ihm bei der Angelegenheit augenscheinlich nicht wohl zumute, wie der beschwichtigende Ton des Begleitschreibens erkennen läßt: Da es sich nach den Travemünder Aussagen anders verhalte, als dem Herzoge berichtet sei, "so werden doch E. F. G. uns verhoffentlich nicht vordencken, insonderheit weil des Bülowen Leute unserm Voigt selber angetzeiget, das der Cörper in der Sehe triebe, des Vogts Diener ihn auch loßtreiben und nirgend angebunden gefunden, das derselbe beschehener Maßen zur Erde bestetiget (bestattet) worden. Und pitten demnach E. F. G. wir dienstlich, Sie wollen diß Werck nicht anderß alß im besten, wie es gemeinet, gnediglich aufnehmen".
Hierauf wurde in Harkensee ebenfalls ein Zeugenverhör veranstaltet. Dabei gab der Schneider Dechow an, er habe die Leiche im etwa knietiefen Wasser, wo sie grundrührig gewesen sei, befestigt. Die übrigen Zeugen wußten nur von Hörensagen, daß Dechow den Toten näher ans Land geholt und festgebunden habe. Auf Grund dieser Angaben bestritt der Herzog die Lübecker Erklärungen und verlangte abermals, "ihr wollet nicht allein die Theter mit gebührlicher Straff belegen, sondern auch euch gegen unß reversieren, das unß dieser actus an unser der Orther


|
Seite 114 |




|
habenden unstreitigen Hoch- und Strandtgerechtigkeit unvorfengklich sein soll".
Vielleicht hatte die Leiche sich von den Steinen gelöst und war dann wieder weggespült worden. So könnte sich der Widerspruch zwischen den Travemünder und Harkenseer Zeugenaussagen in der Frage der Landrührigkeit erklären. Eine weitere Unstimmigkeit liegt darin, daß der Vogt von dem Bauern Veldtmann gehört haben wollte, der Leichnam treibe im Meere, während Veldtmann in Harkensee behauptete, er habe dem Vogt zwar "von dem thoten Cörper gesaget", aber auch mitgeteilt, was ihm über dessen Festbindung von seiner Tochter erzählt worden sei. Allerdings möchte der Bauer sich etwas ungewiß ausgedrückt haben; denn er war kein Augenzeuge und seine Tochter offenbar noch ein Kind, wie sich daraus schließen läßt, daß sie in Harkensee nicht mit vernommen wurde. Jedenfalls war der Vogt sich seiner Sache nicht sicher gewesen und hatte auf alle Fälle den Bootsmann ausgeschickt, aber Anweisung gegeben, die Leiche liegen zu lassen, wenn sie landrührig sei, was ja angenommen werden mußte, wenn die Erzählung von Veldtmanns Tochter zutraf. Übrigens klagte der Bauer bei der Vernehmung sehr darüber, daß ihm die rechtliche Bedeutung des Ereignisses unbekannt gewesen sei; "sonsten er davon kegen dem Voigte woll kein Wort wolte verlohren haben".
Aus den Akten über diesen Fall entnimmt Rörig, daß Lübeck, kraft einer ihm zustehenden Gebietshoheit auf dem Buchtgewässer, das Fahrrecht über Leichen ausgeübt habe, die "unmittelbar vor der mecklenburgischen Küste" trieben. Unmittelbar? Nach der Aussage des Travemünder Bootsmannes hatte dieser die Leiche "diesseit der Fischzüge" gefunden, wo man die Netze auswarf, also sicher im tiefen Wasser, im Strom. Der Strom aber war herrenlos, woraus folgt, daß jedermann dort Leichen bergen konnte. Überdies ist nirgendwo in den Akten von einer Lübecker Gebietshoheit die Rede, sondern der einzige, ausdrücklich angegebene Grund für die Einholung des toten Schiffskochs war der, daß es sich um einen "lübschen Bürger" handelte, den man "begraben" wollte.
Für Mecklenburg dagegen ergebe sich nach Rörigs Ansicht, daß ihm das Fahrrecht auf Grund der Strandgerechtigkeit nur über Leichen zugestanden habe, die grundrührig waren oder sich doch im Waten erreichen und grundrührig machen ließen, wie es 1615 geschah. Auf die Watgrenze ist er deswegen verfallen, weil der Schneider Dechow an den Toten herangewatet war. Wir haben dieser Abgrenzung des Fahrrechtes widersprochen. Gewiß,


|
Seite 115 |




|
es wird in dem Harkenseer Zeugenprotokoll wiederholt gesagt, daß Dechow gewatet sei, wie man ja das Gehen im Wasser zu bezeichnen pflegt. Aber daß Rörig dem eine rechtliche Bedeutung beimißt, begreifen wir nicht. Denn das Protokoll ergibt ja klar, weswegen die Zeugen das Waten, und zwar zusammen mit der Tätigkeit des Krabbenfangens, die Dechow ausgeübt hatte, hervorhoben. Sie wollten nämlich damit die Lübecker Behauptung widerlegen, daß die Leiche dort gefunden sei, wo die lübischen Fischer ihre Heringsnetze auswürfen, also weiter draußen in der See, wo man nicht mehr waten und Krabben fangen konnte. Das sagten die Zeugen mit deutlichen Worten.
Rörigs Watgrenze für das Fahrrecht gab es ebenso wenig wie seine Reitgrenze fürs Bergerecht. Nur eine Strandgrenze kannte man, und sie lag dort, wo die schiffbare See anfing. Bis dahin war Küstengewässer, das der Jurisdiktion des Küstenherrn unterstand. Daher müssen auch Leichen, die in diesem Gewässer gefunden wurden, derselben Jurisdiktion unterworfen gewesen sein, mochten sie nun treiben oder den Grund berühren. Übrigens können grundrührige Leichen natürlich so tief liegen, daß im Waten nicht mehr heranzukommen ist.
Nach dem Harkenseer Zeugenprotokoll ist nicht zu bezweifeln, daß der tote Schiffskoch noch trieb, als man seiner zuerst ansichtig wurde. Auch Rörig nimmt das an 211 ). Wenn aber dann bei der Untersuchung des Streitfalles in Mecklenburg hervorgehoben wurde, daß der Leichnam hernach festgebunden worden sei, und die herzogliche Regierung anordnete, die Zeugen auch hierüber (nicht etwa wegen einer Watgrenze) zu befragen, so versteht sich dies von selbst. Denn nur durch die Befestigung und die Landrührigkeit - der Ausdruck ist aus dem Schiffsbergerecht übernommen- ließ sich sicher beweisen, daß die Leiche im Küstengewässer gelegen hatte. Sonst hätte es von vornherein keinen Sinn gehabt, die Lübecker Angaben zu bestreiten. Denn wohin konnte nicht eine treibende Leiche in zwei Nächten und einem Tage verschlagen werden! Soviel Zeit war nämlich zwischen der Festmachung und der Wegholung durch den Travemünder Bootsmann verstrichen. Eben die Aussage des Bootsmannes, daß der Tote in der See getrieben habe, wies der Herzog in seinem zweiten Schreiben an den Lübecker Rat zurück und fügte hinzu, daß er "fast am Ufer des Landts" (also sicher im Küstengewässer) "gefunden und mit


|
Seite 116 |




|
zweyen Steinen fest und grundtruhrig gemacht worden, dahero dan leichtsamb abzunehmen, das derselbe von dar sey abgeholet".
Es ist ja ganz ausgeschlossen, daß Mecklenburg 1615 eine Hoheit Lübecks über das Buchtgewässer vor seiner Küste habe anerkennen wollen. Denn gleich im nächsten Jahre (1616) und ebenso bei den oben erwähnten Strandungsfällen von 1660 und 1792 hat es sein Strandregal bis zur schiffbaren Meerestiefe beansprucht, und zwar mit vollem Recht. Auf diese selbe Strandgerechtigkeit, die etwas ganz anderes war, als Rörig darunter versteht, beriefen sich auch das Amt Grevesmühlen und der Herzog Adolf Friedrich 1615.
Gesetzt den Fall, daß die beiden Bedingungen für das mecklenburgische Fahrrecht (Grundrührigkeit und Watgrenze), die Rörig annimmt, zuträfen und daß Mecklenburg, wie Rörig ebenfalls glaubt, sie anerkannt und sich danach gerichtet habe, so wäre die natürliche Folge, daß dieselbe Regel für die ganze offene Küste gegolten hätte. Denn die Küste der Travemünder Bucht war offene Küste. Als ein Haff ist die Bucht nie angesehen worden 212 ), und noch viel weniger ist sie mit einem reinen Binnengewässer wie dem Dassower See zu vergleichen, zu dem Rörig sie in Parallele bringen will. Niemals hat Mecklenburg auch nur den geringsten Unterschied zwischen seinem Strande an und in der Travemünder Bucht und dem weiter östlich liegenden gemacht. Wenn also die von Rörig angegebenen Fahrrechtsbedingungen tatsächlich bestanden hätten, so würden Tote, die vor der offenen Küste trieben, keinerlei Jurisdiktion verfallen sein, bis man sie watend erfassen und grundrührig machen konnte. Mithin hätte dort jedermann


|
Seite 117 |




|
treibende Leichen einholen dürfen, einerlei, ob aus dem Strom oder dem Küstengewässer; eine Handlung, die natürlich nicht auf Grund von Gebietshoheit geschehen wäre.
Aber die Dinge lagen anders. Und die einzige Voraussetzung für das mecklenburgische Fahrrecht war die, daß die Leichen innerhalb der Strandgrenze geborgen wurden, wie es 1615 der Fall war. Ausdrücklich auf dem Meere (in mari circumquaque), d. h. auf dem Küstengewässer, wurde Rostock 1358 die volle Gerichtsbarkeit verliehen (oben S. 12). Aussdrücklich sagte der Kanzler Schlüter 1669, das mare adiacens unterstehe derselben Jurisdiktion wie die litora maris (oben S. 83). Ferner erklärte 1760 der Schweriner Regierungsfiskal, soweit das Strandrecht gehe, so weit könne auch "die darinnen begriffene iurisdictio littoralis tam civilis quam criminalis exerciret werden" (oben S. 69). Und auch im rügischen Landrecht heißt es, daß die Gerichtsbarkeit auf dem Strande, und zwar "upme lande und water" von den fürstlichen Beamten ausgeübt werde (oben S. 16, 66). Zur Gerichtsbarkeit aber gehörte auch das Fahrrecht.
Jenseit des Strandes dagegen, aus dem tiefen Meeresstrom, über den niemand zu gebieten hatte, durfte jeder Leichen bergen. So war es auch in der Travemünder Bucht. Solche Fälle sind überhaupt keine Anzeichen für eine Gebietshoheit, auch nicht Lübecks. Das gilt sicher noch für viel spätere Zeit als 1615. Denn noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird immer nur das Strandregal, die Strandhoheit geltend gemacht 213 ), vom modernen Küstenmeer ist da noch gar nicht die Rede. Ob aber eine Leiche innerhalb des Strandes oder schon im Strom gefunden war, darüber mochte man hinterher streiten; deswegen betonte Mecklenburg 1615 die Landrührigkeit.
Der Fall von 1615 gibt in der Tat für Lübeck "nichts her". Von den Berichten über die drei weiteren Fälle am mecklenburgischen Ufer, die Rörig anführt, haben wir Abschriften vom Lübecker Archiv erbeten und erhalten.
l) Am 6. Dezember 1792 gaben zwei Travemünder Fischer an, daß am Tage vorher etwa um 8 Uhr abends ein Zimmermann und ein Matrose nach einem auf der Reede liegenden Schiffe hätten fahren wollen. Ihr Boot sei bei einem Hagelschauer gekentert, der Zimmermann ertrunken. Der Matrose habe sich "auf einen Waßer-Vas, so sie im Both gehabt, gerettet und sey damit an der mecklenburgischen Küste nach Rosenhagen getrieben, allwo sie ihn


|
Seite 118 |




|
heute gefunden und wieder am Bord seines Schiffes gebracht hätten, von ihm hätten sie den vorstehenden Bericht erhalten, worauf sie weiter an der Küste gesuchet und den todten Körper auch gefunden hätten." Wo er gefunden wurde, ob bei Rosenhagen, Pötenitz oder am Priwall, ob überhaupt vor der Harkenbeckmündung, ob im Wasser oder am Lande, darüber sagt der Bericht nichts. Wohlgemerkt, die Nachsuchung fand am Tage nach dem Unglücksfalle statt. Wäre der Tote ebenfalls bei Rosenhagen angetrieben, so würde ihn wohl sein Begleiter schon gefunden haben. Auch könnte die Leiche, wie es 1615 vermutlich der Fall war, über Nacht wieder weggeschwemmt sein.
2) Bericht des Stadthauptmannes Dr. Sibeth in Travemünde vom 8. August 1799: "Bey einem gestern Nachmittag gegen 2 Uhr plötzlich sich erhobenen Gewitter entstand ein fürchterlicher Wirbelwind, der die Wellen so sehr in die Höhe trieb, daß man eine gute Viertelstunde nichts als Dunstkreis und schäumende Wogen wie Nebel vor Augen hatte. Eben dieser Wirbelwind schlug eine ungeheure Menge Wassers gewaltsam über das mit Steinen beladene, ziemlich weit hinaus auf der Rhede bey Rosenhagen befindliche Wadeschiff her, worauf sich zweene hiesige Arbeitsleute befanden, deren einer sich am Maste festhielt, der andere aber, Namens Hans Asmus Timmermann, durch Sturm und wütende Wellen aus dem versunkenen Fahrzeuge weggeschleudert ward." Die Auffindung der Leiche wird durch die Worte angedeutet: "Um 6 Uhr kamen die Fischer mit ihm ans Land." Aber wo der Tote gefunden wurde, darüber steht in dem Bericht kein Wort. Das Wadeschiff kann mitten auf der Bucht, in der Höhe von Rosenhagen, gelegen haben, und die Fundstelle braucht überhaupt nicht am mecklenburgischen Ufer gewesen zu sein.
3) 1804 stürzte "bei der jetzigen Bearbeitung des Kavelmacherschen Schiffes" ein Matrose ins Wasser und ertrank. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Wo das Schiff, ein Wrack, lag, geht aus dem Bericht über diesen Fall nicht hervor. Das Lübecker Archiv hat uns aber zugleich zwei Wetteprotokolle vom 18. und 25. November 1825 mitgeteilt, mit deren Hilfe sich die Lage ermitteln lasse. Auf das erste davon habe Rörig bereits in einem früheren Bericht hingewiesen.
Beide Protokolle handeln von Streitigkeiten der Travemünde Fischer mit den übrigen Lübecker Fischergruppen. In dem vom 18. November werden Vergleichsvorschläge angegeben, wobei die "Stelle, wo Kavelmachers Schiff gesunken", eine Rolle spielte. Es sollten nämlich auf dem Gewässer vom Blockhause vor der Trave-


|
Seite 119 |




|
mündung bis zur Harkenbeck zwei Reviere vereinbart und die Rechte der Parteien darin festgesetzt werden. Über die Grenze zwischen den beiden Revieren aber konnte man sich nicht verständigen. Die eine Partei wollte sie durch das Wrack, die andere durch Rosenhagen bestimmt wissen. Daher beschloß man, zunächst einmal auszumessen, wieviel die Entfernung zwischen diesen beiden Punkten betrage.
Hieraus läßt sich zunächst nur entnehmen, daß das Wrack irgendwo in der Bucht und nicht gegenüber Rosenhagen lag.
Nach dem zweiten Protokoll zeigten die Parteien an, daß sie "die verschiedenen Strecken vom Blockhause bis Harkenbeck laut producirter Zeichnung gemeinschaftlich ausgemessen" hätten. Die Entfernungen machten aus:
| "vom Blockhause bis Kavelmachers Wrack | 735 | Faden | |
| von da bis an den Major hinterm Brodener Ufer | 135 | Faden | |
| vom Major bis Rosenhagen | 1155 | Faden | |
| von Rosenhagen bis Harkenbeck | 780 | Faden | |
|
|
|||
| Zusammen | 2805 | Faden | |
Die Zeichnung wird nicht mehr vorhanden sein. Nach dem Protokoll betrug die Strecke vom Blockhause bis zum Wrack 735 Faden (= 1323 m, den Faden zu 1,8 m gerechnet), die Strecke von da bis zur Harkenbeck im ganzen 2070 Faden (= 3726 m). Danach muß das Wrack sich 1825 fast genau gegenüber der heutigen mecklenburgisch-lübeckischen Staatsgrenze am Priwall befunden haben. Nach Rörig 214 ) war es "an der mecklenburgischen Küste zwischen Priwall und Rosenhagen bei Pötenitz gestrandet, wird 1825, Wetteprotokoll November 18, dort liegend erwähnt und ist noch heute bei niedrigem Wasser deutlich erkennbar". Wo nun das Wrack oder seine Reste heute auch sichtbar sein mögen, es kann seine Lage seit dem Jahre 1804, in dem der Matrose ertrank, verändert haben. Rörig fügt hinzu: "Die Lübecker Fischer suchen den mecklenburgischen Strand nach ihm (dem Ertrunkenen) ab." Der Bericht des Travemünder Stadthauptmannes von 1804 sagt aber nur: "Man hat ihn gleich nach Möglichkeit, aber vergeblich, aufgesucht. Die Fischer waren erst wegen ihres Fischens abwesend. So wie sie zu Hause kamen, ließ ich ihnen die fernere Nachsuchung des Körpers anbefehlen. Aber auch diese kamen ohne denselben zurück, doch glaubten sie, daß sie nächster Tagen, wenn das Wasser


|
Seite 120 |




|
erst klarer geworden wäre, ihn finden würden." Man vermutete also die Leiche gar nicht am Strande, sondern im tieferen Wasser.
Von diesen drei Fällen scheidet der von 1799 ohne weiteres aus, weil gar nicht zu wissen ist, wohin die Leiche getrieben wurde, was ganz auf die Strömung ankommt. Ebenso der Fall von 1804, weil überhaupt nichts gefunden wurde. 1792 wurde an der östlichen Buchtküste gesucht; ob man aber den Toten noch am mecklenburgischen Strande fand, wird nicht angegeben. Und das bloße Suchen ist noch keine Fahrrechtshandlung.
Was wollte es übrigens besagen, wenn die Lübecker wirklich einmal nach einem Unglücksfalle auf der Bucht einen Ertrunkenen vom mecklenburgischen Gebiete weggenommen hätten! Wäre in Mecklenburg etwas davon bekannt geworden, so würde gewiß Einspruch erhoben sein, wie es 1615 geschah.
Es steht denn auch fest, daß die herzoglichen Beamten in mindestens drei Fällen das Fahrrecht über Ertrunkene abgehalten haben, die an der Küstenstrecke von der Travemündung bis zur Harkenbeck geborgen wurden: um 1576, um 1604 und 1757. In den beiden ersten Fällen, die mecklenburgische Zeugen 1616 - bei dem Fischereistreit mit Lübeck - erwähnten, handelte es sich um einen Harkenseer Einwohner, der bei der Travemünder Fähre ertrunken und "uf dem fulen Orte", wie man die Nordwestspitze des Priwalls nannte 215 ), wiedergefunden war, ferner um eine bei Rosenhagen "angeschlagene" Leiche. 1757 lag der Tote, ein Lübecker Kaufmannsdiener, bei Rosenhagen "am Ufer im Wasser" 216 ).
In den Fällen von ca. 1604 und 1757, meint Rörig, stehe die Grundrührigkeit außer Zweifel 217 ). Für den von 1757 ist sie allerdings anzunehmen. Der Fall von 1604 wurde von einem Rosenhäger Zeugen vorgebracht, der zwei Nächte bei der Leiche gewacht und auch an der eigentlichen Fahrrechtshandlung teilgenommen hatte. Den Ausdruck "anschlagen" aber, der in dem Protokoll steht und den der Zeuge selber gebraucht haben mag, darf man nicht pressen. Von den beiden 1616 genannten Fällen lag der eine etwa 12, der andere angeblich 40 Jahre, also sicher sehr lange zurück, so daß die Zeugen sich kaum noch auf alle Einzelheiten besinnen konnten, vorausgesetzt, daß sie überhaupt gewußt hatten, wo die Leichen zuerst gefunden waren. Auf die Landrührigkeit


|
Seite 121 |




|
kam es nicht an. Gefragt wurden die Zeugen ganz allgemein, ob "jemandt ersoffen oder todte Corper gefunden" seien 218 ). Das Entscheidende ist, daß die mecklenburgischen Fahrrechtshandlungen 1616 als Beweise für die Strandhoheit bis zum schiffbaren Strom herangezogen wurden. Und als bei dem Falle von 1757 der Rosenhäger Pächter, der nicht wußte, wie er sich zu verhalten habe, den Gutsherrn von Wieschendorf um Rat fragte, erwiderte dieser, daß der Vorfall dem Amte Grevesmühlen gemeldet werden müsse, "weil der Strand Sr. Herzogl. Durchl. zugehörte". Strand und Strandregal aber waren noch ganz dieselben wie 1616.-
Auf sonstige Lübecker Hoheitshandlungen, die Rörig vorbringt (abgesehen von der Fischerei), haben wir keine Veranlassung näher einzugehen, solange er nicht seine Andeutungen darüber vervollständigt und solange nicht nachgewiesen wird, daß der mecklenburgische Buchtanteil dabei in Betracht käme 219 ).


|
Seite 122 |




|
Sowohl das mecklenburgische Schiffsbergerecht wie die Tatsache, daß das mecklenburgische Fahrrecht über Leichen galt, die - wie in den Fällen von 1615 und 1757 nachweisbar ist - aus dem Wasser geholt wurden, spricht gegen Rörigs Behauptung, es habe Lübeck die Gebietshoheit bis ans trockene Ufer gebührt. Denn man kann nicht über eine Wasserfläche die Hoheit besitzen und gleichzeitig dort einem anderen Staate Hoheitsrechte zugestehen. Die Meinung, es sei "ein gewisses Ineinandergreifen von Hoheitshandlungen" auf dem Buchtgewässer "durch die natürlichen Verhältnisse gegeben" gewesen 220 ), ist rechtlich nicht zu halten. Entweder man hat die Gebietshoheit und damit die Gesamtheit der Hoheitsrechte oder man hat sie nicht.
Die Grenzen der sogenannten Travemünder Reede als eines Lübecker Eigengewässers sollen - nach den Behauptungen Rörigs - an der Küste im Westen durch die Brodtener Scheide gegen Niendorf, d. h. durch die heutige Lübecker Staatsgrenze (Brodtener Grenzpfahl) bestimmt gewesen sein, an der östlichen Buchtküste, also am mecklenburgischen Ufer, durch die Harkenbeckmündung. Seewärts habe die Reede nordöstlich bis zu einer vermeintlich uralten Peillinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle gereicht, die von der holsteinischen Küste her auf die Harkenbeckmündung zulaufe, ferner - im Nordwesten - bis zu dem Lot, das sich von der Brodten-Niendorfer Scheide aus auf die Peillinie fällen läßt. Das alles sei Jahrhunderte hindurch so gewesen 221 ).
Wenden wir uns zunächst der vermeintlichen Seegrenze zu, der Linie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle - Harkenbeckmündung. Wir haben dieser Grenze in unserem Bericht von 1923 die Existenzberechtigung abgesprochen und werden nunmehr eingehender, als wir damals konnten, beweisen, daß wir recht daran taten.
nicht die eigenen Worte des Kommandanten wieder. Was heißt denn "gezwungen"? Einen Zwang würde Lübeck gar nicht gewagt haben anzuwenden. Der Stadthauptmann beschränkte sich ja auch darauf, zu vermitteln, und brachte einen Vergleich zwischen Kriegsschiff und Handelsschiff zustande. - II, Anm. 47 erwähnt Rörig noch eine "Quarantänereede" im 19. Jahrhundert. Kein Schiff aber unterwirft sich der Quarantäne, weil es sich auf dem Hoheitsgebiete des Hafenstaates befindet, sondern weil Fahrzeug, Mannschaft und Ladung sonst nicht in den Hafen hineingelassen werden.


|
Seite 123 |




|
"Stillschweigend" sollen wir "die sehr wichtige Tatsache" übergangen haben, daß die moderne Seekarte die Peillinie Gömnitzer Bergturm-Pohnsdorfer Mühle verzeichne. Diese Tatsache zu bestreiten, ist uns natürlich nicht eingefallen, wohl aber bestreiten wir entschieden, daß ihr für die Grenzfrage auch nur die mindeste Bedeutung zukomme. Auf der modernen Seekarte möchte manche Peillinie angegeben sein, die man vor Zeiten nicht kannte. Ferner trifft die Linie die Harkenbeckmündung überhaupt nicht. Rörigs Rat, mit Hilfe eines Lineals die "gerade Linie" festzustellen, kommt zu spät. Eben weil dieser Versuch mißglückte, haben wir uns 1923 näher erkundigt und von der Gutsherrschaft in Rosenhagen die Nachricht erhalten, daß die Peillinie die Küste ca. 260 m westlich von der Harkenbeckmündung treffe. Auch auf der Seekarte ist die Abweichung bemerkbar. Sie betrüge nach Rörig - der früher angenommen hatte, die Peillinie laufe "zufällig genau" auf die Bachmündung zu, - zwar nur "etwa reichlich 100 m", aber die Rosenhäger Kunde ist richtig; wir haben im Mai 1924 255 m gemessen. Dem sind aber noch ein paar Meter hinzuzuzählen, weil als Richtungspunkt wohl nicht die eigentliche Mündung der Harkenbeck im flachen Strande, die aus einiger Entfernung schwer erkennbar sein wird, in Frage kommt, sondern der Einschnitt im Ufer, aus dem der Bach herausfließt. Es handelt sich also in der Tat um ca. 260 m.
Solche Abweichungen liegen nicht "im Wesen der Peilung", sondern Peillinien müssen stimmen, und wenn man nach drei Landmarken eine gerade Grenze annehmen will, so müssen die Marken auch in einer geraden Linie liegen. Das trifft hier in ganz auffallender Weise nicht zu; davon kann sich jeder an Ort und Stelle überzeugen. Und es wäre höchst wunderbar, wenn die Lübecker durch Jahrhunderte eine solche irreale Grenze gehabt hätten, deren Unstimmigkeit man doch hätte bemerken müssen.
Es ist richtig, daß an der Harkenbeckmündung der Signalturm sichtbar ist, der seit etwa 1828 auf dem Gömnitzer Berge steht. Bei ganz klarem Wetter möchten scharfe Augen vielleicht auch die Pohnsdorfer Windmühle erkennen. Wenn man aber von der Harkenbeckmündung in der Richtung auf den Turm fahren wollte, um dann, wenn die Mündung außer Sicht kommt, in der Richtung der Peillinie die Fahrt fortzusetzen, so würde man bemerken, daß man sich nicht in dieser Linie befindet und buchteinwärts halten muß, um in sie hineinzukommen. Es ist eine ganz beträchtliche Wasserfläche, die bei Annahme einer so unmöglichen Grenze im Zweifel bliebe; wir schätzen sie auf über 3 / 4 qkm. Übrigens sehen wir


|
Seite 124 |




|
einen Beweis für die Unhaltbarkeit der Grenzlinie darin, daß der Lübecker Senat nicht sie, sondern eine Linie Harkenbeck- Steinrifftonne-Gömnitzer Berg vertritt. Die Steinrifftonne ist aber erst 1914 ausgelegt worden (Rörig I, S. 36), und sie liegt natürlich nicht in einer Linie Turm-Mühle-Harkenbeck, weil es solche Linie nicht gibt.
Nachdem Rörig die Peillinie auf der modernen Seekarte gefunden und - in der irrtümlichen Meinung, daß sie auf die Harkenbeckmündung zulaufe, - den Gedanken gefaßt hatte, daß sie eine alte Grenze bilden könne, blieb ihm natürlich die eigentliche Beweisführung noch übrig. Er mußte darlegen, daß die Linie vormals tatsächlich die Grenze gewesen sei. Zu diesem Zwecke beruft er sich auf eine Bemerkung des Travemünder Lotsenkommandeurs A. H. Harmsen von 1828 und stellt gleichzeitig die völlig unbewiesene Behauptung auf, daß die Linie "uralt" sei 222 ).
Die Linie ist keineswegs uralt. Wichtiger als die moderne Seekarte ist hier die französische Seekarte der Lübecker Bucht von 1811, veröffentlicht 1815. Der Franzose, der sie anfertigte, wurde bei seiner Arbeit unterstützt "par le Capitaine du Port de Travemünde A. H. Harmsen". So steht auf der Karte. Und dieser Harmsen ist doch wohl identisch mit dem gleichnamigen Lotsenkommandeur von 1828. Die Karte zeigt an der holsteinischen Küste manche Landmarken, auch die Pohnsdorfer Windmühle, einen "Major" aber, die "verkrüppelte Buche", die früher statt des Turmes auf dem Gömnitzer Berge stand, oder überhaupt den Gömnitzer Berg sucht das Auge vergebens. Daraus folgt, daß A. H. Harmsen noch 1811 die angeblich uralte Peillinie Berg- Mühle nicht gekannt hat. Sie ist gewiß erst aufgekommen, seit sich der hohe Turm auf dem Gömnitzer Berge erhob, der frühestens 1828 erbaut worden ist, und sie diente nur der Schiffahrt, nicht als Grenze 223 ).
Der "Major" wird im Lübecker Wetteprotokoll vom 25 November 1825 (oben S. 119) genannt). Ob er schon früher irgendwo vorkommt, wissen wir nicht. Weil die Seekarte von 1811 ihn nicht


|
Seite 125 |




|
wiedergibt, so kann er vorher nur eine untergeordnete Bedeutung gehabt haben, oder man hat überhaupt erst nach 1811 angefangen, ihn als Richtungspunkt für die Schiffahrt zu verwenden.
Nun die Pohnsdorfer Mühle. Am 16. März 1778 "erteilte Graf Otto von Dernath auf Haselburg und Oevelgönne dem zu Pohnsdorf wohnenden Müller Hans Hinrich Harms einen Erbpachtkontrakt über die zu dem Gute Oevelgönne gehörige neuerbaute Pohnsdorfer Holländer-, Korn- und Graupenmühle". Das steht in einer Mitteilung, die uns das Staatsarchiv in Kiel am 1. August 1924 gemacht hat. Das Staatsarchiv fügt hinzu:"Es scheint indessen, daß die Mühle bereits länger bestanden hat, da in dem Kontrakt gelegentlich von dem alten Mühlenhause die Rede ist. Wann die erste Anlage erfolgt ist, hat sich aus dem hiesigen Material zurzeit nicht ermitteln lassen." Bei dieser alten Mühle muß es sich um die Pohnsdorfer Wassermühle handeln, die nach der Topographie der Herzogtümer Holstein und Lauenburg von Schröder und Biernatzky (2. Band, 1856) ehemals "an der Wiese Mühlenteich westlich vom Hause" ihre Stätte gehabt hatte; eine Wassermühle, die tief gelegen haben muß und als Richtpunkt gar nicht in Frage kommen konnte. Die Mühle jedenfalls, die allein als Landmarke bekannt ist, war 1778 neuerbaut.
Soviel über die Peillinie. Die Bemerkung des Lotsenkommandeurs von 1828 haben wir in unserm Bericht vom August 1923 nur bezweifeln, nicht erklären können. Heute sind wir hierzu imstande, nachdem wir eine Abschrift des ganzen Aktenstückes und einen Auszug aus dem Lübecker Wetteprotokoll vom 25. November 1825 erhalten haben und nachdem Rörig den Fischereivergleich von 1826 seinem neuen Gutachen beigegeben hat (II, Anl. IV).
In diesem Vergleich werden in der Bucht drei Teilstrecken für die Fischerei festgelegt. Die erste ist "die Strecke vom Blockhause an so weit hinaus, bis der Major (ein Baum auf dem Berg zu Gömnitz in Holstein) vor das Brodtener Ufer kommt". Dann folgt "die Strecke von da an, wo der Major vor dem Brodtener Ufer kommt, bis Rosenhagen", schließlich die Strecke von hier bis zur Harkenbeck. Wann aber kam der Major von dem Brodtener Ufer heraus? Wenn man die Bucht seewärts bis zu der Stelle durchfuhr, an der man, an dem Brodtener Höved oder der Brodtener Hucke, wie die Fischer sagen, vorbei, zuerst den Major erblicken konnte. Dann war man aber noch sehr weit von der jetzigen Peillinie Gömnitzer Turm-Pohnsdorfer Mühle entfernt, ja, wie der Vergleich selbst lehrt, sogar noch weit von Rosenhagen und am weitesten von der Harkenbeck. Wäre man bis dahin gefahren, wo


|
Seite 126 |




|
heute die Peillinie an der Bucht vorüberläuft, so wäre der Major lange vorher vor dem Brodtener Ufer erschienen.
In dem Wetteprotokoll vom 25. November 1825 werden, wie wir oben S. 119 schon angeführt haben, vier abgemessene Strecken genannt: Vom Blockhause bis zum Kavelmacherschen Wrack = 735 Faden, von da "bis an den Major hinterm Brodener Ufer" = 135 Faden; dann folgen auch hier die Strecken "vom Major bis Rosenhagen" und von Rosenhagen bis zur Harkenbeck. Die Entfernung vom Blockhause über das Wrack bis zum Major betrug also zusammen 870 Faden (= 1566 m). Das ist noch lange nicht die halbe Entfernung bis zur Harkenbeck. Und was in dem Protokoll, ebenso wie in dem Vergleich vom nächsten Jahre mit dem "Major" gemeint ist, kann nicht zweifelhaft sein: Nicht eine Linie Major-Pohnsdorfer Mühle, sondern eine Stelle in der Travemünder Bucht, von der aus man des Majors zuerst ansichtig wurde, der weit nordwestlich von der holsteinischen Küste herüberschaute.
Man ziehe eine Linie vom heutigen Gömnitzer Turm am Brodtener Höved dicht vorüber bis an die mecklenburgische Küste. Wer in der Travemünder Bucht an dieser Linie entlangfuhr, hatte den "Major" immer in Sicht. Und alle Punkte, wo der Major vor dem Brodtener Ufer erschien, lagen auf dieser Linie. Wer sich aber auf der Wasserfläche hinter der Linie, nach der Trave zu, befand, konnte den Major nicht sehen, weil das hohe Brodtener Ufer ihn verdeckte. Die beigefügte Kartenskizze veranschaulicht dies.
Hierzu stimmt denn auch vollkommen die Eingabe des Travemünder Lotsenkommandeurs A. H. Harmsen vom 8. Februar 1828, worin er dem Präses des Lotsendepartements auseinandersetzte, daß Klagen, die über die Fischerei seiner Lotsen vorgebracht seien, auf Unwahrheit beruhten. Die Lotsen, so heißt es, könnten den Fischern 224 ) gar keinen Schaden zufügen, weil jedesmal, wenn sie ihre Netze aussetzten,
"nur 2 Mann aus dem Boote solche ausbringen, die den freien Tag haben, und dann in offener See 1 u. 11/2 Meile von Travemünde auf 7 u. 8 Fuß bis auf 5 u. 6 Klafter Wasser nach der Norderseite in der See. . . . Gewiß wird der Streit gehoben seyn, wenn erst der Thurm auf dem Gömnitzer Berge steht, dann


|
Seite 127 |




|
wird jeder die Grenze zwischen der Rhede und der See unterscheiden können. So viel ich weiß, haben unsere Fischer" (gemeint sind wohl die Lotsenfischer) "kein Amt noch Zunft; und in der See hat wohl jeder gleiches Recht."
Rörig selbst sagt, daß den Lotsen die Fischerei "nur in der See außerhalb der Reede" gestattet gewesen sei, d. h., seiner Meinung nach, außerhalb der Linie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle-Harkenbeck 225 ). Der Lotsenkommandeur aber, Rörigs einziger Zeuge für diese angebliche Reedegrenze, befand sich schon eine Seemeile (1855 m) vor Travemünde in offener See außerhalb der Reede, wo jeder gleiches Recht habe. Bis zur Peillinie Turm-Mühle und bis zur Harkenbeckmündung ist die Entfernung weit über doppelt so groß. Als Kennzeichen der Reedegrenze vermißte der Kommandeur den "Major", die inzwischen umgestürzte Buche, und er hoffte auf den Bau des Turmes, der schon 1826 geplant wurde 226 ).
Erinnern wir uns, daß in dem Wetteprotokoll von 1825 die Entfernung vom Blockhause bis zum Major über Kavelmachers Wrack auf 870 Faden (1566 m) angegeben wird. Bei 1855 (l Seemeile) Abstand von Travemünde war man laut dem Zeugnisse des Lotsenkommandeurs bereits in offener See. Was soll also Harmsen mit der Reedegrenze gemeint haben, wenn nicht eine Linie in der Bucht, von deren Punkten aus man den "Major", als er noch stand, zuerst gesehen hatte. Es ist dieselbe Linie, die im Wetteprotokoll von 1825 und im Fischereivergleich von 1826 erscheint 227 ). Darüber hinaus war nach Harmsen "offene See".
Dazu passen denn auch ausgezeichnet die von dem Kommandeur gemachten Angaben über die Wassertiefe, in der die Lotsen fischten: 7 und 8 Fuß bis auf 5 und 6 Klafter Wasser (= 2 bis 10,8 m). So geringe Tiefen finden sich hinter der Peillinie Turm-Mühle überhaupt nicht mehr, abgesehen von einer kleinen Fläche über dem Nordostzipfel des Steinriffs, wo das Wasser 9-10 m tief ist.


|
Seite 128 |




|
Damit dürfte diese Peilliniengrenze erledigt sein. Daß sie so schwach, ja, daß sie überhaupt nicht begründet sei, daß sich mit der einzigen Quelle, die Rörig dafür anführt, mit dem Bericht des Lotsenkommandeurs von 1828, gerade die Unrichtigkeit der Grenze erweisen läßt, das hätten wir denn doch nicht erwartet. Der Lotsenkommandeur hat sich aus einem Lübecker Zeugen in einen mecklenburgischen verwandelt.
Die Linie, die er bezeichnete, schneidet von der mecklenburgischen Küste nur eine Strecke von 400-500 m ab. Sie erscheint in dem Fischereivergleich von 1826 und in der Eingabe des Lotsenkommandeurs selbst als Fischereigrenze für einen Bezirk, der nach Travemünde zu innerhalb der Major-Linie lag. Und in diesem Bezirk ist die alte nautische Reede zu suchen, auf der die Lotsen nicht fischen durften. Desbalb sprach der Kommandeur von der Linie als von einer Grenze zwischen Reede und offener See. Aber sie ist deswegen noch lange keine Hoheitsgrenze, am wenigsten an der mecklenburgischen Seite, wo die Reede nicht lag. Es haben auch, wie wir sehen werden, mecklenburgische Fischer um 1600 die Major-Linie nach der Trave zu überfahren.
Mit der Seegrenze Turm-Mühle-Harkenbeck fällt eigentlich schon Rörigs ganze Reedebegrenzung dahin. Wie sollte denn dort Lübecker Hoheitsgebiet gewesen sein, wo nach der Ansicht des Travemünder Lotsenkommandeurs offene See war und jeder gleiches Recht hatte! Es ist ja Rörig Vermutung, daß "die uralte Peillinie" das "Primäre" sei "und daß die Harkenbeck nur deshalb die Rolle sowohl als See- wie auch Landgrenze der Reede erlangt hat, weil eben ungefähr bei ihrer Mündung diese als Reedegrenze geeignete Peillinie auf das mecklenburgische Ufer stößt" (II, S. 250). Aber so wenig wie es je die Peillinien-Grenze gegeben hat, so wenig ist die Harkenbeckmündung eine Hoheitsgrenze. Wir werden im folgenden Abschnitte noch näher darlegen, daß sie von jeher nur eine interne Nutzungsgrenze der Lübecker Fischerei gewesen ist, genau so wie der "Major", wie Rosenhagen, wie der Möwenstein, wie die Linie Harkenbeck - Haffkruger Feld und - in der Niendorfer Wiek - die Gosebeckmündung es waren und wie es "Kavelmachers Wrack" hatte werden sollen. Und daß man die Harkenbeck dazu ausersah, erklärt sich einfach daraus, daß sie einen Merkpunkt bildet, dessen Entfernung vom Buchtwinkel der Länge des westlichen Buchtufers ungefähr entspricht. Bis zur Harkenbeck rechnete man die eigentliche Buchtfischerei an der Ostküste. Solche interne Fischereischeide ist die Bachmündung eben schon 1547, zur Zeit der Aussage des Zöllners vor dem


|
Seite 129 |




|
Holstentore gewesen (oben S. 105). Auch aus der "internen" Fischereigrenze Harkenbeck-Haffkruger Feld, soweit sie an der Travemünder Bucht vorüberläuft, hat Lübeck ja 1896 irrtümlich eine Hoheitsgrenze gemacht 228 ). Sollte der Zöllner Tydemann sich nicht 1547 ebenso haben irren können wie der Lübecker Senat 1896? Wann hätte auch Lübeck früher je Mecklenburg gegenüber die Harkenbeckmündung für eine Hoheitsgrenze ausgegeben! Zuerst 1912! 229 ). Uns jedenfalls ist kein älteres Lübecker Schreiben vor Augen gekommen, in dem es der Fall wäre. Auch bei dem Fischereistreit von 1616 ist gar keine Rede davon. Die mecklenburgischen Kommissare untersuchten damals die Rechtsverhältnisse am Strande von Travemünde an bis weit über die Harkenbeckmündung hinaus, weil diese als Gebietsgrenze ganz unbekannt war.
Wir kommen schließlich zu der von Rörig angenommenen Westgrenze der Reede. Dabei brauchten wir eigentlich nur noch über den Landgrenzpunkt an der Brodten-Niendorfer Scheide einiges zu sagen, weil die Seegrenze, nämlich das von diesem Punkte auf die Peillinie Berg-Mühle gezogene Lot, natürlich mit der Peillinien-Grenze selbst fallen muß. Erwähnen wollen wir aber doch, daß diese westliche Seegrenze lediglich eine ganz willkürliche Konstruktion Rörigs ist. Genau so gut hätte man annehmen können, daß die Grenze sich hier durch eine zweite Peillinie bestimmt habe, die von der Brodten-Niendorfer Scheide auf irgend einen Punkt an der holsteinischen Küste, etwa östlich von Neustadt, zugelaufen sei. Das wäre sogar sehr viel verständiger gewesen; denn die Lotgrenze hätte man doch nur erkennen können, wenn man an der Linie Berg-Mühle unmittelbar entlang gefahren wäre, bis man sich gegenüber der Brodtener Grenze befand. Hielt man sich aber diesseits der Linie auf, so wäre deren Verlauf auf dem Wasser und also auch das Lot überhaupt nicht festzustellen gewesen. Bei alledem bliebe immer vorausgesetzt, daß die Scheide zwischen Brodten und Niendorf durch eine Landmarke von der See her erkennbar war. Denn das katholische Kinderheim, das Rörig als Richtungszeichen vorschlägt, wäre ja für die ältere Zeit nicht in Betracht gekommen. Die Seekarte der Lübecker Bucht von 1811 gibt eine passende Landmarke durchaus nicht an, wie sich denn auf ihr überhaupt nicht das mindeste über eine Reedegrenze findet.
Nun die Landgrenze an der Brodten-Niendorfer Scheide. Wir bleiben dabei, daß Rörigs Beweisführung auch hier sehr unzuläng-


|
Seite 130 |




|
lich ist. Es wäre ja auch höchst wunderbar, wenn die Reede schon in grauen Zeiten just an dem Punkte geendet hätte, der später zufällig Lübecker Staatsgrenze wurde. Denn Brodten kam erst 1804 an Lübeck, nachdem das Domkapitel, dem das Dorf gehört hatte, dem Reichsdeputationshauptschlusse zum Opfer gefallen war 230 ). Seitdem gab es denn auch wohl einen Brodtener Grenzpfahl. Nach Rörig aber wäre das Gewässer vor Brodten schon früher lübeckisch gewesen. Seine älteste Quelle hierfür ist ein Protokoll, wonach Lübeck 1543 das Fahrrecht über eine Leiche abhielt, die am Brodtener Höved im Wasser lag. Wörtlich heißt es in dem Protokoll: "By dem Brotmer Hovede up jennesit Travemunde an dem Strande iß gefunden ein Man im Water . ." 231 ) Den kapartigen Küstenvorsprung im Westen der Bucht nennt man Brodtener Höved, weil er großenteils, zumal sein von der See her zuerst sichtbares Nordende, zum Brodtener Gebiet gehört. Es kommt dabei natürlich auf die Küstenform und nicht auf eine Ortschaftsgrenze an, d. h. der Ton bei der Benennung liegt auf dem "Höved", dem Haupt, und dieses ist nicht nur gerade bis zur Brodtener Südgrenze zu rechnen. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß man die ganze westliche Buchtküste bis Travemünde hin als ein Höved bezeichnen kann. Seit 1329 aber besaß Lübeck den Strand bis zur Brodtener Scheide 232 ), die noch eine Strecke nördlich vom Möwenstein an die See stößt. Also kann der Tote 1543 recht wohl auf Lübecker Gebiet gelegen haben. Auch ergibt die Ortsbestimmung: up jennesit Travemünde, daß der Fundort nicht weit von Travemünde an der Westküste der Bucht zu suchen ist. Der Fahrrechtsfall von 1543 beweist daher gar nichts.
Weiter beruft sich Rörig darauf, daß die Lübecker im 18. Jahrhundert das Recht beanspruchten, vom Brodtener Ufer Steine zu holen, und 1775 dem Domkapitel gegenüber daran festhielten. "Ein derartig weitgehendes wirtschaftliches Nutzungsrecht am Strande eines fremden Territoriums" sei "selbstverständlich undenkbar, wenn hier Lübeck nicht zum mindesten auf der Wasserfläche vor dem Strande Gebietshoheit gehabt hätte: also auch hier reicht die Gebietshoheit von der Reede im nautischen Sinne bis unmittelbar auf den Strand selbst heran" (I, S. 32 f.). Diese Folgerung ist völlig unmöglich. Was hat das Steinholen "am Strande eines fremden Territoriums" mit der Gebietshoheit auf dem Wasser


|
Seite 131 |




|
zu tun? Mit noch mehr Recht könnte man aus der Lübecker Fischerei in der Niendorfer Wiek oder vor dem mecklenburgischen Ufer bis Klützer Höved hin, die doch auch eine weitgehende Nutzung war, schließen, daß die ganze Wiek und das Gewässer vor der Mecklenburger Küste Lübeck gehört habe.
Wenn Rörig (II, S. 244) sagt, er habe das Steinholen mit "der Reedehoheit in Verbindung gebracht", so ist damit eine Auffassung ausgesprochen, die durch das, was er selbst aus den Akten über die Verhandlungen mit dem Domkapitel anführt, nicht bestätigt wird. Im Gegenteil, der Lübecker Senat erklärte: auf das althergebrachte Holen von Steinen am Strande und aus dem Wasser vor dem Strande könne Lübeck nicht verzichten; doch solle den Travemündern das Brechen von Steinen aus dem Steilufer untersagt werden (I, S. 32). Also berief sich der Senat überhaupt nur auf eine hergebrachte Nutzung am Ufer Brodtens und ausdrücklich auch auf dem steinreichen Wassergrunde davor, der ja nach Rörig schon zum Reedegebiet gerechnet haben soll. Hätte der Senat seinen Anspruch auf eine Gebietshoheit gründen wollen, so müßte er sich ganz anders ausgedrückt haben. Daher sollte auch die Grenze von 10 Ruten Breite, die das Domkapitel vorschlug, gewiß für das Steinholen gelten und keine Gebietsgrenze sein. Und wenn hernach der Lübecker Baumeister Soherr klüger sein wollte und erklärte, daß der Strand der Stadt gehöre, so ist doch eine solche Behauptung kein Beweis. Zu erklären ist sie nur dadurch, daß Soherr Nutzung und Eigentum nicht auseinander hielt. Der ganze Streit ergibt gar nichts für eine Reedehoheit oder eine Reedegrenze an der Brodten-Niendorfer Scheide, sondern läßt höchstens erkennen, daß das in Lübeck domizilierende Domkapitel zu schwach oder zu gemächlich war, um sich Lübeck gegenüber durchzusetzen. Vielleicht legte es auch auf den Strand wenig Gewicht, nachdem es erreicht hatte, daß das hohe Brodtener Ufer nicht mehr durch Ausbrechung von Steinen gefährdet werden durfte.
Ferner erklärt Rörig (II, S. 244), für das Jahr 1804 stehe es "aktenmäßig fest, daß das Gewässer vor Brodten unmittelbar am Ufer zur Reede selbst gehörte". Er stützt sich aber dabei nur auf eine Nachricht von 1804, wonach Lübeck als Grenze nur die anerkannte, "welche die Natur selbst durch die See macht, das heißt das steile Ufer selbst" (I, S. 32). Gemeint ist die Grenze des Brodtener Gebietes. Ist aber zugleich eine Reedegrenze gemeint? Das ist doch wohl noch zweierlei. Rörig teilt nicht mit, in welchem Zusammenhange die Bemerkung gemacht wurde. Sie stammt aber


|
Seite 132 |




|
schon aus der Zeit, in der Brodten lübeckisch war 233 ). Und wie man in Mecklenburg den Strand nicht den anliegenden Gütern zugestanden, sondern als besonderes landesherrliches Eigentum betrachtet hat, so wollte offenbar auch Lübeck den Brodtener Strand nicht den Hauswirten überlassen, deren Besitzungen daran stießen. Das wäre um so begreiflicher, als die Hauswirte im Gebiete des früheren Domkapitels ihre Hufen seit 1793 als freies Eigentum innehatten 234 ). Was hätte es denn für einen Zweck haben sollen, Lübecker Hoheitsgebiet als solches gegen anderes Lübecker Hoheitsgebiet abzugrenzen! Es wird sich also nicht um eine Hoheitsgrenze handeln, sondern um eine Strandgrenze gegen den Privatbesitz der Brodtener Hauswirte. Und daß Lübeck 1804, nach der Erwerbung Brodtens, den Strand und das Gewässer vor der Küste des Dorfes beanspruchte, war ja völlig berechtigt. Für eine Reedehoheit und eine Reedegrenze aber läßt sich nichts daraus entnehmen. Vor 1804 hatte Lübeck nur der Strand bis zur Brodtener Südgrenze gehört; so war es seit 1329 gewesen.
Schließlich sucht Rörig seine Meinung über die westliche Landgrenze der Reede mit dem Niendorfer Fischereivergleich zu belegen, der 1817 zwischen Stadt und Fürstentum Lübeck zustande kam 235 ). In dieser Urkunde wird zu Anfang gesagt, daß man sich wegen der Fischereiberechtigungen "längst dem ganzen Strande, von der Travemünder Rehde an, bis zum Hafftkruger Felde" verglichen habe; dabei wird auf die beigegebene, einige Jahre vorher von dem Kammer-Conducteur Kaufmann angefertigte Situationskarte verwiesen 236 ). Was aber heißt "von der Travemünder Reede an"? Rörig legt diese Worte so aus, daß die Landgrenze der Reede in dem Brodtener Grenzpfahl zu erblicken sei, der auf der Kaufmannschen Karte verzeichnet und mit der Gosebeck vor dem Haffkruger Felde durch eine Linie verbunden ist. Aber diese Deutung könnte nur zutreffen, wenn sich vom Grenzpfahl aus eine Wassergrenze -


|
Seite 133 |




|
auf die es ja für die Reede allein angekommen wäre - seewärts erstreckt, d. h. wenn es die Peilliniengrenze und die darauf errichtete Lotgrenze gegeben hätte. Das ist jedoch, wie wir gesehen haben, völlig ausgeschlossen. Hätte man solche Wassergrenze gekannt, so wäre gar nicht zu verstehen, warum die Situationskarte sie nicht wiedergibt; denn sie wäre ja gerade das Entscheidende gewesen. Man muß dabei beachten, daß die von Rörig konstruierte westliche Reedegrenze nicht von Norden, sondern von Nordosten her auf den Grenzpfahl zugeht und mit der Nordküste Brodtens einen spitzen Winkel bildet. Es hätten also die Fischer aus dem Fürstentum Lübeck unmittelbar am Ufer zwar nur bis zum Grenzpfahl Fischerei treiben dürfen, weiter seewärts aber noch darüber hinaus, nämlich bis zur Lotgrenze, die es jedoch in Wirklichkeit nicht gab und die deswegen auch auf der Karte nicht eingezeichnet ist.
Mit der Seegrenze schwindet auch der ohne sie sinnlose Landgrenzpunkt der Reede an der Brodten-Niendorfer Scheide. Also muß in dem Vergleich mit der "Reede" etwas anderes gemeint sein.
Um das Richtige zu finden, bedarf es einiger Feststellungen. Zunächst ist klar, worauf es bei dem Vergleich in erster Linie ankam: auf die Wadenzüge in der Niendorfer Wiek, die denn auch in großer Zahl auf der Situationskarte eingetragen sind. Von der Wadenfischerei handeln die ersten drei Paragraphen. Und weil in ihnen von dem "ganzen obgenannten Strande", der "ge-samten obbemeldeten Strandgegend", der "Eingangs bemerkten und auf der Charte bezeichneten Strecke" gesprochen wird, so können die Bestimmungen dieser Paragraphen sich auch nur auf den Strand beziehen, der zu Anfang des Vergleichs genannt ist, also auf den Strand von der Reede bis zum Haffkruger Felde, und es muß diese Begrenzung auch mit der Situationskarte in Einklang zu bringen sein. Auf der Karte aber darf es nicht beirren, daß zwischen dem Brodtener Grenzpfahl und der Gosebeckmündung eine Verbindungslinie gezogen ist, denn es steht ja dabei, daß sie nur den Bezirk "binnen Landes" abtrennen soll, wie die Fischer das Fanggebiet der Wiek genannt haben werden. Wenn daher die Linie auch dieses eigentliche Fischereigebiet bezeichnet, in dem sich die Wadenzüge finden, so braucht sie doch nicht zugleich den tatsächlichen Geltungsbereich des gesamten Abkommens anzugeben. Sonst müßten alle Interpretationsversuche scheitern; denn der Brodtener Grenzpfahl oder überhaupt die Brodten-Niendorfer Scheide kommt in dem Vergleich schlechterdings nicht vor, und eine Reedegrenze war an dieser Stelle nicht.


|
Seite 134 |




|
Nun aber gibt die Karte noch das Nordufer Brodtens bis ungefähr dahin wieder, wo es sich allmählich nach Südosten buchteinwärts wendet. Wadenzüge sind hier allerdings nicht eingetragen. Aber auch Rörigs Kartenskizze zur Lübecker Fischerei 237 ) verzeichnet keine am Brodtener Strande; auf ihr finden sich Wadenzüge an der Westküste der Travemünder Bucht nur bis zum Möwenstein, dann erst wieder vor dem Niendorfer Ufer. Es wird denn auch in der Lübecker Fischereiverordnung von 1585 die Strecke vom Blockhause bis zum Möwenstein für die westliche Buchtfischerei angegeben, während die östliche bis zur Harkenbeck reichte 238 ). Ebenso in dem Fischereivergleich zwischen den Lübecker und Travemünder Fischern von 1610; dabei wurde bestimmt, daß die Travemünder zwischen dem Blockhause und dem Möwenstein ihre Netze setzen, aber die Wadenzüge der übrigen Fischer hier nicht stören dürften 239 ).
Wie kam man zur Abgrenzung dieser Strecke? Auf die Ursache dafür deutet eine Bemerkung in dem Bericht des Travemünder Lotsenkommandeurs von 1828 hin, wonach die Lotsen weniger als 200 Klafter Netze in einer Länge nicht setzen konnten, "da es oft über Steine und Gründe hingeht, wo keine Fische sind". Diese Lotsenfischerei begann aber eine bis anderthalb Meilen vor Travemünde, nach der "Norderseite" zu, also kurz hinter dem Möwenstein. Hier wird der Strand sehr schmal und samt dem Wassergrunde davor steinig. Die See hat im Laufe der Jahrtausende das Brodtener Ufer kilometerweit zurückgedrängt, und aus den dabei losgespülten Felsblöcken ist das Brodten vorgelagerte Steinriff entstanden. Für die Fischerei mit Zugwaden ist also das Gewässer an der Brodtener Küste so ungeeignet wie möglich.
Bei den Verhandlungen, die zum Niendorfer Vergleich führten, erklärten die Kommissare beider Parteien 1815, daß auf der Kaufmannschen Situationskarte "alle Fischzüge enthalten seien, auf die es ankomme" 240 ). Auf Wadenzüge östlich von Niendorf kam es eben nicht an. Mit der "Reede" aber kann in dem Vergleich gar nichts anderes gemeint sein als einfach die Travemünder Bucht. Niendorfer Wiek und Travemünder Bucht grenzen ja aneinander, und als Scheide zwischen beiden läßt sich der nördlichste Punkt des Brodtener Höveds annehmen, wo dieses südwestlich nach Niendorf,


|
Seite 135 |




|
südöstlich nach der Trave zu abfällt. So genau brauchte man sich aber 1817 nicht auszudrücken, weil ja Einigkeit darüber herrschte, daß die Wadenzüge erst bei Niendorf begannen.
Auf den weiteren Inhalt des Vergleichs brauchen wir hier nicht einzugehen. Der darin vorkommende Ausdruck "Reede" ist von dem Ankerplatze auf die ganze Bucht übertragen worden. Schon bei dem Fischereistreit von 1616 hat Lübeck das Gewässer vor Rosenhagen seine Reede genannt, weil es sich doch auf irgend etwas berufen mußte. In Wirklichkeit aber handelt es sich dabei um einen bloßen Namen, nichts weiter, und besagt für eine Gebietshoheit nicht das mindeste. Nur die Bucht war gemeint, als 1804 der Lübecker Stadtbaumeister Behrens von dem Ufer "längs der Rehde am Brodtener Felde" berichtete 241 ). Ebenso in der Relation des Oberappellationsgerichtsrates Dr. Hach von 1825, worin von dem "Ende der Rehde, wo die Harkenbeck sich ergießet", gesprochen wird 242 ). Übrigens erscheint die Harkenbeckmündung auch hier lediglich als Fischereigrenze; denn der Prozeß, der damals zwischen den Travemünder Fischern und den übrigen Lübecker Fischergruppen vor dem Oberappellaionsgericht der freien Städte ausgefochten wurde, betrifft keine Gebietshoheit und keine Hoheitsgrenze, sondern nur die Art, wie die Ausübung der Fischerei sich auf die Fischergruppen verteilte. Und wenn der Vergleich von 1826, der im Anschlusse an den Prozeß zustande kam, von den lübischen Fischern ein "Vergleich wegen Befischung des Ufers der Travemünder Reede" genannt wurde 243 ), so ist unter der Reede wiederum die Bucht zu verstehen. Reede in dieser ganz vagen Bedeutung und Travemünder Bucht sind ein und dasselbe. Anders dagegen in dem Wetteprotokoll von 1823, wonach die Schlutuper Fischer über die Stellnetze der Travemünder auf dem Distrikt "zwischen der Rehde und Rosenhagen" hinweg gefischt hatten, eine Tat, die den erwähnten Prozeß verursachte 244 ). Hier ist die alte nautische Reede, der Ankerplatz vor der Travemündung gemeint,


|
Seite 136 |




|
genau so wie in dem Bericht des Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828. Statt des Wortes "Reede" in dem Protokoll kann man einsetzen "Major vor dem Brodtener Ufer"; denn es handelt sich zweifellos um die Strecke vom Major bis Rosenhagen, die hernach im Wetteprotokoll vom 25. November 1825 (oben S. 119) und im Fischereivergleich von 1826 genannt wird 245 ).
Auch die Major-Linie ist, wie wir schon oben S. 128 hervor gehoben haben, lediglich eine interne Lübecker Fischereigrenze. Man bedurfte ihrer, weil die innere Bucht vom Blockhause an, in der die Reede lag, als besonderer Fischereibezirk galt. Bloß des Ankerplatzes wegen, d. h. für Reedezwecke ist nie eine Scheidelinie gezogen worden. Auch nicht für die moderne nautische Reede, deren "ungefähre Abgrenzung" Rörig auf der Kartenskizze 2, die seiner ersten Druckschrift beigegeben ist, gegenüber von Rosenhagen nach dem Verlauf der 10 m-Wassergrenze eingezeichnet hat.
Hätte man je eine Hoheitsgrenze in der Travemünder Bucht oder noch weiter seewärts gekannt, sie wäre gewiß nicht in Vergessenheit geraten. Es gab eben keine. Dafür ist ja schon das Tasten Lübecks nach einer Grenze im 19. Jahrhundert bezeichnend 246 ). 1870 nahm das Lübecker Stadt- und Landamt "einen Streifen von einer Seemeile ins Meer, von der Landgrenze des Lübecker Staatsgebiets aus gerechnet", in Anspruch. Nach Rörig wäre darin freilich nur "ein Zeichen für die auffallende Unkenntnis der älteren Verwaltungspraxis" zu erblicken. Er ist des Glaubens, daß seine angeblich Jahrhunderte hindurch innegehaltenen Reedegrenzen nach 1828 aus dem Gedächtnisse der Lübecker weggelöscht seien, um durch ihn zu neuem Leben erweckt zu werden.
Das Lübecker Fischereigesetz vom 11. Mai 1896 nahm die Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld an, soweit sie an der Travemünder Bucht vorüberläuft. Rörig hat nachgewiesen, daß sie wieder nur eine "interne" Abgrenzung zwischen den Lübecker Fischergruppen ist, die 1879 entstand und aus der man irrtümlich eine Hoheitsgrenze gemacht hat 247 ). Der Lübecker Senat hat sie denn auch fallen lassen. Aber auch die neue Grenze ist nun zusammengebrochen, und es bleibt keine mehr übrig, außer der, die


|
Seite 137 |




|
nach Maßgabe des Küstenbesitzes zwischen Mecklenburg und Lübeck zu ziehen ist.
Da die Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld durch die jetzige nautische Reede mitten hindurchführt - auf der Seekarte ist der die Reede bezeichnende Anker noch jenseit der Linie eingetragen -, so hat Lübeck auf einem großen Teile dieser Reede gar keine Gebietshoheit beansprucht, bis Rörig seine neue Grenze entdeckte. Und die 1870 vom Lübecker Stadt- und Landamt angegebene Hoheitszone geht über die 10 m-Wassergrenze nur gegenüber von Brodten und dem Möwenstein ein Stück hinaus, ohne den "besten Ankergrund der Reede in der Gegend der Harkenbeck bei 17 m Wassertiefe" 248 ) auch nur entfernt zu erreichen, von dem sie etwa 1 km abliegt. Schlagender kann nicht bewiesen werden, daß eine Reede überhaupt keine Gebietshoheit voraussetzt. Übrigens muß man sich davor hüten, mit dieser Reede gegenüber der Harkenbeck die Vorstellung eines lebhaften wirtschaftlichen Betriebes zu verbinden. Sie besteht wohl mehr dem Namen nach, da bei den heutigen Tiefenverhältnissen auch größere Schiffe die Trave befahren können. Nach unseren Erkundigungen kommt es selten vor, daß Schiffe auf der Reede liegen. Was man von dieser bemerkt, ist also nur zuweilen ein vor der Küste ankerndes Schiff, dessen Anwesenheit die mecklenburgischen Hoheitsrechte nicht beeinträchtigen kann, sofern es sich auf dem Buchtanteile Mecklenburgs aufhält.
"Nicht nur in der Schiffahrt waren die Lübecker die ersten, die in diesem Meeresgebiet (gemeint ist die große Lübecker Bucht) . . wirtschaftliche Rechte ausübten, sondern auch in der Fischerei. . . . Wenn diese Fischer (die lübischen) noch etwa um das Jahr 1500 mit ihren Fanggeräten (Waden, Netzen, Angeln) in die Lübecker Bucht hinausfuhren, um an ihren verschiedenen Küsten - der holsteinischen und der mecklenburgischen - zu fischen, waren sie damals noch ohne jeden Wettbewerb; erst nach 1500 versuchten die Strandbewohner dieser Küsten, selbst zu einer nennenswerten Eigenfischerei überzugehen." so sagt Rörig I, S. 2 f. Wir haben ihm 1923 erwidert: "Solange dies nicht bewiesen ist, behaupten wir, daß die Strandbewohner dort schon Küstenfischerei getrieben haben, bevor Lübeck gegründet wurde. Wir haben dabei alle Wahrscheinlichkeit für uns, weil gar nicht anzunehmen ist, daß diese Bevölkerung auf die Fischerei in der See verzichtet haben sollte.


|
Seite 138 |




|
Bekannt ist, daß der Heringsfang schon in wendischer Zeit betrieben wurde." Dazu bemerkt Rörig II, S. 256 f., wo er uns recht ungenau zitiert 249 ), wir hätten keine Gegenbeweise vorgebracht und mit wissenschaftlicher Beweisführung habe "diese Art der Schlußfolgerungen jedenfalls nichts mehr zu tun". Was für Schlußfolgerungen? Schlüsse haben wir nicht gezogen, sondern nur einer unwahrscheinlichen Behauptung eine wahrscheinliche gegenübergestellt. Dabei interessierte uns nur die mecklenburgische Küste, auf die wir in unseren weiteren Ausführungen von 1923 ja auch eingegangen sind. Und angesichts der gänzlichen Abwesenheit auch nur des Versuches einer Beweisführung für eine ausschließliche Lübecker Fischerei an dieser Küste (bis zur Wismarer Bucht hin) bedurfte es wohl keiner "Gegenbeweise".
Solche Beweise für die Fischerei an bestimmten Küstenstrecken bis 1500 zu liefern, wird in sehr vielen Fällen überhaupt nicht möglich sein. Dazu reicht das erhaltene Quellenmaterial nicht aus. Auch die Angaben bei Rörig I, S. 3 und 20 f. über eine Lübecker Fischerei bis zur Wismarer Bucht im Mittelalter beruhen ja auf Rückschlüssen aus späteren Nachrichten. Derlei Rückschlüsse können erlaubt sein. Aber es liegt nahe anzunehmen, daß die Lübecker ihre Seefischerei zunächst nach Westen richteten, wo sie ja für den holsteinischen Strand 1252 ein Privileg erhielten 250 ), und daß sie sich erst später dem mecklenburgischen Küstengewässer zuwendeten, zu einer Zeit, wo das Fischereiregal hier nicht mehr so genau in Obacht genommen wurde.
Nun meint Rörig, den Nachweis geführt zu haben, daß an der holsteinischen Küste bis ins 16. Jahrhundert in der Tat ausschließlich die Lübecker gefischt hätten. Aber nachgewiesen hat er nur, daß man sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeitweilig am holsteinischen Strande nicht mehr dulden wollte. Er führt dies zum Teil zurück auf die sorgsame Bewahrung der territorialen Superiorität gegenüber fremden Ansprüchen, wie sie der Zeit eigentümlich war, auf die "Auseinandersetzungen zwischen Territorium und Stadt" 251 ). Mitgespielt hat gewiß ein anderes. Es waren der neue Cismarer Amtmann Detlev Rantzau und einige an der Lübecker Bucht ansässige adelige Gutsherren, die sich der


|
Seite 139 |




|
Lübecker Fischerei widersetzten. Die Bewohner des domkapitularischen Dorfes Timmendorf schlossen sich dem an. Zwischen Lübeck und dem holsteinischen Adel bestand aber von altersher ein Gegensatz, der durch die Grafenfehde in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts nur verschärft sein konnte. Ein Namensvetter des Cismarer Amtmannes, der als Feldherr berühmte Johann Rantzau († 1565) hatte damals siegreich gegen Lübeck gefochten. Solche Erinnerungen und alte Feindschaften werden bei dem Fischereistreit nachgewirkt haben.
Die eigentlichen schweren, aus dem Gegensatze Territorium-Stadt entstandenen Konflikte zwischen den Landesherren und den Seestädten liegen zu Anfang des 14. und im 15 Jahrhundert, nicht im sechzehnten. Und nach dem urkundlichen Material, das wir im ersten Berichtsteile (Abschnitt A) vorgebracht haben, ist die Regalität der Küstenfischerei gerade in der früheren Zeit, im 13. und noch im 14. Jahrhundert streng gewahrt worden. Darum schärfte auch Herzog Bogislav von Pommern 1286 seinen Beamten ein, die Kolberger im Genusse der ihnen neu verliehenen Seefischerei nicht zu stören 252 ). Wäre man damals so weitherzig gewesen wie hernach z. B. an der Küste des Amtes Grevesmühlen, so würden sich wohl nicht so viele spezialisierte Privilegien finden.
Daß es sich bei der Krisis, die um 1580 die Lübecker Fischerei am holsteinischen Strande durchmachte, um etwas ganz Neues, bisher noch nicht Vorgekommenes handelte, erscheint sehr zweifelhaft. Jedenfalls konnten sich gesteigerte Ansprüche der lokalen Gewalten auch darin äußern, daß man eine bisher gemeinsame Fischerei der Lübecker und der Anlieger in eine ausschließliche der Anlieger umwandeln wollte. Denn es war ja beabsichtigt, die lübischen Fischer ganz zu verdrängen 253 ). Zwar nimmt Rörig als weiteren Grund für die Streitigkeiten an, daß die Anlieger erst damals zu eigener Fischerei übergegangen seien, aber er gibt dafür keine Beweise 254 ). Für die lübische Fischerei am holsteini-


|
Seite 140 |




|
schen Strande im Mittelalter besteht ja das einzige vorgebrachte Zeugnis in dem Privileg von 1252. Ob für die Anliegerfischerei vor 1500 etwas festzustellen ist, wissen wir nicht. Sollte es nicht der Fall sein, so würde doch hieraus nicht geschlossen werden können, daß sie überhaupt nicht vorhanden war. Solche Argumentatio e silentio fontium wäre unzulässig.
Es kommt auch gar nicht darauf an, mit was für Geräten gefischt wurde, und ob die Wadenfischerei vormals nur in Lübecker Hand war, was übrigens nicht nachgewiesen ist. Gewehrt hat Lübeck sich lange gegen die Ausbreitung der Niendorfer und Timmendorfer Wadenfischerei; aber die Fischer dieser Ortschaften fanden eben keine genügende Unterstützung bei ihrer Obrigkeit, dem Domkapitel 255 ), das sich ja auch bei dem Streit wegen des Steinholens am Brodtener Ufer schwach zeigte 256 ). Nach Rörig (II, S. 258) sollen wir behauptet haben, die Lübecker hätten sich "in der Niendorfer Wiek Fischereirechte erst all-


|
Seite 141 |




|
mählich auf Kosten der Fischerei der Strandanlieger angemaßt". Gesagt haben wir aber, daß Lübeck es unternommen habe, in der Niendorfer Wiek "die Fischerei der Küstenbevölkerung zurückzudrängen und ihr Bedingungen vorzuschreiben", bis schließlich 1817 der Niendorfer Vergleich auf der Grundlage der Gleichberechtigung abgeschlossen worden sei 257 ). Zum Beweise der Richtigkeit dieses Urteils berufen wir uns auf das, was Rörig I, S. 12 f. dargelegt hat. Wenn er jetzt erklärt, er müsse uns die Verantwortung überlassen "für diese Art, einwandfrei erwiesene historische Entwicklungsreihen auf den Kopf zu stellen", so überlassen wir ihm dagegen die Verantwortung für die Entstellung unserer Ausführungen. Selbstverständlich hatten die Lübecker durch das Privileg von 1252 das Recht erlangt, in der Niendorfer Wiek zu fischen, aber sie hatten dort nicht die ausschließliche Fischerei, waren also auch nicht befugt, den Niendorfern und Timmendorfern Bedingungen vorzuschreiben. Wenn sie z. B. 1729 den Niendorfern, die in der Wiek mit der Wade nach Dorsch fischten, ihre Fanggeräte beschlagnahmten 258 ), d. h. raubten, so war das eine Tat des Erwerbsneides und nichts weiter als nackte Gewalt.
Was Rörig für die holsteinische Küste gefunden zu haben meint, hat er auch für die mecklenburgische vorausgesetzt. "Das steilere Ufer der mecklenburgischen Küste", so heißt es I, S. 20 f., "ist für eigene Schiffahrt und eigene Fischerei gleich ungünstig: erst wo die Buchten an ihr beginnen, setzt früh die eigene Fischerei ein. Das in der ausschließlichen Ausübung von Schiffahrt und Fischerei vor dieser Küste bis Wismar hin liegende absolute Übergewicht Lübecks wurde hier um so weniger beeinträchtigt, als an dieser Küstenstrecke weder für Schiffahrt noch Küstenfischerei die nötigen Stützpunkte (Häfen) vorhanden waren: infolgedessen blieb die Küstenfischerei hier so gut wie in ausschließlicher Nutzung durch die lübischen Fischer." Das alles wurde rein konstruktiv, ohne irgendeinen Beweis behauptet. Wir haben 1923 erwidert: "Zu Rörigs Meinung, daß das steile Ufer der mecklenburgischen Küste bis Wismar hin" (d. h. bis zur Wismarer Bucht) "für eigene Fischerei ungünstig sei, bemerken wir, daß ebenso gut wie die Lübecker auch die mecklenburgischen Fischer hier ihre Netze aufs Land ziehen konnten und daß überall genügend Vorstrand


|
Seite 142 |




|
und Lücken im Steilufer vorhanden sind, um die Fischerei zu ermöglichen. Gerade an der Küstenstrecke bis zur Harkenbeck ist so viel Vorstrand wie kaum irgendwo anders am mecklenburgischen Meeresufer; hätte sich hier keine eigene Fischerei ausbilden können, so wäre dies an einem großen Teile der Küste Mecklenburgs ebensowenig möglich gewesen. Der ÂStützpunkte (Häfen)' bedarf es für den Fischfang überhaupt nicht, sondern nur für die Ausübung des Fischergewerbes und des Fischhandels nach großem Maßstabe. Aber auch die Dorffischer werden Gelegenheit gehabt haben, ihren Fang in den Städten und Dörfern der Umgegend abzusetzen. In der Tat wurden die Heringe, die 1616 mit der großen Reuse gefangen waren, an die Landbevölkerung und sogar in Travemünde verkauft, während die Lübecker in Mecklenburg nichts feilboten" 259 ).
Inzwischen hat Rörig in seinem neuen Gutachten (II, S. 257) erklärt, daß seine Angaben von 1923 jetzt auch für die gesamte mecklenburgische Küste festständen, "nicht zuletzt dank der im M. G. (unserem Gutachten) selbst enthaltenen Quellenzeugnisse". Diese ergäben "das Übergewicht der Städte auch in den Nutzungen der Fischerei für die mecklenburgische Küste". Also doch wenigstens nur noch ein Übergewicht. Er verweist dabei auf den Teil seiner Arbeit, der von der vermeintlichen Vormachtstellung der Städte Lübeck, Wismar und Rostock am mecklenburgischen Strande handelt, Thesen, die wir oben S. 52 ff. wohl ausreichend widerlegt haben. Wenn die Lübecker bis Klützer Höved hin fischten, was von uns nie bestritten ist, wenn die Städte sich - möglicherweise! - zeitweilig über Fischereibezirke geeinigt hatten, wenn die Warnemünder Seefischer, wie sich aus der Beschwerde Rostocks von 1621 ergibt, an der ganzen mecklenburgischen Küste ihrem Gewerbe nachgingen 260 ), so steht doch deswegen ein "Übergewicht" der städtischen Fischerei noch lange nicht fest. Z. B. gab es am Fischländer Strande eine bedeutende Anliegerfischerei, die gewiß älter ist als die zufällig erhaltenen Quellen bezeugen. Auch Wadenfischerei wurde hier betrieben; 1614/15 werden nicht weniger als zwölf Waden genannt 261 ). In neuester Zeit zählen die an der Wismarer Bucht gelegenen Küstendörfer zusammen weit mehr Fischer als Wismar selbst; und wenn man behaupten will, daß das Verhältnis früher umgekehrt gewesen sei oder daß Wismar


|
Seite 143 |




|
hier gar die alleinige Fischereigerechtigkeit gehabt habe, so muß man dafür Beweise vorlegen.
Die ganzen Anschauungen Rörigs über eine Alleinherrschaft der Seestädte auf dem Gebiete der Meeresfischerei rechnen gar nicht mit den tatsächlichen mittelalterlichen Verhältnissen. Kleinbetrieb war überall das Herrschende. Dabei muß der Fischverbrauch schon aus rituellen Gründen (Fastenspeise) verhältnismäßig bedeutend gewesen sein, und daß die Küstenbewohner sich die Gelegenheit hätten entgehen lassen sollen, Fische aus dem Meer zu holen, ist so unwahrscheinlich wie möglich. Aus den wenigen großen Seestädten konnte schon wegen der mangelhaften Verkehrsverhältnisse nicht alles beschafft werden.
Indessen ist es von geringerem Belang, ob die städtische Fischerei überwog oder nicht. Ausschließlich war sie in keinem Falle. Genau so früh und früher noch als die städtische Fischerei lassen sich Dorffischer an der mecklenburgischen Küste nachweisen. Wir erinnern an die Urkunde für das Kloster Neukloster von 1219 (oben S. 13). Weiter erscheint 1312 ein Dorffischer in Nienhagen, das östlich vom Heiligendamm an der dort sehr steilen und also nach Rörig "für eigene Fischerei" so ungünstigen Küste liegt 262 ). Nur Seefischerei kann er in dieser Gegend betrieben haben. Um 1360 wird ein Fischer in Niendorf auf Poel genannt 263 ). Zur selben Zeit, aus der Nachrichten über eine seit langem bestehende Lübecker Fischerei bis Klützer Höved hin erhalten sind, waren auch Tarnewitz und Boltenhagen, beide am Westeingange der Wismarer Bucht gelegen, schon ausgesprochene Fischerdörfer 264 ). Und wenn bei dem Fischereistreit mit Lübeck von 1616 neben anderen Zeugen zwei Tarnewitzer über die Strand- und Fischereiverhältnisse von Travemünde an vernommen wurden, so konnte der Grund nur darin liegen, daß die Fischer aus der Gegend der Wismarer Bucht auch nach Westen, nach Travemünde zu, mit ihren Booten kamen. Desgleichen erscheint 1616 ein Seefischer aus Wilmsdorf (nördlich von Dassow), und auch andere Zeugen aus Kl. Pravtshagen, Harkensee und Dassow wußten über die Seefischerei Auskunft zu geben. 1590 stand bei Brunshaupten eine herzogliche Reuse 265 ). 1618 ist in derselben Gegend Anliegerfischerei nachweisbar 266 ).


|
Seite 144 |




|
Ebenso um die gleiche Zeit an der Wismarer Bucht (Poel, Fischkaten) 267 ). 1690 werden sieben Leute aus Schwansee (nicht weit von der Harkenbeckmündung) als Fischer bezeichnet 268 ). Und 1773 fischten eine ganze Reihe von Gütern, die zwischen Wismar und Travemünde an der Küste liegen, seit langer Zeit 269 ). Das ist eine kleine Auslese, die sich auf den ganzen mecklenburgischen Strand verteilt und vermutlich noch vervollständigt werden könnte.
Schon die Feststellung von Seefischerei in Anliegerdörfern im 13. und 14. Jahrhundert deutet darauf hin, daß diese Zustände sich nicht erst nach 1500 entwickelt haben. Wer das annehmen will, hat keine Wahrscheinlichkeit für sich. Um die Zeit, aus der reichlicheres Quellenmatrial vorhanden ist, fischten an der mecklenburgischen Küste Dorffischer, Warnemünder, Wismarer, Lübecker und andere Fremde bunt durcheinander. So erschienen bei Brunshaupten um 1580 jahrelang holsteinische Fischer, die niemand dort vertrieb, auch nicht die herzoglichen Beamten, die ihnen aus dem Doberaner Wald Holz lieferten und ihre fünf Buden am Strande ruhig stehen ließen 270 ). Die Dinge lagen offenbar gerade so wie an der pommerschen Küste, wo schon im 13. und 14. Jahrhundert keineswegs nur städtische Seefischerei betrieben wurde 271 ).
Soviel über die mecklenburgische Küstenfischerei im allgemeinen. Im besonderen dreht sich der Streit um die Wasserfläche vor der Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck. Auf ihr soll Lübeck stets die alleinige Fischereigerechtigkeit gehabt haben; darin erblickt Rörig eine Hauptstütze für seine These von der Gebietshoheit Lübecks auf der "Reede" am mecklenburgischen Ufer. Und in seiner Beweisführung für die ausschließliche Fischereigerechtigkeit spielen die Lübecker Fischereiverordnungen eine wichtige Rolle. Sie sollen auch dartun, daß die Harkenbeck eine Hoheitsgrenze sei.
Da ist zunächst die Fischereiverordnung von 1585 272 ). Sie betrifft Binnenfischerei sowohl wie Seefischerei und ist zur Regelung von Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischergruppen erlassen worden. Zu Anfang wird gesagt, daß die Fischerei "up des erbarn Radts und gemeiner Stadt Stromen und angehorigen Potmessigkeiten" in Unrichtigkeit geraten sei. Hernach, bei den Bestimmungen über die Seefischerei der Travemünder, ist von "des


|
Seite 145 |




|
erbarn Radts Gerechtigkeit" die Rede. Aber es kommt gar nicht darauf an, wie es Lübeck gefiel, seine Fischereiplätze und Nutzbarkeiten bei seiner Verwaltung zu bezeichnen. Zur selben Zeit hat ja auch Mecklenburg im Streite mit Lübeck seinen Anspruch auf einen Teil dieser Gewässer (Dassower See usw.) vertreten. Mit Benennungen schafft man sich keine Gebietshoheit. Das ist offenbar auch Rörigs Meinung, ausgesprochen im Hinblick auf eine Erklärung des Herzogs Adolf von Holstein (I, S. 26).
Entscheidend ist etwas anderes. Die Verordnung regelt ja, soweit sie Seefischerei betrifft, nicht nur den Fischfang auf der Travemünder Bucht. Sondern es heißt bei den Bestimmungen über die Fischerei der Travemünder und Schlutuper:
". . oft ock wol de Travemunder und Schluckuper na oldem Gebrucke befoget, dat ganze Jahr dorch von Travemünde an beth in de Wick und apene wilde See, so with ein jeder sin Levent wagen will, tho fischen", so solle doch von Jakobi bis Michaelis in der Makrelen- und Tobias-Zeit folgender Unterschied gemacht werden: Es sollte nämlich den Travemündern erlaubt sein, alle Tage vom Blockhause bis zum Möwenstein und bis zur Harkenbeck "und ferner in der Wick und offenen See" zu fischen, den Schlutupern aber in derselben Zeit auf den Strecken bis zum Möwenstein und zur Harkenbeck nur am Montag Vormittag und in drei Nächten jeder Woche, und zwar nur mit dem dritten Teile ihrer Waden. Die übrigen beiden Drittel sollten zwischen Jakobi und Michaelis alle Tage "butten Herckenbeke und Mewenstein in der Wick und offnen fryen See, so with se willen", gebraucht werden dürfen ("mogen . . der Vischerey gebrucken").
Hier handelt es sich also um mehr als um die Fischerei in der Travemünder Bucht oder dem vermeintlichen Reedegebiet. Es wird unterschieden zwischen 1) Buchtfischerei (an den Küstenstrecken Blockhaus-Möwenstein und Blockhaus-Harkenbeck), 2) Fischerei in der Wiek, womit natürlich die Niendorfer Wiek gemeint ist, 3) Fischerei in der offenen See. Wie auf der Kaufmannschen Situationskarte, die dem Niendorfer Vergleich von 1817 beiliegt, die Wasserfläche vor der Strecke Niendorf-Gosebeck ein Bezirk "binnen Landes" genannt wird (oben S. 133), so könnte man auch das Fischereigebiet zwischen dem Blockhause und dem Möwenstein auf der einen, der Harkenbeck auf der anderen Seite als binnen Landes gelegen bezeichnen. Tatsächlich erstreckt sich ja allerdings die westliche Buchtküste weiter als bis zum Möwenstein, aber


|
Seite 146 |




|
dieses letzte Ende wurde nicht berücksichtigt, weil es für Wadenfischerei ungünstig ist 273 ).
Weil die Verordnung über die Harkenbeckmündung hinausgreift, so fällt jeder Grund weg, zu folgern, daß hier eine Hoheitsgrenze gewesen sei. In der Tat muß sich ja Lübeck auch auf der Niendorfer Wiek eine "Botmäßigkeit" - wiewohl auch hier unberechtigt - zugeschrieben haben. Denn wie hätte es sonst dazu kommen sollen, die Fischerei der Niendorfer und Timmendorfer zu regeln und Niendorfer Fischergeräte zu beschlagnahmen. Wollte man aus der Verordnung auf eine Gebietshoheit schließen, so müßte man sie folgerichtig auch auf die Niendorfer Wiek und die offene See ausdehnen. Nicht als Hoheitsgrenze erscheint die Harkenbeckmündung in der Verordnung, sondern - ebenso wie das Blockhaus und der Mewenstein - als interner Lübecker Fischereigrenzpunkt, zur Scheidung des wichtigen und günstig gelegenen Buchtbezirkes von den weiter östlich gelegenen Fangplätzen 274 ).
Dasselbe gilt von dem Vergleich zwischen den Lübecker und Travemünder Fischern von 1610, worin den Travemündern gestattet wird, außerhalb des Möwensteins und der Harkenbeck in der See und am Lande zu fischen und Netze zu setzen 275 ). Ferner heißt es in dem Fischereivergleich von 1826 unter D 3: "Krabben-Körbe dürfen der bisherigen Ordnung gemäß nur außerhalb des Möwensteins und Harkenbeck, ohne näher damit herein zu rücken, von den Travemünder Fischern gesetzt werden" 276 ). Weil also diese Bestimmungen das Gewässer östlich von der Harkenbeck betreffen, so ist nicht einzusehen, warum gleichartige Anordnungen, die für die Fangplätze westlich von der Bachmündung gelten, auf einer Lübecker Gebietshoheit beruhen sollen und warum die Harkenbeck eine Hoheitsgrenze sein soll. Sie ist eben nur eine interne Fischereigrenze.


|
Seite 147 |




|
Sowohl die Fischereiverordnung von 1585 wie der Vergleich von 1610 sind durch Streitigkeiten hervorgerufen worden, die zwischen den Fischergruppen obwalteten und dem Lübecker Rat zur Regelung unterbreitet wurden. Selbstverständlich konnte der Rat solche Konflikte schlichten und entscheiden, auch wenn es sich um die Fischerei auf Wasserflächen handelte, auf denen die Lübecker lediglich eine hergebrachte Nutzung ausübten. Das Recht dazu war aus dem Obrigkeitsverhältnisse des Rates zu den Fischerkorporationen und ihren Mitgliedern herzuleiten und braucht keineswegs auf einer Gebietshoheit zu beruhen. Zum Beispiel wurde in dem Vergleich von 1610 festgesetzt, es solle kein Travemünder "zu fischen befugt sein und zugelassen werden, der nicht sein eigen Haus habe und Nachbarrecht thue", ein Verbot, das doch auch für den Fang in offener See außerhalb der Harkenbeckmündung galt. Mag sich also Lübeck unter seiner "Botmäßigkeit" und "Gerechtigkeit" vorgestellt haben, was es wollte, für eine Gebietshoheit auf der Travemünder Bucht sind diese alten Anordnungen ebenso wenig ein Beweis wie für eine Gebietshoheit in der Niendorfer Wiek.
Der Vergleich von 1826 ist ein Privatvertrag, der zur Beendigung von Streitigkeiten zwischen den Travemündern und den übrigen Fischergruppen geschlossen und durch die Wette bestätigt wurde. Es waren wohl die Fischerkorporationen überhaupt nicht berechtigt, solche Vergleiche ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde abzuschließen. Auch dieser Vertrag band, ebenso wie die älteren Regelungen, lediglich die Lübecker Fischer.
Aber nicht nur sie waren auf der Travemünder Bucht fischereiberechtigt. Rörig behauptet freilich das Gegenteil, und er hat die Zeugnisse, die wir gegen seine Ansicht vorgebracht haben, zu entkräften gesucht. Gelungen ist ihm das nicht.
Zunächst soll Lübeck 1600 mecklenburgische Fischerei auf der Bucht nicht geduldet haben 277 ). Am 30. März 1600 nämlich beschwerten sich die Lübecker Fischer bei ihrem Rate über den früheren Schlutuper Wadenmeister Jochim Schröder, der in die Dienste des Junkers Vicke von Bülow auf Harkensee getreten war. Dieser hatte ihm eine große Wade machen lassen, und damit hatte Schröder nach Angabe der lübischen Fischer "außer der Reyde und innen der Traven und Pötenitze" (Pötenitzer Wiek) "zugleich auch diesen Tagk in der Niendurfer Wich gevischert neben unß". Also wohl auch auf der Travemünder Bucht, aber außerhalb der nautischen Reede. Der Rat entschied, daß den Fischern zu befehlen


|
Seite 148 |




|
sei, dem Schröder, "so weit sich des Raths Boden erstrecket und uf der Reyde", Wade und Kahn wegzunehmen. Danach eine Eintragung im Ratsprotokollbuch vom 4. April, wonach es sich um einen "neuen Heringfangk" handelte. Weiter im Wettebuch (11. April): Die Fischer sollten dem Jochim Schröder seine Geräte wegnehmen, "so verre se ehme up der Reyde bekomen werden", d. h. sofern sie ihm auf der Reede begegnen, ihn dort antreffen würden. Nach der Angabe vom 30. März war er ja auf der Reede noch nicht gewesen.
Nun sagten hernach, bei dem Fischereistreit von 1616 vier Zeugen aus Harkensee, Rosenhagen und Dassow aus, daß der alte Junker Vicke von Bülow mit der großen Wade bis vor Travemünde gefischt habe. Beides, die Eintragungen in den Protokollbüchern und die Aussagen, verschmilzt Rörig miteinander 278 ), und dadurch entsteht ein ganz falsches Bild. Denn unter der "Reede", auf der man den Bülowschen Fischer pfänden wollte, versteht Rörig die Wasserfläche bis zur Peillinie Berg-Mühle, obwohl in der Fischereiverordnung von 1585 das Wort "Reede" gar nicht vorkommt und der Vergleich von 1610 nur eine nautische Reede kennt. Die Hauptsache aber, die darin besteht, daß Jochim Schröder auf den Binnengewässern erschienen war, läßt er außer acht.
Einer der erwähnten Zeugen von 1616, ein Harkenseer, erklärte, es "habe der alte Vicke Bülow mit seiner großen Wade biß an der Lübischen Blockhauß gefischet, daselbst er nur 2 Wadenzüge geschonet". Mithin ließ Bülow an der mecklenburgischen Buchtküste fischen bis in die Gegend des Blockhauses, wo die Reede anfing 279 ). Dazu stimmt die Aussage eines Tarnewitzers, der von der Bülowschen Fischerei nichts berichtete, aber angab:"Außerhalb 2 Wadenzüge hinter der Lübischen Blockhause sei die Fischerey allenthalben gemein gewesen". Was waren das für Wadenzüge? Es können nur solche zwischen dem Blockhause und dem Möwenstein gemeint sein. Hier war - bis zur Brodtener Grenze - Lübecker Strand, und davor lag die Reede. Wer hier mit der Wade fischen wollte, mußte diese über das Gebiet der nautischen Reede hinweg an den Lübecker Strand ziehen. An dieser Stelle war - laut den erwähnten Aussagen von 1616 - die Fischerei in der Tat ausschließlich in lübischen Händen. Seinen eigenen Strand gab Lübeck für Fremde nicht her; aber das lag auch in der Natur der Sache, denn hier war ja die Wadenfischerei


|
Seite 149 |




|
durch die auf der Reede liegenden Schiffe behindert und konnte gewiß nur in eingeschränktem Maße betrieben werden.
Wenn also der Bülowsche Fischer sich wiederum auf den Binnengewässern (so weit sich des Raths Boden erstrecket) zeigen oder den Schauplatz seiner Tätigkeit auf die nautische "Reyde" verlegen würde, dann wollte man ihn fassen. Aber er hütete sich augenscheinlich, seine Wade an den Lübecker Strand zu ziehen, sondern blieb "außer der Reyde". Daher konnte man ihm auf der Bucht nichts anhaben; ausdrücklich sagte ein Rosenhäger Zeuge 1616, er sei bei dieser Fischerei "biß an Travemunde hinan" mit dabei gewesen, und es sei ihnen "nicht gewehret worden".
Was nun mit dem "neuen Heringfang", wie es im Lübecker Ratsprotokollbuche heißt, gemeint ist, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Nach der Aussage eines Zeugen aus Dassow, der also nicht weit von Harkensee wohnte, von 1616 hatte Vicke von Bülow die erste große Wade machen lassen. Wir wollen nicht darüber streiten, ob weitere große Waden gefolgt sind. Von den Bülowschen Besitzungen Harkensee und Rosenhagen aus hatte man nach den Akten über den Fischereistreit von 1616 nur zur Zeit des alten Junkers und seines Fischers Schröder mit der großen Wade gefischt; wenigstens wird nichts weiter angegeben. Aber auf die Geräte kommt es nicht an. Wenn der "neue Heringfang" etwas vom Lübecker Standpunkte aus Verbotenes bedeuten sollte, so kann sich dies nur darauf beziehen, daß Bülow seinen Fischer auch auf die Trave und die Pötenitzer Wiek geschickt hatte. Denn auf den strittigen Binnengewässern wurde ja ebenfalls nach Heringen gefischt. Das besagt schon die Fischereiverordnung von 1585, wonach die Travemünder die große Heringswade auf der Trave vom Stolper Haken an gebrauchen durften. Auch aus den Akten über den Prozeß um die Binnengewässer geht es hervor. Wie uns mitgeteilt ist, werden noch heute auf dem Dassower See Heringe gefangen, die mit einlaufendem Strome hereinziehen.
Die Beschwerden der Lübecker über die Bülowsche Fischerei haben mit der Travemünder Bucht, abgesehen von der nautischen Reede, die ja Jochim Schröder tatsächlich vermied, nichts zu tun, sondern gehören in den Zusammenhang des Prozesses um die Untertrave, die Pötenitzer Wiek usw., der zu eben jener Zeit in vollem Gange war. Begreiflich genug, daß die lübischen Fischer den abtrünnig gewordenen Jochim Schröder bitter haßten und ihn am liebsten dem Lübecker Rate "zu Händen" geschafft hätten. Man muß auch wissen, daß Vicke von Bülow auf Harkensee ein sehr eifriger Vorkämpfer des mecklenburgischen Rechtes auf die Binnen-


|
Seite 150 |




|
gewässer war. Also war er wohl in Lübeck nicht beliebt. Er spricht noch aus dem Grabe; denn es haben sich Briefe von ihm an den herzoglichen Rat Dr. Cothmann erhalten, worin er über diese Gewässer schrieb. Und in einem der Briefe (von 1598) sagt er, daß "die Lübischen alle ihre actus turbatorios actus possessorios nennen". Wäre er noch achtzehn Jahre später am Leben gewesen, so würde er Gelegenheit gehabt haben, diesen Ausspruch auch auf das Verhalten Lübecks in der Travemünder Bucht, bei dem Fischereistreit von 1616 anzuwenden.
Auf diesen Fischereistreit von 1616, wollen wir jetzt des näheren eingehen. Auch hier sollen wir ja wieder eine "tendenziöse Auswahl" von sogenannten Ortsangaben (gemeint ist die Ausdehnung des Küstengewässers) geliefert haben. Woher nimmt eigentlich Rörig (II, S. 262) den Mut zu dieser Behauptung, die doch nur den Zweck haben kann, unsere Benutzung des in Betracht kommenden, für Lübeck allerdings sehr ungünstigen Materials zu verdächtigen? Und welche anderen "Ortsangaben" sind denn Rörig bekannt? Wir haben im Gegenteil das Material, das geheimzuhalten wir am allerwenigsten Ursache hätten, umständlich behandelt und werden es jetzt noch genauer vorlegen, soweit dies nicht schon im bisherigen Verlaufe unserer Untersuchungen geschehen ist.
Einige in der Gegend von Dassow Ansässige, nämlich Hans von Plessen auf Dönkendorf, Jürgen von Bülow auf Harkensee und der Pächter Christian Sithmann zu Wieschendorf ließen gemeinsam eine große Fischreuse anfertigen und im März 1616 am Strande von Rosenhagen, das zu Harkensee gehörte, aussetzen. Die Reuse hatte über 100 Gulden gekostet. Ihre riesige Ausdehnung geht daraus hervor, daß sie nach Angabe des Lübecker Rates "mit 17 Pfälen, vielen stehenden und hangenden Netzen, Draggen (= Ankern) und anderen Sachen" versehen und, vom Ufer an gerechnet, 266 Faden (478 m) lang war. Die Entfernung vom Ufer bis zur Reuse betrug 30 Faden (54 m) 280 ). Nach einer weiteren Angabe des Rates stand die Reuse "von dem Harkenbeke quer über biß auf 4 und mehr Faden tief in die Sehe hinein, gegen dem Munde oder Eingange unsers Travenstrombs" 281 ) Danach hätte sich der äußerste Reusenpfahl seewärts in einer Wassertiefe von mindeftens 7,2 m befunden. In Mecklenburg behauptete man, daß die Reuse "vom Lande oder Strande ab biß


|
Seite 151 |




|
in die Sehe etwa ein Buchßenschuß oder 100 Faden langk hinein belegen, und an dem Ort, da die letzten Pfale der Reusen in der Sehe gestanden, die Tiefe des Wassers nur vierdtehalb Faden ist." Bei niedrigem Wasserstande sei die Tiefe noch geringer 282 ). Als diese Angaben von mecklenburgischer Seite gemacht wurden, stand aber die Reuse nicht mehr, und es ist dabei die Reusenlänge offenbar unterschätzt worden; denn bei einer Entfernung von 180 m vom Ufer kommt man lange nicht auf eine Tiefe von 31/2 Faden (6,3 m). Die von Lübeck genannte Länge wird also eher das Richtige treffen. Die Wassertiefe ist aber von Lübeck übertrieben worden und wird auf 5 bis höchstens 6 m zu reduzieren sein. Jedenfalls ist sicher, daß die Reuse bis in die schiffbare See hineinreichte.
Am 29. März richtete der Lübecker Rat an die Eigentümer der Reuse die Forderung, das Instrument zu entfernen. Für diese Forderung gab er zwei Gründe an: es werde den lübischen Fischern durch die Reuse "der Ort, da sie ihren freyen Wadenzug zu haben pflegen, gentzlich benommen", und des weiteren sei "dem sehefahrenden Manne so wol von dem Lichte in der Hütten, welches ihn bey nachtlicher Zeit verleiten möchte, alß auch von den Pfahlen, daran die Reuse henget, allerhand Schade und Gefahr zu beforchten". Lübeck könne "solche hochsched- und gefehrliche Neurung und Thätigkeit" auf seiner "Reyde" nicht dulden. Plötzlich sollte also gegenüber Rosenhagen eine Lübecker Reede sein, wovon bisher noch niemand etwas bemerkt hatte.
Plessen, Bülow und Sithmann erwiderten am 6. April, sie hätten zwar "in der offenbaren Ost-Sehe eine Fischreuse, da jedermahn fischen magk", setzen lassen, indessen könnten die Lübecker trotzdem fischen; ihnen selber aber könne die von alters her ausgeübte Fischerei in der Ostsee nicht verwehrt werden 283 ). In der


|
Seite 152 |




|
Hütte sei ihres Wissens bisher kein Licht, sondern nur Feuer zur Heizung gehalten worden, wodurch den Seefahrern ebenso wenig wie durch die Reusenpfähle Schaden erwachsen könne. Zugleich wurde um Abhaltung eines Lokaltermins ersucht. Dann werde Lübeck erfahren, "wie zue Weitleuftigkeit kein Anlaß, warumb wir dan vor unsere Persohn bitten, uns bis dahin ungetorbieret bleiben zue laßen".
Lübeck erwiderte am 14. April. In dem Schreiben heißt es: "Ob wir uns nun aber wol unserer der Ends zustehenden Gerechtsamb guter maßen zu erinnern und weitleufige Communication deswegen zu pflegen, nicht so gantz nötig erachtet", so wolle man doch "zur Antzeigung, das wir nirgends anders als zu guter nachbarlicher Correspondentz geneigt", Abgeordnete schicken. Der Lokaltermin (18. April) verlief ergebnislos. Ein Protokoll darüber besitzen wir nicht 284 ). Gleich am nächsten Tage schritt Lübeck zur Gewalt. Es erschien um 6 Uhr abends ein "Haufes Volks", eine reisige Schar auf Booten (11 Stück, jedes mit 12 Mann besetzt) und riß die Reuse weg.
Sofort (20. April) beschwerten sich die Geschädigten beim Herzoge Adolf Friedrich. Sie erklärten, daß sie die Heringsreuse "in der offen freyen Ostsehe" hätten auslegen lassen, "eine Meil Weges uf diesseit Travemunde am Harckenseher Felde, da unstreitig das Strandtgericht dem Hause Greveßmühlen zustehet, und da jederman, nicht allein unsere Underthanen, sondern die am Strande wohnende Leute fischen mugen, auch da Vicke von Bülow zum Harkensehe sehliger des Orts und bis an Travemunde mit einer großen Waden gefischet". Die Lübecker hätten geschrieben, die Reuse solle abgeschafft werden, weil sie "uf ihren Strömen stunde". Man habe erwidert, sie stehe nicht auf Lübecker Strömen, sondern in der freien Ostsee 285 ). Auf dem Lokaltermin habe man dartun wollen, daß die Reuse sich "am megklenburgischen Grundt und Bodden, da jederman zu fischen frey stehet, der Statt Lubegk oder sonsten kemanden (keinem) zu Schaden" befunden habe. Die Abgesandten des Lübecker Rates aber hätten erklärt, daß es sich um eine "Neuricheit" handele. Man habe darauf die Forderung, die Reuse zu entfernen, abgelehnt, es sei denn, daß der Herzog, dem man die Sache vorlegen wolle, Befehl dazu erteile. Eine Prüfung


|
Seite 153 |




|
der Angelegenheit werde ergeben, daß die Reuse von des Herzogs "Strandgericht mit Unrecht und Gewalt" weggenommen sei.
Die herzogliche Regierung war nicht geneigt, "solche der Stadt Lübeck an beruhrtem Orth zu Abbruch und Schmelerung unser daselbst habenden Strandtgerechtigkeit verubete Thetlicheit also mit schlechtem Zusehen hingehen zu lassen", wollte aber vorher "notturftigen Bericht aller Beschaffenheit" erlangen. Daher wurden die herzoglichen Räte Nikolaus von Below und Dr. Christoph von Hagen beauftragt, sich nach Harkensee zu verfügen und mit Hülfe ortskundiger Zeugen eine Untersuchung anzustellen, "insonderheit wegen unser Strandtgerechtigkeit und wie es bißher mit der Fischerey des Orthes gehalten, auch ob und was für Felle mit Schiffbruch und darauf fürgenommene Bergung sich alda begeben".
Dieser Lokaltermin fand am 30. April im Beisein der Geschädigten, des Grevesmühlener Amtmannes und der Herren von Parkentin auf Prieschendorf und Lütgenhof statt. Es wurden dabei elf Zeugen unter Eid vernommen, denen man neun Fragen vorlegte.
Vier von den Fragen, Nr. 1, 3, 4 und 7, sind schon früher von uns mitgeteilt und bei Rörig II, S. 281 abgedruckt worden. Die erste Frage, die die Strandgerechtigkeit im allgemeinen betrifft, haben wir auch oben S. 47, Anm. 74 wiedergegeben, die zweite Frage (Bergerecht und Fahrrecht im besonderen) oben S. 121, Anm. 218, die fünfte S. 46.
Die erste Frage, nach der Strandgerechtigkeit bis zur schiffbaren Meerestiefe von Travemünde an, wurde von sämtlichen Zeugen, die wir hernach einzeln anführen werden, bejaht 286 ); fast regelmäßig beriefen sich die Zeugen dabei auch auf den Bericht alter Leute, von denen sie davon gehört hatten. Hervorheben wollen wir, daß ein Tarnewitzer, der Sohn eines verstorbenen Strandvogtes, von seinem Vater wußte, daß der Strand bis Travemünde mecklenburgisch sei; das Revier seines Vaters habe so weit gereicht. Auch ein zweiter Zeuge aus Tarnewitz, ebenfalls der Sohn eines verstorbenen Strandvogtes, bejahte die Frage und führte dabei seinen Vater als Gewährsmann an 287 ). Speziell die Strecke Travemünde-Harkenbeck (Rosenhäger Grenze) haben wir schon oben S. 106 ff. behandelt, es ist kein Zweifel, daß die


|
Seite 154 |




|
Strandhoheit hier die Jahrhunderte hindurch mecklenburgisch gewesen ist. Und daß die Ausdehnung des Strandes bis zum schiffbaren Strom keineswegs ein "Unikum", eine Verlegenheitserfindung der Kommissare von 1616 war, wie Rörig annimmt 288 ) sondern daß die Frage 1 den überall geltenden Strandbegriff ausdrückte, das haben wir im ersten Berichtsteile nachgewiesen 289 ). Es wäre ja ganz sinnlos gewesen, plötzlich einen Strandbegriff aufzustellen, den niemand kannte und den daher kein Zeuge hätte annehmen können. Wenn Rörig meint, die Kommissare hätten sich widersprochen, indem sie eine "zweite, zutreffendere" Formulierung hinzusetzten, so mißversteht er den Sinn der Worte: "von Travemunde an biß hinunter 290 ), so weit meckelburgisch Grundt und Bodem sich erstrecket". Hier ist weniger die Ausdehnung des Strandes seewärts, als vielmehr die Richtung des mecklenburgischen Gebietes von Travemünde an nach Osten zu gemeint. Aber auch gerade der Strand selbst wurde oft genug als "Grund und Boden" bezeichnetet 291 ). Er gehörte zum Territorium.
Die erste Frage lautet zugleich dahin, ob nicht die Herzöge und ihre Beamten weder den Lübeckern noch irgend jemand anders von ihrer Strandgerechtigkeit "das allergeringste außerhalb der gemeinen Fischereyen" zugestanden hätten. Daraus geht hervor, daß man den Lübeckern diese gemeinsame Fischerei nicht bestritt. Die Zeugen gingen hierauf nicht näher ein, doch ist ihre Antwort in der Bejahung der ganzen Frage enthalten. Des weiteren aber zeigt dieser Teil der ersten Frage, daß die Fischerei zur Strandhoheit gehörte, ein Rechtsgrundsatz, der sich nicht etwa nur hier findet, sondern allgemein war, wie wir ebenfalls im ersten Berichtsteile dargelegt haben. Es genügt, auf die völlig gleichartigen Erklärungen der Städte Ribnitz und Rostock von 1664/65 und 1675 zu verweisen (oben S. 77 ff.). Genau so wie die herzoglichen Kommissare 1616 Lübeck gegenüber haben auch Ribnitz und Rostock sich gegenüber der Landesherrschaft auf das Bergerecht berufen, um ihre Fischereigerechtigkeit damit zu beweisen. Die Fischerei an sich konnte ja eine bloße Nutzung sein. Wer aber das Bergerecht aus-


|
Seite 155 |




|
übte, der hatte das Strandregal und mußte daher auch die Fischerei als Regal innehaben.
Im besonderen sollten die Fischereiverhältnisse durch die Fragen 3 und 4 klargelegt werden. Diese Fragen lauteten:
3) Ob nicht wahr, das die Hertzogen zu Meckelnburgk wie auch derselben Beambten, auch des Orts am Strande Angrentzende vom Adel und derselben Unterthanen sich je und allewege über Menschengedencken hero der Fischerey auf der gantzen Ostsehe deßelben Orts biß an Travemünde mit und nebenst den Lubischen Fischern, oder wer sonsten alda fischen wollen, ruhesamblich gebrauchet, und ihnen deßwegen weder von den Lubischen oder jemandt anders kein Eintragk und Behinderung, ohne was itzo mit der Fischreuse vorgenommen, zugefueget worden?
4) Ob nicht wahr, das ihnen nie vorgeschrieben, ob sie mit großen oder kleinen Waden, großen oder kleinen Netzen oder auch andern Instrumenten, dadurch sie Fische oder Hering fangen könten, fischen sollen und mügen?
Hier die Antworten:
1) Mathias Kröger aus Wendisch Tarnewitz, 66 Jahre alt: Zu 3: Affirmat, außerhalb 2 Wadenzüge hinter der Lubischen Blockhause sei die Fischerey allenthalben gemein gewesen. Zu 4: Affirmat.
2) Hans Bandow aus Wendisch Tarnewitz, 65 Jahre alt: Zu 3: Sagt, er habe nicht gehöret, daß jemande das Fischen an den Orten verbotten oder gewehret sey. Zu 4: Affirmat.
3) Chim Kelling aus Kl. Pravtshagen, bei 60 Jahren alt: Zu 3: Affirmat, und habe von keiner Verhinderung gehöret alß dieses Mahl. Zu 4: Affirmat.
4) Hans Bose aus Harkensee, bei 80 Jahren alt: Zu 3:Affirmat, und habe Vicke Bulow mit der großen Wade biß harte für Travemunde gezogen. Zu 4: Affirmat, und habe sein Lebtage nicht anders gehoret.
5) Asmus Femerling zu Harkensee, bei 60 Jahren alt: Zu 3: Affirmat. Zu 4: Affirmat, sei außerhalb dieser Reusen niemalß gewehret zu fischen, womit sie gewolt.
6) Peter Schmitt aus Rosenhagen, ungefähr 60 Jahre alt: Zu 3 : Affirmat, und sagt, daß der alte Juncker Vicke von Bulow mit der großen Heringswade biß an Travemunde hinan gefischet, da Zeuge mit dabei gewesen, und ihnen nicht gewehret worden. Zu 4: Affirmat, und habe sein Lebtage nicht gehoret, daß einem oder dem andern gehindert


|
Seite 156 |




|
oder verbotten, mit seinem Zeuge, es sei gewesen, waß eß wolte, seines Gefallens zu fischen.
7) Asmus Wittenburg zu Wilmsdorf, über 64 Jahre alt: Zu 3 und 4: Affirmat.
8) Peter Quedenborch aus Wilmsdorf, bei 40 Jahren alt: Beantwortete nur die erste Frage und hatte von den übrigen Artikeln "keine Wissenschaft".
9) Carsten Wilde aus Wilmsdorf, bei 48 Jahren alt: Zu 3 und 4: Affirmat
10) Heinrich Feldtmann aus Harkensee, bei 60 Jahren alt: Zu 3: Affirmat. Zu 4: Affirmat, und habe der alte Vicke Bulow mit seiner großen Wade biß an der Lubischen Blockhauß gefischet, daselbst er nur 2 Wadenzuge geschonet.
11) Hans Wibbernitz aus Dassow, 82 Jahre alt: Zu 3: Affirmat. Zu 4: Affirmat, und habe Vicke Bulow die erste große Wade machen laßen und damit biß an Travemunde und Nyendorf gefischet.
Hiernach kann sich jeder ein Urteil darüber bilden, ob - laut diesen Aussagen, abgesehen von anderen Quellen, die wir noch bringen werden - auf der See "biß an Travemünde" eine mecklenburgische Fischerei bestand, wie wir behauptet haben und noch behaupten.
Die Frage 7 lautet: "Ob nicht wahr, das auf jener Seit des Mehres, da holsteinischer Grundt und Bodem ist und die Lubischen sich ebenermaßen der Fischereyen anmaßen, dergleichen Fischreusen stehen und gehalten werden und von den Lubischen deßwegen keine Verhinderung geschehen?" Hierauf erwiderte der 1. Zeuge (aus Tarnewitz): "Affirmat, und habe Zeuge selbst, wan er des Orts gefischet, zwey Reusen alda gesehen, die eine stunde auf dieser Seit der Gröpenitz und die andere nicht weit von der Neustatt, daselbst die Lubischen auch fischen und solchs seines Wissens nicht gehindert noch hindern können, weil es einem jeden frey, und liefen daselbst gleicher Gestaldt viel Schiffe." Der 5. Zeuge, ein Harkenseer, sagte, "uf der Holsten Seiten zu Farve 292 ), da Henning Powische wohnet, habe er eine Reuse gesehen". Die übrigen Zeugen waren in jener Gegend nicht gewesen; einer von ihnen, der 4. Zeuge, wußte nicht zu antworten, "weil er nicht fische".
Auf den Rest der Fragen und die Erwiderungen darauf brauchen wir nicht näher einzugehen, weil sie für die rechtlichen


|
Seite 157 |




|
Verhältnisse nichts Neues besagen oder unwesentlich sind, abgesehen von zwei schon oben S. 46 f. mitgeteilten Antworten auf die fünfte Frage (Zeugen 4 und 9) 293 ).
Rörig (II, S. 281 f.) bemerkt zu den Fragen 1, 3, 4 und 7, die ihm durch uns bekannt geworden sind, sie beabsichtigten "jedenfalls weniger, sachliche Angaben über den Vorfall des Jahres 1616 zu erhalten, als in den Zeugenaussagen eine Bestätigung von dem, was die Mecklenburger Regierung an allgemeinen Grundsätzen für ihr Recht hielt oder als Recht glaubte beanspruchen zu dürfen". Das kann man natürlich von allen Fragen behaupten, die in der damals üblichen Form (ob nicht wahr usw.) aufgestellt wurden, und wenn man dann noch, wie Rörig, annimmt, daß die Zeugen


|
Seite 158 |




|
aus Respekt vor ihrer Obrigkeit die Eidespflicht vergaßen - was gar nicht der Fall war, denn wenn sie nichts wußten, sagten sie nichts -, so mag man sich der Wertlosigkeit solcher Zeugenprotokolle getrösten. Auf die Zerstörung der Reuse kam es bei dem Verhör wenig an; die war notorisch. Was man vor allem wollte, war Feststellung der Strandgerechtigkeit einschließlich der Fischerei. Das Protokoll zerfällt in drei Teile. Zunächst handelt es von der Besichtigung der Gegend, wo die Reuse gestanden hatte. Schon hierbei war mindestens ein Teil der Zeugen zugegen, und da bei dieser Gelegenheit bereits vieles zur Sprache kam, was hernach beim Zeugenverhör wiederkehrt, so hat man die Fragen vermutlich nach dem Ergebnisse der Voruntersuchung formuliert 294 ). Dann folgte das Verhör auf dem Hofe Harkensee, schließlich noch eine Besichtigung des Priwalls, weil die Zeugen auf das mecklenburgische Bergerecht dort eingegangen waren. Die 9 Fragen selbst sind völlig klar und logisch aufgebaut; sie betreffen die Strandgerechtigkeit im allgemeinen, Fälle von Bergerecht und Fahrrecht im besonderen, dann die Fischerei im allgemeinen, die Fanggeräte und schließlich die Fischreuse und was damit zusammenhing.
Rörigs Einwendungen gegen die Fragen und Antworten erklären sich nur daraus, daß er rechtliche Verhältnisse voraussetzt, die tatsächlich nicht vorhanden waren. Alles, was das Protokoll über die Fischerei ergibt, führt er zurück auf die seiner Meinung nach nur zufällig ungestört gebliebene Wadenfischerei Vicke von Bülows. So zu argumentieren, ist aber nach dem Gesamtinhalt der Aussagen ganz unmöglich. Wer berichtete denn etwas von dieser Wadenfischerei? Zwei Zeugen aus Harkensee und einer aus Rosenhagen, also Leute aus den Bülowschen Besitzungen, dazu ein Dassower, der in der Nähe wohnte. Und es ist erklärlich genug, daß sie darauf zu sprechen kamen; denn sie lieferten damit ja einen starken Beweis gerade für die Fischerei von Rosenhagen aus.
Wenn Rörig ferner meint, daß "bei der Lage der Harkenbeck am Ende der Reede in den Fragen" 3 und 4 (bei ihm 2 und 3)


|
Seite 159 |




|
"fortwährend zugleich auf tatsächlich bestehende mecklenburgische Fischerei nordwestlich der Harkenbeck verwiesen werden konnte, gegen die Lübeck kein Einspruchsrecht zustand", so trifft das zwar insofern zu, als es die Harkenbeckgrenze in Wirklichkeit nicht gab, man sie also auch nicht berücksichtigen konnte, aber das Entscheidende ist, daß es in der Frage 3 ausdrücklich heißt: bis an Travemünde. Falsch beurteilt Rörig auch die Frage 7 (bei ihm Nr. 4). Es sollte darin Lübeck keineswegs das Recht bestritten werden, an der holsteinischen Küste zu fischen; "anmaßen" hatte damals nicht die heutige Bedeutung, es heißt einfach: sich zuschreiben.
Die von Rörig besprochene Aussage eines Wilmsdorfers (Zeuge 7), daß "die Buttnetze viel weiter, alß diese Reuse gestanden, in die Sehe hinein, da es bißweilen woll 24 Faden tief ist, gesetzet" würden, "wie Zeuge solchs selbst woll gethan, und sei nicht gewehret", ist eine Erwiderung auf die Frage 6 (oben Anm. 293), und es sollte damit nur dargetan werden, daß Schifffahrt und Fischerei durch die Reuse nicht hätten Schaden erleiden können. Die Tiefenangabe von 24 Faden trifft allerdings für die Lübecker Bucht nicht zu, aber solche Zahlen wurden oft willkürlich hingeworfen 295 ).
Schließlich sucht Rörig seinen Kampf gegen die Zeugenaussagen damit zu unterstützen, daß nach Techen 1597 - beim Prozesse um das Strandrecht an der Insel Lieps - nichtwismarische Zeugen Behauptungen aufgestellt hätten, durch die ihre Glaubwürdigkeit aufs ärgste diskreditiert werde 296 ). Aber er hat auch damit kein Glück 297 ). Im übrigen weiß jedermann, daß Zeugenaussagen mitunter zu beargwöhnen sind. Aber deswegen kann man sie doch nicht alle verwerfen.


|
Seite 160 |




|
Man kann sich auch die Vernehmung kaum so vorstellen, daß längere Fragen wie Nr. 1, den Zeugen einmal vorgelesen wurden und daß dann gleich die Antwort erfolgte und notiert wurde. Verlesen sind die Fragen gewiß, aber es hinderte nichts, sie zu wiederholen und zu gliedern. Unmöglich kann man annehmen, daß während des ganzen Verhörs nichts weiter gesprochen wurde, als im Protokoll steht. Das trifft für kein Protokoll der Welt zu, das nicht stenographisch aufgenommen ist. Um aber den richtigen und unverfälschten Sinn der Antworten festzuhalten, dazu hatte man Notare. Deswegen ist auch das ganze Protokoll von 1616, über die Lokalbesichtigung sowohl wie über das Verhör, von einem Notar aufgezeichnet worden, der "der Zeugen eidtliche Kundtschaft getreulich protocolliret" hat, das Schriftstück dann eigenhändig mundierte, die Reinschrift selber kollationierte und mit seiner Unterschrift beglaubigte.
Bei der Ortsbesichtigung, die dem Verhör vorausging, wurde laut dem Protokoll festgestellt, daß dort, wo die Reuse gestanden habe, "die rechte offenbare Ostsehe sey; uf dieser Seiten des gantzen Wassers ist unstreitig meckelnburgisch Grundt und Bodem, uf jener Seiten aber, welchs von der Meckelburger Seiten und Lande kaum eine 3 Meilwegs breit und man gantz woll übersehen kan, ists holsteinischer Grundt und Bodem . ." Also zog man die ganze Lübecker Bucht in Betracht, nicht allein die Travemünder oder gar ein Reedegebiet im Rörigschen Sinne. Erst bei der Besichtigung des Priwalls, die nach dem Zeugenverhör stattfand, wird nebenbei die Reede erwähnt, und zwar die nautische Reede, die, wie die Kommissare ausdrücklich sagten, beim Blockhause lag. Von einer Reede im weiteren Sinne wußte kein Mensch etwas. Ebenso wenig wurde von einer Harkenbeckgrenze gesprochen. Dagegen setzten die Kommissare die zerstörte Reuse mit Reusen am holsteinischen Strande in Vergleich, wo die Lübecker ebenfalls Fischerei betrieben. Sie machten also keinerlei Unterschied zwischen dem lübischen Fischfang vor der holsteinischen und vor der mecklenburgischen Küste, und das war auch vollkommen richtig.


|
Seite 161 |




|
Am 4. Mai erstatteten die Kommissare unter dem frischen Eindrucke ihrer Ermittelungen dem Herzoge einen Bericht. Da wurde denn gegenüber allen den Klagen der Lübecker, die das offene Meer vor Rosenhagen für ihren Travestrom und ihre Reede ausgäben 298 ), betont, daß die Reuse auf mecklenburgischem Strand und Boden gestanden habe und daß "den Lubischen Fischern umb und bei derselben zu fischen ganz nichts benommen, ja, ihnen außerhalb eines solchen geringen Pläzleins ein so großes weites Sehewasser auf etliche Meil lang und breit offen und frei stehet, wie auch gleiche Reußen auf und bei ihrem Grund und Bodem zu setzen ihnen erlaubt und unverbotten". Das Fahrwasser der Schiffe liege weiter seewärts, und "da gleich uber Verhoffen kleine Schiffe oder Schuten des Ohrts hinkommen solten", so könnten doch "die Pfehle oder Reuse denselben (ja nicht einmahl einem Bohte, gestald der von Lubeck eigener Voigt zu Travemunde offentlich in Beisein ihrer Abgeordneten außgesaget) einigermaßen verhinderlich sein". In der kleinen, mit Stroh gedeckten Fischerhütte, die hinter einem Sandhügel liege, - in dem Protokoll vom 30. April wird sie einer Vogelfängerhütte verglichen und gesagt, daß von der See aus nur ihr Dach zu sehen sei - lasse sich "weder groß Feur noch Licht" halten, wodurch ein Schiff verleitet werden könne. Überdies dürfe jeder auf seinem Grund und Boden Gebäude errichten und erleuchten, wie denn ganze Dörfer an der See lägen, ohne daß den Lübeckern deswegen ein Jus prohibendi gebühre. Sie hätten denn auch bei der Wegreißung der Reuse "sich eins andern bedacht" und die Hütte stehen lassen. "Und da gleich auch des Ohrts ieniges dominium maris solte anzuziehen sein, daßelbe mit beßerm Fuege und Recht dem Hause Meckelnburgk und Holstein (als derer territorium und Gebiehte einzich und allein daran stoßet und den Schiffen einen freien sichern Gangk und transitum vergönnet und Schuz und Schirm helt), mit nichten aber den Lubischen ihrem Andeuten nach (weil ihnen von dem Lande und Strande des Ohrts kein einiges Sandes-Korn zugehorig 299 ) competiren und zustehen wurde". Ein über den Strand hinausgehendes Dominium maris wurde also nicht beansprucht, aber auch Lübeck abgestritten, und es wurde hervorgehoben, daß ein solches Dominium sich höchstens auf Küstenbesitz stützen könne. Schließlich


|
Seite 162 |




|
heißt es, daß "die Fischerei des Ohrts und auf der ganzen Ostsehe nicht allein den Lubschen, sondern auch E(uer) F(ürstl.) G(naden) und deroselben Beambten, Lehenleuten und Unterthanen je und alle Wege uber Menschen Gedencken frei gestanden, mit grossen oder kleinen Wahden, großen oder kleinen Netzen oder andern Fischerzeuge, wie solchs Namen haben muchten und damit Fische können gefangen werden, ihres Gefallens zu fischen, und ihnen deßwegen, wormit und wie weit sie fischen sollen, von den Lubschen (ohne was sie izo de facto sich unterstehen) oder von andern nie vorgeschrieben".
Daraufhin richtete der Herzog Adolf Friedrich am 22. Mai an den Lübecker Rat ein Beschwerdeschreiben, worin die Angaben der Kommissare wiederholt wurden. Wir heben aus dem Schriftstück folgende Stellen hervor. Der Herzog habe sich "einer solchen unnachbarlichen Zunötigung und eigenthätlichen gewaltsahmen Beginnens . . keineswegs versehen und vermuhten sollen, weil einmahl notori und Euch und den Euren uberflußig bekant, das so wol das feste Land als der Strand und die Strandgerechtigkeit und was dem anhengig nit allein des Orts, do die Reusen gestanden", sondern auch von der Stadt Wismar bis Travemünde "dem Furstl. Hause Mecklenburgk iure superioritatis unzweifelbar einzig und allein zustendig, so gar, das die Lubecksche Fischer dißeit des Mehrs ihre Netze an keinen Ort dan mecklenbugischen Grund und Bodem aufziehen oder auch aufs Land außetzen und trucknen laßen können . . .""Entlich können wir Euch auch des Angebens, das inhalts obberurten Eurn Schreibens die Reide oder der Strom der Ends Euch gehörig sein solle, gar nit einig sein, inmaßen wir demselben hiemit feirlich wollen contradicieret und wiedersprochen haben". Der Herzog verwies hier auf das vorher genannte Lübecker Schreiben an die Eigentümer der Fischreuse vom 29. März, worin das Wort "Reede" für die fragliche Gegend vorkommt. Selbstverständlich wollte er damit nicht sagen, daß gegenüber der Harkenbeck tasächlich eine Reede sei, die ja von den Kommissaren ausdrücklich beim Blockhause festgestellt war. Sodann verlangte der Herzog, daß der Rat seine Leute anweise, sich mit ihm "des begangenen Frevel und Muhtwillens halber" abzufinden und den angerichteten Schaden zu erstatten, auch eine neue Reuse, deren Aussetzung befohlen sei, nicht anzutasten "und zu andern Furnehmen" wider die Lübecker, wozu es "sonsten an fugsahmer Gelegenheit gar nit ermangeln wurde, kein Ursach und Anlaß" zu geben. Also eine Drohung mit Repressalien.
Am selben Tage wurden Plessen, Bülow und Sithmann an-


|
Seite 163 |




|
gewiesen, eine neue Reuse verfertigen und dort, wo die vorige gestanden habe, auslegen zu lassen.
Die ganze Beurteilung des Fischreusenstreites durch Rörig ist verfehlt. Seiner Meinung nach hätten die Eigentümer der Reuse ihren Rechtsstandpunkt geändert; sie hätten zuerst behauptet, die Reuse stehe in der freien Ostsee, und hernach sich auf die Strandgerechtigkeit ihres Landesherrn berufen (II, S. 263). Offen, frei heißt die See jedoch sehr häufig im Gegensatze zu Binnengewässern, ohne daß damit ein rechtliches Verhältnis angedeutet werden soll, und es kommt diese Bezeichnung in den nämlichen Schreiben vor, in denen die Strandgerechtigkeit betont wird 300 ). Von einem Wechsel des Standpunktes kann also nicht gesprochen werden. Die Strandhoheit war etwas so Bekanntes, daß man sich darauf nicht erst zu besinnen brauchte. Auch Lübeck hat genau gewußt, was sie bedeutete. Ferner meint Rörig (II, S. 278), der Streit um die Reuse werde in seinem ganzen Verlaufe erst wirklich verständlich, wenn man ihn in Beziehung bringe zu den "Auseinandersetzungen zwischen Territorium und Stadt". Er vergleicht ihn mit den Schwierigkeiten, die 30-40 Jahre früher den lübischen Fischern am holsteinischen Strande gemacht seien, und mit dem Widerstande, den später Rostocker (richtiger Warnemünder) Seefischer an der mecklenburgischen Küste gefunden hätten. Nichts ist verkehrter als das. Bei der Rostocker Beschwerde handelte es sich, wie wir schon oben S. 71 ff. nachgewiesen haben, nur um ein spezielles Verbot des Amtshauptmannes Vieregge, das nicht auf die von Rörig angenommene Ursache zurückzuführen ist, sondern auf Schädigungen der Anliegerfischerei in der Gegend von Gaarz durch Warnemünder. Was hatte denn Mecklenburg für Auseinandersetzungen mit Lübeck außer dem, daß es sich gegen Lübecker Störungsakte wehren mußte! Nicht der angegriffene Teil war Lübeck im Fischreusenstreit, sondern der angreifende, während man in Mecklenburg die lübische Fischerei gar nicht verhindern wollte. Niemand konnte gegen fremde Seefischer duldsamer sein als die herzogliche Verwaltung. Nur dann kam es zu Streitigkeiten, wenn städtische Fischer sich Übergriffe erlaubten oder die landesherrliche Strandhoheit in Frage gestellt wurde.
Der Fischreusenstreit wurzelt nicht im Gebietsrecht - gebietsrechtliche Gründe suchte Lübeck sich erst, fadenscheinig, wie sie waren, zu schaffen -, sondern er hatte eine eminent praktische Ursache. Worum handelte es sich? Nicht um die mecklenburgische Fischerei überhaupt, sondern um die "Neuerung", die


|
Seite 164 |




|
durch die Setzung der großen Reuse geschaffen war. Auch die mecklenburgischen Kommissare sagten, daß bisher eine solche Reuse an dem betreffenden Orte nicht gestanden habe. Nach dem rügischen Landrecht war es verboten, Buchten durch Reusen zuzusetzen 301 ). Das hatte seinen guten Grund. Aus einer Äußerung der Stadt Rostock von (1675) wissen wir, daß man in der Setzung großer Reusen eine Gefahr für die übrige Fischerei erblickte: Es sei, so heißt es, vor einigen Jahren am Rostocker Strande "eine Herings-Reuse außgesetzet worden; weil aber verspüret worden, daß es den Fischern an dem andern Fischfange großen Schaden gethan, zumahl der Fisch zur Leichelzeit von vielen Meilen her lengst dem Üfer streichet und in die Warnow nach dem frischen Waßer gehet, alß hat man die Rüsen daselbst müßen abstellen, wurde also noch viel weiniger den Frembden vergönstiget werden können zu der Stadt Schaden" 302 ). Ebenso sagte Lübeck 1616 in seiner Erwiderung auf die Beschwerde des Herzogs, daß durch die Reuse am Rosenhäger Strande "die Fischerey des Travenstrombs, Daßower Sehes und anderer Örter vernichtiget und verdorben" werde 303 ).
Wenn die Mecklenburger erklärten, daß die Reuse der Fischerei nicht hinderlich gewesen sei, so hatten sie allerdings insofern recht, als um das Instrument herumgefischt werden konnte. Immerhin war die Reuse der Wadenfischerei im Wege. So sagte 1616 ein Zeuge aus Harkensee, daß die Fischer "eines Wadenzugs, so lange die Reuse da stehet, sich enthalten müssen". Ein Kl. Pravtshäger gab an, er habe gehört, daß die Travemünder vorgäben, "wan der Lachß deßelben Orts nach dem frischen Wasser nach der Bulowen Bäche gehet, das es ihnen an ihrem Wadenzuge hinderlich sei; er, Zeuge, aber wisse solchs nicht" 304 ). Gingen die Mecklenburger dazu über, mit einer solchen großen Reuse zu fischen, und folgten dieser einen gar noch weitere 305 ), so wurde den Lübeckern nicht nur das wichtige Buchtfischereigebiet vor dem mecklenburgischen Ufer beschnitten und am Ende ganz genommen, sondern auch die Fischerei auf den Binnengewässern gefährdet. Dem


|
Seite 165 |




|
sollte unbedingt abgeholfen und vorgebeugt werden, und da dies durch gütliche Verhandlungen nicht gelang, so scheute Lübeck auch vor Gewalt nicht zurück, immer mit der Begründung, es habe seine Gerechtsame wahrzunehmen. Das kannte man in Mecklenburg längst. Was riskierte denn die Stadt? Repressalien? Die konnte man erwidern, bis sie von selbst aufhörten. Eine wirkliche Fehde wegen einer zerstörten Fischreuse lag nicht im Bereiche der Wahrscheinlichkeit. Blieb also ein Reichskammergerichtsprozeß, und der konnte lange dauern, wenn überhaupt einmal ausnahmsweise ein Urteil herauskam 306 ).
Die ganze Schwäche der rechtlichen Stellung Lübecks zeigt sich in dem Schreiben des Rates vom 12. Juni 1616 womit auf die Beschwerde des Herzogs erwidert wurde 307 ) Aus diesem Schreiben geht zunächst mit vollkommener Sicherheit hervor, daß Lübeck das Fischereirecht der von ihm Geschädigten nicht bestritt und zugab, daß sie es bisher tatsächlich ausgeübt hatten. Das gilt auch für die Wadenfischerei des alten Vicke von Bülow. Denn ausdrücklich hatten die Reuseneigentümer am 6. April an Lübeck geschrieben, daß "auch theils unsere Vorfahren des Orts und viel neger an Trafemunde mit der großen Sehewaden gefischet" 308 ) und ausdrücklich sagte jetzt der Rat, es sei ihm nie in den Sinn gekommen, die herzoglichen Lehnleute
"in dem jure piscandi, wan sie sich nuhrt (nur) derselben wie Herkommens und je allewege biß die Zeit so wol bey ihnen selbst alß ihren Vorfahren gebreuchlich gewesen, gebrauchet, im weinigsten zu turbiren oder zu behindern."
Deutlicher kann man sich doch gar nicht ausdrücken.
Ferner beteuerte der Rat, er habe nichts vornehmen wollen, "dadurch E(w.) F(ürstl.) G(naden) an Ihrem des Orts angrentzenden Lande und deßelben Bottmeßigkeit Eintracht oder Nachtheil zugetzogen werden könte oder möchte". Hinter "Bottmeßigkeit" findet sich in dem Abdruck bei Rörig die eingeklammerte Bemerkung: "haec posita pro: ÂStrant und Strantgerechtigkeit,


|
Seite 166 |




|
soweit sich die erstrecket'; ne ponendo ista videamur concedere id, de quo non satis constat, an habeat princeps talia jura". Diese Bemerkung fehlt natürlich im Original des Schreibens, das uns vorliegt. Wahrscheinlich haben die Worte: Strant und Strantgerechtigkeit usw. ursprünglich im Konzept gestanden und sind dann getilgt worden. Aber die an ihrer Stelle gewählte vorsichtige Umschreibung hatte natürlich nur den Zweck, den Anschein zu vermeiden, als ob Lübeck das schon lange zwischen ihm und Mecklenburg strittige Strandrecht im engeren Sinne, das Bergerecht, als nutzbringendes Regal anerkennen wolle. Dieses den Städten so verhaßte Bergerecht wurde ja in erster Linie unter dem Strandrecht verstanden 309 ). Nur hierauf beziehen sich die bei Rörig eingeklammerten Worte, und sie gelten für das Bergerecht überhaupt, nicht bloß für das in der Travemünder Bucht. Die Strandhoheit an sich war gar nicht zu bestreiten; das hat auch Lübeck nie getan.
Dann folgt in dem Schreiben eine bewegliche Klage darüber, daß die Mecklenburger sich "eines neuen, ungewohnlichen, praejudicirlichen, ja, sehr schäd- und unleidlichen modi der Fischerey" bedient hätten, nämlich der "gar nahe bey Travemunde auf unserer unstreitigen Reide" aufgestellten Fischreuse, die für die Fischerei auf den Binnengewässern gefährlich gewesen sei und - auch daran hielt Lübeck fest - die Schiffahrt "im freyen Auß-und Einlaufe mercklich vorhindert" habe. Und wieder heißt es:
"Wir zwar gönnen ihnen gerne, das sie sich der Fischerey derer Örter wie herbracht gebrauchen, doch aber das sie sich sothaner ungewöhnlicher und uns sehr praeiudicirlichen Enderung mit Reusen und Pfählen, derer sich ihre antecessores niemalß angemaßet, enthalten mugen."
Hernach noch einmal: Der Herzog möge seinen Lehnleuten als unbefugten Conquerenten
"solche ungewöhnliche, unnachparliche und uns zumahl praeiudicirliche Neuerung mit Ernst verweisen und sie dahin halten, das sie es mit der Fischereyen, wie es von Alters hero gebreuchlich gewesen, auch hinfuhro halten und uns bey hergebracher Fischerey und andern dieser Statt habenden Gerechtigkeiten ruhig und unbehinderlich bleiben laßen mußen."
Kann da denn noch ein Zweifel aufkommen, daß Lübeck sich ganz allein gegen die Reusenfischerei auflehnte, keineswegs aber gegen


|
Seite 167 |




|
die weitere mecklenburgische Fischerei in derselben Gegend "gar nahe bei Travemünde", also in der Travemünder Bucht?
Fast zum Schlusse des Schreibens, als möchte der Rat selber nicht damit heraus, findet sich eine Rechtsbegründung:
"D[e]weil auch beschließlichen der Travenstromb mit dem Port und der Reide von Oldeschlo an biß in die offenbare Sehe, unangesehen viele unterschiedtliche territoria daran stoßen, dieser guten Statt, wie mit Kayßerlichen und Konigklichen Privilegien, auch unterschiedtlichen actibus possessoriis so woll Criminahl alß Civil-Sachen, do es noth sein solte, wol zu behaupten, zugehorig, so wollen wir nicht hoffen, das E. F. G. uns daran einige Eintracht zu thun gemeint sein werden."
Diese Rechtsbegründung sucht an Kühnheit ihresgleichen. Es gab kein Privileg, in dem Lübeck ein Port oder eine Reede - von der Trave ganz abgesehen - verliehen war. Gemeint sind natürlich die Barbarossa-Urkunde von 1188, eine gleichfalls unechte Bestätigung dieses Privilegs durch König Waldemar II. von Dänemark 310 ) und die Bestätigung Kaiser Friedrichs II. Hiermit wollte der Lübecker Rat, der damals die Barbarossa-Urkunde wohl selber für echt hielt, nachgerade alles beweisen. Von einem Travestrom außerhalb des Blockhauses wird schon - neben der nautischen Reede - in dem Lübecker Fischereivergleich von 1610 311 ) gesprochen. Darunter verstand man natürlich die kurze Strecke des Fahrwassers bis zur Reede, die wohl durch Seezeichen kenntlich gemacht war und rein äußerlich als eine Fortsetzung des Flusses erschien. Jetzt aber sollte die Trave usque in mare schon einerlei sein mit einer "Reede" bis Rosenhagen hin, eine Interpretation des Barbarossa-Privilegs, deren völlige Unmöglichkeit wir oben (S. 93 ff.) nachgewiesen haben. Und wenn Lübeck seinen Anspruch auf das Gewässer vor der mecklenburgischen Küste mit actibus possessoriis belegen wollte, wo sind denn diese besitzrechtlichen Handlungen? Regelungen der lübischen Fischerei sind dazu nicht zu rechnen 312 ) und die Auslegung des Privilegs von 1188 läßt eine ebenso künstliche Auslegung anderen Materials vermuten. Es könnten ja gar Handlungen auf der Trave gemeint sein, mit der die "Reede" ein untrennbares Ganzes bilden sollte.


|
Seite 168 |




|
Die Bezeichnung der Wasserfläche vor der Travemündung (d. h. der ganzen Bucht) als "Reede" und die erstaunliche These, daß diese "Reede" zum Flusse gehöre, das waren die obzwar untauglichen Notanker, vor denen das gebrechliche Schiff des Lübecker Hoheitsrechtes in der Travemünder Bucht trieb. So haben wir 1923 gesagt. Rörig (II, S. 243) will das natürlich nicht gelten lassen. Aber es ist ein gutes Bild, und wir halten daran fest. Weiter haben wir bemerkt, daß Rörig das, was der Lübecker Rat 1616 behauptete, heute rechtsgeschichtlich zu beweisen suche. So ist es auch. Freilich kann unsere Bemerkung nicht dahin verstanden werden, daß er die Angabe des Rates als ein Dogma betrachtet und sich blindlings danach gerichtet habe. Sondern was wir sagen wollten, ist, daß seine Meinung der von 1616 entspricht. Auch das Barbarossa-Privileg hat er ins Feld zu führen gesucht. Es ist daher für die Sache ganz gleichgültig, daß ihm, wie er jetzt mitteilt, zur Zeit seines ersten Archivberichtes über die Reede das Schreiben von 1616 noch nicht bekannt war. Wollte er seinen Standpunkt aufgeben, so hätten wir uns unsere Untersuchungen sparen können. Aber er vertritt ihn nach wie vor, und deswegen kann von einer "Unterstellung" gar nicht gesprochen werden.
Man könnte die Frage aufwerfen, ob Lübeck mit der Reede und dem Strom nur das tiefe schiffbare Gewässer der Bucht meinte, in das die Reuse ja unzweifelhaft hineingereicht hatte. Indessen war der größere Teil des Inatruments innerhalb des mecklenburgischen Küstengewässers zerstört worden, und es kommt wenig darauf an, mit was für Gründen Lübeck die offenbare Gewalttat bemäntelte. Das Entscheidende ist, daß die Stadt das mecklenburgische Jus piscandi einräumte; damit gab sie - trotz ihrer Rechtsbegründung - die Lage der Dinge tatsächlich zu. Denn die mecklenburgische Fischereigerechtigkeit beruhte natürlich nicht auf einer Lübecker Erlaubnis, sondern auf der Strandhoheit und des weiteren auf der jedermann zustehenden Befugnis, jenseit des Strandes in der herrenlosen See zu fischen. Dagegen konnte die Lübecker Fischerei, soweit sie im mecklenburgischen Strandgebiet ausgeübt wurde, überhaupt nichts anderes sein als eine hergebrachte Nutzung. Hierfür ist es von Wichtigkeit, daß der Rat auf den Hinweis des Herzogs auf Reusen am holsteinischen Strande, die von den Lübeckern nicht angetastet seien, folgendermaßen erwiderte:
"Ferner, das auch dergleichen Reusen und Pfehle uf der Holstein Seiten solten gebrauchet sein, davon ist uns nichts


|
Seite 169 |




|
furkommen, wurden sonsten ihnen eben[so] 313 ) wenig solches gut sein laßen können, und wird von den Supplicanten nuhr zum Behelf angetzogen."
Also erklärte der Rat, er würde auch gegen holsteinische Reusen einschreiten. Auf Grund welchen Rechtes? Auch am holsteinischen Strande hatte Lübeck keine Gebietshoheit; auch dort war seine Fischerei lediglich Nutzung. Es liegt mithin in den Worten des Rates eine Anerkennung dessen, was die mecklenburgischen Kommissare und die herzogliche Regierung als selbstverständlich ansahen, daß nämlich die Lübecker Fischerei an der holsteinischen und an der mecklenburgischen Küste sich rechtlich in nichts unterschied. So unklar und zwiespältig sind die Ausführungen des Rates. schon 1580, bei einem Streit um den Fischfang am Grömitzer Strande, hatte Lübeck seine Fischerei am Holsteiner und am Mecklenburger Ufer in Parallele gesetzt, indem es darauf hinwies, daß an der mecklenburgischen Küste keine Irrungen beständen 314 ); und natürlich ist nicht, wie Rörig annimmt, bloß die Küste jenseit der Harkenbeckmündung gemeint.
Man lese das, was Rörig (II, S. 285 ff.) über das Schreiben des Lübecker Rates vom 12. Juni 1616 sagt. Weil er die Wadenfischerei Vicke von Bülows unrichtig beurteilt, auch den eigentlichen Grund des Fischreusenstreites verkennt und davon ausgeht, daß Lübeck von jeher die alleinige Fischereigerechtigkeit auf der "Reede" ausgeübt habe, weil er sich gar nicht vorstellen kann, daß auch die Mecklenburger auf der Travemünder Bucht fischten, so kommt er zu einer ganz unmöglichen Interpretation. Freilich, es ist "die erste rechtsgeschichtliche und rechtstheoretische Begründung", die Lübeck für "seine Hoheitsrechte auf der Reede" gab. Aber sie war auch danach; mit einem widerspruchsvollen Schreiben trat die Stadt den klaren Ausführungen Mecklenburgs entgegen, das sich auf seine gar nicht anfechtbare Strandhoheit berief. Und widerspruchsvoll ist das Schreiben nicht deswegen, weil es dem Lübecker Rate an Logik mangelte, sondern weil Unrecht sich nun einmal nicht in Recht verwandeln läßt. Höchstens darüber hätte man streiten können, ob es erlaubt sei, Reusenpfähle noch außerhalb des Strandes einzuschlagen.
"In der Antwort auf die von Mecklenburg behauptete Fischereiübung bei der Harkenbeck, ja bis vor Travemünde", so meint Rörig, lasse das Schreiben "Geschick, Energie, Vorsicht,


|
Seite 170 |




|
vielleicht auch ausreichende Sachkenntnis vermissen". Ach nein, danach war man in Lübeck nicht angetan. Aber man konnte unmöglich die notorische mecklenburgische Fischerei leugnen. Ferner: Es sei "nicht gerade sehr ehrlich, nur um seine gerechte und friedliebende Gesinnung zu dokumentieren, in mehrdeutigen Worten von mecklenburgischer Fischerei im allgemeinen zu reden". Mehrdeutig? Wir haben oben die betreffenden Stellen des Schreibens wiedergegeben; sie lassen sich gar nicht mißverstehen. Rörig aber, obwohl er sogar die "Sachkenntnis" des Lübecker Rates anzweifelt, hält es für möglich, daß dieser mit einer hinterlistigen Reservatio mentalis immer die Fischerei östlich von der Harkenbeckmündung gemeint habe. Wenn man die Quellen auf diese Weise kritisiert, kann man allerdings aus Weiß jedesmal Schwarz machen. Wo hatte denn die Reuse gestanden? Am Rosenhäger Strande, und um den handelte es sich. Man stelle sich vor, daß der Lübecker Senat heute auf eine mecklenburgische Beschwerde über die Vertreibung von Fischern aus dem Gebiet innerhalb der neuen Peilliniengrenze die Antwort gäbe, er denke gar nicht daran, die Mecklenburger in der fraglichen Gegend (derer Örter, wie es 1616 heißt) zu stören - und dabei das Gewässer hinter der neuen Grenze im Auge habe!. -
Mit allem Nachdruck trieb die herzogliche Regierung zur schleunigen Verfertigung und Setzung einer neuen Reuse an. Würden die Lübecker ihren Übergriff wiederholen, so sollten Plessen, Bülow und Sithmann "Gewaldt, so viel muglich, defensive" abwehren. Indessen ließ sich die Reuse aus allerlei Gründen so schnell nicht schaffen, und erst im Februar 1617 meldeten die drei Interessenten dem herzoglichen Rat von Hagen, nun sei das Instrument bald fertig. Zugleich aber äußerten sie Bedenken, die sie hernach im März in einem Briefe an den Herzog Adolf Friedrich wiederholten. Es hätten sich nämlich die lübischen Fischer, die "dies Spiel" verursacht hätten, öffentlich verlauten lassen, daß die Lübecker auch diese Reuse, sobald sie ausgesetzt sei, wieder wegreißen würden. "Dofern dan E. F. G. wieder sie etwaß Tetliches vornehmen wurde, sie darauf gestracks so starck heraußfallen und unß unsere Höfe in den Brandt stecken wolten." Mögen diese "hochbeschwerlichen Dreuworte" auch, was die Anzündung der Höfe angeht, nicht so ganz ernst zu nehmen sein, es zeigt sich doch, welch ein Ingrimm in Lübeck gegen den "neuen modus der Fischerei" herrschte. Der Herzog aber bestand darauf, daß die Reuse ins Wasser gebracht werde. Dies geschah am 24. April. Am Sonntage darauf (27. April) "unter der Predigt", also zur Kirchzeit, er-


|
Seite 171 |




|
schienen eine lübische Schute und 13 Boote "voller Volcks", und es wurde die Reuse nebst den Pfählen "ufgerißen und wegkgeführet" 315 ).
Jetzt klagte Mecklenburg beim Reichskammergericht. Die Originalakten dieses Prozesses sind verloren gegangen. Auch der mecklenburgische Geh. Justizrat v. Schröder, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Wetzlar die Akten über Reichskammergerichtsprozesse zwischen Mecklenburg und Lübeck auszog, fand nur noch ein an Lübeck erlassenes Mandat vom 3. Juli 1618 und einen dagegen gerichteten Schriftsatz des Lübecker Anwalts vom 2. Oktober; nicht mehr vorhanden war die Replik hierauf, die am 26. Februar 1619 produziert wurde. Der Schriftsatz vom 2. Oktober 1618 hat sich vollständig erhalten in Gestalt einer gleichzeitigen Abschrift, die der damalige mecklenburgische Anwalt in Speyer, Dr. Kremer, der herzoglichen Regierung mitteilte. (Anl. V.) Außerdem finden sich einige Schreiben der mecklenburgischen Anwälte 316 ) und von diesen übersandte Terminsprotokolle, die jedoch nur prozessuale Formalien betreffen und ohne Bedeutung sind.
Als Kläger erschienen die beiden mecklenburgischen Herzöge Adolf Friedrich und Johann Albrecht, mit ihnen Johann von Plessen auf Dönkendorf, also von den drei Geschädigten - wohl der Kostenersparnis halber - nur einer. Sie erwirkten das erwähnte Mandat vom 3. Juli 1618, wodurch Lübeck angewiesen wurde, die Reusen und Pfähle zu restituieren und in vorigen Stand zu setzen 317 ). Hiergegen überreichte der Lübecker "Syn-
Sie hätten auf mecklenburgischem Grund und Boden eine Härings-Reuse sezen lassen, darauf Lubecenses am 19. April 1616 mit gewehrtem Haufen ausgefallen und gedachte Reussen mit den Pfählen aufgerichtet(!) und hinweg geführet; und als Supplicantes zur Erhaltung ihres Besizes im April 1617 eine Härings-Reusse dahin sezen lassen, solche abermahls in dicto mense auf einen Sonntag, gleich unter der Predigt mit Gewalt aufgehoben und weggenommen etc.
Dahero Mandatum erkannt worden.


|
Seite 172 |




|
dikus", Lizentiat Martin Khun, dem Gericht am 2. Oktober eine Einrede (Exceptiones).
Gewiß, der Lübecker Ratssyndikus war es nicht, der dieses Schriftstück in Speyer produzierte. Der konnte wohl überhaupt den Prozeß vor dem Reichskammergericht nicht führen. Syndikus nannte man damals stets den Prozeßvertreter, während der Mandant als Prinzipal bezeichnet wurde. Aber mochte auch Rörig in diesem Punkte durch den Ausdruck "Syndikus" zu einem Mißverständnisse verleitet werden können, so ist doch der Unterschied ohne Bedeutung; denn selbstverständlich ist die ganze Einrede einer Vernehmlassung des Lübecker Rates gleichzusetzen. Der von Rörig angenommene, an sich höchst unwahrscheinliche Gegensatz besteht ja gar nicht.
Wer die in der Anlage V wiedergegebene Exzeptionsschrift mit dem Schreiben des Lübecker Rates bei Rörig (II, Anl. I b) vergleicht, wird eine vollkommene Übereinstimmung feststellen, abgesehen von dem prozessualen Teil der Einrede und abgesehen davon, daß diese ausführlicher ist und einen Punkt, auf den wir zurückkommen werden, mehr hervorhebt.
Die Exzeptionsschrift gibt die mit Waden und Netzen ausgeübte mecklenburgische Fischereigerechtigkeit auf dem Portus oder der "Reide" ausdrücklich zu und polemisiert - genau so wie das Schreiben von 1616 - lediglich gegen die Fischreuse, den neuen Modus piscandi. Demgemäß bestreitet sie, daß Lübeck "das novum ius der Strandtgerechtigkeit oder gantzen Fischerey" jemals begehrt habe. Damit wird natürlich die mecklenburgische Strandhoheit anerkannt; denn einer mußte sie ja innehaben. Ferner wird die unbestreitbare Verbindung von Strandgerechtigkeit und Fischerei dadurch eingeräumt, daß es heißt:
". . inmasen dan solch ihr (der Lübecker) Intent und daß sie einige Strandgerechtigkeit oder die gantze Fischerey an sich zu reißen nicht gemeint, sonnenheiter darauß erscheinet, daß sie vielgedachtem mitclagendem von Pleßen an der Fischersgerechtigkeit, wan dieselbe von ihnen uf vorige Maß und Weiß und gleich andern derneden Geseßen usurpirt und gebraucht wird, Eintrag und Hinderung zu thun nicht gemeinet, . . sondern vielmehr ihme sowol alß sonst iedermenniglich das Sein und worzu er von Rechtswegen befugt, wohl gönnen und unverhindert gestatten mögen."


|
Seite 173 |




|
Aber welche Unklarheit der Rechtsauffassung findet sich auch in diesem Schreiben! In Absatz 2 wird gesagt, die Konstitution der Pfändung, auf Grund deren das Mandat an Lübeck erwirkt war, setze voraus, daß der klagende Teil im Besitze des fraglichen loci vel iuris sei. Hernach aber wird nur bestritten, daß die Kläger den neuen "modum piscandi an dem Ort herbracht" und "deßelben Gewehr und Possession bestendiger Masen erlangt" hätten. Daß sie nicht im Besitze loci seien, ließ sich eben nicht behaupten, um so weniger, als die mecklenburgische Strandgerechtigkeit implicite zugegeben wurde. Dann folgt die bekannte Rechtsbegründung oder "Reededefinition". Alsbald aber heißt es wieder, daß der mitklagende von Plessen, der hier natürlich die Gesamtheit der drei Geschädigten vertritt, auf dieser Reede vermöge Herkommens "und allgemeiner beschriebenen Rechten" fischen dürfe. Wie das Schreiben von 1616 macht also auch die Exzeptionsschrift den Versuch, das Rechtsverhältnis umzukehren, die Lübecker Fischerei als auf einer Gebietshoheit beruhend hinzustellen, die mecklenburgische Fischerei dagegen als eine Nutzung; immer aber wird auf halbem Wege haltgemacht, weil solche Behauptungen an der klaren Rechtslage scheitern mußten. Welch ein Widerspruch liegt darin, daß die Exzeptionsschrift einmal erklärt, die Reuse habe auf Lübecks unstreitiger "Reide und Port" gestanden, und hernach feststellt, es sei unzutreffend, daß die Lübecker
"die Reise oder Pfäle hinweg genommen oder das angegebene novum ius der Strandtgerechtigkeit oder gantzen Fischerey zu . . erlangen jemahlen begert oder noch begeren sollen, synthemal sie nicht allein die Reisen und Pfäle, wie dieselbe außgerißen und abgeworfen, im Waßer liegen und dem Windt und dem Waßer befohlen sein lasen 318 ), sondern auch diesen Actum allein pro conservando iure suo et portus libertate, keinswegs aber eine neue Gerechtigkeit dadurch zu schöpfen, uti actum retinendae possessionis furgenommen . ." 319 ).


|
Seite 174 |




|
Hätte die Reuse tatsächlich auf Lübecker Gebiet gestanden, so wäre gar nicht einzusehen, warum Lübeck sich nicht das Recht zuschrieb, sie zu beschlagnahmen.
Mit seinen Deduktionen über die Reede hat Lübeck selber kaum gehofft durchzudringen. Darum tritt in dem Schriftsatz, mehr noch als in dem Schreiben des Rates von 1616, ein anderes hervor: das ist die Begründung des Lübecker Eingriffes damit, daß die Schiffahrt durch die Reuse und das Licht in der Fischerhütte gestört werde.
1669 unterschied der herzoglich mecklenburgische Kanzler Dr. Schlüter zwischen dem usus, den utilitates atque proventus und der iurisdictio litorum, portuum et maris finitimi. Der usus litorum maris portuumque aber war nach ihm iuris gentium atque ita publicus, ut litora in nullius, nedum privati alicuius dominium cadant 320 ). Genau so wird in der Exzeptionsschrift argumentiert. Darum heißt es, daß die Reuse in dem Lübecker Portus nicht habe gesetzt werden dürfen
eo quod eatenus licitum in litore vel portu aliquid facere, quatenus usus publicus non impeditur aut alter non sentiat damnum, per iura vulgaria.
Und weiter heißt es, daß den Klägern nicht zugestanden habe, irgend etwas zu anderer Leute Schaden und Präjudiz, "ja zu Hinderung des usus publici in loco publico zu constituiren und zu setzen". Die angeblich durch die Reuse und das Licht in der Hütte verursachte "Behindernuß der freyen Navigation", das war der Ast, an den man sich eigentlich klammerte. Warum wurde denn nicht einfach gesagt: Fremde haben auf Lübecker Gebiet nicht zu fischen? Weil die Dinge nicht so lagen.
Wie beurteilt Rörig 321 ) diese Exzeptionsschrift? Zunächst läßt er es dahingestellt sein, ob der Lizentiat Khun zwischen der Verkündigung des Mandats und dem Termin vom 2. Oktober, an dem das Mandat reproduziert und die Einrede übergeben wurde, genügend Zeit hatte, sich in Lübeck zu informieren; der Befund der Akten spreche jedenfalls dagegen, daß eine solche Information erfolgt sei. Im Gegenteil, der Befund der Akten, nämlich die Exzeptionsschrift, spricht dafür, ganz abgesehen davon, daß Khun ja einen Auftrag von Lübeck erhielt, mit dem doch natürlich nähere Nachrichten verbunden waren. Mündliche Ver-


|
Seite 175 |




|
handlungen mit einem Reichskammergerichtsanwalt haben, wenn der Mandant weit entfernt wohnte, wohl selten stattgefunden. Eben weil Khun keine "persönlichen Kenntnisse" von der Sache hatte, mußte Lübeck ihm das Material liefern.
Das Mandat ist am 27. August 1618 dem Lübecker Rate zugestellt worden 322 ), und in der Zeit bis zum 2. Oktober hat dieser selbstverständlich seinen Anwalt instruiert. Die herzogliche Regierung verfuhr nicht anders; die verlorene Replik, die am 26. Februar 1619 dem Gericht produziert wurde, ist dem Mecklenburger Prozeßvertreter von dem Kanzler Dr. Tothmann übersandt worden 323 ), der, nach Äußerungen des Rates Dr. von Hagen, in dieser Sache "die schriftliche Notturft" verfertigte. Die Replik ist also in der herzoglichen Kanzlei entstanden.
Rörig bemerkt, daß der Lizentiat Khun die Exzeptionsschrift "auf Grund seiner Akten" ausgearbeitet habe. Das glauben wir auch, aber welches waren diese Akten? Nach Rörig hätte sichs um das Schreiben des Lübecker Rates vom 12. Juni 1616 gehandelt und um "Mecklenburger Schriftsätze", von denen doch erst einer vorliegen konnte, der das Mandat zur Folge hatte und dessen Inhalt in das Mandat übergegangen war. Woher wußte dann aber Khun, daß die Lübecker die Reusen und Pfähle nicht weggenommen, sondern im Wasser hatten liegen lassen? In dem Schreiben von 1616 wird nichts davon gesagt, und die in dem mecklenburgischen Schriftsatze und in dem Mandat gebrauchten Ausdrücke ließen auf das Gegenteil schließen 324 ); sonst hätte ja auch Khun keine Ursache gehabt, die Wegnahme zu bestreiten. Also muß Lübeck ihm hierüber Mitteilungen gemacht haben. Ferner meint Rörig, daß der lübische Anwalt das Opfer eines Mißverständnisses geworden sei; denn der Lübecker Rat habe ja 1616 die mecklenburgische Fischerei nur mit jener listigen Reservatio mentalis zugegeben. Davon habe der "ahnungslose" Khun nichts gewußt. Aber gesetzt den Fall, daß es mit der Reservatio mentalis stimme, kann denn jemand glauben, daß der Lübecker Rat die grenzenlose Torheit begangen habe, seinem Prozeßvertreter das Schreiben mit den gar nicht "zweideutigen", sondern sehr eindeutigen Stellen darin zu übersenden, ohne ihm mitzuteilen, daß das alles anders gemeint


|
Seite 176 |




|
sei? Nein, sondern die Exzeptionsschrift ist sicherlich in ihren Grundzügen in der Lübecker Ratskanzlei und am Ende gar von dem Ratssyndikus selbst entworfen worden 325 ). Ob Khun überhaupt das Schreiben vom 12. Juni 1616 gekannt hat, ist mindestens zweifelhaft.
Die angebliche Konfusion, die der lübische Anwalt angerichtet haben soll, sucht Rörig damit zu erweisen, daß in dem Schriftsatze nicht speziell von der Bülowschen Wadenfischerei gesprochen wird. Aber den Grund hierfür gibt er ja selber an. Nicht der jüngere Bülow war der Vertreter der drei Geschädigten, sondern Hans von Plessen, und darum erscheint dieser in dem Schriftsatze; er vereinigte dem Gericht gegenüber die drei Interessenten in seiner Person. Übrigens heißt es an der Stelle, wo die mecklenburgische Fischerei mit Waden und Netzen zugegeben wird: von Pleß wie auch seine Vorfahren, nit weniger als sonsten jeder-menniglich derneden geseßen.
Schließlich legt Rörig Wert darauf, daß das Schriftstück die übliche Protestationsklausel enthält. Es gibt ja kaum Schriftsätze von Prozeßvertretern aus jener Zeit, worin solche Klauseln sich nicht finden. Sie waren eine bloße Form. Ein paar Griffe aufs Geratewohl in unsere Reichskammergerichts- oder andere Gerichts-Akten würden uns Dutzende von Beispielen an die Hand geben. Hätte ein Gerichtshof darauf Wert legen wollen, so hätte er überhaupt keinen Schriftsatz ernst nehmen können. Übrigens beziehen sich die Worte der Klausel: "nisi quatenus et in quantum in Willen und Meinung" nicht auf den Lübecker Rat, sondern auf den Prozeßvertreter.
Die ganzen quellenkritischen Bemerkungen Rörigs über die Akten des Fischreusenstreites sind auf das entschiedenste abzulehnen. Felsenfest steht für ihn alles, was ein Lübecker Zöllner 1547 angibt, obwohl es gar nicht stimmen kann; höchst verdächtig aber sind ihm mecklenburgische Zeugenaussagen. Den mecklenburgischen Kommissaren von 1616 traut er zu, daß sie einen "redaktionellen Eingriff" in das Vernehmungsprotokoll vorgenommen, d. h. eine Zeugenaussage ein bißchen umgefälscht


|
Seite 177 |




|
hätten 326 ), wozu ihnen nicht einmal die Möglichkeit gegeben war, weil das Protokoll von einem Notar aufgenommen wurde. Wenn dann die Erklärungen des Lübecker Rates über die Fischerei mit den mecklenburgischen Angaben übereinstimmen, so ist eben eigentlich das Gegenteil gemeint. Und wenn schließlich zum Überflusse eine Lübecker Prozeßschrift dasselbe bekundet, so beruht sie auf "Irrtum im juristischen Urteil" und kommt - "höchstens als Zeugnis für mecklenburgische Parteibehauptungen" in Betracht!
Die Exzeptionsschrift von 1618, die ja gar nicht einmal unser "eigentlicher Stützpunkt" ist, hat nicht "als Quelle überhaupt auszuscheiden", sondern ist selbstverständlich ein Beweisstück ersten Ranges. Die Zeugenaussagen von 1616, das Schreiben des Lübecker Rates und die Exzeptionsschrift, alles greift, was die Fischerei angeht, ineinander. Kann man sich stärkere Beweise denken als übereinstimmende Angaben streitender Parteien?
Dabei sind, um die mecklenburgische Fischereigerechtigkeit auf der Travemünder Bucht festzustellen, die ganzen Akten über den Fischreusenstreit nicht einmal nötig. Wir haben 1923 aus jener Rostocker Beschwerde von 1621 (oben S. 72) den Schluß gezogen, daß die Warnemünder Seefischer bis Travemünde hin gefischt hätten. Rörig 327 ) meint zwar, daß das keiner Widerlegung bedürfe. Jedoch wird unsere Angabe vollkommen bestätigt durch die Zeugenvernehmung in Warnemünde vom 11. November 1618, die wir schon im ersten Berichtsteile besprochen haben 328 ). Sie wurde durch den Streit wegen der Seefischerei bei Gaarz veranlaßt, der schließlich die Beschwerde von 1621 zur Folge hatte. Vernommen wurden acht Warnemünder Seefischer, und man zog dabei die ganze mecklenburgische Küste "zwischen dem Dars und der Trave" in Betracht. Wir heben folgende Aussagen hervor 329 ):


|
Seite 178 |




|
1) Ortman Reuße, gegen 66 Jahre alt: Er "habe nebenst Holsteinschen und andern im Treutzer (Klützer) Orte und sonsten hin und wieder in der Sehe biß an die Trave hinan ohne menniglichs Verhinderung gefischet, habs auch von seinen Eltern, so zu Warnemunde gewohnet, nie anders gehöret noch erfahren, Zeug hab auch zu Lubeck Dorsch oft verkauft und ein gantz Spitt voll große Dorsche für zwey Schilling lubsch verkauft, und wan sie wieder in die Sehe kommen, hetten sie ihre Schnöre, so sie des Orts in der Sehe stehende gehabt, wiedergezogen und das ganze Both mit Dorsch beladen, nach Rostog gefuhret und kaum verkaufen können . ."
2) Timm Hase, 68 Jahre alt: "Zeug habe biß an die Trave, auch im Clußer Orte und am ganzen Seheschlage hero in der Sehe gefischet und bestochen . ."
3) Jochim Wintepper, gegen 60 Jahre alt: Er habe zwischen dem Dars und Gaarz gefischt, "Zeugens Bruder Titke Wintepper aber hette woll biß an Lubeck hinan gefischet, hetten auch zu Lubeck und Wißmar Dorsch genug verkauft".
4) Cheel (Michael) Reimers, über 70 Jahre alt: "Zeuge habe selbst mit Schnören vor der Traven, auch zu Tramunde (Travemünde) gefischet und besteken, vielmahls zu Lubeck und Wißmar Dorsch verkauft, hetten die Zeit große Bothe gehabt, da funf oder sechs Mann uff fuhren konnen."
5) Ties Darries, über 53 Jahre alt: Er habe von andern Warnemundern wol oftmals gehört, daß sie biß an die Trave und dißeit derselben allewege unverhindert frey gefischet und der Sehe sich gebraucht hetten."
Das sind doch gewiß unverdächtige Zeugen; denn es handelte sich ja bei dem ganzen Streit um die Gaarzer Gegend; die Fischerei in der Travemünder Bucht wurde nur nebenher erwähnt. Und selbstverständlich ist in den Aussagen unter der Trave der Fluß zu verstehen und nicht etwa ein Reedegebiet im Rörigschen Sinne (vgl. unten Anm. 335).
Es ist also ganz ausgeschlossen, daß, wie Rörig 330 ) meint, die mecklenburgische Fischereigerechtigkeit an der Uferstrecke bis zur Harkenbeck sich auf den Krabbenfang beschränkt habe. Seine


|
Seite 179 |




|
einzige Quelle hierfür ist der Umstand, daß bei dem Fahrrechtsfalle von 1615 der Schneider Dechow aus Harkensee, als er den Toten erblickte, zufällig mit einer Bauerntochter Krabben fing, wobei er sich des Krabbenhamens (kleines Netz mit Stiel) bediente. Dieses Instrument wird in dem hernach aufgenommenen Zeugenprotokoll nur deswegen beiläufig erwähnt, weil Dechow damit den Toten im Wasser umgewendet hatte. Schon oben S. 114 f. haben wir dargelegt, daß Krabbenfang und Heringsfischerei bei dem Zeugenverhör von 1615 überhaupt nur eine Rolle spielten, weil der Fundort der Leiche danach bestimmt werden sollte, über den die Behauptungen der Parteien auseinandergingen. Weil man gar keine Veranlassung hatte, auf weitere mecklenburgische Fischerei außer Dechows Krabbenfang einzugehen, so kann das Zeugenprotokoll von 1615 auch kein Bild der tatsächlichen Fischereiverhältnisse geben. Krabbenfang wurde und wird überall an der Küste betrieben, ohne daß sich daraus ein Schluß auf die übrige Fischerei der Uferanwohner ziehen ließe 331 ). Die von Rörig (I, S. 55) vorgebrachte Analogie mit dem Dassower See ist sehr unzutreffend, einmal weil es sich um ein reines Binnengewässer handelt, während die Travemünder Bucht Strand und freie See umfaßte, sodann weil es nicht angeht, aus den umfangreichen Akten über den Streit wegen der Binnengewässer einige Quellenstellen herauszunehmen, die den Kern der Sache nicht treffen. Die Fischerei auf dem Dassower See war strittig, jahrhundertelang, und Mecklenburg hat dort ganz etwas anderes in Anspruch genommen als Watfischerei, nämlich die Hoheit über den ganzen See. Wir können unmöglich des näheren auf diese Dinge eingehen. -


|
Seite 180 |




|
Der Ausgang des Prozesses wegen der Wegreißung von Fischreusen steht nicht fest. 1622 erhielt der als Mitkläger auftretende Hans v. Plessen durch einen Verwandten aus Speyer die Nachricht, daß für die mecklenburgische Partei "die Sache sehr wol stunde und balt eine gute Urthel erfolgen kundte" 332 ). Wie hätte es auch anders sein sollen! Indessen möchte der Streit wohl das Schicksal so vieler Reichskammergerichtsprozesse geteilt haben, überhaupt nicht beendet zu werden. Aber nicht der "Lübecker Besitzstand" blieb gewahrt, sondern Mecklenburg wahrte den seinigen durch Einspruch und Klage. Was sollte es denn weiter tun? Will Rörig den Herzögen etwa einen Vorwurf daraus machen, daß sie Lübeck nicht jedesmal mit Krieg überzogen?
Der Fall von 1658, in dem die Lübecker wiederum eine Fischreuse bei Rosenhagen bedrohten 333 ), haben wir ein Nachspiel des Übergriffes von 1616 genannt. Das ist auch die richtige Bezeichnung. Wiederum handelte es sich nur um die Reusenfischerei, "wodurch der Fisch, welcher seinen Gang langs den Ufer zu nehmen pflegte, ufgefangen und verhindert würde, das er nicht mehr wie zuvor in die Trave suchen könte". Außerdem hatte der Rosenhäger Fischer sich verlauten lassen, daß er "mehr Volk annehmen" und diese Reusenfischerei noch erweitern wolle. Man konnte also damit rechnen, daß bald Reuse neben Reuse stehen würde, wie es um dieselbe Zeit am Fischländer Strande der Fall war. Und dann war es vorbei mit den lübischen Wadenzügen am mecklenburgischen Ufer. Als die Lübecker Heerschar auf dem Schauplatze erschien, fand sie nur noch einige Staken oder Pfähle im Wasser vor, die ausgerissen wurden. Netze und Körbe waren schon in Sicherheit gebracht worden, sodaß ein eigentlicher Schaden nicht entstand. Wir können durchaus nicht finden, daß der ganze Vorgang sich "klarer und bestimmter" abspielte als 1616 und 1617. Nur das gütliche Zureden von 1616 fehlt; Lübeck wußte ja aus Erfahrung, daß es nichts nützen würde. Eine Beschwerde der lübischen Fischer muß auch 1616 erfolgt sein; sie hatten ja damals, wie die Eigentümer der Fischreuse sich ausdrückten, das "Spiel" verursacht.
Akten über den Fall von 1658 besitzen wir nicht. Sollte die herzogliche Regierung nicht protestiert haben, so wäre dies der sicherste Beweis dafür, daß sie von der Angelegenheit nichts erfuhr.


|
Seite 181 |




|
Denn daß sie sonst gegen die Verletzung ihrer Strandgerechtigkeit nicht ebenso Einspruch erhoben hätte wie 1516, 1615, 1616, 1617 und 1660, ist ausgeschlossen. Höchstens könnte man annehmen, daß der Rosenhäger Grundherr um des lieben Friedens willen auf die Reusenfischerei verzichtete. Die allgemeine, 1616 und 1618 von Lübeck zugegebene mecklenburgische Fischereigerechtigkeit wird dadurch gar nicht berührt.
Nicht Besitzhandlungen waren die Akte von 1616/17 und 1658, sondern unrechtmäßige Übergriffe, Actus turbatorii, wie Vicke von Bülow gesagt haben würde. Später erscheinen dann solche Störungsakte immer als Beweismittel für den Lübecker Besitzstand. Nicht anders war es bei dem Streit um die Binnengewässer. Auch ein 1670 vom Reichskammergericht erlassenes Poenalmandat, das den Lübeckern alle Übergriffe auf den Binnengewässern bis zum Austrag der Sache untersagte, hatte keine dauernde Wirkung. Im Gegenteil, Pfändungen mecklenburgischer Fischer, die nach der Verkündigung des Mandates vorgenommen waren, gab Lübeck späterhin für besitzrechtliche Handlungen aus. Die Hartnäckigkeit, die es in diesen Dingen an den Tag legte, darf über die Rechtslage nicht hinwegtäuschen. Selbst dann wäre der Fall von 1658 möglich gewesen, wenn Mecklenburg inzwischen in dem 1618 eingeleiteten Prozesse gesiegt haben sollte. Denn das Reichskammergericht war weit, der Kaiser noch weiter, und eine solche nachbarliche Gewalthandlung sah noch der Deutsche Bund, als im Jahre 1841 die Hessen-Darmstädter Regierung den nassauischen Rheinhafen zu Biebrich durch Versenkung von Schiffen und Steinen sperren ließ.
Es kann auch nicht beirren, daß Lübeck 1658 das Gewässer vor Rosenhagen wieder seine Reede und seinen Strom nannte, und daß die Angelegenheit nach der Angabe der lübischen Fischerältesten oder dessen, der ihnen ihre Beschwerde abfaßte, des Rates "Jurisdiction, Hoch- und Gerechtigkeit" betreffen sollte. Was ließ sich denn nicht alles behaupten! Wie mag wohl Lübeck die von ihm erzwungene Beschränkung der Anliegerfischerei in der Niendorfer Wiek begründet haben? Und wie schnell hat es sich in unseren Tagen die Rörigsche Peilliniengrenze zu eigen gemacht, die doch vor dem kritischen Blicke in Nichts zergeht!
"Einen sehr deutlichen Anhaltspunkt" für das Lübecker Fischereiregal erblickt Rörig (I, S. 50 ff.) in den Abgaben, die für den Fischfang auf der Reede erhoben sein sollen. Wie er erwähnt, findet sich eine Notiz von 1502, wonach die Schlutuper


|
Seite 182 |




|
und Gothmunder Wadengeld bezahlten. Seit 1561 lassen sich dann Abgaben der Schlutuper und Travemünder Fischer feststellen, und zwar zahlten die Schlutuper für große (Herings-) und kleine Waden, auch Krabbenwaden, die Travemünder nur für große Heringswaden. Diese Geräte wurden nach Rörig "gerade auch im Reedegebiet" verwendet. Aber doch wohl auch in der Niendorfer Wiek und anderswo. Es ist gar nicht einzusehen, warum immer alles für die "Reede" gelten soll. Dagegen passen zu den Abgaben von den genannten Geräten recht gut einige Bestimmungen der Fischereiverordnung von 1585, die Jahrhunderte hindurch gegolten hat; es sollten nämlich die Schlutuper "binnen der Traven" mit kleinen Waden und Krabbenwaden zu festgesetzten Zeiten fischen dürfen, desgleichen mit der großen Heringswade auf der Trave vom Stolper Haken an, die Travemünder aber mit der großen Heringswade "in dem Strome van Stolpe an beth in de See", d. h. vom Stolper Haken bis zur Travemündung, und zwar ebenfalls binnen einer angegebenen Zeit. Außer der Seefischerei übten also diese Fischer auch Binnenfischerei aus. Dabei ist es denn auffallend, daß die große Heringswade der Travemünder nur an dieser Stelle der Verordnung erwähnt wird; es ist die einzige Netzfischerei, die ihnen auf der Trave zugestanden wurde. Außerhalb der Flußmündung aber haben sie gewiß auch mit kleinen Waden gefischt; ihre Seefischerei unterlag nach der Verordnung keiner nennenswerten Beschränkung. Weiter fällt auf, daß die Schlutuper nur Abgaben von solchen Geräten zahlten, die sie auch auf den Binnengewässern benutzen durften; Krabbenwaden kommen sonst in der Verordnung gar nicht vor. Also waren die Abgaben gewiß ein Entgelt für Binnenfischerei. Darauf deutet auch hin, daß die Michaelisgebühr der Schlutuper seit 1753 als "Grundhauerzahlung" (Grundheuer) gebucht wurde; denn diesen Ausdruck mochte man zur Not für eine Abgabe von Binnenfischerei, aber sicher nicht von Seefischerei anwenden. Wenn Rörig (I, S. 52) sagt, "Abgaben, welche die Ausübung der Fischerei im Reedegebiet als Nutzung des Fischereiregals Lübecks erkennen lassen", seien "Seit 1561 in ununterbrochener Reihe nachweisbar", so müssen wir bestreiten, daß er überhaupt Seefischerei-Abgaben für die Zeit vor 1896 nachgewiesen hat. Das Lübecker Fischereigesetz vom 11. Mai 1896 verlangt die Lösung von Fischereikarten gegen eine Gebühr auch für den Fischereibezirk III, der die Travemünder Bucht bis zur Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld umfassen sollte. Es geht davon aus, daß Lübeck hier ein Fischereiregal besitze, und darin irrt es.


|
Seite 183 |




|
Nach den Konflikten wegen der Reusenfischerei sind Streitigkeiten Mecklenburgs mit Lübeck wegen des Fischfanges in der Travemünder Bucht, soweit sich nachweisen läßt, erst in jüngster Zeit wieder vorgekommen. Inzwischen hatten sich, wenn man vom Priwall absieht, nur der Bergerechtskonflikt von 1660 334 ) und im Jahre 1739 ein Zwist wegen verhinderter Löschung zweier Schiffe am Harkenseer (Rosenhäger) Strande 335 ) ereignet.
Der Mangel an Fischereistreitigkeiten seit 1658 ist aber natürlich kein Beweis für die alleinige Ausübung des Fischfangs durch Lübeck.Weil um 1616 mecklenburgische Fischerei auf der Travemünder Bucht ausgeübt und von Lübeck als berechtigt anerkannt wurde, so steht um so fester, was wir schon oben S. 147 dargelegt haben, daß nämlich die Lübecker Fischereiverordnungen keine Beweise für eine ausschließliche lübische Fischereigerechtigkeit sind


|
Seite 184 |




|
und daß daraus kein Recht auf eine Gebietshoheit herzuleiten ist. Denn 1616 bestanden ja schon die Verordnung von 1585 und der Vergleich von 1610, die also mecklenburgische Fischerei nicht ausschlossen. Ebensowenig kann ein Fischereiregal daraus gefolgert werden, daß Streitigkeiten zwischen den einzelnen Lübecker Fischergruppen von Lübecker Gerichten entschieden wurden 336 ). Den Fischereivertrag von 1826 hält Rörig (II, S. 270) für zu eingehend, als daß sich außer der lübischen Fischerei noch weitere an der Strecke Priwall-Harkenbeck denken lasse. In gleicher Weise ist aber der Fischfang doch auch anderswo ausgeübt worden, ohne ausschließlich zu sein. Rörig selber gibt zu, daß zur Zeit, wo dieser Vertrag galt, mecklenburgische Fischerei auf der Bucht betrieben wurde 337 ). Aber warum denn erst seit 1870? Es handelt


|
Seite 185 |




|
sich auch keineswegs um ein "gelegentliches Eindringen". Will Lübeck behaupten, daß Mecklenburger Fischer lange Zeit hindurch, etwa vom 17. bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht auf der Travemünder Bucht erschienen seien, so müßte es dies nachweisen. Von uns ist nicht zu erwarten, daß wir für jede Zeitspanne und jede Küstenstrecke die Ausübung der Fischerei belegen können, zumal da mecklenburgische Seefischereiverordnungen erst in neuerer Zeit erlassen worden sind. Es würde übrigens Lübeck ein solcher Nachweis gar nichts nützen, weil die Mecklenburger stets das Recht gehabt hätten, den Fischfang im Küstengewässer ihres Landes wieder aufzunehmen.
Jedenfalls, als Lübeck 1911 dazu überging, fremde Fischerei auszuschalten oder, wie Rörig sagt, die vollen Konsequenzen aus dem Gesetz von 1896 auch für die Strecke Priwall-Harkenbeck zu ziehen, bestand an dieser Strecke seit langer Zeit eine mecklenburgische Fischerei. Und zwar handelte es sich nicht nur um bescheidenen Anliegerfischfang, sondern es fischten hier auch die Barendorfer Fischer, die Poeler, in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch Wismarer Fischer 338 ), endlich die Dassower. Sie fischten an der mecklenburgischen Küste entlang bis zur Lübecker Grenze und bis zum Fahrwasser hin, genau so wie um 1616 der Fang von mecklenburgischer Seite bis zur Travemündung, der damaligen Grenze, betrieben worden war. Die Barendorfer haben sogar bis zur schwarzen Tonne vor der Travemündung und darüber hinaus, auch an der Lübecker Seite, gefischt. Alles vollzog sich unter den Augen der lübischen Fischer und der lübischen Fischereibeamten. Die Dassower hätten nach Rörig 339 ) nur unbedeutende "Kleinfischerei" betrieben. Was heißt das? Unter Kleinfischerei ist Uferfischerei zu verstehen, während die Dassower mit Kähnen und Netzen fischten 340 ). Die Wismarer bedienten sich des Schleppnetzes und der Zeese. Ferner meint Rörig, daß die Ausübung von Kleinfischerei keine Beeinträchtigung des Regals bedeuten würde, und zum Beweise führt er die Verhältnisse auf dem großen Schweriner See an 341 ). Aber diese Analogie ist zu streichen; denn einmal ist der Schweriner See


|
Seite 186 |




|
ein Binnengewässer, und sodann wird in der Abhandlung von Zastrow 342 ), auf die Rörig sich beruft, gerade berichtet, daß unbefugte Kleinfischerei auf dem See von jeher verboten war 343 ). Auch auf den kleinen Schweriner Amtsseen durfte sie nur bis zum 16. Jahrhundert, abgesehen von einigen späteren Ausnahmen, unentgeltlich ausgeübt werden 344 ).
Eigenartig mutet Rörigs Bemerkung 345 ) an, daß es eine gewerbsmäßige mecklenburgische Fischerei an der Strecke Priwall- Harkenbeck überhaupt nicht gäbe und daß sich unser Satz, die Mecklenburger könnten hier ihrem Gewerbe nicht nachgehen, "sich höchstens auf mecklenburgische Berufsfischer jenseits der Harkenbeck beziehen" könnte. Auf den Wohnsitz der Fischer kommt es doch nicht an. Auch die lübischen Fischer wohnen ja nicht in Warnemünde; trotzdem erscheinen sie dort vor der Küste zum Fischfang. Tatsächlich liegen die Dinge so, daß das mecklenburgische Fischergewerbe durch die Lübecker Maßnahmen schwer geschädigt wird, während die "ungemein zahlreiche Fischerbevölkerung" Lübecks ja gar nicht allein auf die Travemünder Bucht angewiesen ist. Es besteht in den Kreisen der mecklenburgischen Fischer eine gerechte Erbitterung darüber, daß sie auf dem seit Jahren für den Heringsfang so wichtigen Meeresgebiet vor der Travemündung nicht zugelassen werden sollen.
Tatsache ist, daß Lübeck um 1870 überhaupt keine Gebietshoheit am mecklenburgischen Ufer vertreten hat 346 ), obwohl doch die lübische Fischerei dort genau so betrieben wurde wie früher. Das Fischereigesetz von 1896 nahm dann ein Regal bis zur Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld in Anspruch. Indessen kann ein einseitig von Lübeck erlassenes Gesetz keine Gebietshoheit schaffen, ganz abgesehen davon, daß die mecklenburgischen Rechte seither nicht verjährt sind. Rörig (II, S. 301 f.) vergleicht dieses Gesetz mit den Verordnungen über die Fischerei in den Ostseegewässern bei Wismar von 1897 und 1908. Aber die Wismarer Bucht ist stets wie ein Binnengewässer behandelt worden, und des weiteren


|
Seite 187 |




|
ist sie, worauf es gerade ankommt, von Küsten ein und desselben Staates eingeschlossen, was für die Travemünder Bucht nicht zutrifft 347 ).
Wenn Mecklenburg gegen das Gesetz von 1896 nicht protestiert hat, so ist dem entgegenzuhalten, daß auch von Lübecker Seite gegen mecklenburgische Verordnungen, die das Gewässer vor der Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck betreffen, kein Einspruch erhoben worden ist. Es handelt sich dabei um folgende Bestimmungen:
1) In § 1 der Verordnung vom 10. Oktober 1874 zum Schutze der Dünen des Ostseestrandes bei Rosenhagen, Barendorf usw. wird verboten, "im Dünenbezirke oder an den hohen Ufern längs der Seeküste, wie auch aus der Ostsee bis 400 Meter in die See hinein , von dem seewärts belegenen Fuße der Dünen beziehungsweise der hohen Ufer gerechnet, ohne Erlaubnis der Ortsobrigkeit Sand, Kies, Thon oder Lehm zu graben, Gras, Dünenkorn oder sonstigen Anwuchs abzuschneiden und Seetang oder Steine wegzuholen." - Diese Verordnung ist auf Ersuchen der mecklenburgischen Regierung von Lübeck in Travemünde veröffentlicht, also ausdrücklich anerkannt worden 348 ).
2) Die Verordnung vom 17. Dezember 1874 zur Ausführung der Strandungsordnung des Reiches vom 17. Mai gleichen Jahres bestimmt in § 2, Ziffer 7 als Bezirk des Strandamtes Grevesmühlen das Gebiet "von der westlichen Grenze der Feldmark Beckerwitz 349 ) bis zur Grenze des


|
Seite 188 |




|
Gebiets der freien und Hansestadt Lübeck". - Natürlich setzt die Handhabung der Strandungsordnung eine Hoheit Mecklenburgs auf dem Gewässer voraus, in dem "ein auf den Strand geratenes oder sonst unweit desselben in Seenot befindliches Schiff" 350 ), dem Hülfe zu bringen ist, bemerkt wird.
3) Die Verordnungen über den Fischereibetrieb in der Ostsee vom 1. Okt. 1868 und 20. Juli 1875 sowie die Verordnung über den Fischereibetrieb vom 18. März 1891 regeln auch den Fischfang "am Außenstrande der Ostsee . ." Zum Außenstrande gehört auch die Strecke Priwall-Harkenbeck.
4) § 1 der Verordnung zum Schutze der Fischerei auf Plattfische vom 22. April 1904 regelt diese Fischerei "an der ganzen Ostseeküste Unseres Landes bis auf 51/2 km von der Küste", also innerhalb der Drei-Seemeilen-Zone. Ebenso § 1 der gleichartigen Verordnung vom 20. Dezember 1913.
Auf einen unvordenklichen Besitzstand kann Lübeck sich nicht berufen. Denn seit Menschengedenken liegen mecklenburgische Verordnungen vor, die das Gewässer vor der Uferstrecke Priwall-Harkenbeck betreffen, und seit Menschengedenken ist auch mecklenburgische Fischerei auf der Bucht ausgeübt worden. Auch hat ja Lübeck selber um 1870 einen ganz anderen Standpunkt eingenommen als heute. Rörig bringt dies in Zusammenhang mit dem "Eindringen völkerrechtlicher Anschauungen". Doch waren gerade die damaligen Anschauungen der Lübecker Verwaltung die richtigen. Es gibt in der Travemünder Bucht und darüber hinaus kein lübisches Eigengewässer, das in seinen Rechtsverhältnissen einem Binnengewässer entspräche, sondern nur Küstenmeer beider streitenden Staaten 351 ). Und um hier zu fischen, dazu bedarf es keiner Lübecker "Nachsicht". Lübeck hat ja auf der Travemünder Bucht nie ein alleiniges Fischereirecht gehabt, wie Rostock es auf Grund seiner Privilegien an seinem Meeresufer besaß, wollten aber andere deutsche Küstenstaaten mit Hülfe archivalischer Forschungen festzustellen suchen, daß vormals der Fischfang an ihrer Küste oder an Teilen davon ausschließlich von ihren Untertanen ausgeübt sei, und dann die neuere Praxis als Irrtum bezeichnen, so möchte in den Rechtsverhältnissen des deutschen Küstengewässers eine beträchtliche Wirrnis angerichtet werden.


|
Seite 189 |




|
Als im Herbst 1911 die Bestrafung der Barendorfer Tagelöhner erfolgt war und die mecklenburgische Regierung am 2. November 1911 deswegen beim Lübecker Senat anfragte, stellte dieser am 29. Februar 1912 eine Beantwortung in Aussicht, die aber erst am 10. Juni 1912 erfolgte. In diesem Schreiben heißt es, der Senat müsse "nach dem Ergebnis der angestellten Untersuchungen, die sich auf ein reiches archivalisches Material erstreckten", daran festhalten, daß Lübeck die Fischereihoheit "bis zur Harkenbeck, und zwar auch in unmittelbarer Nähe der mecklenburgischen Küste" zustehe. Indessen scheint sich der Senat noch im Jahre 1911 seiner Sache gar nicht sicher gewesen zu sein, weil er es ja für nötig hielt, sein Archiv mit einer Untersuchung zu beauftragen 352 ). Lübecker Archivberichte müssen auch in der Begründung des Urteils verwendet worden sein, das 1913 vom Amtsgericht zu Lübeck gegen zwei Poeler Fischer gefällt wurde; ein Urteil übrigens, das zwischen den beiden Staaten selbst kein Recht schaffen kann.
Die Unterlagen der Erklärung Lübecks 1912 hat Mecklenburg dann teilweise durch das erwähnte Gerichtsurteil, eingehender erst durch das Gutachten Rörigs vom Oktober 1922 erfahren. Niemals aber hat es inzwischen sein Recht aus der Hand gegeben. Aus nebensächlichen Dingen will Rörig scheinbar eine Art von Zugeständnis herleiten 353 ), obwohl er andererseits für Lübeck die Folgen der "unterlassenen Rechtsverwahrung" und des "Irrtums im geschichtlichen und logischen Urteil" in so weitgehendem Maße abzuwehren sucht 354 ).


|
Seite 190 |




|
Zusammenfassung.
Unsere allgemeinen Untersuchungen der Rechtsverhältnisse am Ostseestrande seit dem Mittelalter (Teil I) ergeben, daß die Strandhoheit bis zur schiffbaren Meerestiefe reichte (Küstengewässer) und das Regal der Seefischerei umfaßte. Für die Ausübung der Fischerei wurden Abgaben erhoben, die jedoch an großen Teilen der mecklenburgischen Küste weggefallen sind, bis schließlich überall der Grundsatz freier Fischerei im Küstenmeer durchdrang.
Im zweiten Berichtsteile konnten wir darlegen, daß diese Strandhoheit auch an der Strecke Priwall-Harkenbeck von mecklenburgischer Seite vertreten und ausgeübt worden ist (S. 104 ff.), und zwar einschließlich der Fischerei. Mecklenburgische Fischerei bestand in der Travemünder Bucht um 1600 und wurde von Lübeck anerkannt (S. 165 ff., 172 f.). Dann ist sie wieder seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festzustellen (S. 185). Danach ist anzunehmen, daß sie auch in der Zwischenzeit ausgeübt wurde.
Nachdem die Entwicklung über den alten Strand hinausgegangen ist, können für die Abgrenzung der Hoheitsrechte Mecklenburgs und Lübecks in der Travemünder Bucht nur die modernen zwischenstaatlichen Regeln maßgebend sein. Auch seither hat Mecklenburg seine Rechte durch Verordnungen betätigt (S. 187 f.). Dagegen kann Lübeck weder auf Grund von Privilegien noch auf Grund eines unvordenklichen Besitzstandes eine Gebietshoheit vor der Strecke Priwall-Harkenbeck geltend machen. Eine Reedegrenze im Rörigschen Sinne hat es nie gegeben (II, B), auch ist die Harkenbeckmündung keine Hoheitsgrenze (S. 105 f., 128, 144 ff.). Handlungen Lübecks, die infolge von Gebietshoheit geschahen, sind für das strittige Gewässer nicht nachgewiesen. Als solche Handlungen können auch nicht die Störungsakte von 1616/17 und 1658 angesehen werden (S. 150 ff.), ebenso wenig die Ausübung der Fischerei, die von jeher eine hergebrachte Nutzung war und sich in ihrer rechtlichen Natur von dem Fischfange der Lübecker östlich von der Harkenbeck und vor der holsteinischen Küste nicht unterschied (S. 145 f., 160, 168 f.). Jahrhunderte hindurch haben die lübischen Fischer am mecklenburgischen Strande Gastfreundschaft genossen. Aus diesem Gastrecht aber ist kein Hoheitsrecht des Lübecker Staates bis zur Harkenbeck geworden.


|
Seite 191 |




|
Wir halten daran fest, Rörig in allen entscheidenden Punkten widerlegt zu haben. Mecklenburg beansprucht das Hoheitsrecht auf der Travemünder Bucht von seiner Staatsgrenze an in nördlicher Richtung bis zum Buchtfahrwasser und an diesem entlang. Es ist hierzu berechtigt.
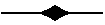


|
Seite 192 |




|
Anlage I.
Friedrich Techen hat in seinem Aufsatze: Das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste (Hansische Geschichtsblätter XII, 1906, S. 273) eine Stelle des Privilegs interpretiert, das der Fürst Heinrich I. von Mecklenburg am 14. April 1266 der Stadt Wismar ausstellte (Mecklb. Urkundenb. II, Nr. 1078). Diese Stelle lautet:
omnia infra terminos sive disterminaciones dicte civitatis contenta, tam aquas, quam prata cum pascuis et insulam Lypez usque ad municiones civitatis . . . concedimus perpetuo possidenda.
Die Urkunde ist nach Techen in zwei beglaubigten Abschriften (eine davon im Wismarer Privilegienbuche) erhalten. Techen glaubt, daß statt insulam im Original insula gestanden habe, doch ist diese Konjektur nicht zwingend. Die Stelle besagt also:
Wir übertragen zu ewigem Besitz alles, was innerhalb der Grenzen und Scheiden der genannten Stadt liegt, sowohl Wasser wie Wiesen mit Weiden, und die Insel Lieps, bis zur Stadtbefestigung.
Techen, der "mit den Weiden und der Insel Liepz" übersetzt, meint: "Wenn für das Wasser eine Grenze bestimmt sein sollte, so wird diese als durch die Lieps gegeben gedacht sein." Er rechnet also den Hafen bis zur Lieps. Jedoch sind für die Hafengrenze allein entscheidend die Worte infra terminos sive disterminaciones civitatis, d. h. innerhalb der Stadtgrenzen, soweit sie sich um den tiefsten Buchteinschnitt, vor dem Wismar liegt, herum erstrecken. Die Lieps ist als besonderer Besitz einfach eingeschoben, obwohl sie weit außerhalb dieser Grenzen lag. Selber kann sie als Grenze gar nicht in Betracht kommen. Wenn sie auch damals größer gewesen ist als heute, so lehrt doch die Karte, daß man unmöglich das ganze Buchtgewässer von der Lieps bis zur Stadtbefestigung als infra terminos civitatis gelegen bezeichnen kann. Denn die Stadtfeldmark reicht noch heute an den Buchtküsten nur bis Vorder-Wendorf im Westen und Redentin im Osten, die beide nicht dazu gehören; und ausgedehnter ist sie hier nie gewesen. Will man mit Techen "insula" lesen, so muß die Stelle trotzdem so verstanden werden, wie wir auseinandergesetzt haben. Techen meint


|
Seite 193 |




|
zwar, daß ein Privileg des Fürsten Nikolaus II. von Werle, das dieser 1302 infolge einer Erbverbrüderung mit dem Fürsten von Mecklenburg der Stadt erteilte (Mecklb. Urkundenb. V, Nr. 2780), eine authentische Auslegung der Urkunde von 1266 gebe. Aber dieses Privileg bestätigt nur den Besitz des Hafens (de portu), ohne über dessen Größe und Grenzen etwas zu besagen.
Der Abgrenzung des Wassers nach dem städtischen Gebiete zu beiden Seiten der Bucht entspricht es etwa, daß zu Ende des 16. Jahrhunderts der Grevesmühlener Amtmann Thurmann in einem Prozesse wegen des Strandrechtes auf der Lieps, den Wismar gegen ihn angestrengt hatte, das Hafengebiet nur bis zum Hafenbaum, d. h. bis zum äußeren der beiden vorhandenen Bäume, also bis zur sperrbaren Hafengrenze rechnen wollte, die ungefähr da lag, wo heute die beiden Schwedenköpfe angebracht sind.
Der Wismarer Rat allerdings nahm die ganze Wasserfläche bis an die Lieps als Hafen und städtisches Gebiet in Anspruch. In dem erwähnten Prozesse wurden 1597 zwölf von Wismar aufgebotene Zeugen darüber vernommen, ob die Lieps, samt dem Strandrechte dort, der Stadt gehöre und im Stadthafen liege. Es kam also darauf an, festzustellen, ob sich der Hafen so weit nach Norden erstrecke. Die Zeugen, fast lauter Seeleute oder Fischer und, mit zwei Ausnahmen, Wismarer Einwohner, rechneten den Hafen oder das Tief so weit, wie die Seetonnen lagen, d. h. bis zum Timmendorfer Haken am Eingange in die Bucht gegenüber der Lieps, auch bis zum Hanenberge (Hannibalriff). Ausdrücklich unterschieden jedoch mehrere Zeugen zwischen dem eigentlichen Hafen bis zum Hafenbaum und dem weiter hinaus liegenden Tief. Andere Zeugen erklärten, Hafen und Tief seien "ein Ding". Auch eine außerhalb des Baumes bis gegenüber Hoben (an der westlichen Buchtküste, nicht weit von Wismar) sich erstreckende Reede wird erwähnt. Beides, Hafen und Tief, kam nach Ansicht der Zeugen den Wismarern zu. Jedoch waren einige in ihren Aussagen unsicher, und es geht daraus hervor, daß sie über die Weite des Hafens nichts Bestimmtes zu behaupten wagten.
Die folgenden Auszüge mögen ein Bild der Aussagen über Hafen und Tief geben:
- Der 88jährige Fischer und Pilot Claus Brun aus Hoben, der als der Kronzeuge Wismars bezeichnet werden kann: "Die Have seie das Wißmarische Tief, da die Schiffe auß-und einsiegelten". - "Binnen, do die Schiffe liegen, heiße es die Have, außerhalb das Tiefe" - "Es werde die Wißmarische Have genennet, biß man die Tonnen vorbeykombt,


|
Seite 194 |




|
welches wol dritthalb Meil von der Wißmar, und daselbsten wol acht, neun und zehen Faden tief, biß an die Solder Beke (?), da scheideten sich die Ströme und gienge die offne See an". - An der Poeler Seite gehe der Hafen "biß an die Golwitz, da die Schiffe siegeln köndten, und ferners biß da die See ankombt". - Der Hafen gehöre den Wismarern so weit, "biß das Rugehövet auß dem Clüßhövede keme".
- Der 63jährige Fischer, frühere Seemann Asmus Holste zu Wismar: "Er wiße nicht anderß, dan das die Wißmarischen ihre Have, biß Pöle wiederkehre, rechneten und ferner biß an das Tonnendief, so fast zwo Wege Sehes von der Statt wehre, und erachte Zeuge, daß die Have binnen den Tonnen gehe." Hernach aber erklärte er, nicht zu wissen, wie weit sich der Hafen erstrecke.
- Der 66jährige Wismarer Fischer Jacob Everß: "Binnen Bohms wehre es eine beschloßene Have, außerhalb des Bohms aber, so weit die Tonnen liegen, würde eß inßgemein das Wißmarische Tief geheißen."
- Der 62jährige frühere Seemann Claus Schönefeldt zu Wismar: "Sonsten nenne Zeuge das Tiefe und Have für ein Ding, welches dan auch gemeinlichen für ein Ding gehalten würde, binnen den Gründen, so zwo Meil Wegs von der Wismar belegen." - "Hinter dem Lande zue Pöle liege eine Grundt zur Seewart, der Hanenbergk genandt, welche sich biß hinüber an die Mittelgrundt erstrecke, und wiße nicht anderß, den daß sich die Have an der Seit auch so weit erstrecke."
- Der 60jährige Steuermann Marx Speet zu Wismar: "Wan man binnen den Gründen wehre, biß an das Land zu Pöle, welches eine Meil Wegs von der Wißmar, also weit erstrecke sich die Wißmarische Have. Was die Gründe anlange weiter hinauß, heiße man die Wißmarischen Gründe und nicht die Have." - Der Hafen gehe "bis harde bey das Land zu Pöle ein, da die eine Tonne liege, eine große Wege Sees von der Statt." - "Was zwischen dem Bohme und der Hoven (Hoben) ab seie, das werde eigentlich die Have geheißen, das übrige biß an die Gründe, da die Tonnen liegen, würde daß Wißmarische Tiefe geachtet."
- Der 62jährige Steuermann Lorenz Krause zu Wismar: "Außer dem großen Bohme heiße es uf der Reide oder im Tiefe."
- Der 53jährige Fischer Jacob Barner zu Wismar: die Lypze


|
Seite 195 |




|
liege binnen den Wißmarischen Gründen, aber nicht in der Have, und heiße die Have so weit bis an den Wißmarischen großen Bohm, außerhalb demselben heiße es daß Wißmarische Tief" (bis zu den Tonnen).
- Der 67jährige Brauer und Seehandelsmann Jasper Tabbert in Wismar: "Die Lypze liege im Wißmarischen Diefe, alß die Schiff auß- und einsiegelten, binnen den Gründen, aber nicht in der Statt Have, weil er nicht eigenlich wißen köndte wie weit sie rechneten, daß die Have angienge." - Hernach aber: "Diese drey Orter, alß die Lypze, Have und Tiefe achte Zeuge nach seinem Verstande für ein Ding und nicht für unterschiedliche Örter, außerhalb, daß man bey der Lypze nicht siegeln köndte, und liege dieselbe recht im Wißmarischen Tiefe, und würde sonsten wol von etlichen die Have genennet, da die Schiffe in liegen, fürlengst dem Bollwerck." - " . . . und sei kein gesetzt Recht, wie mans nennen soll, sonsten erstrecke sich daß Wißmarische Tief biß an die Gründe." - Auf die Frage, warum er den Hafen weiter rechnen wolle als bis zum Hafenbaum: "Ein jeder möchte sie rechnen, wie weit er wölle, allhie wehre keine beschloßene Have." - "Sonsten halte Zeuge die Wißmarische Have und Tiefe für eins, ob wol etliche es anders deuten und rechnen wolten."
- Der 73jährige Gärtner Christoph Grüell in Wismar: "Die Wißmarischen hielten Tonnen, derowegen Zeuge erachte, daß sie dieselbe (die Have) so weit verteidigten."
- Der 65jährige Wismarer Schiffer Heinrich Bumgarde: Ein Hafen sei, "da man Schiff und Gutt könne bergen, alß im Wißmarischen Dief geschehen könne. Der Lübeck und Rostock heiße es eine Reide". - "Die Wißmarische Have gehe, so weit die Tonnen liegen, zwo Meil Wegs von der Wißmar, welche Tonnen die Wißmarischen halten müesten, und achte Zeug die Wißmarische Have und Tiefe vor ein Ding." - "Alles, was binnen den Gründen liege, hieße im Wißmarischen Tiefe." - "Das Wißmarische Tief und Have gienge biß zu Pöle, und gebe solches der Augenschein." - "Weil allhie zur Wißmar die Have von Wißmar an, biß da die Tonnen liegen, so wol an einer Seiten von Land zu Pöle, alß uf der andern Seiten von Clußhövede herüber beschloßen wehre, so gehe die Wißmarische Have auch so weit. Wan es aber an andern Örtern auch solche Gelegenheit hette, köndte es auch geschehen." - "Die Gründe außerhalb deß


|
Seite 196 |




|
Wißmarischen Tiefs scheideten die Oost-See und daß Wißmarische Tief, wie es der Augenschein ergebe."
- Der Wismarer Fischer Jacob Meißner, über 60 Jahre alt: Die Wismarer hielten ihren Hafen, "so weit alß die Tonnen liegen, gegen der Lypze zu, Ostnordoost über". - Auf der Poeler Seite gehe der Hafen "biß an den Haken, da die eine Wißmarische Tonne liege, bey anderthalb Wege Sees von der Statt."
- Der gegen 65 Jahre alte Poeler Bauer und Pilot Carsten Buck, Lübecker Untertan: Der Hafen gehe bis zum Hanenberg, "und seie also dieselbe Have auch außerhalb deß großen Bohms". Auf die Frage, warum er den Hafen über den Baum hinaus rechne: "Er habe es von Hörensagen, sie möchten es beweisen." - "Zeuge acht daß Wißmarische Tief und die Have für ein Ding."
Diese und weitere Aussagen lassen erkennen, daß man unter dem Tief, wie schon der Ausdruck selbst besagt, das schiffbare, tiefe Wasser der Bucht verstand 1 ). Auf Angaben einiger Zeugen über eine vermeintliche Strandgerechtigkeit Wismars an der landesherrlichen Küste und über die Abgrenzung des landesherrlichen Rechtes an der See gehen wir im Texte des Berichtes (S. 37 ff.) ein. Der Wismarer Rat selbst hat nie, wie Lübeck es auf der Travemünder Reede tut, das Gewässer der Bucht bis an den trockenen Strand beansprucht.
Daß die Zeugen das Tief zum Hafen rechneten, erklärt sich aus der geographischen Lage, weil die Bucht noch keine offene See ist, wie denn der Schiffer Bumgarde (Zeuge 10) den Hafen einfach nach dem Augenschein bemaß, weiter daraus, daß die Bucht den Schiffen, auch außerhalb des eigentlichen Hafens, Schutz bot Praktische seemännische Erwägungen sind es, nicht gebietsrechtliche, die diese Aussagen bestimmten. Eine von dem Anwalt des Amtmannes Thurmann, also von dem Vertreter der landesherrlichen Rechte gestellte Frage, ob die Zeugen wüßten, was ein Hafen im Rechtssinne sei, verneinten alle. Es folgten zwei Fragen, ob nicht ein Hafen der Ort sei, wo Schiffe sicher liegen könnten, und ob man wohl den öffentlichen Strom und Seestrand 2 oder 11/2 Meilen von einer Stadt als deren Stadthafen betrachten könne, Fragen, die erkennen lassen, daß Thurmann und sein Anwalt dem Gewässer bei der Lieps


|
Seite 197 |




|
nicht die Eigenschaft eines Hafens beilegten, wie denn in der Tat wohl niemand den Eindruck hat, sich hier in einem Hafen zu befinden. Die Zeugen aber beriefen sich darauf, daß die Schiffe im Tief vor Anker liegen könnten, weil es binnen Landes sei. Da finden sich denn Antworten wie die des Fischers Everß (Zeuge 3):
"So weit es zwischen Landts wehre, köndte es wol sein." Hernach sagte er aus: Der Hafen werde "binnen den Tonnen gerechnet, aber nicht außerhalb, dan binnen den Tonnen köndten die Schiff für Ancker und Tow wol loß riden" (Reede machen).
Ähnlich eine Antwort des Seemanns Schönefeldt (Zeuge 4):
"Allhie zur Wißmar würde es von den seefahrenden Leuten, wan man über die Mittelgründe keme, welches zwo Meil Wegs von der Statt wehre, also gehalten, und köndte man daselbst ein Schiff für einen Tow oder, so es nicht halten wölle, für zwey Towe bergen. Wie es aber in andern Stetten seie und gehalten werde, davon wiße er nicht zu berichten, sondern wan daselbsten die Schiffe buten Bohms wehren, so sagten sie, daß sie in der See liegen."
Oder die Aussage des Steuermanns Speet (Zeuge 5):
". . wan man binnen den Gründen wehre, so seie man im Wißmarischen Tiefe, da ein Schiff mit Ancker und Towe der Windt wehe auch her, woher er wölle, köndte geborgen werden, und wan der Windt auß der See von Norden und Nord-Westen wehre, kondte man es auch bergen sonder Ancker und Tow, binnen Bohms gegen der Hoven."
Der Steuermann Krause (Zeuge 6) meinte, man könne das einen Hafen nennen,
"wo man Beschutz habe und Reide machen köndte, welches man allhie zur Wißmar thun könne".
Der Brauer Tabbert (Zeuge 8) erwiderte:
"Alhie zur Wißmar köndte es wol sein, weil allhie die Gründe zwo Wege Sees von der Wißmar liegen, und also weit gienge auch daß Wißmarische Tiefe; Zeuge aber wiße keinen Unterschied unter Have und Tief. In andern Stetten hette es eine andere Gelegenheit, daß sie Tief und Have so weit nicht rechnen köndten."
Der Schiffer Bumgarde (Zeuge 10:
"Wan er zur Wißmar binnen den Gründen wehre, welche noch buten der Lypze in der See liegen, so hielde erß dafür, daß er in einer Haven wehre, was aber außerhalb den Gründen oder Tonnen wehre, köndte er, Zeuge, nicht in


|
Seite 198 |




|
der Have halten, sondern in der See. In den andern benachbarten Stetten hieße eß eine Reide." Hernach: "Er seie biß dahero gewohnet gewesen, so viel die Stadt Wißmar belange, wan er binnen den Gründen wehre, daß er in deß Rahts zur Wißmar Gebiete und Tiefe und also geborgen seie. Wie es in andern Stetten gehalten würde, nescit." - "Die Wißmarische Have gienge biß an die Gründe und würde von den seevahrenden Leuten gesagt, wan sie die Wißmarischen Gründe vorbey wehren, Gottlob, wir sein im Wißmarischen Tief."
Der Fischer Meißner (Zeuge 11):
Er rechne den Hafen weiter als bis zum Baum "darumb, weil die Schiffe jenseit deß großen Bohms sicher sein können, wan Ancker und Tow hielten".
Was die Zeugen sich unter einem Hafen dachten, geht aus einer ganz verständigen Definition des Fischers Everß hervor, wie sie ähnlich auch von anderen Zeugen gegeben wurde:
"Eine Have wehre, da die Schiffe auß- und einsiegelten und da man Schiffe und Güetter für Ancker und Tow bergen köndte, und anderß wiße er eine Have nicht zu beschreiben."
Auch eine Reihe der von Amtmann Thurmann aufgebotenen 23 Zeugen, Bauern und Fischer aus Tarnewitz, Boltenhagen, Beckerwitz, Niendorf und Wichmannsdorf, erachteten, daß der Hafen so weit gehe, als die Schiffe segeln könnten, während andere wieder nicht wußten, wie weit der Hafen gerechnet werde. Einer dieser Zeugen, ein Bauer und Schulze zu Niendorf, meinte, "das Wissmarische Tiep, weil sie (die Wismarer) sich desselben gebrauchten, muste ihnen ja zugehoren, wie weit sich aber dasselbe erstrecke und ob unser g. F. und Herr sich deßen anmaße 2 ), wisse Zeuge nicht . ." Ein anderer, der Fischer und Kossate Claus Preen aus Boltenhagen, erwiderte auf die Frage, ob das Meer bei Wismar den Herzögen zustehe, ganz unbestimmt: "Er konne nicht anders sagen, dan so weit sich der Hertzogen Ströme erstrecke, welches er doch nicht wisse, den(n) das saltzen Have sei weit". Eine einsam erscheinende Zeugin endlich, eine Kossatenfrau aus Wendisch-Tarnewitz, erklärte, die Lieps liege im fürstlichen Hafen und nicht im wismarischen. Über den Begriff der Gebietshoheit waren sich diese einfachen Leute völlig im Unklaren, und mit allen Aussagen sämtlicher 35 Zeugen läßt sich eine Gebietshoheit Wismars auf dem


|
Seite 199 |




|
Tief nicht beweisen. Martin von Plessen zu Barnekow hatte ganz recht gehabt, als er zehn Jahre früher bei einem Streit mit Wismar wegen der Kornverschiffung von dem "vormeinten Strom" der Stadt schrieb 3 ).
Wie der Gärtner Grüell aus Wismar angab, lagen "die großen Schiffe den Winter über oft außerhalb des großen Bohms". Näher läßt sich die Wismarer Reede nach einer Aussage des hochbetagten Zeugen Claus Brun aus Hoben bestimmen:
"Gegen sein, Zeugens, Thür, da die großen Schiffe liegen, gegen den Holm, biß an die Statt und nach der Seewart hin (seewärts), da die Tonnen liegen, daß seie die Have."
Also nach dem Walfisch (Holm) zu, gegenüber von Hoben und dicht bei der Stadt lag die Reede. Dazu stimmt auch die Aussage des Steuermannes Speet:
"Was zwischen dem Bohme und der Hoven (Hoben) ab seie, das werde eigenlich die Have geheißen."
Zwar erklärte Claus Brun:
". . wan schon die Schiffe ein Meil Wegs und weiter von der Wismar liegen, müsten sie gleichwol ihren Ruderzollen, ein Thaler oder einen halben Thaler nach Gelegenheit, wie auch den Acciß geben,"
aber die Regel wird es nicht gewesen sein, daß Schiffe so weit draußen ankerten; denn die erwähnten beiden Aussagen, darunter die von Claus Brun selber, lassen ja die Örtlichkeit der Reede deutlich erkennen. Und die Abgaben, die Claus Brun meinte, wurden nicht erhoben, weil die Schiffe auf Wismarer Gebiet lagen, sondern weil sie löschten und luden, so daß ihre Fracht in den Hafen hinein oder aus ihm heraus gebracht wurde 4 ).


|
Seite 200 |




|
Das Tief der ganzen Bucht als Hafen zum Wismarer Gebiet zu zählen, war unzulässig. Daß dort Schiffe ankern konnten, spielt für die gebietsrechtliche Entscheidung keine Rolle. In den von Wismar aufgestellten Elisivartikeln 13-15 wurde behauptet, daß die Stadt die Gerichtsgewalt auf der Lieps und im Hafen ausgeübt, beides, Insel und Tief, seit über Menschengedenken "vor ihren unzweiflichen Grundt und Bodem" beschirmt und verteidigt habe und daß die Jurisdiktion ihr iure proprietatis zuständig sei. Hierzu bemerkte Claus Brun, er wisse von seinem Großvater, daß die Wismarer drei Pfähle in den Hafen gestoßen hätten, einen auf der Ketelsharde (Kettelhard, Untiefe westlich von Redentin), den zweiten "zum Frimenßorte, welchen man den Frimens-Pfal genennet" (wohl in der Nähe von Fliemstorf, das nördlich an Hoben grenzt), den dritten "uf den Staggow bey Frimenstorff" (Fliemstorf), wohl dem heutigen Stagort, "welche Pfäle die Scheide uf die Lypze gewiesen und die Scheide gewesen wehren, wie dan auch Zeug selbst die Pfahl wol gesehen, und wehren über sechs Jahr nicht weg gewesen" (standen also nun nicht mehr). Als Antwort Claus Bruns auf Elisivartikel 15, die Jurisdiktion Wismars betreffend, notiert das Protokoll:
"Sagt wahr, außerhalb daß er von der Jurisdiktion und Gerichtsgewaldt nicht wiße. Ursach seines Wißens, dan unßer gnediger Fürst und Herr sich der Lypze, so wol auch der Have und Tiefes nie angemaßet."
Der 4. Zeuge brachte vor, "daß den Schiffern könne verpotten werden, daß sie keine Boßleute (Matrosen), die etwas gethan, und andere, so etwaß verbrochen, von hinnen führen dürfen, ehe es ihnen erlaubt," was natürlich kein Beweis für die Behauptung ist, daß den Wismarern das Gewässer bis an die offene See gehöre. Der 5. Zeuge berichtete gar von einem Morde "am Ziegelhövede, bey der Lastadie", also ganz nahe am Bollwerk (wenn nicht auf dem Lande selbst), den der Rat gestraft habe. Außerdem erwähnte er, ebenso wie die Zeugen 6 und 8, ganz allgemein Todesfälle im Stadthafen, über die das Fahrrecht vom Rate gehalten sei, ohne nähere Ortsbestimmung. Wahrscheinlich waren es dieselben Fälle, deren Schauplatz von einigen Zeugen angegeben wurde. Der


|
Seite 201 |




|
3. Zeuge nämlich wußte von Ertrunkenen, die "gegen dem Frimenßorte binnen dem Holm oder sonsten binnen Bohms" den Tod gefunden hatten; die Zeugen 7 und 12 berichteten, daß nach der Kenterung eines Bootes bei der Lieps vor 30 Jahren zwei der Insassen ertrunken und "an die Lypze zu Lande gekommen seien"; der Rat habe einen Gerichtsdiener und einen Barbier hingeschickt, ob aber eigentlich Fahrrecht gehalten sei, wußten die Zeugen nicht; weil die Leichen am Lande gefunden wurden, kann dieser Fall für den Hafen nichts beweisen. Außerdem erklärte der 7. Zeuge, es sei vor vier Jahren ein Prahm "dißeit deß Holms" untergegangen, wobei drei Personen ertrunken seien; ferner hätten sich vor sechs Jahren zwei Jungen im Winter "gegen dem Holm" in eine Wake "gepücket". Über alle diese Fälle habe der Wismarer Rat das Fahrrecht ausgeübt. Ebenso der 11. Zeuge: "Er habe wol gesehen, wan Leute in der Haven binnen Bohms zu Schaden kommen, wie Zeugen dan gedencke, daß zween Jungen bey dem Holm in daß Eiß gefallen und ertruncken, daß darüber vom Raht zu Wißmar Gericht geheget worden". Der 10. Zeuge erinnerte sich zweier Fälle, in denen Personen ins Eis gefallen und als Leichen aufgefischt seien; ein Fall davon örtlich bestimmt: "zwischen dem Holm und großen Bohme" 5 ). Der 9. Zeuge endlich führte zwei Fahrrechtsfälle "binnen den beiden Böhmen" an.
Seewärts vom Walfisch wurden also Fahrrechtsfälle nicht bezeugt. Freilich lag der Walfisch schon außerhalb des großen Hafenbaumes; hier war kein Hafen mehr, sondern Reede. Es geschah wohl nicht mit Wissen und Zustimmung der Landesherrschaft, daß Wismar sich auch auf der Reede das Fahrrecht zuschrieb. Als jedenfalls 1621 der Wismarer Rat über einen bei Brandenhusen (Südwestspitze Poels) ertrunkenen Lübecker Matrosen, dessen Leiche durch den lübischen Kapitän nach Wismar ans Land geschafft war, das Fahrrecht abgehalten hatte und die Beamten in Neubukow davon erfuhren, wurde sofort Einspruch erhoben. Nach dem Berichte der Beamten hatte sich der Todesfall hinter Brandenhusen am fürstlichen Strande zugetragen, nach der Angabe Wismars "in dieser Stadt unstreitigen Strome und wißmarischen Tief", am Harten Orte, wo nicht zu gründen sei, nach einem Schreiben des Herzogs Adolf Friedrich an die Stadt aber "auf unserm Strom beim Lande Pole hinter Brandenhusen und also auf unserm unstreitigen Grund und Boden". Der Herzog verlangte Genugtuung oder Beweis der


|
Seite 202 |




|
Wismarer Ansprüche, worauf die Stadt sich auf ihre Privilegien berief, mit denen hier aber schlechterdings nichts anzufangen war, und Wert darauf legte, daß am Harten Ort eine Tiefe von 8 Ellen und also Raum für große Schiffe sei und daß die Seetonnen "eine gantze Weke Sehes" weiter lägen. Der Ausgang des Streites geht aus den Akten nicht hervor 6 ).
Was sonst bei den Wismarer Zeugenaussagen von 1597 über die Gebietshoheit zutage kam, waren allgemeine Behauptungen wie: man habe gehört, "daß die Lypze und die Statthave den Wißmarischen solle zukommen und dieselbe verpetten", oder daß sie "Have und Tiefe für ihre Freyheit sollen gehabt haben", bloße Behauptungen also, wie sie auch der Wismarer Rat aufstellte, die aber erst zu beweisen waren; oder es steht im Protokoll ein Nescit zum Zeichen dessen, daß der Zeuge versagte. Und wie sollte gar eine Gebietshoheit über das Tief der Bucht mit der Aussage des Brauers Tabbert bewiesen werden, daß er den Stadthafen "am Bollwerck" seit 25 Jahren im Auftrage des Rates säubern lasse, oder mit dem Elisivartikel 17, wonach Wismar auf dem Grasorte, innerhalb des Stadtfeldes am Lande, einen Galgen errichtet hatte, der nach Claus Brun Wassergalgen genannt wurde und vor langer Zeit umgeweht war!
Was übrig bleibt, sind die Legung von Seetonnen und die Einstoßung von Pfählen im Tief. Techen (a. a. O. S. 307) erwähnt eine Denkschrift von 1622, wonach seit über Menschengedenken zwei Tonnen auf dem Hanenberge (Hannibal) und dem Timmendorfer Haken an der Poeler Küste lagen. Eine Tonne am Poeler Haken wird auch bei den Zeugenaussagen von 1597 erwähnt, doch kann die zweite sich damals nicht auf dem Hanenberge befunden haben, weil der Bauer und Pilot Carsten Buck aus Poel ausdrücklich erklärte, der Hafen "gehe biß an die Tonnen, wie auch außerhalb denselben biß an den Hanenbergk". Von den beiden Tonnen, die nach Claus Brun zwei große Meilen von Wismar lagen, mag die eine wohl westlich von Timmendorf auf der "Platte", wo für den Anfang des 18. Jahrhunderts eine Tonne bezeugt ist (Techen a. a. O.), oder auf dem etwas weiter südwestlich gelegenen Mittelgrunde verankert gewesen sein. - Die von Claus Brun angeführten drei Pfähle auf Ketelsharde, auf dem Staggow und dem Friemensorte werden auch von zwei weiteren Zeugen erwähnt, von denen einer, der Fischer Everß, noch den Friemenspfahl gesehen hatte, von dem auf dem Staggow nur wußte, daß er früher


|
Seite 203 |




|
jedes Jahr gesetzt worden sei, "bey seinem Gedencken" aber nicht mehr, während der andere Zeuge, der Steuermann Krause, vor 40 Jahren die Pfähle auf Ketelsharde und dem Staggow, zwei Gründen im Tief, hatte stehen sehen. Damit sollte dargetan werden, daß Wismar über das Tief zu gebieten habe. Jedoch hatten die Pfähle alle drei in der inneren Bucht gestanden, und sie waren bereits verschwunden, nach Claus Brun seit höchstens sechs Jahren, nach dem Zeugnisse des Steuermannes Krause aber seit viel längerer Zeit. Auf Untiefen eingestoßen, dienten sie gleich den Tonnen zur Bezeichnung des Fahrwassers, und zwar nach der Lieps hin, wie die Aussage Claus Bruns ergibt 7 ). Und unmöglich konnte die Stadt Wismar sich dadurch, daß sie ein paar praktischen Zwecken dienende Seezeichen anbrachte, zur Eigentümerin des gesamten Fahrwassers machen.
Der Wismarer Rat selbst scheint sich nicht klar darüber gewesen zu sein, ob er den Hafen bis zu den Tonnen rechnen solle. Nach einem Schreiben, das er 1612 an den herzoglichen Hauptmann Tiede zu Doberan und Neubukow richtete 8 ), wurde als Hafen das Gewässer "binnen der Lypze und der Statt unstreitigen Tonnen-Tiefe" betrachtet; in dem schon erwähnten Fahrrechtsstreite von 1621 aber berief sich der Rat dem Herzoge Adolf Friedrich gegenüber auf das alte Privileg, das die Vorfahren des Herzogs ausgestellt hätten und wonach Wismar der Hafen, "so weit sich derselbe von der Insel Lüptze biß an das Bollwerk für der Statt erstrecket, eigenthumblich concedirt" sei; freilich gedachte der Rat in diesem Schreiben hernach der Seetonnen 9 ), aber er gründete seinen Anspruch auf das Privileg von 1266, das er so auslegte, wie Techen es ausgelegt hat, und selbst bei dieser Deutung reichte der Hafen nicht bis zu der Seetonne, die 1622 seit längerer Zeit auf dem Hanenberge lag. 1585 und 1589 bezeichnete Wismar als Stadthafen das Gebiet, "so weidt sich das Waßer von der Stadt biß an die Luptze auf beiden Norder- und Suderseiten erstrecket" 10 ), wobei mit Nordseite nur das Gewässer nach Poel zu, mit Südseite nur das nach dem Festlande zu gemeint sein kann; ebenso 1622 "soweit sich


|
Seite 204 |




|
das Waßer von der Stadt Bollwergk biß an die Lipse inclusive beyde der norder und sueder Seiten erstreckt" 11 ); also alle drei Male wurde nur das Gewässer bis zur Lieps beansprucht, aber mit allen Hoheitsrechten, und zwar vermöge der städtischen Privilegien.
Daß die Landesherrschaft der Stadt nur die Wasserfläche bis zum großen Hafenbaum zugestand, geht aus einer Spezialfrage hervor, die der Thurmannsche Anwalt 1597 den Wismarer Zeugen im Hinblick auf die in verschiedenen Frageartikeln des städtischen Vertreters ausgesprochene Behauptung, daß die Lieps zum Hafen gehöre, vorlegen ließ:
"Ob nicht Zeuge sagen und bekennen muß, das das, waß außerhalb des Wißmarschen Bohms ist, nicht die Stadthave oder Tief, sondern die wilde Sehe und an den Ufern und Sehestrandt sey und genennet werde" 12 ).
Bei dieser Frage, die natürlich den Anschauungen der Zeugen über das Tief nicht entsprach, kann der Ausdruck "wilde See" nur angewendet sein, um den Gegensatz zum geschützten Hafen hervorzuheben, und er ist nicht so zu verstehen, daß das tiefe Buchtgewässer als herrenloses Meer gelten sollte, über das auch der Landesherr kein Recht habe. Wäre das letzte der Fall gewesen, so würde man keinen Unterschied zwischen der Wismarer Bucht und der Travemünder gemacht haben, über deren schiffbaren Teil die mecklenburgischen Kommissare in dem Fischereistreit mit Lübeck 1616 ein Dominium maris weder beanspruchten noch einräumten. Jedoch ist die Wismarer Bucht eine mehr eingeschlossene Wasserfläche, und es wäre schwer einzusehen, warum man sie rechtlich anders behandelt haben sollte als die Gewässer zwischen der Insel Rügen und dem Festlande sowie die rügischen Bodden, die als Binnengewässer galten 13 ). Zwar kommt der Ausdruck "wild" für die herrenlose See vor, wird aber in seiner Bedeutung ebenso schwankend gewesen sein wie der Ausdruck "offene, offenbare See", womit keineswegs immer das herrenlose, gemeine Meer, nicht einmal das Meer an der offenen Küste gemeint wurde. Z. B. bezeichneten Wismarer


|
Seite 205 |




|
Zeugen verschiedentlich das Mitteltief oder Tonnentief der Bucht als offenen Seestrom, obwohl sie es doch als städtisches Gebiet ansehen wollten, während andere Zeugen wieder die offenbare See erst vom Buchteingange rechneten. Überdies läßt sich feststellen, daß die mecklenburgischen Herzöge sich in der Wismarer Bucht nicht nur das reine Strandrecht zuschrieben. Als 1566 der König von Dänemark bei den Herzögen Ulrich und Johann Albrecht über Schiffe Beschwerde führte, die mit verbotenen Waren im Wismarer Hafen und unter Poel lägen und für Schweden nach Estland bestimmt sein sollten, erwiderten die Räte des Herzogs Ulrich in dessen Abwesenheit, daß sie Wismar angewiesen hätten, den bestehenden Mandaten nicht zuwider zu handeln, daß aber die Jurisdiktion über Poel dem Herzoge Johann Albrecht zustehe 14 ). Bezeichnender Weise wird in dem Schreiben der Räte von "Ihrer Furstlichen Gnaden Haven zur Wißmar" gesprochen. Die Ortsbezeichnung "unter Poel", die natürlich für das tiefe Wasser galt, wo die Schiffe Raum hatten, kann sich sowohl auf die Golwitz wie auf die Wismarer Bucht beziehen. Daß aber auch hier in der Bucht eine landesherrliche Jurisdiktion geltend gemacht wurde, lehrt der bereits erwähnte Fahrrechtsstreit von 1621, bei dem Herzog Adolf Friedrich von seinem "Strom beim Lande Pole" sprach. Warum hätte man denn auch die Golwitz rechtlich anders behandeln sollen als die Wismarer Bucht! Ferner wurde zeitweilig "achter Brandenhausen", an der Südküste Poels und offenbar gerade in der Gegend des Fahrrechtsfalles von 1621 (vgl. S. 201 dieser Anlage) ein landesherrliches Hafenrecht ausgeübt, indem die herzoglichen Beamten von dort überwinternden Schiffen Liegegeld nahmen 15 ). An derselben Stelle müssen auch die beiden Schiffe geankert haben, die Herzog Johann Albrecht I. in Memel hatte erbauen lassen und zu deren Besichtigung er 1567 nach Brandenhusen fuhr 16 ). Auch machte der Amtshauptmann Tiede 1608 und 1612 gar keinen Unterschied zwischen Strand und Strom bei Poel, in der Golwitz sowohl wie anderswo an der Buchtküste, sondern nahm beides für den Landesherrn in Anspruch, was gleichfalls darauf schließen läßt, daß die Bucht rechtlich als ein Binnengewässer angesehen wurde 17 ).
Im 16. Jahrhundert kam es mehrmals zu Streitigkeiten, weil Wismar verhinderte, daß die Herzöge Korn aus dem Hafen aus-


|
Seite 206 |




|
führten 18 ), während diese in der Regel ein Schiffahrtsmonopol der Städte ebenso wenig anerkannten wie ein Eigentum Wismars an dem Tief. Schließlich befuhren die beiden großen Lastschiffe Johann Albrechts I. die Bucht, ohne Rücksicht auf das Mißfallen der Stadt hierüber 19 ), und später mußten auch die beiden Kriegsjachten oder Kanonenboote des Herzogs Adolf Friedrich I. 20 ), des Erbauers von Schloß und Festung auf Poel, ertragen werden.
Nach der Abtretung Wismars an Schweden haben die Meinungsverschiedenheiten über den Hafen nicht aufgehört. Wir wollen darauf nicht mehr eingehen. Nur noch ein Wort über die Fischerei.
Ein alleiniges Fischereirecht hat Wismar auf der Bucht nicht gehabt. Es fischten hier auch die Poeler 21 ), die Fischer aus Fischkaten (A. Redentin) 22 ), und als die Wismarer 1612 an der Westküste Poels bei Wangern eine große Reuse setzten, verbat sich der herzogliche Hauptmann Tiede dieses Unternehmen. Er wollte die Reuse wegnehmen lassen, stand dann aber aus "christlichem Mitleiden" mit den armen Fischern davon ab und verlangte den achten Fisch als Abgabe pro recognitione in loco. Als Wismar statt dessen wiederholt behauptete, der betreffende Ort gehöre zum Stadthafen, ließ Tiede die Reuse beschlagnahmen. Vom Herzoge Adolf Friedrich berichtete er, daß den Wismarern zwar "die frey Fischerey umblangst Pöhle gestattet worden", daß sie aber dort keine Reusen setzen und Pfähle dazu in den Strom schlagen dürften. Schließlich befahl der Herzog, die Reuse zurückzugeben und den Fischfang damit bis auf weiteres zu gestatten. Er drückte eben ein Auge zu, wie denn bei der Beurteilung solcher Zwistigkeiten nicht übersehen werden darf, daß Wismar mecklenburgische Territorialstadt war, deren Gewerbe man, wenn es anging, keine Hindernisse bereiten wollte. Zugleich aber ließ der Herzog dem Rate einen Protest dagegen bekannt machen, daß er den .Wismarern "das Dominium


|
Seite 207 |




|
an dem Orte, da sie die Reusen gesetzet gehabt, oder einige andere Gerechtigkeit, so zu Ihrer Fürstl. Gnaden Landesfürstlichen Superioritet, Regalien, Hoch- und Obrigkeit gehörig, gestanden, concediret und eingereumet haben" wolle, dawider sich der Rat durch einen höflichen Gegenprotest wegen der städtischen Privilegien salvierte 23 ).
Nach einem Berichte des Amtes Grevesmühlen von 1773 24 ) betrieben die an die Westküste der Bucht stoßenden ritterschaftlichen Güter Hoben, Fliemstorf, Wohlenberg den Fischfang seit langer Zeit. Fischerboote, die den Beckerwitzer Bauern gehörten und in der Wohlenberger Wiek lagen, finden sich 1772 erwähnt 25 ). Auch die Fischer aus Tarnewitz werden wohl schon damals das Buchtgewässer aufgesucht haben 26 ). Nach der Rückerwerbung Wismars im 19. Jahrhundert wurde dann der Fischereibetrieb auf der Bucht, für die Wismarer Fischer sowohl wie für andere, landesherrlich geregelt: durch die Verordnungen über den Fischereibetrieb in der Ostsee vom 1. Oktober 1868 (Reg.-Blatt 78, S. 631) und vom 20. Juli 1875 (Rbl. 20, S. 163), die Verordnung betr. den Fischereibetrieb vom 18. März 1891 (Rbl. 6, S. 33) und die Verordnung betr. die Fischerei in den Ostseegewässern bei Wismar vom 23. Januar 1897 (Rbl. 7, S. 54) nebst der Abänderung vom 17. Februar 1908 (Rbl. 4) 27 ). Und zwar wurde 1897 und 1908 die Ausübung des Fischfanges vom Besitze einer Fischereikarte abhängig gemacht, die für alle Gewässer zu lösen sei "ausschließlich des inneren Hafens der Stadt Wismar bis zum sog. Alten Schweden", so daß hier die alte Grenze bis zum großen Hafenbaum wiedererscheint.


|
Seite 208 |




|
Die Nutzung des Tiefs der Bucht haben die Landesherren Wismar nie strittig gemacht, nie aber anerkannt, daß die Stadt dort eine Gebietshoheit habe. Der Prozeß wegen des Strandrechtes auf der Lieps, der sich zu einem Streit um das Tief erweiterte, ist nicht zu Ende geführt worden. Wismar berief sich damals auf seine Privilegien und auf unvordenklichen Besitz. Die Privilegien aber, wenn man sie richtig verstand, ließen die Stadt im Stich (wie das Barbarossaprivileg Lübeck im Stich läßt), und daß es ihr gelungen wäre, einen unvordenklichen Besitz zu erweisen, kann nach dem Stande der Akten nicht behauptet werden. Beide, die Landesherrschaft sowohl wie Wismar, haben verschiedentlich ihren Anspruch verfochten und betätigt; das bessere Recht aber ist auf Seiten der Landesherrschaft gewesen.


|
Seite 209 |




|
Anlage II.
Urkundliche Nachrichten über Hoheitsgewässer und Meeresfischerei an der Küste von Rügen, Pommern und Pommerellen (Westpreußen).
1) 1249, Mai 17.
Herzog Barnim I. von Pommern vergleicht den Fürsten Jaromar II. von Rügen mit dessen Vetter Borante III. von der Putbuser Linie dahin, daß Borante seine Erbgüter auf dem Festlande Rügen (Neuvorpommern) und auf der Insel mit dem an diese Güter überall rührenden Meere nebst dem Vorstrande zu fürstlichem Rechte besitzen solle. . . bona et terras eo iure, quo princeps sua possidet, ipse (Borante) quoque et sui heredes perpetuo possidebunt . . cummari salso predictas terras et bona ubique attingenti, cum litoribus etiam, quod vorstrand dicitur, et plane cum omni iure, dominio et libertate (Fabrizius, Urk. z. Gesch. d. Fürstent. Rügen II, S. 29; Auszug im Pomm. Urkb. I, Nr. 489). Die Erbgüter werden in der Urkunde aufgezählt. Einige davon lagen am rügischen Binnenstrand. Bei anderen, auch beim dritten Teile von Jasmund, den Borante cum mari salso außerdem erhalten sollte, ist nicht zu erkennen, ob sie den Außenstrand berührten. Bestimmt trifft dies aber zu für das mit aufgezählte Land Reddevitz, das den nördlichen Teil von Mönchgut bildete. Reddevitz wurde, obwohl es zu den Erbgütern Borantes III. gehörte, 1252 von Jaromar II. dem Kloster Eldena verkauft. (Pomm. Urkb. I, Nr. 551, vgl. Pyl, Gesch. d. Cistercienserklosters Eldena I, S. 334.) 1276, März 13. bestätigte Jaromars Sohn Wizlaw II. dem Kloster den Besitz des Landes mit der Küsten- und Binnenfischerei und sonstigen Rechten (cum omni circumiacentipiscatione et infra iacenti), Pomm. Urkb. II, Nr. 1031. 1295, Jan. 24. verglichen sich dann die Erben Borantes mit dem Kloster Eldena und überließen ihm Reddevitz mit allen Rechten und Pertinentien. Sie verzichteten dabei auf jede Sonderberechtigung zum Fischfange und zur Ziehung von Netzen und Waden an der Küste des Landes: . . . nec nos nec nostri homines aliquod ius speciale piscandi vel trahendi recia


|
Seite 210 |




|
nostra vel sagenas in littoribus fratrum antedictorum volumus vel cognoscimus nos habere, nisi quod communitas terre secundum consuetudinem eiusdem terre Rugie communiter approbatam dinoscitur obtinere . . (Pomm. Urkb. III, Nr. 1709). Diesen Vergleich bestätigte Fürst Wizlaw II. am selben Tage (ebd. Nr. 1710) und verbot jede vom Kloster nicht gestattete Netzfischerei am Strande von Reddevitz. (Mandamus eciam universis et singulis, cuiuscunque status fuerint, ac districte precipimus . . . ., ne quis recia vel sagenas in littoribus dicte terre Reddeviz et suorum terminorum mittere vel trahere presumat vel in Redevizewik (wohl Hagensche Wiek) piscare, nisi de dictorum religiosorum (Abt und Konvent von Eldena) voluntate et licencia speciali). Zum Lande Reddevitz, dessen Grenzen in den Urkunden von 1276 und 1295 genau beschrieben werden, gehörte der Außenstrand Mönchguts bis Lobbe im Süden, dazu an Buchtgewässer im Westen des Landes die Hagensche Wiek vom Zickernitz bis Reddevitzer Höwt und die halbe Having an der Reddevitzer Landzunge entlang.
2) 1265, Mai 6.
Herzog Barnim I. von Pommern erteilt dem Kloster Dargun das Recht, mit einem abgabenfreien Schiffe in dem zu seiner Landesherrschaft belegenem Meere Schollen zu fangen (von dem Klosterhofe Kaseburg auf Usedom aus) . . . libertatem capiendi rumbos 1 ) cum una navi et retibus ad eam pertinentibus in mari salso terre nostre dominio adiacenti, decernentes ipsam navem una cum piscatoribus et retibus in ea existentibus liberam et solutam ab omni pensione, theloneo et alia qualibet exactione, in quibus alie naves ratione piscationis nobis sunt obligate, que in predicto mari deducuntur in captura rumborum . . . (Mecklb. Urkundenb. II, Nr. 1044; Pomm. Urkb. II, Nr. 775.) Vgl. die Urkunde vom 5. März 1266, worin Barnim I. dem Kloster Dargun seine Besitzungen und Rechte bestätigte (Mecklb. Urkundenb. II, Nr. 1071, S. 290; Pomm. Urkb. II, Nr. 796): . . . libertatem capiendi rumbos in salso mari et in Zwina (Swine) cum una navi et cum hiis, que ad unam navem pertinent, ita ut nobis aut officiliabus nostris nichil penitus inde solvere teneantur. In diesen Urkunden wird also ausdrücklich Meeresfischerei verliehen, nicht Fischerei im Haff (mare recens) wie 1242 und 1256 (Rörig II, Anm. 21).


|
Seite 211 |




|
3) 1266, Febr. 12.
Herzog Barnim I. von Pommern gestattet den Bürgern von Kolberg, abgabenfreie Heringsfischerei im Persantehafen und in der Ostsee zu treiben, soweit sich die Grenzen des Stadtgebietes am Meere erstrecken und soweit die bezeichneten Örtlichkeiten (d. h. Wasserflächen) der Landesherrschaft angehören, . . .ut ipsi libere et absque cuiuslibet solucione thelonei videlicet decem et octo denariorum de remo et unius masse allecium de navi in captura allecium piscari valeant ante exitum Parsande in salsum mare et in portu ipsius Parsande usque ad civitatem ipsam et ubique in salso mari, in quantum se eiusdem civitatis termini iuxta mare salsum in agris, pascuis et campis extendunt. Hanc inquam eis prerogativam et gratiam donavimus, videlicet ut prescriptum est, allecia libere et absque cuiuslibet thelonei solucione capere valeant in locis predictis, quantum ad nostram pertinent dominationem . . . (Pomm. Urkb. II, Nr. 794).
4) 1286, April 25.
Herzog Bogislaw IV. von Pommern verleiht der Stadt Kolberg das Privileg, in der Ostsee von Kolberg bis zur Swine überall, wo es (d. h. die Fischereigerechtigkeit) ihm (als dem Landesherrn) zustehe, mit bestimmten Netzen zu fischen. . . . . ipsi civitati et inhabitatoribus eius cunctis talem dedimus libertatem, scilicet quod in salso sive in magno mari cum retibus strictis et hiis, que somernette vocantur, a dicta civitate Colberch usque ad Zvinam in omni loco, ubi nostrum est, piscandi diversi et omnis generis pisces habebunt perpetuam libertatem. Quos utique in nostram protectionem assumimus, non volentes eos ab ullo penitus mortalium impediri, capitaneis, advocatis, subadvocatis, officialibus seu incolis dominii nostri dantes firmiter in mandatis, quathenus predictam libertatem circa civitatem et burgenses eius audeant nullomodo violare. (Ebd. Nr. 1372.)
5) 1268, Okt. 9.
Wartislaw II., Herzog von Pommern zu Danzig, bestätigt dem von seinem Vater Swantopolk gestifteten Kloster Bukow seine Besitzungen und Gerechtigkeiten, darunter freie Meeresfischerei, soweit das Gebiet desKIosters an der Küste reicht. . . . Damus etiam ipsi claustro stagnum Bucowe (Bukowsee) integraliter et novam aquam (Neuwasser


|
Seite 212 |




|
am Nordostende des Bukowsees) cum omnibus clausuris (Fischwehren) eius totaliter cum hac libertate videlicet tam fratribus quam hominibus ipsius claustri largiter conferendo, ut in captura alleciorum et aliorum piscium ad predictam novam aquam solito manendo nulli nisi soli abbati de aliqua portione reddenda vel danda sive de iure aliquo respondere cogantur . . . Concedimus insuper claustro predicto, ut omnes, qui infra terminos bonorum eius ad predictam capturam alleciorum seu piscium ad littus maris manserint, libertate predicta fruantur nec cuiquam nisi abbati premisso super aliqua portione respondeant sive iure. (Pomm. Urkb. II, Nr. 870.) Ebenso in den Bestätigungen Mestwins II. von Pommerellen, des älteren Sohnes Swantopolks, von 1269 (ebd, Nr. 886) und Wizlaws II. von Rügen, des Tochtersohnes Swantopolks, von 1271 (ebd. Nr. 935). In Bestätigungen Wizlaws II. und Mestwins II. von 1275 (ebd. Nr. 1009, 1011) heißt es: Item sepedictis fratribus tam longe, ut eorum termini circa littora maris salsi porriguntur, in eodem mari piscandi licentiam indulgemus.
6) 1274, Jan. 5.
Privileg Herzog Barnims I. für die Stadt Cammin; darin Befreiung von Abgaben für Meeresfischerei an der Küste des Landes Cammin. . . . Si vero cives vel quidam de civibus Camynensibus in captura allec in salso mari (also nicht etwa im Camminer Bodden [stagnum Camynense], wo der Stadt das Recht zum Fischfange mit bestimmten Netzen außerdem verliehen wurde) suis retibus vel instrumentis pisces vel allecia capere voluerint, quantum ad terram Camynensem pertinet, eorum remos vel recia ab 2 ) omni solucione, que nobis vel nostris debetur, ea libera iudicamus. (Pomm. Urkb. II, Nr. 981.) Vgl. die Urkunde von 1308, Sept. 10: Herzog Bogislaw IV. bestätigt Besitzungen und Rechte der Stadt Cammin. . . Insuper libertatem piscandi in salso mari de flumine, qui dicitur Rega, usque in Zwinam (Swine) eisdem (den Bürgern Cammins), sicut prius habuerunt, erogamus . . . (Pomm. Urkb. IV, Nr. 2418.)
7) 1278, Juni 18.
Bischof Hermann von Cammin bestiftet das Nonnenkloster in der Altstadt Kolberg und verleiht ihm ein freies Schiff für den Heringsfang an der Küste des bischöflichen


|
Seite 213 |




|
Gebietes . . . Preterea dedimus ipsi claustro in terminis nostris ad usus ipsarum santimonialium unam navem liberam, cum alletia capiuntur. (Pomm. Urkb. II, Nr. 1101.)
8) 1278, Aug. 15.
Bischof Hermann von Cammin überträgt dem Kloster Bukow die Dörfer Karnkewitz und Eventhin mit der Fischerei im Bukowsee und in der Ostsee innerhalb Âder Eventhiner Grenzen. . . cum . . . piscationibus in stagno Buchow et in mari salso infra terminos ipsius vilIe Jwenthin. . . . (Pomm. Urkb. II. Nr. 1104.)
9) 1281.
Herzog Mestwin II. von Pommerellen überläßt dem Kloster Belbuck u. a. freie Fischerei mit einem Netze im Gardeschen See, mit zwei Netzen im Lebasee, vier freie Schiffe zum Fischfang in der Ostsee und ein Fischwehr im Stolpefluß, außerdem den Zehnten vom Fischfang, die zehnte Last vom Heringsfang, Jagdabgaben und Gerichtsgefälle. . . Praeterea addidimus saepedictis fratribus liberam piscationem in stagno, quod Gardna vocatur, cum una sagena et duas liberas sagenas in stagno, quod Lebesco dicitur, et quatuor naves liberas in captura allecum cum piscationibus in salso mari et unam clausuram in Stolpa, ubi nobis visum fuerit. Insuper donavimus decimum piscem, decimam sarcinam allec, scapulas nostrae venationis, iura iuditiorum. (Pomm. Urkb. II, Nr. 1224.)
10) 1291, Dez. 20.
Herzog Bogislaw IV. von Pommern bestätigt den Klöstern Oliva und Sarnowitz in Pommerellen ihre Besitzungen nebst Meeres- und Binnenfischerei. - Oliva: . . dimidiam quoque partem terre Oxivie (Oxhöft, nördlich von Danzig, am Eingange der Putziger Wiek) cum. . . . libera piscatione in mari . . ., a portu vero Wisle (Weichsel) versus occidentem totum litus maris cum omni utilitate et libertate usque ad extremum litus rivulvi, qui Swelina (Bach bei Zoppot) nuncupatur, preterea unam navem liberam in salso et in recenti mari (Frisches Haff) ad capiendum allec, rumbos vel alios quoscunque pisces . . . Sarnowitz: . . stagnum, quod Pesnicza nominatur (Sarnowitzer See an der Nordküste Pommerellens), et fluvium eiusdem nominis (Piaßnitz) in utroque littore . . . usque in


|
Seite 214 |




|
mare et liberam piscationem ibidem, unam quoque navem liberam allec vel rumbos aut ceteros pisces libere capiendi (Das gesperrt Gedruckte kann sich nur auf Meeresfischerei beziehen). Pomm. Urkb. III, Nr. 1598.
11) 1312,Mai 21.
Peter, Graf von Neuenburg, Johannes, Herr von Schlawe, und Lorenz, Herr von Rügenwalde, erteilen den 5 Lokatoren der neu zu gründenden Stadt Rügenwalde ein Privileg, gewähren 6 abgabenfreie Schiffe zum Heringfang und das Recht zur Strandfischerei. . . Ceterum sexnaves liberas, que bordingge (kleinere Fahrzeuge) vocantur, in captura allecum habebunt, de quibus navibus ipsa civitas tres, reliquas vero tres naves possessores (die 5 Gründer) obtinebunt, . . . Recia nichilominus, que strantgarne vocantur, ipsi possessores in littore maris habere poterunt, ita tamen, ne nostri piscatores in nostra piscatura, hoc est in loco, qui Hake nuncupatur, aliquod inpedimentum paciantur. (Pomm. Urkb. V, Nr. 2726.)
12) 1313, Febr. 2.
Die Markgrafen Waldemar und Johann von Brandenburg erteilen der Stadt Stolp ein Privileg und geben ihr das Recht, sechs abgabenfreie Seechiffe zum Fischfange und zu sonstigem Gebrauche zu halten. . . . Ceterum dimisimus et dimittimus predictis civibus sex naves in vulgo berdige (Fahrzeuge kleinerer Art) dictas in . . . salso stagno ad piscaturam et ad quoslibet alios usus omnino libere possidendas. (Pomm. Urkb. V, Nr. 2774.)


|
Seite 215 |




|
Anlage III.
Schiffsstrandungen an der mecklenburgischen Küste.
1) 1662 , Strandung einer schwedischen Schute am Priwall. Der Grevesmühlener Hauptmann berichtete am 24. Nov.: "Weilen biß auf diese Zeit wir an die am Priwaldt gestrandete Schuette, da sie noch zu tief im Waßer stehet nicht ankommen können", so hätten die Lübecker sie durch Musketiere besetzen lassen. Denn der Priwall samt dem Strandrechte dort war zwischen Mecklenburg und Lübeck strittig. Alsbald wurde mecklenburgisches Militär aus Schönberg aufgeboten; manum de tabula, schrieb der herzogliche Rat Cretschmar. Inzwischen aber ließen die Lübecker die Ladung löschen und die Schute zerschlagen, woran man sie nicht hindern konnte, weil das Schiff "vor Travemünde gar nahe am Bollwerck und unter die Stücke" lag, Kanonen, mit denen der lübische Hauptnann in Travemünde bereits gedroht hatte (Bericht des A. Grevesmühlen vom 27. Nov.). 1 )
2) 1665 , Lübecker Schute, nach dem Bericht des Grevesmühlener Hauptmannes gestrandet "fast kegen Travamunde über unter Pötenitze". Die herzoglichen Beamten verfügten sich an Ort und Stelle, "in Meinung, unser Schuldigkeit nach E. Fürstl. Durchl. Strandesgerechtigkeit dabey in Acht zu nehmen". Doch habe das Schiff, "insonderheit da daß Waßer auch eben sehr hoch gewesen, so weit vom Lande gestanden, daß wir von mecklenburgischer Seiten unmüglich eine Barchhülfe thuen und leisten können". Die Schiffer hätten sich selbst geholfen, die Ladung auf Booten nach Travemünde gebracht, so daß das Schiff flott geworden sei. "Ist also die Schuette sampt den Güttern durch ihre eigene Hülfe, da von mecklenburgischer Seiten ihnen unmüglich dieselbe geschehen können, geborgen worden." Also nicht die Entfernung des Schiffes an sich, sondern die Unmöglichkeit heranzukommen, war für den Verzicht auf das Strandrecht entscheidend. Sonst hätte ja auch der ganze Bericht keinen Sinn gehabt 2 ).
Daß Rörigs Auffassung dieses Falles (II, S. 268) nicht zutrifft, lehrt schon der oben unter Nr. 1 angeführte Strandungsfall von 1662.


|
Seite 216 |




|
3) Am 30. Nov. 1688 nachmittags wurde eine bei stürmischem Wetter leck gewordene Stralsunder Schute vom Kapitän in der Gegend des Dorfes Bollhagen (A. Doberan) ans Land gesetzt. Die am nächsten Tage von den Beamten vorgenommene Besichtigung ergab, daß das Schiff "biß an die Bohrt bereitß mit Waßer angefüllet" war und "auf einen steinern Grund und tief im Waßer stehet, also daß die starcken Wellen öfterß mitten darüber herschlagen". Bei "gelinden südlichen Wetter" sei wohl "dem Schiffe anzukommen, darauß mit Bohten etwaß an Land zu holen", was also vorläufig nicht möglich war. In der Nacht darauf wurde das schon schlechte Schiff zerschmettert. Weil fast nichts geborgen werden konnte, wurde von der Erlegung einer Rekognition ans Amt für diesmal "ohn ein eintzige künftige Consequentz und Praejuditz" abgesehen 3 ).
4) 1762 strandete ein Lübecker Schiff von mehr als 60 Last am Buck, einer Sandbank in der Gegend von Arendsee und Kägsdorf. "Wegen des bösen und windigten Wetters trauet sich weder Schiffer noch Bauer an Borte", schrieb der Landrat v. Oertzen auf Roggow, Pfandbesitzer von Arendsee, der zuerst Meldung von dem Schiffbruch erhalten hatte, am 31. Dez. an den Herzog. Inzwischen griff der Neubukower Amtmann ein. Nach seinem Berichte vom 31. Dez. war das Schiff "etwa 200 Schritt vom Lande hart in den Strand gesetzet". Dem Kapitän sei eröffnet worden, "daß das Schiff und deßen Ladung dem Strandrechte Ihro Hertzogl. Durchl. anheim gefallen wäre", wenn er nicht bei der Regierung in Schwerin "eine Donation erwircken würde". Die Löschung sollte stattfinden, "so bald der Nord-Ostwind, weswegen es ratione der auftreibenden starcken, ans Land schlagenden Wellen nicht möglich, mit Böthen an das Schiff zu kommen, sich geleget. . . Ich glaube aber fast, daß der größeste Theil der Ladung mit Waßer angefüllet sein wird, zumahl das Schiff schon gestern im Boden 6 Fuß Waßer gefaßet haben soll und jetzt bey 11 Fuß tief theils unten am Boden mit Sand bewellet, theils im Waßer stehet, sodaß kaum eine Elle hoch die mittlere Bort sichtbahr ist, mithin bey jetz fortstürmenden Winde die aus der See aufsteigende Wellen darüber hin schlagen." Der Herzog Friedrich befreite den Schiffer "von allen aus dem Strand-Recht auf Uns kommenden Erlegnißen und Vortheilen" 4 ).
5) 1780 strandete ein finnisches Schiff, das künstlich hatte zum Sinken gebracht werden sollen und von der Mannschaft verlassen


|
Seite 217 |




|
war, zwischen Warnkenhagen und Haffhagen "etwa 400 Fuß vom Ufer". Wegen der unruhigen See war es zunächst unmöglich, an Bord zu gelangen. Schiff und Ladung wurden vom Amte Grevesmühlen meistbietend verkauft 5 ).
6) 1781 , Stralsunder Schiff, bei Nienhagen auf den Strand geraten. Nach dem Berichte des Amtes Doberan an die herzogliche Regierung stand es "über 5 Fuß tief zwischen verschiedenen grossen Steinen im Sande", und es war ihm "wegen des noch anhaltenden Sturms zur Zeit mit keiner Hülfe beyzukommen". Die Beamten fragten an, ob "von dem diesem Amte ohnstreitig zustehenden Strand-Rechte wir würcklichen Gebrauch machen und nach aufgehörten Sturm das, was von dem Schiffe und der Ladung noch etwa zu nutzen stehet, in Beschlag nehmen oder ob der unglückliche Schiffer von der Ausübung der Befugnisse des Strand-Rechtes vor dieses mal aus besondern Gnaden entfreyet bleiben und ihm nach berichtigten Kosten sein Fahrzeug und Ladung, oder wenn beydes versilbert werden müste, der Werth wieder verabfolget werden solle". Darauf wurde vom Herzoge Friedrich die Freigabe verfügt, "ohne von dem Unserm Amte Doberan zustehenden Strandrechte in dem gegenwärtigen Fall Gebrauch zu machen" 6 ).
7) 1793 lag ein bei Dierhagen gescheitertes Schiff, dessen Mannschaft ertrunken war, "mehrere hundert Schritte vom Strande so tief im Waßer", "daß davon weiter nichts als die Masten zu sehen waren". Das Wrack und die geborgene Ladung wurden vom Amte Ribnitz verkauft; der Erlös sollte den Eigentümern nach Abziehung von Bergelohn und Unkosten übergeben werden 7 ).
8) 1799 , Wismarer Zweimaster (Galliaß), in der Nacht auf den 27. Okt. bei Hinter-Bollhagen und Fulgen gestrandet. Am 30. Okt. berichteten die Doberaner Beamten: "Das Schif liegt jetzt etwa 200 Schritte vom Ufer in Strande, das Waßer ist bereits auf 7 Fuß Höhe im Schiffe getreten . .". Das Fahrzeug sei verloren, aber, wenn nicht wieder schweres Wetter einträte, "alle Hoffnung da, die Ladung, auch manches brauchbares Stück des Schiffes zu bergen". Auf Bergegeld verzichtete der Herzog 8 ).


|
Seite 218 |




|
Anlage IV.
"Usque in" in der Bedeutung von "bis zu" in Urkunden der Reichskanzlei und anderer Kanzleien.
Reichskanzlei.
1) 1081, März 18.
König Heinrich IV. verschenkt 3 Dörfer nebst einem Walde in Sachsen. . . . . Hec si[lva ad] ortum aride Wilze inde tendio usque in fluentem Wilczam; de fluenti Wilza usque in Orchouna (Fluß); item ab ortu aride Wilze usque ad vallem, que est inter Groznam et Neniwiz; item de hac vallae (!) usque ad collem iacentem in semita, que duc[it a] colle usque ad congeriem lapidum; de hac congerie usque in flumen, quod vocatur Oznliza; item inde usque ad ortum eiusdem Oznlize; ab ortu vero eius usque in silvam, que dicitur Hachenloch, ubi lapis terrae iacet involutus (Stumpf, Reichskanzler III, Nr. 74. Nach dem Original).
2) 1161, April 19.
Kaiser Friedrich I. erteilt dem Nonnenkloster S. Senatoris zu Pavia einen Schutzbrief. . . Confirmamus etiam eidem cenobio duo vada ad piscandum in fluvio Pado, unum, quod nominatur Acerru, de fine caput lactis usque in fluvio Corione simul cum ripariis, alterum vero in Kalendasco de fine Karridi usque in finem caput hominis (Prutz, Kaiser Friedrich I., Band I, S. 440. Nach dem Original).
3) 1185, Juli 3.
Kaiser Friedrich I. verleiht Wipert von Chiavenna für eine Klosterstiftung zu Induno "tenimentum terre in loco, qui dicitur Ronka, iuxta praedium eiusdem ecclesie, sicut situm est et protenditur in directum a monte usque in stratam (Straße) publicam, habens ab oriente iam dictam ecclesiam, ab occidente vero habens terminos usque in stratam publicam. . ." (Prutz, Kaiser Friedrich I., Bd. III, S. 390. Nach dem Original).
Verschieden Kanzleien.
1) 1167.
Herzog Heinrich (der Löwe) von Bayern und Sachsen bestimmt


|
Seite 219 |




|
die Sprengelgrenzen des Bistums Ratzeburg. Ad meridiem vero distinximus, ubi aqua Trisniza (Bach, bei Sudenhof in die Sude fallend) Zudam (Sude) influit et regirat in orientem usque ad paludem, ubi eadem Trisniza sortitur originem, et sie directe usque in Eldenam (Eldefluß), ubi terra Zwerin et Wanceburch inter se terminos faciunt, et sic per decursum Eldene in Albim (Elbe), usque quo Bilna (Bille) Albim influit. Ad occidentem terminos fecimus . . paludem . . et sic infra ad aquilonem usque in aquam Stricniziam (Bach bei Strecknitz), et ultra Wocniziam (Wakenitz) in aquam, que Fluvius Ducis dicitur (Landgraben zwischen Ratzeburg und Lübeck), usque quo mare influit, et sic per litus maris usque ad aquam Wissemaram (Bach, aus dem Mühlenteiche bei Wismar in den Hafen gehend) . . (Mecklb. Urkundenbuch I, Nr. 88. Nach dem Original).
2) 1173, Nov. 30.
Bischof Berno von Schwerin bestätigt die Bewidmung des Klosters Dargun. Termini . . flectuntur . . in quandam vallem profundam et longam usque in viam, que per se de Dimin (Demmin) viantes deducit ad Dargon et Lucho, per quam flectuntur ad orientem et deducuntur per eandem viam usque in pontem Bugutiza, . . ascendunt . . versus occidentem . . in tres lapides terre affixos et ab illis . . in unum magnum lapidem . . et ab illo. . . in duos lapides . ., et ab illis transeunt silvam usw. (Mecklenb. Urkundenbuch I, Nr. 111. Nach dem Original, verhandelt 1173, ausgestellt nach 1177, Febr. 1, vgl. Pomm. Urkb. I, Nr. 61, Note).
3) 1225
in der päpstlichen Kanzlei hergestellte Fälschung: Bestätigung des Bistums Schwerin durch Urban III., angeblich von 1186, Febr. 23 (Mecklenb. Urkundenb. I, Nr. 141, vgl. Salis, die Schweriner Fälschungen, Archiv für Urkunden-Forschung I). Diözesangrenze: claustra et ecclesias . . per provincias ducis Henrici, quarum una, que Mykelenburch nuncupatur, tendit usque ad provinciam, que dicitur Brezen, usque in mare, et sic iuxta maritimam, pervenit terminus episcopalis usque in Ruyiam (Rügen), ipsam insulam dimidiam includens, a Ruyia antem usque ad Penum fluvium (Peene), ubi idem fluit in mare.
4) 1248, November.
Herzog Wartislaw III. von Pommern bestätigt dem Kloster Eldena seine Besitzungen und beschreibt die Grenzen der Abtei . . . Hyldam fluvium (Rick) a loco Guttyn usque in mare . .


|
Seite 220 |




|
Jnter Darsim (Ludwigsburg) et Beliz sive Lodizin (Lossin bei Wusterhausen) rivulus, qui Lypiz dicitur, terminus est, et sic per decursum suum usque in mare terminos Darsim et Golkogh distinguit. . . De Guttyn autem ultra Hildam fluvium directo tendun[tur] (termini) in Gardist et de Gardist in paludem Lazconiz . . . et sic per eandem paludem descendunt usque in mare (Pomm. Urkb. I, Nr. 478. Nach dem Original). Genau in derselben Bedeutung findet sich usque ad in einer Urkunde von 1249, ebd. Nr. 501: Dobizlav, Herr zu Gristow, vergleicht sich mit dem Kloster Eldena (Original): . . Terminos . . . inter nos et predictas possessiones assignavimus, sicut privilegiis monasterii . . . continentur, videlicet a castro Guttin directa linea usque ad montem, qui Gardyst dicitur, . . . usque in rivulum, qui Liazcha dicitur . . . et per eundem rivulum usque ad mare.
5) 1294, April 2.
Die Herzöge Bogislaw IV., Barnim II. und Otto I. von Pommern versprechen der Stadt Stettin an der Oder, am Haff und an der Swine bis zur Ostsee keine Befestigungen anzulegen (in ascensu et descensu Odere ac in recenti mari et in Szwina usque in salsum mare). Pomm. Urkb. III, Nr. 1672. Original.
6) 1313, Febr. 2.
Privileg der Markgrafen Waldemar und Johann von Brandenburg für die Stadt Stolp in Pommern, mit Verleihung eines 5 Ruten breiten Steiges an beiden Ufern des Stolpeflusses entlang von der Stadt bis zur Ostsee, zum Ziehen (Treideln) von Schiffen an Seilen. . . . ab utroque quolibet latere dicte aque Stolpp super terram de ipsa civitate Stolpp usque in salsum stagnum liberum meatum tractualem, quod in vulgo dicitur een treyleganc, latum scilicet de quinque perticis seu virgis geometralibus dedimus. . . (Pomm. Urkb. V, Nr. 2774. Nach dem Original).
7) 1241, März 4.
Herzog Albrecht I. von Sachsen schenkt dem Kloster Reinbeck das Dorf Talkau. . . Hec autem est distinctio hujus ville: a memorata villa usque in Manhaghen, dehinc in amnem, qui dicitur Gesne (Roseburger Au, Nebenfluß der Stecknitz). Schleswig-Holst.-Lauenb. Urk.-Samml. I, S. 469. Nach dem Original).
8) 1324, Juni 28.
Bischof Johann und das Domkapitel zu Schwerin beurkunden


|
Seite 221 |




|
ihren Vergleich mit Wismar wegen des Zehnten von dem im Schweriner Sprengel belegenen Stadtfelde. . . decime omnium agrorum cultorum et incultorum, . . .videlicet . . . de ipsa curia (Ghoredze) usque ad distinctionem ville Kritzowe, de Kritzowe usque ad distinctionem Hornstorp, de Hornstorp usque ad distinctionem ville Cismerstorp, de Cismerstorp usque Ricquerstorp, de Ricquerstorp usque in mare salsum (Mecklb. Urkb. VII, Nr. 4545. Nach der Abschrift im Wismarer Privilegienbuche).
9) 1329, Jan. 13.
Graf Johann von Holstein verkauft der Stadt Lübeck Travemünde und die beiden holsteinischen Fähren über die Trave, wobei festgesetzt wurde, daß keine neue Fähre angelegt werden solle. . . Est autem nominatim actum et conventum, quod inter civitatem Lubecensem et villam Travenemunde predictam et ab ea ulterius usque in mare neec a nobis . . . nec a quovis alio . . . vectorium aliquod super Travenam vel in ipsa de novo possit. . . fieri . . Grenzen eines zu Travemünde gelegten Gebietsstreifens: . . et durat a marchia ville Travenemunde usque in marchiam (Mark, Grenze) ville Brothme (Brodten); item campus ille, qui est ab ipsa eadem alciori ripa deorsum usque in mare et a marchia, ville Travenemunde usque in marchiam ville Brothme, se protendit subtus in oblongum eciam iuxta mare. (Lübeck. Urkb. II, 1 S. 454. Nach dem Original).


|
Seite 222 |




|
Anlage V.
Exzeptionsschrift des Lübecker Anwalts beim Reichskammergericht von 1618.
(Nach einer gleichzeitigen Abschrift).
Hochwurdiger Fürst, Rom.
Kayß. Maytt. Cammerrichter,
gnediger Herr.
Demnach uf ungleich Anruffen der durchleuchtigen hochgebornen Fursten und Hern, Hern Adolphs Friederichs und Hern Hanß Albrechten, Hertzogen zue Mekelburg, sodan Hanß von Pleßen in Demckhendorf wider Hern Burgermeister und Rhatt der Kayß freyen und des heyligen Reichs Statt Lubekb ein Mandatum uf die Constitution der Pf(andungen) an diesem hochlöbl. Kayß. Cammergericht 1 ) außbracht, verkhundt und in heutiger Audients reproducirt, vermittelst deßen ehrbemelten gantz übel beclagten Hern Burgermeister und Rhatt befohlen und ufferlegt worden, ettliche abgenommene Herings-Reusen und Pfälen zue restituiren und in vorigen Stand zue setzen als fernern Inhalts beruhrten Mandati so erscheinet hierauf Lübischer Syndikus kraft seines habenden gemeinen Gewalts, gleichwol mit vorgehender Protestation de non consentiendo nec prorogando nisi quatenus et in quantum in Willen und Meinung, erhebliche Ursachen gerichtlich furzubringen, warumb angeregtes per meram sub et obreptionem außgewirktes Mandatum von Uncreften nicht bestehen mögen, noch seine g(edachten) Hern Principalen 2 ) demselben zue pariren schuldig, sondern daßelbig billich widerumb zue caßiren und ufzueheben, auch die Hern Impetranten in die verursachten Gerichtscosten zue condemniren sein. Zu welchem Ende nimpt anfangs Syndicus dasienige, so in bemeltem Mandato und deßen unbegrundten Narratis seinen g(edachten) Hern Principalen zue Vortheyl und verhofften Obsieg in dieser Sach immer verstanden oder gedeutet werden mag, fur gerichtlich bekand ahn, mit zierlicher Widersprechung des Undienstlichen.


|
Seite 223 |




|
In specie aber der beruhrten Narraten greiflichen Ungrund zu entdekhen, so befind sich fürs erste in des heil. Reichs Constitution von Pignorationen und Pfandungen außtruklich versehen, und weiß man sich auch sonsten auß dem herbrachten stylo und Observantz zue bescheiden, das neben an den requisitis dieser Constitution zumahl auch dieses insonderheit erfordert wirt, das der clagende Theyl in Besitz und Possession eius loci vel iuris, in quo vel cuis respectu facta praetenditur pignoratio, erfunden werde, sicuti id plenius traditum reperitur a Geil. tract. singul. de pignorat. obs. 3. n. 6, eo quod haec constitutio ad interdictum retinendae possessionis pertinaet, quod nisi possidenti non datur per iura notissima.
Nun aber kan von den Hern Gegentheil, insonderheit aber dem mitclagenden Hansen von Pleßen in keine Weg und mit Bestand erwiesen und beigebracht werden, daß sie oder ihr Vorfahren den gantz neulicher Weiß angemasten 3 ) und Syndici g(edachten) Hern Principalen und deren Underthanen hochschädlichen modum piscandi an dem Ort herbracht oder sich deßen jemahlen dergestalt gebraucht und also deßelben Gewehr und Possession bestendiger Masen erlangt hetten, sondern ist vielmehr wahr und unverneinlich, das der Trave-Strome mit dem Port, so man die lübische Reide nennet, von Oldeßlho ahn biß in die offenbahre Ostsee, ohnangesehen underschiedlicher 4 ) Herschaften territoria daran stoßen, Syndici Hern Principalen und der Statt Lubekh einig und allein zugehöret, solches auch mit Kayß. und Königlichen Privilegien wie auch underschiedlichen Actibus possessoriis, so wol in Criminal- alß Civilsachen wol mag bekreftiget und behauptet werden.
Und obwohl der mitclagender von Pleß wie auch seine Vorfahren, nit weniger als sonsten ieder-menniglich derneden geseßen, vermög Herkommens und allgemeiner beschriebenen Rechten sich des Fischens mit Waden und Netzen in solchem der Statt Lubekh zugehörigem portu oder uf der Reide unverhindert gebraucht, solches auch Syndici ged. Hern Principalen nahmahlen gern geschehen lasen können, wan es allein uf vorige und iederzeit herbrachte Maß und Weiß, keineswegs aber zue anderer Interessirten Prae-


|
Seite 224 |




|
iuditz und Schaden, zuvorauß aber der freyen Navigation Behindernuß usurpit wirdt, so hat doch dem zu entgegen vielgedachter mitclagender von Pleßen zue Demckhendorf allererst neulich und im Martio des 1616. Jars wider das alte Herkommen, nur auß lauterm Eigennutz sich undernommen, eines neuen ungewohnlichen, praeiudicirlichen, in sehr schädlichen, ohnleidenlichen modi der Fischerey dergestalt zu gebrauchen, das er eine grose Fischreusen gar nahe bei Travemundt, uf Syndici ged. Hern Principalen unstreitigen Reide und Port, mit siebenzehen Pfälen 5 ), viel stehenden und hangenden Netzen, Draggen und andern Sachen, 266 Klafter lang, vom Lande biß vorgedachte der Statt Lubekh Reide machen und setzen, daruber auch auf den Strand eine Hutte zue behueff des Fischers, der auf die Reise gewartet, aufrichten und erbauen lasen, dardurch nicht (allein) die Fischerey des Travestrohms, Deßowers Sees und anderer Orten merklich gestikhet und verdorben, sondern auch die Schieffart im freiem Auß- und Inlauf trefflich verhindert, ja auch wol die Schieffleut durch daß auß wolgedachter Fischerhutten bei Nachtzeiten scheynendes Licht zue Gefahr und Ungelegenheit verleutet werden.
Dannenhero dan Syndici ged. Hern Principalen in Considration ihrer Pflichten und Eyden, damit sie gemeiner Statt und Burgerschaft zue Erhaltung deroselben Strohms und Meerhafens Frey- und Gerechtigkeit verwandt und zugethan, solchen neuen praeiudicirlichen, ohnbefugten Anmasungen nicht zuesehen können, sondern weil vorbemelte Reusen und Pfäle von der Hern Impetranten mitclagenden eigennutzigen Lehenleuten uf ihr freundlich treuhertzig, so wol schrieft: als mundlich beschehenes Ersuchen nicht auß den Weg geräumet und abgeschaffet, sondern noch vermeintlich iustificirt und continuirt werden wollen, selbst darzue thun und durch Abschaffung der Reusen und Pfälen sich bei der Freiheit ihres portus schutzen und handhaben musen. Und wiewol sie sich darauf zue gedachtem mitclagendem von Pleßen versehen, er hette es mit der Fischerei bei dem alten Herkommen laßen und Syndici ged. Hern Principalen mit solcher hochbeschwerlichen Neuerung ferner verschonen werden, so hatt er doch folgendts im verschienen 1617. Jahrs auß sonderbarer Verhengnuß und Zulasung der Hern Impetranten als seiner Lehenshern ein ander Reise und Pfäle an demselben Ort, von welchem er die vorige abgeschafft, widerumb zu legen eigenthättlich sich understanden und dadurch beclagte Hern Burgermeister und Rhatt


|
Seite 225 |




|
billiche Ursach und Anlaß geben, zue Abwendung eines solchen hochschädlichen praeiudicii die widerumb de facto eingesänkhte Reisen besampt den Pfalen abermahln außzureisen, allermasen das mitclagender von Plessen den 6 ) Gebrauch solcher Fischereyen und ungewohnlichen sehr schädtlichen modi piscandi und also per consequentiam die Possession desselben iuris nit erlangen mögen. Und derowegen augenscheinlich sich befindet, das E. F. G. von dem Hern Gegentheyl die Sach viel anderst berichtet und vorgetragen und also diß Mandatum suppressa rei veritate extrahirt und außgewurkhet worden.
Und gestalt nun die possessio a parte pignorati alhie nicht vorhanden, viel weniger die Hern Gegentheil ihrem Vorgehen nach zue Setzung solcher Reisen und Pfäle in der Statt Lubekh eigenthumblichen portu vermög aller Rechten wol befugt und berechtiget, eo quod eatenus licitum in littore 7 ) vel portu aliquid facere, quatenus usus publicus non impeditur aut alter non sentiat damnum, per iura vulgaria, also ist ingleichem gantz ohne 8 ), daß Syndici ged. Hern Principalen die Reise oder Pfäle hinweg genommen oder das angegebene novum ius der Strandtgerechtigkeit oder gantzen Fischerey zu acquiriren und zu erlangen iemahlen begert oder noch begeren sollen, synthemal sie nicht allein die Reisen und Pfäle, wie dieselbe außgerißen und abgeworfen, im Waßer liegen und dem Windt und dem Waßer befohlen sein lasen, sondern auch diesen Actum allein pro conservando iure suo et portus libertate, keinswegs aber, eine neue Gerechtigkeit dadurch zue schöpfen, uti actum retinendae possessionis furgenommen und unumbgänglich furnehmen musen, inmasen dan solch ihr Intent, und das sie einige Strandgerechtigkeit oder die gantze Fischerey an sich zu reißen nicht gemeint, sonnenheiter darauß erscheinet, das sie vielgedachtem mitclagendem von Pleßen an der Fischersgerechtigkeit, wan dieselbe von ihnen uff vorige Maß und Weiß und gleich andern derneden Geseßen usurpirt


|
Seite 226 |




|
und gebraucht wirdt, Eintrag und Hinderung zu thun nicht gemeinet, solches auch in Sinn und Gedankhen niemals genommen, sondern viel mehr ihme so wol alß sonst iedermenniglich das Sein und worzu er von Rechts wegen befugt, wohl gönnen und unverhindert gestatten mögen.
Und wan dan, gnediger Furst und Hern, auß Oberzelten 9 ) allen sonnenclar so viel erscheinet, daß die Hern Gegentheil und vorab mitclagender Impetrant in possessione der furgebildeten Gereg(!)tigkeit dergestalt in portu der Statt Lubekb niemals gewesen, viel weniger ihnen gebühret oder zugestanden, ichtwas zue ander Leut merklichem Schaden und praeiudits, ia zu Hinderung des usus publici in loco publico zue constituiren oder zue setzen, zuvorauß auch beclagte Hern Burgerm. und Rath die Reisen und Pfäle geclagter Masen nicht hinweg genommen, noch die Abwerfung derselben ad ius novum acquirendum gemeinet und angesehen, also das die furnembste requisita der Constitution von Pfandungen allerding ermanglen und sich nicht befinden wolten, und dan in solchen Fällen und der Sachen Beschaffenheit keine Mandata uf vorbemelte Constitution erkant oder doch die erkante widerumb pflegen caßirt und uffgehoben werden, wie in Sachen Velberg contra Brantzenburg den 6. Junii Ao. 1592 beschehen:
Als ist und gelangt demnach an E. F. G. Syndici, im Nahmen obstehet, unterthenig rechtmesig Bitten und Begeren, in Recht zu erkennen und außzusprechen, das dieses außgangene und reproducirte Kayß. Mandat widerumb zue caßiren und ufzueheben, die Sach an gehörige Ort zue remittiren und also Syndici ged. Hern Principalen von übel angestelter Clag cum refusione expensarum damnorum et interesse von Rechtswegen zue absolviren und zu erledigen seyen.
Hieruber E. F. G. hochadelich milthrichterlich Ampt in Unterthenigkeit höchstes Fleises anruffendt,
vorbehältlich
E. F. G.
unterthäniger
Martinus Khun
Licentiatus
m. p.


|
Seite 227 |




|
Auf der Rückseite:
Exeptiones sub- et obreptionis
Syndici
Hern Burgermeister und Rhatt
der Kayß.
Freyen und des Heyl. Reichs
Statt Lubekh
contra
den
durchleuchtigen hochgebornen Fursten
und
Hern, Hern Adolph Friederichen und
Hanß Albrechten,
Hertzogen zue
Mekhelburg, et Consorten
|
Mandati der
Pfandung die an der Ostsee
Außgerißene und hinweg gefuhrte Reisen und Pfälen betr. |
| In Sachen Mekelburg | |
| et cons. | P. Spirae 2. Octobris |
| Contra | Ao.1618. |
| Lubekh. |


|
Seite 228 |




|
Berichtigung.
Zu S. 68 f.: Den Ausdruck "Räve" haben wir verkehrt gedeutet. Räve ist gleich Riff, Sandriff. Der Notar, der das Protokoll von 1757 aufnahm, muß seine Gewährsmänner mißverstanden haben. Sie hatten offenbar nicht das "Räve" mit der "Düpe" gleichsetzen, sondern sagen wollen, daß Räve und Düpe aneinander grenzten. Bei einem Zeugenverhör von 1763, das im Laufe des Prozesses veranstaltet wurde, erklärte der Strandvogt Kelling aus Kl. Pravtshagen, "seiner Meynung nach ginge der Strand so weit, als das See-Waßer auf das Reff überschlüge". Der Schneider Teut aus Warnkenhagen erwiderte auf die Frage, "woran er erkenne, wo das Räve sey, da das Ufer der See abschießet und in die Tiefe gehet": "Das Reff könne keiner gewiß kennen". Beide Zeugen meinten das Riff. Dieses geht bis zur "Düpe" und ist der Boden des überfluteten Strandes, auf dem Schiffe auflaufen können. Die Angaben von 1757 und 1763 stehen miteinander im Einklange. Durch die Aussage des Schneiders Teut wird übrigens unsere Bemerkung bestätigt, daß die Grenze zwischen Strand und Tief schwer aufzuzeigen war (S. 86).
Nachtrag.
Zu S. 131 f.: Die Vermutung, die wir über den Sinn des Lübecker Kämmereiprotokolls vom 10. September 1804 geäußert haben, wird durch eine inzwischen aus Lübeck eingetroffene Abschrift als richtig erwiesen.



|
[ Seite 229 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Wandmalerei
in Mecklenburg bis 1400.
Von
Dr. phil. Werner Burmeister (Schwerin).
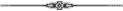


|
[ Seite 230 ] |




|


|
[ Seite 231 ] |




|
Einleitung.
Die mittelalterliche Wandmalerei des Ostseegebietes bietet ein noch wenig beachtetes, sehr reiches Material zur Geschichte der Malerei des Mittelalters. Durch das allmähliche Wiedererscheinen der meist unter neuzeitlicher Überstreichung verschwundenen Malereien und durch ihre teils sehr schlechte Erhaltung ist ihnen lange nicht das verdiente Maß an Aufmerksamkeit zuteil geworden. Noch heute gelten alle anderen Kunstzweige als dankbarere Objekte der Erkenntnis mittelalterlicher Kunst, die Malerei wird in zusammenfassenden Schilderungen der Kunst dieser Jahrhunderte fast ganz beiseite gelassen. So trug auch die Unsichtbarkeit der meisten Werke unter späterem Überstrich dazu bei, daß der Umfang und die Bedeutung der Wandmalerei im mittelalterlichen Leben unterschätzt wurde. Die klassizistisch verbildete Welt mußte ihre Vorstellung vom Mittelalter ebenso wandeln, wie von der Antike. In Mecklenburg hat zuerst Lisch das Interesse an diesen Dingen zu wecken versucht, ohne daß es ihm gelungen wäre, gerade einige sehr wichtige Denkmäler, die Wandmalerei des Doberaner Beinhauses und des Chorgewölbes von St. Marien in Röbel, vor der Vernichtung zu bewahren. Inzwischen sind noch mehrere solcher denkmalspflegerischen Sünden zu verzeichnen gewesen. Das Verdienst, viele charakteristische Wandmalereien unseres Landes durch eine leidlich getreue Restauration wenigstens in ihrem Gesamteindruck erhalten zu haben - eine Erhaltung des wahren manuellen Charakters, des Pinselstrichs, ist ja kaum möglich -, gebührt Friedrich Schlie, der diese im Küstengebiet sehr bedeutsame Kunstgattung vollauf zu würdigen wußte.
Die Menge der im norddeutschen Küstengebiet heute vorhandenen mittelalterlichen Wandmalereien ist außerordentlich umfangreich, und eine erstmalige wissenschaftliche Bearbeitung muß irgendwie aus der Masse des Matrials eine örtlich und zeitlich begrenzte Gruppe herauszulösen suchen. Die Begrenzung auf die


|
Seite 232 |




|
Frühzeit bis zur Hochgotik um 1400 herum ist eine etwas gewaltsame Maßnahme, denn derselbe bilderfreudige Geist geht ohne Unterbrechung ins 15. Jahrhundert über und wirkt sich gerade in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und noch weit ins 16. Jahrhundert hinein in einer Fülle von Werken aus. Gerade diese Spätwerke sind es, die durch ihren Umfang und die eindringliche Wucht ihrer Sprache den Blick zuerst auf sich lenken. Im Folgenden haben wir es mit den viel zurückhaltenderen Stücken der Frühzeit zu tun, die in die ersten, harten und stolzen Zeiten des Ostseedeutschtums hineinreichen. Die eng verklammerte Kette von Malereien in Ostmecklenburg bringt es mit sich, daß die Betrachtung dort nicht um 1400 rücksichtslos unterbrochen wurde, sondern auch noch Werke der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Berücksichtigung gefunden haben.
Die örtliche Begrenzung umfaßt in der Hauptsache Mecklenburg. Hier ist noch mehr eine Gewaltsamkeit des Ausschnitts fühlbar, denn Mecklenburg stellt sich nicht als einheitliches Gebiet dar, sondern teilt sich in zwei Hälften, eine an Denkmälern arme westliche und eine denkmälerreiche östliche Gruppe, die grundverschiedenen Charakter zeigen. Ihre Grenze wird ungefähr durch die Linie Wismarsche Bucht-Schweriner See bezeichnet. Die westliche Landeshälfte ist unselbständig und ohne wirkliches Eigenleben, sie zeigt sich von Lübeck eng abhängig und läßt einen ausgeprägten Charakter vermissen. Im Gegensatz zur östlichen Gruppe finden sich ihre Denkmäler fast nur an den großen städtischen und klösterlichen Kirchen, es fehlt eine bodenwüchsige Volkskunst. Im ganzen ist also der Westteil des Landes eine sterile Zone zwischen zwei Gebieten mit lebhafter Produktion der Wandmalerei, auf der einen Seite steht Lübeck und sein lauenburgisches Hinterland, auf der anderen Ostmecklenburg. Es ergibt sich, will man nicht den westlichen Landesteil ganz ausscheiden, die Lösung, den kulturellen Mittelpunkt des Gebietes, Lübeck, als Exkurs mit heranzuziehen, und die Wandmalereien des lauenburgischen Landes als von Lübeck ebenfalls unmittelbar abhängige Gruppe mit den spärlichen Stücken des westlichen Mecklenburgs zusammenzufassen und sie der ostmecklenburgischen Gruppe gegenüberzustellen.
Die frühesten erhaltenen Wandmalereien des Küstengebietes fallen in die Zeit um 1300. Es ist kaum anzunehmen, daß vor ihnen eine erhebliche Wandmalerei bestanden hat. Die Hauptmasse der Granitquaderkirchen des Landes entstand um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Ehe man dann zu einer malerischen Aus-


|
Seite 233 |




|
schmückung der Kirchen über die erste rein architektonisch-geometrische Behandlung hinaus gelangte, war man wohl dem Ende des 13. Jahrhunderts nahe gekommen.
Die Fragen der Herkunft und des Entwicklungsganges der mittelalterlichen Malerei des Küstengebietes streifen interessante Fragen der allgemeinen künstlerischen Abhängigkeitsverhältnisse Norddeutschlands. Gingen die Verbindungen mehr nach Westen, nach Westfalen und zum Rhein, oder nach Süden in das niedersächsische alte Kulturgebiet nördlich des Harzes? Welche Rolle, gebend oder empfangend, spielt der Norden, Dänemark und Südschweden? Für ein begrenztes Gebiet möchte die Arbeit auf diese Frage eine Antwort zu geben versuchen.
I. Übergangszeit.
Westlicher Landesteil: Mölln, Lauenburg.
Nordseite des östlichen Langhausjoches. Hl. Jakobus und Nikolaus und andere Szenen. Restauriert.
Friesartige Malerei, früher wohl einheitlich an den übrigen Jochen des Langhauses weitergeführt. Der etwa 50 cm hohe Fries zeigt über dem Zwischenpfeiler eine Erweiterung durch einen schwach halbkreisförmigen Bogen, der durch eine Säule und zwei auf ihr ruhende Kleeblattbögen unterteilt ist. In den Arkaden die Heiligen Jakobus und Nikolaus, Jakobus als Schutzpatron der Pilger, zwei seitlich von ihm kniende Pilger krönend, während links weitere Pilger herankommen; Nikolaus, halb nach rechts gewandt, segnet ein nach rechts segelndes Schiff, dessen Bemannung ihn anruft. Zu Seiten der Mittelszenen enthält der Fries links Jagdbilder, man erkennt Männer und Hunde, einen fliegenden Falken und Bäume. Welche Szene dargestellt ist, ist unklar. Rechts von der Mittelgruppe ist die Seelenwage mit Engeln und Teufeln, noch weiter rechts die Krönung Marias. Unter der Mittelgruppe im Zwickelfeld zwischen den Arkadenbögen die symbolische Darstellung des von Hunden gehetzten Hirsches und ein gekrönter fratzenhafter Löwenkopf, wohl eine Teufelsdarstellung.
Die Möllner Malerei zeigt Züge, die bestimmt auf rheinische Beeinflussung hinweisen. Die Szene des Jakobus, zu dem die Pilger hinwallen, um von ihm gekrönt zu werden, (S. Jago di Compostella) tritt im Rheinland mehrfach auf, in der ältesten und schönsten Fassung in Linz 1 ). Die Abhängigkeit von dem dortigen Bilde ist deutlich. Auch andere Typen der Darstellungen, die Jagd-


|
Seite 234 |




|
szenen und die Krönung Marias zeigen rheinische Charakterzüge. Daneben aber ist ein anderer Stammescharakter, der der niedersächsischen Miniaturmalerei, in der eckigen, hartbrüchigen Art der Faltengebung und mehreren Einzelheiten festzustellen. Die Darstellung des Heiligen Nikolaus als Schutzpatron der Seefahrer findet sich ähnlich in Melverode bei Braunschweig.
Zu den fremden Einflüssen, dem rheinischen und dem niedersächsischen, tritt nun als spezifisch küstenländischer Zug die Lockerung der Komposition und aller Einzelformen. Strenge Symmetrie und eine ruhige Flächenbehandlung, wie sie das Rheinland liebt, ist nicht angestrebt, im Gegenteil sind alle Teile möglichst verselbständigt und lehnen sich gegen eine strenge Disziplinierung auf. Diesen Zug werden wir im deutschen Küstengebiet regelmäßig wieder finden.
Die Datierung der Möllner Malerei muß ins 13. Jahrhundert gesetzt werden, da die Formen noch ganz romanisch erscheinen. Doch ist die Malerei in dieser Zeit im Küstengebiet auffallend rückständig, und einzelne leicht gotisierende Formen bedingen, daß das Werk schon dem letzten Viertel, vielleicht nahe dem Ende des Jahrhunderts, zugewiesen wird.
Östlicher Landesteil:
Doberan, Beinhaus. Christus und Apostel, kluge und törichte Jungfrauen, Kreuzigung und Marienkrönung.

|
Christus und Apostel, kluge und törichte Jungfrauen, Kreuzigung und Marienkrönung. Frei restauriert. Einheitliche Ausmalung des frühgotischen Oktogons.
An den gebrochenen Wandfeldern zwischen den Fenstern zwei Figurenreihen übereinander:
|
Leider ist der ursprüngliche Charakter der Malerei durch die Restauration von 1883 sehr zerstört, und bei der Beurteilung kann man nicht vorsichtig genug sein. Die Beschreibung, die Lisch von der Malerei vor ihrer Restaurierung in dem Mecklenburgischen Jahrbuch XIX, Seite 374 ff. gibt, zeigt, daß überall willkürliche Veränderungen vorgenommen sind. Statt der rhombischen


|
Seite 235 |




|
Brustschließen, die Lisch an den Jungfrauen sah, haben sie jetzt Mantelriemen nach Art der Magdeburger Jungfrauen. Die Kreuzigungsszene ist durch die nach einem Glasfenster von Bourges kopierten Figuren der Ekklesia und der Synagoge ergänzt worden, an Stelle einer verschwundenen Figur ist eine ritterliche Heiligengestalt mit Anlehnungen an eine Naumburger Stifterfigur und mit Porträtzügen des Herzogs Johann Albrecht getreten. Für die knieenden tragenden oder anbetenden Figuren unter den Konsolen ist Rankenwerk eingesetzt, nur an einer Stelle eine Droleriefigur, die mit jenen nicht identisch sein kann.
Es ist nach diesen Beobachtungen klar, daß der Restaurator unter Benutzung historischer Vorbilder den Charakter der Malerei gänzlich verändert hat. Die Färbung ist ganz seine Erfindung, da nach der Beschreibung Lischs die klugen Jungfrauen rote Mäntel zeigten, die übrigen Figuren aber nur als Umrißzeichnungen erhalten waren. Auch das Ornament der Bauglieder ist verändert, besonders das Ranken- und Blätterornament hinzugefügt.
Trotz dieser Verschleierung muß der Versuch gemacht werden, den ursprünglichen Charakter der Malerei zu bestimmen. Es ergibt sich bei Betrachtung des Gewölbes, daß dort ein Unterschied besteht zwischen Christus und seinen beiden Nachbarn, die Lisch als verschwunden bezeichnet, und die sich durch ihren klassizierenden Charakter als Erfindungen Andreäs verraten, und den übrigen fünf Aposteln. Diese haben anscheinend die ursprünglichen Umrißlinien bewahrt und atmen trotz der Überarbeitung noch mittelalterlichen Geist. Sie erinnern in ihrer frontale Haltung und dem scharfbrüchigen Faltenstiel an Gestalten sächsischer Kalendarien, daneben, besonders in der Bildung der Hände, an Gestalten der Malerei von Methler in Westfalen.
Die Kopftypen und der Faltenwurf entsprechen aber mehr den sächsischen Miniaturen der von Haseloff 1a ) zusammengestellten Gruppe. Petrus hält, wie zuweilen in den Handschriften, neben dem Schlüssel den Kreuzstab. Die Jungfrauen erscheinen gegenüber den Gestalten des Gewölbes mehr gotisierend, aber vielleicht ist dies, wie die Veränderung des Mantelschlusses, nicht ohne Mitwirkung Andreäs geschehen. Die von Lisch gesehene rhombische Mantelschließe ebenso wie die lebhafte Bewegung und die Neigung der Gestalten gegeneinander bringen sie den Jungfrauen des Braunschweiger Doms nahe. Die Heilige Katharina entspricht ziemlich genau der gleichen Heiligen auf der Altartafel der Quedlinburger Ägidienkirche im Berliner Museum, und derselben Tafel


|
Seite 236 |




|
entspricht die Anordnung der Krönung Marias über der Kreuzigung, d. h. diejenigen Teile der Wandfläche über der Tür, die auf alte Spuren zurückgehen.
Nach diesen Vergleichen läßt sich mit einiger Bestimmtheit sagen, daß die Malereien ein Werk des Übergangsstils waren, noch mehr byzantinisierend, als gotisierend, und daß der Stil von der niedersächsischen Malerei des 13. Jahrhunderts abhängig war.
Die Datierung des Werkes hängt von der Erbauungszeit des Beinhauses ab, auf die die Ausmalung unmittelbar gefolgt sein wird. Wir dürfen dieses zierliche Bauwerk der Übergangszeit in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts setzen, und zwar eher dem Ende, als der Mitte zuneigend, und kommen für die Malerei also auch in die letzte Zeit des 13. Jahrhunderts. Ein Vergleich mit der Rostocker Fünte von 1290 zeigt eine zeitliche Nähe. Die auch dort auftretenden Jungfrauen haben schon ausgeprägteren gotischen Charakter, aber da die Malerei gegenüber der Plastik sich allgemein etwas konservativer zeigt, ist damit eine Priorität der Beinhausmalerei nicht notwendig anzunehmen, und wir können sie auch um 1300 ansetzen.
Jüngstes Gericht u. Marienszenen. Restauriert. Abb. S. 313-314.
Jüngstes Gericht und Marienszenen. Restauriert.
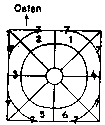
|
|
Das Chorgewölbe von Hohen Sprenz ist eins der achtrippigen Kuppelgewölbe des für das östliche Mecklenburg charakteristischen Dorfkirchentyps des 13. Jahrhunderts. Die Malerei bedeckt einen breiten Gürtel der Kuppel und die Zwickel, während die Mitte frei bleibt. Streng wie die Anordnung ist die formale Gestaltung: Auf einem breiten Fußring sitzen die ruhigen Gestalten in wohl abgewogenen Gruppen. Der Charakter ist, wie in Doberan, in der Hauptsache byzantinisch, aber im Gegensatz zu jenem Werk herrschen gerundete, weichere Linien vor, auch ist die Gesamthaltung in den figürlichen Szenen von freierem Leben. Die lebhafte Bewegtheit ist die gleiche, wie sie byzantinisierenden


|
Seite 237 |




|
Werken Niedersachsens eigen ist, dem Goslarer Evangeliar oder der Malerei des Braunschweiger Doms. Mit dem letztgenannten Monumentalwerk stimmen manche Züge überein. In der Komposition liegt der Vergleich mit dem Vierungsgewölbe des Braunschweiger Doms nahe. Auch dort sind die figürlichen Szenen in einem festen Ring angeordnet, der die Gewölbemitte freiläßt. Auch dort ist die Standhöhe der Figuren verschieden, sie schweben zuweilen über dem Bodenstreifen in der Luft. Einen weiteren Vergleichspunkt bietet der Faltenstil, der in Hohen Sprenz eine ähnliche Fülle von bewegtem Linienspiel und kontrapostischer Anordnung zeigt, wie in Braunschweig. Besonders finden sich die von Schultern und Unterarmen herabfallenden langen, taschenartigen Hänge mit der Neigung zu spiralischer Umbiegung am Ende ebenso dort wie hier.
Die Reihen der sitzenden Apostel an der Nord- und Südseite erinnern zugleich an ein etwas früheres plastisches Werk Niedersachsens, die Apostel der Chorschranken in der Halberstädter Liebfrauenkirche 2 ), und es erscheint notwendig, eine Einwirkung ihrer Stellungsmotive sowie des plastisch gerundeten Charakters ihrer Erscheinung hier zu sehen. Die glatten, die Glieder umschreibenden Faltenzüge sind ganz entsprechend. Ähnliche lange, mit Pfosten versehene Sitzbänke finden sich an einem Quedlinburger Reliquienkasten wieder.
Neben diesem byzantinischen Grundton ist ein andersartiges Element festzustellen, ein westlicher, gotischer Einfluß. Die beiden westlichen Gewölbekappen zeigen Ikonographie, die auf Portaltympana französischer Kathedralen zurückgeht. Dort ist der Tod und die Krönung Marias zwischen flankierenden leuchtertragenden Engeln die regelmäßig auftretende Füllung des Bogenfeldes der Marienpforte. Auch die acht schwebenden und knienden Engel mit Posaunen und Rauchfässern gehören zu dem reicheren Hofstaat, der Christus und Maria in der neuen Stilbewegung zukommt.
Formal spricht sich der westliche Einfluß in der Behandlung der Gewänder aus. Neben den oben angeführten byzantinischen Motiven ist ein lang-hängender, dünner und schmiegsamer Charakter auffallend, der die Leichtigkeit und Weichheit des Stoffes betont, gern in langen, ungestörten Faltenzügen herabfällt und die unteren Säume in gerader Linie abschneiden läßt. Auch hier zeigt ein Vergleich mit französischen Portalskulpturen (Marienpforten von Paris und Amiens), daß von dort Gewandmotive übernommen sind.


|
Seite 238 |




|
Zusammenfassend stellen wir in Hohen Sprenz eine Verschmelzung byzantinisch-sächsischer Formen mit französisch-frühgotischen fest, und da die letzteren so rein und frisch auftreten, liegt die Annahme einer Beziehung zu den frühgotischen Dombauhütten Niedersachsens, Magdeburg oder Halberstadt, nahe.
Einige Ungewöhnlichkeiten im Ikonographischen fallen ins Auge. Die Doppelmajestas der östlichen Kappen ist unter dem Zwang der die Mitte durchschneidenden Scheitelrippe entstanden. Daß sie als Einheit gemeint ist, zeigt das enge Zusammenrücken beider Throne und die Zusammenfassung beider Gruppen durch ein äußeres Paar von Assistenzheiligen. Die in dieser Zeit sehr ungewöhnliche Form des bartlosen Christus mag durch ein Vorbild frühmittelalterlicher Kleinkunst vermittelt sein. Endlich ist die Zahl dreizehn der sitzenden Apostel ungewöhnlich 2a ).
Die Datierung möchte man des vorherrschenden byzantinischen Charakters wegen gerne noch vor 1300 ansetzen, aber die Rückständigkeit des Küstengebietes, der Vergleich z. B. mit den Gußsteinaposteln des Lübecker Museums, die Goldschmiedt in den Anfang des 14. Jahrhunderts setzt, macht auch für Hohen Sprenz eine Entstehung gleich nach 1300 wahrscheinlich.
Lüdershagen, Chorgewölbe.
Weltgericht, ringförmige Malerei von acht Einzelfiguren. Restauriert. Abb. S. 314.
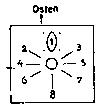
|
|
Auch hier ist das Chorgewölbe ein Kuppelgewölbe auf quadratischem Grundriß, aber rippenlos. Die Malerei zeigt, wie dieselbe Aufgabe in der gleichen Zeit völlig anders gelöst werden konnte. In Hohen Sprenz war ein tektonisches Gerüst, das den Figuren Haltung gab und innerhalb seines Rahmens Möglichkeit für freie, ja lebhafte Bewegung bot. Hier schweben die Figuren in der leeren Fläche ohne jede Rahmenbildung, und sie selber bilden durch ihre Starrheit und tektonische Anordnung die Gliederung der Kuppel.


|
Seite 239 |




|
In Lüdershagen drängt sich ein bestimmter Vergleich auf mit der Malerei des Chorgewölbes der Dorfkirche von Methler in Westfalen 3 ). Auch dort ist ein kuppeliges Gewölbe mit quadratischem Grundriß, das den thronenden Christus inmitten sechs stehender Heiligen enthält, zweier Bischöfe, eines jugendlichen Heiligen und drei heiliger Frauen. Im Gegensatz zu Lüdershagen ist das Gewölbe durch Bänder streng gegliedert; aber die figürliche Anordnung ist zu entsprechend, um zufällig zu sein. Ein weitergehender Vergleich zeigt auch in den Einzelheiten der Figurenbildung ähnliche Züge. Vom zeitlichen Abstand entsprechend ist die Figurendarstellung in Lüdershagen einfacher und von eindringlicher betontem Ausdrucksgehalt, das westfälische Werk erscheint dagegen unpersönlicher, hoheitsvoll-ferner. Aber die Grundelemente sind geblieben. Die Frontalität der Figuren, ihre steife, schematische Körperhaltung ist noch gesteigert, sie blicken mit starrem Ernst den Beschauer an, ihre Handbewegungen vor dem Leibe sind gebunden und schematisch, die Füße hängen symmetrisch herab. Es ist der Schluß zulässig, daß der mecklenburgischen Malerei westfälische spätromanische Werke als Vorbild gedient haben. Westfälischer Einfluß erhellt aus der Gestaltung des Weltrichters in der sehr breiten, fast kreisförmigen Mandorla, der mit der rechten Hand den Segensgestus nach außen macht, im Mantelwurf und dem Sternengrunde in und um die Glorie seine Herkunft von dem byzantinischen Weltenrichter westfälischer romanischer Apsiden nicht zweifelhaft läßt. Auch bei den übrigen Gestalten treten, besonders in der Bildung der Hände, die zierlich und dünnfingerig vor dem Gewande spielen und die Attribute mit gestrecktem Zeigefinger halten, Eigenheiten der westfälischen romanischen Malerei zutage. Die Erinnerung an die prunkvolle byzantinische Tracht, die dort zur Anwendung kam, ist noch in den freilich sehr schematisierten Borten der Dalmatika des Engels, sowie in den breiten Hals- und Schulterstücken der Tracht der stehenden Heiligen lebendig. Die Dalmatika des Bischofs ist wie in Methler schräg gerautet.
Die die Gewänder der Figuren wagerecht durchschneidenden Ornamentborten dürften ihren Ursprung in der Glasmalerei haben 4 ); unerklärlich ist die Doppelflügeligkeit des Engels, der einen breiten Raum mit seinen beiden Schwingenpaaren auszufüllen hat. Mit den Seraphbildungen mit zwei gekreuzten und einem ausgebreiteten Flügelpaar hat sie keine Ähnlichkeit.


|
Seite 240 |




|
Auch in Lüdershagen kündet sich die Frühgotik deutlich an. Der byzantinische Grundcharakter ist mehr zerstört, als in Hohen Sprenz. Überall finden sich byzantinische und gotische Formen nebeneinander; während die beiden westlichen Heiligen in dem abflatternden Mantelzipfel das erstere Stilgepräge zeigen, hat besonders Petrus schon eine Andeutung gotischer Gewandhaltung. Die Haarbehandlung und die sehr längliche Kopfform verraten das Eindringen der westlichen Formen. Schon beginnen regelmäßige Wellenlocken das Gesicht zu rahmen. Das Untergewand Christi ist schon das engärmelige gotische, die Thronbank ist lehnenlos und zeigt unter der Platte frühgotische eingerollte Rankenmotive.
An der Ostwand direkt über dem Fenster befindet sich noch eine kleine Dreifigurengruppe, die thronende Maria mit dem Kinde zwischen zwei Heiligen, wohl Joachim und Anna. Sie zeigt das Eindringen der Gotik am stärksten, wohl weil sich hier der Maler nicht, wie am Gewölbe, an romanische Vorbilder gebunden fühlte. Von dem Thron Marias blühen seitlich zwei große natürliche Lilien schräge empor; sie müssen von dem frühgotisch französischen Motiv des Ausblühens der Thronbankenden in Ranken hergeleitet werden, das sich auch in Niedersachsen schon im 13. Jahrhundert zeigt (Altartafel von Quedlinburg).
Die Datierung der Malerei von Lüdershagen muß nach der stilistischen Haltung etwas später angesetzt werden, als die von Hohen Sprenz. Mit letzterer stimmen einige Eigenheiten überein, die Mehrfarbigkeit der Nimben und die Namensbeischriften bei einigen Figuren sowie die zarte Farbenstimmung. Der zeitliche Abstand zwischen beiden Werken kann nicht bedeutend sein, so daß wir Lüdershagen in das erste Viertel des 14. Jahrhunderts datieren möchten.
Gnoien, Chorgewölbe.
Weltgericht und Szenen des Marienlebens. Restauriert. Abbildung: Schlie I (1), Tafel S. 490; (2), Tafel S. 506.
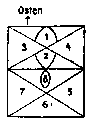
|
|


|
Seite 241 |




|
Die Malerei des Gnoiener Chorgewölbes unterliegt schon durch die Architektur, den zweijochigen, mit gotischen Kreuzgewölben gedeckten Chor, veränderten Bedingungen. Der Gesamteindruck ist durchaus gotisch, und erst die nähere Betrachtung zeigt die starken byzantinischen Züge, die in den Einzelformen noch überwiegen. Die verschiedenartige Anordnung der Bilder in den beiden Jochen hat frühere Betrachter zu dem Schluß verleitet, daß sie zwei verschiedenen Händen angehören 5 ). Dem gegenüber muß betont werden, daß eine Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit des Stils besteht. Die Frage nach der Herkunft der Formen läßt zwei Möglichkeiten zu: Entweder stammen sie vom rheinisch-westfälischen oder vom niedersächsischen Kunstkreise her. Das erstere lassen die vier großen Halbfiguren des östlichen Joches vermuten durch ihre isolierte statuarische Form und ihren düsteren Ernst. Der Christus, der sich dem Pantokratortyp sizilischer Apsismosaiken nähert, kommt am Rhein häufiger vor, z. B. in Schwarzrheindorf und im Kapitelsaal von Brauweiler. Die Zusammenstellung der vier Halbfiguren, von denen Christus und Maria von Halbmandorlen unten abgeschnitten werden, die beiden seitlichen aber unvermittelt abbrechen, ist ungewöhnlich, doch beweist das Vorhandensein Marias und des Täufers, daß eine Deesisgruppe zugrunde liegt, und eine solche findet sich, strenger in die Kappen komponiert, in der Taufkapelle von St. Gereon in Köln. Ein weiteres ähnliches Beispiel der Deesisanordnung durch Halbfiguren in drei Gewölbekappen, freilich in Kreismedaillons, zeigt das Chorgewölbe von Neuenbeken bei Paderborn 6 ). Für Westfalen spricht die düstere Monumentalität, das A und O seitlich des Hauptes Christi, die bortenbesetzten Halssäume mit Saumfalte und die in Westfalen besonders häufige Gestalt des Johannes mit der Lammscheibe.
Die Szenen des westlichen Joches und das Scheitelornament beider Gewölbe beweisen aber den überwiegenden Einfluß der niedersächsischen spätromanischen Malerei, und zwar der Buchmalerei. Schon die unorganische Anordnung der vier Szenen im Gewölbe deutet auf die Übertragung fertiger Vorbilder auf die Putzflächen, ohne daß man sich den Kopf über ihre Umwandlung im Sinne der neuen Aufgabe zerbrach. Die vier Szenen sind in umlaufender Folge ablesbar. Daß noch romanisches Formgefühl wirksam ist, beweist die in eine Seitenkappe gesetzte Kreuzigung. Gotische Komposition würde sie nur in der Mittelachse dulden.


|
Seite 242 |




|
Die Verkündigung zeigt den für niedersächsische Kunst des frühen 13. Jahrhunderts charakteristischen schreitenden Engel mit gesenktem Schriftband und ungleich gestellten Flügeln. Die Maria ist sitzend auf frontalem Thron dargestellt und hält eine Laute in der Hand, die wohl durch ein Mißverständnis des Malers, der die byzantinische Spindel so umdeutete, entstanden ist. Deutlicher zeigt die Geburtsszene, daß wir die Vorbilder in der Miniaturmalerei zu suchen haben, und zwar in der Nähe der von Haseloff zusammengestellten niedersächsischen Schule. Dasselbe gilt für die Kreuzigungsgruppe, wo aber auch die großen plastischen Triumphkreuzgruppen Niedersachsens nicht ohne Einwirkung gewesen sind. Die Form des Kreuzes mit verstärkten Kreuzenden und der Kelch darunter (Wechselburg) und Haltung und Gewand der Nebenfiguren sprechen dafür, wie überhaupt die Erinnerung an solche monumentalen Plastiken den Gesamteindruck bestimmt. An niedersächsische Miniaturen erinnert der stark gebogene Leib und die gekreuzten Beine Christi, das lange ausgezackte, vorn geknotete Lendentuch und die rechte Hand des Johannes mit dem für Niedersachsen charakteristischen eingeschlagenen kleinen Finger. Endlich zeigt auch die Marienkrönung dieselben Beziehungen zu der genannten Miniaturengruppe, wenn auch die Fassung in Gnoien stark in gotischem Sinne verändert ist. Die Rankenmotive am östlichen Gewölbescheitel sind niedersächsischer Herkunft (vgl. Rankenfriese an den Chorwänden des Braunschweiger Doms), das Drôlerienornament des westlichen Gewölbescheitels ist dem Initialornament niedersächsischer Buchkunst entsprossen.
In Gnoien überwiegt somit der niedersächsische Einfluß vor den daneben beteiligten westlichen, wohl rheinischen Zügen. Das Gotische ist in der Lockerheit und stärkeren Sentimentalität, die auffällt, überall zu spüren, aber von keiner bestimmten, etwa unmittelbar französischen oder rheinischen Ausprägung. Es ist unbewußtes Mitschwingen des modernen Geistes, nicht bewußtes Wollen. Wegen des starken Mitsprechens der gotischen Formen muß die Malerei auch später angesetzt werden, als die vorigen, an das Ende des ersten Viertels des 14. Jahrhunderts oder in den Anfang des zweiten.
Fassen wir die wesentlichen Merkmale der Malerei des Übergangsstils in Mecklenburg zusammen, so fällt zunächst ein Mangel an Einheitlichkeit auf. Wir sehen eine Reihe unter sich sehr ungleichartiger Stücke, die weder nach dem Darstellungskreis noch nach der formalen Haltung ein für die Landschaft charakteristisches


|
Seite 243 |




|
einheitliches Gepräge tragen. Das liegt zunächst an der geringen Zahl der erhaltenen Werke, und besonders an dem vollständigen Fehlen von solchen in den Städten; es ist dadurch das gliedernde Gerüst verloren gegangen, und nur zufällige Einzelfälle haben wir noch in Händen, die zu keinem Gesamteindruck mehr geeignet sind. Der zweite, wichtigere Grund der Uneinheitlichkeit aber ist, daß sich um 1300 ein besonderer Wandmalereistil des Ostseegebietes erst aus verschiedenen fremden Faktoren bildet; darum darf es nicht befremden, daß die Produktion keinen einheitlichen Charakter trägt, müssen wir doch zum guten Teil zugewanderte Fremde als Hersteller annehmen.
Vergleichen wir die Werke untereinander, so fällt die im Westen vereinzelte Möllner Malerei durch die besondere örtliche Lage an der Wand des Mittelschiffs einer Basilika, dann durch ihre friesartige Komposition mit sehr kleinen Figuren und durch ihren lebendigen, naturalistischen Charakter heraus. Sie zeigt als einzige rheinische Beeinflussung. Sie allein kann auch eine Ahnung von der Art geben, wie die ältesten Stadtkirchen malerisch behandelt waren. Ihr gegenüber dürfen wir die ostmecklenburgischen Stücke näher zusammenrücken. Sie schließen sich an Niedersachsen und Westfalen an. Der niedersächsische Einfluß überwiegt, im Gegensatz zur Architektur, die hauptsächlich westfälischen Einfluß zeigt. Leichte Anklänge an rheinische Malereien scheinen sich nur in Gnoien zu finden. Von diesen ostmecklenburgischen Werken nimmt Doberan eine Sonderstellung ein durch die Eigenart der architektonischen Gegebenheit, die zu einer ebenso originellen malerischen Komposition führt, die nur sehr losen Zusammenhang mit dem Braunschweiger Vorbild zeigt. Dagegen haben die drei übrigen Werke, Hohen Sprenz, Lüdershagen und Gnoien, als gemeinsame Aufgabe die Ausmalung des Chorgewölbes und lösen sie auch in ähnlicher Weise, ringförmig (in Gnoien etwas abweichend durch die Verdoppelung der Gewölbejoche). Im östlichen Gewölbefeld der thronende Christus, an den sich nun mehr oder weniger zum Weltgericht gehörende Figuren anreihen. Dagegen sind in Hohen Sprenz und Gnoien die westlichen Gewölbeteile, in Lüdershagen die östliche Wand des Chors der Marienverehrung gewidmet.
Nordische Einflüsse sind in der Übergangszeit nicht zu erweisen, zu der bedeutenden nordisch beeinflußten Malerei in Bergen auf Riigen finden sich keine Beziehungen.


|
Seite 244 |




|
II. Frühe und hohe Gotik (14. Jahrhundert).
Die gotische Kunst des Ostseegebietes hat ihren Ausgangs-und Mittelpunkt in Lübeck. Eine Untersuchung der Wandmalereien des gotischen Zeitalters in Mecklenburg kann nicht unternommen werden, ohne vorher die lübischen Werke der frühen Gotik kurz zu behandeln. Wie alle Städte von Bedeutung im jungen Kolonialland, hat Lübeck keine Reste von Übergangswerken bewahrt. Um so reicher ist die frühe Gotik noch heute vertreten trotz sicher sehr großer Verluste (in beiden Hauptkirchen ist uns nichts erhalten), ein Zeichen, welche reiche Tätigkeit auf dem Gebiet der Wandmalerei im 14. Jahrhundert geblüht hat.
Charakteristisch ist, daß die Malerei in dem Stilwandel zur Gotik hinter der Architektur um ein gutes Stück nachhinkt. In Lübeck hat die gotische Architektur im 13. Jahrhundert ihre Herrschaft durch die Chorbauten der Marienkirche und des Doms fest begründet die gotische Malerei aber entwickelt sich erst langsam während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Bis dahin herrscht ein noch in der Hauptsache romanischer Ubergangsstil.
Bei den gotischen Malereien sind wir in besserer Lage, als bei denen um 1300, weil nunmehr auch die führenden Städte nicht mehr alle Auskunft versagen. Wir können zwischen fortschrittlichen und zurückgebliebenen Werken, zwischen städtischer, klösterlicher und ländlicher Volkskunst unterscheiden.
Zunächst müssen die Werke der Stadt Lübeck, soweit es für die vorliegende Arbeit notwendig ist, untersucht werden.
Kolossale Einzelfiguren der Apostel und einiger Heiliger, Gnadenstuhl, Christophorus.
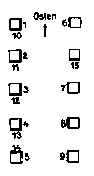
|
|


|
Seite 245 |




|
|
Beschreibung: Bau- und Kunstdenkmäler Lübecks III, S. 332ff, außerdem 16. Jahresbericht des Vereins von Kunstfreunden, Lübeck.
Am Anfang steht gleich das gewaltigste Werk der mittelalterlichen Malerei Norddeutschlands, eins der besten Malereiwerke des Mittelalters überhaupt. Die Kolossalfiguren der Apostel und Heiligen, die in doppelter Lebensgröße unter zierlichen gotischen Baldachinen die Pfeilerseiten bis zum Kämpfer füllen, heben sich von tiefblauem Grunde ab, darunter befindet sich unter einem Rundbogen die kleinfigurige Szene des Martyriums des betreffenden Heiligen. Die Gewohnheit, Kolossalfiguren in eine schmale Pfeilerseite zu komponieren, findet sich an den Vierungspfeilern des Braunschweiger Doms und an den Wandpfeilern der von Braunschweig abhängigen Melveroder Kirche. Mit Melverode sind einige Gestalten in der Gesamthaltung zu vergleichen, die Maria mit dem Kinde dort und die Annaselbdritt in Lübeck, beim Christophorus der ähnlich gerade Baum mit dem Blätterbüschel an der Spitze.
Auf die Herkunft der gotischen Formen läßt die enge Verwandtschaft der Martyrienszenen mit den Miniaturen des Soester Nequambuches, das Kölner Werken (Wandmalerei in St. Cecilien) nahesteht, Schlüsse zu. Außerdem entspricht die Kreuzigung Petri einer gleichen Darstellung des 13. Jahrhunderts im Limburger Dom. Also ein Vorherrschen rheinisch-westfälischer Züge in den bewegten kleinen Nebenbildern.
Auf die großen Standfiguren mit ihrer etwas gezierten, repräsentativen Haltung mögen flandrische Bronzetafeln nicht ohne Einfluß gewesen sein, die auch so wilde Lockenköpfe, so schlängeligen, zipfeligen Faltenstil und um die seitlich gestellten Füße schleppendes Untergewand aufweisen. Noch bedeutende Vergleichspunkte bilden einige Königsfeldener Glasfenster, die aber nur den Glauben an die rheinische, über Köln vermittelte Stilherkunft verstärken.
Rheinisch-französischem Charakter entgegengesetzt ist aber die seelische Stimmung dieser Figuren. Das Lübecker Werk ist von dumpfer und schwerer Geistigkeit, an die Stelle der Eleganz der vorgenannten Malerei ist eine Herbheit und Trägheit getreten, die aber mit einer tiefen, stillen Innerlichkeit des seelischen Gehalts verbunden ist, die sich besonders in einigen der Köpfe erschütternd


|
Seite 246 |




|
offenbart. Diese Eigenschaften müssen im norddeutschen Küstengebiet, wohl in Lübeck selber entwickelt worden sein.
Die Datierung darf mit den "Bau- und Kunstdenkmälern" um 1334, Vollendung der Kirche und Weihe des Hochaltars, angesetzt werden. Einige von diesem Werk beeinflußte Tafelmalereien wahrscheinlich lübischen Ursprungs in Doberan setzt Paul 6a ) zwischen 1338 und 1341 an, sie bestätigen durch ihren etwas fortgeschritteneren Charakter die Datierung.
Krönung Marias, Christus als Weltrichter. Restauriert. Abb. Bau- und Kunstdenkmäler II, S. 465.
Die beiden großartig komponierten Bogenfelder sind von der Malerei der Jakobikirche sehr verschieden. Die Enge und Gepreßtheit hat einer wohligen Körperlichkeit und Rundung Platz gemacht. Statt der bäuerlichen Derbheit dort herrscht hier Eleganz und Grazilität. Viel unmittelbarer ist hier die Abhängigkeit vom französischen Heimatlande des Stils zu spüren. Auf welchem Wege kommen diese Formen nach Lübeck?
Die Wahrscheinlichkeit spricht für eine Vermittlung durch das Rheinland mit dem Mittelpunkt Köln. Und wirklich zeigt der Vergleich mit Kölner Malereien weitgehende Übereinstimmungen im Aufbau der Komposition und in der Figurenbildung. Der Typus der Marienkrönung ist gerade im Rheinland in dieser Form besonders häufig - in Köln sind mehrere ganz ähnliche Bilder festzustellen, z. B. an den Chorschränken des Doms, in St. Andreas und auf einer im Berliner Kunstgewerbe-Museum erhaltenen Pause eines verschwundenen kölnischen Wandbildes 7 ). Der Thron mit den seitlich stehenden Löwen (Thron Salomons) findet sich auch in Köln auf einem Glasgemälde in der Johanniskapelle des Domchors. Endlich sind die musizierenden Engel für kölnische Frühgotik charakteristisch. Sie treten dort gleichmäßig an Wandmalereien, Glasfenstern und in der Plastik auf. Neben diesen ikonographischen Übereinstimmungen zeigt auch die formale Haltung in der Gesichts-, Hand- und Faltenbildung mit der Kölner Malerei um 1330 - 1350 engeren Zusammenhang. Es ist deshalb notwendig, hier eine unmittelbare Übernahme französischer Formen auf dem Wege über Köln zu erkennen.
Das rechte Bogenfeld mit dem thronenden Christus in der Mandorla zeigt ebenfalls den französischen Einfluß. Zwar hat der


|
Seite 247 |




|
Christus in seiner frontalen Starrheit noch starke Züge romanischer Apsisbilder bewahrt, aber die Formen sind überfein und grazil geworden und die Kopfbildung mit gescheiteltem Haar wie der langzügig fallende Faltenwurf weisen deutlich nach Frankreich. Die Evangelistensymbole haben kaum noch ursprüngliche Züge, höchstens von dem Engel könnte etwas noch erhalten sein; auch die das Mittelbild umgebenden Bildnismedaillons sind völlig verdorben. Sie stehen inhaltlich als eigentümlich moderne Erscheinung ohne Analogie da und tragen zu der Würdigung der Malerei als unmittelbarer Import von einer fortgeschritteneren Gegend bei. Dem Charakter der Zeichnung, fein im Linienschwung, straff und klar in der Komposition, scheint auch die Färbung entsprochen zu haben, die seine Zusammenstellungen und im ganzen eine gute Farbverteilung ahnen läßt.
Der Stil ist um ein gutes Stück fortgeschritten gegenüber den Jakobipfeilern. Wir dürfen die Malerei nach ihrer ungefähren Gleichzeitigkeit mit den Kölner Domchorschranken und unter Annahme eines auswärtigen, wahrscheinlich eines Kölner Meisters, um 1350 datieren.
Die Malerei teilt sich in
- die spitzbogigen Rückwände des mittelsten und des südlichsten Lettnerbogens; restauriert;
- die zwickelförmigen Stücke der Lettnerstirnwand, Malerei sehr zerstört, nicht restauriert.
I. Das Mittelfeld enthält im oberen, spitzbogigen Felde die Kreuzigung zwischen Maria und Johannes und seitlich zwei kniende, Rauchfässer schwingende Engel. Darunter in einem breiten Rechteck den Tod Marias im Kreise der Apostel, hinter dem Lager Jesus mit der Seele im Arm. Seitlich je ein stehender Engel mit Schriftband.
Das südliche Bogenfeld zeigt in der Spitze des Bogens nur Ranken, ein unterer Streifen ist zweigeteilt und zeigt nebeneinander die Marienkrönung und die Dreieinigkeit.
II. Die Zwickelfelder der Lettnerstirnwand enthalten von links nach rechts:
- einen posaunenblasenden Engel,
- den Verkündigungsengel,
- Maria der Verkündigung,
- Christus als Weltenrichter,
- den auferstehenden Christus,
- einen posaunenblasenden Engel.


|
Seite 248 |




|
Der Umstand, daß der Teil I restauriert ist, macht die Lösung der Frage schwierig, ob die Malerei einheitlich, oder ob sie aus einem älteren Teil, den Rückwandbögen, und einem sich in der ganzen Haltung ihm anpassenden jüngeren, den Zwickelfeldern der Lettnerstirnwand, besteht. Gleichartig ist bei beiden Teilen der blaue, grün gerandete Hintergrund, die durchgehende steif repräsentative Haltung der Figuren ohne Schwingung, der gleiche Gewandstil mit gerundeten Saummotiven und gelegentlichen Zipfelbildungen, die gleiche Vorliebe für goldene Saumborten an weiten Ärmeln und goldene Nimben und das durchgehende Kompositionsmotiv flankierender Engel. Dagegen scheint in der stilistischen Haltung ein merklicher Abstand zu sein: die Malerei der Rückwandbögen ist noch voll von romanisierenden Zügen, während die Vorderwand voll entwickelte Gotik bietet.
Die Bilder der Rückwände stecken noch stark in romanischem Formgefühl. Die Gesamthaltung der Kreuzigung entspricht spätromanischen Miniaturen, und zwar kommt für Lübeck am meisten die niedersächsische Buchmalerei in Betracht. Zu dieser ergeben sich nun deutliche Beziehungen. Die Gestalt des Kreuzes mit seiner zweifachen Schattierung und Sonne und Mond über dem Querbalken, die eckige Schollenbildung des Bodens, die Umrandung der breiten Säume und der Nimben mit weißpunktierten Linien, die Verwendung der weißen Kante an Gewandsäumen und das gelegentliche Vorkommen von heller, netzartiger byzantinischer Innenzeichnung des Gewandes, all diese Züge finden sich an den niedersächsischen Miniaturen regelmäßig wieder. Eine ungewöhnliche ikonographische Erscheinung, das Schwert, das Marias Brust durchbohrt, kommt ebenfalls in der Buchmalerei vor 8 ).
Eine gewisse Verwandtschaft in der Haltung der Figuren besteht mit dem im ersten Teil besprochenen Möllner Werk. Derselbe halb schwebende Stand und dieselbe steife Haltung zeichnen die Heiligen Jakobus und Nikolaus dort aus. Es scheint sich so ein Blick auf die stilistische Eigenart der verschwundenen vorgotischen lübischen Malerei zu öffnen und zugleich eine Erklärung für die romanisierende Haltung der Malerei der Lettnerrückwand in der Benutzung älterer Vorbilder zu finden. Im Ausdrucksgehalt ist eine Verwandtschaft nicht vorhanden; in Mölln war die freie, naturnahe Lebendigkeit der Hauptcharakterzug, hier steife und feierliche Repräsentation.
Neben den niedersächsisch-romanischen Formen treten überwiegend gotische hervor. Die Einteilung der Fläche in ein oberes


|
Seite 249 |




|
Bogenfeld und ein unteres Breitrechteck ist eine frühen französischen Portaltympanen eigentümliche Erscheinung. Auch die Ikonographie zeigt Dinge, die mit der französischen Portalplastik in Zusammenhang stehen. Die Flankierung durch kniende, meistens leuchtertragende Engel tritt an den Marienpforten von Chartres und Paris auf, ebenso der Tod Marias inmitten der Apostel. Auch die Marienkrönung zwischen zwei Engeln findet sich da; die Dreieinigkeit ist in der hier auftretenden Fassung für Norddeutschland ungebräuchlich, findet sich aber im Psalter Ludwigs des Heiligen, so daß auch hierfür eine französische Herkunft wahrscheinlich wird.
Sind so französische Elemente zweifellos vorhanden, so ist andererseits eine unmittelbare Verbindung mit französischen Werken und ihrem eleganten Lineament nicht anzunehmen. Der Gewandstil ist eigentümlich schwerfällig, es besteht ein Konflikt zwischen der starren Linienführung der niedersächsisch-romanischen Malerei und einer unorganisch damit zusammentreffenden Neigung, mit gebogenen wulstigen Faltenzügen die Starrheit zu brechen. Die Schwerfällig geschlängelten derben Saummotive können die Annahme westfälischen Einflusses begründen. In einer Miniatur aus dem Graduale der Gisela von Kerssenbrock in Osnabrück 9 ) findet sich eine ähnliche Übergangsstufe vertreten, schlängelige Saummotive von ähnlicher Einfachheit und Derbheit treten auf. Auch die weißen Gewandsäume und weißpunktierten Nimbenränder finden sich vor. Die Möglichkeit, daß ein ähnliches Vorbild dem Maler vorlag, kann nicht abgewiesen werden.
Mit Rücksicht darauf, daß die Malerei, auch der Rückwände erst nach dem Bau des Lettners entstanden sein kann, möchten wir mit Vorbehalt eine Gleichzeitigkeit der Arbeit und Ausführung beider Teile durch die gleiche Hand annehmen. Viele kleine Einzelzüge scheinen darauf hinzudeuten. Die archaisierende Haltung der Rückwände müßte dann durch die Benutzung älterer Vorbilder erklärt werden, während der Maler an der Lettnerstirnwand frei schalten konnte. Volle Klarheit über den Tatbestand wird erst eine spezielle Bearbeitung der lübischen Wandmalereien ergeben können.
Die Datierung möchte man nach der strengen linearen Komposition und den nahen Beziehungen der Stirnwandmalerei zu den Pfeilern der Jakobikirche noch in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts setzen. Beide Malereien haben noch den blauen, grün gerandeten romanischen Grund. Manche Bewegungsmotive erscheinen ganz ähnlich denen an den Jakobipfeilern, so daß der zeitliche Zwischenraum nicht bedeutend sein wird. Ähnlich ist z. B. die


|
Seite 250 |




|
Maria der Verkündigung mit der Annaselbdritt in der Jakobikirche, auch die Darstellung des geöffneten Buches, dort bei Anna, hier beim Weltrichter, ist ganz entsprechend. Aber die Stellung der Figuren ist freier und beweglicher geworden, die Linienführung weicher gerundet, der Charakter leichter und dekorativer. Der Pinselstrich ist breiter und die Farbengebung ausgeprägter die der reifen Gotik.
Der Bau des Lettners wird von den "Bau- und Kunstdenkmälern" in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert und die Basen und Kapitelle der Säulen als von einem früheren Bau berrührend angesehen. Dagegen spricht die Haltung der Malerei, die wir nicht nach 1350 setzen möchten. Nimmt man die Errichtung des Lettners in der ersten Jahrhunderthälfte an, was wohl möglich ist 10 ), so können die Werkstücke gleichzeitig sein, und die Malerei darf dann, ihrer stilistischen Entwicklungsstufe entsprechend, zwischen 1340 und 1350 angesetzt werden.
Am Schluß möchten wir bemerken, daß die unrestaurierten Malereien der Lettnerstirnwand interessante Aufschlüsse über die Technik ergeben. Man erkennt die Untermalungen der verschiedenen Farben. Es würde eine farbentechnische Untersuchung lohnen.
Es sind nur unvollkommene Bruchstücke, aber sie sind von Restaurierung verschont geblieben. An der Ostwand links vom Fenster der Gnadenstuhl unter einem Kleeblattbogen mit Wimperg, rechts die Verkündigung unter zwei solchen Bögen. An der Westwand der Rest eines Frieses von Standfiguren unter Spitzbogenarkaden, die mit Türmchen gekrönt sind. Diese Malerei ist in der Haltung völlig anders als die Lettnerbilder, der Charakter ist in stärkerem Maße zeichnerisch, wenigstens erscheint er so in dem heutigen zerstörten Zustande. Tatsächlich liegt in den sparsamen einfachen Linien ein starker Ausdrucksgehalt, und es scheint, als ob ihre Straffheit und formende Kraft ohne viel farbige Modellierung ausgekommen wäre. Die Eckigkeit und Geradlinigkeit der Zeichnung findet ihre Erklärung in dem Nachwirken des eckig gebrochenen spätromanischen Zeichenstils, der vom Rheinland bis nach Niedersachsen im Anfang des 13. Jahrhunderts herrscht. Für ein Nachwirken spätromanischer Formen spricht auch die straffe Einspannung der nimbenumgebenen Köpfe in die Kleeblattarkaden, eine Erscheinung, für die die Taufkapelle von St. Gereon in Köln


|
Seite 251 |




|
und Methler in Westfalen Beispiele sind. Der Gnadenstuhl mit der Taube über dem oberen Kreuzende ist gleichfalls für diese Zeit charakteristisch. Das zeigt der romanische Altarvorsatz aus der Soester Wiesenkirche im Berliner Museum 11 ) und, dem Lübecker Bild noch ähnlicher, die Miniatur des Hermannpsalters 12 ). Die Gesamterscheinung ist genau dieselbe, nur der Faltenstil ist fortgeschritten.
Die Szene der Verkündigung ist in ihrer Erscheinung nicht romanisch, sondern folgt schon der gotischen Typenbildung. Der Engel mit dem nach oben gebogenen breiten Schriftband knickt leicht in die Knie, Maria neigt wie er den Kopf vor und hält die Hand in zager Abwehrbewegung erhoben 13 ). Diese früheste gotische Ausprägung der Verkündigung ist dem byzantinischen Schema noch sehr ähnlich. Von der Reihe der stehenden Heiligengestalten sind nur die Faltenmotive der Gewänder erhalten, sie entsprechen lebhaft denen der Taufkapelle von St. Gereon.
Aus diesen Wahrnehmungen ist der Schluß zulässig, daß wir es mit einer stark von spätromanischen Formen beeinflußten Malerei der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu tun haben. Die Stilherkunft scheint deutlich nach Westfalen und dem Rhein zu weisen. Weftfälisch erscheint auch die Kleeblattbogen-Arkatur mit derben Türmen, die Vierpaßrosetten als Füllung haben und deren kräftige Pyramide sich über vier Giebeln erhebt. Eine nähere Datumsbestimmung ist kaum zu wagen. Wegen der schon hauptsächlich mit Rot und Grün arbeitenden Farbigkeit kann man das Werk nicht wohl zeitlich vor die Pfeiler der Jakobikirche rücken. Aber wie schlecht fügt es sich einer Entwicklung von dem letztgenannten Werk zur Malerei des Lettners der Heiligengeistkirche ein. Die drei Werke der Wandmalerei, die unmittelbar nebeneinander in der Heiligengeistkirche slehen, bergen noch eine Fülle von ungelösten Problemen.
Kreuzigung zwischen Maria und Johannes und zwei weiblichen Heiligen. Nicht restauriert.
Wir haben die an die Rückwand gemalte "Retabel" eines heute verschwundenen Altars vor uns. Daher darf es nicht wundern, in der Malerei ein zierliches, ähnlich der Tafelmalerei mit feinem Pinsel gearbeitetes, auf nahe Sicht berechnetes Stück zu


|
Seite 252 |




|
finden, das mit den übrigen Malereien nur da gut vergleichbar ist, wo sie demselben oder einem verwandten Zweck dienen, z. B. mit der Rückwand des mittelsten Lettnerbogens der Heiligengeistkirche. Dieser Darstellung gegenüber ist der Stil erheblich fortgeschritten, er ist bewegter im Linienschwung und physiognomischer im Ausdruck geworden.
Besonders durch die letztgenannte Eigenschaft stellt die Malerei eine neue Stufe der Entwicklung dar. Dazu ist dieses Bild das erste Beispiel des im Einflußgebiet Lübecks ziemlich häufigen Typs der Kreuzigung zwischen vier Figuren, deren äußeres Paar je nach der Örtlichkeit verschiedene Heilige darstellt. In Lübeck selber ist dieses kleine Wandbild das einzige, das diesen Typ vertritt.
Die Stilhaltung hat hier nichts Zwiespältiges mehr, die westliche Gotik ist restlos rezipiert. Die Komposition ist von vollkommener Geschlossenheit, jeder Linienschwung steht in Beziehung zum ganzen Bilde. Das Lübecker Wandbild steht auf dem äußersten Höhepunkt des linearen Schwunges, der die erste Stufe der gotischen Malerei im Lande charakterisiert. Von hier aus geht der Weg zu den stilleren und körperhafteren Formen der reifen Gotik über. Auch die Farben zeigen noch die Zartheit der frühen Stufe.
Das Bild vertritt die Stufe bald nach 1350. Paul begründet durch die Baudaten eine Möglichkeit der Entstehung erst nach 1334. Wahrscheinlich aber entstand es bald darauf, denn die Umwälzung des malerischen Stils ist bald nachher auch in Lübeck vor sich gegangen.
Drei Bischöfe, nicht restauriert.
In den drei lebensgroßen Bischofsgestalten ist der Stilwandel vollzogen, und obgleich wenige Jahre zwischen dem vorigen Werk und diesem liegen, ist eine Brücke kaum zu schlagen. Der lineare Schwung hat nachgelassen, an seine Stelle ist eine stärkere körperliche Plastizität getreten. Statt der bewegten, ausdrucksstarken Linien sind weiche und stille Formen charakteristisch. Die vollere, weichere Malweise holt die Plastik der Köpfe und der Gewandfalten stark heraus, ohne daß es einer lebhaften Zeichnung bedarf. Die Farben sind milder und satter geworden, der Klang wird hauptsächlich durch ein warmes Pflanzengrün, ein Grauviolett und ein Gelbbraun gebildet. Auch die Gesichtszüge wie die Gesten sind im Gegensatz zu der Erregtheit der vorigen Stilphase regelmäßig, ruhig und sanft geworden.
Bei der Frage nach der Herkunft des Stils blicken wir zunächst wieder nach Westen. Das sanfte feminine Schönheitsideal dieser


|
Seite 253 |




|
Gestalten ist westlichen Ursprungs. In Köln finden wir nichts direkt in der Stilstufe Vergleichbares, sondern können nur feststellen, daß die Lübecker Bischöfe in der Kölner Entwicklung zwischen der Chorschrankenmalerei und den Malereien um 1370 (dem Clarenaltar und den Rathausfresken) einzureihen wären. Mit den Chorschrankenmalereien stimmt die ähnlich weich modellierende Malart und manche der mit gleicher Sorgfalt behandelten Einzelheiten überein, wie die gestickten Borten der Alben, die in der Kölner Malerei am Kleide des mit Joachim redenden Engels wiederkehren, und das krabbenbesetzte reiche Pedum. Ähnlich ist mit der Chorschrankenmalerei auch die rahmende Arkatur mit drei konsolengetragenen Bögen, doch mit dem Unterschied, daß das Kölner Werk flaches Maßwerk, das Lübecker perspektivisch vertiefte Gewölbe darstellt. Paul möchte daraus einen böhmischen Zusammenhang folgern. Böhmische Zusammenhänge sind nicht feststellbar, wohl aber solche mit französischer Buchmalerei; womit zugleich die Vermutung Pauls ihre Begründung finden wird, denn von Frankreich entlehnte Böhmen ebenso wie Nordwestdeutschland die neuen Formen.
Eine Miniatur der Pariser Vie de St. Denis 14 ) zeigt eine sehr ähnliche Faltenbildung und auch die hier auftretende ganz steile Form der Mitra. Ebenso sind vergleichbare Züge in den Grandes Chroniques de France aufzustellen 15 ). Bei beiden Handschriften kehrt der vornehme und schmale Kopftypus wieder, die Haar- und Barttracht ist ähnlich.
Es ist also wahrscheinlich, daß in dem Lübecker Wandbild unmittelbarer französischer Einfluß geltend ist, der durch einen im Westen ausgebildeten und von dort zugereisten Maler ausgeführt wurde. Er scheint direkt aus der Einflußsphäre von Paris gekommen zu sein, nicht aber von Köln, wo eine andersartige Malerei herrschte. Für die Datierung gilt nach der Baugeschichte nur der Termin nach 1354. Mit der Kreuzigung im Unterchor ist sie stilistisch kaum vergleichbar, so groß ist der Unterschied. Aber diese ist ja auch von einem Lübecker, die andere wohl von einem aus Frankreich kommenden Maler; da wäre selbst Gleichzeitigkeit nicht unmöglich. Immerhin dürfte das Bischofsbild etwas später sein und um 1370 herum datiert werden können.
Die besprochenen Wandmalereien Lübecks bieten ein sehr wenig abgerundetes, ja ein verwirrendes Bild. Die Laune des Schicksals,


|
Seite 254 |




|
die uns einige zusammenhanglose Stücke aus der Fülle dessen, was einst da war, erhalten hat, ist nur zum Teil verantwortlich zu machen. Tatsächlich ist die Wandmalerei Lübecks sehr buntscheckig. Es ist eine Zeit der Rezeption, Lübeck holt die Anregungen von Westfalen, vom Rhein, über See von den Niederlanden und von England, um sie in seinen Mauern zu einem eigenen Stil zusammenzuschmelzen unter Mitwirkung romanischer Elemente niedersächsischen und westfälischen Ursprungs. Als Haupteigenschaften des hier ausgebildeten Stils sind hohe Monumentalität, Herbheit und dekorative Pracht zu nennen. Statuarisch ist die Haltung der Figuren, die meistens ohne Handlung dargestellt werden. Die Malerei ist streng linear, mehr noch im weiteren Wirkungskreise Lübecks, als in der Metropole selber, es wird eine Kraft und Ausdrucksfähigkeit der Umrißlinie erreicht, die oft erschütternd wirkt. Der seelische Gehalt ist ernst und streng in provinzieller Ausführung oft etwas hölzern und langweilig.
Für das gesamte Ostseegebiet ist Lübeck im späteren Mittelalter der ausstrahlende Mittelpunkt. In allen Küstenländern sind die Spuren dieses Einflusses zu verfolgen, ebenso an der deutschen und baltischen Küste bis Reval hinauf, wie in Dänemark, Schonen und Schweden. Die Malereien der Domkirche von Strängnäs in Schweden wie die der Oesterlarskirche auf Bornholm, eine Vorhalle des Doms zu Riga wie die Chorgewölbe des Schleswiger Doms lassen lübische Beeinflussung bemerken. Daß die Seestädte des wendischen Quartiers zur engstem Gefolgschaft Lübecks gehören, ist begreiflich. Deutlich
Schwerin, Dom, nördliche Marienkapelle.
Einzelfiguren in Kreismedaillons. Nicht restauriert.
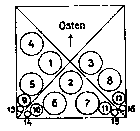
|
|


|
Seite 255 |




|
|
Die Aufteilung der Gewölbekappen durch Kreismedaillons und ihre Füllung mit thronenden Figuren geht auf die Malerei des Chorgewölbes des Braunschweiger Doms zurück. Dort finden sich dieselben Farben für Medaillons, Ranken und Gewölbegrund verwendet. Die Schweriner Malerei stellt eine Übersetzung dieser Formen ins Gotische dar. Die Figuren sind in kontrapostischer, gezierter Weise bewegt, die Thronlehnen haben statt der Pfosten mit Knäufen Fialen erhalten. Die gezierte, feinschwingende Bewegtheit der Figuren hat etwas Ornamentales, spielerisch Graziöses, und geht völlig in diese Aufgabe auf. Dieser Geist spielerisch tändelnden Figurenornaments ist Westdeutschland, besonders dem Rheinlande, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eigentümlich. Von den Kölner Domchorstühlen bis zu den Chorschrankenmalereien blüht er und lebt sich in Deutschland, wie im Westen, am stärksten in der Buchmalerei, besonders den illustrierten Romanen und Minnedichtungen, aus. Ein Einfluß dieser Kunstgattung muß bei der Schweriner Malerei angenommen werden.
Die Frage: Wo vollzog sich die Verschmelzung der Braunschweiger romanischen mit den westlich gotischen Formen, läßt an Lübeck denken. Ein indirekter Beweis liegt in einer von Lübeck deutlich abhängigen Malerei in der Nordvorhalle des Doms von Riga 16 ), wo sich auf einem Wandstreifen ebenfalls von Ranken begleitete Rundmedaillons mit sitzenden Figuren darin finden. Stilistisch ist das Schweriner Werk mit den kleinfigurigen Szenen der Pfeilermalereien der Lübecker Jakobikirche verwandt, nur etwas jünger in der Gesamthaltung, der Schwung weicher und hemmungsloser.
Es ist infolgedessen die Datierung der Schweriner Malerei in die Nähe der Jakobipfeiler zu rücken, vielleicht auch schon zwischen 1330 bis 1340. Baugeschichtlich ist dies nicht unwahrscheinlich, da die Kapelle wie die gesamte Osthälfte des Doms 1327 vollendet ist 17 ).
Jugendszenen aus dem Leben Christi, Fragment, nicht rest.
Das Fragment der Südwand zeigt einen zierlichen, schlankgliedrigen Rahmenbau von zwei mit Korbbögen gedeckten Ge-


|
Seite 256 |




|
schossen, die architektonischen Glieder sind hellgrau, die umschlossenen Felder blau (das untere grün, vielleicht aber ursprünglich auch blau). Links von diesem System ein ungegliedertes, orangefarbenes Feld mit Ranken. Der starke rote untere Begrenzungsstreifen und die seitliche Anlehnung an jetzt vermauerte Fenster, dazu Reste einer gleichartigen Malerei an der Westwand machen die Annahme eines um alle Wände laufenden friesartigen Zyklus wahrscheinlich; ein ähnlicher spätgotischer Zyklus oberhalb des beschriebenen ist in größerem Umfange aufgedeckt, für ihn dürfte der ältere als Vorbild gedient baben.
Das obere Rahmenfeld enthält die Darstellung im Tempel, das untere wahrscheinlich die Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel. Im freien Felde links ein Prophetenbrustbild. Majuskelbeischriften begleiten die Bilder.
Der Charakter ist von einer miniaturhaften Zierlichkeit, feiner Zeichnung und vielfach abgetönter, sanfter Farbigkeit. Der Geschmack der Nonnen geht hier ebenso wie noch öfters (z. B. in Wienhausen) aufs Zarte und Zierliche. Die Arbeit hängt eng mit lübischer Kunst zusammen. Der Vergleich mit dem wahrscheinlich lübischen Fronleichnamsaltar in Doberan (siehe Paul) zeigt engeren Zusammenhang. Die Darstellung im Tempel ist dort sehr ähnlich. Es fehlt an beiden Stücken nicht der Knabe mit der gedrehten Kerze. Nach dem unvollkommenen Bruchteil an der Westwand zu urteilen, war dort eine Mahlszene dargestellt, man erkennt eine runde, tuchbedeckte Tafel in derselben Darstellungsart wie auf der Abendmahlstafel in Doberan, die sicher derselben Werkstatt entstammt wie der Fronleichnamsaltar. Die Art der Faltenbildung ist an dem Rehnaer ebenso wie an den beiden Doberaner Werken etwas sackig und schwerfällig, und ähnlich ist hier und dort eine gewisse Geschrobenheit und Geziertheit in Stellung und Geste. Der Neigung zu architektonischer Rahmenbildung in Rehna entsprechen die Arkaden um die sitzenden Propheten beim Doberaner Altar. Auch die Vierpaßrosette tritt an beiden Stellen als Füllung auf. So ist auch für Rehna lübische Arbeit anzunehmen.
Der Stil ist, wie in Lübecks Malerei um diesen Zeitpunkt allgemein, überwiegend von Köln her beeinflußt. Die obere Szene hat die gebräuchliche Ikonographie, die untere mit ihrem eigenartigen Ciborienaufbau findet eine gewisse Analogie in der Gewölbemalerei von St. Maria Lyskirchen in Köln bei der Szene der Geburt Christi 18 ). Auffallend viele Einzelteile finden sich da


|
Seite 257 |




|
wieder, der Aufbau von Taufbecken und Bogen dahinter entspricht dem "Altar" mit Ciborium in Rehna, rechts sitzt Maria im Bett, ein aufgeschlagenes Buch in der Hand, in Rehna entsprechend der Hohepriester. Und selbst das Krüglein, dort in der Hand einer Dienerin, findet sich hier in den Händen des Elternpaares. Also scheinbar eine übertragene Anwendung von älteren Kölner Typen. Die architektonische Umrahmung der Szenen mit ihrer Fialen- und Krabbenbekrönung erinnert an englische Buchmalerei, die bei einem Kloster, in dessen Besitz eine englische oder flandrische Prachthandschrift wohl möglich ist, leicht einen Einfluß ausüben konnte.
Die Datierung muß infolge der vorgeschrittenen Stilstufe etwas später als die Doberaner Altäre angesetzt werden. Paul datiert diese um 1340; so kann die Rehnaer Malerei um 1350 entstanden sein.
Fragmente, Tierbilder im Chorgewölbe, restauriert.
An der Nordwand eine nur zur Hälfte und nur in Umrißlinien erhaltene Marienkrönung. Sie gehört der hauptsächlich von Köln beeinflußten Lübecker Kunst um 1340 bis 1350 an.
An der Ostwand rechts vom Triumphbogen eine fragmentarische, genreartige Szene, läutende Glöckner, ein Beispiel der fast ganz verschwundenen Profanmalerei der Zeit, ähnlich den Randdrolerien der Buchkunst.
Im Chorgewölbe nimmt jede Kappenmitte eine zierliche Figur oder Figurengruppe ein, die Ostkappe das Lamm mit der Siegesfahne in der Rundscheibe, die Nordkappe zwei im Turnier gegeneinanderrennende Ritter, die Südkappe Löwe und Drache einander gegenüberstehend, die Westkappe der Hirsch, vom Hunde verfolgt. Hier scheint eine Einwirkung westfälischer Malereien erkennbar zu sein. Typen der westlich gotischen Buchmalerei, wie die Ritter auf gestrecktem Pferde, verbinden sich mit romanisch-westfälischen, dem Lamm in der Rundscheibe und den Drachengestalten in der Art der Gewölbe von St. Maria zur Höhe in Soest. Die Malerei hat den Übergangscharakter noch nicht abgestreift, eine Entstehung um 1330 bis 1340 ist wahrscheinlich.
Gewölbe des Langhauses. Martyrien der Apostel, biblische Szenen und Legenden. Nicht restauriert.
| 1-12. | Martyrium der Apostel. |
| 13-16. | Martyrium Katharinas. |
| 17-20. | Martyrium Johannes des Täufers. |


|
Seite 258 |




|
| 21-24. | Vier Martyrienszenen. |
| 25-28. | Vier Prophetenpaare. |
| 29-32. | Vier ritterliche Heilige zu Pferde. |
| 33-36. | Alttestamentliche Szenen (David und Goliath, Simson und der Löwe u. a.). |
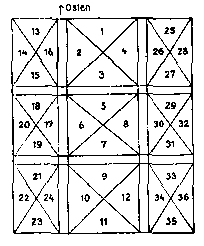
Die Gurtbögen nehmen Ranken- und andere Ornamente ein, reich mit Figuren, Tieren und Drolerien durchsetzt.
In der unrestauriert gebliebenen Büchener Malerei ist uns ein höchst originelles und wertvolles Denkmal früher gotischer Kunst erhalten. Die Malerei stellt einen neuartigen Typ dar. Eine solche Füllung aller Gewölbe und Gurte durch bewegte Szenen zu einer bunten flimmernden Teppichwirkung widerspricht der bisher betrachteten gehaltenen und streng komponierenden Kunst. Es ist deutlich, daß hier gegenüber der disziplinierten und an strenge Gesetzmäßigkeit gewöhnten Malerei Lübecks eine unbekümmerte Bauernkunst waltet, die sich der Fülle und Buntheit der Bilder freut und im einzelnen gegen Derbheiten nicht empfindlich ist.
Daß volkstümliche Züge mitsprechen, ergibt die Feststellung romanisch-niedersächsischer Erinnerungen. Die Bilder des Johannesmartyriums lehnen sich an die entsprechenden Darstellungen im Braunschweiger Dom an. Mit der Braunschweiger Fassung stimmt die Tafelszene bis in Einzelheiten überein, nur sind die Formen in die Gotik übertragen. Auch die anderen Szenen, die gegenüber der in ein Bild zusammengezogenen romanischen Fassung hier getrennt sind, sind dort vorbildlich, z. B. die Enthauptung; die Form des Kerkerturms findet sich in Braunschweig in den bekrönenden Zwergarchitekturen wieder.
Ein weiterer, mit dem niedersächsischen Übergangsstil zusammenhängender Zug ist das Auftreten reich gemusterter Gewänder (Quedlinburger Altaraufsatz, Goslarer Antependium) 19 ). In Büchen haben sie bedeutenden Anteil an der Gesamtwirkung; es sind Kreis- und Rautenmuster byzantinischen Ursprungs, sowie gotische Streifenmuster, für welche Wienhausen ein niedersächsi-


|
Seite 259 |




|
sches Beispiel in der frühen Gotik bietet. Einzelne Bewegungsmotive der Figuren zeigen noch lebhafte Anlehnung an die Braunschweiger Malerei.
Neben diesen Archaismen herrscht die gotische Formgebung aber entschieden vor. Es ist die zierliche, graziöse Formenwelt der westdeutschen Buchmalerei der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Auf höfische Eleganz und Zierlichkeit kommt es in der Hauptsache an. Dementsprechend ist die eckige und hartbrüchige Linienführung des Spätromanismus durch den fließenden Schwung der Gotik ersetzt. Die Büchener Malerei bietet ein sehr lebensvolles Beispiel, wie organisch und schmiegsam diese Formen wirken neben dem fast Akademischen des Spätromanismus. Den formalen Umschwung bezeichnet auch eine eigentümlich primitive Perspektive ohne einheitlichen Sehwinkel. Die Figuren stehen zum Teil scheinbar regellos auf dem Fußboden oder in der Luft. Diese primitive Reduktion in die Fläche steht im Gegensatz zu der festen räumlichen Anschauung der spätromanischen Zeit.
Die Gaukler und Drolerien der Gurtbögen weisen auf die Buchmalerei hin. Von den Handschriften nähert sich der Kasseler Wilhelm von Oranse am meisten dem Charakter der Büchener Malerei, daneben möchte man die Manesse-Handschrift und andere rheinische und westdeutsche Stücke zum Vergleich heranziehen. Diesen und der Büchener Malerei ist in gleicher Weise die lebendige Bewegtheit der Szenen eigen, das Bevorzugen der Zeittracht mit ihren Modeeigentümlichkeiten, die gleiche Darstellungsart der Pferde: am liebsten im gestreckten Galopp, beim Schritt an dem auf den Boden gesetzten Vorderbein ein Gelenk zu wenig. Dazu kommen einzelne Darstellungstypen in gleicher Weise am Wilhelm von Oranse und in Büchen vor, die Tafelszene mit Musikanten, der Typ des Königs ähnlich dem zur Seite der Büchener Martyrienszenen. Die Szenen des Simson mit dem Löwen und des David und Goliath finden sich in entsprechender Ikonographie an einem Gurtbogen im Chor des Schleswiger Doms. Auch dort gehen sie wahrscheinlich auf Buchmalereien zurück, wie das spielerische Motiv eines am Bildrande aufgehängten Mantels vermuten läßt.
Von den schon besprochenen gotischen Malereien steht Büchen am nächsten die der Schweriner Marienkapelle, wo derselbe Miniaturencharakter, freilich in feinerer, kultivierter Ausführung, zutage tritt. Daneben legen die Martyrienszenen einen Vergleich mit der Malerei von St. Jakobi in Lübeck nahe. Trotz der dort strengeren und herberen Formen ist eine ungefähre Gleichzeitigkeit annehmbar. Wir kommen so auf eine Ansetzung zwischen


|
Seite 260 |




|
1330 bis 1340. Von Lübeck ist wohl nur eine allgemeine Abhängigkeit anzunehmen.
Ost- und Nordwand des Langhauses. Weltgericht und Apostel. Restauriert. Abb. S. 315.
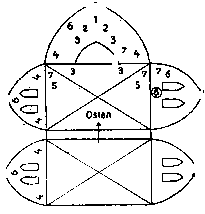
|
|
Die Berkenthiner Malerei zeigt sich als ein Werk von ähnlicher dekorativer Gesinnung wie Büchen, auch sind manche Einzelformen im Figürlichen wie im Ornament direkt von Büchen abgeleitet. Aber der Darstellungskreis ist ganz anders angeordnet. Eine so monumentale Komposition, wie die Verbindung des Weltgerichts der Ostwand mit den großen Apostelgestalten, die, ursprünglich natürlich zwölf an der Zahl, sich auch an der Süd- und Westwand fortsetzten, ist ein Neues und wird bedeutenden Vorbildern nachgeschaffen sein, die wir, für die Apostel ist es klar, in Lübeck suchen müssen. Die Apostelreihe ist eine freie Nachbildung derjenigen der Lübecker Jakobikirche. Man merkt das Bestreben, den ernsten, monumentalen und dabei bäurisch derben und knochigen Charakter wiederzugeben. Auch die einfache Haltung der Gewandung ist zum Teil aus diesem Streben verständlich.
Dagegen hängt die Ostwand mit der Kompositionsweise französischer Portaltympana zusammen. Hier zuerst tritt der an den gotischen Portalen stets wiederkehrende Christus mit den erhobenen Händen und den Schwertern am Munde auf, dazu die Deesis, die posaunenblasenden Engel und die aus den Gräbern steigenden Toten. Da dieser Christustyp zuerst in Hamburger und Lübecker Stadtrechtshandschriften vorkommt (Hamburg 1301, Lübeck 1348), so besteht die Möglichkeit, daß durch die Miniatur die Übertragung aus dem Westen stattgefunden hat. Wahrscheinlich ist aber das Vorbild für Berkenthin ein nicht erhaltenes Lübecker Wandbild gewesen. Der französische Weltrichter-


|
Seite 261 |




|
typ ist um diese Zeit im Ostseegebiet nicht vereinzelt (siehe Rostock). Daß neben Büchen Lübecker Wandmalereien dem Maler zum Vorbilde dienten, beweist die bortenbesetzte Tunika der Engel und die die senkrechte Konturlinie unterbrechenden Hangfalten, Eigenschaften, die von der Lettnermalerei der Heiligengeistkirche herstammen.
Eigenartig sind die auferstehenden Toten, die aus hochbeinigen Gestellen herausklettern. Sie müssen wohl der Buchmalerei entstammen, wie die spielerische Zierlichkeit des Motivs vermuten läßt. Denselben Schluß legt die bizarre Bildung der Evangelistensymbole nahe. Für die Grabgestelle läßt eine flandrische Miniatur aus einem Antiphonar von Beaupré 20 ) und das Portaltympanon von St. Omer 21 ), wo ein Toter aus einem mit Füßen versehenen Gefäß steigt, den Schluß zu, daß die Form aus Flandern kommt.
Berkenthin muß ein gutes Stück später datiert werden als die Büchener Malerei und die des Lübecker Lettners. Der Charakter ist provinziell zurückgeblieben und derbe, und man darf sich durch die noch frühen Typen nicht täuschen lassen. Die Kronen zweier weiblicher Heiligen, des Restes der ehemaligen Chorausmalung, gleichzeitig mit der Langschiffmalerei, zeigen eine ausladende Form, die in die zweite Hälfte des Jahrhunderts weist. Auch die Gewandhaltung mit ihrer von Schwingung freien, mehr schlaff hängenden Anordnung ist fortgeschritten. Wir möchten daher die Malerei um die Mitte der zweiten Jahrhunderthälfte ansetzen.
Chorgewölbe, jüngstes Gericht, Reste. Zum Teil restauriert.
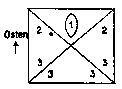
|
|
Von der einst reichen Ausmalung sind an den Wänden des Chors und des Langhauses nur dürftige Reste übrig geblieben. Im Chor waren es Reihen von Standfiguren unter Kleeblattarkaden, im Schiff größere Apostelfiguren. Die Figuren des Chorgewölbes sind ebenfalls außer dem restaurierten Christus nur schwach erkennbar. Sie haben, wie es scheint, am meisten Ähnlichkeit mit der Malerei des Lettners der Heiligengeistkirche. Zarte und gerundete Formen zeichnen die Malerei aus, der weiche Fall


|
Seite 262 |




|
des Mantels ist der Lettnermalerei entsprechend, auch die weiten Ärmel und die Haarbehandlung. Ähnlich ist das Motiv der posaunenblasenden Engel gestaltet. Die Flügel der Engel sind quergeftreift wie in Berkenthin, das diesen Zug, da es jünger ist, von Behlendorf übernommen haben wird.
Die Beziehung zu Westfalen, die wir bei der Lettnermalerei ahnten, ist hier noch greifbarer. Die breit schwellende Mandorla und der gestirnte Grund deuten darauf, ganz unzweifelhaft aber das sehr reiche Ornament, mit dem alle architektonischen Gliederungen, Gurte und Leibungen bemalt sind. Dieselbe reiche Umrahmung der Fensternischen und dieselben Bandmuster, Rauten, Palmetten und Ranken finden sich in St. Maria zur Höhe in Soest und dem benachbarten Weslarn 22 ).
Die Datierung kann nach den frühen Formen ungefähr gleichzeitig mit der Lettnermalerei, um 1350, angesetzt werden.
Maria und Stifter, Apostel und Heilige. Restauriert. Abbildungen S. 315 und Schlie II, S. 570.
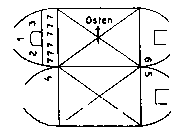
|
|
Die Malerei zeigt mit Berkenthin in der Komposition verwandte Züge. Die symmetrisch aufgebaute Schildbogenwand mit der thronenden Maria zwischen zwei Stiftern entspricht der Ostwand in Berkenthin, die Wandflächen zu Seiten der Fenster werden wie dort von monumentalen Einzelgestalten eingenommen, von denen nur drei erhalten sind. In der stilistischen Haltung und der Oualitätsstufe besteht aber ein großer Unterschied. Das Schweriner Werk entspricht den Ansprüchen eines Domkapitels und ist den lübischen Malereien ebenbürtig.
Der Stil hängt von der rheinischen Malerei ab. Mehrere für das Rheinland charakteristische Typen finden sich vor, z. B. die thronende Maria mit dem Kinde, für die in der kölnischen Kunst die Robinson-Madonna (Diptychon um 1350) des Kaiser-Friedrich-Museums ein Beispiel ist, deren Typus im Rheinlande aber sehr verbreitet ist (Beispiele auf mittelrheinischen Siegeln bei Back,


|
Seite 263 |




|
mittelrheinische Kunst, Tafel 30, 3 und 4). Derselben Gattung festgeprägter Typen gehört die Katharina an, die in dieser Form mit geziert auf der Handfläche balanciertem Rade und der leicht am Schwertknauf ruhenden anderen Hand auch im Ostseegebiet durch Lübecks Vermittlung allgemein verbreitet ist. Bei beiden Gestalten ist ein starker linearer Schwung vorhanden und die ideale Typik überwiegt noch vollständig, dagegen lassen die übrigen Gestalten, Paulus, Johannes und die Stifter, schon stark die Wandlung ins Beruhigte und Körperliche erkennen, die wir im Oberchor der Katharinenkirche feststellen konnten. Die Schweriner Malerei steht noch in einem Übergangszustand zwischen beiden Stufen. Die Herrschaft der linearen Stufe ist auch beim Johannes und Paulus noch nicht gebrochen, aber es fehlt schon gänzlich die Körperschwingung, die Linie hat schon mehr eine dem körperlichen Eindruck dienende als selbstherrliche Funktion. Die Malweise ist nach der Restaurierung nicht mehr rein erkennbar, aber auch in ihr scheint im Zusammenhang mit der schlaffer fallenden Gewandung eine weichere Modellierung eingetreten zu sein.
Ein stofflich neues Feld beschreitet die Schweriner Malerei mit der Darstellung der beiden knienden Stifterfiguren. Bisher ist die linke derselben als weiblich angesehen worden. Dagegen spricht entschieden die priesterliche Tracht, Kasel mit Kragen, die als Frauentracht unmöglich ist. Der Kopfschmuck mit Schleier ist wohl bei der Restauration hinzugefügt. Wahrscheinlich stellt die Figur einen Bischof oder Domherren dar.
Die Propheten der Bogenleibung, in der heutigen Erscheinung und auch wohl ursprünglich skizzenhafter und flüchtiger, weisen gleichfalls nach Westen; sie haben etwas von der in Flandern und am Rhein starken Neigung zum Grotesken in Haltung und Geste. (Prophetengestalten an flandrischen Bronzeplatten). Die realistisch wirkenden Köpfe mit den phantastischen Kopfbedeckungen erinnern schon an die Prophetenköpfe im Hansasaal des Kölner Rathauses.
Hauptsächlich besteht also eine Abhängigkeit von der rheinischen Kunst. Außerdem könnte noch eine Beziehung zu Böhmen bestehen. Die Kronenform der Maria, die der Glatzer Madonna (Berlin) in ihrer breit ausladenden Form entspricht, und der Edelsteinbesatz an Kronen, Mitren und Schwertgriffen, auch der sackige Fall der Gewänder bei den knienden Stiftern sind dafür anzuführen. Im ganzen herrschen aber die rheinischen Formen unbeschränkt. Auch das Fliesenmuster kehrt in Köln wieder, und die knienden Stifter sind dort häufig anzutreffen. Wahrscheinlich ist, daß der Maler von Lübeck nach Schwerin kam. Für Lübeck spricht


|
Seite 264 |




|
die Verwendung der kurzen eingerollten Krabbenranke längs der Rippen, eines für lübischen Einfluß charakteristischen Ornaments.
Die Datierung ist, da wir ältere und jüngere Formen nebeneinander verwendet finden, nach den jüngsten zu bestimmen. Da in der Komposition Ähnlichkeit mit Berkenthin besteht und die Prophetenköpfe mit denen des Kölner Rathauses Ähnlichkeiten aufweisen, ist eine Entstehung zwischen 1370 und 1380 wahrscheinlich.
Die weiteren Malereien des Schweriner Doms: vier Figuren an der Ostseite der beiden mittelsten Chorpfeiler um 1400, sehr zerstört und für die stilistische Untersuchung ungeeignet, und das Christushaupt mit zwei Engeln am Triumphbogen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, können hier nicht behandelt werden.
Den einer einst reicheren Ausmalung sind nur die beiden monumentalen Gestalten an der Nord- und Südseite eines Gurtbogens übrig geblieben. Die verschwundenen Bilder 23 ) waren Martyriendarstellungen ähnlich St. Jakobi in Lübeck oder Büchen, und eine Kreuzigung zwischen vier Figuren, sie weisen also ikonographisch auf Lübeck.
Die Vermutung lübischen Einflusses wird durch die beiden erhaltenen Figuren bestätigt. Die überschlanken, in starkem linearen Rhythmus bewegten Gestalten zeigen sich am nächsten mit den von Paul behandelten und dort abgebildeten Wandmalereien der Stralsunder Nikolaikirche (auferstehender Christus, Christophorus) verwandt. Das Bewegungsmotiv des dortigen Christophorus ist hier beim Michael entsprechend, die Form der Brustschließe ist ähnlich, auch das bogenförmige Hinüberziehen des Mantels vor dem Leibe und sonstige Faltenmotive. Auch der Gesichtstyp mit der langen Nase, dem kleinen Mund und den unter gleichmäßig geschwungenen Brauen gelangweilt blickenden Augen zeigt den Zusammenhang, daneben finden sich im Marienkopf noch deutliche Anklänge an Braunschweiger Typen; Erinnerungen an niedersächsische Spätromantik sind in der von Lübeck ausgehenden Gotik immer wieder zu beobachten. Der Drache ist im Umriß mit den romanischen Drachen am Gewölbe des Kapitelsaals von Brauweiler verwandt. Rheinischen Ursprung, in der Lübecker Einflußsphäre nicht verwunderlich, verraten manche Einzelheiten, wie das lebhaft bewegte Kind auf Marias Arm.


|
Seite 265 |




|
Da der lübische Einfluß sich in Gägelow in so unmittelbarer Form äußert, ist diese Malerei, die geographisch östlich der Trennungslinie Wismarsche Bucht-Schweriner See liegt, dennoch beim westlichen Landesteil zu behandeln.
Die Datierung muß in die gleiche Zeit fallen wie die der Stralsunder Bilder. Paul vermutet für diese eine Entstehung in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Lieber möchten wir beide Malereien infolge des voll ausgeprägten und stark bewegten Linearstils um 1350 ansetzen.
Kreuzigung zwischen zwei Engeln, Christophorus, restauriert.
Die einzige Wandmalerei des 14. Jahrhunderts, die Wismar bewahrt, gibt nicht gerade einen sehr hohen Begriff von seiner damaligen malerischen Kultur, im Gegensatz zu seiner großen Bedeutung im 15. Jahrhundert. Das überlebensgroße Kruzifix der Ostwand zeigt den stark gebrochenen Typ der westlichen Frühgotik der in Lübeck ebenfalls in der Jakobikirche und im Unterchor der Katharinenkirche auftritt. Der wismarsche Christus steht einer auf 1348 datierten Kreuzigung in der Domsakristei in Konstanz am nächsten, deren kölnische Herkunft Vitzthum nachgewiesen hat. Beide geographisch so weit entfernten Stücke müssen auf eine ähnliche Tradition zurückgehen. Die wismarsche Malerei ist mittelmäßig, die Formen von teigiger Breite, besonders die Zeichnung der Füße weicht gegenüber der für diesen Typ geltenden Regel ab. Das beginnende Streben nach Rundung der Formen läßt diese Malerei in zeitliche Parallele mit der des Schweriner Kapitelhauses rücken. Ihr entspricht die noch lineare, aber mit der Absicht auf körperliche Rundung gegebene Behandlung des runden Lockenhaars der Engel, des zerklüfteten Lendentuches Christi. Mit den Schweriner Stiftern ist die Gewandbehandlung um die Unterschenkel der knienden Engel vergleichbar, es legt sich sackig um die Körperformen und bedeckt die Fersen. Hierin spricht sich schon ein Übergang zu Gewandformen, wie sie als Hauptvertreter Bertram gibt, schüchtern aus. Doch herrscht im allgemeinen noch unbeschränkt ein abstrakter Linearstil, wie das unvermittelte Stehen der knienden Engelfiguren vor der weißen Wand ohne Andeutung einer Bodenfläche, die auch in halber Höhe des Kreuzesstammes nicht möglich wäre, beweist. Auch Sonne und Mond über den Kreuzarmen zeigen, daß von einer Abweichung von älteren Formen keine Rede ist, sondern diese möglichst konservativ beibehalten werden. Die Beeinflussung von Lübeck ist nach der Lage Wismars


|
Seite 266 |




|
und dem sonstigen künstlerischen Verhältnis beider Städte wahrscheinlich. Die Kölner Formen werden durch Lübeck vermittelt sein. Die Rundung der Faltenzüge und manche Einzelheiten, wie die rauchfaßschwingenden Engel, und Sonne und Mond über dem Kreuzbalken, erinnern an die Lettnermalerei der Lübecker Heiligengeistkirche.
Auch der Christophorus geht wahrscheinlich auf ein lübisches Beispiel zurück, das aber nicht erhalten ist. Dagegen können wir ihn mit dem Christophorus der Stralsunder Nikolaikirche vergleichen. Im Verhältnis zu ihm ist der wismarsche Christophorus aber wieder eine vergröbernde, plumpe Nachbildung, die mit dem feinlinigen Stralsunder Bilde nur die allgemeine Umrißlinie gemeinsam hat. Eine eigentümliche Form ist die pilzförmige Krone des Baums, die zu den sonst vorherrschenden naturalistischen Blätterbüscheln im Gegensatz steht. Die Haltung des Kindes, das mit beiden Händen in Haar und Bart des Christophorus spielt, findet sich ähnlich an rheinischen romanischen Christophorusbildern 24 ) und dem der Petrikirche in Soest. Das schlängelige Faltenspiel des Mantels rechts und der vorn sich breitende runde Hang erinnern wieder an die Lübecker Lettnermalerei und an Motive westfälischer Buchmalerei der frühen Gotik 25 ).
Es mögen hier einige Worte über die Herkunft der in der norddeutschen Malerei so verbreiteten Christophorusdarstellung Platz finden. Wo diese Figur entstanden ist, darüber muß eine Spezialuntersuchung Aufschluß geben. Im 13. Jahrhundert findet er sich in Niedersachsen (Wandmalerei von Melverode, Buchmalerei s. Haseloff), im Rheinland, in Flandern und England. Auf welchem Wege kommt er ins Ostseegebiet? Der Lübecker Christophorus in der Jakobikirche zeigt gewisse ähnliche Züge mit dem von Melverode, der wismarsche Christophorus der Wrangelkapelle verrät in Einzelheiten, wie in den Fabelwesen im Wasser, Verwandtschaft mit dem von Wienhausen. Wie es scheint, hat also die Ostseeküste die Christophorusdarstellung von Niedersachsen her übernommen. An der Küste wurden wohl die Naturbeobachtung verratenden Abbilder von Scholle und Dorsch, sowie (in Stralsund) des Hummers hinzugefügt.
Die Malerei der Wrangelkapelle trägt den Charakter der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Parallele mit dem Schweriner Kapitelhaus ist in mehreren Stücken durchzuführen, auch dort herrscht dieselbe Übergangsstufe zur freieren malerischen


|
Seite 267 |




|
Behandlung, dabei noch das zähe Festhalten an der strengen linearen Malerei der ersten gotischen Periode. Nur ist die wismarsche Malerei um einige Grade roher. Wir dürfen sie etwa in die gleiche Zeit setzen, um 1370 bis 1380.
Breite zyklische Darstellung des apostolischen Glaubensbekenntnisses in sechs dreiteiligen Nischen. Restauriert. Abb. S. 316.
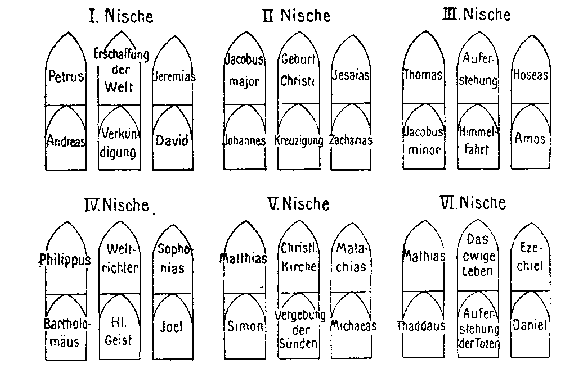
Die Nischen sind durch drei kleinere Blenden geteilt, die stets zwei Bilder übereinander enthalten, also in jeder der sechs Nischen sechs Bildfelder. Die mittelste Blende enthält die inhaltliche Darstellung, die linke Einzelgestalten der Apostel mit einem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses auf dem Schriftband, die rechte Einzelgestalten von Propheten mit Sprüchen auf den Schriftbändern.
Die Malerei stellt einen uns nicht gewohnten Typ dar. Eine so kleinteilige und dabei streng systematische Anordnung, ein wirkliches feierliches Credo, muß ein Erzeugnis gelehrter Klosterfrömmigkeit sein. Es wird seine erste Ausprägung in der Miniaturmalerei erhalten haben. Eine gewisse Ähnlichkeit im Charakter besteht mit der oben behandelten Rehnaer Malerei, die ebenfalls einem Kloster angehört.
Die Nischeneinteilung möchte man mit der Glasmalerei in Verbindung bringen, aus der auch die verschiedenfarbige Behandlung der durch die unteren Bögen gebildeten Zwickelfelder erklärt werden kann. Der Stilcharakter steht, soweit heute noch zu prüfen, noch verhältnismäßig der frühen Gotik nahe, und nur die Übertreibung des Schwunges und der Bewegung zeigt die zweite Hälfte des Jahrhunderts an. Die Gestalten sind plebejischer und derber


|
Seite 268 |




|
geworden, sie haben stark gelockte dicke Köpfe und untersetzte, übermäßig verrenkte Körper und gestikulieren eckig und gewaltsam. Sie erscheinen den Figuren an der Mensa des Hochaltars des Kölner Doms und ihnen nahestehenden westfälischen Plastiken verwandt.
Die Ableitung einer Reihe von Bildern der Mittelfelder macht Schwierigkeiten. Die meisten von ihnen sind zwar durchaus dem Charakter der nordfranzösischen und kölnischen Frühgotik verwandt, z. B. die Kreuzigung, die Auferstehung, die Geburt Christi und die Verkündigung. Dagegen sind ungewöhnlich die schwebende Taube des Heiligen Geistes, die Darstellung des Meßopfers (Ecclesia catholica), die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und der Christus in der Glorie (Vita aeterna). Für mehrere dieser Szenen sind die Vorbilder in der Miniatur zu suchen. Die spielerisch leichte Behandlung des vor der Mandorla schwebendenThrons, vor dessen Fußende die Weltkugel erscheint (Vita aeterna), läßt an diese Herkunft denken; den Eindruck verstärkt die knappe Einbeziehung der Nebenfiguren, wie in den Raum eines Initials. Die Auferstehung der Toten ähnelt dem gleichen Felde des Klosterneuburger Altaraufsatzes, deutet also auf französische Herkunft dieser Fassung, die sehr gut durch Miniaturen vermittelt sein kann. Die Szene des Meßopfers findet sich als Mittelbild des Kölner Clarenaltars wieder, ist aber schon eher an der Maas und am Niederrhein verbreitet, wie ein aus Lüttich stammendes gesticktes Antependium aus der Mitte des 14. Jahrhunderts im Museum in Brüssel zeigt 26 ). Dieses Stück zeigt mit der Ratzeburger Darstellung ganz auffallende Ähnlichkeit, so daß die Herkunft der Typen vielleicht des ganzen Zyklus von Flandern wahrscheinlich wird. Die seitlich am Boden schleppenden Gewandenden, etwa des Weltrichters, sind die nordfranzöfisch-flandrischen Formen, die dann in der Kunst eines Broederlam, daneben auch in der böhmischen Malerei durch den Meister von Wittingau weiter ausgebildet werden. Sie bestärken den Zusammenhang mit Flandern. Eng mit diesem Lande hängt Ostengland künstlerisch zusammen. Einige Züge sprechen für eine Einwirkung von dieser Seite. Die architektonische Einteilung mit den derben bunten Türmen, die über dem Zinnenkranz Kegeldächer und um die Mauer herumlaufend derbe Wulste zeigen, ist englischer Buchkunst eigen und findet sich in Ratzeburg wieder. Auch die Begleitung des Hauptbildes durch mehrere übereinander in architektonisch gerahmten Seitenfeldern angeordnete Einzelfiguren ist eine


|
Seite 269 |




|
hier wiederholte Eigenart englischer Buchmalerei (Vitzthum, Tafel 15, 18). Endlich sind diese Figuren selber in ihrer übertriebenen Schwingung und Gestik den dortigen verwandt.
Zusammenfassend stellen wir fest: Wir finden ein von engeren Parallelen sich loslösendes, durch westliche, wahrscheinlich englisch-flandrische Buchkunst beeinflußtes Werk. Die Datierung ist nach dem Figurencharakter und der Minuskelschrift in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts zu setzen. Dafür sprechen auch die wahrscheinlich gleichzeitigen Wappen zwischen den Nischen, von denen nur eins ein Bischofswappen ist, das sich auf Bischof Wiprecht von Blücher, 1356 bis 1367, bezieht, also eine Datierung um 1360 rechtfertigt. Ein anderes Bischofswappen im östlichen Kreuzgangflügel, das des Dethlev von Parkentin (1395 bis 1418), hat noch dieselbe Form, aber keinen so wahrscheinlichen Zusammenhang mit der Malerei.
Gegenüber der vielfältigen und beweglichen Entfaltung, die die Malerei im westlichen Teil des von uns behandelten Gebietes unter dem starken Einfluß der vielfachen Einflüssen offenstehenden Metropole Lübeck nimmt, geht im Osten Mecklenburgs eine in hohem Maße selbständige Entwicklung vor sich. Die Eigenschaften, die die Malerei des östlichen Landesteiles schon im Übergangsstil zeigte, eine Lust an lockerer Anordnung und Füllung der Gewölbeflächen mit einem Ring zusammenhängender Bilder, finden wir in der gotischen Zeit noch gesteigert. Beim Beginn der Gotik sind die von verschiedenen Seiten eingedrungenen Einflüsse verarbeitet, und der östliche Landesteil tritt uns in fast geschlossener Erscheinung entgegen, die nunmehr von den die Entwicklung bestimmenden Strömungen zwar berührt, aber in ihrer Wesenheit nicht verändert werden kann.
Kreuzigung, Weltgericht. Restauriert. Abb. Schlie IV, S. 146.
Die Sternberger Malerei stellt die "Retabel" der beiden verschwundenen Seitenschiffaltäre der Kirche dar und bildet somit eine Parallele zu der Kreuzigung im Unterchor der Lübecker Katharinenkirche. Das Sternberger Werk enthält in seiner strengen Anordnung und Proportionierung noch ganz romanischen Geist, und die romanischen Stilelemente treten überall stark hervor.
Die Kreuzigungsgruppe möchte man in unmittelbare Beziehung zu romanischen niedersächsischen Werken setzen, z. B. dem Triumphkreuz des Halberstädter Doms und niedersächsischen Malereien des 13. Jahrhunderts. Die kompakten und untersetzten


|
Seite 270 |




|
Proportionen und die Geschlossenheit der Gruppe, das Anlegen der Hand an den Kopf bei einer der Seitenfiguren, das in den mecklenburgischen Werken hier und in der Folge regelmäßig symmetrisch verdoppelt wird, das oben wulstig gerollte, unten zipfelig hängende, zwischen den Beinen eingetiefte Lendentuch und endlich die parallelogrammförmige Titulustafel sind Elemente niedersächsischer Kunst. Die Füße sind schon mit einem Nagel angeheftet, aber nur die Füße kreuzen sich, während die Beine nebeneinander liegen. Marias Mantelhaltung ist noch zum Teil die byzantinische, wo der Mantel von beiden Unterarmen leicht gerafft wird und von ihnen aus glatt herunterfällt; in Sternberg zeigt noch der rechte Arm diese Form, während im übrigem bei beiden Figuren schon das gotische Schema mit dem um den Ellbogen straff herumgezogenen und unter den Arm geklemmten Mantel herrscht. Die Figuren zeigen nur leichte Andeutung der Schwingung und stehen mit symmetrisch leicht auswärts gestellten Füßen, noch im Sinne des Übergangsstils.
Das Weltgericht zeigt in der Arkadenstellung zu beiden Seiten des Weltrichters romanische Anordnung rheinisch-westfälischer Färbung, und auch die breitschwellende Mandorla trägt westfälischen Charakter. Dagegen ist die Gestalt des Weltrichters von fortgeschrittenem, gotischem Typus, das älteste Beispiel des französischen Weltrichtertyps mit ausgebreiteten Händen und Schwertern am Munde, das der östliche Landesteil aufweist. Sehr elegant und flüssig wirken die Evangelistensymbole, die Tiere dem neuen Streben entsprechend in trabender Bewegung; auch die Deesisfiguren in ihrer mehr schwebenden als knienden Haltung der frühgotischen Geistigkeit gemäß.
Die kräftigen Kleeblattarkaden mit den Türmchen mit Vierpaßfüllung dazwischen deuten auf westfälischen Einfluß (Methler). Auch die kräftigen, untersetzten Apostelfiguren haben Züge romanischer Gestalten des westfälischen Kreises bewahrt; so ist die erste Figur der rechten Seite in Haltung und Gewandbehandlung mit der Magdalena im Paradies des Doms von Münster zu vergleichen. Das beiderseits verschieden hoch geraffte Mantelende, sowie die für die Sternberger Faltengebung bezeichnenden seitlich spitz herausstoßenden Falten zeigen den Zusammenhang. Im ganzen überwiegt schon das gotische Gewandschema, dessen Herkunft von Westfalen her wir nach den obigen Ausführungen annehmen dürfen. Diese Annahme wird durch die durchaus westfälische Architektur der Kirche gestützt, da wir Grund haben anzunehmen, daß die Malereien gleich nach Vollendung derselben entstanden sind.


|
Seite 271 |




|
Die sich angesichts der Arkadenrahmung des Weltgerichtbildes aufdrängende Frage nach dem Zusammenhang mit nordischer Kunst, wo solche Arkaden seitlich der Mandorla Christi besonders auf hölzernen Antependien häufiger im 13. Jahrhundert erscheinen, kann bei den Anzeichen direkter westfälischer Beeinflussung verneint werden. Das Rheinland und Westfalen üben auf die nordischen Länder und auf das Kolonisationsgebiet in gleicher Weise ihren Einfluß aus.
Ist die Kirche zwischen 1309 und 1322 vollendet 27 ) so wird die Malerei, da beide erhaltenen Stücke von einer Hand sind und annehmen lassen, daß sie zur ersten Ausstattung gehören, gleich im Anschluß daran geschaffen sein.
Passionsszenen und Weltgericht, restauriert. Abb. Schlie IV, Seite 110, 111.
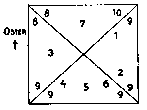
|
|
Die Malerei von Bernitt ist das älteste erhaltene Beispiel der zyklisch fortschreitend erzählenden Malerei, die für die östliche Landeshälfte nunmehr charakteristisch wird. Hier kann die Herkunft dieser Kunst gut verfolgt werden. Mit der im ersten Teil behandelten Malerei von Lüdershagen ist die lockere ringförmige Anordnung gemeinsam, auch der Weltrichter zwischen Petrus und Paulus und die Flügelstellung der Evangelistensymbole gehen darauf zurück.
Neu ist die erzählende Folge von Szenen, die ziemlich in der Zeitfolge gereiht um das Gewölbe herumlaufen. Ein neues Prinzip kommt mit dieser stofflichen Neuordnung in die Wandmalerei. Wir können logisch eine Entstehung dieser Erscheinung mit Notwendigkeit aus der Buchkunst ableiten. Nach Mecklenburg aber kommt sie durch die Vermittlung der niedersächsischen Wandmalerei, wie an dem Bernitter und Teterower Werk nachzuweisen sein wird.


|
Seite 272 |




|
Das Hauptbeispiel der frühgotischen Wandmalerei in Niedersachsen ist Wienhausen bei Celle (Nonnenchor des Cisterzienserinnen-Klosters) 28 ). In mehreren Szenen ist die Typik die gleiche wie dort; die schlanke Säule, an welche Christus bei der Geißelung gefesselt ist, aber bis zu deren Fuß er nicht herabreicht, die Haltung Christi und der Knechte ist an beiden Stellen ähnlich. Die Kreuztragung, die Auferstehung, das Noli me tangere und besonders die Limbusszene sprechen für die Beziehung beider Orte zueinander. Bei der Kreuztragung ist neben der Haltung Christi und seiner Anordnung zwischen den Begleitern besonders der voranschreitende Knecht mit Strick und Hammer gleichartig. Bei der Auferstehung ist die Gesamtgruppe, die Gestalt Christi und die hockenden Wächter sehr verwandt. Die Limbusszene mit dem Höllenrachen tritt hier zuerst in der Wandmalerei des Landes auf. Der hellgelbe Rachen, der rote Flammen aus Maul, Nüstern und Ohren speit, geht auf Wienhausen im Typus zurück. Der Teufel hat wie dort hellgrau gestricheltes Fell, und an beiden Stellen finden sich bei den Teufeln Widderhörner. Für die Gestaltung des Höllenrachens finden sich die nächsten Analogien in der niedersächsischen und von ihr abhängigen Buchmalerei 29 ). In der Farbengebung herrschen wie in Wienhausen zarte, blasse Farben vor. Die für Wienhausen charakteristische Mi-parti-Färbung bei Kleidern wird in Bernitt selbst auf Säule, Axt- und Geißelstiel ausgedehnt.
Nach so weitgehenden Übereinstimmungen ist an einer Abhängigkeit von niedersächsischer zyklischer Wandmalerei nicht zu zweifeln. Da außer Wienhausen in Niedersachsen selber nicht viel von der Gattung erhalten zu sein scheint, so können wir über den Weg, auf den diese Beeinflussung erfolgte, und über Zwischenglieder nichts aussagen. Daß aber von Niedersachsen ein Einfluß in dieser Richtung ausging, ist sicher; mußten wir doch auch das Beispiel im Westen des Gebietes, das Ansätze zu erzählender Folge


|
Seite 273 |




|
zeigte, Büchen in Lauenburg, mit Niedersachsen in Verbindung bringen. Die zu beiden Seiten der wieder sehr niedersächsisch wirkenden Kreuzigungsgruppe stehenden zwei weiteren Heiligen, Bartholomäus und Jakobus, sind eine typische Erscheinung im hansischen Kunstkreise, wie im binnenländischen Gebiet Mecklenburgs (Lübeck, Stralsund, Gägelow, Bernitt, Teterow). Auch Diese Anordnung wird aus der romanischen Kunst Niedersachsens ihre Abkunft herleiten.
Westlich gotischen Geist atmen die Zwickelfiguren, die der Neigung des neuen Stils zum Drôlerien- und Groteskenwesen Rechnung tragen. Die beiden fliegenden bewaffneten Frauen sind inhaltlich schwer erklärbar, möglicherweise bilden sie eine Analogie zu den reitenden Hexen des Schleswiger Doms. Der betrügerische Weinschenk, den der Teufel in den Klauen hat, ist aber eine in Literatur und Volksvorstellung der Zeit lebendige Figur.
So ist Bernitt ein Angelpunkt, der das Eindringen eines von nun ab in Ostmecklenburg sich ausbreitenden Typs zeigt. Die Datierung läßt zuerst das Verhältnis zu der Malerei von St. Marien in Röbel ins Auge fassen; es ist indessen bei der schlechten Überlieferung der Röbeler Malerei nicht möglich, zu erklären, welches von beiden Werken das ältere ist. Wahrscheinlich ist aber anzunehmen, daß Bernitt älter und um 1350 zu datieren ist. Trotz einiger romanisierender Nachklänge, z. B. in den Drachengestalten, ist es konsequent frühgotisch in der Formensprache ("früh" relativ für das Ostseegebiet), und ist bei Berücksichtigung seiner handwerklichen Derbheit den um 1350 anzusetzenden Malereien der Stralsunder Nikolaikirche (abgebildet bei Paul) zeitlich nahe zu rücken.
Kreuzigung und einzelne Szenen. Überdeckt. Abb. Schlie V, S. 482-85.
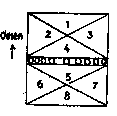
|
|
Im Anschluß an Bernitt reihen wir ein Werk ein, das leider bald nach seiner Aufdeckung wieder unter einer weißen Tünche verschwunden ist und uns nur in den klassizierenden Zeichnungen


|
Seite 274 |




|
Schumachers im Schweriner Museum erhalten ist. Es stellt wegen des vielfach rätselhaften Charakters dieser Überlieferung eine wahre Sphinx für die historische Forschung dar. Bald möchte man dem Urteil Lischs, der die Malerei ins 13. Jahrhundert setzte, zustimmen, bald ist man versucht, sie ins 15. Jahrhundert zu rücken. Volle Klarheit kann sich erst ergeben, wenn es einmal möglich sein sollte, die alte Malerei wieder freizulegen und zu erhalten. Jedenfalls greift die Datierung Lischs ins 13. Jahrhundert zu weit zurück. Wohl aber hat die Ansetzung in die Mitte des 14. Jahrhunderts als erstes vorwiegend gotisches, noch mit romanischen Elementen stark behaftetes Werk die höchste Wahrscheinlichkeit. Überraschend ist die Leichtigkeit und Lockerheit der Komposition, die vor allem, zusammen mit dem Rankenwerk, eine gewisse Ähnlichkeit mit Werken des 15. Jahrhunderts ergibt.
Zunächst fällt die Rankenbildung auf. Eine solche spiralische Ranke finden wir ähnlich in Braunschweig, freilich kompositionell anders verwendet und mit natürlicheren Blättern besetzt, aber es ist dieselbe saftige, mit einer gewissen elastischen Spannung geschwungene Spiralranke. Die nächste Analogie im Ornament wie im Bestienwesen bildet eine westfälische Malereiengruppe des 13. Jahrhunderts, St. Marien zur Höhe in Soest (Langhausgewölbe) und Weslarn bei Soest. Dem Röbeler Weihekreuz entsprechen gleiche Kreuze auf einem Gurtbogen in Weslarn, das lebhaft sich vordrängende Bestien- und Teufelswesen ist beiden Stellen gemeinsam. Eine Ähnlichkeit besteht zwischen den zweibeinigen, geflügelten und gehörnten Drachen in St. Maria zur Höhe und dem Röbeler Georgsdrachen. Die Spitze, geschlossene Flügelform und die rundballigen Füße sind gut vergleichbar. Dennoch ist die Formensprache in Röbel um einen starken Grad verändert und vorgeschritten.
Die anfangs festgestellte Gleichartigkeit der Ranken mit Braunschweig leitet zur Untersuchung der Figur über. Diese ist überaus schwierig, da ihre Wiedergabe durch die Zeichnungen offenbar sehr verderbt ist. Die Kleidung wird von merkwürdig seitlich auseinanderfallenden symmetrischen Falten und Saumzügen beherrscht, für die sich nur sehr ungewisse Anhalte gewinnen lassen. Die weibliche Heilige (2) ist mit der thronenden Kaiserin Helena in Braunschweig wegen der taschenartigen Hänge um die Arme zu vergleichen, und der entsprechende männliche Heilige mit dem Henker des heiligen Blasius dort in der eigenartig auseinanderstrebenden Faltenbildung. Die seitlich spitz herausstechenden Faltenhänge dürfen als eine handwerklich vergröberte Ableitung


|
Seite 275 |




|
von spätromanischen Formen aufgefaßt werden, und ebenso die eigenartige glockenförmige Verbreiterung des Gewandes am Boden. Dem Braunschweiger Spätromanismus steht der Gottvater des Rundbildes im Scheitel des östlichen Gewölbes nahe, und auch der niederschwebende Engel mit Spruchband, der in Röbel über der Kreuzigung erscheint, ist in Braunschweig häufig nachzuweisen. Der kleine frontale anbetende Engel mit den ausgebreiteten Flügeln ist von den mächtigen Engeln in den Schildbogenflächen des südlichen Querschiffs des Braunschweiger Doms abzuleiten. An noch ältere romanische Vorbilder erinnert der mit ganz wagerechten Armen ruhig hängende Christus am Kreuz, dessen untere Hälfte leider zerstört war, so daß auch seine Gestalt nicht ganz zur Aufhellung der um das Röbeler Werk schwebenden Fragen herangezogen werden kann. Man wird an niedersächsische Triumphkreuze am ersten bei seinem Anblick denken, z. B. die Triumphkreuze des Doms und der Liebfrauenkirche in Halberstadt. Die Malerei des Gurtbogens zwischen den beiden Jochen ist ebenfalls aus spätromanischer Tradition, hauptsächlich des Rheinlandes und Westfalens, zu erklären.
Die Gotik, die für den Gesamteindruck ohne Frage bestimmend ist, ist in den Einzelzügen schlecht greifbar. Die Gewandhaltung zeigt nicht die durchgehende Schwingung der frühen Gotik. Wohl aber ist allgemein eine weiche Rundung und Schmiegsamkeit der Linien zu bemerken. Eine bewußte Aufnahme des neuen Stils ist nicht erfolgt. Der reitende St. Georg trägt den langen Waffenrock der frühen Gotik, aber sein Pferd ist nicht in gestrecktem Galopp, sondern in kurzer Sprungstellung gegeben. Es ist etwa dieselbe Stellung, die die Pferde in der Petschower Malerei zeigen. Der König oder Ritter (6) mit seinem offenen, schlicht fallenden Mantel und der gespreizten Beinstellung erweckt zunächst den Eindruck einer Figur des frühen 15. Jahrhunderts, doch kehrt diese Mantelform und steife, gefrorene Haltung in Petschow (drei Jungfrauen der Nikolauslegende) sehr ähnlich wieder. Auch die nackte menschliche Gestalt, die von dem Höllentier verschlungen wird, erinnert an die Menschen der Petschower Hölle.
Einige ikonographische Fragen bleiben noch zu lösen. Die zwei kleinen Gestalten seitlich des Kreuzes werden von Lisch als Joseph von Arimathia und Maria Magdalena oder als Donatorenpaar erklärt. Die letztere Erklärung ist unmöglich wegen der bewegten Haltung der Gestalten; eher als die erste Hypothese ist die Erklärung als Longinus und Stephaton oder, wie in Wienhausen, Longinus und der Hauptmann glaublich, nur scheitert sie an dem


|
Seite 276 |




|
ausgesprochen weiblichen Charakter der rechten Figur. Endlich kommt als Möglichkeit, die aber auch innerhalb der Malerei des Landes vereinzelt darstünde, die Erklärung als Ecclesia und Synagoge hinzu. Auch hierfür fehlen alle Anhaltspunkte. Wir müssen uns bescheiden, daß nach den Schumacherschen Zeichnungen ein Urteil nicht möglich ist, und auf ein Wiedererstehen der Bilder hoffen. Die zweite ikonographische Frage betrifft das dreiköpfige Ungeheuer, das Lisch als das apokalyptische Tier erklärt, das aber eher als eine groteske Darstellung des Teufels zu gelten hat, zugleich als Höllenrachen aufgefaßt, der einen nackten Menschen verschlingt. Wir begegnen dieser phantastischen Kategorie von Tieren ähnlich in Bernitt, wo mit den fliegenden Amazonen auch die Flügelform des Röbeler Drachen übereinstimmt.
Nur mit großer Vorsicht kann man eine Datierung des Röbeler Werks wagen. Es scheint Bernitt nicht fern zu stehen. Die lockere, unbekümmerte Anordnung und manche Einzelheiten sprechen für ungefähre Gleichzeitigkeit. Zugleich sind mehrere Motive dem Petschower Werk ähnlich, so daß wir die Malerei zwischen beiden Werken ansetzen möchten. Mit Petschow hat das Röbeler Werk das ruhige Fortarbeiten auf der spätromanischen Basis gemeinsam und ebenso die Freiheit der stofflichen Disposition, die in Röbel ohne nähere Parallele dasteht. Endlich setzt Röbel, wie später Petschow, die schon in den frühesten Malereien beobachtete Größenverschiedenheit der Figuren fort, die größten sind den Rippen benachbart, die kleinste stehen in der Mitte der Kappe. Wir müssen uns trotz der starken Romanismen zu einer Datierung nach 1350, zwischen 1360 und 1380, entschließen.
Alt- und neutestamentlicher Zyklus, Weltgericht und Marienkrönung. Restauriert. Abb. Schlie V, S. 16-18.
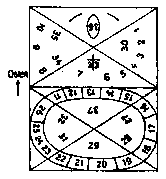
|
|


|
Seite 277 |




|
|
|
Die Teterower Gewölbemalerei bedeutet eine Weiterentwicklung des Typs von Bernitt ins Reiche und Komplizierte. Hier ist nicht mehr ein einzelnes Gewölbejoch, sondern das gesamte Gewölbe des zweijochigen Chors durch einen zusammenhängenden Zyklus malerisch gefüllt, die Anordnung ist reich und wohlberechnet geworden, die dekorative Wirkung von einzigartiger gehaltener Pracht, der auf den beiden Gewölben abgewickelte Darstellungskreis von vollendeter Geschlossenheit.
Ein dreifacher Kreis von Darstellungen zieht sich um die Schlußsteine beider Gewölbe, ein engerer Kreis mit größeren, ein weiterer mit kleineren figürlichen Szenen, dazu in den Zwickeln Drôlerien, Drachen und Wappenhalter und an einer unsichtigen Ecke der erhängte Judas. In jedem der Gewölbejoche ist aber das System in anderem Rahmen gegeben, im westlichen durch einen starren Ring, der innen und außen von getreppten schwarzweißen Bändern begrenzt wird und den äußeren Figurenkreis zu einem ornamentalen Gebilde zusammenschließt, im östlichen ohne jeden Rahmen; dort bilden allein die in strenger Disziplin angeordneten Figuren die Gliederung des Gewölbes. In beiden Jochen ist durchgehend die Hauptachse durch formal und inhaltlich besonders betonte Bilder hervorgehoben.
In noch weitergehendem Maße als Bernitt zeigt sich Teterow von dem durch Wienhausen vorzugsweise verkörperten niedersächsischen Kunstkreise beeinflußt. Die Schöpfung ist in Teterow, wie in Wienhausen, durch Kreisschemata dargestellt, neben denen links die Gestalt Gottvaters in redender Bewegung erscheint. Entsprechend dem geringen Raum, der in Teterow zur Verfügung steht, ist die Reihe der Schöpfungsszenen abgekürzt, auch ist die Auf-


|
Seite 278 |




|
fassung weit gröber und an dichterischen Gedanken ärmer, als in Wienhausen. Das Kreisschema wird, sobald es lästig ist, in Teterow aufgegeben, und die Schöpfung der Tiere und Menschen vollzieht sich ohne Einengung in die Kreisscheibe. Beim Sündenfall weicht Teterow dadurch ab, daß die Schlange keinen Menschenkopf hat, wie es in Niedersachsen schon romanische Tradition ist. Bei der Versuchungsszene wird der Tempel wie in Wienhausen als zweitürmige Kirche dargestellt; die Szene des Einzuges in Jerusalem zeigt den Esel in gleicher Haltung mit gesenktem Kopf und zeigt auch denselben Hagel von Palmblättern, der Christus empfängt. Von den Passionsszenen ist die Szene vor Pilatus mit der Handwaschung ähnlich, ebenso die Auferstehung und das Limbusbild. Das Weltgericht zeigt, wie in Wienhausen, das Tribunal der heiligen Märtyrer, hier die 12 Apostel zu Seiten des Richters. Neben den ikonographischen Vergleichspunkten ist die formale Gesamthaltung sehr verwandt. Die leicht geschwungenen schlanken Gestalten, sowie die naive und drastisch erzählende Komposition, die nur in Teterow etwas steifer und wortkarger ist, sowie die Haltung des Gewandes mit konventioneller Faltengebung und gelegentlicher breiter Streifen- oder Mi-parti-Musterung zeigen deutlich den Zusammenhang.
Wenn auch abgeschwächt, verrät die Teterower Malerei doch einen Hauch französischen Geistes, der die Berührung mit französisch beeinflußten Zyklen, die in Norddeutschland mehrfach anzutreffen waren, von denen der große Zyklus im Schleswiger Domkreuzgang noch vorhanden ist, wahrscheinlich macht 30 ). Mit ihm zeigt die Teterower Malerei in mehreren Szenen ähnliche Haltung, wie bei der Krönung Marias, den reitenden und anbetenden Königen sowie einer Reihe von Einzelheiten in der Gewandhaltung und im Beiwerk wie in der Szenenkomposition. Überall durchdringen sich französische Formen mit den niedersächsischen.
Eigentümlich ist die Kreuzigung, die statt der eckig gebrochenen Christusfigur eine wenig gebogene mit fast geraden Beinen und eigenartig geformtem, plumpem Lendentuch erscheinen läßt, deren Form wohl am leichtesten mit dem Weiterleben des so fest eingewurzelten niedersächsisch-romanischen Typs erklärt wird. Die vier Seitenfiguren fehlen nicht. Über dem Kreuzbalken treten hier, wohl auch niedersächsischen Vorbildern entnommen, trauernde Engelhalbfiguren auf. Das Weltgericht zeigt die Bereicherung des hergebrachten Typus durch Figuren französisch-gotischer Portalkompositionen, die Engel mit den Leidenswerkzeugen und die


|
Seite 279 |




|
Apostel als Beisitzer. Die Anordnung auf der Gewölbekappe zeigt, daß dem Maler das Bild von Tympanon und Leibungsfiguren vorschwebt.
Das lustige geschwänzte Volk der Drôlerien und Drachen in den Zwickeln, die Weiterentwicklung der Bernitter Drachenwesen, sowie der hängende Judas haben ihr Vorbild wohl vor allem in der gotischen Buchmalerei.
Gegenüber Bernitt ist Teterow das vorgeschrittenere Werk, das die dort schüchtern angeschlagenen Akkorde voll ertönen läßt. Eine zeitliche Übereinstimmung besteht mit der Kreuzigung im Unterchor der Lübecker Katharinenkirche mit ihren voll ausschwingenden Gestalten. So möchten wir die Teterower Malerei in Übereinstimmung mit Schlies Deutung der Wappen in der östlichen Kappe (Schlie V, S. 17, Anm. 2) um 1350 bis 1360 datieren. Die Rüstung der Schildträger deutet eher noch auf die Mitte als auf das Ende des Jahrhunderts hin.
Neutestamentlicher Zyklus, Weltgericht, Nikolauslegende, Christophorus. Restauriert; der Wandfries neue Zutat. Abb. S. 317 und Schlie I (2), Tafel S. 432/33, 434/35.
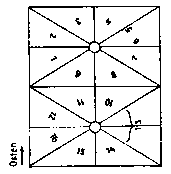
|
|
In den Zwickeln stehende Heiligenfiguren mit Attributen, sowie einzelne Heiligenszenen (St. Martin und der Bettler), an der Ostwand seitlich des Triumphbogens links Christophorus, rechts Kreuzigung; über den Weihekreuzen der Längswände in sechs Rundmedaillons die Brustbilder der Evangelisten, das Lamm mit der Siegesfahne, der Gnadenstuhl.


|
Seite 280 |




|
Die Malerei von Petschow fügt sich als weiter vorgeschrittenes Werk neben Bernitt und St. Marien in Röbel in dieselbe Entwicklungsreihe ein. Es sind trotz der großen Eigenart und Eigenwilligkeit dieser Arbeit genug Züge zu erkennen, die auf einheimische Tradition zurückgehen. Der lockere Ring von Szenen und Figuren entspricht in seiner Anordnung auf dem Gewölbe der Bernitter Malerei, mit der auch die derben Spruchbänder mit Majuskelschrift und die Inschrift SANCTUS übereinstimmen. Der Eindruck ist bereichert durch einen Kranz ornamentaler Blütenzweige um die Gewölbescheitel. An die Röbeler Malerei erinnert der Typ der Figuren in Haartracht und Faltengebung, die Pferdedarstellung und der Kreuzigungstyp mit ganz wagerechten, auf der Mitte der Kreuzbalken liegenden Armen. Auch zeigt Petschow wie Röbel die schon in der romanisierenden ostmecklenburgischen Malerei angetroffene Erscheinung, daß die Figuren nahe den Diagonalrippen größer sind als in der Nähe der Seitenmitte.
Petschow läßt aufs neue erkennen, daß in der ostmecklenburgischen Malerei weniger westliche als südliche Strömungen herrschen. Eine Menge von Einzelzügen beweist, daß für Petschow der Braunschweiger Kunstkreis, besonders das spätromanische Melverode bei Braunschweig, der Ausgangspunkt des Stils ist. Einzelne Figuren und Gruppen scheinen zu dem Schluß aufzufordern, daß der Petschower Maler das Melveroder Werk gekannt hat. Die Kreuzigungsgruppe und die gekrönte Maria mit dem Kinde in der Beschneidungsszene stimmen mit dortigen Darstellungen in der Gesamthaltung überein. Mit Malereien des Braunschweiger Doms zeigen verwandte Züge die Auferstehungsszene durch die weit ausgreifende Geste Christi und sein keilförmiges Vordringen zwischen die schlafenden Wächter, sowie die byzantinische Haltung der zu Boden gesunkenen Magdalena in der Noli-me-tangere-Szene.
Die Figuren sind sehr lang und überschlank mit kleinen Köpfen, es fehlt fast ganz die der westlichen Gotik eigene Körperschwingung, das Gewand fällt mit sparsamer, schlichter Faltenbildung ohne die um die Mitte des Jahrhunderts gewöhnliche Betonung wagerechter Faltenzüge herab. Die Saum- und Zipfelbildung hat außer der ruhigen vertikalen Hängetendenz die Neigung, die Schlängellinie des Saums zur spitzen Zickzacklinie umzubilden.Von der dekorativen, strengen Faltenbehandlung westlicher Gotik ist wenig zu spüren, dagegen begegnen überall Nachwirkungen byzantinischer Gewandformen, deren Herkunft aus dem an byzantinisierenden Malereien so reichen Niedersachsen zweifellos erscheint. Die meisten Szenen sind in ihrer Gesamtkomposition


|
Seite 281 |




|
schon in der niedersächsischen Buchmalerei vorgebildet, wie ein Vergleich der Verkündigung, der Geburt Christi, der Frauen am Grabe, des Noli me tangere und des heiligen Martin mit entsprechenden Bildern der von Haseloff zusammengestellten Handschriftengruppe des 13. Jahrhunderts zeigt. Die ebenfalls von Niedersachsen stammende Limbusszene ist hier in sehr reicher Ausführung gegeben; neu in unserem Kunstkreise ist der im Höllenrachen thronende Höllenfürst, dessen Herkunft hier im Dunkel bleibt, vielleicht, wie manche andere Bildungen in Petschow, aus der Anschauung geistlicher Schauspiele zu erklären ist. Nikolausszenen finden sich in Melverode, auch im Küstengebiet, schon in früheren Werken (vgl. Mölln, erster Teil); der Christophorus, der uns hier zuerst in einer Dorfkirche entgegentritt, ist ebenfalls in Niedersachsen lange heimisch (Melverode, Wienhausen).
Besonderes Interesse verdient die Petschower Darstellung des Weltgerichts, die formal wie inhaltlich von den bisherigen Fassungen abweicht. Zunächst ist von der herkömmlichen zentrischen Formulierung unter dem Zwang der Mittelrippe, aber auch infolge der Gleichgültigkeit des Malers gegen die hieratische Form abgewichen. Ist schon die Verlegung dieses wichtigsten Stoffes auf das westliche, am wenigsten betonte Gewölbejoch auffallend, so noch mehr, daß der Maler den Weltrichter untergeordnet behandelt, dagegen gleich neben demselben seiner Erzählerlust freien Lauf läßt und mit großer Anschaulichkeit und drastischen Einzelzügen die Auferstehung der Toten, die Abführung der Verdammten in die Hölle und diese selbst mit ihren Qualen schildert. Dagegen fehlen ganz die Gegenstücke der Seligen und des Paradieses, für welche der Maler zwei Szenen der Nikolauslegende eingeschoben hat.
Der reiche Apparat des Weltgerichts, die Engel mit Leidenswerkzeugen, die posaunenblasenden Engel und die breite Schilderung der Vorgänge haben ihren Ursprung im Westen, den figurenreichen Weltgerichtspforten der französischen Kathedralen. In Petschow verbindet sich Niedersächsisch-Romanisches (der Weltrichter) mit westlich-gotischen Zügen (Auferstehung der Toten, Abführung der Verdammten unter Differenzierung der Stände). Die Auferstehung der Toten hat die ganze Frische der plastischen Vorbilder bewahrt, die lebendig bewegten Figuren erwecken in ihrer naiven und stark empfundenen Menschlichkeit unbedingte Teilnahme. Bei der Abführung zur Hölle ist die Schilderung packend und drastisch, nicht ohne soziale Parteinahme gegen den stolzen Ritter wie gegen den betrügerischen Schneider, ein schätzbares Dokument volkstümlichen Empfindens jener Zeit. Das Höllenbild


|
Seite 282 |




|
endlich bekrönt die Eigenart des Werkes. Zum erstenmal in unserer Gruppe werden aus der Volksphantasie geborene Schreckensbilder in so realistischer Weise dargestellt. Natürlich gehen diese Szenen auf Gesehenes zurück. Die romanische Malerei der Marienkirche zu Bergen auf Rügen bringt ein bis in Einzelheiten ähnliches Höllenbild, und dieses oder ein verwandtes Vorbild muß dem Petschower Maler bekannt gewesen sein. Auch in der englischen Buchkunst und der italienischen Malerei der Zeit waren Darstellungen der Höllenstrafen häufig, Petschow ist das erste Beispiel typisch mecklenburgischer Ausprägung; dieser eingehende objektive Realismus mit einem Zug von Humor (besonders in der Gestaltung der Teufel) wird sich noch mehrmals wiederfinden.
Die Zwickelfiguren mit ihrem etwas steifen, gleichförmigen Aussehen, die Attribute ostentativ neben sich emporhaltend, finden sich in Petschow zum erstenmal ausgeprägt, wie sie in den nun folgenden Werken gleichmäßig wiederkehren. In Petschow ist ihr steifes Wesen nicht weiter auffällig, da es mit dem der übrigen Figuren in den offiziellen Szenen übereinstimmt. Erst wo das offizielle Programm aufhört, entfaltet der Maler seine eigenwillige Schöpferphantasie.
Die Datierung des Petschower Werkes muß in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts und warscheinlich schon in das letzte Viertel gesetzt werden. Gegenüber Teterow ist eine völlige Stilwandlung eingetreten: Statt des strengen Reliefstils ist hier ein schon mit Tiefenillusion rechnender Stil zu erkennen. Analogien formaler und ikonographischer Art mit Berkenthin in Lauenburg bestimmen uns, das Petschower Werk ebenfalls zwischen 1370 und 1380, wenn nicht noch etwas später, anzusetzen.
Malerei an Wänden und Gewölbe des Chors. Zyklus des alten und neuen Testaments, Christophorus. Restauriert. Abb. Schlie I (1), S. 327 ff., Tafel S. 334; (2) S. 333 ff., Tafel S. 340/41.
|
|


|
Seite 283 |




|
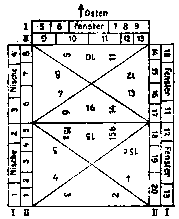
|
|
|
|
|
|
Die Malerei des Chors von Toitenwinkel, das Werk, das die zyklische Malerei in der breitesten Ausdehnung zeigt, ist von den vorher behandelten Stücken am meisten mit Teterow verwandt, das eine ähnlich wohlüberlegte Verteilung auszeichnet; auch in den Einzelszenen nimmt Toitenwinkel vielfach Züge des älteren Werkes auf. Wie in Teterow, ist im Gewölbe die Mittelachse durch formal und inhaltlich hervorragende Szenen betont. Mit Petschow ist als verbindendes Moment die Aufnahme der Zwickelfiguren festzustellen, während im übrigen der stärkste Gegensatz in der Gesamthaltung besteht.


|
Seite 284 |




|
Mehr noch als die vorher behandelten Malereien fordert Toitenwinkel zu einem Vergleich mit Wienhausen heraus. Das ganze System des niedersächsischen Beispiels ist hier übernommen; Zwei Wandfriese übereinander und Gewölbemalerei. Selbst die großen Nischenfiguren der Nordseite des Nonnenchors von Wienhausen finden hier im Christophorus ihre Parallele. Eine Untersuchung der Einzelformen ergibt, daß eine Reihe von Wienhausener Formen hier frisch rezipiert auftreten, die Geißelung im Charakter des Wienhausener Gegenstücks, beim Sündenfall hier zuerst die Schlange mit Menschenkopf. Der Höllenrachen zeigt hier eine bis ins einzelne gehende Verwandtschaft mit dem Wiesenhausener, die Limbusszene bringt die am Boden liegenden Torflügel, die Opferung Isaaks den auf dem Altar knienden Knaben in lebhafter Übereinstimmung mit dem dortigen Werk. Auch das häufige Hinzutreten von Engeln zu den Szenen ist neu und findet in Wienhausen seine Vorbilder. Es ist also wohl sicher, daß der Maler von Toitenwinkel das niedersächsische Werk kannte. Niedersächsische Züge in den häufig bildrahmenden Architekturen (Braunschweig, Wienhausen) und besonders in der Typenbildung (Anklänge an die niedersächsischen Buchmalereien des 13. Jahrhunderts) vollenden den Eindruck einer hauptsächlich von dort her überlieferten Formenwelt. Hiermit verbindet sich eine merkliche Beeinflussung durch die ebenfalls ganz aus niederfsächsischer Tradition erwachsene frühgotische Fünte der Rostocker Marienkirche, von deren Reliefs die Toitenwinkeler Malerei manche Züge entlehnt.
Eine weitere Quelle des überreichen Szenenschatzes ist, wie deutlich erkennbar wird, die englische Buchmalerei. Der englische St. Omer-Psalter um 1325 31 ) zeigt die Szenen des Baues der Arche, der Trunkenheit Noahs und der Arbeit in ganz ähnlicher Fassung. Da schon das eine Blatt der Handschrift so viele Vergleichspunkte ergibt, so dürfte eine Durchführung des Vergleichs weit mehr Resultate bringen.
Eine dritte Ableitung hat der heute halb verdeckte Christophorus. Er entspricht dem frühgotischen hansischen Idealtyp und berechtigt zu der Annahme, daß wir in ihm die Kopie eines Rostocker Wandbildes des 14. Jahrhunderts zu sehen haben.
Diese Feststellungen fassen indessen nur eine Seite der Toitenwinkeler Malerei. Man muß zugeben, daß hier ein Werk von unvergleichlicher Eigenart geschaffen ist, gegenüber dessen Ein-


|
Seite 285 |




|
druckswucht die gefundenen Anlehnungen ganz bedeutungslos werden. Das Verhältnis der Figuren zur Wand und zum Raum hat sich kompliziert. Es ist nicht mehr, wie noch in Petschow, möglich, mit einem Blick den Raum und seine Malereien aufzunehmen. In Toitenwinkel ist der anfängliche Eindruck der des Chors in seinem räumlichen und farbigen Wohllaut, aber ohne Zusammenhang mit dem Einzelbilde, das in einem Eindruck teppichartiger Farbigkeit und verwirrenden Reichtums untergeht. Jedes Bild verlangt eine Einzelbetrachtung. Harte Zäsuren trennen die Einzelbilder in den Wandfriesen, und der Zyklus am starkbusigen Gewölbe ist von keinem Standpunkt aus zugleich überschaubar, vielmehr verlangt gerade dort die Zerklüftung der Bildebenen und die verschiedene Orientierung der Einzelbilder für das Ablesen der Szenenreihe einen fortwährenden Wechsel des Standpunktes. Statt des noch in Petschow herrschenden abstrakten Raums ist hier überall eine reale Räumlichkeit gegeben, eine flache, begrenzte Bühne, die eine ganz andere Einstellung zu den dargestellten Szenen fordert, als der schwebende, unbestimmte Raum von Petschow.
Eine Vertiefung in die Malerei von Toitenwinkel läßt immer mehr die Überzeugung erstarken, daß wir hier das Werk vor uns haben, mit dem der Schritt vom Mittelalter zu jener Übergangsstufe zur modernen Welt, als welche das 15. Jahrhundert anzusehen ist, gemacht wird. In allen Figuren und Szenen sind wir Zeuge der Emanzipation von der traditionellen Typik, des Einsetzens einer individuellen Auffassung und eines hier noch schüchternen und zaghaften Naturstudiums. Der Kampf herrscht zwischen der Gebundenheit an die mittelalterliche Typik und dem Geltendmachen des neu erwachten Interesses an der umgebenden Sinnenwelt. Wir betreten also in Toitenwinkel die Welt, als deren erster Repräsentant uns Bertram erscheint. Und tatsächlich finden wir in der unsicheren Haltung der Figuren, ihrer noch ungeschickten und gebundenen Gestik, der Gewandbehandlung, die das lineare Gewandschema des 14. Jahrhunderts preisgegeben hat und sich um plastische Rundung und Abstoßung des Schemas bemüht und doch an neuen allgemeingültigen Rezepten Halt sucht, durchaus die Entwicklungsstufe, die das Wirken Bertrams charakterisiert. Für die Wandmalerei in Toitenwinkel ist auch eine ähnliche Fragestellung gegeben: Müssen wir in diesem Werk neben dem bekannten niedersächsischen Grundton und dem soeben festgestellten, mit flandrischen Elementen gespeisten hansichen Einfluß auch süddeutsche vom böhmischen Kunstkreise abhängige Strömungen feststellen? Die Antwort muß angesichts der weicheren und stilleren, die Figur


|
Seite 286 |




|
plastisch isolierenden Umrißlinien, die die böhmische Malerei auszeichnen, und der für das Ostseeland neuartigen Faltenbildung mit schlichten, fallenden, leicht gekrümmten und streckenweise umgeschlagenen Säumen, endlich angesichts mancher Szenenkompositionen, wie des Kindermordes 32 ), in bejahendem Sinne gegeben werden. Wir befinden uns in der Zeit des wachsenden Austausches der Schuleigentümlichkeiten und daraus folgender Bildung eines allgemeinen Zeitstils, der die Grundlage für die malerischen Eroberungen des 15. Jahrhunderts bildet.
Charakteristisch für die neue beobachtende Einstellung ist der Vergleich der Rundbilder der Schöpfung mit denen von Teterow. Dort herrscht heraldische Abstraktion, hier ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, wie durch ein rundes Fernrohr gesehen. Das Verlangen, die heilige Geschichte menschlicher und mit dem Gefühl zu erfassen, führt zur Einschiebung von genreartigen Zügen, ja zu reinen Genreszenen, wie der idyllischen Familienszene im Garten Wie nach der Seite des Lieblichen, so wird auch nach der Seite des Schrecklichen eine neue Eindringlichkeit bemerkt. Die Passion Christi ist mit Mitleid erregenden Zügen ausgestattet, wie die Szene des Ölbergs und das Motiv des schlagenden Kriegsknechtes, dagegen gewinnt das Weltgericht eine schreckenerregende Realität durch die Schilderung der Auferweckung der Toten, die der Zeitsitte entsprechend in weiße Totengewänder gehüllt sind, durch Engel und Teufel.
Toitenwinkel ist also das erste hochwertige Werk im Sinne einer neuen Art, die Welt zu sehen. Da wir es mit der Stilstufe des Grabower Altars unmittelbar verbinden können und die Malerei einen durchaus fortschrittlichen Eindruck macht, so ist im Zusammenhang mit den kostümlichen Merkmalen eine Datierung zwischen 1380 und 1400, wahrscheinlich schon um die Jahrhundertwende herum, zu vertreten. Die Wappen der Michaelsdorf und Moltke, letzteres sicher gleichzeitig mit der Malerei, ergeben keinen bestimmten Zeitpunkt, ebensowenig das (nach Schlie) Woldesche Wappen im unteren Fries der Südseite.
Weltgericht in einer Bogennische der Rathausvorderwand. Durch beweglichen Klapprahmen verdeckt. Stellenweise beschädigt, nicht restauriert. Abb. Denkmalspflege 15, Seite 91.
Der Weltrichter auf dem Regenbogen in der Mandorla mit ausgebreiteten Unterarmen und zwei Schwertern am Munde


|
Seite 287 |




|
nimmt die Mitte des Bildes ein. Die Mandorla wird von vier Engeln gestützt, von denen zwei die Leidenswerkzeuge halten. Maria und Johannes knien beiderseits des Richters als Fürbitter mit ausgestrecken Unterarmen. Zwischen ihnen erscheinen noch zwei kleinere Figuren (nur eine ganz erkennbar), Opfer oder Gaben darbringend.
Das Weltrichterbild am Rathause ist das einzige Werk der Wandmalerei des 14. Jahrhunderts, das in Rostock erhalten ist, das einzige solche Werk des ganzen Landes an einem Profanbau. Durch seinen guten Erhaltungszustand und seine recht hohe Qualität ist es ein wichtiges Denkmal der heimischen Wandmalerei.
Die Darstellung des Weltgerichts war im Mittelalter an dieser Stelle, in der Rückwand der Gerichtslaube, angebracht, sehr verbreitet. Ein spätgotisches Weltgericht in ähnlichem Bogenfelde enthält das Rathaus zu Prenzlau.
Der Charakter des Rostocker Bildes in seiner ruhigen Monumentalität schließt sich an die Frühwerke der hansischen Wandmalerei an, steht dagegen den vielbilderig-redseligen Malereien der Landkirchen fern. Mit den Lübecker Malereien stimmt der blaue Grund und die reiche Verwendung von Gold (an Nimben und Gewandsäumen) und Silber (an den Schwertklingen) überein. Wie schon die genannten Eigenschaften an die Lettnermalerei der Lübecker Heiligengeistkirche erinnern, so auch die Rundung der Konturen und der plastisch klare Gewandstil mit weichgerundeten Säumen und halbweiten Ärmeln. Kopf und Schultern des Weltrichters in Rostock und des Auferstehenden und des Weltrichters am Lübecker Lettner zeigen denselben gerundeten Umriß, das schlicht gescheitelte Haar ist dort ähnlich wie hier.
Das Rostocker Werk ist um mehrere Jahrzehnte jünger als das Lübecker und zeigt das Eindringen neuer Formen, deren Ausgangspunkt wahrscheinlich im Westen, in Flandern und Nordfrankreich, zu suchen ist. Es sind elegante, leichtflüssige Linien und Formen und ein Ausdruck von zarter Hingabe in den gerundeten, sich leise neigenden Köpfen; ebenso ist die starre Monumentalität der Hauptfigur den westlichen Vorbildern durchaus eigentümlich. Auf westlichen Import läßt auch die ganze Anordnung des gemalten Bogenfeldes, das wie das Tympanon eines französischen Portals behandelt ist, schließen. Dagegen ist die Frage nach böhmischem Einfluß nicht so unbedingt zu bejahen.Von den Einflüssen des deutschen Binnenlandes scheint dieses Werk doch ziemisch unberührt, und die sicherlich vorhandene Einwirkung des italienischen Trecento, die ruhige, abgeschlossene Körperlichkeit der


|
Seite 288 |




|
Figuren, die auf eine böhmische Beeinflussung gedeutet werden könnte, ist auch durch die flandrische Kunst erklärbar. Für den Westen spricht die kühle Eleganz und formale Sicherheit, ferner die Isoliertheit des Werkes gegenüber dem Festlande, dagegen die leichte Anknüpfungsmöglichkeit an die mit dem Westen in dauernder Verbindung bleibende lübische Kunst.
Die ikonographische Deutung der beiden Figuren zwischen den Knienden der Deesis und dem unteren Engelpaar wird nur durch Aufdeckung uns unbekannter Gegenstücke möglich sein. Es sind stehende Figuren, von denen die deutlich erkennbare links keinen Nimbus trägt und männlich ist. Sie weist mit der rechten Hand auf ein schreinartiges goldenes Kästchen, das vor ihr auf einem braunen Block oder Altar steht. Unentschieden bleibt, ob es sich hier um eine Stifterdarstellung handelt, oder ob biblische Gestalten in opfernder oder darbringender Handlung dargestellt sind.
Die Vereinzelung des Stückes erschwert die Datierung. Die Faltengebung folgt nicht mehr dem linearen Schema des 14. Jahrhunderts, sondern geht mit linearen Mitteln auf plastische Herausarbeitung der Formen aus. Ebensowenig ist aber von irgendwelcher malerischen Erweichung eine Andeutung vorhanden. Zwar kann ein Vergleich mit Petschow und Toitenwinkel wegen der völligen Zusammenhanglosigkeit kaum unternommen werden, doch scheint das Werk in der Stilstufe eher dem letzteren Stück zu entsprechen, und es darf mit Wahrscheinlichkeit auch für das Rostocker Weltgericht eine Entstehung zwischen 1380 und 1400 angenommen werden.
Malerei der Wände. Passionsszenen, Weltgericht und aufgereihte Einzelfiguren. Restauriert. Abb. S. 319-320 u. Schlie IV, S. 130/131.
|
|


|
Seite 289 |




|
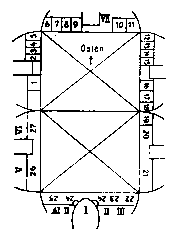
|
|
In Boitin ist alles anders als bei den vorherigen Fällen. Der Raum stellt einen neuen Typ dar mit seiner beruhigten Weite und seinen quadratischen Gewölbejochen. Die Malerei weicht ebenfalls in der Anordnung von der Tradition aufs schroffste ab. Das Gewölbe, bisher vornehmlich das Feld für die malerische Ausschmückung, ist vollständig leer, dagegen sind die Wände nun der Schauplatz der erzählenden Malerei geworden. Die in Toitenwinkel zuerst auftretende Friesanordnung ist hier zum beherrschenden Motiv geworden. Es ist ein rationalistischer Geist, der aus der veränderten Anordnung spricht. Mit nüchterner Klarheit reihen sich die Szenen im Friese aneinander, möglichst vermieden ist das malerische Flimmern der Gewölbemalerei zugunsten eines klaren und ruhigen Eindrucks. Neben dem Wandfries ist die stärkste formale Neuerung das die Westwand füllende monumentale Weltgericht.
Nicht in der Anordnung, aber im Stoffkreis und in der Durchführung der einzelnen Figuren und Szenen erweist sich Boitin dennoch als Glied der ostmecklenburgischen Reihe, und zwar zeigt es engeren Anschluß an Petschow als an Toitenwinkel. Die Isoliertheit der Figuren von allem Beiwerk wie auch die Steifheit und Herbe der Form ist dem Petschower Stil verwandter als den in Toitenwinkel herrschenden rundlichen Formen. Mit Petschow stimmt die Szenenauswahl am besten überein, wie auch die Einzelfiguren mit den dortigen Zwickelfiguren Ähnlichkeiten zeigen.
Ein Wandel in der Bildauffassung ist gegen die vorigen Werke festzustellen. Der Boitiner Maler beherrscht die reale perspektivische Darstellung, aber er stellt sie nicht mehr mit der naiven Freude


|
Seite 290 |




|
zur Schau, wie der Meister von Toitenwinkel, sondern neigt im Gegenteil dazu, möglichst nüchtern und einfach zu zeichnen und den neugewonnenen Reichtum auf wenige Formeln zu beschränken. So ist die Zeichnung der Grabkisten und Thronbänke von geradezu öder Nüchternheit; die Umrißlinien sind mit dem Lineal gezogen und bei einer Folge von mehreren Grabszenen laufen die wagerechten Linien einfach durch. (Vgl. dagegen Auferstehung und Frauen am Grabe in Petschow.) Als positiver Fortschritt gegenüber dieser Erstarrung muß die im modernen Sinne richtige Gruppierung, die Eroberung der einheitlich perspektivischen Bildauffassung betont werden. Man bemerkt den Konflikt, der aus der Beherrschung räumlicher Illusionsmittel und der flächig dekorativen Aufgabe erwächst. Mit Gewalt hat der Maler sich oft, beim Weltgericht z. B., in den abstrakten Flächenstil der früheren Zeit zurückzuzwingen versucht. Die stehenden Einzelfiguren, die in langen Reihen nebeneinandergestellt etwa die Hälfte der Malerei bestreiten, zeigen ebenfalls ein starres, vereinfachtes Schema, das all die Reize des linearen Stils vermissen läßt, dagegen auf plastische Isolierung und Abrundung der Gestalten ausgeht.
Der Schritt von der Abstraktion zum Naturalismus, den Boitin so stark erkennen läßt, steht im Zusammenhang mit der Kenntnis italienischer Trecentomalerei. Das Abendmahl als Tafelrunde mit den Rückenfiguren vorn erinnert lebhaft an die gleiche Darstellung Giottos in der Arenakapelle. Weitere Züge der italienischen Malerei enthalten auch die anderen Passionsbilder. Damit wird für Boitin nichts Besonderes ausgesagt, denn am Ende des 14. Jahrhunderts überläuft die italienische Welle ganz Deutschland; wichtig werden aber einige Zeichen des Zusammenhangs mit Süddeutschland, die den Weg dieser Stilwandlung angeben. Die Kreuztragung, bei der das lange Ende des Kreuzes hinten nachschleppt, und die Kreuzigung mit der sehr ruhigen und gehaltenen Christusgestalt und der ungewöhnlichen Handhaltung des Johannes scheinen dafür zu sprechen, daß ein Zusammenhang mit dem süddeutsch-böhmischen Kunstkreise besteht. Die Vermittlung übernimmt wieder einmal das niedersächsische Gebiet, in das um 1400 italienische und flandrisch-burgundische Formen (letztere von der Soester Schule her) eindringen. Das Boitiner Werk zeigt bei einer Untersuchung der Einzelformen seine Zugehörigkeit zu dieser neu erblühenden westfälisch-niedersächsischen Malerei. Das lehrt auch ein Vergleich der weiblichen Heiligenfiguren der Südseite mit Heiligengestalten des Niederwildunger Altars 33 ).


|
Seite 291 |




|
Das Weltgericht entspricht seinem Standpunkt an der Westwand nach italienischer Gewohnheit; auch hier scheint sich die vom Süden herkommende Strömung zu zeigen. In seinen Einzelformen überwiegen aber Züge der hansischen Monumentalmalerei, ein Vergleich des Weltrichters mit dem auferstehenden Christus in der Stralsunder Nikolaikirche oder mit den frühen lübischen Werken zeigt den gleicken Charakter. Die Deesisfiguren, schon lange an der Küste heimisch (Fünte der Marienkirche in Wismar), zeigen, im Gegensatz z. B. zu dem Rostocker Weltgericht, den modernen Realismus in ihrer naturwahr beobachteten Haltung. Das Fellkleid des Johannes ist einer der naturalistischen Züge, die mit dieser Stilwelle in die Darstellung eindringen. Die Engel mit langen Posaunen und den ausgebogenen Flügelenden erscheinen uns nicht fremd, sie stehen denen des Lettners der Lübecker Heiligengeistkirche nahe trotz des dazwischenliegenden halben Jahrhunderts.
Eine ganz neue Szene ist die anschaulich lehrhafte Darstellung des Meßopfers mit den als Halbfiguren, die aus Flammen emportauchen, gebildeten, den Priester umschwärmenden armen Seelen. Die Darstellung der Messe ist in Westdeutschland (Köln, Clarenaltar) und im Hennegau (Antependium aus Lüttich im Brüsseler Museum) verbreitet. Sie begegnete uns schon im Kreuzgang des Ratzeburger Doms. Aber neu und ohne bekannte Parallele ist die zur größeren Eindringlichkeit hinzugefügte Darstellung der Seelen.
Der Darstellungskreis der Boitiner Malerei ist uns mit Ausnahme einiger Seltsamkeiten, die bei der Macht des hereinbrechenden Neuen nicht Wunder nehmen, ziemlich vertraut. Nur für die lange paradierende Reihe von Heiligengestalten, die die westliche Hälfte des Frieses füllt, können wir die zugrunde liegenden Vorbilder nicht bestimmen, vermuten sie aber im böhmisch-süddeutschen Kunstkreise 34 ). Boitin ist das erste Beispiel dieser im 15. Jahrhundert dann häufigeren Aufreihung von heiligen Standfiguren in unserem Gebiet. Formal zeigen sich auch diese Teile von Niedersachsen abhängig. Anklänge an die aufgereihten Cherubim bei der Weltgerichtsdarstellung in Wienhausen möchten die fünf steif dastehenden Engel in der Südwestecke des Frieses erwecken. Sie, wie die anschließende Reihe von Heiligen, die, enger gereiht, sich mit einer Schulter gegenseitig überschneiden, gehören als Darstellung der Seligen zum Weltgericht. Hier sind die einzelnen nicht alle durch Attribute individualisiert, sondern es folgen zwei Bischöfe,


|
Seite 292 |




|
ein König, eine weibliche und zwei männliche Heilige, deren letzter einen Kelch trägt. In der Mitte unter dem Weltrichter folgen dann die beiden Engel mit den Leidenswerkzeugen, während die ganze rechte Seite des Frieses der Westwand die Höllendarstellung einnimmt. Die starre Ruhe und Steifheit der Gestalten der Seligen, dazu die frühe Mitrenform der Bischöfe läßt scheinbar das Bestreben erkennen, sich alten, strengeren Vorbildern anzupassen, eine Vermutung, die auch durch die Steife, den Miniaturen des 13. Jahrhunderts entsprechende Siegesfahne Christi gestützt wird. Das Höllenbild ist eine Nachahmung der Petschower Höllendarstellung, bewegter und naturalistischer, hat es dennoch nicht die Wirkung des naiveren Vorbildes. Der Christophorus überführt die sonst lebhaft bewegte Gestalt in ein bewegungslos starres Schema, wie die übrigen Einzelfiguren, mit denen er sich nach Kleidung und Barttracht völlig identifiziert.
So steht Boitin vor uns als ein Werk von bestimmtester Eigenart, handwerklich steif und ärmlich in der Ausführung, aber für die Erkenntnis der um die Wende des 14. Jahrhunderts einsetzenden Stilwandlung sehr wertvoll und auch packend in seiner Gesamtwirkung. Die Datierung muß wohl schon in den Anfang des 15. Jahrhunderts gesetzt werden, in zeitlicher Nähe des Hauptwerks der neuen Malerei, des Niederwildunger Altars von 1404. Der Boitiner Stil ist aber gegenüber jenem Werk so rückständig, daß eine direkte Einwirkung der Schule Konrads, die eine spätere Datierung verlangen würde, nicht angenommen zu werden braucht. Wir möchten die Boitiner Malerei zwischen 1400 und 1420 ansetzen.
Malerei nur der Wände, nicht des Gewölbes. Bilder aus dem Leben Marias, Weltgericht, Einzelfiguren. Restauriert. Abb. S. 317-318.
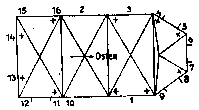
|
|
-
Weltgericht.
Oben: Christus in der Mandorla, rechts ein Engel mit Kreuz und Dornenkrone.


|
Seite 293 |




|
Unten: links der Erzengel Michael mit den Seligen, rechts derTeufel mit den Verdammten.
- Oben: Fünf Propheten. Unten: Die Abschleppung der Verdammten in die Hölle.
- bis 9. Einzelbilder um den polygonalen Chorabschluß.
- St. Michael, den Drachen tötend.
- Laurentius.
- Johannes der Täufer.
- Heiliger Bischof.
- Stephanus.
- Katharina.
- Christophorus.
- Männliche und weibliche Standfigur.
- Heiliger Bischof mit Kelch.
- Verkündigung Marias.
- Sündenfall.
- St. Martin und der Bettler.
- Weibliche Heilige. + Weihekreuze.
Die Malerei von Retschow leitet von dem Toitenwinkeler Werk zu denen von Boitin und Lichtenhagen über, sie zeigt sich besonders mit Toitenwinkel und Lichtenhagen eng verwandt und bildet mit diesen eine engere Gruppe. In der Anordnung führt Retschow zugleich mit Boitin eine durchgreifende Änderung herbei, in der die Malereien nur an den Wänden, nicht an den Gewölbefeldern stehen. Retschow ist hierbei das vermittelnde Werk. Wir bemerken ein noch tastendes Versuchen in der Neugestaltung der Innenraumausmalung, doch auch zugleich energisches Fortschreiten Ein einheitlicher Fries ist hier nicht durchgeführt, vielmehr herrscht eine gewisse sprunghafte Lebendigkeit in der Verteilung der Bilder, die mit roten Linien gerahmt, zum Teil eine stark isolierende Tendenz zeigen.
An Toitenwinkel erinnert eine Anzahl von Zügen dieser Malerei: Die beiden Wände des östlichen Joches unmittelbar vor dem Chorabschluß zeigen eine streifenförmige Anordnung in mehreren Bändern übereinander, sie erinnern an die beiden Toitenwinkeler Friese auch durch die Gruppierung und Gestaltung der einzelnen Szenen. So wird man die Darstellung im Tempel mit dem auf dem Altar stehenden Kinde und der gleichen, etwas steifen Nebeneinanderstellung der Figuren und die Szene des 12jährigen Jesus unter den gestikulierenden Schriftgelehrten mit dem überrascht herzukommenden Elternpaar in die nächste Abhängigkeit von Toitenwinkel rücken. Die in Retschow häufigen Kleeblatt-


|
Seite 294 |




|
bögen mit Fialen und Wimpergen, die beide Tempelszenen bekrönen und die Szenerie des Tempels andeuten, können wir in Toitenwinkel in der architektonischen Umrahmung der Tempelreinigungsszene vorgebildet finden, ähnlicher noch sind die Architekturandeutungen in Lichtenhagen, wo auch die krabbenbesetzten Wimperge genau wiederkehren. Die Szene des Todes Mariä weicht gegenüber der der Lettnermalerei in Lübeck darin ab, daß nicht mehr Christus mit der Seele im Arm hinter dem Bett steht, sondern diese von Engeln begleitet emporschwebt und nur noch die Füße und der Saum des Kleides unter dem Bildrande erscheinen läßt, also in der Art gefaßt ist, wie früher nur die Auferstehung Christi geschildert wurde. Wir stehen im 15. Jahrhundert, das der Maria die gleichen Ehren zubilligt wie Christus selbst. Die Anbetung der Hirten in der unteren Reihe zeigt in der Darstellung der auf dem Felde gelagerten Schafe Ähnlichkeit mit Toitenwinkel. Das Gebäude, das den Stall versinnbildlicht, ist mit den trennenden Architekturen der Toitenwinkeler Friese verwandt. Die Hirtengruppe dagegen erinnert mehr an Lichtenhagen. Die vor dem am Boden liegenden Kinde kniende Maria gehört der um 1400 einsetzenden ikonographischen Wandlung an, die, von Nordfrankreich und Flandern ausgehend, sich in der böhmischen Malerei wie am Rhein ausbreitet 35 ). Die Darstellung des Marienlebens wird beherrscht von der Gruppe der Marienkrönung. Auch sie weckt lebhaft die Erinnerung an das Gegenstück in Toitenwinkel. Die auf einer Stufe sich erhebende Thronbank und die Gesamtauffassung der Gruppe ist gleichartig, selbst die ungewöhnliche Kronenform entspricht sich bei beiden Stücken. Aber die Gruppe in Retschow ist freier und körperlicher empfunden, die Bank hat Rücken- und Armlehnen in überzeugender Perspektive und entspricht einem wirklichen zeitgenössischen Schreinerwerk. Die die Szenen flankierenden Engelsgestalten erinnern an die ähnliche Verwendung von Engeln in Toitenwinkel, entsprechen aber in der Stilstufe schon eher denen von Lichtenhagen durch die aufgerichtete Flügelhaltung. Die Verwendung wagerecht fliegender Engel ist gemeinsam mit Boitin, wo sie zu den neuen Erscheinungen gehören, die aus der Bekanntschaft mit der italienischen Trecentokunst erwachsen sind. Auch Retschow hat den Hauch dieser Strömung verspürt, wie die räumliche Erscheinung der Marienkrönung beweist.
Dem der Marienverehrung gewidmeten Wandfelde stehen auf der Nordseite das Weltgericht und die Abschleppung der Verdammten in die Hölle gegenüber. Der Weltrichter in der Mandorla


|
Seite 295 |




|
schließt sich in der Gesamthaltung dem Toitenwinkeler Bilde an, geht aber ebenfalls über ihn hinaus. Das Retschower Bild ist mächtiger, zugleich in der körperlichen Erscheinung wie im Ausdruck. Wie schmächtig erscheint die Geste der Ausbreitung der Arme in Toitenwinkel im Vergleich zu dem Retschower Bilde. Im selben Verhältnis stehen die fünf Propheten mit Schriftbändern über der Höllenszene zu der Prophetenfigur in dem einen Zwickelfelde von Toitenwinkel trotz engster Abhängigkeit von ihr. Die Reihe der Seligen und der Verdammten unter dem Weltrichter teilen mit den Boitiner Seligen die gegenseitige Überschneidung mit einer Schulter ebenso wie ihre friesartige Aufreihung unter dem beherrschenden Bilde des Richters im Bogenfelde. Auch die steife Fahne an dem Kreuzstabe ist ähnlich Boitin. Selige und Verdammte erscheinen voll bekleidet, es sind merkwürdigerweise nur Kleriker und Frauen. Anders als das noch der alten Typik folgende Toitenwinkeler Werk schildert die Retschower Malerei die Abschleppung der Verdammten in die Hölle. Einzeln werden die Sünder von Teufeln gepackt und unter Sträuben in den geöffneten Rachen geschleppt. Die Lebendigkeit der Bewegungsmotive ist zur höchsten Dramatik gesteigert. Mit diesem Bilde sind am ersten die Petschower und Boitiner Höllenbilder zu vergleichen. Auch hier scheint die italienische Trecentomalerei nicht ohne Einfluß gewesen zu sein. Bei der links stehenden Menschengruppe, den durch die Luft sausenden Teufel mit den sich sträubenden nackten Menschen und besonders bei der Gruppe des um eine Seele kämpfenden Engels und Teufels drängt sich der Gedanke an den Triumph des Todes im Pisaner Camposanto unwillkürlich auf, wenn auch eine nur sehr mittelbare Beziehung bestehen kann. Die lehrhafte Darstellung der drei betenden Angehörigen, auf deren Bitte hin ein Engel eine Seele rettet, bildet thematisch ein Gegenstück zu dem Meßopfer in Boitin. Die Teufel sind von ähnlicher Gestalt wie in Toitenwinkel.
Außer diesen drei mit größeren Kompositionen gefüllten Wandflächen besteht die Malerei sozusagen aus einzelnen Tafelbildern, die in einheitlicher Anordnung der Flächen zwischen den Fenstern ausfüllen, jedes Bild für sich mit roten Linien umrahmt. Die Einzelgestalten sind in der für den Anfang des 15. Jahrhunderts charakteristischen, etwas hintenübergebogenen, gespreizten und eleganten Pose gegeben, wie sie auch auf Tafelmalereien der Zeit erscheinen. Inhaltlich setzen sie die Zwickelfiguren von Petschow und Toitenwinkel fort. Auch der Christophorus und der drachentötende Erzengel Michael, beides alte niedersächsische und


|
Seite 296 |




|
seit dem Einzug der Gotik in Mecklenburg heimische Darstellungen, passen sich den neuen weicheren Formen willig an.
Ikonographisch bleibt das Bild 11 der Südwand unklar, zwei stehende Gestalten, links ein bärtiger Mann mit Hut, geteiltfarbigem Rock, knöchellangem Unterkleid und kurzem Mantel, einen Stock in der Hand; rechts eine Frau in der Idealtracht der Heiligen, beide ohne Nimbus. Ob hier ein Erinnerungsbild an ein Stifterpaar oder biblische Gestalten zu erkennen sind (gegen Ioachim und Anna spricht das Fehlen der Nimben; es müßten schon Gestalten des alten Bundes sein), ist mangels vergleichbarer Analogien heute nicht zu bestimmen. In der genauen Ähnlichkeit der Frau mit der Magdalena des Noli me tangere in Toitenwinkel liegt ein weiterer Beweis des engen Zusammenhangs beider Stücke.
Die beiden Szenen der Westwand, Verkündigung und Sündenfall, fußen auf der Fassung, die sie in Toitenwinkel zeigen, sind aber in der Gestaltung fortgeschritten. Noch ähnlich steif stehen bei der Verkündigung die beiden Figuren einander gegenüber, aber abgerundeter ist die Szene geworden; die Lilie in der Hand des Engels und die besser empfundene Bewegung der Gestalten leitet zu einer neuen, mit feinerem Gefühl diese Szene darstellenden Kunststufe über. Noch deutlicher ist bei dem Sündenfallbild in seiner strengen Symmetrie beiderseits des noch gerade so schematisch gegebenen Baums die Abhängigkeit festzustellen. Das Bild des heiligen Martin mit dem Bettler erinnert an das Boitiner Gegenstück, ist aber viel feiner in der Ausführung. Dasselbe ist von dem gegenüberstehenden heiligen Bischof mit von Blut überströmendem Kelch, wahrscheinlich St. Gregor, zu sagen, demgegenüber die Boitiner Bischöfe steif und roh wirken. Das Retschower Bild hat eine genaue stilistische Parallele in einer Wandmalerei der Marienkirche in Wismar 36 ). Mit Toitenwinkel zeigt die kompositionelle Behandlung der Westwand eine Analogie. Wie in Retschow das Verkündigungs- und das Sündenfallbild, im Viereck gerahmt, auf der Süd- und Nordseite der Wand sich entsprechen, so stehen dort an der Ostwand zwei viereckige Felder mit Wappen und Helmzier der Ritter von Moltke in gleicher Symmetrie in der sonst leeren Wandfläche.


|
Seite 297 |




|
Eine ganz eigenartige Erscheinung ist die Gestaltung der Weihekreuze als kleine rechteckige Rahmenbilder des Gekreuzigten, über denen sich jedesmal in einem Rundbild die Halbfigur eines Apostels befindet (auch hierfür ergeben sich in der Marienkirche zu Wismar Analogien). Die Kreuzigungsbilder lehnen sich noch stark an das eckig gebrochene Schema des 14. Jahrhunderts an, aber diesen kleinen Andachtsbildern haftet ein den frühen Werken fehlender Zug zum Sentimentalen an, der durch die Betonung des aus den Wunden spritzenden Blutes besonders verstärkt wird.
Da das Retschower Werk mit Toitenwinkel so starke Ähnlichkeiten aufweist und nur den Stil etwas fortgeschritten zeigt, so ist es nicht zu kühn, die Vermutung auszusprechen, es möchte ein etwas späteres Werk desselben Malers sein. Zeitlich möchten wir die Retschower Malerei mit der von Boitin etwa gleichsetzen, von der sie aber stilistisch weit erntfernt ist. Zu der etwas späteren Lichtenhäger Malerei dagegen bildet sie eine Brücke. Der Charakter weist ziemlich deutlich, auch durch die Analogie mit der wismarschen Malerei bestätigt, in die Zeit um 1410.
Chorgewölbe und Triumphbogenleibung. Zyklus des alten und neuen Testaments, kluge und törichte Jungfrauen. Restauriert. Abbildung Schlie III, Seite 703, 704.
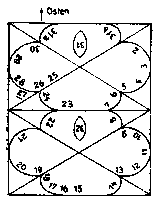
|
|
|
|


|
Seite 298 |




|
|
|
In den Zwickeln Aposteln und Heilige.
Die Malerei von Lichtenhagen, die sich auf Chorgewölbe und Chorbogenleibung beschränkt, steht unter dem unmittelbaren Einfluß eines Vorbildes: Toitenwinkel. Die Szenenfolge und die Gestaltung im einzelnen enthält zahlreiche Züge, die die Abhängigkeit beweisen, manchmal auch Umwandlungen, wie bei der Pilatusszene, wo ein struppiger Teufel an Stelle des federgeschmückten Dieners dem Pilatus seinen Rat ins Ohr flüstert.
Der Stoffkreis enthält an neuen Typen den Gnadenstuhl, der im Anfang des 15. Jahrhunderts häufiger und populärer wird, aber auch vorher anzutreffen ist (Lübeck, Jakobikirche; Petschow); und die klugen und törichten Jungfrauen an der nördlichen Triumphbogenleibung. Letzterer Stoff ist in dieser Form zum erstenmal hier anzutreffen, die eindringlich-realistische Darstellung der törichten Jungfrauen vor der verschlossenen Pforte, darunter die von Christus in der geöffneten Pforte empfangenen klugen, hat in der Malerei Mecklenburgs keine nähere Parallele. Daß die Anregung des Stoffes von dem nahen Doberan (siehe I. Teil) ausgegangen ist, darf bei der Vereinzelung dieses Themas im Lande angenommen werden. Noch einmal ist es in Parkentin, also in demselben engeren Umkreis Doberans, anzutreffen. Bei dem Bilde in Lichtenhagen erinnern die beiden Züge der Jungfrauen an die ähnlich aufmarschierenden Züge der Verdammten in Petschow und der Seligen und Verdammten in Retschow.
Die Anordnung der Gewölbemalerei geht von der Zerrissenheit Toitenwinkels wieder auf die zusammenhängendere, leichter überschaubare Form Teterows zurück. Doch besteht zwischen dem streng flächenbetonten, tektonisch aufgebauten Teterower Werk und Lichtenhagen ein bedeutender Unterschied. Hier ist ein elastischer, nach unten unbestimmt sich verlierender Bodenstreifen, der Hügel und Täler bildet und manche Deformation erträgt, an Stelle des starren Ringes von Teterow getreten und statt der reliefartig streng der Fläche eingepaßten Figuren dort treten hier sorglos aneinandergereihte Szenen auf, teils schwerer, teils leichter von Gewicht; Bäume und Architekturen sind eingestreut, ohne daß die


|
Seite 299 |




|
teppichartige bunte Gewölbefläche dadurch aus dem Gleichgewicht kommt. Das Mittel, das solche Sorglosigkeit im einzelnen erlaubt, ist das rote wuchernde Rankenwerk, das alle freibleibenden Stellen ausfüllt. Es bewirkt zusammen mit der oft in die Tiefe gestaffelten Anordnung der Figuren und der lockeren Boden- und Landschaftsandeutung, daß die Szenen wie von weicher Luft umspielt erscheinen und so zu der mathematisch begrenzten Räumlichkeit der Toitenwinkeler Bilder in lebhaften Gegensatz treten. Daß manche strengeren Elemente von Toitenwinkel her übernommen sind, zeigt die Betonung der Mittelachse durch stärkere Akzente und die Steifen, den dortigen Gegenstücken entsprechenden Zwickelfiguren, die aber hier auch das Rankenwerk umspinnt.
Die figürlichen Darstellungen sind freier und unmittelbarer sinnlich erfaßt als bisher. Neue Gruppierungen und Bewegungen brechen die Gebundenheit der vorigen Zeit, ein wohliges Dehnen im Raum wie in der körperlichen Bewegung ist überall zu bemerken. Die Auffassung ist aus der mittelalterlichen Idealität ins Naturalistische verwandelt. Die Kreuzigung bricht mit dem überkommenen Schema völlig und setzt die Szene in die Realität um; die Limbusszene erscheint der abstrakten Symbolik entkleidet und versucht, auch diese Situation realistisch glaubhaft zu machen.
Das Vorhandensein italienisch-süddeutscher Elemente ist kaum nötig zu erwähnen, ihr Eindringen erklärt ja die umstürzende Revolution in der Darstellungsweise. Das Mantelmotiv des Judaskusses erinnert an Giottos Bild in der Arenakapelle, der Einzug in Jerusalem mit den ruhig schreitenden Gestalten der drei Jünger, die Darstellung der Taufe Christi mit der hier schon natürlichen Bildung des Wassers und dem Johannes mit Fellkleid und Kreuzstab, das nackte, seitlich sitzende Kind auf Marias Schoß bei der Anbetung der Hirten lassen keinen Zweifel an der Durchdringung dieser Kunst mit den Errungenschaften der italienischen Trecentomalerei. Zu den in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts sich von Süddeutschland her ausbreitenden Formen gehört die Lage des Kreuzes bei der Kreuztragung mit dem langen Ende nach hinten. Eine weitere Errungenschaft ist das Komponieren mit Massen statt mit Einzelfiguren. Wir sehen hier häufig die Figuren zu geschlossenen Massen, oft nach der Tiefe gestaffelt, zusammengefaßt und der Einzelfigur gegenübergestellt. Auch diese Erscheinung ist von Italien her über die böhmisch-süddeutsche Malerei dem Norden vermittelt worden.
In Lichtenhagen erhebt sich die Frage angesichts des naturalistischen Fanatismus, des beginnenden Überwucherns profaner


|
Seite 300 |




|
Züge, ob von niederländischer Beeinflussung die Rede sein kann. Die Kreuzigungsszene, das Weltgericht, die Anbetung der Hirten, diese auffallend veränderten und verdiesseitigten Kompositionen, möchten dafür sprechen. Die Architekturen, flach und unräumlich, deuten auf die schon im Anfang des Jahrhunderts in die sächsische Malerei eindringenden französisch-burgundischen Formen. Das Rankenwerk wird von der französischen Buchkunst der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wo es eine ähnlich wuchernde Tendenz zeigt, seinen Ausgang genommen haben.
Die Entstehungszeit der Malerei fällt jedenfalls schon weit ins 15. Jahrhundert hinein, und nur der enge Zusammenhang mit Toitenwinkel rechtfertigt ihre Behandlung an dieser Stelle. Die zu reicheren und volleren Formen vorgeschrittene Gewandung spricht für eine Ansetzung um 1430. Die leise anklingenden Züge niederländischen Einflusses wollen eine noch spätere Datierung befürworten, doch möchten wir eine Entstehungszeit in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts als sicher annehmen. (Vgl. das zeitlich nahestehende Kalkhorst im Nordwesten Mecklenburgs 37 ), dagegen das der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehörende Below bei Dobbertin 38 ).
Chorgewölbe. Weltgericht mit klugen und törichten Jungfrauen. Restauriert.
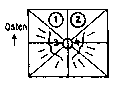
|
|
Die Malerei des Chorgewölbes von Parkentin lehnt sich in der Anordnung an Vorbilder aus der ältesten Zeit der ostmecklenburgischen Wandmalerei an. Wir werden an Hohen Sprenz durch die Doppelmajestas in den östlichen Kappen des Gewölbes, an Lüdershagen durch das Schweben im leeren Raum und die bewegungslose Stille der Figuren erinnert. Die klugen und törichten Jungfrauen leiten sich leicht von dem frühen Doberaner Werk ab und haben von dort noch den Zug statuarischer Isoliertheit behalten. Mit diesen Feststellungen sind aber die Analogien erschöpft, und es muß nun vielmehr der Gegensatz in der Auffassung betont werden.
Die Parkentiner Malerei soll trotz ihrer Stille und Zurückhaltung eine Handlung ausdrücken, die Aufnahme der klugen, die


|
Seite 301 |




|
Zurückweisung der törichten Jungfrauen durch Christus und Maria, die als gleichberechtigtes Richterpaar thronen. Daß trotzdem eine so statuarische Isolierung der Figuren beliebt wird, mag neben dem Streben nach feierlicher Monumentalität, das die dekorative Aufgabe der Schmückung des halbdunklen frühen Chorraums erforderte, aus der gleichzeitigen Blüte des Schnitzaltars zu erklären sein, mit der überhaupt die Zunahme der stehenden Einzelfiguren in der Malerei zusammenhängt.Von den Werken der ostmecklenburgischen Gruppe ist Petschow das im ganzen Charakter verwandteste. Mit den dortigen Gestalten hat der ruhige Stand, das schlicht fallende Gewand, der ovale, gleichförmige Gesichtstyp und die Haartracht eine allgemeine Ähnlichkeit.
Doch gehört die Parkentiner Malerei zweifellos dem 15. Jahrhundert an. Waren die Gestalten in Petschow noch von einer abstrakten Hoheit und Unwirklichkeit, so gehören diese einer menschlichen, ja bürgerlichen Sphäre an. Die Jungfrauen sind sanfte und zarte Mädchengestalten, die ihre Freude und ihren Schmerz in stille, gebundene Bewegungen fassen. Die durch die Mittelrippe erzwungene Gleichstellung der Maria mit Christus ist dem 15. Jahrhundert nicht mehr so wesensfremd, wie der früheren Zeit. Selbst die Gottheit umgibt menschliche Empfindung mit sentimentalen Zügen.
Der glatte, schlicht und eng die Körper umhüllende Gewandstil findet sich auf niedersächsischen Malereien um 1400, z. B. auf dem Altar von Hannoversch-Münden 39 ). Eine Ähnlichkeit in der Kopf-und Haarform, eine gleiche Verwendung z. B. der kleinen Stirnlocken im Scheitelwinkel der Stirn, auch in der stillen, sanften Auffassung der Figuren ist mit der Lüneburger Goldenen Tafel um 1410 zu beobachten 40 ). Der Stil des Parkentiner Gewölbebildes gehört also der vom Westen (Flandern-Burgund) beeinflußten niedersächsischen Strömung vom Anfang des 15. Jahrhunderts an und muß uns veranlassen, das Stück ebenfalls in die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts, etwa um 1420, zu datieren.
Fragmente der ehemaligen Gewölbemalerei 41 ). Nur Pausen im Archiv der Kommission zur Erhaltung der Denkmäler in Schwerin erhalten.
- Teile eines Zyklus des Marientodes. Tod, Aufbahrung und Grabtragung mit Gefolge.


|
Seite 302 |




|
- Teile eines Katharinenzyklus: Disputation, Besuch Faustinas, Radwunder und Enthauptung Katharinas.
- Teil eines Höllenbildes.
- Der heilige Martin zerteilt seinen Mantel unter zwei Bettler.
Selbst der schwache Wiederschein des wirklichen Eindrucks, den die Pausen bieten können, muß das Überstreichen der Malerei im Jahre 1860 aufs Tiefste bedauern lassen. Es ist ein Zyklus von großer Eigenart in stofflicher und formaler Beziehung, ein wichtiges Glied der Entwicklung der mecklenburgischen Wandmalerei im 15. Jahrhundert.
Die Gewölbe der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebauten zweischiffigen, vierjochigen Halle steigen schlank auf und haben eine steile Form. Die durch die Architektur gegebene Grundlage fordert zu einer neuen Lösung heraus. Durch ein wagerechtes Band ist kurz unter den Stichbogenhöhen die Gewölbekalotte von den Zwickeln abgeteilt. Das Band besteht aus einem Vierpaß- oder Bogenfries; die darunterliegenden Zwickel enthalten unter dem Marientodzyklus Blätterbäume sowie eine wahrscheinlich als Prophet anzusprechende Figur vor der das Zwickelfeld teilenden und den Bogenfries tragenden gemalten Säule. Von der Zwickelbehandlung der übrigen Gewölbejoche ist nichts bekannt.
Die Darstellungen sind derb und naiv, aber eigenartig im Stoffkreis und in der Komposition. Es ist eine zugleich monumental-repräsentative und lebendig erzählende Malerei. Die naturalistische Eindringlichkeit der Darstellung und die Erhöhung der dekorativen Wirkung durch überlegte Komposition und reiche ornamentale Ausschmückung geben dem Ganzen ein von den bisherigen Werken abweichendes Gepräge. Der Stil ist malerischer und gelockerter. Auch hier wird, wie in Lichtenhagen, durch die Streumuster des Hintergrundes eine flimmernde, unbegrenzte Atmosphäre erzielt, die sich schmiegsam um die Figuren ausbreitet. Dadurch ist bei den figürlichen Szenen die Strenge, die besonders durch den starren Bodenring getont wird, gemildert; starre Symmetrie ist nirgends vorhanden, in lebendiger Folge fügen sich die Szenen aneinander. Lisch erwähnt als starres, tektonisierendes Element eine senkrechte Halbierung der Gewölbekappen durch eine einfache Linie, die auf der Pause des Marientodbildes zum Ausdruck kommt, die aber, wie die übrigen Pausen erkennen lassen, nicht überall vorhanden war. Die Zeichnung der Figuren schließt sich nicht unmittelbar an die vorigen Werke an, sondern zeigt eine stark abweichende Haltung. Bekannt ist uns der heilige


|
Seite 303 |




|
Martin und der kniende Bettler an seiner rechten Seite, aber auch diese Szene ist durch Verdoppelung der Bettlergestalt anders gefaßt; die übrigen auf den Pausen erhaltenen Szenen sind uns völlig fremd. Die Gestalten sind untersetzt, stark bewegt, der Umriß oft unförmlich durch bauschige, lose umhüllende Gewandung: langes Unterkleid, oft mit tiefer, blusenartiger Gürtung; der Mantel zum Teil noch in dem älteren Schema eng um die Schulter und den Leib gewickelt, teils in neuerer Auffassung etwas ungelenk und eckig herabfallend.Von momentaner Knitterbewegung ist der herabgeworfene Mantel des heiligen Martin. Die Bewegung der Figuren ist von drastischer Lebendigkeit, die Ausführung aber einförmig, die Motive oft wiederholt. Auch die Gesichter sind bei allem Streben nach Lebendigkeit sehr gleichmäßig in der Ausführung, meistens von häßlich-grämlichem Ausdruck. Die Zeichnung ist locker und arbeitet mit zahlreichen kleinen Strichen; der Charakter der Figuren ist mehr räumlich-plastisch als flächig, wie auch die Komposition oft Tiefenanordnung zeigt.
Für die Ableitung des Stils ist das Gegenständliche wichtig. Wir finden eine sehr ähnliche plastische Darstellung des Todes und der Grablegung Marias an einem Portal der Nürnberger Sebalduskirche aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 42 ), wo beide Szenen in den Grundzügen wiederkehren. Der bewegte, lebendige Charakter beider Szenen ist ähnlich, die Menschen zeigen einen ebenso greisenhaft vergrämten Typ, ebenso üppige Haartracht, und sowohl in der Faltengebung der Gewänder wie in den Stand- und Bewegungsmotiven ist eine Einwirkung auf die Tarnower Fassung zu erkennen. Auch der Aufbau der Gruppen auf einer festen Bodenlinie mit hintereinander gruppierten und nach hinten aufwachsender Figurenanordnung ist dort vorgebildet.
Die Tarnower Malerei ist durch dieses süddeutsche Gegenstück freilich noch nicht erklärt. Die Malerei ist durchaus norddeutsch und, wie die übrigen Stücke Ostmecklenburgs, aus dem niedersächsischen Kunstkreise erwachsen. Auch hier erkennen wir die zyklischen, erzählenden Szenenfolgen in dem Tode, der Aufbahrung, Grabtragung und (nicht erhalten) Himmelfahrt Marias sowie in den vier Bildern der Katharinenlegende. Nehmen wir das Bild des heiligen Martin als Glied einer ähnlichen Folge von Szenen der Heiligenlegende, so haben wir inhaltlich wie formal eine Malerei ähnlich der Büchener vor uns, die ebenfalls mit niedersächsischer Kunst im Zusammenhang steht.


|
Seite 304 |




|
Das Höllenbild erscheint hier in neuer, eigenartiger Fassung. Links thront Luzifer, von einer Schlange umringelt, in der Mitte steht ein gitterartiger Ofen voller Flammen, in dem kleine nackte Seelen schmachten, rechts und links zwei Teufel, lang bekleidet, aber mit Flammen statt der Füße und Flammen auf den Wangen, das Feuer mit Ofengabeln schürend. Ein dritter schwebt zur Rechten, scheinbar eine halb entrollte Schriftrolle in den Händen. Es ist klar, daß dieses Bild die Reihe der Höllendarstellungen, die die ostmecklenburgische Gruppe besonders auszeichnet und die ebenfalls in der Vorstellungswelt des niedersächsischen Stammes vor allem ihre Erklärung findet, fortsetzt. Drastischer und eindringlicher ist die Darstellungsweise geworden, ein Zeugnis des gesteigerten Naturalismus des 15. Jahrhunderts.
Mit dem niedersächsischen Charakter verbinden sich, im Mecklenburg des 15. Jahrhunderts leicht erklärbar, Züge der nordischen Malerei. Mit der Malerei von Borreby in Schonen (um 1350) 43 ) zeigt die Darstellung des heiligen Martin eine Ähnlichkeit der Auffassung, und dort sind auch Ornamentborten, Ranken und Streumuster ähnlich verwendet, so daß eine Wirkung älterer nordischer Werke dieser Art auf die deutsche Ostseeküste in den Bereich des Möglichen rückt. Die herbe, etwas gehackt und unbeholfen erscheinende Zeichnungsart, die Neigung zu häßlicher Realistik sind Züge, die für einen nordischen Einfluß sprechen. Das Streumuster ist in der nordischen Spätgotik überaus verbreitet, meistens mit der Schablone hergestellt; Teufelsszenen nehmen dort einen breiten Raum ein, in manchen spätgotischen Teufelsszenen herrscht ein ähnliche, halb grausige, halb humoristische Drastik wie im Tarnower Höllenbild 44 ). Die Vermutung nordischen Einflusses erfährt eine vollkommene Bestätigung durch den Vergleich von Malereien norwegischer Holzkirchen. Die Malerei der Kirche von Aal zeigt in der Figurenbildung wie im wuchernden Füllornament eine auffallende Ähnlichkeit des Stils mit den Tarnower Fragmenten 45 ).
Die Datierung ist in das 15. Jahrhundert zu setzen. Wenngleich ohne nähere Parallele im Lande, zeigt die Malerei eine Stilstufe, die sie der ersten Hälfte des Jahrhunderts zuweist. An Zeittracht ist wenig zu finden, nur das Kopftuch, das die Kaiserin Faustina und ihre Dienerin tragen, scheint für die Zeit um 1430 zu sprechen. In dieselbe Zeit weist die freiere und doch noch unbeholfene Faltengebung mit ihrer Tendenz zu eckiger Bewegung


|
Seite 305 |




|
und Durchbrechung des geschlossenen Umrisses. Für den Anfang des Jahrhunderts möchte man die noch frühe Ärmelform, weit um den Oberarm, eng um den Unterarm, z. B. bei den Teufeln und dem Henker der Katharina, anführen; auch die Form der Kronen fordert frühe Datierung. Die Treppe zum Hause Katharinas findet sich in ähnlicher Perspektive auf dem Fröndenberger Altar von 1421 46 ). Da das Original übermalt ist, so müssen wir uns mit der ungefähren Datierung "wahrscheinlich um 1430" begnügen.
Zusammenfassend ist über die ostmecklenburgische Gruppe zu sagen: Sie ist, wie schon in der Übergangszeit, so auch in der Gotik hauptsächlich von Niedersachsen abhängig. Ihr Charakter ist einheitlicher, bodenwüchsiger, auch provinzieller, als der des Westens, unberührter von der europäischen Mode. Die Auffassung ist von der Lübecks merklich unterschieden. Das formale Interesse ist gering, dagegen die Freude am Inhalt ganz unersättlich. Naive Erzählerkunst herrscht statt des Ringens nach formalen Problemen. Der niedersächsische Volkscharakter ist vorwiegend unsinnlich-gedanklich.
Wie die gotische Baukunst Lübecks in ihrer straffen Sehnigkeit und funktionellen Durchdachtheit stärker französischen Charakter trägt, als die gotische Baukunst Vorpommerns oder der Mark, wo weniger funktionelles Denken als Freude an flächigem Schmuck zutage tritt, so ist auch Lübecks Wandmalerei mit dem Bau organisch verbunden, geht die des Ostens ohne Rücksicht auf die Funktion der Bauglieder auf flächige Teppichwirkung aus.
Die nördlich der Ostsee liegenden Länder, besonders Dänemark und Schonen, zeigen in ihren Wandmalereien so starke Berührungen mit dem deutschen Küstengebiet - ebenfalls zyklische Bilderfolgen, Einzelfiguren in den Zwickeln und eine Vorliebe für Teufelsszenen -, daß eine Beeinflussung von Niedersachsen her, wahrscheinlich über Mecklenburg, wahrscheinlich ist 47 ). Die umgekehrte Einwirkung kommt im 14. Jahrhundert sicher nicht in Betracht, im 15. Jahrhundert ist die Tarnower Malerei ein vereinzeltes Beispiel, um 1500 ist eine solche Strömung mit Sicherheit anzunehmen, doch liegt für diese späte Zeit noch keine Untersuchung vor.
Schluß.
In diesem abschließenden Abschnitt sei der Entwicklung der Farbengebung und dem gemalten Bauornament, das neben dem


|
Seite 306 |




|
Figürlichen in der norddeutschen Malerei einen breiten Raum einnimmt, eine kurze Betrachtung gewidmet.
Die farbige Haltung, die in der Behandlung der einzelnen Werke nur gelegentlich gestreift werden konnte, macht im Verlauf des 14. Jahrhunderts eine Entwicklung von zarter Milde zu prächtiger Vollfarbigkeit durch, deren einzelne Phasen hier nicht aufgeführt werden können. Eine allgemeine technische Eigenschaft der frühen Malereien ist die Verwendung des schwarzgrauen Konturstrichs, während die gotische Malerei zuerst eine nach Fleisch- und Gewandteilen in rote und schwarze Linien trennende Zeichnungsart einführt und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu ausschließlicher Verwendung der roten Zeichnung übergeht.
Die Ornamentik der frühesten Periode, des Übergangsstils, ordnet sich der Architektur völlig unter und sieht ihre Aufgabe in der Ausdeutung der baulichen Formen. Die Bemalung ist bei den schweren, ungegliederten Kirchen des Übergangsstils zur Vervollständigung des Raumeindrucks notwendig. Sie beschränkt sich meistens auf die struktiven Glieder, auf Bögen, Gurte, Rippen, Dienste, Tür- und Fenstereinfassungen und besteht zumeist aus Ouaderung in zweifarbigem (meist rotweißem) Wechsel. Die Wände werden meistens nur durch ein wagerechtes Band in Kämpferhöhe und durch regelmäßig angeordnete Weihekreuze belebt, zuweilen wird mit Scheingliederungen (gemalten Arkadenreihen, Röbel, St. Marien) oder auch einfachen Teppichmalereien (Satow) gearbeitet. Reicher wird der Eindruck durch zierliche Schmuckborten um die Fensterbögen und auf Rippen und Gurten, wie in Behlendorf, und durch ausstrahlende Palmetten um den Chorbogen, wie in Behlendorf und Petschow. Die tektonisierende Malerei des Übergangs hat ihre Heimat im Rheinland und in Westfalen, wo eine ähnliche Dekorationsweise von romanischer Zeit her gepflegt wurde.
Die derben Granitquaderbauten des Übergangsstils waren auch außen bemalt, wie überall erhaltene Spuren im Putz beweisen. Durch rote gemalte Fugen auf weißem Kalkputz wurde der Eindruck eines Haussteinbaues vorgetäuscht. So fest wurzelte die heimatliche Matrialvorstellung in den Kolonistenbaumeistern.
Die Gotik bringt eine allmähliche Umwandlung der farbigen Haltung des Innenraums, deren Ziel der Übergang des Ornaments von den struktiven Teilen auf die struktiv indifferenten Flächen ist, während die ersteren kahl werden und das bloße Ziegelwerk zeigen.


|
Seite 307 |




|
In Behlendorf und Büchen wie in Röbel ist das allmähliche Hineinwuchern der Ornamentformen von den Rippen, Scheiteln, Zwickelecken aus in die Kappenfelder zu beobachten. In Niedersachsen ist eine ähnliche Bewegung schon in romanischer Zeit zu finden (Braunschweiger Chorgewölbe, später Wienhausen), die auch in unserem Gebiet, in der Schweriner Marienkapelle, vereinzelt Anwendung findet.
Neben den Ranken finden sich als Flächenfüllung lose Bäume und Büsche (Lüdershagen, Petschow, Tarnow), deren Vorbilder in Westdeutschland (Rheinland und Westfalen, z. B. St. Maria zur Höhe, Soest) im 13. Jahrhundert zu suchen sind.
In Lübeck findet die Rankenausbildung eine feste Formulierung, die für das Ostseeland lange maßgebend bleibt. Es sind die kurzen, die Rippen und Schildbögen reihenweise begleitenden eingerollten Krabbenranken, rot oder rot-grün in Wechsel. Von den Bogenhöhen und Scheitelecken wachsen größere Ranken oder Palmettengebilde in die Kappen hinein. Überall in Lübecks Einflußzone ist diese Dekorationsweise zu finden. Erst im 15. Jahrhundert lockert sich diese noch tektonisch gebundene, trotz ihrer vegetabilen Freiheitslust und ihres Nagens an der baulichen Klarheit doch das Baugerippe anerkennende Dekorationsweise. Nun tritt die freiwuchernde Ranke als Flächenschmuck auf. In Lichtenhagen überspinnen die Ranken ohne Symmetrie die Flächen mit gleichmäßig füllendem Gerank. Sie gehören nicht mehr den Rippen, sondern den Kappenflächen an.
Ein weiteres gotisches Flächenornament ist das Streumuster das mit zarten Sternchen in der Art westdeutscher romanischer Vorbilder seinen Anfang nimmt (Methler-Lüdershagen). Die hohe Gotik verwendet das Streumuster in derberem und mehr füllendem Sinne. In Behlendorf sind die Figuren von einer flimmernden Sternenmenge umgeben, wie von einer sie dicht umgebenden Atmosphäre. Die derbere und schwerere Verwendung der Streumuster in Niedersachsen (vgl. Wienhausen) findet sich in Tarnow vertreten, wo ein Höhepunkt teppichartiger Wirkung mit durcheinanderwimmelnden Streumustern verschiedener Art, Lilien Rosetten, Kleeblättern, Sternchen, erreicht wird. Das 15. Jahrhundert bringt auch hier die Tendenz zur ornamentalen Füllung aller Flächen.
Die Wandfläche zeigt auch in der Gotik meistens kein Ornament, da die figürlichen Darstellungen häufig die Wände einnehmen. Ein vereinzelter Fall ist die ehemalige Wandbemalung der Schweriner Marienkapelle, wo reihenweise Rundscheiben mit


|
Seite 308 |




|
kleinen figürlichen Szenen auftraten. Häufiger ist ein Arkadenfries, von Wimpergen gekrönt, der aufgereihte Einzelfiguren enthält. In der Lübecker frühen Gotik ist Quaderbemalung häufig; sie tritt auch in Tarnow im 15. Jahrhundert auf. Eigenartige Flächenmuster zeigen die Pfeiler der Sternberger Kirche in ihrem unteren Teil, und ähnlich die beiden schlanken Querschiffpfeiler von Doberan. Diese getreppten und gewellten Muster entstammen als Teppichmuster wohl der Textilkunst, ähnliche Gebilde kommen schon in romanischer Zeit in Westfalen, hauptsächlich als Bandornament, vor.
Die ornamentale Verwendung der Weihekreuze wird in gotischer Zeit fortgesetzt, sie werden nun oft mit figürlichem Schmuck verbunden und treten in ein engeres Verhältnis zu der figürlichen Malerei. Figürlicher Schmuck von reinem Ornamentcharakter findet sich nur ausnahmsweise. In Gnoien tritt figürlicher Schmuck an den Gewölbescheiteln auf; für die frühe Zeit scheinen in Doberan kniende Figuren unter Konsolen in vorwiegender Ornamentbedeutung durch Lisch nachgewiesen zu sein; die reife Gotik bringt unter plastischen Kopfkonsolen gern gemalte Gestalten an.
Die gotische Dekoration unterscheidet also von der strengen, sich unterordnenden Dekorationsweise der Übergangszeit ihr vegetabiles Wuchern, ihr organisches Eigenleben gegenüber den zugrunde liegenden Formen der Architektur. Sie entwickelt sich zu immer größerer Unabhängigkeit, um sich in der Spätgotik möglichst zu verselbständigen und alle Schranken zu sprengen; das spätgotische Ornament verliert sich schließlich in regellose Willkür.
Die Zusammenfassung der beherrschenden Grundlinien für die Entwicklung der Wandmalerei von 1300 bis 1400 ergibt einen im ganzen einheitlichen Verlauf. Für die frühe Zeit wie für die Gotik geht der hauptsächliche Einfluß von Niedersachsen aus, also von Süden nach Norden. Mit dieser Strömung kreuzt sich eine von Westen, vom Rhein und Westfalen ausgehende, die ebenfalls im Verlauf des gesamten 14. Jahrhunderts fortbesteht.
Im frühen Zeitabschnitt ist die Verwirkung der Fäden dieses Gespinstes noch nicht klar erkennbar, es herrscht noch eine Vereinzelung und Zufälligkeit, die es uns unmöglich macht, feste Wege und Gruppen zu bestimmen. In der Gotik klärt sich das Bild. Lübeck im Nordwesten unseres Gebietes bildet den Knotenpunkt, wo sich vor allem die beiden Strömungen treffen und verschmelzen,


|
Seite 309 |




|
wo über See weitere Anregungen kommen und auch auf dem Seewege hauptsächlich der neu geschaffene Stil verbreitet wird. Daher ist der Einfluß Lübecks an der Küste besonders stark und weitreichend, dagegen im Binnenlande nur für das westliche Mecklenburg überwiegend, während das abgelegene Landgebiet des östlichen Mecklenburg hauptsächlich von Süden her niedersächsischen Einfluß erfährt. Die so sehr charakteristische ostmecklenburgische Malereiengruppe führt ein stetiges, wenig von außen gestörtes Eigenleben, eine provinzielle, konservative Kunst im Gegensatz zu dem fortschrittlich großstädtischen Kunstleben Lübecks.
Das 15. Jahrhundert, das hier nur ein wenig gestreift ist, erfordert eine besondere Behandlung; es setzt die starke Produktion ungehemmt fort, ja es steigert sie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch einmal zu einer ähnlichen Ausdehnung, wie in der Zeit um 1400.


|
Seite 310 |




|
Literatur.
Friedrich Back, Mittelrheinische Kunst. Frankfurt
1910.
Richard Borrmann, Aufnahmen
mittelalterlicher Wand- und Deckenmalereien
Deutschlands, Berlin 1897-1914.
Burger-Schmitz-Beth, Die deutsche Malerei vom
ausgehenden Mittelalter bis zum Ende der
Renaissance. Berlin-Neubabelsberg.
Paul
Clemen, Die romanische Monumentalmalerei in den
Rheinlanden. Düsseldorf 1897.
Georg Dehio,
Geschichte der deutschen Kunst. Berlin-Leipzig
1921.
Curt Habicht, Die mittelalterliche
Malerei Niedersachsens, I. Straßburg 1919.
Arthur Haseloff, Eine thüringisch-sächsische
Malerschule des 13. Jahrhunderts. Straßburg
1897.
P. Hasse, Miniaturen aus
Handschriften des Staatsarchivs in Lübeck.
Lübeck 1897.
Carl Georg Heise, Norddeutsche
Malerei. Leipzig 1918.
H. Janitschek,
Geschichte der deutschen Malerei. Berlin
1890.
Lindblom, La peinture gothique en
Suède de Norvège.
Bau- und Kunstdenkmäler
der Freien und Hansestadt Lübeck. Lübeck
1906.
Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler der
Provinz Westfalen.
H. Mithoff, Das Kloster
Wienhausen (Archiv für Niedersachsens
Kunstgeschichte, 1849-1862).
W. H. v. d.
Mülbe, Die Darstellung des jüngsten Gerichts an
den romanischen und gotischen Kirchenportalen
Frankreichs. Leipzig 1911.
Joseph Neuwirth,
Die Wandgemälde im Kreuzgang des Emmausklosters
zu Prag. Prag 1898.
Max Paul, Sundische und
lübische Kunst. Berlin 1914.
Heinrich
Reincke, Die Bilderhandschrift des Hamburger
Stadtrechts von 1497 im Hamburger Staatsarchiv.
Hamburg 1917.
Otto Rydbeck, Medeltida
Kalkmålningar in Skånes Kyrkor. Lund 1904.
Scheibler-Aldenhoven, Geschichte der Kölner
Malerschule. Lübeck 1902.
Friedrich Schlie,
Die Kunst- und Geschichtsdenkmäler des
Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin. Schwerin
1900.
Hermann Schmitz, Die mittelalterliche
Malerei in Soest. Münster 1906.
Henry
Thode, Die Malerschule von Nürnberg im 14. und
15. Jahrhundert. Frankfurt 1891.
Georg Graf
Vitzthum, Die Pariser Miniaturmalerei. Leipzig 1907.


|
Seite 311 |




|
Lokal=Literatur.
Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Schwerin.
G. C. Friedrich Lisch, Jahrg. 16 S. 175, 286, St.
Marien Wismar; Über die Bemalung der alten
Kirchen.
Jahrg. 17 S. 376,
Röbel, St. Marien.
Jahrg. 19 S.
374, 385, Doberan.
Jahrg. 20 S.
312, Büchen, Toitenwinkel.
Jahrg. 24 S. 317, 338, Bützow,
Gägelow.
Jahrg. 26 S. 234,
Bernitt.
Jahrg. 27 S. 213,
Tarnow.
Jahrg. 33 S. 154,
Röbel, St. Nikolai.
Jahrg. 35
S. 181, 201, Güstrow, Dom; Lüssow.
Jahrg. 36 S. 170, Schwerin,
Dom.
Jahrg. 40 S. 161,
Schwerin, Kapitelhaus.
Jahrg.
42 S. 168, Parchim, St. Marien.
F. Crull,
Jahrg. 45 S. 274, 282, Teterow, Gnoien.
Jahrg. 47 S. 94, Wismar, St.
Nikolai.
F. Crull, Über Toitenwinkel,
Zeitschr. f. christl. Kunst, 4. Jahrgang S. 274
f.
G. C. Friedrich Lisch, Röbel, St.
Marien, Zeitschr. f. Bauwesen, August 1852.



|
Seite 312 |




|
Alphabetisches Verzeichnis der behandelten Malereien.
| Behlendorf | 261 |
| Berkenthin | 260 |
| Bernitt | 271 |
| Boitin | 288 |
| Büchen | 257 |
| Doberan, Beinhaus | 234 |
| Gägelow | 264 |
| Gnoien | 240 |
| Lichtenhagen | 297 |
| Lübeck, Jakobikirche | 244 |
| Lübeck, Heiligengeistkirche, Nordwand | 246 |
| Lübeck, Heiligengeistkirche, Lettner | 247 |
| Lübeck, Heiligengeistkirche, Südschiff | 250 |
| Lübeck, Katharinenkirche, Unterchor | 251 |
| Lübeck, Katharinenkirche, Oberchor | 252 |
| Lüdershagen | 238 |
| Mölln, Nordwand, östliches Langhausjoch | 233 |
| Mölln, übrige Malereien | 257 |
| Parkentin | 300 |
| Petschow | 279 |
| Ratzeburg, Domkreuzgang | 267 |
| Rehna | 255 |
| Retschow | 292 |
| Röbel, Marienkirche | 273 |
| Rostock, Rathaus | 286 |
| Schwerin, Dom, nördliche Marienkapelle | 254 |
| Schwerin, Dom, Kapitelhaus | 262 |
| Hohen-Sprenz | 236 |
| Sternberg | 269 |
| Tarnow | 301 |
| Teterow | 276 |
| Toitenwinkel | 282 |
| Wismar, Marienkirche, Wrangelkapelle | 265 |



|
Seite 313 |




|




|
Seite 314 |




|




|
Seite 315 |




|
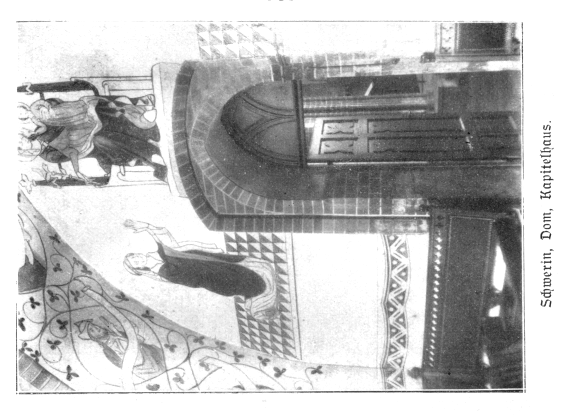
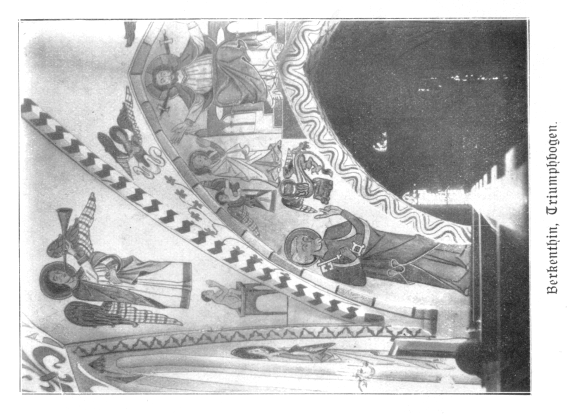


|
Seite 316 |




|
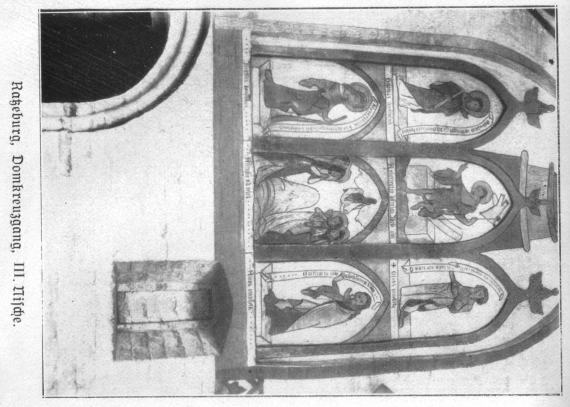
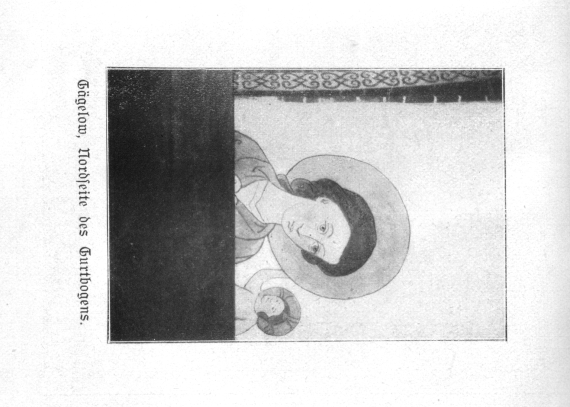


|
Seite 317 |




|
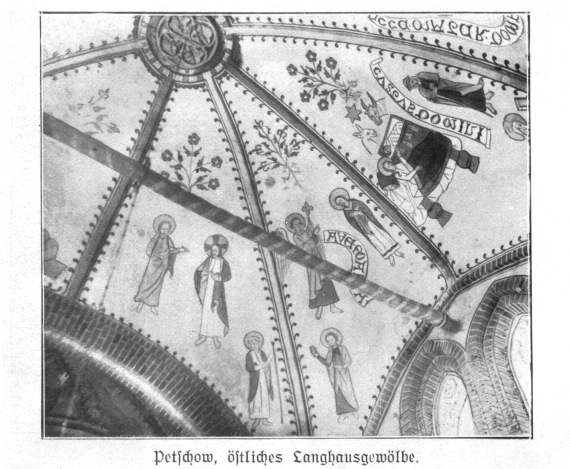
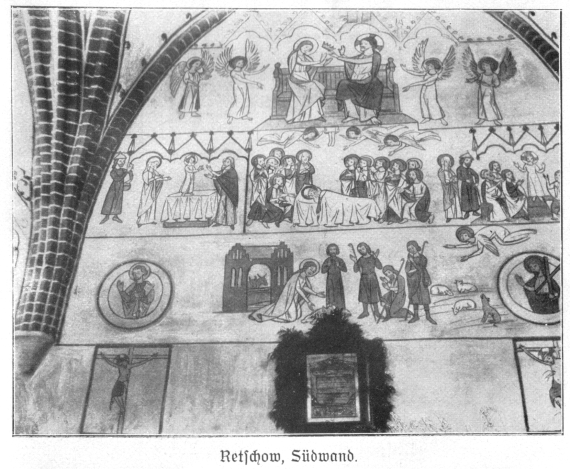


|
Seite 318 |




|
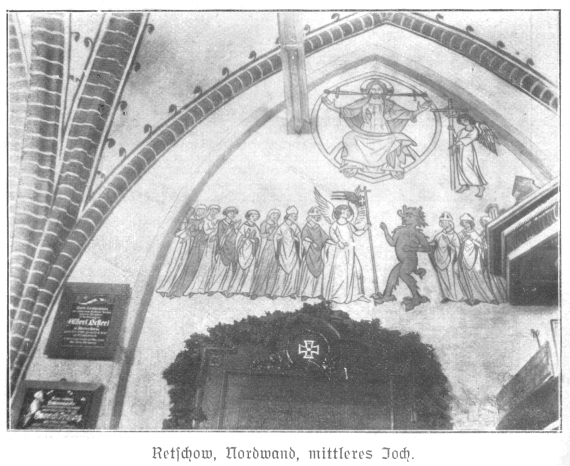



|
Seite 319 |




|
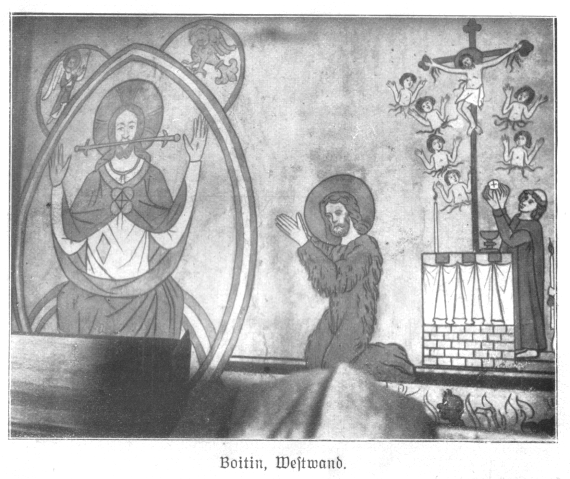
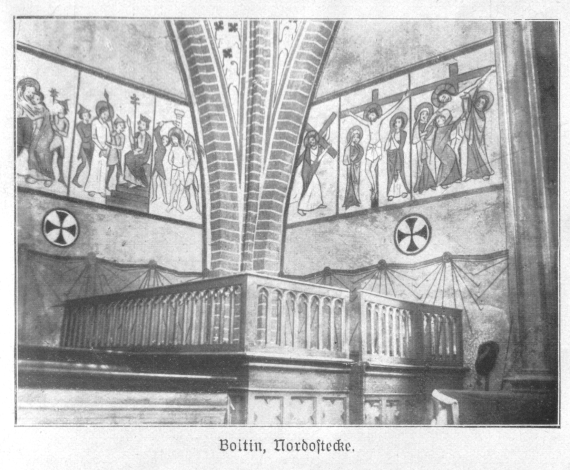


|
Seite 320 |




|
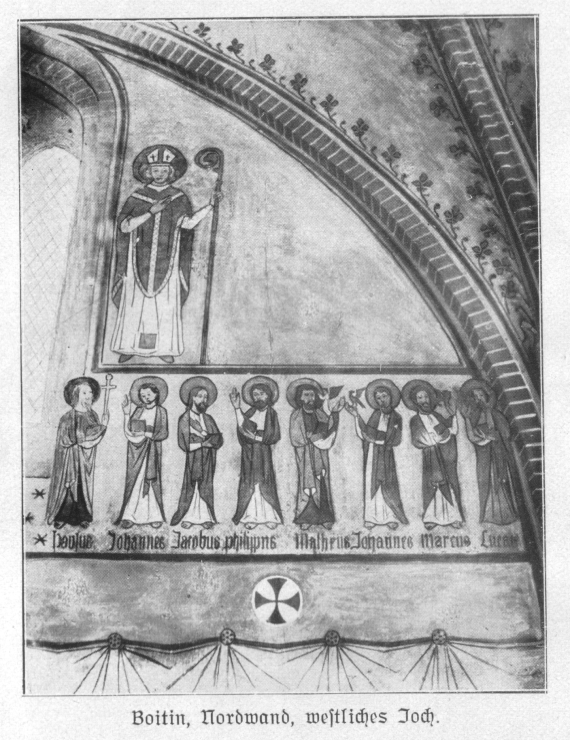


|
[ Seite 321 ] |




|



|


|
|
:
|
III.
Ein Beitrag
zur Einwanderungsfrage
von
Julius von Weltzien,
Generalmajor
z. D.,
Ehrenmitglied des
Vereins
für Mecklenburgische
Geschichte und Altertumskunde.
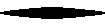


|
[ Seite 322 ] |




|


|
[ Seite 323 ] |




|
Im Mecklb. Monatsheft vom Jan. d. J. wird darauf hingewiesen, daß die Bauart eines großen Teils der Wohnhäuser in den mecklb. Bauerndörfern die des niederdeutschen Typus sei.
Auf diesen Umstand hat auch schon Lisch im Jahrbuch 13 (1848 hingewiesen, indem er auf eine überraschende Übereinstimmung der Bauart der Bauernhäuser in Mecklenburg und Westfalen aufmerksam macht und daraus mit Recht schließt, daß ein großer Teil der Bauern, welche Mecklenburg zu Ende des 12. und im 13. Jahrhundert besiedelten, aus Westfalen stammt, was er auch nach anderen Merkmalen für sicher annimmt.
Woher stammen nun aber die Adelsgeschlechter, welche urkundlich bald nach Eroberung des Landes durch Heinrich den Löwen auftreten und so vielfach wendische Familiennamen führen?
Masch in demselben Jahrbuch läßt diese Frage unentschieden, eine Lösung kann auch immer nur für jedes Geschlecht einzeln versucht werden. Ich möchte nun für einige Adelsgeschlechter des Landes den Nachweis führen, daß sie trotz ihres rein wendischen Familiennamens doch deutschen Ursprungs sind. Aus den Urkunden im Mecklenburgischen Urkundenbuch ersehen wir, daß zu der fraglichen Zeit der Besiedelung Mecklenburgs Familiennamen auch beim Adel noch nicht durchweg gebräuchlich waren; es finden sich zahlreiche Beispiele, daß die Personen, welche in den Urkunden genannt, nur mit Vornamen bezeichnet werden, und weiter eine Reihe von Fällen, daß Brüder oder sonstige Geschlechtsgenossen verschiedene Familiennamen führen, z. B. Hahn und Dechow, Schack und Estorf, Bülow und Britzkow, Brüsewitz-Brüsehaver und Weltzin, Holstein-Parkentin und Kruse, Negendank und Plüskow usw.
Also die Familiennamen standen damals noch nicht sicher fest, sie entstanden hier erst im Laufe des folg. Jahrhs., um die vielen Personen, welche den gleichen Vornamen führten, voneinander unterscheiden zu können, beim Adel in der Regel nach den Lehngütern.
Um also die wendische oder deutsche Herkunft eines Adelsgeschlechts Mecklenburgs zu erforschen, kann der Familienname vielfach keinen Anhalt bieten.
Dafür gibt es indessen beim Adel in manchen Fällen einen andern Weg, den durch das Wappen; das ist beim Uradel meistens älter als der Familienname. Der Brauch, daß ganze Geschlechter in allen ihren Gliedern ein gemeinsames Bild auf ihre Schilde


|
Seite 324 |




|
setzten, war schon vor Anfang des 12. Jahrhunderts die Regel.
Allerdings ist der Beweis für die Abstammung einer Familie durch die gleiche Schildfigur recht schwierig und auch trügerisch, denn eine Durchsicht des Siebmacherschen Wappenbuchs für den Adel Europas zeigt nur zu deutlich, daß viele Schildfiguren sich in allen Ländern unseres Erdteils wiederholen, wie z. B. Adler, Löwe, Bär, Lilie, Fisch, Flug, Balken, Stern, Fallgatter, Leiter usw.
Diese so weitverbreiteten Schildfiguren sind also für den Nachweis der Abstammung eines Adelsgeschlechts ziemlich wertlos. Es gibt nun aber solche Schildfiguren, die in einem ganz bestimmten Landstrich ursprünglich nachweislich entstanden sind und nur dort vorkamen; diese geben uns nun einen sicheren Beweis für die Abstammung eines Adelsgeschlechts. Eine solche Wappenfigur ist die "Pferdebremse oder Pferdeprame". Diese Wappenfigur kommt laut Siebmacher und dem Wappenbuch des westfälischen Adels ursprünglich nur beim Uradel in Westfalen vor, wie mir auch aus den westfälischen Archiven bestätigt wurde, und dort nur bei den Lehnsmannen der 877 gegründeten reichsunmittelbaren Benediktiner Nonnen-Abtei zu Essen an der Ruhr, und die Adelsgeschlechter, welche dies Wappen damals führten, leiteten es ursprünglich her von der Wildpferdezucht im Emschenbruch.
Von den mecklenburgischen Adelsgeschlechtern, welche urkundlich bald nach Eroberung des Landes durch die Deutschen auftraten, führten die Familien von Brüsewitz, von Brüsehaver, von Weltzin und von Wolkow die geflügelte Pferdebremse im Wappen. Dies bringt also den Beweis, daß diese vier Adelsgeschlechter Mecklenburgs trotz ihres wendischen Namens deutschen Ursprungs sind.
Jüngere Söhne des Adels aus den Landen Heinrichs des Löwen kamen mit dessen Heeren ins Land und wurden mit Lehngütern für ihre Kriegsdienste belohnt. Später kamen sie auch als Führer der herbeigerufenen deutschen Bauern ins Land und in den Besitz von Lehngütern mit wendischen Namen. Als die Nachkommen Niklots wieder in den Besitz des Landes gekommen und zum Christentum übergetreten waren, zogen auch sie, wie dies sicher die deutschen Grafen von Schwerin getan, neben den Resten des wendischen Adels diese deutschen Ritter an ihren Hof und in ihren Dienst und belehnten sie mit Grundbesitz, so daß es für die Abstammung eines Adelsgeschlechts auch nicht allein entscheidend ist, ob es zuerst urkundlich im Gefolge der deutschen Grafen von Schwerin oder der Fürsten aus Niklots Stamm auftritt.
Vielleicht regen diese Zeilen dazu an, daß auch andere mecklenburgische Adelsgeschlechter versuchen, mit Hilfe des Wappens ihre Abstammung klarzulegen.


|
[ Seite 325 ] |




|



|


|
|
:
|
IV.
Archivrat Carl Friedrich Evers
in
Schwerin
im Verkehr mit Johann
Bernoulli (III)
in Berlin
von
Geheimen Hofrat
Professor
Dr.
Wilhelm Stieda, Leipzig.
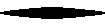


|
[ Seite 326 ] |




|


|
[ Seite 327 ] |




|
J ohann Bernoulli 1 ), der älteste Sohn des gleichnamigen Professors der Mathematik in Basel 2 ), kam im Jahre 1764 in dem jugendlichen Alter von 20 Jahren als Mitglied der von Friedrich dem Großen reorganisierten Akademie der Wissenschaften nach Berlin. Seinen Vater hatten in den 40er Jahren Leonhard Euler und Maupertuis vergeblich in die nordische Residenz zu ziehen sich bemüht 3 ). Er hatte, ein Schweizer, der an seiner Heimat mit unzerreißbaren Banden hing, es vorgezogen, in der Vaterstadt zu bleiben, wo er eine angesehene und allgemein anerkannte Persönlichkeit war 4 ). Wohl aber gönnte er seinem Sohne eine äußerlich glänzendere Zukunft, zumal, solange der Vater lebte, in Basel für ihn kein Platz war, und hatte dem Könige selbst den hoffnungsvollen Jüngling angetragen. Henri de Catt, der Vorleser des Königs 5 ), durch den dieser vielfach mit der Akademie verkehrte, ebenfalls ein Schweizer, hatte seine Hand dabei mit im Spiele gehabt und in höchster Verehrung für das Genie des Vaters dem jugendlichen Landsmanne gerne die Wege geebnet.
Johann Bernoulli, ein sicher und gewandt auftretender junger Mann von bester Erziehung, hatte sich in der Residenz des großen Monarchen einzuleben verstanden. Er behauptete seine Stellung in Ehren, wurde nach dem Tode von Castillon senior (1708-91)


|
Seite 328 |




|
Direktor der mathematischen Klasse in der Akademie und hinterließ, als er 63jährig starb, ein ruhmvolles Andenken. Nicht eigentlich beobachtender Astronom, hat er gleichwohl für diesen Wissenszweig manches geleistet, wenn er auch in der Geschichte der Astronomie keinen hervorragenden Platz einnimmt 6 ). Bekannter als durch seine fachwissenschaftlichen Studien ist er durch seine schriftstellerischen Leistungen, die sich nicht auf dem Gebiete der Mathematik bewegen. Er hat die auf eigenen Reisen gemachten Beobachtungen in Büchern herausgegeben, so 1774/75 die "Lettres sur différents sujets, écrites pendant le cours d'un voyage par l'Allemagne, la Suisse, la France méridionale et l'Italie" und 1779/80 die "Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, Rußland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778" Außerdem aber redigierte er mehrere periodische Journale: von 1781 bis 1787 eine "Sammlung kurzer Reisebeschreibungen", von der jährlich einige Hefte, im ganzen 18 Bände, schließlich ans Licht getreten sind, und von 1785 bis 1788 ein "Archiv zur neuern Geschichte, Geographie, Natur- und Menschenkunde". Auch stellte er 1786 bis 1791 eine Beschreibung Indiens auf Grund vorhandener Berichte zusammen, die in einer französischen und einer deutschen Ausgabe erschienen ist.
Wie es den Anschein hat, war es nicht nur der Drang zur Tätigkeit, der ihn dazu trieb, in seinen Mußestunden neben der amtlichen Arbeit sich derartigen literarischen Unternehmungen zu widmen, sondern auch der Wunsch, mit ihrem Ertrage seinem schmalen Einkommen aufzuhelfen. Friedrich der Große bezahlte die Mitglieder seiner Akademie nicht gerade üppig, so daß derjenige, der nicht über eigenes Vermögen verfügte und eine größere Familie zu ernähren hatte, leicht in Ungelegenheit geraten konnte. Um einen sicheren und flotten Absatz seiner Geisteskinder zu erzielen, wählte Bernoulli den damals vielfach eingeschlagenen Weg der Subskription. Er suchte schon vor dem Erscheinen seiner Druckwerke Pränumeranten und bedurfte zu diesem Zwecke an verschiedenen Orten der Hilfskräfte, die für ihn die Geschäfte besorgten, das Geld einsammelten und die eintreffenden Hefte verteilten.
So kamen Bernoulli und Carl Friedrich Evers zufammen. Ob der Herausgeber auf den letzteren als eine besonders geeignete Persönlichkeit, in Mecklenburg Propaganda für seine Periodika zu machen, hingewiesen war, oder ob Evers sich auf die durch die


|
Seite 329 |




|
Zeitungen gehende Ankündigung gemeldet hatte, läßt sich nicht mehr genau bestimmen. Nach dem ersten Briefe Evers' (Nr. l) hat sein Vetter, der Doktor Siemerling in Berlin, den Herrn Professor Bernoulli auf ihn aufmerksam gemacht. Doch könnte ja eine vorherige Anfrage von Evers und eine Bitte um Vermittlung vorausgegangen sein.
Carl Friedrich Evers ist am 10. Juni 1729 in Schwerin als Sohn von Johann Wilhelm Evers und der Margarethe Elisabeth Siemerling geboren. Nach beendetem Studium 7 ) wurde er zunächst Advokat, folgte jedoch im Jahre 1754 einem Rufe als Sekretär in das Geheime und Haupt-Archiv. Nach vierjährigem Dienste wurde er 1758 Archivar, 1767 Geheimer Archivar unter Beförderung zum Hofrat und 19 Jahre später zum Geheimen Archivrat ernannt (Nr. 14). Er ist dann im Alter von noch nicht völlig 74 Jahren am 14. April 1803 in Schwerin gestorben 8 ). Evers hat nicht nur als Archivbeamter sich in hervorragender Weise betätigt, er hat auch als Schriftsteller von sich reden gemacht. Sein bedeutendstes Werk ist wohl die Mecklenburgische Münzverfassung, die in zwei Teilen 1798 und 1799, ausgegeben ist 9 ). Der erste Teil behandelt die Geschichte des Münzwesens, während der zweite ein, wie ich glaube, sorgfältiges Münzverzeichnis bietet. Von ihm rührt ferner die "Betrachtung über eine in Rostock geprägte alte Münze in Grundlage der dieser Stadt ertheilten Landesherrl. Münz-Begnadigungsbriefe und urkundlichen Siegel nebst Anzeige einiger gefundenen Wendischen Münzen" 10 ) her, von der er Bernoulli selbst Mitteilung macht (Nr. 11 und Nr. 14). Er hat sich aber auch als guter Jurist und Kenner des Lehnrechts hervorgetan in der Schrift "Von der Mecklenburgischen Landtags-Resolution, die Einlösung der adjudicirten Lehn-Stücke betreffend" 11 ) und in dem Buch "Das Mecklenburgische Erb-Jungfrauenrecht, besonders die Frage betreffend, ob das zu den väterlichen Lehngütern gehörige Kirchen-Patronat den Erb-Jungfrauen oder den nächsten Agnaten zustehe" 12 ). Endlich wird die in den Gelehrten Beiträgen zu den Mecklenburg-Schwerinschen Nachrichten 13 ) abgedruckte "Ausführliche Geschichte der von Jakob Varmeyer an dem königlichen Obristen und Kommandanten von Rostock, Heinrich Ludewig von


|
Seite 330 |




|
Hatzfeld begangenen Mordthat", die mit einem E. unterzeichnet ist, von Bachmann 14 ) Carl Friedrich Evers zugeschrieben.
Ein solcher Mann verdient wohl, daß einige der von ihm herrührenden Briefe, die sich im Nachlaß von Johann Bernoulli erhalten haben 15 ), an die Öffentlichkeit gebracht werden. Die 14 Briefe aus den Jahren 1780 - 86, also vor mehr als 150 Jahren geschrieben, legen ein wohltuendes Zeugnis von der Gewissenhaftigkeit und Gelehrsamkeit ihres Verfassers ab. Sie sind auch kultur- und sittengeschichtlich bemerkenswert, sofern sie erweisen, wie ein hochstehender Mann, der gesellschaftlich und amtlich mit den tonangebenden Kreisen in beständiger Fühlung ist, sich mit allen Problemen abfindet, die ihm bei seinen Bemühungen, Subskribenten für Bernoulli zu gewinnen, aufstoßen. Ein offenbar liebenswürdiger und wohlwollender Charakter spricht aus ihnen, dessen Stimme wir gerne hören und dessen Bemerkungen über seine Zeitgenossen wir schmunzelnd quittieren. Sie sind auch gut stilisiert und man liest sie mit Vergnügen. Als guter Deutscher erweist er sich, wenn er gleich im ersten Briefe auf das an ihn in französischer Sprache gerichtete Anschreiben Bernoullis deutsch "in seiner Muttersprache" antwortet und tapfer zum Ausdruck bringt, daß er auch in den folgenden Schreiben bei ihr bleiben will.
Der Abdruck erfolgt hier nachstehend genau nach dem Original, an dem etwas zu ändern nicht geboten schien. Die jedesmal gleichlautende, sich wiederholende Anrede ist nur beim ersten Briefe mitgeteilt, bei den folgenden als selbstverständlich weggelassen worden.
Dank der umsichtigen Sorgfalt, mit der der Herr Archivrat sich des Werbegeschäfts annimmt, ist die Zahl der Subskribenten auf die Bernoullische Sammlung der Reisebeschreibungen 16 ) in Mecklenburg recht hoch gewesen. Der erste Band der Sammlung weist in der ihn eröffnenden Subskriptionsliste für Schwerin nicht weniger als 17, in Bützow und Rostock je 1, in Ludwigslust 3 Namen auf. Ein Nachtrag in einem späteren Bande nennt noch für Rostock und Schwerin je 1, nämlich die Buchhandlung Koppe und den Regierungssekretär Blume. Evers selbst jedoch gibt (Nr. 6) die Zahl der von ihm gewonnenen Subskribenten auf 25 an, war aber mit diesem Erfolg nicht ganz zufrieden. Sicher war es seinem Einflusse und seinem Eifer zuzuschreiben, daß vor allem die allerhöchsten Herrschaften sich entschlossen zu subskribieren.


|
Seite 331 |




|
Bei den spezifisch mathematischen Werken, den aus dem Nachlasse des hervorragenden Mathematikers Lambert von Bernoulli herausgegebenen Abhandlungen, mußte freilich das Interesse erlahmen. Nur drei Liebhaber hatte er für dieses Buch finden können, je einen in Bützow, Güstrow und Rostock. Begütigend meint Evers, daß für derartige, fachliche Kenntnisse voraussetzende Bücher das mecklenburgische Publikum noch nicht genügend vorgebildet wäre. Wahrscheinlich würde selbst heute die Neigung, sich in solche Werke zu vertiefen, nicht größer sein, und zwar nicht in Mecklenburg allein.
Daß die Erfahrungen, die gelegentlich bei Subskriptionen und Vorausbezahlung von angekündigten Büchern, indem die Werke nie erschienen, auf die man sich verpflichtet hatte, in Mecklenburg abschreckend gewirkt hätten, ist kaum anzunehmen. Die wohlbekannten Namen des Herausgebers und des Vermittlers werden Bürgschaft genug gewesen sein dafür, daß man nicht für leere Versprechungen sein gutes Geld hingab. Wie es ihm mit den von einem Kriegsrat Brochmann angekündigten Briefen ergangen war, erzählt er selbst dem Professor Bernoulli und bittet ihn sogar, ihm bei der Rückzahlung des gezahlten Betrages behilflich zu sein. Indes wird Evers wohl nichts erreicht haben, denn ich kann die Sammlung in Heinsius Bücherlexikon nicht nachweisen.
Eher ist es denkbar, daß der jährliche Abonnementspreis von einem Dukaten, obwohl er nicht gerade ein hoher genannt werden muß, für die Mittellosigkeit weiter Kreise der Bevölkerung nicht erschwinglich war. Hierauf wirft die Begründung von Lesegesellchaften Licht, in denen das Buch umlief. Sie sind offenbar im 18. Jahrhundert aufgekommen und waren damals vielleicht verbreiteter als heute, sowohl in kleineren als in größeren Städten oder gar auf dem platten Lande.
Große Freude bereitet dem Herrn Archivrat die goldene Medaille, die er im Namen des Herzogs in Anerkennung der ihm von Bernoulli übersandten Schriften dem Berliner Professor überreichen darf (Nr. 2). Die in dem fünften Everschen Briefe in Klammern stehenden Ausführungen hat Bernoulli schleunigst, ohne des Verfassers Zustimmung dazu eingeholt zu haben, in dem nächsten Hefte der Reisebeschreibungen veröffentlicht. Den Namen des Verfassers hat er dabei nicht genannt. Daran knüpft eine weitere Ausführung von anderer Seite, die die von Evers vertretene Ansicht bekämpft. Doch macht auch bei dieser Gelegenheit der Angreifende sich ebenso wenig namhaft. Evers geht dann in seinem Briefe vom 3. September 1781 darauf ein und liefert einen


|
Seite 332 |




|
neuen Aufsatz zur Geschichte des Kirchenkastens von Angermünde (Nr. 6). Dieser Aufsatz hat im Band 4 der Bernoullischen Sammlung 17 ) Aufnahme gefunden und wird daher nachstehend nicht mit abgedruckt. Evers Namen bleibt jedoch dabei verschwiegen. Der Herausgeber teilt lediglich mit, daß ihm der Aufsatz von einem Freunde in Mecklenburg zugegangen sei.
Dem Wunsche Bernoullis nach Beiträgen aus Mecklenburg für seine Sammlung konnte Evers insoweit entsprechen, als er jemanden fand, der sich geneigt zeigte, einige Irrtümer, die in des Thomas Nugents Reisen durch Deutschland, besonders Mecklenburg 18 ), enthalten waren, zurechtzustellen. Es war der Geheime Kammerrat Jakob Fr. Joachim von Bülow auf Klaber im Amte Güstrow 19 ), der ihm diesen Gefallen tat. Ursprünglich hatte Evers den Geheimen Kanzleirat Aepinus 20 ) in Rostock für diesen Zweck ins Auge gefaßt, aber gleich selbst einschränkend hinzugefügt, daß er wegen Überhäufung mit Amtsgeschäften wohl nicht dazu in der Lage sein würde (Nr. 6). Da seine Ahnung sich erfüllte und Aepinus offenbar die Aufforderung, Zusätze zum Nugent zu liefern, abgelehnt hat, wandte sich Evers im Interesse seines Vaterlandes wie auch wahrscheinlich, um Bernoulli einen Gefallen zu tun, an Herrn von Bülow. Dessen Zurechtstellungen sind dann im Band 6 der Bernoullischen Sammlung 21 ) gedruckt worden. Andere Beiträge aus Mecklenburg scheint Evers, obwohl er im September 1781 einen neuen interessanten Beitrag in Aussicht stellte (Nr. 7), nicht beschafft zu haben.


|
Seite 333 |




|
1. C F. Evers in Schwerin an Johann
Bernoulli in Berlin.
Schwerin 1780,
August 13.
Wohlgeborner Herr Doctor!
Höchst zu verehrender Herr!
Hätte mein Vetter, der Herr Doctor Siemerling, nicht schon längstens auf meine ganze Liebe und Hochachtung die gegründeste Ansprache gehabt, so würde er solche lediglich schon dadurch verdienen, daß er mir die schäzbarste Gewogenheit Ew. Wohlgeboren und eine Gelegenheit verschaft hat, Denenselben meine unbegränzte Verehrung und Bereitwilligkeit, wie wohl nicht so vollenkommen als ich es wünsche, bethätigen zu können. Zwar muß ich schon gleich besorgen, daß Ew. Wohlgeb. über einen so langen Verzug meiner schuldigsten Antwort unzufrieden seyn mögten: allein die Absicht, von dem nächsten Erfolg meiner Ausrichtung Deroselben Befehle zugleich zu berichten, wird mein bisheriges Stillschweigen in etwas rechtfertigen.
Noch an demselben Tage des Empfangs Ew. Wohlgeb. gewogentlichen Schreibens, nemlich den 22ten v. M., habe ich den Anschluß nebst den Büchern, Abriß und Avertissement mit einem unterthänigsten Begleitungs-Schreiben meinem gnädigsten Herrn 1 ) übersandt. Eine persönliche Ueberreichung war nicht möglich, weil Höchstdieselben sich stets in Ludewigs Lust aufhalten und sehr selten in Schwerin kommen. Höchstdieselben sind ein zu großer Freund gelehrter Producte und deren berühmten Verfasser, als daß die unverzüglichste Erwiederung einer hohen unmittelbaren Dancksagung bezweifeln könnte, wiedrigenfalls wäre es der Unaufmerksamkeit höchst Ihrer Cabinets-Bedienten lediglich beizumessen.
Das für mich beigeschlossene Exemplar der Astronomischen Briefe 2 ) und der Abriß sollen in meiner Bücher-Sammlung als ein Denckmal Ew. Wohlgeb. großen Gewogenheit gegen mich aufbehalten bleiben und sie werden mich stets an die angenemste Pflicht, solche einigermaßen zu verdienen, erinnern; es konnte mir also der Auftrag in betref Dero vorhabenden Sammlung kurzer Reise-Beschreibungen nicht anders als sehr angenem seyn. Auf verschiedene Art habe ich versucht, den Prospect derselben in meinem Vaterlande bekannt zu machen. Erstlich ließ ich solchen alhie unter den Gelehrten und Freunden einer guten Lecture zur Subscription coursiren, zweitens besorgte ich eine hinlängliche Nachricht davon in den hiesigen, durch ganz Mecklenburg sich verbreitenden Intelligenz-Blättern und politischen Zeitungen 3 ) und drittens habe auswärts einige Sub-Collecteurs bestellet. Dennoch muß ich Ew. Wohlgeb. offenherzig gestehen, daß der Erfolg meiner


|
Seite 334 |




|
Erwartung bis jetzt noch nicht entsprochen habe. Nur 12 Liebhaber haben sich hieselbst zu Praenumeration unterschrieben, bei Auswärtigen kan ich mich zur Zeit noch keines Absazes rühmen, vieleicht ist Deroselben den Buchführern gemachte Offerte in etwas Ursache davon, weil mancher wahrscheinlich von denselben es besseren Preises erwartet als durch den Weg der Praenumeration. Dem sey aber wie ihm wolle: so werde mit dem grösten Vergnügen mich bestreben, die Zahl der Praenumeranten möglichst zu vermehren. Inzwischen erbitte Ew. Wohlgeb. fernern Befehl, ob ich den Praenumerations=Preis sogleich abfordern und übersenden solle, oder ob damit bis zum erfolgten Abdrucke und Auslieferung des ersten Bandes Anstand zu nehmen? In beiden Fällen werde eine pünctliche Folge leisten und auch dadurch vergewissern, das ich mit vollenkommenster Verehrung Zeitlebens beharre
unterthänigster Diener
C. F. Evers.
N.S. Ew. Wohlgeb. haben mich mit einem französischen Schreiben beehret und ich erdreiste mich in meiner Mutter-Sprache zu antworten, nicht aus der Ursache, daß mir jene unbekannt seyn sollte, sondern weil es mir in vielen Jahren an der Gelegenheit, mich darinn schriftlich auszudrücken, mithin auch an der Uebung gefehlet hat. Ist Ew. Wohlgeb. die französische Sprache bequemer: so bitte es mir zur Gewogenheit aus, in betref der erbetenen Antwort keine Abänderung zu machen. Im Lesen ist mir selbige so bekannt als die deutsche.
Schwerin den 13ten August 1780.
2. An denselben. Schwerin 1780, September 21.
Es ist zwar die in meiner Ew. Wohlgebornen hoffentlich behändigten Antwort vom 13ten August geäußerte Vermuthung wegen einer höchst unmittelbaren Dancksagung für Dero meinem gnädigsten Herrn übersandte astronomische Wercke nicht völlig eingetroffen: so bin dennoch von Deroselben edlen Denkungs-Art zu sehr überzeuget, als daß ich einige Unzufriedenheit über diesen durch ganz unerwartete Hindernisse veranlaßten Verzug bei Ihnen besorgen dürfte. Ew. Wohlgeb. nicht allein hievon, sondern auch, daß Serenissimo dero schäzbares Geschenck und Attention vorzüglich angenem gewesen, die vollenkommenste Versicherung zu ertheilen, dieses ist es, wozu ich eben jezo von dem Durchlauchtigsten regierenden Herzog den besondern Auftrag, aber auch zugleich den hohen Befehl, angeschlossene goldene Medaille als ein geringes Merckmal Ihrer ganz vorzüglichen Hochachtung gegen die großen Verdienste Ew. Wohlgeb. denenselben zum geneigten Andencken zu übermitteln, erhalten habe.
Gewiß kein Geschäfte hätte mir je angenehmer seyn können als eben dieses, und ich würde mich recht glücklich schäzen, wenn


|
Seite 335 |




|
Ew. Wohlgeb. von dero Zufriedenheit darüber und von der Fortdauer deroselben Gewogenheit, nicht weniger wie ich mich laut meiner vorigen Anfrage wegen der Praenumerations-Gelder auf die zu edirende Reise-Beschreibung, und wan der erste Theil derselben etwa die Presse verlassen mögte?, hochgeneigt mich belehren wollten, da ich den nicht verfehlen würde, die bestimmte Zahl der hiesigen Praenumeranten, zu deren Vermehrung ich noch einige Hofnung habe, schuldigst anzuzeigen, sowie ich mit unbegränzter Hochachtung beharre
C. F. Evers.
Schwerin den 21. September 1780.
N.S. Dürfte ich wohl mit der Bitte zur Besorgung des Anschlusses beschwerlich fallen?
3. An denselben. Schwerin 1780, Dezember 7.
Ew. Wohlgeb. beide gewogentliche Schreiben vom 31ten August und 30ten September habe richtig erhalten, wiewohl den ersten noch einen Tag später als den zweiten, und ich habe nicht ermangelt, den Einschluß an Serenissimum Höchstdenenselben alsobald behändigen zu lassen.
Schon eher würde mir die Freiheit genommen haben, die hiesigen Praenumerations-Gelder auf dero Sammlung kurzer Reise-Beschreibungen einzufordern und schuldigst zu übersenden, woferne theils die Hofnung zu mehrern Praenumeranten und die Entfernung meiner Sub-Collecteurs, deren einer zu Ludewigs-Lust doch nur einen Beitrag liefern können, dieses Geschäfte nicht in etwas verzögert hätten. Jezo entlädige mich dieser meiner Pflicht, indem ich hierdurch 23 Species Dukaten für 23 Exemplare nebst dem anbefohlenen Verzeichnisse der Praenumeranten überliefere und dagegen, außer einer geneigten Antwort wegen des Empfanges, zu seiner Zeit die Exemplare vollständig und unbeschädigt ganz gehorsamst erbitte. Wie gerne hätte ich diese geringe Zahl auf eine weit ansehnlichere Summe vergrößert! es ist mir aber bei so wenigen Liebhabern einer angemessenen und nützlichen Lectür, auch bei der Abneigung gegen Praenumerations-Wercke in hiesiger Gegend unmöglich gewesen. Ew. Wohlgebornen wollen also den besten Willen für die That annehmen.
Aber werde ich auch wohl von Ihnen Verzeihung gewärtigen können, wen ich mich erdreiste, den Einschluß an den Herrn Doctor Siemerling zur Beförderung gehorsamst zu empfehlen?
Gewiß ich hätte diesen Schritt nicht gewagt, wen ich von seinem dasigen Aufenthalte und Logis noch völlig versichert wäre. Inzwischen und da auch von seiner Abreise keine Nachricht erhalten, will ich es hoffen, wiedrigenfalls würde zu einer zweiten noch unverschämteren Bitte mich fast gezwungen finden.
Die Anlage mit dem darinn befindlichen Gelde betrifft einige Exemplare von den in Berlin herausgekommenen Briefen zur Er-


|
Seite 336 |




|
innerung an merckwürdige Zeiten und rühmliche Personen aus dem wichtigen Zeitlaufe von 1740 bis 1780, 2 Theile, um deren Absaz mein Vetter mich ersucht hat und welche der Verleger für 1 Rthlr. 24 sl. abstehen will. Sollte nun der Herr Dr. Siemerling nicht mehr daselbst oder in der Nähe sich aufhalten und der Verleger, wie ich hoffe, Ew. Wohlgeb. bekannt wäre: so wünschte, daß dieselben den Einschluß entsiegeln, die sieben Exemplare für mich erstehen und ehestens übersenden mögten.
Ich schmeichle mich einer gewogentlichen Nachsicht wegen eines solchen Ihnen vieleicht unbequemen Auftrags und versichere dagegen, daß mir keine Beschäftigungen so angenem und dringend seyn werden als eben diejenigen, wodurch ich überzeugend beweisen kan, mit welcher unwandelbaren Verehrung beharre
unterthänigster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 7ten December 1780.
4. An denselben. Schwerin 1781, März 15.
Wen ich Ew. Wohlgeb. ganz gehorsamst versichere, daß die übersandten 23 Exemplare des ersten Bandes deroselben Sammlung kurzer Reise-Beschreibungen an die Behörden richtig abgegeben worden: so erkenne mich zugleich höchstens verbunden, sowohl für die beiden übrigen Exemplare, wovon eines meinem Subcollecteur zutheil geworden, als auch besonders für die durch Bemerckung meines Namens in dem Praenumeranten-Verzeichnisse mir erwiesene unverdiente Ehre.
Wären alle Stunden meines Lebens für mich so vergnügt als diejenigen, welche in diesem so allgemein beliebten Wercke zu verdancken habe, mit Schaudern würde ich an das lezte Ziel meines Lebens dencken. Eine Auswahl unter der Sammlung der Reise-Beschreibungen zu treffen, dieses überlasse um so lieber andern, als ich den Verdacht einer Schmeichelei, auch bei der reinsten Wahrheit, nicht gerne auf mich laden mögte. Sollte ich indeß bei diesem ersten Bande etwas bemercken müssen: so würde es vieleicht auf eine Beschuldigung meiner eigenen Unvorsichtigkeit ausfallen. Ich lese in dem Verzeichnisse der Praenumeranten: Se. Hoch fürstl. Durchlaucht der regierende Herzog Friederich z. M. und ferner Ihre Herzog liche Durchlaucht die regierende Herzoginn Louise Friederike z. M. Sollte in meinem übersandten Verzeichnisse nicht bei beiden das Wort herzoglich stehen, so wäre freilich der Fehler nur mir beizumessen, welchen, womöglich, abzuändern bitte.
Den bis zum 1ten April verlängerten Praenumerationstermin habe sogleich durch die hiesigen Intelligenzblätter wieder bekannt gemacht. Allein ebensowenig ist die vorige Zahl dadurch vermehret als wenig die dasigen Astronomischen Wercke das in diesem Fache noch zu unerfahrene Mecklenburgische Publicum


|
Seite 337 |




|
interessiren; nur zu deroselben lettres astronomiques habe einen einzigen Freund gefunden, wofür der Herr Doctor Siemerling 8 Gr. N. 2 / 3 an dieselben abliefern wird, und welches mit den Exemplaren des zweiten Bandes dero Reise-Beschreibungen gehorsamst erwarte. Ist es aber wohl zu bewundern, daß wir mit den Sternen so unbekannt sind, da wir sogar die Oberfläche unsers eigenen Vaterlandes nicht weiter als mit dem Pfluge berühren, mindestens die beendigte genaue Landes-Vermessung noch in keiner Landkarte im ganzen nuzbar gemacht haben. Berlin muß uns auch hierinn zuvorkommen. Die fürtrefliche von der Academie der Wissenschaften schon anno 1764 edirte Karte 4 ) macht dem Lande Mecklenburg Ehre, und dieselbe des Herrn Grafen von Schmettow 5 ), wovon bis jezt zwei Blätter dem Publicum überliefert sind, ist in betref des saubern Stiches und des großen Maßstabes für das kleine Fürstenthum Stargard, eine der prächtigsten und übertrift alle Erwartung. Aber wäre es nicht möglich gewesen, dem Grundrisse auf den 9 Blättern eine solche Stellung zu geben, daß aus der Zusammensetzung derselben ein regelmäßiges Ganzes, ich meine ein Oblongum entstanden? Hätten die inneren Abtheilungen nicht durch Farben unterschieden werden können und war es nur der Absicht des Herrn Grafen angemessen, dieses Land gleich einer Insel im Weltmehre darzustellen? da doch bei Bestimmung der Landes-Gränzen beiderseitige daran gelegene Grundstücke und Gegenden auf der Karte unentbehrlich sind.
Verzeihen Ew. Wohlgeb. der Ausschweiffung eines unberufenen Beurtheilers; vieleicht habe ich mich dabei von dem eigentlichen Gesichtspunkte des Herrn Verfassers zu weit entfernt; nie werde aber die Gränzen meiner Pflicht und aufrichtigsten Verehrung überschreiten, mit welcher unverbrüchlich beharre
unterthänigster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 15ten März 1781.
5. An denselben. Schwerin 1781, Juni 11.
Von dem nachfolgenden Briefe ist die eingeklammerte Stelle [ ] gedruckt in Johann Bernoullis Sammlung kurzer Reise-Beschreibungen 3 (1781) S. 400-401.
Einem der hiesigen Praenumeranten auf Ew. Wohlgeb. Sammlung kurzer Reisebeschreibungen ist der erste Band derselben von


|
Seite 338 |




|
Händen gekommen und er wünschet statt dessen ein anderes Exemplar der zwoten Auflage wieder zu erhalten; ich nehme mir also die Freiheit, um gewogentliche Uebersendung dessen nebst Bestimmung des Preises entweder in Gold oder N. ²/3 dafür, bei Gelegenheit des dritten Bandes, womit zugleich der Herr Regierungs Secretair Blume den seinigen erwartet, ganz gehorsamst zu bitten.
Der zweite Band enthält recht viel schönes, [besonders aber war mir die Nachricht pag. 256 von einem in der Angermündischen Kirche als eine besondere Seltenheit aufbehaltenen Kasten, worinn des Herzogs Hans Lösegeld soll gelegen haben, auffallend, weil ich mich sogleich aus meiner vaterländischen Geschichte erinnerte, daß derselbe der Herzog Johann oder Hans von Mecklenburg-Stargard gewesen, welcher auf Veranlassung des Churfürsten Friedrich des ersten von Brandenburg durch den Grafen zu Ruppin und Lindow im Jahr 1418 oder 1419 zu Koblanck im Stargardischen überfallen, gefangen genommen und nach Tangermünde gebracht worden, woselbst er bis 1427 in schweren Fesseln gehalten und nebst anderen harten Bedingungen eine große Summe Geldes (zu dessen Aufbewahrung hat also wohl der Kasten gedienet) zum Lösegeld zahlen müssen. (Franck, Alt- und Neu-Meckleburg Lib. VII pag. 163 sq. et 211).] Jedoch vieleicht komme ich zu spät mit dieser Kleinigkeit und vermuthlich haben Ew. Wohlgeb. solches schon selbst aus der Brandenburgischen Geschichte wahrgenommen.
Das Post-Porto von Lenzen bis hierher beträgt aufs Jahr zwischen 5 und 6 Mark schwer Geld; bei den nicht allein hieselbst, sondern zum größten Theil hin und wieder in Mecklenburg wohnhaften Praenumeranten würde es mit Weittläufftigkeit verknüpft, besonders aber in betref der herzogl. Familie bedencklich seyn, wen ich denselben jedesmahl einen oder einige Schillinge Porto abfordern sollte, um so mehr nehme deroselben gefälliges Anerbieten, diesen kleinen Verlag zu seiner Zeit berechnen zu dürfen, dancknehmigst an, vieleicht aber würden Ew. Wohlgeb., mindestens in Rücksicht der Münzsorte, gewinnen, wen die Rackete bis hieher völlig frei gemacht werden könnten.
Mit vollenkommenster Hochachtung habe die Ehre zu beharren
unterthänigster Diener
C. F. Evers.
N. S. Meine verbindlichste Empfehlung an den Herrn Dr. Siemerling bitte gelegentlich zu vermelden, auch daß ich zu dem dritten Theile der Briefe zur Erinnerung etc. mir baldige Hofnung machte, ob ich gleich selbige in dem allgemeinen Franckfurt- und Leipziger-Meß-Catalogo d. J. nicht bemerkt gefunden 5a ).
Schwerin den 11ten Juny 1781.


|
Seite 339 |




|
6. An denselben. Schwerin 1781, September 3.
Eine Anlage zu diesem Briefe ist gedruckt in Bernoullis Sammlung kurzer Reisebeschreibungen 4 (1781) S. 406-15 und daher hier nicht wiederholt.
Nebst Ew. Wohlgeb. gewogentl. Schreiben vom 12ten v. M. habe die Exemplare des dritten Bandes, wie auch zwei derselben des ersten richtig erhalten. Der Herr Archiv Secretair Schmidt hatte seinen ersten Band an einen Freund geliehen, welcher solchen nach einiger Zeit nicht wieder liefern konnte, daher er mich um Verschaffung eines andern an dessen Stelle ersuchte. Kurz vor dem Empfang dessen fand der vermißte Band sich wieder an, und dieses hatte zur Folge, daß der Freund nunmehro dieses Werck gleichfalls zu halten und zu continuiren sich entschloß. Er hat mir für alle vier Theile anliegenden Holländischen Ducaten behändiget und erwartet dagegen den 2. 3. und 4ten Band, nach erfolgtem Abdrucke des lezteren. Ich machte ihm den Einwurf, daß die Praenumerations-Zeit schon verflossen wäre, allein er glaubte, Ew. Wohlgeb. würden sich damit begnügen, weil dadurch der Defect gehoben, und dieselben die einigen Provinzen offerirte Prolongation bis zum 1sten October ihm gleichfalls zu gute kommen lassen würden, mithin fielen die notirten 40 sl. für den übersandten ersten Band aus meiner Berechnung. Hierüber und besonders, wen mehrere dergleichen einzelne Praenumeranten sich ergeben sollten, erbitte dero Befehl, ob ich, wie jezo, das Geld sogleich mit der Post (dieses Porto bis Lenzen bezahle ex propriis) übersenden oder bis zur Praenumeration für den folgenden Jahrgang damit warten oder auch solches jemanden hieselbst zustellen solle.
Folgende Stelle Ew. Wohlgeb. Schreibens: Es ist schlimm, das das Porto so hoch kömmt . . indessen muß ich mir wohl diesen Abgang gefallen lassen, wen es nicht anders seyn kan und da ich mich schon dazu verbunden habe etc., sezet mich, ich gestehe es aufrichtig, in Verlegenheit, weil ich, nach meiner Situation von den theils hieselbst theils auch in Ludewigslust, Lübeck, Neu-Strelitz, Rostock und Stavenbagen zerstreut wohnenden Praenumeranten das Postporto, welches man hieselbst sonsten in allen dergleichen Fällen niemahlen bezahlet, einzufordern mich fast ohne Unannemlichkeiten außer Stande finde, in betref der fürstlichen Familie aber aus erheblichen Ursachen solches gar nicht gerathen finde. Dieses ist mein erstes Geschäfte von der Art, womit ich mich bis hieher noch nie befasset habe, außer dem Porto von Lenzen bis Schwerin, welches gemeiniglich 24 sl. M. V. jedes Mahl beträget und der Correspondence mit den Interessenten habe ich beinahe so viele Kosten als die Praenumeration eines Jahrganges beträget. Nicht Gewinnsucht, sondern lediglich die Achtung gegen Ew. Wohlgeb. und die Liebe gegen den Herrn Dr. Siemerling hat mich zur Übernahme dessen bewogen. Ew. Wohlgeb. verheißen in dero ersten Ankündigung auf 10 Exemplare das 11 te frei und in der Nachricht


|
Seite 340 |




|
bei dem dritten Bande auf 6 Exemplare das 7te oder dem Abzug des siebenden Theiles des Geldes und dabei das freie Porto nicht allein bis an die Gränze sondern auch bis Leipzig, Dresden, Nürnberg, Basel, Münster, Hamburg und andere Oerter mehr. Schwerin ist kaum 24 Meilen von Berlin, meine Zahl der Praenumeranten beläuft sich jezo (ich weiß nicht, ob solche in der Folge zu- oder abnehmen wird, Todes- oder andere Fälle lassen dieses eher als jenes vermuthen) auf 25. Zwey überschüssige Exemplare habe dagegen von dero Gewogenheit oder vielmehr nur eines, weil das andere einem Subcollecteür für 10 Exemplare gebühret . . . jedoch genug hievon, dero endlicher Entschluß wird mich vergewissern, ob dieselben obige Verheißungen auf mich anwenden, und im Falle des Abzuges trage ich die Kosten von Lenzen bis hieher und so weiter.
Ew. Wohlgeb. wünschen einige gute Aufsätze für dero allgemein beliebte Sammlung, wenigstens Anmerckungen und Ergänzungen des weil. Herrn Nugent's Reise. Freilich würde dieses meinen Landesleuten Ehre machen, auch manche Örter und Seltenheiten Mecklenburgs gemeinkündiger darstellen; aber zur Zeit wüste ich doch von meinen Bekannten oder andern noch keinen, der im ersten Falle hiesige Gegenden mit einem forschenden Blicke durchgereiset, weniger aber beurtheilende Diarien von seinen Reisen entworfen hätte. Indeß will ich mich darnach umsehen und, sollte ich brauchbare Entdeckungen machen, davon benachrichtigen. Nugents Reisen lassen sich, soviel ich aus dem übersezten ersten Theile schließe, ziemlich lesen, sie sind freilich hin und wieder, wie die mehresten der Art, mit unbedeutenden Kleinigkeiten überladen und enthalten wenig für jeden Leser Intressantes, auch manches Fehlerhafte, daher der Übersezer solche zum Theil in den Anmerckungen berichtigt hat. Ich kenne einen unter meinen Freunden und Korrespondenten, auch Nugent hat ihn schon selbst, der reinen Wahrheit gemäß, als einen Mann von großer Gelehrsamkeit und dem besten Herzen geschildert, es ist der Geheime Kanzelei-Rath Aepinus zu Rostock, welcher gewiß am fähigsten wäre, die besten Anmerckungen darüber zu entwerfen, nur sorge ich, daß seine vielen Amts- und anderen Geschäfte ihm keine Muße dazu lassen werden. Versuchen will ich es doch bei der ersten Gelegenheit, ob ich ihn dazu bereden kan, vieleicht übernimmt er diese Arbeit oder bringet einen andern dazu in Vorschlag.
Nun noch etwas von meiner vorherigen brieflichen Anecdote in Betref des Angermündischen Kirchen-Kastens. Es war ein flüchtiger und der Zeit ganz unreifer Gedanke, dem ich, gefraget, keinen Plaz in dem dritten Bande dero Sammlung würde zugestanden haben. Geschehene Dinge sind nun nicht zu ändern; vieleicht wird ein anderer dadurch gereizet, den Zweifels-Knoten zu entwickeln. Finden Sie bei meiner Erklärung Bedencklichkeiten, so würde ich gerne denselben von Ew. Wohlgeboren meinen ganzen, wiewohl


|
Seite 341 |




|
geringfügigen Beifall geben, den zu dergleichen Controversen habe so wenig Zeit als Neigung, aber - - - Nun über dieses Aber habe in der Anlage etwas ausführlicher gehandelt. Machen Ew. Wohlgeb. damit, was Ihnen beliebt, ist es ganz untauglich, so wird es doch wenigstens zu Vidibus gut seyn. Sind wir nun gleich im obigen Falle nicht von gleicher Meinung, so schmeichele mich dennoch der Fortdauer dero Gewogenheit, wogegen ich mit unverbrüchlicher Hochachtung mich nenne
unterthänigster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 3ten September 1781.
N.S. In voriger Woche sind unser durchlauchtiger Prinz Friedrich Franz mit ihrer Frau Gemahlin 6 ), dem Herrn Geheimen Rath und Oberhofmarschall Baron von Lützow 7 ) von hier nach Berlin und Pozdam gereiset, um das dasige Sehenswürdige in Augenschein zu nehmen. Vieleicht sind sie noch dorten. Eine gute Gelegenheit etwas ohne Kosten herrüber zu senden, deren sich allenfalls Herr Dr. Siemerling, wo er schon wieder da ist, zu Nuze machen könnte. Ich weiß nicht, wie es mit dem mir schon lange versprochenen dritten Theil eines Buches stehen möge, und ob derselbe endlich die Presse verlassen habe, oder gar nicht erscheinen werde.
7. An denselben. Schwerin 1781, Dezember 24.
Ew. Wohlgeboren können nicht mißvergnügter über den langen Verzug meiner Antwort und der einzusendenden Praenumerations Gelder für den zweiten Jahrgang dero Sammlung kurzer Reise-


|
Seite 342 |




|
Beschreibungen seyn als ich selbst bin. Jch habe mich seit dem Empfange des lezten Bandes durch eine Missive hieselbst und verschiedene Briefe an meine auswärtigen Freunde alle mir ersinnliche Mühe gegeben, die Zahl der Liebhaber zu diesem schäzbaren Wercke nicht allein zu erhalten, sondern auch zu vermehren, aber ist es Mangel am Gelde oder Abneigung gegen alle Pränumerationen . . . Wunsch und Hofnung ist mir dabei fehlgeschlagen, vielmehr ist jene durch den Todt des Herrn Regierungsraths zur Nedden 8 ) und Aufsage des Herrn Cammerjunckers von Ranzow und Hofraths Hertel sogar auf 3 vermindert, so daß zur Zeit noch 22 Praenumeranten übrig geblieben. Zwar habe ich mich auch in Güstrow um Subscribenten beworben, aber bis jezt von da noch keine Antwort erhalten. Sollte ein oder der andere sich dazu angeben, so werde nicht verfehlen, ungesäumt davon zu benachrichtigen. Die Praenumeration auf 22 Exemplare des künftigen Jahrganges und auf eines für mich (mein Subcollecteur hat für seinen Antheil Geld gewählet und abgezogen) beträgt laut anliegender hoffentlich mit dero gewogentlichen Offerte übereinstimmende Berechnung, deductis deducend., 54 Rth. 29 sl. oder resp. 11 Spec. Ducaten, 5 Louisd'or und 9 sl. Pr. Cour., welche hiebei erfolgen. Die Ducaten sind in dieser Gegend nicht coursirend, mithin sehr selten, ich habe also, um nur Geld zu erhalten, von einigen N. ²/3tel und von andern schwer. Cour. annehmen und zum Theil mit Verlust gegen Louisd'or umsezen müssen. Bei dieser Gelegenheit übersende zugleich den Bogen Z aus dem zweiten Bande hiebei, welcher in dem Exemplar des Herrn Hofrat Plate gedoppelt gewesen, wogegen aber der Bogen A fehlet. Diesen Defect hat einer aus seiner Lese-Gesellschaft erst spät wahrgenommen, er erbittet sich also mit nächster Gelegenheit den mangelnden Bogen A dagegen gehorsamst zurück.
Ferner empfangen Ew. Wohlgeboren hiedurch einige Anmerckungen über Nugent's Reisen durch Deutschland, warum dieselben vor dem mich gewogentlich ersucht haben. Sie sind von dem Verfasser der in diesem Jahr edirten und gewiß mit vieler Mühe ausgearbeiteten Geschichte der adlichen Familie von Bülow 9 ), ich meine von dem Herrn Geheimen Kammerrath von Bülow zu Neu-


|
Seite 343 |




|
Streliz, mit welchem ich jener Geschichte und noch eines andern Werckes wegen Amtes halber in Correspondence stehe. Ich hatte ihn, weil Nugent viel von dem Strelizschen Hofe in seinen Reisen erzählet, darum ersucht. Sie sind nun zwar mit einer in etwas flüchtigen und zum Theil unleserlichen Hand abgefast und es ist sein eigenhändiges Concept, jedoch kommen hin und wieder Berichtigungen vor, welche einige Aufmercksamkeit verdienen. Er überläst mir die Freiheit, darinn nach Belieben auszustreichen, oder zu verbessern, und ich stelle Ew. Wohlgeb. nicht allein dieses, sondern auch, ob Sie davon in dero Sammlung Gebrauch machen wollen und können, völlig anheim, nur weiß ich nicht, was derselbe bei folgender Stelle aus seinem Schreiben an mich: Will der Herr Bernoulli für meine Arbeit einen Jahrgang schencken, so mögte mein Ehrgeiz nicht, aber mein Geldgeiz Nahrung erlangen, auf alle Fälle sende ich hiebei den Werth eines Dukatens -"i. e. 2 Rthlr. 16 sl. schwer. Cour." dencken und entschließen werden. Dieser Werth ist unter den 22 Ducaten eben nicht zu meinem Vortheil berechnet. Er hat mir nicht geschrieben, daß im Fall Ew. Wohlgeb. solche Anmerckungen abdrucken lassen wollten, es unter seinem Namen geschehen könne, meiner unmaßgeblichen Meinung nach wäre statt dessen in dem Vorbericht etwa anzuzeigen, daß selbige von einem vornehmen und der Sache völlig kündigen Bedienten am Herzogl.-Mecklenburg-Strelizschen Hofe eingesandt worden. Vieleicht habe ich in kurzem das Vergnügen, einen andern interessanteren Beitrag zu dero Sammlung zu übermachen, weßfalls ich mich jezo noch nicht näher erklären kan. Wegen des Transports dieses Wercks in der Folge bitte jedesmahl die bis Lenzen franquirten Pakete von da auf Ludewigslust, mit einem blossen Couvert um den Brief an mich, an den dasigen Herzogl. Mundschenck und Postmeister Herrn Cornelius zu addressiren, welcher alsdan die herrschaftlichen und einige andere Exemplare herrausnehmen, die übrigen aber mir übersenden wird, als wodurch mir einige Erleichterung des sonst gedoppelten Porto zuwächst.
Die Anzeige der von Ew. Wohlgeb. zu edirenden Lambertschen 10 ) Wercke habe auf dero Verlangen gleichfalls nicht nur bei allen Gelehrten hieselbst coursiren lassen, sonder auch einige davon an meine Bekannte in Rostock, Büzow, Ludewigslust etc. gesandt, jedoch, leider, nicht mehr als zwei Subscribenten, nemlich den Herrn Geheimen Kanzelei Rath A. J. D. Aepinus in Rostock und den Herrn Professor M. F. L. C. Karstens 11 ) in Büzow


|
Seite 344 |




|
auf alle drei Theile derselben gleichsam erpressen können, ein Beweis, wie wenig meine Landesleute jenen weiland großen Gelehrten kennen oder vielmehr, wie wenig Geld man zu dergleichen Wercken übrig hat. Sobald der erste Theil den beiden Freunden wird überliefert seyn, will jeder seinen dafür bestimmten Ducaten zahlen.
Wie stehet es mit dem von dem Herrn Kriegsrath Borchmann längstens versprochenen dritten Theil der Briefe zur Erinnerung an merckwürdige Zeiten? Jch will ja nicht hoffen, daß er es, wie der Herr Baron von Crohn 12 ) und andere seines Gleichen, machen werde, welche sich mit den Praenumerationen bene gethan, aber die versprochenen Wercke nie geliefert haben. Wie ich aus deroselben Schreiben ersehe, so hat er schon die Hälfte der diesseitigen Praenumeration auf 7 Exemplare, welche ich zum Theil aus meiner Tasche vorgeschossen, von Herrn Dr. Siemerling in Empfang genommen. Ich bitte recht sehr, die andere Hälfte so lange zurückzubehalten, bis er den verheißenen Theil würcklich an dieselben abgeliefert hat, und sollte er damit gegen Ostern noch nicht fertig seyn, so wäre wohl der beste Weg, auch den Vorschuß ihm abzufordern, damit ich und einige meiner Praenumeranten das unsrige wieder erhielten.
Bloß der unschätzbaren Gewogenheit Ew. Wohlgeb. darf ich es zurechnen, daß dieselben meiner fernern Erörterung von dem Herzoge Hans einen Plaz in dero 4ten Bande gegönnet und noch dazu mit einer so schmeichelhaften, um so weniger aber verdienten Einleitung begleitet haben. Vieleicht reizet dieser schöne Kranz einen Kenner, den schlechten Wein genau zu prüfen und statt dessen, dem Publicum einen besseren vorzusetzen. Gut wen nur die Geschichte dadurch aufgekläret wird, werde demselben den ersten Beifall zurufen. In bemercktem 4ten Bande ist mir unter andern auch und vermuthlich allen Lesern die pag. 121 angebrachte Note von der statlichen Reuterei auf den gehörnten Thieren sehr belustigend gewesen. Ich gäbe etwas darum, die Original-Urkunde selbst zu sehen, und ob die Worte oxen würcklich darinn stehen, es ahndet mir aber, daß der Abschreiber (wo es kein bloßer Druckfehler ist) von der Urkunden-Schrift und alten platten Sprache wohl eben keine genauen Kenntnisse möge gehabt haben, mithin ein x für ein r oder oxen für orsen gelesen, weil ihm das erste, nicht aber das lezte verständlich gewesen. Tausendfältig habe ich dieses sowohl in Original-Urkunden des hiesigen Herzoglichen Archivs als in Abdrücken, jenes aber nie, vorgefunden, welches den ein zum Kriege völlig abgerichtetes, auch zuweilen geharnischtes Pferd, equum bellicum et feudalem, bedeutet. Haltausii, Gloss. German. med. aevi sub voce: ors. item ors-


|
Seite 345 |




|
dienst, und so fiele freilich bei einem Feldzuge alles comische weg. Jedoch dieses sey nur meinem Gönner, nicht dem Publikum, in der unverbrüchlichsten Hochachtung gesaget, mit welcher nebst Anwünschung des vollenkommensten Wohlergehens und der dauerhaftesten Gesundheit in dem bevorstehenden und folgenden Jahren lebenswierig beharre
C. F. Evers.
Schwerin den 24ten December 1781.
8. An denselben. Schwerin 1782, Februar 2.
Ew. Wohlgeb. gewogentliches Schreiben vom 1sten v. M. nebst 23 Exemplaren des 5ten Bandes dero Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und 2 Exemplare des ersten Bandes der Lambertschen Briefe habe richtig erhalten und nichtes kan mir angenemer seyn als deroselben Zufriedenheit mit meiner deßfalls verwandten, obgleich der Erwartung nicht völlig entsprechenden Bemühung.
Jezo erfolgen hiebei ein Spec. Ducaten und 1 Rth 34 sl. Pr. Cour., welche nach anliegender Berechnung deduct. deducend. die Praenumeration zweier schon bekannter Liebhaber für drei Bände der Lambertschen Schriften 13 ) und des Herrn Magistri Friedrich Neumann zu Güstrow für den jezigen Jahrgang deroselben Sammlung kurzer Reisebeschreibungen betragen. Zwar sollte noch ein Spec. Ducaten dabei seyn, allein nach dero ausdrücklicher Bewilligung habe selbigen zurückbehalten, um ihn dem Herrn Geheimen Cammerrath von Bülow zu Neu-Streliz für seine Anmerkungen über Nugents Reisen entweder gelegentlich zu übersenden oder auch als seine Praenumeration für den dritten Jahrgang bis dahin bei mir zu asserviren.
Ich gestehe aufrichtig, daß mir anfänglich dieses meines Gönners Antrag in etwas auffallend war, zumahl ich ihn aus unserer häuffigen Correspondence von einer solchen Seite nicht kannte; allein er hat mich durch folgende Stelle seines jüngsten Schreibens: "Ich kan es beinahe rathen, daß sie sich wohl ein wenig darüber gewundert haben, daß ich nach einem Ducaten so begierig war, allein, liebster Freund, das hatte eine andere Ursache. Schenckte er mir einen Jahrgang, so konnte ich diesem mir unbekannten berühmten Manne mit guter Manier auch wieder mit meinem Buche (i. e. seiner Familien Geschichte, woran ich einen kleinen Antheil hab, deren Praenumeration einen Louisd'or betragen) unter die Augen gehen und das habe ich auch gethan" völlig befriedigt. Wen beider dero Wercke die Presse werden verlassen haben, so erwarte durch die nunmehr beliebte Addresse an Herrn Mundschenck und Postmeister zu Ludewigslust, Cornelius,


|
Seite 346 |




|
außer den gewöhnlichen 23 Exemplaren des 6ten Bandes, noch ein Eremplar des 5. und 6ten dero Sammlung kurzer Reisebeschreibungen für den aufs neue beigetretenen Herrn Mag. Neumann zu Güstrow, wie auch 2 Exemplare der Continuation Lambertscher Schriften.
Die Nachricht, daß des Herrn Kriegsraths Borchmann Auflage des längst versprochenen dritten Theils seiner Briefe etc. Schulden halber in Berlin mit Arrest beleget sey, ist mir eben nicht angenem. So habe ich auch einstens einen Spec. Ducaten für das Adels Lexicon des berüchtigten Avanturier von Krohn eingebüßet und dergleichen Vorfälle sind dan wohl die Haupt Ursache, daß Bücherfreunde sich so ungerne zu Praenumerationen verstehen wollen. Ew. Wohlgeb. gewogentlichen Vorschlag, daß ich, um die Hälfte des denenselben bezahlten Preises für sieben Exemplare jenes Theils womöglich wieder zu erhalten, denenselben eine Art von Vollmacht übersenden sollte, habe nun zwar durch Anlage dancknehmig befolget, allein woferne solches mit einigen Weiterungen oder Kosten verknüpfet seyn sollte: so wäre es auf meiner Seite Zudringlichkeit, damit beschwerlich zu fallen, viel lieber will diese Kleinigkeit ausopfern, sowie ich es den überhaupt in Ew. Wohlgeb. freien Willkür stelle, ob, wan und welchen Gebrauch dieselben davon machen wollen, welches den, wen noch Hofnung wäre, daß der Arrest gehoben und der Abdruck beendigt werden könnte, ohne dem unnöthig seyn dürfte, allenfalls bleibet doch mindestens die andere Hälfte jener Praenumeration bis zu unserer künftigen Berechnung in dero Verwahrsam. Übrigens werde lebenswierig mit unbegränzter Hochachtung beharren
C. F. Evers.
Schwerin den 4ten Februar 1782. 14 )
9. An denselben. Schwerin 1782, April 4.
Indem ich den richtigen Empfang der Exemplare des 6ten Bandes Ew. Wohlgeb. Auszüge kurzer Reisebeschreibungen und des Lambertschen Wercks hiedurch ganz gehorsamst versichere, so bedaure zugleich recht sehr, daß dieselben wegen der Borchmannischen Affaire so viele Mühe gehabt haben. Diese Kleinigkeit verdienet solche gewiß nicht, ich bitte also ganz gehorsamst, woferne die Exemplare gegen den bei Ihnen aufbehaltenen Nachschuß, allenfalls mit einer kleinen Zulage, nicht können in Empfang genommen werden, diese Sache nur auf sich selbst beruhen zu lassen.
Der Herr Geheime Kammerrath von Bülow hätte Ihnen doch wohl billig etwas mehr als ein bloßes Equivalent, mithin ein Exemplar auf Postpapier von seiner Familien-Nachricht offeriren


|
Seite 347 |




|
sollen, zumahl er dero Sammlung nicht allein mit seinen ein wenig zu eilfertig entworfenen Anmerckungen über Nugents Reisen, sondern auch so gar mit den Kleinigkeiten zur Berichtigung einiger Stellen in jener Familien-Nachricht überladen hat. Das deßfalls von ihm erhaltene Schreiben ließ mich dieses erwarten, allein er ist ein Kameralist und freilich muß die Sparsamkeit sein Haupt-Grundsatz im Dienste seyn, ob er aber auch in seinen eigenen Geschäften und besonders im gegenwärtigen Falle Gebrauch davon machen müssen, dieses lasse dahingestellt seyn. Übrigens schäze ihn als einen rechtschaffenen, geschickten und sehr fleißigen Cavalier.
Die Absicht unserer durchlauchtigsten Prinzessin Ulrique Sophie, deroselben allgemein beliebte Sammlung kurzer Reisebeschreibungen gleichfalls zu besizen, und der Befehl, selbige für Höchstdieselben zu verschreiben, dieses ist die Haupt-Veranlassung des jezigen Briefes. Wen ich also nach Abzug des gewogentlich zugestandenen 7ten Theils einen Spec. Ducaten und 2 Rthlr. 7 sl. Pr. Cour. (den Ducaten zu 3 Rthlr. Pr. Cour. gerechnet) als das Pretium für die vier Bände des vorigen und die Praenumeration für dieselben des jezigen Jahres hie beischließe, so hoffe Ew. Wohlgeb. werden dagegen die oben edirten 6 Bände mit nächster Post über Lenzen gerade auf Schwerin jezo ohne Addresse auf Ludewigslust (in der Folge bleibet es jedoch dabei) zu übersenden und in Betref der beiden übrigen hoc anno noch zu erwartenden Bände, die vorige Zahl der Exemplare noch mit einem für die durchlauchtige Prinzessinn zu vermehren, allenfalls auch einen Empfang- und Praenumerations-Schein darüber beizufügen die Gefälligkeit haben, wogegen ich mit unbegränzter Hochschäzung beharre
C. F. Evers.
Schwerin den 4. April 1782.
10. An denselben. Schwerin 1784, März 8.
Mit Mißvergnügen seze endlich die Feder an. Briefe, Missiven und in den hiesigen Intelligenz-Blättern wiederholte Empfehlungen dero beiden Wercke - alles hat meiner Erwartung nicht entsprochen und ist ganz vergebens gewesen. Statt daß die Zahl der Mecklenburgischen Liebhaber dazu sich vermehren sollen, so hat selbige im Gegentheil mercklich abgenommen. Ich beziehe mich deßfalls auf beiliegendes Verzeichniß. Ist meine Berechnung, wie ich hoffe, richtig, so beträgt die ganze Summe der Praenumerations-Gelder für dieses Jahr deduc. deducendis 29 Rthlr. 19 sl. in Louisd'or und 3 Rthlr. 39 sl. Pr. Cour. oder 9 Spec. Ducaten und 1 1/2 Louisd'or, welche hiebei erfolgen und von deren richtigen Empfang mich gelegentlich zu vergewissern bitte.
Laut dero Briefes vom 27ten Juny v. J. assignirten dieselben 3 Rthlr. an den Herrn Geheimen Cammerrath von Bülow zu Neu-


|
Seite 348 |




|
Streliz für ein erhaltenes Exemplar seiner Familien-Nachricht. Er verlangte solche der Zeit nicht, hat dagegen den diesjährigen Ducaten für die neue Sammlung zurückbehalten; wegen des Überrestes werden sich also Ew. Wohlgeb. mit ihm weiter zu berechnen die Gefälligkeit haben.
In den Büschingschen wöchentlichen Anzeigen waren die beiden Mecklenburgischen Land-Charten und zwar die Strelizsche mit dieser französischen Aufschrift: Carte de Duché de Mecklenbourg-Streliz, presenté à S. A. S. Monseigneur le Duc Adolph Fréderic par Fréderic Struve 1782, jede zu 4 Gr. aufgeführet 15 ). Die Preise derselben mögen nachher wohl etwas verhöhet seyn; ich habe also auf der Anlage den Rückstand von 2 Gr. mit in Rechnung gebracht. Werden die übrigen Lambertschen Bände bald zu erwarten seyn? Sollten selbige und die committirten wenigen Exemplare der Indischen Erdbeschreibung mit der neuen Sammlung nicht zugleich die Presse verlassen, so ersuche beide nicht über Lenzen, sonder nach der in einem deroselben Avertissement gegebenen Offerte über Lübeck und bis dahin postfrei zu senden, weil der Herr Mundschenck Cornelius zu Ludewigslust an diesen Wercken keinen Theil nimmt. Wen aber Ew. Wohlgeb. dahin keine Absendung hätten und dieser Cours Ihnen lästig fiele, so bleibt es, wie allemahl in betreff der Sammlung beim Alten. Meine Ursache dazu ist, weil von hier bis Lenzen ein Weg von höchstens 7 Meilen, drei Stationes, nach Lübeck aber nur 2 gerechnet werden.
Bald hätte ich schon jezo das bei Ew. Wohlgeb. in deposito stehende halbe Praenumerations-Quantum von 2 Rthlr. 22 Gr. für 7 Exemplare der Borchmannschen Briefe mit in Abrechnung gebracht, weil dieser unartige Mann wohl sein Wort nie erfüllen und ebensowenig die schon empfangene andere Hälfte restituiren wird. Allein da Ew. Wohlgeb. Mens. Aug. v. J. brieflich anzeigten, daß der dritte Theil wircklich unter der Presse und wohl in der Oster-Messe 1784 herrauskommen würde, so habe damit noch Anstand genommen. Sollte er aber auch dan damit zurückbleiben und dadurch alle Hofnung zum Empfange vereiteln, so bitte ganz geborsamst, die Kleinigkeit demnächst in einem Packet der neuen Sammlung oder der andern Wercke zu übersenden und, wen es nicht zu viele Mühe verursachte, in einem besonderen P. S. ostensible mich


|
Seite 349 |




|
zu benachrichtigen, daß der Herr Kriegsrath Borchmann daselbst, als der Herausgeber der Briefe zur Erinnerung an merckwürdige Zeiten und rühmliche Personen aus dem Zeitlaufe von 1748 bis 1780, schon im Jahre 1781 die Hälfte der von mir übersandten Praenumeration auf 7 Exemplare des dritten Theils jenes Wercks à Exemplar 40 sl. in Golde wircklich empfangen, und daß mein. dasiger Commissionair bei seiner Abreise die andere Hälfte bis zur Ablieferung besagten Theils bei Ew. Wohlgeb. deponiret hätte, daß aber der Verfasser bis jezt das Werck nicht abdrucken lassen, auch wohl in der Folge nie liefern würde, daher Sie mir, weil der halbe Vorschuß von dem Kriegs Rathe Borchmann seiner bekannten Dürftigkeit wegen auf keine Weise wieder zu erhalten, die übrige Hälfte, um solche den Praenumeranten zu restituiren, zurück senden müssen. Zu meiner Legitimation bei vier Interessenten muß ich mit diesem Gesuche beschwerlich fallen, auf die übrigen drei Exemplare ist nur subscribiret, ich habe den Vorschuß gethan, ich werde also auch den Verlust alleine tragen müssen.
Machen die Montgolvieschen Luftbälle 16 ) in Berlin und bei dasiger Academie so viel Aufsehen als in Frankreich? Von Ew. Wohlgeb. als dem competentesten Richter in diesem Fache wünschte ich gerne deßfalls und des künftigen Nuzens davon gelegentlich jedoch nur in wenigen Zeilen belehret zu seyn. Voltaire ließ einstens sein Micromegas mit einem Bewohner des Saturns eine Sternreise durch Beihülfe der Sonnenstralen bis zu uns verrichten; bald wird man den neu entdeckten Planeten vermittelst der brennbaren Luft in der Nähe betrachten können.
Haben Ew. Wohlgeb. die Recensionen der von dem Herrn Regierungsrath und ersten Archivar Spieß 17 ) zu Plassenburg herausgegebenen Archivalischen Nebenarbeiten in Büschings wöchentlichen Anzeigen 1783 44tes Stück und in den Leipziger gelehrten Zeitungen de d. a. 102tes Stück gelesen? Glauben Sie den auch, daß der ohnedem als ein geschickter Mann bekannte Herr Spieß nicht anders, als durch unhöfliche Herabwürdigung einiger seines Amtes konnte nach Würden gerühmet werden? Wie wen man öffentlich durch den Druck anzeigte, daß der Herr Büsching, weil er dieses oder jenes Werck geschrieben, kein Ober-Consistorialrath von der gemeinen Art, sondern ein gelehrter und arbeitsamer Mann sey, oder noch kraftvoller, daß der Leipziger Recensent ein rühmliches Original für viele academische Lehrer wäre, die eher den Namen der Küster oder Universitäts-Aufwärter als wahrer Professoren verdienten? Gewiß viele von der Geistlichkeit und


|
Seite 350 |




|
Lehrern auf hohen Schulen würden es dem Lobredner sehr übel deuten, mindestens verbreitete sich ein heftiger Feder-Krieg von Mecklenburg bis in Sachsen, als der weil. unglückliche oder, wohl passender, unwürdige Consistorialrath Fiedler 18 ) so etwas von einem Theil der Mecklenburgischen Prediger geschrieben hatte. Dieses werden jene Herren von den zur Gedult gewöhnten Archivarien wohl eben nicht zu gewärtigen haben. In allen Ständen sind leider untaugliche Mitglieder, keine sind aber dem Publicum weniger bekannt als Archivarien. Von diesen können nur Minister und Collegia, denen sie zur Hand arbeiten, gegründet urtheilen, ihre Geschäfte bleiben allen übrigen verborgen und müßen es auch, weil die strengste Verschwiegenheit ihre erste Pflicht ist. Ich weiß gewiß, mancher Archivar übertrifft viele andere Gelehrte, die durch die Presse Bekantschaft und Ruhm erworben haben, sowohl an wahrer Gelehrsamkeit als Fleiß, ob er gleich nie eine Zeile abdrucken lassen, weil vieleicht Neigung, überhäufte Amtsgeschäfte oder gewisse Rücksichten ihn davon abhalten. Ich habe immer eine bessere Meinung von einem Manne, der sich ganz seinem Amte widmet als von demjenigen, welcher sich mit Nebendingen viel beschäftiget, von diesem vermuthe vielmehr, daß ihn entweder sein Dienst nicht genug beschäftigen könne oder auch, daß er denselbigen vernachlässigt. Wen ein Leipziger Anonymus sich zuviel herausnimmt, so verdient er Mitleiden oder Verachtung, aber daß der verehrungswürdigste und berühmte O. C. R. Büsching 19 ) zu einer Recensenten Licenz sich herabläst, das war mir doch in etwas auffallend.
Gehöret dieses den auch zu unserm Collectur-Geschäfte? werden Sie vieleicht fragen. Freilich nicht, aber nicht immer einerlei zu schreiben, so fiel mir dieses eben zur Veränderung bei und ich konnte mich nicht enthalten Ew. Wohlgeb. meine etwanige Gedancken darüber bloß unter uns mitzutheilen. Der Recensenten Ruhm oder Tadel wird jedem Archivar sehr gleichgültig seyn, wen nur sein Landesherr, das Ministerium und Männer, wie Ew. Wohlgeb. seine Fähigkeiten und Diensteifer nicht verkennen, dessen bin ich bisher versichert gewesen und ich werde mich stets bestreben, diese Achtung besonders auch gegen dieselben in unverbrüchlicher Hochachtung zu verdienen, mit welcher Zeitlebens zu beharren die Ehre habe
ganz gehorsamster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 8ten März 1784.


|
Seite 351 |




|
kurzer Reisebeschreibungen
| 1. | des Herzogs Friederich zu Mecklenburg Durchlaucht 2 Exemplare | 2 | Spec. | Dukaten |
| 2. | der Herzoginn Louise Friederique zu Mecklenburg Durchlaucht 1 Exemplar | 1 | " | " |
| 3. | des Prinzen Friedrich Franz zu Mecklenburg Durchlaucht 1 Exemplar | 1 | " | " |
| 4. | der Prinzessin Friederich zu Mecklenburg Durchlaucht 1 Ex. | 1 | " | " |
| 5. | der Prinzessinn Ulrique Sophie zu Mecklenburg Durchl.1 Ex. | 1 | " | " |
| 6. | des Herrn Geheimen Raths und Oberhofmarschalls Baron von Lützow 1 Ex. | 1 | " | " |
| 7. | des Herrn Oberhauptmann von Kamz zu Stavenhagen 1 Ex. | 1 | " | " |
| 8. | des Herrn Geheimen Cammerraths von Bülow zu N.-Streliz 1 Ex. | 1 | " | " |
| 9. | des Herrn Justizraths Schmidt 1 Ex. | 1 | " | " |
| 10. | des Herrn Revisionsraths Cahns 1 Ex. | 1 | " | " |
| 11. | des Herrn Regierungs-Secretär Blume 1 Ex. | 1 | " | " |
| 12. | für mich 1 Ex. | 1 | " | " |
P. M. Von den vorherigen Praenumeranten sind der Archiv-Secretär Schmidt und der Magister Neumann gestorben; der Rittmeister von Plessen, der Regierungs-Archivar Scheibel und der Marsch(all) Secretär Neumann aber ausgetreten. Von diesen erbitten sich den zu den bisherigen 12 Theilen versprochenen Supplement- und Register-Band für den bestimmten Preis von 24 sl.
| 1. | der weiland Magister Neumanns Erben 1 Exemplar | 24 | sl | |
| 2. | der Herr Regierungs-Archivar Scheibel 1 Ex. | 24 | " | |
| 3. | der Marsch(all) Secretär Neumann 1 Ex. | 24 | " |
die übrigen haben solchen nicht verlangt.
| Summa 13 Ex. der neuen Sammlung und 3 Supplementbände | |
| 13 Spec. Duc. und 1 Rth. 24 sl. Louisd'or. | |
| Beides beträgt in Louisd'or, den Ducaten zu 2 Rthlr. 40 sl. gerechnet | |
| 38 Rth. 16 sl Louisd'or |
| 1. | der Herr Regierungs-Secretär Blume auf ein deutsches Exemplar in Quart | 5 Rthlr. | Louisd'or | |
|
|
||||
| Summa | 43 Rthlr. | 16 sl. | " | |


|
Seite 352 |




|
| 2. | der Herr Geheime Cammerrath von Bülow zu N-Streliz auf ein deutsches Exemplar in Octav | 1 Rthlr. | 20 sl. | Pr. Cour. |
| 3. | der Herr Marschall Secretär Neumann dito | 1 " | 20 sl. | " |
| 3. | für mich dito | 1 " | 20 sl. | " |
|
|
||||
| Summa | 4 Rthlr. | 12 sl. | Pr. Cour. | |
Hievon gehet an bewilligte Collectur-Gebühr ab
| 1. | von 38 Rth. 16 sl. Louisd'or der siebente Theil, beträgt 5 Rth. 23 sl., bleiben also | 32 Rth. | 41 sl. | Louisd'or |
| 2. | von 5 Lousd'or der 8te Theil beträgt 30 sl., bleiben also | 4 " | 18 sl. | " |
|
|
||||
| Summa | 37 Rth. | 11 sl. | Louisd'or | |
Von jenen 37 Rth. 11 sl. Louisd'or kommen noch in Abzug
| a. | die Praenumeration des Herrn Geheimen Cammerraths von Bülow auf die neue Sammlung pro hoc anno, welche er auf Abschlag seiner Forderung zurückbehalten hat, nemlich 1 Spec. Ducaten oder | 2 Rth. | 40 sl. | Louisd'or |
|
|
||||
| b. | des Herrn Sekretär Blume Praenumeration auf die Indische Erdbeschreibung in Quart, welche ich schon im vorigen Jahre übersandt habe | 5 Rth. | ||
|
|
||||
| Summa | 7 Rth. | 40 sl. | Louisd'or | |
Bleiben also übrig 29 Rthlr. 19 sl Louisd'or.
Hierauf erfolgen hiebeit 9 Spec. Ducaten à Stück 2 Rth 40 sl., betragen 25 Rth. 24 sl. Louisd'or und 1 1/2 Louisd'or, welche auch auf den Rest von 3 Rthlr. 43 sl Louisd'or und die obigen 3 Rth. 39 sl. Pr. Cour. (der Louisd'or zu 16 Mark Pr. Cour. gerechnet) enthalten.
| Schwerin den 8. März 1784. | C. F. Evers. |
11. An denselben. Schwerin 1785, Oktober 31.
Von dem richtigen Empfang der 15 Exemplare dero kurzen Reisebeschreibungen und des ersten Bandes Tiefenthalers Beschreibung von Indien in Quart 21 ) gebe hiedurch nicht nur die Versicherung, sondern übermittele zugleich des Herrn Regierungs-Secretärs Blumen Praenumeration von 3 Rthlr. 16 sl. resp. in Gold und Chur-Sächsischer Conventions-Münze. Diese leztere ist


|
Seite 353 |




|
nun freilich bei uns gar nicht coursirend, noch bekannt, und kaum habe ich in Schwerin 32 sl. davon auftreiben können. Indeß gilt nach dem Sächsischen Courant-Fuße der Louisd'or 5 Rthlr., mithin ist mit einem halben Louisd'or und 8 sl. dasiger Münze das übrige ergänzt. Mit dem nächsten Paket erbitte einen Praenumerations- Schein darüber und erwarte zu seiner Zeit von dero Gefälligkeit den Rückstand der praenumerirten Wercke als 1.) 15 Exemplare des 16ten Theils der Reisebeschreibungen, 2.) 16 Exemplare des Supplement- und Register-Bandes zu diesem Wercke, auf das 16te Exemplar haben bekanntlich die ausgetretenen Neumannschen Erben in Güstrow praenumeriret, 3.) 1 Exemplar des 2. und 3ten Bandes der Indischen Beschreibung in Quart und 3 Exemplare derselben deutschen Edition in Octav und endlich 3 Exemplare des zweiten Bandes der Lambertschen logicalischen Wercke.
Von meiner unlängst durch Sereniss. höchste Genehmigung und Veranstaltung des Kupferstichs zum Druck beförderten Betrachtung über eine in Rostock geprägte alte Münze in Grundlage der dieser Stadt ertheilten Landesherrlichen Münzbegnadigungs-Briefe und urkundlichen Siegel nebst Anzeige einiger gefundenen Wendischen Münzen in Quart 22 ) würde ich es mir zur besonderen Ehre schäzen Ew. Wohlgeb. mit einem Exemplar aufzuwarten, allein da dergleichen hiesige Alterthümer dieselben wohl wenig oder gar nicht interessiren, diese kleine Piece auch kaum das Porto werth seyn dürfte, so habe damit Anstand nehmen, allenfalls eine bequemere Gelegenheit dazu erwarten wollen.
Hätte ich nun keine andere Veranlassung dazu gebabt als das ehemalige Sentiment des gelehrten Herrn O. C. R. Büsching von den Archivarien, welche entweder keine Zeit noch Lust haben für die Ewigkeit oder Käsebuden zu schreiben - das schriftstellerische Schicksal ist in diesem Puncte oft sehr problematisch -; so würde gewiß noch lange in der Classe der ungeschickten Archiv-Handlanger geblieben seyn, aber auch diese Abhandlung, vieleicht auch meine Mitwirckung bei Herrn Hofrath Rudloff 23 ) gründlichen Handbuche der Mecklenburgischen Geschichte, sind zu unbedeutend, als daß ich mich dadurch bei den Herren Recensenten in bessern Credit sezzen könnte.
Dero fernerer Gewogenheit mich empfehlend beharre mit vollenkommster Hochschäzung
ganz gehorsamster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 31. October 1785.


|
Seite 354 |




|
12. An denselben. Schwerin 1786, Januar 22.
Theils Mangel der Zeit, theils auch eine besondere Ursache verhindert mich, jezo hiebei zu schreiben. Nehmen Sie also diese von mir verlangte kleine Abhandlung als ein Zeichen meiner unbegränzten Hochachtung an, mit welcher lebenswierig beharren werde.
ganz gehorsamster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 22ten Januar 1786.
13. An denselben. Schwerin 1786, Januar 26.
Die jüngst übersandten Exemplare des 16ten Bandes Ew. Wohlgeb. Sammlung kurzer Reisebeschreibungen habe richtig erhalten, dagegen hoffe ich, daß meine in voriger Woche mit Gelegenheit übermachte Abhandlung von einer Rostockschen Münze denenselben gleichfalls in einem offenen Couvert - man wollte solche von mir wegen der strengen Preußischen Post- oderAccise-Ordnung nicht versiegelt annehmen - werde behändigt seyn. Hierinn habe ich dero Befehl befolget, ob ich gleich gar wohl weiß, daß dergleichen locale Kleinigkeiten Ew. Wohlgeb. wenig oder gar nicht interessiren können, noch weniger aber wird der Herr O. C. R. Büsching es werth achten, davon in seinen wöchentlichen Nachrichten eine Zeile einfließen zu lassen. Wäre auch sonsten nichtes daran zu tadeln - eine offenbar gewagte Voraussezzung -, so müste Ihnen doch der ganz gleichlautende Ausdruck am Schlusse des Vorberichts und im Eingange der Abhandlung anstößig seyn, und dieses mit Recht. Leztere war schon lange zuvor für den Abdruck mundirt, als ich die Kupferplatte zur Vignette und den Münzen erhielt. Bei beiden waren kleine Fehler begangen, welche den sonst unnöthigen Vorbericht veranlaßten. Ich entwarf solchen in Eile, ohne die Abhandlung selbst wieder anzusehen, hatte die wörtliche Einkleidung und den Eingang derselben längst vergessen und so entstand dieser Fehler ohne mein Wissen und Willen.
Die Resultate darinn über die Fragen von wem und wan mögen gegründet seyn oder nicht, so ist dieses doch zuverlässig, daß die Münze eine Mecklenburg-Rostocksche sey, aber von einer andern, in dem meiner Aufsicht anvertrauten Herzogl. Cabinet aufbehaltenen alten und nicht weniger seltenen Münze vermag ich noch weniger mit Überzeugung zu sagen. Erlauben Sie mir, daß ich sie beschreibe. Es ist ein kleiner silberner Solidus, dünne und 61/2 Aß an Gewicht. Auf der einen Seite stehet eine männliche Person in einem bis an die Knie reichenden und umgürteten Kleide, mit einer auf beiden Seiten umgebogenen Haube auf dem Haupte, vieleicht aber zutreffender im bloßen Haupte und an jeder Seite mit einer Haar-Locke, in der rechten Hand ein breites, oben


|
Seite 355 |




|
stumpfes Schwert, in der lincken aber einen langen Stab, an dessen obern nicht ausgeprägtem Ende ein Ring ist, haltend. Die andere Seite stellet einen vorwärts sehenden Ochsenkopf mit großen punctirten Hörnern dar, ohne alle Nebenzeichen, mithin ohne Krone, Halsfell und Nasenring. Keine Schrift oder Legende ist darauf geprägt. Fehlen mir gleich alle Data, diese Münze, besonders den Avers, zu erklären, weniger das Wan und von wem sie geprägt worden, zu bestimmen, so war ich doch zuvor der Meinung, daß es eine Mecklenburgische seyn müße. Aber seitdem ich die Geschichte der Stadt Cottbus in dem 15ten Bande der Reisebeschreibungen gelesen und darinn S. 16 und 17 gewahr werde, daß die ehemahligen Herren dieser Stadt auch einen OchsenKopf - S. 119 sagt dagegen der Verfasser, daß sie beständig einen Krebs im Wapen gehabt - auf ihren Münzen geführt haben, so werde auch sogar in Betreff der Frage, wo, zweifelhaft und weiß nicht, ob ich sie den Herren von Mecklenburg oder Cottbus, oder gar einem dritten zueignen solle. Wie wen nun Ew. Wohlgeb. in Cottbus Bekanntschaft hätten und eine nähere Nachforschung veranlassen könnten, ob man noch dorten dergleichen Münzen nicht nur mit dem Ochsenkopf - diese Wapen Figur haben außer Mecklenburg mehrere Länder und Städte beliebet -, sondern auch besonders mit dem beschriebenen Manne aufbehielte, ob man gewiß wüßte, daß sie herrschaftlich Cottbusche und ob historische Beweisthümer davon vorhanden wären?, so würden dieselben meine Münzliebhaberei nicht allein befriedigen, sondern auch selbst der deutschen Münz-Kunde einen wahren Dienft leisten. Vieleicht sind Sie glücklich darinn und dan werde mit Vergnügen dero Belehrung entgegensehen, der ich mit unverbrüchlicher Hochschäzung beharre
ganz gehorsamster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 26ten Januar 1786.
14. An denselben. Schwerin 1786, März 2.
Kan ich Ew. Wohlgeb. Beifall in betreff meiner kleinen Münz-Abhandlung zwar für nichts weiter als eine Folge dero unverdienten Gewogenheit gegen mich ansehen, so ist selbiger mir doch höchst schäzbar. Ich weiß gar wohl, daß die Diplomatik und Numismatik, zumahl wen sie sich auf kleine Länder beschräncken, nur wenige Liebhaber finden, ich würde mich auch zu dessen Abdruck kaum entschlossen haben, wen Se. Durchlaucht 24 ), durch Dero vordringende Gnade ich vor kurzem zum Geheimen Archiv-Rath ernannt worden, nicht Höchst Selbst die Kupfer-Platte dazu ver-


|
Seite 356 |




|
fertigen und mir überliefern lassen. Für die freundschaftliche Bemühung und Nachfrage zu Cottbus wegen der zweifelhaften Münze mit dem Stier-Kopf bin ich Ew. Wohlgeb. recht sehr verpflichtet. Ist nun gleich dadurch das Räthsel nicht aufgelöst, so bin ich nunmehr doch vergewissert, daß es keine Cottbusche Präge sey und werde sie also nach wie vor für eine Mecklenburgische halten, ob als gleich zur Zeit nicht ausfindig machen kan, wan und von welchem hiesigen Fürsten sie geprägt seyn möge.
Die 3te Lieferung der Beschreibung von Hindustan in Quart und 3 Exemplare des zweiten Theils der Edition in Octav habe richtig erhalten, aber eben dieses veranlaßt mich, daß ich Ew. Wohlgeb. mit meinem Schreiben schon jezt wieder beschwerlich fallen muß. Dieselben bemercken in den beiliegenden Avertissement, daß Sie befürchten, es würden manche Käuffer des ersten Theils ihn haben binden lassen, ohne das Ende der Vorrede zu lesen. Hieraus darf ich doch wohl mit Zuverlässigkeit die Folge machen, daß der erste Theil schon seit einiger Zeit den Praenumeranten abgeliefert sey, und dennoch habe ich so wenig ein als die committirten drei Exemplare davon erhalten, vielmehr noch in meinem Briefe vom 31ten Oktober v. J. solche als rückständig angeführt. Seit der Zeit ist mir von Ew. Wohlgeb. nichts weiter übersandt, Sie entschuldigen dagegen in dero gütigen Antwort vom 17ten December den bisherigen Verzug der von mir erwarteten Wercke. Wahrscheinlich muß daselbst bey Versendung jenes ersten Theils ein Versehen vorgegangen und die 3 Exemplare für mich vergessen seyn Von Ew. Wohlgeb. Gewogenheit erbitte selbige also mit dem ehesten und ich werde die beiden Exemplare des zweiten Theils für meine Committenten so lange bei mir behalten, biß ich ihnen das ganze Werck, wie wohl ohne die nachzutragende dritte Karte, abliefern kann.
Ich beharre mit unbegränzter Verehrung
ganz gehorsamster Diener
C. F. Evers.
Schwerin den 2ten März 1786.
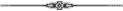


|
[ Seite 357 ] |




|



|


|
|
:
|
V.
Die geschichtliche und landes-
kundliche Literatur
Mecklenburgs 1924-1925
von
Archivdirektor Dr. Stuhr.
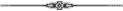


|
[ Seite 358 ] |




|


|
[ Seite 359 ] |




|
Quellen.
-
1. Hoogeweg (H.), Gesch. d. Geschl. v.
Heydebreck. Urk.-Buch 1. Bd. 1245-1500.
Stettin (Saunier) 1924. 291 S. Gr.
4°.
Bespr. v. Otto Grotefend in Mon.-Bl. f. Pomm. Gesch. u. Alt. 1924, S. 44.
Vorgeschichte.
- Beltz (R.), Aus unserer Vorzeit: M. Ztg. 24. u. 25. Juni 1925 (Nr. 144, 145). M. Nachr. 28. Juni 1925 (Nr. 148).
- Warncke (J.), D. Steinzeit unserer Heimat: Quellen d. Heimat, Jahrg. 1924, Reihe III, Heft 1, S. 1-8.
- Beltz, D. Bronzezeit in M. [Bericht über einen Vortrag]: Prähist. Zeitschr. 15. Bd. (1924), S. 132.
- Beltz (R.), D. Bronzezeit u. d. Eisenzeit: Ouellen d. Heimat, Jahrg. 1924, Reihe III, Heft 1, S. 8-13.
- Beltz (R.), D. Schädel auf d. Herde: Zeitschr. M. 19. Jahrg. (1924), Nr. 3, S. 68-70.
- Beltz (R.), Zu unseren Burgwällen: Zeitschr. M. 19. Jahrg., S. 41-50.
- Schuchhardt (C.), Rethra [Bericht über einen Vortrag]: Prähist. Zeitschr. 15. Bd. (1924), S. 134.
-
Schuchhardt (Carl), Vineta: Sitz.-Ber. d.
Preuß. Ak. d. Wiss. 1924, XXV, S. 176-217. -
Hügelbestattung bei den Slaven östl. d.
Oder.
Bespr. v. Becker in Rost. Anz. 18. Okt. 1924 (Nr. 245); Im Lit. Zentr.-Bl. 75. Jahrg. (Nr. 16), Sp. 1276; v. Robert Burkhardt in Mon.-Bl. f. Pomm. Gesch. 1924, Nr. 12, S. 46-48; Entg. v. Schuchhardt das. 1925, Nr. 1, S. 8. - Vitense (Otto), Alte Burgwälle in M. u. ihre Gesch.: M. Nachr. 5., 12. Okt., 30. Nov. 1924, 18., 25. Jan. 1925 (Nr. 234, 240, 281, 15, 21).
- Beltz (Robert) u. Becker (Julius), Berichte über vorzeitliche Funde bei Bramow: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 13. Bd., S. 83-88.
- Becker (J.), D. Ausgrabungen in Bramow: M. Monatshefte 1. Jahrg. 3. Heft, S. 132-133.
- Beltz (Rob.), Neue Funde aus d. Wendenzeit in M. [Mecklenburg, Dierkow]: M. Nachr., M. Ztg. u. Rost. Anz. 9. April 1925 (Nr. 83).
- Buddin (Fr.), D. Wendenzeit in unserer Heimat (bis 1066): Ouellen d. Heimat, Reihe IV, Heft 4 (1924).
- Karbe (W.), D. Blumenbäger Silberfund: Kunst- u. Gesch.-Denkmäler d. Freistaats M.-Strelitz I, 2, S. 1-6.
- Karbe (W.), Wendische Wohngruben: M.-Strel. Heimatbl. 1. Jahrg. Heft 1, S. 13-16.
- Schwantes (Gustav), Vorgeschichtliches zur Longobardenfrage: Nachr.-Bl. f. Niedersachsens Vorgesch. Nr. 2 (1921), S. 1-25.
Geschichte.
- 1Krabbo (Hermann), Markgraf Woldemar von Brandenburg: Monatsbl. "Brandenburgia", 27. u. 28. Jahrg. (1919), S. 39-96. - Grenzen der Mark gegen M. um 1300, M.'sche Fehden Anfang des 14.Jahrhs.


|
Seite 360 |




|
- Steinmann (Paul), D. Gesch. d. m. Landessteuern u. d. Landstände bis z. Neuordnung d. Jahres 1555: Jahrb. f. m. Gesch. 88, S. 1-58.
- Büsch (Walter), Wallensteins letzter Tag in M.: M. Nachr. 2. Aug. 1925 (Nr. 178).
- Endler, Wie es im 30jähr. Krieg auf d. Lande aussah: Unsere Heimat, Bogen 1 (1925), S. 6-16.
- Winkler (Wilhelm), D. Güstrower Erbfolgestreit bis z. Ausscheiden Gutzmers (1695-1699). Rost. Diss. (Auszug). Rostock (Winterberg) 1924. 2 S. 8°.
- Müller (Hans Georg), D. Strel. Politik während d. Güstrower Erbfolgestreites vom Dienstantritt Edzard Adolf v. Petkums (22. Juli 1699) bis z. Hamb. Erbvergleich (8. März 1701). Rost. Diss. (Auszug) 1924. 2 S. 8°.
- Grobbecker (Hans), M.-Strelitz in d. Jahren 1848-1851. Rost. Diss. (Auszug) 1922. 3 S. 8°.
- Sperling (Alfred), D. m. Geistlichkeit in d. Wirren unter Hz. Carl Leopold (1713-1747). Rost. Diss. (Auszug). Harburg (Bertram) 1924. 4 S. 8°.
- Beste (Niklot), M.'s Verhältnis zu Kaiser u. Reich v. Ende d. siebenjähr. Krieges bis z. Ausgang d. alten Reiches (1763-1806). Rost. Diss. (Auszug). Rostock (Winterberg) 1924. 1 S. 8°.
-
v. Bülow (Paula), Aus verklungenen Zeiten.
Lebenserinnerungen 1833-1920. Hrsg. v.
Johannes Werner. Leipzig (Koehler) 1924. 213
S. 8°. - Gattin d. m. Bundestagsgesandten v.
B. (1852-1868) u. m. Oberhofmeisterin
(1868-1880).
Bespr. v. Heinr. Otto Meisner in Preuß. Jahrb. 198. Bd., Heft 3, S. 329-330; v. Eugen Wolbe als "Idylle v. Ludwigslust" in M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 88-91. - Buddin (Fr.), Scherenschnitte aus d. Gesch. d. Ratzeburger Landes: Heimatkal. f. d. Fürst. Ratzeburg 1925.
Fürstenhaus.
- Josephi (W.), Madame u. d. m. Herzogsfamilie: M. Nachr. 21. Mai 1925 (Nr. 117).
- Königin Luise. Briefe u. Aufzeichnungen. Hrsg. u. erl. v. Karl Griewank. Leipzig (Bibl. Inst.) [1925]. 431 S. kl. 8°.
- Ein Brief d. Königin Luise [vom 15./17. Mai 1807, aus "Memoiren u. Briefe" des Bibl. Inst. zu Leipzig]: M. Nachr. 16. 4. 1925 (Nr. 87).
- Josephi, Königin Luise. Aus d. Schloßmuseum: M. Nachr. 4. Jan. 1925 (Nr. 9).
- Pniower (Otto), Aus Berlins Theaterwelt: Mitt. z. Gesch. Berlins 42. Jahrg. Nr. 1-3, S. 2-6. - Brief u. Bild Hgs. Karl v. M.-Strelitz v. 1829.
-
Schultze (Johannes), Kaiser Wilhelms I.
Weimarer Briefe. Deutsche Verlags-Anstalt
Stuttgart 1924. 2 Bde. I: XXXIX u. 302 S.
II: 241 S. 8°. - Beziehungen zum m.
Fürstenhaus.
Bespr. v. Heinr. Otto Meisner in Preuß. Jahrb. 198. Bd., Heft 3, S. 329. - Gechter (John), Gemeinsame Vorfahren d. Kronprinzessin Cäcilie u. d. Hamburger Bgm. Burchard: Zeitschr. f. nieders. Fam.-Gesch. 6. Jahrg. (1924), S. 62-66.
- Wolbe (Eugen), M.'sche Autographen: M. Monatshefte 1. Jahrg. 4. Heft, S. 191-198.


|
Seite 361 |




|
Familien- und Personengeschichte.
- Hintze (Otto), Alte Familien in Stadt u. Amt Gadebusch in M. im 15.-17. Jahrh.: Zeitschr. d. Zentralst, f. niedersächs. Fam.-Gesch. 7. Jahrg. Nr. 3, S. 57-58.
- Bohnsack, Bauernfamilienforschung: D. Heimat 3. Jahrg., Nr. 9/10, S. 138-142.
- Weinitz (Franz), D. Bildnis Blüchers von Ernst Gebauer: Mitt. z. Gesch. Berlins 42. Jahrg., Nr. 1-3, S. 19-21.
- Teuchert (H.), Ein Brief John Brinkmans aus New York: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 82-83.
- Nachr.-Bl. d. Freiherren u. Herren v. Ditfurth. Nr.1. Hannover (Niederdeutsche Ztg.) 1925.
- Mitt. d. Düring schen -Fam.-Verb. Nr. 9 (1923). Nr. 10 (1924). Fol.
- Stier (Walter), Stammtafel d. Fam. Erdmann [aus Schwerin]. 1925.
- Baumann (Martin), Rudolph Gahlbeck: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 92-93. - Maler, Musiker, Dichter.
- Beltz (R.), E. Geinitz †: Zeitschr. M. 20. Jahrg. Nr. 1, S. 1-3.
- Ruppersberg, Hermann Grotefend als Frankfurter Stadtarchivar: "Didaskalia", Beil. d. Frankf. Nachr. 8. Febr. 1925, S. 22-24.
- Heuer (O.), Hermann Grotefend. Ein Frankf. Erin.-Bl. z. s 80. Geburtstage: Deutsche Allg. Ztg., Ausg. v. Gr. Frankf. 17. 1. 1925 (Nr. 29).
- v. Beresteyn (E. A.), Fragment-Genealogie van het Geslacht de Groot [dazu gehörig der Gelehrte Hugo Grotius, †Rostock 1645]: De Nederlandsche Leeuw 43. Jahrg. (1925), Nr. 6 (Grotius-Nummer), Sp. 163-172.
- Haack (Ernst), Führungen u. Erfahrungen. Schwerin (Bahn) 1925. 240 S. 8°.
- Steinhausen (Georg), General Haevernick: Rost. Anz. 19. Febr. 1925 (Nr. 42); Zeitschr. M. 20. Jahrg. Nr. 1, S. 22-26.
- Krüger (Christian), Zu Reuters Dörchläuchting (Die Läufer Jacobsen u. Halsband ): Jahrb. f. niederd. Sprachf. Jahrg. 50 (1924), S. 55-57.
- Iven' sche Fam.-Nachrichten, Nr. 2 (1925). Stettin (Pomm. Reichspost) [1924]. 12 S. Gr. 4°.
- D. Geschl. derer v. Kirchbach im Weltkriege 1914-18. Görlitz (Nachr. u. Anz.) 1925. 170 S. Gr. 4°.
- Benick (L.), Friedrich Wilhelm Konow u. Wilhelm Weltner, zwei Naturwissenschaftler aus d. Ratzeburger Lande: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6. Jahrg. (1924), S. 52-54.
- Ludwig Krause † [Landesarchivar in Rostock]: D. Heimat 3. Jahrg. Nr. 8, S. 118-119.
- Dragendorff (Ernst), Ludwig Krause † : Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 13. Bd., S. 5-11.
- Gosselck (Johannes), Karl Krickeberg [Prof. in Rostock, Dramatiker]: M. Monatshefte 1. Jahrg. 1.Heft, S. 51-53.
- Seebo (Heinrich), Joachim Pentz u. d. Kloster Harsefeld: Stader Archiv N. F. Heft 14 (1924), S. 64-70.
- Aus vergangenen Tagen: Nr. 1. Der Cammer Juncker Eurd Friedrich v. Pentz auf Volzrade. Schwerin (Dietzsch) 1925. 35 S. 8°.


|
Seite 362 |




|
- Nachr.-Bl. d. Fam. v. Pressentin bzw. v. Pr. gen. v. Rautter. Nr. 10-11. Hettstedt (Hohnbaum-Hornschuch) 1924-25. Nr. 12. Friedland (Döring) 1925.
- Bremer (Otto), Wie stehen wir zu Fritz Reuter?: Ouickborn 1924, S. 66-71.
- Dohse (Richard), Fritz Reuter als Erzieher: Deutsche Kunstschau 1. Jahrg., S. 27--29, 46--49.
- Gosselck (J.),Reuter u. d. Schule: M. Schulztg. 55 (1924), S.345--348.
- de Haas (A.), Fritz Reuters religiöse Weltanschauung. Neuwied (Meincke) 1924. 23 S. 8°. Sonderdr. aus "Theol. Arb. aus d. Rhein. wiss. Pred.-Ver."
- Janssen (Albrecht), Fritz Reuters dichterische Entwickelung u. Bedeutung: Niederd. Heimatblätter 1. Jahrg. (1924), S. 12--14.
- Huhnhäuser (Alfred), Zu Fritz Reuters Gedächtnis: M. Monatshefte 1. Jahrg., 1.Heft, S. 21-28.
- Müller, Fritz Reuter: D. Volksschule 20 (1924), S. 173-178.
- Mitt. über d. Gesch. d. Familien Rosenow. Nr. 40 (März 1925).
- v. Schack (Hans), Beitr. z. Gesch. d. Grafen u. Herren v. Schack, 4. Beitr., 2. u. 3. Heft (1924-1925), S. 21-78.
- Karbe (W.), Heinrich Schliemann u. s. Beziehungen zu M.-Strel.: M.-Strel. Heimatbl. 1. Jahrg. Heft 1, S. 9-13.
- Spalckhaver (Richard), Gesch. d. Fam. Spalckhaver aus Rostock. Halle (John) 1916. 49 S. Gr. 8°.
-
Spiegelberg (Rudolf), Über d. Fam.
Spiegelberg. Sippenkundl. Untersuchungen:
Jahrb. f. m. Gesch. 88, Anhang S.
1-46.
Bespr. v. F. Meggendorfer in Zeitschr. d. Zentralst. f. niedersächs. Fam.-Gesch. 7. Jahrg. Nr. 2, S. 34; v. Ludwig Flügge in Fam.-Gesch.-Bl. 23. Jahrg., Sp.91-92. - Ernst (Gustav), Tilmann Stellas Reise nach Wien 1560: Siegener Ztg. 28. März 1925.
- Ernst (Gustav), Tillmanus Stella Sigenensis in Zweibrücken 1563: Siegener Ztg. 5. Sept. 1924 (Nr. 209).
- Ernst (Gustav), D. Privilegium d. Kaisers Maximilian II. für Tilemann Stella von Sigen (1569): D. Heimat, hrsg. v. Westfälischen Heimatbund, 6. Jahrg., Heft 9 (1924), S. 234-235.
- Ernst (Gustav), Von d. Fam. d. Tilemannus Stella Sigenensis: Siegerland 7. Bd., S. 51-56.
- Wunderlich, D. Nachkommen d. Geh. Min.-Rats Georg Störzel. Schwerin (Sandmeyer) 1924. 43 S. 8°.
-
Trendelenburg (Friedrich), Aus heiteren
Jugendtagen. Berlin (Springer) 1924. 296 S.
8°. - Wismarsche Fam., Univ.-Prof. in
Rostock.
Bespr. im Rost. Anz. 21. Dez. 1924 (Nr. 299). - Zitelmann (Ernst), Lebenserinnerungen. Privatdruck. Bonn 1924. 40 S. 8°. [Ord. Prof. d. Jurispr. in Rostock 1879-81.]
Chronologie.
- Grotefend (H.), Chronologisches XXII, XXIII [Nachträge, Peterstach so allerwrmich leiche ze wazzer gat. Werkwoche]: Korr.- Bl. d. Gesamtver. 72 (1924), Sp. 104-107.
Landeskunde.
- Göbeler (P.), Über Heimatkunde u. Naturschutz: M.-Strel. Heimatbl. 1. Jahrg. Heft 1, S. 3-9.


|
Seite 363 |




|
- Ahrens (Adolf), An d. Recknitz: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S.107-109.
- Kröplin (O.), D. Treptowsee: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 22-25.
- Geinitz (E.), D. Warnow Profil bei der Niexer Eisenbahnbrücke: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 17-22.
- v. Maltzahn, M.'s Vogelwelt u. ihr Heimatswert: M. Monatshefte 1. Jahrg. 1. Heft, S. 33-37.
- Wachs (Horst), D. Vogelzug u. d. Methoden s. Erforschung: M. Monatshefte 1. Jahrg. 3. Heft, S. 124-131.
- Wachs (H.), Beitr. z. Ornithologie M.'s: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 29-63.
- v. Stralendorff, Über Veränderungen in d. Vogelfauna während eines Zeitraums von 60 Jahren: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 14-15.
- Warncke (M.), Seltene Vogelarten unsres Heimatlandes: Zeitschr. M. 19. Jahrg. (1924), Nr. 3, S. 65-68.
- Steusloff (Ulrich), Bem. zur Paludestrina jenkinsi E. A. Smith [eine Schnecke]: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 7-13.
- Krause (H. L.), Rostocker Botaniker des 16. bis 18. Jahrhs. u. über d. Veränderungen im Pflanzenbestande: Archiv m. Naturforscher 1. Bd., Heft 2, S. 15-17.
- Staak (G.) u. a., Wurten: Zeitschr. M. 20. Jahrg. (1925), S. 52-56.
- Geinitz (E.), D. Wurten im m. Flurnamenverzeichnis: Zeitschr. M. 20. Jahrg. Nr. 1, S. 26-27.
- Allerding (Friedr.), D. Flurname "Schar": Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg. (1925), S. 25-26.
- Flurnamen von Schaddingsdorf: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg. (1925), S. 24-25.
- Tiedemann (Franz), Flurnamen von Schlagsdorf, Dorf u. Hof: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg., Nr. 1, S. 8-9.
- Techen (F.), D. Flurnamen d. Wismarschen Feldmark: Zeitschr. Mecklb. 19. Jahrg., S. 33-41.
Kulturgeschichte und Volkskunde.
- Peßler (Wilhelm), D. niedersächsische Kulturkreis: Niederdeutsche Heimatbl. 1. Jahrg. (1924), S. 3-5.
-
Huhnhäuser (A.), Aus d. Heimat Fritz Reuters
u. John Brinckmans. Ein m. Heimatbuch.
Frankfurt a. M. (Diesterweg)
1924.
Bespr. v. C. Fr. Maaß in M. Monatshefte 1. Jahrg., S. 212. -
Wolf (Gustav), D. norddeutsche Dorf. München
(Piper) 1923. 222 S. 8°. - Berührt auch
M.
Bespr. von Walter Dammann in Zeitschr. f. Hamb. Gesch. 25. Bd., S. 297-298. - Folkers (J. U.), D. Wohnkultur d. m. Bauerndorfes: M. Monatshefte 1. Jahrg. 1. Heft, S. 41-44.
- Lenschow (Wilh.), D. Bauen auf d. Lande: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg. (1925), S. 18-22.
- Gillhoff (Jobannes), Strohkaten: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 111-113.
- Romberg (G.), Aus alter bäuerlicher Hauswirtschaft: Zeitschr. M. 20. Jahrg. (1925), S. 59-62.


|
Seite 364 |




|
- Ahrens (Adolf), Licht u. Feuer im Hause unserer Großväter: M. Monatshefte 1. Jahrg. (1925), S. 233-235.
- Puls, Dei mäkelbörgsche Volksdracht: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6. Jahrg. (1924), S. 55-57.
- Wossidlo (R.), Von Hochtiden. (Bökerie v. Plattd. Landesverb. M. Heft 5). Wolgast (Christiansen) 1924. (46 S.) 8°.
- Beltz (R.), Steinmale: Zeitschr.M. 19. Jahrg. (1924) Nr. 3, S. 70-78.
- Niedt (O.), D. Volksdichte in M.-Strelitz. Rost. Diss. (Auszug). [1924]. 3 S. 8°.
- Staak (G.), Was weiß d. Volkssage v. d. Gesch. d. Landes?: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 102-106.
- Passehl u. Buddin (Fr.), Sagen aus d. Norden u. dem Süden d. Landes Ratzeburg u. d. angrenzenden Gebieten: Quellen der Heimat 1924, Reihe III (Vorgesch. u. Sagen), Hefte 2 u. 3.
- Asmus (Heinrich), Pape Dön, der Bettler: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6, S. 39-40.
Wirtschaftsgeschichte.
(Landwirtschaft,
Handwerk, Verkehrswege.)
- Rörig (Fritz), M. Küstengewässer u. Travemünder Reede: Zeitschr. f. Lübeckische Gesch. u. Alt. Bd. 22, Heft 2, S. 215-323.
- Ploen (H.), Lübecks erster Übergriff an d. Stepnitz. Wieschendorf- Vorwerk-Bünsdorf: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg, 7. Jahrg. Nr.1, S. 9-13.
- Jaentsch (W.), D. m. Obst- u. Gartenbau einst u. jetzt. Rostock (Hinstorff) [1925]. 117 S. 8°.
- Lau (Magda), D. Betriebsräte in d. Landwirtschaft M.-Schwerins. Rost. Diss. (Auszug). Rostock (Winterberg) 1924. 3 S. 8°.
- Endler, Aus d. Gesch. d. Handwerks im Lande Ratzeburg: Nordd. Handwerker, Bundestagung Neustrelitz 1924, 3 S.
- Endler, Handwerk u. Zünfte im Lande Stargard: Nordd. Handwerker, Bundestagung Neustrelitz 1924, 4 S.
- Endler, Aus vergangenen Tagen d. Handwerks im Lande Stargard: Landesztg. 26.-28. Juli 1924.
- Endler (E. A.), D. Entwicklung d. Verkehrswege in M.-Strelitz: M. Rundschau, Jan. 1925.
Ortsgeschichte.
- Verzeichn. sämtl. Ortschaften v. M.-Schwerin u. -Strelitz (mit Ausn. d. Städte). 7. Ausg. v. 1. Okt. 1924. Güstrow (Opitz) 1924. 126 S. Gr. 8°.
- Bachmann (Friedrich), Die älteren m. Städteansichten: Jahrb. f. m. Gesch. 88, S. 117-224.
- Passehl, Aus Dassows Vergangenheit: Quellen d. Heimat Jahrg. 1924, Reihe IV (Gesch.), Heft 2, S. 1-6.
- Görschner (R.), D. musikalische Gilde in Friedland: Zeitschr. M. 20. Jahrg. (1925), S. 62-64.
- Beilz (R.), Gadebusch: Zeitschr. M. 20. Jahrg. (1925), S. 35-48.
- Reinhardt, Vom Rat in Gadebusch: Zeitschr. M. 20. Jahrg. (1925), S. 48-51.
- Masch (Konrad), Aus d. Akten d. Brunnens auf d. Sandhofe zu Gnoien in M.: Zeitschr. M. 19. Jahrg. (1924), Nr. 3, S. 78-85.
- Reuter (Adolf), Ludwigslust im Wandel zweier Jahrh.: Westermanns Monatshefte 68. Jahrg. (1924), S. 493-501.


|
Seite 365 |




|
- Wendt, Wie Neubrandenburg gegründet wurde: Quellen d. Heimat, Reihe IV Heft 1, S. 6-11.
- Wendt, Neubrandenburg in alter u. neuer Zeit: M. Monatshefte 1. Jahrg. (1925), S. 214-222.
- Wendt, Tillys Zug durch M. u. d. Eroberung Neubrandenburgs (März 1631): Unsere Heimat, Bogen 1 (1925), S. 1-6.
- Mahn (E.), D. Neubrandenburger Fritz-Reuter-Sammlung: Korr.-Bl. f. niederd. Sprachf. 1924, Heft 39, S. 33-35.
- Endler, Wie Neustrelitz gegründet wurde: Quellen d. Heimat, Reihe IV Heft 1, S. 12-16.
- E., Vom Grundstein d. alten Gymnasiums [in Neustrelitz]: Landesztg. 12. Juni 1925 (Nr. 133).
- Schondorf, D. Neubau d. Carolinums in Neustrelitz:Landesztg. 12. Juni 1925 (Nr. 133).
- Meyer (E.), D. Neubau des Carolinums: Landesztg. 12. Juni 1925.
- Duncker, D. Entwicklung d. Gymnasium Carolinum bis 1925 Landesztg. 12. Juni 1925: (Nr. 133).
- Wesemann, D. Entwicklung d. Realgymnasiums bis 1925: [in Neustrelitz: ]: Landesztg. 12. Juni 1925 (Nr. 133).
- [Augustin], D. Aussehen Parchims um d. Jahr 1800: Norddeutsche Post, Herbst 1920.
- [Augustin], Aus d. ältesten Parchimer Stadtbuch: Norddeutsche Post April 1922.
- [Augustin], Hundert Jahre "Brunnen" [bei Parchim ]: Norddeutsche Post 19. Juli bis 29. Aug. 1923 (Nr. 164-198). Unvollständig abgedruckt.
- Augustin (Karl), Schanze bei Parchim: Zeitschr. M. 19, S. 59.
- Endler, D. fürstl. Haus auf d. Domhof [ Ratzeburg ], die Propstei: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg. Nr. 1, S. 3-5.
- Krause (Ludwig), Zur Rostocker Topographie: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 13. Bd., S. 12-82.
- Alte Volkszählungen in Rostock: Rost. Anz. 16. 6. 1925 (Nr. 137).
- D. Wohnungsdichte d. Rostocker Bevölkerung: Rost. Anz. 19. April 1925 (Nr. 90).
- Eysten (J.), Adviezen van den Hollandschen Ingenieur Johan van Valkenburg over de Bevestiging van Rostock: Bijdragen en Mededeelingen van het historisch Genootschap te Utrecht, 34. Bd. (1913), S. 272-292.
- Wie man vor 80 Jahren den Sonntag in Rostock verlebte: Rost. Anz. 2. Aug. 1924 (Nr. 179).
- Voß (G.), Unsere Kirche [St. Marien zu Rostock ]: Gem.-Bote v. St. Marien-Rostock 4. Jahrg., S. 29-31; 5. Jahrg., S. 1-3, 8-9.
- Hulshof (A.), Verslag van een Onderzoek te Rostock naar Handschriften, Drukwerken en Bescheiden belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland. S'Gravenhage (Nijhoff) 1909. 90 S. 8°.
-
Ahrens (Adolf u. Rudolf), D. Heide, d.
Kleinod d. Stadt Rostock. Rostock (Bohrend
& Boldt). 2. Aufl.
Bespr. v. C. Fr. Maaß in M. Monatshefte 1. Jahrg., S. 211. - Buddin (Fr.), Auf d. Burg Schlagsdorf (aus Beyers Roman "Anastasia"): Quellen d. Heimat 1924, Reihe IV (Geschichte), Heft 3.
- Geinitz, Aus d. Erdgesch. von Schönberg: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6, S. 34-38.


|
Seite 366 |




|
- Buddin (Fr.), Wie Schönberg entstanden sein mag: Quellen d. Heimat, Reihe IV Heft 1, S. 1-5.
- Warncke (J.), D. Schönberger Bischofsschloß: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7. Jahrg. Nr. 1, S. 5-7.
- Endler (E. A.), D. Schönberger Zünfte: Heimatkal. f. d. Fürst. Ratzeburg 1925.
- Führer durch Schwerin u. Umgebung, Bad Zippendorf, Luftkurort Friedrichsthal. Schwerin (Merkur-Verlag) [1925]. 40 S. 8°.
- Franz (Wilhelm), Heimkehr nach Schwerin: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 57-65.
- Hamann (Andreas), Rat u. Serenissimus beim Neubau d. Kramgebäudes in Schwerin: M. Monatshefte 1. Jahrg., S. 134-138.
- Haendler (Eberhard), D. ehem. tierärztlichen Lehranstalten zu Karlsruhe, Marburg u. Schwerin: Veterinärhist. Jahrb. 1925, S. 118-124.
- Warncke (J.), Ein Grabmal d. 17. Jahrh. in Selmsdorf: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6, S. 40-42.
- Endler, D. Fehde von Tornowhof (1811): Landesztg. 4. Febr. 1925 (Nr. 35).
- Barnewitz (Friedrich), Gesch. d. Hafenorts Warnemünde. 2. Aufl. Rostock (Leopold) 1925. 347 S. 8°.
- Barnewitz (Friedrich), Warnemünder Volkstum: M. Monatshefte 1. Jahrg. 4. Heft, S. 198-203.
- Mielert (Fritz), In Wismar werfen sich Kirchen wie rote Berge auf: M. Monatshefte 1. Jahrg., 1. Heft, S. 29-32.
- Josephi (W.), D. Haus d. Kaufm.-Comp. in Wismar: Beil. z. Rost. Anz. 19. April 1925 (Nr. 90).
- Schüßler (Hermann), Woldegks Handwerk u. Gewerbe in früheren Zeiten: Nordd. Handw., Bundestagung Neustrelitz 1924, 4 S.
Kirchenwesen.
-
Willgeroth (Gustav), D. M.-Schwer. Pfarren
seit d. Dreißigjähr. Kriege. Mit Anm. über
d. früh. Pastoren seit d. Reform. 1. Bd.
Wismar (Selbstverlag) 1925. S. 1-632.
8°.
Auf Grund der 1.Lief. (Sept. 1924) bespr. v. Friedrich Stuhr in M. Ztg.; Paul Kuhlmann in M. Nachr.; Friedrich Techen in M. Tagesbl.; G. K. im Rost. Anz.; C. Frhr. v. Rodde im Deutschen Herold 55. Jahrg., S. 49; W. Weidler in Zeitschr. f. Nieders. Fam.-Gesch. 6. Jahrg., S. 110-111. - Salis (F.), Forschungen z. ält. Gesch. d. Bistums Kammin: Balt. Stud. N. F. 26. Bd. (1924), S. 1-155.
- Bachmann (Fr.), D. erste niederdeutsche Gesangbuch: Ev.-Luth. Zeitbl. 16. Jahrg. Nr. 8, S. 113-116.
Schulwesen.
- Schult (O.), M.-Schwer. Volksschulunterhaltungsgesetz v. 10. Dez. 1920. Schwerin (Bärensprung) 1924. 131 S. 8°.
- Evermann (W.) u. Wahls (H.), Schulrecht u. Lehrerrecht im Freistaat M.-Schwerin. Wismar (Eberhardt) 1925. XII u. 504 S. 8°.
Kunst und Kunstgewerbe.
- Krüger (Georg), Kunst- u. Geschichts-Denkmäler d. Freistaates M.-Strelitz. I, 2. (Amtsgerichtsbezirke Fürstenberg, Feldberg, Woldegk u. Friedland, 1. Hälfte). Neubrandenburg (Brünslow) 1925. XV u. 474 S. Gr. 4º.


|
Seite 367 |




|
- Baalk (Arth.) Bem. üb. d. klassizistische Architektur M.-Schwerins: Zeitschr. M. 19.Jahrg. (1924), Nr. 3, S. 86-92.
-
Zu Dobert (Joh. Paul), Bauten u. Baumeister
in Ludwigslust.
Bespr. v. C. Zetzsche in Denkmalpflege u. Heimatschutz 1923, Heft 7-9, S. 157. - Gehrig (Oscar), D. bürgerliche Baukunst Wismars. (M. Bilderhefte, Heft 3). Rostock (Hinstorff) [1925]. 42 S. 8°.
- Baalk (Arthur M.), D. m. Dorfkirche: Zeitschr. M. 19, S. 50-59.
- Ihlenfeld (Kurt), Die mittelalterlichen Grabsteine in M. u. Vorpommern. Greifsw. Diss. (Auszug). Greifswald 1923. 2 Bl. 8°.
- Philippi (F.), D. ma. Grabsteinplastik M.'s: Denkmalpflege u. Heimatschutz 1923, Heft 4/6, S. 81-88.
- Beltz (R.), D. ma. Grabsteinplastik M.'s: Zeitschr. M. 20, S. 56-58.
- Dettmann (Gerd), Alte Gärten in M.: M. Nachr. 24. Mai 1925.
- Josephi (W.). D. Sammlungen u. d. Prunkräume d. Schloßmuseums (Führer durch d. M. Landesmuseum in Schwerin). 3. erw. Aufl. Schwerin (Bärensprung) [1925]. 84 S. Gr. 8°.
- Josephi (W.), D. Schweriner Museen: M. Monatshefte 1. Jahrg. 4. Heft, S. 164-169.
- Dettmann (Gerd), D. Bildnisse d. Schloßmuseums: M. Ztg. 26. u. 28. Juli 1924 (Nr. 173, 174).
- Witte (Hans), Aufbau u. Entwicklung d. Landesmuseums in Neustrelitz: M. Rundschau, Jan. 1925.
- Tank (Helene), Gesch. d. Schweriner Hoftheaters 1855-1882: Jahrb. f. m. Gesch. 88, S. 59-110.
- Tank (Helene), D. Aufführungen d. Schweriner Hoftheaters in Doberan, Ludwigsl. u. Wismar: Jahrb. f. m. Gesch. 88, S.111-116.
- Von einer Kapellmeisterin vor hundert Jahren [Marie Westenholz am Hoftheater in Ludwigslust]: M. Nachr. 10. Juli 1924 (Nr. 159).
- Milenz (Hermann), D. Pflege d. Musik u. d. Gesanges im Lande M., speziell in d. Hauptstadt Schwerin, einst u. jetzt: M. Nachr. 28. Dez. 1924 (Nr. 303), 4. u. 11. Jan. 1925 (Nr. 3, 9).
Münzgeschichte.
- Westien (Johs.), D. Kipper- u. Wipperzeit Alt-M.'s: M. Monatshefte 1. Jahrg. 4. Heft, S. 206-208.
Kriegs- und Militärgeschichte.
- Daniel, Aus d. Militärabteilung d. Schweriner Museums, I-IX u. Schlußbetrachtung: M. Nachr. 22. März - 16. Mai 1925.
- Die Schellenbäume d. M. Bat.: M. Nachr. 28. Jan. 1925 (Nr. 23).
- v. Wulffen (Gustav Adolf), Unsere Grenadiere im Weltkriege: M. Nachr. 14. Nov.- 7. Dez. 1924 (Nr. 268-287); Nachr.-Bl. d. Bundes m. Gren. Nr. 6 ff. (1925).
- Range, Weihnachtskämpfe 1914, 1. u. 2. Sommeschlacht 1916, Schlacht in der Champagne: Nachr.-Bl. des Bundes m. Grenadiere Nr. 4, 5 (1924).
- Hüls (Karl), Aus meinem Kriegstagebuch: Nachr.-Bl. des Bundes m. Grenadiere Nr. 4, 5 (1924), 6, 7 (1925).
- Währer (Georg Asmus), D. Res.-Feldart.-Rgt. Nr. 46 (Erinnerungsbl. deutsch. Rgtr., Ehem. Preuß. Truppenteile, 93. Heft). Oldenburg-Berlin (Stalling) 1923. 220 S. 8°. - M. Formation: I. u. II. Abt. in Güstrow aufgestellt, auch Ers.-Abt. in Güstrow.


|
Seite 368 |




|
- Grambow (R.), D. Feuertaufe. Ein Tag in Belgien [beim Res.-Inf.-Rgt. 214]: Div.-Ztg. d. ehem. 46.Res.-Div., 2. Jahrg. (1925) Nr. 2, S. 5-6; Nr. 3, S. 6.
- Willers (H.), Aus d. Gesch. d. Inf.-Rgts. 215. Die Patrouille nach Roulers 18. Okt. 1914 [geführt v. Off.-Stellv. Sellschopp v. Rgt. 214]: Div.-Ztg. d. ehem. 46. Res.-Div., 2. Jahrg. (1925) Nr. 3, S. 3-5; Nr. 5, S. 4.
- D. M. Kriegerverband von s. Gründung bis zur Gegenwart: Festschr. z. Feier des 50jähr. Bestehens 1925, S. 13-29.
Literatur.
- Stuhr (Friedrich), D. gesch. u. landeskundl. Literatur M.'s 1923-1924: Jahrb. f. m. Gesch. 88, S. 225-236.
- Techen (Fr.), D. Name M. u. s. Schreibung: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 100-101.
-
Zu Kruse (E.), Dialektgeographie v. Süd-M.
u. d. angrenz. Elbmarschen Brandenburgs u.
Hannovers Rost. Diss. 1923.
Bespr. v. H. Teuchert im Korr.-Bl. f. niederd. Sprachf. 1924, Heft 39, S. 47. - Krüger (H. K. A.), Vom Redentiner Osterspiel: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 94-97.
-
Zu Gehl (W.), Metrik d. Redentiner
Osterspiels. Rost. Diss. 1923.
Bespr. v. H. Teuchert im Korr.-Bl. f. niederd. Sprachf. 1924, Heft 39, S. 46-47. - Schlüter (Ernst), Vom neuniederdeutschen Drama: M. Monatshefte 1. Jahrg. 2. Heft, S. 84-87.
- Reuter (Fritz): Werke. Hrsg. v. Wilhelm Seelmann. 7 Bde. Leipzig (Bibl. Inst.) [1924]. Kl. 8°.
- Fuchs (G.), D. sittl. Gedanken in Fritz Reuters Werken: D. Deutschkirche 3. Jahrg. Bl. 21, 5 (1924).
- Semerau (Alfred), Fritz Reuter u. s. Modelle: Frankf. Ztg. 12. 7. 24.
- Müller (Viktor), Über Fritz Reuters Sprache u. s. Entwicklung z. mundartlichen Dichter: D. Volksschule 20 (1924), S. 178-184.
- Winkel (Fr.), Etwas über Fritz Reuters "Kein Hüsung": M. Schulztg. 12. Juli 1924, S. 349-350. 211. Winkel (Fr.), Ouellen zu Fritz Reuters"Läuschen un Rimels" : M. Schulztg. 12. Juli 1924, S. 351-354.
- Teuchert (Hermann), John Brinckmans dichterische Heimat: M. Monatshefte 1. Jahrg. 3. Heft, S. 141-143.
-
Zu Böhmer (A.), Friederich Georg Babst.
Rost. Diss. 1923.
Bespr. v. H. Teuchert im Korr.-Bl. f. niederd. Sprachf. 1924, Heft 39, S. 47: Im "Theutonista", 48-59, ein größerer Auszug. -
Zu Ballschmieter (G.), Adolf Brandt (Felix
Stillfried) u. s. Erzählungstechnik. Rost.
Diss. 1921.
Bespr. v. H. Teuchert im Korr.-Bl. f. niederd. Sprachf. 1924, S. 46.
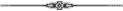


|
Seite 369 |




|
A
rt.-Rgt. 46 (Res.-Feld-) 196.
Autographen 36.
B
abst, Dietrich Georg 213.
Blücher,
Fürst 39.
Blumenhagen 15.
Botaniker
91.
Bramow 11. 12.
Brand, Adolf
214.
Brandenburg, Mark 18.
Brinckman.
John 40. 212.
v. Bülow, Paula,
Oberhofmeisterin 27.
Bünsdorf 114.
Burchard, Hamburger Bürgermeister 35.
Burgwälle 7 ff.
C
äcilie, Kronprinzessin 35.
Chronologie 80.
D
assow 114. 123.
See 114.
Dierkow 13.
v. Ditfurth, Familie 41.
Doberan, Theater 187.
Düring, Familie 42.
E
rbfolgestreit, Güstrower 22. 23.
Erdmann, Familie 43.
F
amiliengeschichte 37 ff.
Feldberg
173.
Flurnamen 93-97.
Friedland 124.
173.
Friedrichsthal 157.
Fürstenberg
173.
Fürstenhaus 25. 29-36.
G
adebusch 37. 125. 126.
Gahlbeck,
Rudolph 44.
Gärten 181.
Gartenbau
115.
Geinitz, E., Professor 45.
Gesangbuch 170.
Geschichte 18-28.
Gnoien 127.
Grabsteine 178-180.
Grenadier-Rgt. 89: 192-195.
Grotefend, H.
Geh. Archivrat 46. 47.
Grotius, Hugo
48.
Gutzmer 22.
H
aack, Geh. Oberkirchenrat 49.
Haevernick, General 50.
Halsband, Läufer
51.
Handwerk 117-119.
Harsefeld,
Kloster 58.
v. Heydebreck, Familie 1.
Hochzeitsbräuche 107.
J
acobsen, Läufer 51.
Inf.-Rgt. 214
(Res.-) 197. 198.
Jven, Familie 52.
K
ammin, Bistum 169.
Karl, Herzog
33.
Karl Leopold, Herzog 25.
Karlsruhe
160.
v. Kirchbach, Familie 53.
Kirchenwesen 25. 168-170.
Konow, Friedr.
Wilh. 54.
Krause, Ludwig, Landesarchivar
55. 56.
Krickeberg, Karl, Prof. 57.
Kriegerverband 199.
Kriegs- u.
Mil.-Geschichte 21. 131. 191-199.
Kulturgeschichte 98 ff.
Kunst 173 ff.
Küstengewässer 113.
L
andeskunde 81-97.
Landessteuern
19.
Landstände 19.
Landwirtschaft
116.
Literatur 200 ff.
Longobardenfrage 17.
Lübeck, Streit mit -
um die Lübecker Bucht u. d. Dassower See 113.
114.
Lübecker Bucht 113.
Ludwigslust
128. 175. 187. 188.
Bauten 175.
Theater 187. 188.
Luise, Königin von
Preußen 30-32.
M
arburg 160.
Maximilian II., Kaiser
75.
Mecklenburg, Dorf 13.
M.-Schwerin
25. 26. 29. 34-36. 113. 121. 122.
Fürstenhaus 25. 29. 34-36.
Küstengewässer 113.
Ortschaftsverzeichnis 121.
Politik
26.
Städteansichten 122.
M.-Strelitz 22-24. 30-34. 70. 109. 120. 121.
122. 173.
Fürstenhaus 30-34.
Kunst- u. Gesch.-Denkm. 173.
Ortschaftsverzeichnis 121.


|
Seite 370 |




|
Politik 23.
Städteansichten 122.
Verkehrswege 120.
Volksdichte
109.
Münzgeschichte 190.
N
aturschutz 81.
Neubrandenburg
129-132.
Neustrelitz 133-138. 185.
Gründung 133.
Museum 185.
Schulen, höhere 134-138.
Niex,
Eisenbahnbrücke 84.
O
bstbau 115.
Ortsgeschichte
121-167.
Osterspiel, Redentiner 203. 204.
P
archim 139-142.
Pastoren 168.
v. Pentz, Curd Friedr. 59.
Joachim 58.
v. Petkum, Edzard Adolf 23.
v. Pressentin,
Familie 60.
Preußen, Luise, Königin von 30-32.
Q
uellen 1.
Ratzeburg, Domhof 143.
R
atzeburg, Fürftentum 28. 111. 112.
Sagen 111. 112.
R
ecknitz, Fluß 82.
Redentiner
Osterspiel 203. 204.
Rethra 8.
Reuter,
Fritz 51. 61-67. 132. 206-211.
Rosenow,
Familie 68.
Rostock 91. 144-151.
Befestigung 147.
Botaniker 91.
Heide 151.
Kirche (Marien) 149.
Topographie 144.
Volksleben 148.
Volkszählung 145.
Wohnungsdichte 146.
S
agen 110-112.
v. Schack, Familie
69.
Schaddingsdorf 95.
Schar, Flurname
94.
Schlagsdorf 96.
152. Schliemann,
Heinrich 70.
Schneckenart 90.
Schönberg 153-156.
Bischofsschloß
155.
Schulwesen 171.
Schwerin 157-160.
182-184. 186. 187. 191.
Führer 157.
Kramgebäude 159.
Museen 182-184.
191.
Theater 186. 187.
Tierärztliche Lehranstalt 160.
Sellschopp, Off.-Stellv. 198.
Selmsdorf
161.
Spalckhaver, Familie 71.
Spiegelberg, Familie 72.
Steinmale
108.
Stella, Tilemann 73-76.
Stepnitz,
Fluß 114.
Steuern 19.
Stillfried,
Felix 214.
Störzel, Georg, Geh Min.-Rat 77.
T
ornowhof, Reede 162.
Travemünde,
Reede 113.
Trendelenburg, Friedr., Prof.
78.
Treptowsee 83.
v.
V
alkenburg, Johann, Ingen. 147.
Verkehrswege 120.
Vineta 9.
Vogelwelt
85-89.
Volkskunde 98 ff.
Volkssagen
110-112.
Volkstracht 106.
Vorgeschichte 2-17.
Vorwerk 114.
W
allenstein 20.
Warnemünde 163.
164.
Warnow, Fluß 84.
Weltner, Wilhelm
54.
Westenbolz, Marie, Kapellmeisterin
188.
Wieschendorf 114.
Wilhelm I.,
Kaiser 34.
Wirtschaftsgeschichte 113
ff.
Wismar 97. 165. 166. 176.
Baukunst 176.
Flurnamen 97.
Kaufmannskompagnie 166.
Kirchen
165.
Woldegk 167. 173.
Woldemar,
Markgraf v. Brandenburg 18.
Wurten 92. 93.
Z
ippendorf 157.
Zitelmann, Ernst,
Prof. 79.
Zunftwesen 118.
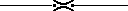


|




|


|




|



|


|
|
:
|
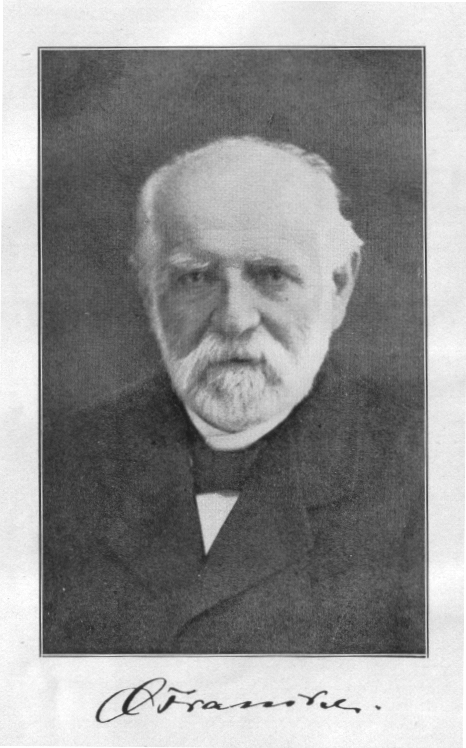


|
[ Seite 371 ] |




|
Jahresbericht
über das Vereinsjahr
vom 1. Juli 1924 bis 30. Juni 1925.
Die Mitgliederzahl ist im abgelaufenen 90. Vereinsjahr etwas zurückgegangen. Eingetreten sind 28 Mitglieder, ausgetreten 29, verstorben 12. Der Verein zählte am 30. Juni 1925 4 Ehrenmitglieder, 7 korrespondierende und 692 ordentliche Mitglieder (Anlage A).
Unter den Toten dieses Jahres ist der Geheime Kommerzienrat Carl Francke, der am 2. Januar 1925 in Schwerin im hohen Alter von 86 Jahren verstorben ist. Er war vierzig Jahre hindurch unser Mitglied und als Besitzer der Bärensprungschen Hofbuchdruckerei während dreier Jahrzehnte Verleger der gesamten Veröffentlichungen des Vereins. Für diese seine Wirksamkeit sei ihm ein Wort herzlichen Dankes nachgerufen. Nicht vergessen dürfen auch die Verdienste werden, die er sich um den mustergültigen Druck des fünfbändigen Schlieschen Denkmälerwerkes und um die Herausgabe der Geschichte der Stadt Schwerin von W. Jesse erworben hat. Ein Bildnis Franckes ist diesem Jahresbericht beigefügt.
Ferner haben wir aus der Reihe der ältesten Mitglieder durch den Tod verloren den Kaufmann Berthold zur Nedden in Rostock nach 40jähriger Mitgliedschaft, den Oberkirchenratspräsidenten Gottfried Bierstedt nach 32jähriger und den Oberjägermeister Oberlandforstmeister a. D. Carl von Monroy in Schwerin nach 25jähriger Mitgliedschaft. 24 Jahre lang hatten zum Verein gehalten der Domprediger Carl Ditz in Güsstrow und der Pastor emer. Hermann Peek in Rostock, der noch in der letzten Zeit vor seinem Tode als rüstiger Achtziger der Kommission zur Herstellung einer textlich einwandfreien Ausgabe der Werke John Brinckmans angehörte. Zwanzig Jahre war Mitglied gewesen der Oberlandesgerichtspräsident a. D. Gustav Brückner in Rostock; durch seine Tätigkeit als Repräsentant, die er von 1912 bis zu seinem Wegzuge aus Schwerin im Jahre 1920 ausübte, hat er sich Anspruch auf unseren Dank erworben.
Zu den Vereinen, mit denen wir im Austauschverkehr stehen, sind hinzugekommen der Roland in Dresden, Verein zur


|
Seite 372 |




|
Förderung der Stamm-, Wappen- und Siegelkunde, der uns hinfort gegen unser Jahrbuch die Mitteilungen des Roland liefert, sodann die Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte der Oberlausitz, von der wir die Bautzener Geschichtshefte, und der Mindener Geschichtsverein, von dem wir die Mindener Heimatblätter eintauschen.
Vortragsabende wurden im verflossenen Winter sechs veranstaltet. Es sprach am 17. Oktober Univ.-Prof. Dr. Feine aus Rostock über Todesstrafen und Friedlosigkeit im germanischen Recht. Am 12. November folgte ein Vortrag des Pastors Bachmann aus Pampow, der sich die älteren mecklenburgischen Städteansichten zum Thema gewählt hatte und hier aus der Fülle seiner Kenntnisse über diesen Gegenstand schöpfen konnte, dem er seil Jahrzehnten sein Studium gewidmet hat; eine Auswahl von Originalbildern und Reproduktionen, die im Saale ausgehängt waren, gab einen guten Überblick über die wichtigsten Darstellungen 1 ). Durch das päpstliche Rom führte uns am 22. November Frau General v. Igel, wiederum, wie in ihrem 1920 über das antike Rom gehaltenen Vortrage, eine Fülle von Lichtbildern darbietend, die von einer ungewöhnlichen Kenntnis der römischen Bauten und einem feinen Verständnisse für die Reize des römischen Stadtbildes zeugten. Ein wichtiges Gebiet der norddeutschen Münzgeschichte behandelte am 10. Dezember Museumsassistent Dr. Jesse aus Hamburg. Seine Ausführungen galten dem Wendischen Münzverein und wurden durch Lichtbilder und durch Auslegung von Originalmünzen aus dem Besitze des Museums für hamburgische Geschichte veranschaulicht. Am 6. Februar sprach Univ.-Prof. Dr. Schüßler aus Rostock über die Epochen der mitteleuropäischen Geschichte in den letzten hundert Jahren. Den Beschluß machte ein Lichtbildervortrag des Museumsdirektors Dr. Peßler aus Hannover über Niedersachsens Volkstum und Volkskunst (24. März).
Zu dem auf der Hauptversammlung 1924 beschlossenen Ausfluge nach Lübeck, der am 12. Juli unternommen wurde, fanden sich etwa 70 Mitglieder und Gäste zusammen. Herr Gewerbelehrer Warncke in Lübeck hattte sich erboten, uns bei der Besichtigung der baugeschichtlichen und sonstigen künstlerischen Denkmäler der Hansestadt zu geleiten. Mit Dank sei hervorgehoben, daß seiner sachkundigen und unermüdlichen Führung das Gelingen des Ausfluges wesentlich zuzuschreiben ist.


|
Seite 373 |




|
Die 90. Hauptversammlung wurde am 3. April in Schwerin unter Leitung des Vereinspräsidenten abgehalten. Sie brachte einen Lichtbildervortrag des Univ.-Prof. Dr. Bruhns aus Rostock über deutsche Barockschlösser, der einen vortrefflichen Eindruck von der Entwicklung der deutschen Barockkunst vermittelte. Den Geschäftsbericht erstattete der Unterzeichnete, den Kassenbericht Rechnungsrat Sommer, dem Entlastung erteilt wurde (siehe Anlage B). Ein Antrag des ersten Vereinssekretärs, den Jahresbeitrag aus Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des Vereins wieder wie vor dem Kriege auf sechs Mark festzusetzen, wurde zum Beschlusse erhoben. Ferner stimmte die Versammlung seinem Vorschlage zu, am 9. Juli einen Ausflug nach Ratzeburg zu veranstalten. - Das Amt des Bücherwarts wurde dem Direktor der Schweriner Landesbibliothek Dr. Crain übertragen, der es provisorisch bereits seit dem Juli 1924 verwaltet hatte. Die übrigen Vereinsbeamten wurden wiedergewählt. - Einstimmige Annahme fand der Vorschlag des Vereinspräsidenten, den Generalmajor z. D. Julius v. Weltzien in Rostock, der am 8. Dezember 1924 auf eine Mitgliedschaft von nicht weniger als sechs Jahrzehnten hatte zurückblicken können und früher längere Zeit als Vereinsrepräsentant gewirkt hat, zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Ebenso wurde der Vorschlag angenommen, dem um die Erforschung der norddeutschen und besonders hansischen Geschichte hochverdienten Historiker Prof. Dr. Dietrich Schäfer in Berlin-Steglitz zur Feier seines achtzigsten Geburtstages am 16. Mai 1925 die Ehrenmitgliedschaft zu übertragen. Geheimrat Schäfer zählte bisher, seit mehr als vierzig Jahren, zu unseren korrespondierenden Mitgliedern.
Vereinsausschuß für das Jahr 1925/26.
Präsident: Staatsminister Dr. Langfeld, Exz.
Vizepräsident: Ministerialdirektor v. Prollius.
Erster Sekretär: Archivdirektor Dr. Stuhr.
Zweiter Sekretär: Archivar Dr. Strecker.
Rechnungsführer: Rechnungsrat Sommer.
Bücherwart: Bibliotheksdirektor Dr. Crain.
Bilderwart: Regierungsrat Dr. Wunderlich.
Repräsentanten: Ministerialdirektor Dr. Krause,
Generaldirektor Gütschow,
Geh. Archivrat Dr. Grotefend,
Generalleutnant v. Woyna, Exz.
Der zweite Vereinssekretär.
W. Strecker.


|
Seite 374 |




|
Anlage A.
Ehrenmitglieder.
Ernannt sind:
1. Generalmajor z. D. Julius v. Weltzien, Rostock, am
3. April 1925. Ord. Mitglied seit dem 8. Dez.
1864.
2. Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Dietrich
Schäfer, Berlin-Steglitz, am 3. April 1925. Korr.
Mitglied seit dem 2. Juli 1883.
Ordentliche Mitglieder.
Eingetreten sind:
1. Univ.-Prof. Dr. Feine, Rostock. 2. Das Rechtshistorische Seminar der Universität Rostock. 3. Hauptmann Griephan, Hamburg. 4. Kaufmann Laudan, Rostock. 5. Studienrat Dr. Galle, Schwerin. 6. Generaloberarzt Dr. Kamm, Schwerin. 7. Facharzt Dr. Behm, Schwerin. 8. Syndikus Kayser, Woltersdorf bei Berlin. 9. Studienrat Schröder, Schwerin. 10. Gerichtsassessor Dr. Wagner, Schwerin 11. Regierungsrat v. Ehrenkrook, Ludwigslust. 12. Oberfinanzinspektor Ahrens, Schwerin. 13. Seminarlehrer Buddenhagen, Warnemünde. 14. Pastor Voß, Cramon. 15. Kaufmann Vanheiden, Parchim. 16. Oberschulrat Dr. Weber, Schwerin. 17. Bankbeamter Brauer, Schwerin. 18. Geh. Postrat Sauer, Schwerin. 19. Amtsgerichtsrat Schlüter, Rostock. 20. Eisenbahninspektor Schepler, Waren. 21. Hof-Buchdruckereibesitzer Francke, Schwerin. 22. Hauptmann a. D. v. Kühlewein, Schwerin. 23. Frau Hofmarschall v. d. Lühe, Exz., Schwerin. 24. Buchhändler Herbst, Schwerin. 25. Rittmeister Ihlefeld, Ostorf. 26. Schulrat Scheele, Ratzeburg. 27. Dr. Max Weber, Syndikus der Handelskammer, Rostock. 28. Regierungsbaurat Oeding, Schwerin.
Ausgetreten sind:
1. Reg.- und Vermessungsrat Mau, Wismar. 2. Museumskonservator Dr. Reifferscheid, Schwerin. 3. Landforstmeister a. D. v. Blücher, Bad Doberan. 4. Frl. Plawneck, Hilfsarbeiterin am Landesmuseum, Schwerin. 5. Klosterküchenmeister a. D. Reckling, Wernigerode. 6. Geh. Kämmerer v. Blücher, Warnemünde. 7. Schriftsteller v. Müller, Berlin. 8. Studienrat Halm, Charlottenburg. 9. Kaufmann Haller, Schwerin. 10. cand. Glotzbach, Mainz. 11. Obersekretär a. D. Ritter, Schwerin. 12. Eisenbahn-


|
Seite 375 |




|
inspektor Schöning, Schweren. 13. Kommerzienrat Berger, Schwerin. 14. Obersekretärin Friederichs, Rostock. 15. Frl. Klett, Schwerin. 16. cand. rer. pol. Hävernick, Hamburg. 17. Kaufmann Kalderach, Gr. Flottbeck. 18. Rittergutsbesitzer Lüttmann, Wahrstorff. 19. Oberverwaltungssekretär Einfeldt, Röbel. 20. Oberzollsekretär Dettmann, Schwerin. 21. Facharzt Dr. Senn, Konstanz. 22. Studienassessor Dr. Overbeck, Schwerin. 23. Lehrer Schmidt, Poltnitz. 24. Rittmeister Petersen, Gneven. 25. J. Baer & Co., Buchhändler, Frankfurt a. M. 26. Studiendirektor Dr. Gerhardt, Rostock. 27. Obersekretär Kuhlmann, Schwerin. 28. Studienrat Bröker, Neustrelitz. 29. Regierungsbaurat Marstatt, Coblenz.
Gestorben sind:
1. Domprediger Ditz, Güstrow, am 3. Juli 1924. 2. Pastor emer. Peek, Rostock, am 2. Aug. 1924. 3. Generalleutnant a. D. v. Ditfurth, Exz., Schwerin, am 6. Nov. 1924. 4. Rektor Köhn, Schwerin, am 8. Dez. 1924. 5. Oberkirchenratspräsident Bierstedt, Schwerin, am 16. Dez. 1924. 6. Oberjägermeister, Oberlandforstmeister v. Monroy, Exz., Schwerin, am 24. Dez. 1924. 7. Geh. Kommerzienrat Francke, Schwerin, am 2. Jan. 1925. 8. Landgerichtsrat Regenbrecht, Hirschberg (Schlesien). 9. Admiral z D. v. Usedom, Exz., Schwerin, am 24. Febr. 1925. 10. Oberlandesgerichtspräsident a. D. Brückner, Rostock, am 1. März 1925. 11. Professor Wachenhusen, Bantin, am 2. Mai 1925. 12. Kaufmann zur Nedden, Rostock, am 15. Juni 1925.
Anlage B.
Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde
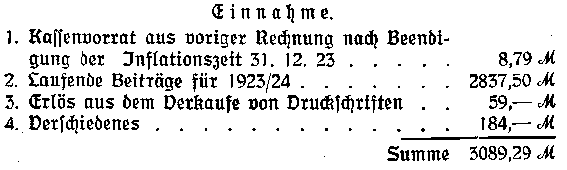


|
Seite 376 |




|
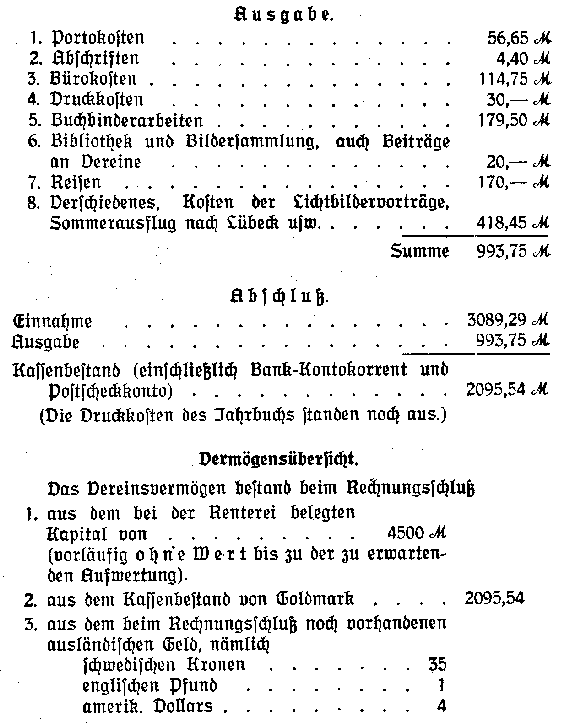
Der Rechnungsführer.
Sommer.