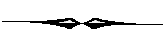|
Seite 86 |




|



|
|
:
|
II.
Die Schiffergesellschaft in Rostock.
Von
Professor Dr. Wilh. Stieda zu Rostock.
~~~~~~~~
D ie mittelalterliche Organisation des Handels in Rostock zeigt uns neben einander verschiedene Compagnieen von Kaufleuten, die sich je nach dem Hafen, nach dem sie hauptsächlich Handel trieben, zusammengefunden und benannt hatten. So hatte man die Gesellschaften der Rigafahrer, der Schonenfahrer, der Bergenfahrer, der Wykfahrer. Zwei von ihnen, die Compagnieen der Rigafahrer und der Wykfahrer, haben sich im Laufe der Jahre, unbekannt wann, aufgelöst und leider sind sehr geringe Spuren ihrer einst sicherlich außerordentlich bedeutsamen Wirksamkeit hinterlassen. Die beiden anderen Vereinigungen dagegen leben bis auf den heutigen Tag fort,. freilich unter einem anderen Namen und mit einander verschmolzen. Es ist die altehrwürdige Schiffergesellschaft, die, aus der Asche der beiden genannten Brüderschaften im Jahre 1566 erstehend, ein rühmliches Dasein bis auf die Gegenwart geführt hat und der hoffentlich noch eine recht lange Existenz beschieden sein wird.
Durch die Ungunst der Zeit geriethen die Compagnieen der Schonenfahrer und Bergenfahrer in Verfall. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigte sich der Hering nicht mehr in gewohnter Menge an den Küsten der Halbinsel Schonen und sein vermindertes Auftreten bedang einen Rückgang in der Zahl der Personen, die sich mit dem Einsalzen und dem Vertrieb des leckeren Fisches befaßten. In ähnlicher Weise muß zur gleichen Zeit auch der Fischfang und der Fischhandel vor Bergen nachgelassen haben, wenngleich dieser Proceß noch nicht durch die wissenschaftliche Forschung vollkommen klar gestellt ist. So kamen denn die beiden Genossenschaften auf


|
Seite 87 |




|
den Gedanken, sich zu einer Gesellschaft zu vereinigen. "Nach dem die gabe des herrenn" - heißt es in dem Entwurfe zu den neuen Statuten - "mit dem heringesfange inn Schonne vnnd anderwegen nun lange zeidt, Godt sei geclaget, nicht wol zugegangenn ist, das auch dardurch die algemeynne koffleute der Schonenfarer seindt abgestorbenn unnd zum teile sich anderwegenn zu segelenn vorgenomenn und also hirdurch ire gerechtigkeit in Schonnseittenn und anderwegenn, auch ir hauss bynnen Rostock, das Schonfarrergelach, unnd companey, der name beynhahe erloschet wer worden ...," schien es den noch vorhandenen Genossen am zweckmäßigsten, durch Zuführung neuen Bluts das alte Gelag wieder lebensfähiger zu machen. Schonenfahrer und Bergenfahrer, Schiffer und Kaufleute traten zu einem Verbande zusammen und sagten sich gegenseitig das Halten gewisser, in ihrer aller Interesse liegenden Bestimmungen zu, deren Genehmigung sie vom Rathe erbaten.
Die Physiognomie der Gesellschaft wurde nun eine andere. Hatten die früheren Compagnieen ihre Thätigkeit auf einen einzelnen Platz in der Ostsee oder Nordsee beschränkt, so ersah der neue Verband das Gesammtgebiet der Ost= und Nordsee zum Schauplatz seiner Thätigkeit aus. Aus einer ursprünglichen Compagnie von Kaufleuten, auf deren Rechnung die Schiffe für eine bestimmte Fahrt ausgerüstet zu werden pflegten und die nicht immer ihre Waaren in Person begleiteten, wurde ein Verband von Schiffern, die, meist Eigenthümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge, diese in den Dienst von Rhedern oder Kaufleuten stellten. Wie zahlreich letztere überhaupt je in der Gesellschaft vertreten waren, bleibt dahingestellt. Seit 1735, wo sie eine eigene Gesellschaft begründeten, erscheinen sie nicht mehr als Mitglieder und die Schiffer stehen im Vordergrunde der Interessen.
Zwei in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft befindliche Petschafte legen von der Verschmelzung Zeugniß. Das eine Siegel weist den kopflosen gekrönten Stockfisch, - das Symbol der Bergenfahrer, - drei Heringe, d. h. den Hinweis auf die Schonenfahrer, und in der Mitte zwei übers Kreuz gelegte Bootshaken, die Andeutung an die Schiffer, auf. Die Inschrift aber lautet: "Der Schiffer=Gesellschaft zu Rostock ihr Signet." In dem anderen, jedenfalls neueren Siegel ist die Erinnerung an die einstigen Bestandtheile, die den Grundstock zu der Verbindung gelegt haben, geschwunden, insofern ein stolzes Schiff an die Stelle der drei Zeichen getreten ist. Mag das dahin gedeutet werden, daß für den Verband nunmehr die Vertretung der Schifffahrtsinteressen allein maßgebend geworden war, so taucht dafür in der Inschrift: "Siegel des Schonenfahrer Gelags


|
Seite 88 |




|
zu Rostock" der Anklang an die den meisten wohl kaum mehr geläufige Entwickelung auf. Die Benennung "Schonenfahrergelag" hat unsere Gesellschaft in ihren verschiedenen Statuten dann beibehalten, während sie im gewöhnlichen Leben und officiell, ich weiß nicht seit wann, den Namen "Schiffergesellschaft" führt.
Das älteste Statut der Schiffergesellschaft, dessen Entwurf im Jahre 1566 dem Rathe zur Bestätigung unterbreitet wurde, enthält in der Hauptsache eine Regelung des geselligen Verhaltens der Mitglieder zu einander im Geschmacke der damaligen Zeit. Jährlich einmal wurden vier Aelterleute gewählt, die das Gelag nach außen vertraten und auf dessen Bestes im Allgemeinen zu wachen hatten. Die gleichfalls jährlich neu berufenen Schaffer waren dazu bestimmt, die gesellschaftliche Ordnung im Gelagshause selbst aufrecht zu erhalten, in dem man sich zu gemeinsamen Trünken zu versammeln pflegte. Kein Compagniebruder soll auf den anderen Groll hegen, alle sollen sich gegenseitig mit geziemenden Worten begegnen. Für gutes Getränk im Gelagshause ist jederzeit zu sorgen; die Beobachtung des Anstandes bei Vertheilung der Plätze, im Gespräche, beim Trunke versteht sich von selbst, wird aber doch ausdrücklich empfohlen und eingeschärft. In diesem Tone sind so ziemlich alle 28 Artikel abgesandt und nur wenige Bestimmungen verrathen, daß die Erwerbsinteressen nicht vergessen waren.
Dahin gehört vor allen Dingen der Beitrittszwang. Jeder, der nach Bergen, Schonen oder anderswohin von Rostock aus Schifffahrt treiben will, muß sich für eine gute Mark als Compagniebruder einschreiben lassen (Art. 4) 1 ), und keiner darf von Rostock aus ein Schiff frachten oder verfrachten, ehe er Mitglied der Compagnie geworden ist (Art. 24). Fremde Schiffer aber, die nicht in Rostock zu Hause sind, können überhaupt hier keine Fracht bekommen, so lange sich gute, taugliche, große oder kleine Rostocker Schiffe im Hafen befinden. Insbesondere aber war es auf die Warnemünder Fischer abgesehen. Sie sollten sich an ihrer Fischerei in Falster, Schonen und Gjedser genügen lassen und man verbot ihnen, sich mit Schifffahrt abzugeben, weil sie auf diese Weise "in der stadt burger und schiffer nerunge fallen." (Art. 27.) Namentlich aber sollte in Warnemünde kein Schiff gelöscht werden. Keiner war berechtigt, Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine, Schafe, Gänse, Hühner und Enten oder Fleisch, Hering, Lachs, Getreide "in suma nichtes ausgenomen" aus den Schiffen oder Schuten in Warnemünde an Land


|
Seite 89 |




|
zu bringen; vielmehr mußten alle Schiffe an die Rostocker Schiffsbrücken anlegen und erst am städtischen Strande ausladen (Art. 28). Der Grund für diese Maßregel war, "weil den anders nicht von oldinges her zu Wernemunde denn eynn fischerleger unnd fischerbudenn gestundenn" (Art. 27).
Aus Gründen, die sich unserer Kenntniß entziehen, erhielt der Entwurf erst am 26. September 1576 die Genehmigung des Raths. Wesentlich der Vorlage gleich, ist diese Ordnung doch etwas umfangreicher als jene ausgefallen, indem sie aus 41 Artikeln besteht. Sie ist geblieben, was der Entwurf war, eine "Ordnung", wie der Eingang besagt, "wo idt van olders unnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn copluden, der Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werden." Zu zwei Exemplaren im hiesigen Stadtarchiv erhalten, weichen diese doch von einander ab, insofern die Artikel 31, 38, 39, 40, 41 der einen Ausfertigung, die wir mit A. bezeichnen wollen, in der anderen, die wir mit B. benennen, fehlen. Dafür aber sind wieder in letzterer einige Bestimmungen enthalten, die der ersteren mangeln. Den Vermerk, daß das Statut vom Rathe genehmigt ist und publicirt wurde, trägt nur die Ausfertigung A., an die wir uns somit ausschließlich halten wollen.
Die Bestätigung des Raths, der redactionell allerdings verschiedene Aenderungen vornahm, brachte in das Statut der Gesellschaft doch keinen anderen Charakter. Es war eben darauf abgesehen, einen Sittencodex aufzustellen, der für den Verkehr der Genossen unter einander, für die Begegnungen beim Trunke oder Spiele die Richtschnur bilden sollte. Von einem Bestreben, die Erwerbsinteressen zur Geltung kommen zu lassen, zeigen sich eigentlich gar keine Spuren und bei den beiden einzigen Maßnahmen, die wirthschaftliche Bedeutung haben, ist mir fraglich, ob sie überhaupt je in Kraft gewesen sind. Denn einmal fehlen sie in der Ausfertigung B. und sind in der anderen ausgestrichen. Dahin sind zu rechnen die Bestimmungen, einmal daß alle Verträge über Frachten nur im Gelagshause abgeschlossen werden durften (Art. 39) und zweitens, daß überhaupt kein hiesiger Schiffer regelmäßig seinem Berufe nachgehen dürfe, ohne die Mitgliedschaft des Gelages erworben zu haben (Art. 41). Zu der ersteren hat eine andere Hand bemerkt: "der sich im Schonevarlage wil frachten laten, ist frey" was doch nur so viel heißen kann, daß Jeder sich frachten lassen kann, wo er will. Die andere aber ist einfach durchstrichen und an ihrer Stelle - sie war der Schlußpassus des Statuts - steht der Vorbehalt des Raths, das Statut beliebig jederzeit nach seinem Sinne zu ändern.


|
Seite 90 |




|
Ueber die Vorlage hinaus greift die Errichtung einer Hülfskasse. Bei einem so gefährlichen Berufe, wie der der Seeleute ist, der der Familie nur zu oft den Ernährer unvermuthet raubt oder ihn zu weiterer Ausübung der Thätigkeit unfähig macht, legt es nahe genug, in besseren Zeiten für schlechtere zu sammeln, von den Vermögenden Gaben zum Unterhalt Armer oder Kranker zu heischen. Zweifellos huldigten auch die Rostocker Schiffer diesem Gebrauche, den in den Entwurf ihres Statuts einzufügen sie freilich nicht für erforderlich erachtet hatten. Es war aber doch gut, daß die Einrichtung einen etwas formelleren Anstrich erhielt. Daher bestimmte man, daß alles Armengeld, das an Bord der Schiffe gesammelt wurde oder sonst einging, den Aelterleuten übermittelt würde, damit diese die Vertheilung an die armen Schiffer und die Hausarmen in die Hand nehmen könnten (Art. 31). Das ist der Anfang des später verzweigteren Kassenwesens, das durch die Auszahlung von Leichengeldern und die Unterstützung bedürftiger Schiffer bezw. deren Wittwen so vielen in bedrohter Lage befindlichen Personen zu helfen vermocht hat.
Sehr bemerkenswerth erscheint die Thatsache, daß die auf die Zurückdrängung der Warnemünder berechneten Maßregeln des Entwurfes in der Bestätigung fehlten. Der Punkt ist wichtig genug, um etwas ausführlicher bei ihm zu verweilen.
Bereits am 11. April 1567 klagten die Rostocker Schiffer beim Rathe über die Schifffahrt der Warnemünder, "datt se mit schuten und bothen der kopmans gud vorforden und ehn ehre narunge entogen." Wenn sie sich "der Segelation gebruken" wollten, so möchten sie in die Stadt ziehen und hier die gleichen Lasten wie sie tragen. Die Warnemünder erwiderten, daß sie arme Leute seien, die großen Schaden erlitten hätten und sich zu ernähren suchen müßten, so gut es ginge, beriefen sich auch darauf, daß ihre Väter schon Schifffahrt getrieben hätten. Der Rath, der die Richtigkeit der Warnemünder Aussagen einsehen mochte, kam mit dem Vermittelungsvorschlage heraus, daß die Warnemünder zu ihren Fahrten sich keiner größeren Fahrzeuge als solcher von 8 Lasten bedienen sollten, fand aber damit keinen Anklang. So blieb ihnen denn nichts anderes übrig, als den Warnemündern die Benutzung von Schuten und "vorbueden Boten" zu untersagen und sie auf die von kleineren Fahrzeugen ("böthe mit einem upgesetteden spoleborde") zu beschränken. Was sie in diesen an Kaufmannsgütern fassen könnten, sollte ihnen frei stehen zu verschiffen.
Wenn die Rostocker Schiffer mit dieser Entscheidung ganz zufrieden waren und sich dafür bedankten, so waren die Warnemünder natürlich keineswegs davon erbaut, lagen vielmehr der verbotenen


|
Seite 91 |




|
Seefahrt nach wie vor mit Erfolg ab. Daher sahen sich nach sieben Jahren 1 ) unsere Rostocker genöthigt, von Neuem beim Rathe vorstellig zu werden, jene Verordnung den Warnemündern besser einzuschärfen. Bitter beschwerten sie sich, daß "de nering und foding, de wy armen sehefaren lude hebben scholden, dat unss de van Warnemunde uth der nesen und under den handen genamen werth." Auch die Stadt leide darunter, denn seit die Warnemünder nicht mehr fischen wollten, gingen die Preise für Dorsche und andere Fische beträchtlich in die Höhe.
Es läßt sich heute nicht mehr feststellen, ob der Rath gegenüber dem Beginnen der Warnemünder machtlos war oder es im Interesse der Stadt für richtiger hielt, sie gewähren zu lassen. Für die Kaufleute war es natürlich bequemer, nicht ausschließlich auf die Rostocker Schiffer angewiesen zu sein. Je mehr Fahrzeuge zu ihrer Verfügung vorhanden waren, desto wohlfeiler werden wohl die Frachten gewesen sein. Die Mitglieder der Schiffergesellschaft, die damals zum Theil selbst noch Kaufleute waren, sprachen die Ansicht aus, daß der Rath die Warnemünder stärke und befördere, beruhigten sich aber dabei nicht, sondern ließen sich angelegen sein, den Rath zu ihren Gunsten umzustimmen.
Daher reichten sie einige Jahre später, nachdem ihre Beschwerden unberücksichtigt geblieben waren, eine neue Eingabe ein 2 ) die darauf hinauskam, daß die Warnemünder, solange sie Schiffer und Kaufleute sein wollten, nach Rostock ziehen möchten, damit sie die gleichen städtischen Kosten trügen. Warnemünde sei eben als Fischerlager gegründet worden. Dem gegenüber wiesen die Warnemünder darauf hin, daß die Fischerei in neuerer Zeit überall sehr zurückgegangen wäre. Man müsse weit hinausfahren "bis zum Darss uber die funff meilen" und brächte nur ungenügende Erträge heim. Durch ihre Thätigkeit als Schiffer litte die Kaufmannschaft in Rostock keineswegs. Sie führten Bier und andere gute Waaren nach Kopenhagen, Helsingör und Ellenbogen und brächten von dort Korn, Butter, Fleisch, Talg, Oel, Fett, Häute und "was sonst dabei furfallen mag" zurück. Sie seien es ja auch, die zu den Unterhaltskosten "der leuchten zu Warnemunde, so allen sehefarenden leuten zum besten angesteckett wird," Beiträge zahlen müßten, während die Rostocker Schiffer für diesen Zweck nichts zahlten. Daher hoffen sie, daß der Rath sie bei ihrer Schifffahrt schützen und für sie sorgen würde. Anders geriethen sie mit Weib und Kindern an den Bettelstab.


|
Seite 92 |




|
Mittlerweile trat am 31. December 1583 in den Verhandlungen der Stadt mit Herzog Ulrich das Collegium der Hundertmänner als Vertreter der Gemeinde ins Leben. 1 ) Ursprünglich nur ausersehen, im Namen der Gemeinde mit dem Rathe über die 20 Punkte zu verhandeln, die der Herzog Ulrich hatte vorschlagen lassen, wurde sie doch von vornherein zu einer ständigen Einrichtung. Fortan sollten die Hundertmänner bei den "hochwichtigsten Ratschlägen, daran der ganzen stadt gelegen." anwesend sein und was sie beschließen würden, erklärte der Rath sich gefallen lassen zu wollen. In einer besonderen Weise zusammengesetzt, nämlich so, daß der Rath drei Brauer, drei Kaufleute und vier Handwerker erwählte und diesen den Auftrag gab, je neun zu cooptiren, doch wohl in erster Linie aus ihren Berufsgenossen, schien das Collegium allen Ansprüchen auf eine geeignete Vertretung der verschiedenartigen Interessen vollkommen zu entsprechen.
Das neue Collegium faßte seine Aufgabe ernst und reichte bereits zwei Monate, nachdem es sich gebildet hatte, am 6. März 1584 dem Rathe eine Supplication ein, die gewisse abzustellende Mängel aufzählte. Unter ihnen war auch der Warnemünder Concurrenz gedacht. §.15 lautete: "Item tho gedencken der Warnemunder wegen des segellnss, datt se mogen dattsulve instellen, denn idt iss ein Fischleger und keine kopstadt; wer by de sehwart bliven wil, den schal idt frey sin in de stadt tho thende."
Indeß Vorschläge zur Besserung waren leichter gemacht als ausgeführt, und der Rath that zunächst keine Schritte, den Wünschen der Bürgerschaft entgegenzukommen. Die Hundertmänner warteten mehrere Monate, dann aber griffen sie zum Mittel der Steuerverweigerung, um den Rath willfähriger zu machen. Sie verweigerten am 12. Januar 1585 die Zulage so lange, bis die von ihnen gerügten Mängel abgestellt worden seien. So wurde denn der Rath gezwungen, zu den Reformen Stellung zu nehmen und that dies in Bezug auf den §.15 mit folgender Erklärung: "Der Warnemünder Segelation belangend, wolle man nach gelegenheitt dieser zeitt und deroselben umbstende, ob dieselbe gantz und gar fuglich abgeschaffet werden könne und ob solchs dieser stadt und gemeiner burgerschafft zutreglich sein würde, wol behertzigen und erwegen und daruff ihre gruntliche und einhellige erclerung nicht allein, sondern auch in specie die ursachen ihrer erclerung einem erbarn rahte einbringen, daruff sich dan gemelter raht weiter mit gebührlicher resolution vornehmen lassen wolle."


|
Seite 93 |




|
Hiermit erklärten sich die Hundertmänner einstweilen einverstanden und wünschten nur, daß die Fischerei in Warnemünde nicht völlig vernachlässigt werden sollte. Daher sollten bis zur Entscheidung die Warnemünder wenigstens angehalten werden, starke Knechte zu miethen, die für sie fischen könnten, wenn sie aussegeln würden. Außerdem verlangten sie, daß die Warnemünder die nach Rostock gebrachten Waaren hier sogleich verkaufen und die Unpflicht gleich anderen Bürgern tragen sollten.
Der Rath, der hierauf wahrscheinlich nicht eingehen wollte, legte sich nun auf das Vermitteln, aber ohne etwas zu erreichen. Die erbitterten Schiffer wandten sich vielmehr, der vergeblichen langjährigen Gesuche müde, bald darnach 1 ) direct an den Herzog Ulrich mit der Bitte, den Rath zur Durchführung des im Jahre 1567 ergangenen Entscheides zu veranlassen. Dieser entsprach fast unmittelbar dem Ansinnen der Petenten und erließ, kaum nachdem die Beschwerde der Schiffer in Güstrow eingetroffen gewesen sein kann, am 5. März ein Schreiben an den Rath des Inhalts, daß er in dieser Angelegenheit die Billigkeit nicht außer Acht lassen und die Supplicanten schützen möge und "ihr umb etzlicher wenig leute privatnutzes willen nicht gestattet, dass die supplicanten uber erhalten urtheil und recht beschwert werden mugen."
Es mochte schwer genug sein, zu entscheiden, was billig war. Wenn die Rostocker Schiffer eine unliebsame Concurrenz sich vom Halse halten wollen, so kann man es vom Standpunkte der damaligen Zeit, die Freiheit des Handels und der Schifffahrt nicht anerkennen wollte, sondern sich an wohl erworbene ausschließende Privilegien hielt, nicht verurtheilen. Aber man kann es ebensowenig den Warnemündern verargen, wenn sie weiterstrebten und, nachdem die Erwerbsquelle der Fischerei versiegte oder gar ganz versagte, sich der Schifffahrt zuwandten, bei der sich ein gut Stück Geld verdienen ließ. Der Fehler lag nur darin, daß man die Warnemünder nicht als voll ansah und sie nicht die gleichen Abgaben und Lasten tragen ließ, die den Rostocker Schiffern auferlegt waren. Dadurch erhielten sie einen wirthschaftlichen Vorsprung, der in jener Zeit, die einer etwas engherzigen und kleinbürgerlichen Politik gehuldigt zu haben scheint, besonders übel vermerkt wurde.
Zu einer Gleichstellung der Warnemünder mit den Rostockern kam es indeß nicht. Der Rath versuchte aufs Neue gütliche Vergleiche und konnte nicht umhin, da sie fehlschlugen, herzoglicher Weisung gemäß, ein früheres zu Gunsten der Rostocker Schiffer ergangenes


|
Seite 94 |




|
Urtheil vom 15. März 1585 zu bestätigen. Bei 50 Thalern Strafe wurden die beklagten Warnemünder angewiesen, in 14 Tagen ihre Schuten und Böte abzuschaffen.
Daß diese sich hierbei nicht beruhigen würden, war anzunehmen und richtig appellirten sie an das Hofgericht in Güstrow zur Erlangung besseren Rechts. Indeß von hier aus erging schon am 12. October des folgenden Jahres der Bescheid, daß "in voriger Instanz woll geurtheiltt und ubell davon appelliret und die sache zum vorigen richter zu remittiren sey." Die Warnemünder, vielleicht hierauf vorbereitet, wandten sich bereits acht Tage später an das Kaiserliche Kammergericht. 1 ) Aber hier hatte ihre Beschwerde das Schicksal mancher andern; sie gerieth langsam in Vergessenheit, und am 28. Juni 1593 konnte daher das Hofgericht in Güstrow verfügen, daß das in erster Instanz gesprochene Urtheil nunmehr in Kraft treten solle, da die Appellation an das Kammergericht vorlängst erloschen wäre. Doch die Warnemünder verstanden die Vollstreckung noch für längere Zeit hinauszuschieben. Es gelang ihnen auf Wegen, die sich unserer Kenntniß entziehen, nach nahezu 60 Jahren, am 23. Mai 1604, eine abermalige Versendung der Acten nach Speyer zu erwirken.
Was das Kammergericht erwiderte, ist leider nicht bekannt, da die von mir für vorstehende Darstellung benutzten Acten im Haupt=Archiv zu Schwerin an dieser Stelle aufhören. Aus einem Rostocker Rathsprotocoll aber vom 1. Februar 1606, dessen Kenntniß ich Herrn Dr. Koppmann verdanke, erhellt, daß die Warnemünder schließlich nachgegeben haben. Der betreffende Bürgermeister berichtet, daß die Warnemünder "liti renuntiirt" haben und in die Stadt ziehen wollen. Bis die Renuntiation formell vollzogen sei, sollen für die Schifffahrt genannte Bestimmungen, d. h. wohl die Verfügung von 1567, gelten.
So hatten denn die Rostocker Schiffer schließlich den Sieg davongetragen und war die Lösung glücklich gefunden worden, die als die natürlichste erscheinen mußte. Ob die Rostocker wirklichen Vortheil davon zogen, ist eine andere Frage. Es läßt sich eher vermuthen, daß sie nicht viel Freude daran gehabt, denn das 17. Jahrhundert war mit seinem großen Kriege Handel und Gewerbe wenig geneigt. Wenn auch leider über diese Zeit nur spärliche Nachrichten vorliegen und die in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft noch vorhandenen Acten das Dunkel fast gar nicht zu lichten vermögen, so wird es doch kaum bestritten werden können, daß es im Allgemeinen der Schifffahrt in Rostock nicht zum Besten ging.


|
Seite 95 |




|
Bei dem großen Brande, der im Jahre 1677 Rostock heimsuchte, scheinen auch die Papiere der Schiffergesellschaft in Unordnung gerathen zu sein. Jedenfalls wurden ihre Statuten, vielleicht schon früher etwas vernachlässigt, seit dieser Zeit nicht mehr gehörig anerkannt, und so kamen am 7. Februar 1714 die Gelagsbrüder zusammen, um sich auf eine neue Redaction ihrer "sehr alten leges" zu vereinigen. Anfangs scheinen sie nicht die Absicht gehabt zu haben, sich die Genehmigung dieser Statuten vom Rathe zu erbitten, und es dauerte nahezu ein volles Jahr, bis sie sich zu diesem Schritte entschlossen. 1 ) Anlaß, den Rath um seine Unterstützung anzugehen, war in mehrfacher Beziehung gegeben.
Abweichend von dem bisherigen Gebrauch, hatte ein Rostocker Kaufmann, Chr. Rudolf Stolte, einen fremden Schiffer zu einer Fahrt nach Stockholm gedungen, wogegen die Schiffergeseltschaft Einsprache erhob. Der Handel, der schon im 17. Jahrhundert ins Stocken gerathen war, wollte sich zu Anfang des 18. durchaus nicht bessern. Allgemein klagten die Schiffer über die "nahrlose Zeit" und schon einige Jahre vorher - am 17. März 1710 - hatte das Gelag sich über den Wettbewerb kleinerer Holsteinscher Schiffer beschwert, die für "gar geringen Preis" Korn auszuschiffen bereit waren. Um so empfindlicher mußte es ihnen jetzt sein, sich in der Führung größerer Fahrzeuge bedroht zu sehen.
Ferner hatte der Artikel 40 der älteren Statuten von 1576 vorgesehen, daß bei Streitigkeiten der Schiffer mit ihren Leuten und der Kaufleute mit den Schiffern zunächst die Aeltesten der Gesellschaft um ihre Vermittelung ersucht werden sollten und erst, wenn diese versagte, die Streitenden an die ordentliche Obrigkeit zu gehen befugt waren. Aber den Kaufleuten gefiel dieser Modus, sich zunächst an die Schiffer wenden zu müssen, auf die Dauer nicht, und sie hielten sich von vornherein an die ordentlichen Gerichte. Die Schiffer dagegen, die sich bei der Schiffergesellschaft in Lübeck erkundigt hatten, wie es dort gehalten werde, 2 ) legten Gewicht darauf, daß die alte Bestimmung in Kraft blieb.
Endlich lag den Schiffern am Herzen, die dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer gesetzlich gleichmäßig festgesetzt zu sehen.
Diese drei Gründe hauptsächlich werden die Schiffer veranlaßt haben, den Rath um die Bestätigung der neu aufgesetzten Artikel


|
Seite 96 |




|
anzugehen, an die sich "die Vorfahren in letzter Zeit wenig gekehret hätten."
Es hat den Anschein, als ob der Rath sowohl auf die Bitte überhaupt als auch auf die Regelung der drei angezogenen Punkte in dem von den Schiffern gewünschten Sinne einzugehen geneigt war. Speciell mit der Art, wie die Beilegung von Streitigkeiten vorgesehen wurde, erklärte er sich grundsätzlich vollkommen einverstanden. Er hielt es sogar für heilsam und nützlich, in dieser Weise vorzugehen, damit "hernach bey unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich daselbst melden, man so viel besser und promter aus der Sache kommen könne." Man erkannte eben die Aeltesten einer Schiffergesellschaft gerne als diejenigen Sachverständigen an, die sich in Seeangelegenheiten zurechtzufinden wissen würden.
Bei alledem bleibt es fraglich, ob die Bestätigung wirklich stattgefunden hat. Eine formelle Ausfertigung hat mir nicht vorgelegen. Nur ein Brouillon der Statuten, das den Genehmigungs=Vermerk des Raths von Schreiberhand aufweist, in der bekannten Form, daß gelegentliche Aenderungen vorbehalten werden, hat sich finden lassen. Aber dieses Exemplar ist ohne Datum, und ich glaube daher, daß eine wirkliche Anerkennung der Statuten aus irgend welchen Gründen unterblieben ist.
In dieser Auffassung werde ich bestärkt durch die auf uns gekommene Erzählung von einer Differenz des Großhändlers Herrn Johann Allwardt mit einem Schiffer Hans Töpcken, der ersteren im Jahre 1750 vor das Gelag forderte. Als der Kaufmann sich weigerte, der Ladung Folge zu leisten, erkannte der Rath, daß die Angelegenheit "in loco Judicii tanquam ordinario foro" ausgemacht werde. Gewiß hätte er nicht so entschieden, wenn die Vorlage von 1715 in der That gesetzliche Sanction erhalten hätte. Ihrerseits rühmten sich die Schonenfahrer bei Gelegenheit einer andern Streitsache wegen eines angeblich zu hohen Eintrittsgeldes, 1 ) daß sie seit unvordenklichen Zeiten Statuten und Ordnungen gehabt und gemacht hätten, ohne daß sie confirmiret wären oder deren Confirmation auch nur erheischet wurde.
Die unbestätigten Statuten von 1714 oder 1715 haben den gleichen Charakter wie die älteren. Sie bieten im Wesentlichen Vorschriften über die bei den Verhandlungen im Gelagshause und beim Verkehr der Mitglieder unter einander zu beobachtende Ordnung. Die von den Einzelnen zu leistenden Beiträge, die Aufgaben des Vorstandes im Hinblick auf das Gebäude und das darin befindliche


|
Seite 97 |




|
bewegliche Inventar, endlich die Leichenfolge, d. h. wer Recht und Anspruch darauf hat, von den Genossen zu Grabe getragen zu werden, wie das Gefolge zusammengesetzt und gekleidet sein soll - dies und Aehnliches ist Gegenstand ausführlicher Darlegung.
Tiefer geht der 16. Artikel, der von den sog. Vorsetzschiffern handelt. Als solche pflegte man diejenigen Seeleute zu bezeichnen, die im Auftrage eines anderen Schiffers, falls dieser krank ober sonst verhindert war, die Fahrt für ihn machten. Jener Artikel verlangte von Jedem, der Vorsetzschiffer benutze, daß er das Gelag gewonnen habe. Ich kann mir diese Bestimmung nicht anders erklären, als daß es mit ihr darauf abgesehen war, die Dienstleistung fremder Schiffer unmöglich zu machen. Kein Rheder oder Kaufmann konnte bei dieser Anordnung einen Schiffer in seine Dienste nehmen, der nicht Mitglied des Gelags war. Für Rostocker Schiffer verstand sich ja der Eintritt in die Genossenschaft von selbst, zu Vorsetzschiffern aber mochten mehrfach Fremde gewählt worden sein, die seither an die Mitgliedschaft nicht gebunden waren, falls sie auf Rostocker Schiffen in See gehen wollten.
Wirthschaftliche Gesichtspunkte kommen darin zum Vorschein, daß die Seeleute verpflichtet waren, alle außerhalb Landes erfahrenen Thatsachen, deren Kenntniß das Gelag fordern konnte, dem Vorstande mitzutheilen (Art. 25), sowie in dem Versuch, die Matrosenheuer nach den verschiedenen Plätzen gleichmäßig anzusetzen, damit kein Schiffer mehr als der andere bezahlte.
Noch einmal hat die Verfassung der Schiffergesellschaft einen Neuguß, keine eigentliche Aenderung erfahren - am 10. Januar 1825. Von diesen Statuten wissen wir sicher, daß sie nicht bestätigt sind. Denn §. 20 besagt ausdrücklich: Es sollen diese Statuten noch nicht bey E. E. Rathe zur Confirmation eingereicht werden, weil die Gesellschaft zuvor durch die Erfahrung davon sich überzeugen will, dass selbige zweckmässig und vollständig sind, folglich keiner Abänderung bedürfen.
Dann aber hat die Frage vor Kurzem ihre Erledigung dahin gefunden, daß am 3. August 1891 die Schiffergesellschaft ihre "Revidirten Statuten" vom Rathe hat bestätigen lassen. Diese jetzt die Grundlagen der Verfassung bildenden Bestimmungen sind wesentlich kürzer gehalten als das Statut von 1825. Da sie in einer besonderen Ausgabe veröffentlicht sind, nehme ich davon Abstand, sie unter den Beilagen mitzutheilen.
Das Bild, wie wir es nun von der Organisation der Seefahrenden Bevölkerung Rostocks auf Grundlage dieser Statuten von 1567 bis 1825 erhalten, ist in seinen Hauptzügen folgendes:


|
Seite 98 |




|
Alle selbständigen Schiffer Rostocks, die ein Schiff zu führen im Stande waren, gehörten dem Schonenfahrer=Gelag an, dessen Mitgliedschaft durch ein zu zahlendes Eintrittsgeld ohne weitere Förmlichkeiten zu erlangen war. Erhalten wurde die Mitgliedschaft durch regelmaßige Beiträge, die in der Form des sog. Lastengeldes, d. h. nach Maßgabe der Größe des Schiffes, in Lasten gemessen, von jeder ausgeführten Reise zu entrichten war. Seit 1716 war der Beitrag auf einen Schilling für die Last der Ladung angesetzt und wurde vom Schiffer dem Rheder in Rechnung gestellt.
An die Stadt entrichteten die Schiffer gleichfalls ein Lastengeld, das sie nach einem Eide von 1616 sogar völlig uncontrolirt in den dafür bestimmten Kasten zu legen hatten. 1 ) Sie übernahmen dabei die Verpflichtung, die sie durch den Schwur bekräftigten, kein fremdes Gut als Rostocker Waare zu veräußern, insbesondere kein an fremdem Orte eingeladenes Bier für Rostocker Bier auszugeben ober fremde Tonnen mit Rostocker Bier zu füllen.
Durch die Mitgliedschaft erwarben die Gelagsbrüder das Recht, im Gelagshause, wo einer der älteren Schiffer eine Schankwirthschaft führte, zu verkehren und an den am Fastnachtstage oder sonst daselbst zu veranstaltenden Festlichkeiten sich zu betheiligen. Die hierbei erwachsenden Unkosten wurden durch Vertheilung unter die Anwesenden gedeckt. Außerdem hatten sie Anspruch darauf, gemeinsam von allen Genossen, Männern und Frauen, zur letzten Ruhe bestattet zu werden; aus einer Kasse wurde den Hinterbliebenen für die Beerdigung eine gewisse Summe ausgeworfen. Die Statuten dieser bereits im vorigen Jahrhundert bestehenden Todtenlade wurden am 1. December 1821 obrigkeitlich bestätigt. Wann die Wittwenkasse und die Unterstützungskasse für nicht erwerbsfähige, mittellose Mitglieder dazu kamen, läßt sich beim Mangel an Nachrichten nicht feststellen. Die Anfänge dieser Kassen sind in das 16. Jahrhundert zurückzuverlegen und 1825 bestanden sie alle drei in der vollständigen Ausbildung, wie sie noch gegenwärtig functioniren.
Der Verkehr im Gelag hatte die Bedeutung, daß hier gewissermaßen die Börse für den Abschluß von Frachtverträgen war. Ein Rheder, der einen Schiffer brauchte, war sicher, dort Erkundigungen über die zur Zeit verfügbaren Persönlichkeiten einziehen zu können.
Die Gesellschaft besaß ein eigenes Haus, dessen schon im 15. Jahrhundert Erwähnung geschieht und das in der heutigen großen Bäckerstraße belegen war. Neben ihm befand sich der Schütting der Haken, den die Schiffergesellschaft am 27. April 1700 käuflich erwarb und


|
Seite 99 |




|
mit ihrem bisherigen Besitze vereinigte. Bei irgend einer Gelegenheit ist dann wohl durch einen größeren Ausbau dasjenige Gebäude geschaffen worden, das heute noch steht und in dem gegenwärtig die Wirthschaft zum Franziskaner betrieben wird. Im Jahre 1855 wurde dieses Haus verkauft, und damals war die Erinnerung noch rege, daß es sich ursprünglich um zwei Gebäude gehandelt hat, da von den "Gelaghäusern" die Rede ist. Das Gelag entschloß sich, sein Haus zu verkaufen, um die Wittwenkasse, mit deren Mitteln es spärlich bestellt war, mit einem größeren Fonds auszustatten. Den 45 Wittwen, die damals existirten, konnten jährlich nur je 5 Thaler verabfolgt werden.
Die Regelung der gemeinsamen Erwerbsinteressen beschränkte sich auf wenige Punkte. Man suchte sich die auswärtige Concurrenz vom Halse zu halten und ließ nur Mitglieder der Genossenschaft zur Ausübung der Schifffahrt zu. Fremden und denjenigen Schiffern, die nicht aus hiesigen Schifferfamilien hervorgegangen waren, forderte man das doppelte Eintrittsgeld ab. Im Laufe der Jahre, vermuthlich in dem Maße, als der Verdienst nachließ, wollte man auch die Vorsetzschiffer veranlassen, die Mitgliedschaft zu erwerben. Der hierauf im Statut von 1714 bezügliche Artikel scheint nicht genügend berücksichtigt worden zu sein. Daher beschloß man im Jahre 1767, daß den kranken Gelagsbrüdern und den Wittwen nur zweimal gestattet sein sollte, andere nicht zum Gelag gehörende Schiffer für sich fahren zu lassen. Vor der dritten Reise, die ein solcher Setzschiffer machen wollte, mußte er Mitglied des Verbandes geworden sein. Diese Beliebung aber erregte solche Verstimmung, daß der Rath sich veranlaßt sah, den Beweggründen, welche die Schiffer zu diesem Beschlusse gebracht hatten, nachzugehen. Indeß ergab das mit mehreren Deputirten des Gelags zwei Mal abgehaltene Verhör kein positives Ergebniß, und man scheint die Angelegenheit schließlich haben auf sich beruhen zu lassen.
Die Seefahrt erstreckte sich regelmäßig und vorzugsweise nach allen Plätzen der Ost= und Nordsee. Die für die einzelne Reise dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer war je nach der Entfernung verschieden. Im Uebrigen aber hatten die Schiffer vereinbart, daß Keiner mehr als der andere zahlte. So wurde für eine Fahrt nach Stockholm oder Kurland 6 bis 7, nach Riga 7 bis 8, nach Holland 10, nach Lübeck 3 bis 4, nach der holsteinschen Küste 4 bis 5 Thaler bewilligt. 1 ) Wie es auf den nach Frankreich, England oder ins Mittelmeer segelnden Schiffen gehalten wurde, melden die Statuten nicht


|
Seite 100 |




|
und hat es daher den Anschein, daß diese Fahrten nur ausnahmsweise vorzukommen pflegten.
Die Gesellschaft wurde verwaltet durch einen Vorstand, der aus vier Aeltesten und ebensoviel Deputirten gebildet wurde. Der Zusammensetzung des Gelages aus verschiedenen Elementen entsprechend, mußten zwei Aelteste dem Kaufmannsstande, zwei dem Schifferstande entstammen. Als später die Kaufleute nicht mehr Mitglieder waren, wurde es üblich, die zwei kaufmännischen Aeltesten aus der Kaufmanns=Compagnie zu nehmen, und zwar unter denen die Auswahl zu treffen, die gleichzeitig Großbrauer waren. Ihre Wahl mußte vom Rathe bestätigt werden, der unter drei ihm vorgestellten Candidaten einen zu ernennen hatte.
Ein Verzeichniß der Aelterleute läßt sich für die ältere Zeit nicht mehr aufstellen. Nur einige Namen stoßen gelegentlich auf der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert auf, ohne daß wir angeben können, wie lange die Amtsdauer war, beziehungsweise welcher der beiden Kategorien der Aelteste entstammte. Dahin gehören:
Hinrick Paschen, gestorben 1699;
Hans Dettloff, 1699-?
Jacob Wögener, gestorben 1699;
Arent Petersen;
Clauß Tönings, gestorben 1702;
Hinrich; Degener, 1702-?
Peter Nemtzow, 1699-?
Hinrich Dose, gestorben 1713;
Hinrich Mantzel, 1705-12;
Hinrich Pegelau, 1712-?
Hans Stüdemann, 1718-?
Jacob Fredelandt, 1705-?
Jochim Davietzen, 1705-?
Seit 1714 haben wir zuverlässige Nachrichten, aus denen sich folgende Namen ergeben:
Aelteste der Schiffer waren:
Jacob Frädtlandt, 1714-1723;
Johann Davids, 1714-1717;
Hans Stüdemann, 1723-1742;
Carsten Frädlandt, 1724-1736;
Joachim Grundt, 1736-1742;
Peter Krepplin, 1742-1752;
Martin Töppe, 1742-1754;
Andreas Block, 1752-1756;


|
Seite 101 |




|
Joachim Jenßen, 1754-1770;
Peter Mauer sen., 1757-1780;
Andreas Bähr, 1770-1776;
Joachim Brinckmann, 1776-1793;
Ibe Rohde, 1781-1795;
Hans Stüdemann, 1793-1806;
Joh. Gustav Jenßen, 1795-1808;
Peter Gerdeß, 1807-1813 1 )
Heinrich Frädlandt, 1813-1823;
Martin Hinrich Töppe, 1815-1817;
Friedr. Bernhard Jenßen, 1817-51; 2 )
Jacob Maack, 1823-1837;
Joh. Heinr. Maack, 1837-1853;
Fritz Gottlieb Rentz, 1851--1860;
H. J. F. Bercke, 1853-1857; 3 )
Hans Heinr. Frädland, 1857-?
Heinrich Alwardt, 1860-?
Wilh. Ahrens, 1889-?
Aelteste von Seiten der Kaufleute waren:
Hinrich Pegelau, 1714-1725;
Hans Goltermann, 1713-1717; 4 )
Jacob Ernst Stever, 1717-1722;
John Wilh. Schulz, 1722-1755;
Johann Bauer, 1726-1731; 5 )
Heinrich Goldstädt, 1731-1745; 6 )
Diedrich Harms, 1746-1752;
Joh. Dietrich Dörcks, 1752-1765;
Johann Hinrich Tarnow, 1755-1772;
Carl Friedrich Bauer, 1765-1793;
Johann Danckwarth, 1772-1777; 7 )
Cord Hinrich Stubbe, 1777-1785; 8 )
David Hävernick, 1785-1811;
Jochim Siegmund Mann, 1793-?
Joh. Gottlieb Neuendorff, 1799-1805;


|
Seite 102 |




|
J. C. Janentzky, 1805-1819;
Johann Bauer, 1811-1836;
Chr. Fr. Koch, 1819-1854;
J. C. Heydtmann, 1837-1842;
Ernst Pätow, 1842-1855; 1 )
Ludwig Capobus, 1854-1857; 2 )
N. H. G. Witte, 1855-?;
Eduard Burchard, 1857-1860; 3 )
C. Ahrens, 1860-1889.
Die Aeltesten hatten die Aufsicht über die Ausführung und Beobachtung der Statuten, die es darauf absahen, einen angemessenen kameradschaftlichen Ton unter den Mitgliedern einzubürgern und aufrecht zu erhalten. Sie bildeten bei Streitigkeiten der Genossen unter einander die Spruchbehörde erster Instanz, und nur, wenn sich eine Einigung nicht erzielen ließ, konnte das ordentliche Gericht angerufen werden. Es war der Wunsch der Schiffer, sie auch bei Zerwürfnissen mit den Kaufleuten in gleicher Vertrauensstellung wirken zu sehen, der indeß, wenn überhaupt, nicht auf die Dauer Verwirklichung fand.
Die Aeltesten galten im Allgemeinen als Respectspersonen, denen unbedingt Gehorsam zu leisten war. Bei den festlichen Zusammenkünften hatten sie Anspruch auf besondere Ehrenplätze. Nicht immer mag gegenüber den etwas eigenwilligen Seeleuten, die ihren eigenen Kurs zu segeln vorzogen, ihre Stellung eine ganz leichte gewesen sein. Es hat sich z. B. Kunde von einer Beschwerde der Aeltesten beim Rathe aus dem Jahre 1699 erhalten, in der sie bitten, die Gelagsbrüder anweisen zu wollen, künftig sich bescheidentlicher gegen sie zu verhalten.
Weniger wichtig waren die Aemter der Deputirten und der Schaffer oder Schenken, wie sie im 16. Jahrhundert genannt werden. 4 ) Die Aufgabe der ersteren ist nicht recht durchsichtig. Sie dienten im Wesentlichen dazu, den Vorstand zu erweitern, wenn es sich um Ahndung der Verstöße gegen die Statuten oder um Einigungsversuche in ernsteren Fällen handelte. Sie waren es auch, die zusammen mit den Aeltesten die Schaffer wählten, deren Thätigkeit die von Festordnern bei den Zusammenkünften war. Die Schaffer sollen - heißt es in dem Statut von 1714 5 ) - bey solcher Zusammenkunft im


|
Seite 103 |




|
Fastlabend Fleisch, Brodt, Bier und andere nothdürftige einschaffen und dahin sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch gesetzet werde und überall kein Mangel sein möge. Außerdem hatten sie die Sorge für die Instandhaltung des Hauses und des Inventars. Die Wahl zum Schaffer konnte nur aus triftigen Gründen abgelehnt werden; jedenfalls aber mußte der Gewählte sich loskaufen, im 16. Jahrhundert mit einer halben Last Bier, 1 ) später durch Erlegung einer gewissen Geldsumme, 2 ) deren Betrag zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 14 Fl. 10 Sch. zu sein pflegte. Strenge wurde geahndet, wenn hiergegen sich Jemand auflehnen wollte. Ein Protocoll hat uns den Namen eines derartigen Renitenten aufbewahrt. Es lautet in klassischer Kürze: "Anno 1713, den 21. Februar, ist Jacob Priess zum Schaffer gewält und auffgeruffen worden. Alss er hat dass gehört, ist er weckgegangen und ist nicht wiederkommen. Darauff ist ihm sein Nahm aussgethan worden und soll nicht mehr hinführo vor Gelachsbruder angenommen werden."
Selbstverständlich ging es bei diesen Zusammenkünften mit größter Feierlichkeit her. Gravitätisch zog man auf und setzte sich in steifer Ordnung zu Tisch an die angewiesenen Plätze. An das Mahl, bei dem Wein in karger Ration, Bier nach Belieben die Zunge lösten, schlossen sich Kaffee und Thee für die mittlerweile sich einstellende Frauenwelt - nur Hausfrauen und Bräute der Schiffer durften erscheinen -, und gemeinsam wurde nun bis in die sinkende Nacht oder gar bis an den grauenden Morgen ein Tänzchen gemacht. Ich kann mich nicht enthalten, die behagliche Schilderung eines solchen Festes durch einen Theilnehmer aus dem Jahre 1780, die sich glücklich erhalten hat, hier einzuschalten.
Es war das Ehrsame Gelag am 20ten Januar 1780 versamlet, um wegen des Schaffens zu stimmen, und es ward mit 18 Stimmen gegen 16 Stimmen beschlossen, daß man öffentlich am Mittag und warm Essen schaffen wolle.
Auf die Anfrage was das Gelag zu legen ged
 chte, wurden 5 Propositiones,
nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.
und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;
da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1
Rthlr. und 16 Stimmen
chte, wurden 5 Propositiones,
nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.
und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;
da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1
Rthlr. und 16 Stimmen


|
Seite 104 |




|
auf 1 Rthlr. 16 Sch. kamen. Mithin der Zutrag von
Rthlr. 1 : 16 Sch. bestimmt w
 rde.
rde.
Der 10. Februar an, der erste Donnerstag in der
ersten Fastnachtswoche w
 rde hiezu anberahmet, und die
Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen
Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage
vorgenommen wird, wegen des Aufr
rde hiezu anberahmet, und die
Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen
Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage
vorgenommen wird, wegen des Aufr
 umens und Reinigung des Hauses,
und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag
Montage eintrat, bis zum n
umens und Reinigung des Hauses,
und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag
Montage eintrat, bis zum n
 chsten Dinstag den 15. Febr.
verschoben und festgesetzet.
chsten Dinstag den 15. Febr.
verschoben und festgesetzet.
Dem gelag w
 rde dieses bekant gemacht und
ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere
Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender
Woche einfordern w
rde dieses bekant gemacht und
ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere
Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender
Woche einfordern w
 rden, nicht s
rden, nicht s
 umig zu seyn. Diese Schaffere
forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den
Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von
welchem Zutrag keiner weder Ausw
umig zu seyn. Diese Schaffere
forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den
Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von
welchem Zutrag keiner weder Ausw
 rtiger als Krancken als blos die
Herren Aeltesten und der Secretarius frey.
rtiger als Krancken als blos die
Herren Aeltesten und der Secretarius frey.
Am 8. und 9. Februar invitirten gedachte
Schaffere die Geselschafft in Kleidung ohne
M
 ntels um den 10ten Februar halb 11
Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und
da das Gelag beschlossen auch die drey Herren
des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu
bitten, so würden auch der Herr Senator D
ntels um den 10ten Februar halb 11
Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und
da das Gelag beschlossen auch die drey Herren
des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu
bitten, so würden auch der Herr Senator D
 rcks als Pr
rcks als Pr
 ses, der Herr Senator Hille als
Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am
8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer
invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am
10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g
ses, der Herr Senator Hille als
Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am
8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer
invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am
10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g
 nnen, wozu ihnen, diesen drey
Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.
nnen, wozu ihnen, diesen drey
Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.
Die Musicanten der Stadt w
 rden von denen Schaffern auch
pr
rden von denen Schaffern auch
pr
 cise ümb halb 11 Uhr zum
Empfangblasen beordert, welche f
cise ümb halb 11 Uhr zum
Empfangblasen beordert, welche f
 r dieses Blasen und der
Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,
sondern stat dieser Bezahlung wird w
r dieses Blasen und der
Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,
sondern stat dieser Bezahlung wird w
 render Mahlzeit zwey Mahl ein
T
render Mahlzeit zwey Mahl ein
T
 ller zur Samlung f
ller zur Samlung f
 r sie bey allen Tischen umgetragen.
r sie bey allen Tischen umgetragen.
Am 10ten Februar
 m halb 11 Uhr war die Einkunfft
auf dem Gelag, und
m halb 11 Uhr war die Einkunfft
auf dem Gelag, und
 m ein Viertel auf 12 Uhr w
m ein Viertel auf 12 Uhr w
 rde der Anfang mit der Dancksagung
f
rde der Anfang mit der Dancksagung
f
 r das Erscheinen gemacht, darauf
die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen
Deputirten bey der Todtenlade und der neuen
Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage
bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am
Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit
dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.
r das Erscheinen gemacht, darauf
die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen
Deputirten bey der Todtenlade und der neuen
Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage
bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am
Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit
dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.
Die Tische waren gedecket, und zwar der Regiments Tisch unten in der Stube war auf Bitten der Schaffere von dem Mit=


|
Seite 105 |




|
Aeltesten
Herrn Brinckmann durch seiner Frauen
Veranstaltung gedecket, obgleich sonsten von den
Schaffern solches nach alten Gebraucht besorget
werden muß. Er war auf 24 Persohnen
eingerichtet, es saßen aber nur 19 Persohnen
daran, als die 3 Herren des Gericht, die 4
Herren Aeltesten, der Secretarius, die 4
Gelags=Deputirten, 2 Deputirten der Todtenlade
(NB. es waren nur 2, sonsten sind 4), die 2
neuen Schaffer (NB. die beyden alten Schaffers
besorgen die Aufwartung und Anstalten), Schiffer
Frantz Ruht, Schiffer Johan Jenssen und Schiffer
Hans Bey, zusammen 19 Persohn. Es w
 rden noch mehr altere Schiffer
soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam
keiner herein.
rden noch mehr altere Schiffer
soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam
keiner herein.
Nun saßen die Schiffere nach ihrer Ordnung im
Gelage und zwar die Aeltere im Aeltesten Gelage,
darnechst an den langen Tischen, und die J
 ngeren soweit die langen Tischen
nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster
nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.
ngeren soweit die langen Tischen
nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster
nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.
Die Musicanten hatten einen besondern Tisch auf
der Diele, worauf dieselben bewirthet wurden.
Gleich nach 12 Uhr kamen die Herren des Gerichts
gefahren, und wie solche beysammen, die Suppe
aufgetragen, darauf mit der Glocke das Zeichen
zum Gebet gegeben, welches stille verrichtet
w
 rde.
rde.
Der Regiments=Tisch ward bedienet mit Perlgraupen
im Wein, darnach Schincken mit langen Kohl,
ger
 uchert Fleisch, Ochsenzunge und
Mettw
uchert Fleisch, Ochsenzunge und
Mettw
 rste, alles gekocht, darauf Fisch,
zuletzt einen Wildbraten und einen K
rste, alles gekocht, darauf Fisch,
zuletzt einen Wildbraten und einen K
 lberbraten, dabey Gurcken,
Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war
Herrenbrodt und K
lberbraten, dabey Gurcken,
Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war
Herrenbrodt und K
 mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch
Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother
nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.
mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch
Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother
nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.
Die Tische in der Geselschaft waren ebenso
servirt, nur kein Wildbraten, daran aber weil
Vorrath, von den Regiments=Tische ein guter
T
 ller voll nach dem Aeltesten
Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath
geblieben, von dort in der Gesellschaft
gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß
ller voll nach dem Aeltesten
Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath
geblieben, von dort in der Gesellschaft
gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß
 der der Mahlzeit je 2 und 2 eine
Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da
hiezu das Rostocker Bier angeschafft.
der der Mahlzeit je 2 und 2 eine
Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da
hiezu das Rostocker Bier angeschafft.
W
 rend der Mahlzeit wurde der
obbenandter T
rend der Mahlzeit wurde der
obbenandter T
 ller für die Musicanten zweimahl
bey gesamte Tischen rund praesentirt.
ller für die Musicanten zweimahl
bey gesamte Tischen rund praesentirt.
An Gesundheiten w
 rde
rde
 der der Mahlzeit ausgebracht: E.
E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,
welche von den Herren des Rathes bedancket w
der der Mahlzeit ausgebracht: E.
E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,
welche von den Herren des Rathes bedancket w
 rde. 2) w
rde. 2) w
 rde von diesen
rde von diesen


|
Seite 106 |




|
Herren des Raths die Gesundheit und Wohlfahrt des
Gelags ausgebracht, welche von denen Herren
Altesten bedancket werde. 3) wurde der
Abwesenden Gesundheit getruncken. Diese
Gesundheiten waren mit Blasinstrumenten
begleitet und mehrere Gesundheiten auch nicht
getruncken. Die Musicanten aber machten w
 hrend der Tafel allerhand Concerte.
hrend der Tafel allerhand Concerte.
Wie man ges
 tiget und zum Gebet das Zeichen
mit der Glocke gegeben, so w
tiget und zum Gebet das Zeichen
mit der Glocke gegeben, so w
 rde wieder
rde wieder
 mb solches in der Stille
verrichtet, und darauf der Gesang "Nun
dancket alle Gott"' mit der
Instrumentalmusic abgesungen.
mb solches in der Stille
verrichtet, und darauf der Gesang "Nun
dancket alle Gott"' mit der
Instrumentalmusic abgesungen.
Hierauf w
 rde, wie sonsten gew
rde, wie sonsten gew
 hnlich, der Willkom mit der
Armb
hnlich, der Willkom mit der
Armb
 chse umhergetragen, und da w
chse umhergetragen, und da w
 rend der Zeit die Frauens
angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag
rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb
rend der Zeit die Frauens
angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag
rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb
 chse von den Schaffer zugebracht.
Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln
aber die Frauens solches gerne haben wollten, so
ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.
Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie
sonst gebräuchlich von einen Deputirten und
Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb
chse von den Schaffer zugebracht.
Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln
aber die Frauens solches gerne haben wollten, so
ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.
Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie
sonst gebräuchlich von einen Deputirten und
Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb
 chse nach den darauffolgenden
Aeltesten seinen Hause gebracht. In w
chse nach den darauffolgenden
Aeltesten seinen Hause gebracht. In w
 render Zeit wurden die Tische zum
Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die
vereheligten Frauen eigefunden. Br
render Zeit wurden die Tische zum
Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die
vereheligten Frauen eigefunden. Br
 ute waren keine in diesem Jahre in
der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br
ute waren keine in diesem Jahre in
der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br
 utigam nachkommen. Unverheyrathete
M
utigam nachkommen. Unverheyrathete
M
 nner, so keine Braut haben, k
nner, so keine Braut haben, k
 nnen weder andere Frauens oder
Wittwen noch weniger T
nnen weder andere Frauens oder
Wittwen noch weniger T
 chter an der Frauen Stelle zum
Coffee und Tantz nachkommen lassen.
chter an der Frauen Stelle zum
Coffee und Tantz nachkommen lassen.
Nachdem nun der Coffee verzehret, so w
 rde der Schaffer Tantz in
schwartzer Kleidung und M
rde der Schaffer Tantz in
schwartzer Kleidung und M
 ntel
ntel
 m dem Cr
m dem Cr
 tzbaum mit dem Willkom gemacht,
und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern
zugleich, darnechst von denen beiden neuen
Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei
jeden den Willkom in H
tzbaum mit dem Willkom gemacht,
und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern
zugleich, darnechst von denen beiden neuen
Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei
jeden den Willkom in H
 nden hat. F
nden hat. F
 lt ihnen der Deckel vom Willkom
ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine
Tonne Bier Strafe.
lt ihnen der Deckel vom Willkom
ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine
Tonne Bier Strafe.
Wegen dieser Tantze vertragen sich die Schaffere
mit den Musicanten und k
 nnen nun ihre schwarze Kleidung
und M
nnen nun ihre schwarze Kleidung
und M
 ntel ablegen.
ntel ablegen.
Wie nun dieses vorbey, so ging das Tantzen auf
dem Saal an, und wurden die Herren Aeltesten von
denen Schaffers gebeten mit das Tantzen den
Anfang zu machen; weiln nun dieselben alt und
schw
 chlich w
chlich w
 ren, so danckten die Aeltesten vor
dismahl f
ren, so danckten die Aeltesten vor
dismahl f
 r die Ehre und sie m
r die Ehre und sie m
 chten nur den Anfang machen; weiln
die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so
resolvirten 2 Aelteste
chten nur den Anfang machen; weiln
die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so
resolvirten 2 Aelteste


|
Seite 107 |




|
in Gottes Nahmen den Anfang zu machen. Darnechst folgten die Schaffers und alsden die erste Tour nach der Ordnung des Alters im Gelage; wer sich vorbey gehen lassen will, der kan es thun.
Ist die erste Tour rund, so kan tanzen, wer da
will aus der Gesellschafft und Platz findet,
ohne weitere Beobachtung der Rangordnung. Die
Music kostet f
 r einen Tantz mit der Violin 4
Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten
8 Sch., welcher ein jeder T
r einen Tantz mit der Violin 4
Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten
8 Sch., welcher ein jeder T
 nzer selbst bezahlt.
nzer selbst bezahlt.
Gegen Abend, wenn der Schaffer Tantz angehet, so kam der Wachtmeister mit 4 Mann und hielt die Wache.
Nach 10 Uhr Abends ward auch in der untern Stube getantzt.
Die Bewirthung zu Abend war ein belegtes Butterbrodt, Wein und Bier, auch Pfeiffen und Toback. In der Nacht beim Tanz war Limonade, Coffee und Thee und endigte sich dieses Fest des Morgens nach 6 Uhr.
Weiln die Zeit verging, mit dem Willkom der Frauens zu trincken, so wurden die Frauen nach der Schaffer Tantz erstlich mit Caffe, Thee und Kuchen bewirthet.
Wie zahlreich die Genossenschaft war, wissen wir leider nur unvollkommen; insbesondere fehlt jede Angabe über die Größe der Compagnie aus den Tagen ihrer Blüthe während des 16. Jahrhunderts. Offenbar wird je nach den kaufmännisch wechselnden Conjuncturen die Mitgliederzahl geschwankt haben. Im Jahre 1676 zählte die Schiffergesellschaft 57 Mitglieder; nahezu 100 Jahre später, 1767, ungefähr ebensoviel. Der in diesem Jahre gefaßte Beschluß über die Setzschiffer wurde von 34 Schiffern unterzeichnet, aber es stellte sich bei der nachherigen Vernehmung durch den Rath heraus, daß etwa 14 Schiffer aus unbekannten Gründen an jener Sitzung nicht theilgenommen hatten und etwa 11 zur Zeit auf Reisen abwesend gewesen waren. Für die Zeit von 1678 bis 1713 und wieder von 1723 an bis auf die Gegenwart läßt sich die Zahl der jährlich in die Gesellschaft aufgenommenen Schiffer nach dem "alten Hauptbuch des ehrbahren Schonfahrer=Gelages, worin alle Schiffers ihre Nahmen stehen, so das Gelag gewonnen haben," angeben. Dic Maximalziffer von 70 wurde im Jahre 1856 erreicht; in nicht wenigen Jahren wurde nur einer aufgenommen, und in manchen Jahren meldete sich gar keiner. Indem man die Angaben der einzelnen Jahre zu Perioden zusammenfaßt, die freilich wegen dazwischen


|
Seite 108 |




|
fehlender Jahre nicht ganz gleichmäßig gebildet werden können, erhält man folgende Uebersicht.
Es wurden in die Schiffergesellschaft aufgenommen:
| 1678-1697 | zusammen | 59 | Pers., | durchschnittlich | jährl. | 2,85 | Pers. |
| 1698-1713 | " | 51 | " | " | " | 3,28 | " |
| 1773-1793 | " | 60 | " | " | " | 2,29 | " |
| 1796-1815 | " | 93 | " | " | " | 4,65 | " |
| 1816-1835 | " | 84 | " | " | " | 4,20 | " |
| 1836-1855 | " | 117 | " | " | " | 5,85 | " |
| 1856-1875 | " | 121 | " | " | " | 6,05 | " |
Die vollständige Eintragung vorausgesetzt, findet man, daß die heutige Frequenz die des vorigen Jahrhunderts um ein Beträchtliches übertraf, und die Hauptblüthe würde in den uns bekannten Jahren auf die Mitte unseres Jahrhunderts fallen.
Wie es scheint, haben die Schiffer sich bemüht alle irgend zu ihnen gehörenden Persönlichkeiten wirklich in ihrem Gelag zu vereinigen. Von der Engherzigkeit bei der Aufnahme, wie sie bei den Zünften früherer Tage nur zu häufig war, haben sie sich alle Zeit ferngehalten. Nur ein Fall ist mir aufgestoßen, daß Jemand zurückgewiesen wird, obwohl er bereits 23 Jahre Bootsmann gewesen, weil er unehelich geboren. Es ist nicht wahrscheinlich, daß derartige Zurückweisungen öfter vorkamen, denn es fehlt in den Statuten ganz die Aufzählung zu erfüllender Bestimmungen, wie sie in den Rollen der Handwerker gewöhnlich aufstoßen. Fremde und Söhne von Nichtschiffern behandelte man allerdings weniger freundlich, indem man von ihnen das Doppelte des sonst üblichen Eintrittsgeldes verlangte, aber man wies sie doch nicht ab, und es lag im Geiste der Zeit, daß man sich gegen Fernerstehende ablehnend verhielt.
Die Höhe des Eintrittsgeldes, das ursprünglich auf eine Mark bemessen war, stieg mit der Zeit. Nach dem Statut von 1714 war es auf 11 Thaler 4 Sch. angesetzt für Einheimische und auf das Doppelte für Fremde. Das erwähnte "Hauptbuch" giebt sogar einen noch höheren Betrag an, nämlich 16 Thaler 20 Sch. Diese Summe bestand nach dem im Hauptbuch eingetragenen "Verzeichniss was ein Gelagsbruder geben muss" aus folgenden Posten:
| 12 | Rthlr. | - | Sch. | Gelagesgelt | |
| 2 | " | 16 | " | zum Proceß | |
| 1 | " | - | " | so bewilliget ist | |
| - | " | 12 | " | vor Marckt | |
| Thut | 16 | Rthlr. | 4 | Sch. | kumpt daß gelag zu gewinnen. |
| - | " | 16 | " | dem Gelagesdiener. |


|
Seite 109 |




|
Die Einnahmen und Ausgaben des Gelags hielten sich, wie der in den Beilagen abgedruckte Bericht ausweist, 1 ) in bescheidenen Grenzen. Mit Ausnahme weniger Jahre darf man der Gesellschaft nachrühmen, daß sie gut hauszuhalten und auszukommen verstand.
Reichthümer konnte sie freilich nicht sammeln. Immerhin weist die Aufstellung eines Inventars aus dem Jahre 1691 auf eine gewisse Behäbigkeit. Nach einem "Verzeichniss wass Anno 1691 auff Fastenacht beim Gelage gewessen ist," besaß die Gesellschaft:
"2 Leiche-Laeken in einer führen Lade,
"4 lange Manteln.
"An Silbergeschirr ist vorhanden wie folget:
"Einen grossen weissen Willkommen mit der Deckell,
"Einen kleinen weissen Wihllkommen mit der Deckell,
"Eine verguldte Traube mit Puckeln, so sehl. Jacob Wulff verehret.
"Eine verguldte Traube, so Sehl. Hinrich Schlüter verehret.
"Ein klein verguldeter Becher ohne Deckell,
"Ein missingscher verguldeter Ochsse, worin man ein Glas schrauben kan, so zerbrochen ist.
"Bey diesem Silbergeschirr ist eine Lade bey von führen holtz.
"24 Kannen, undt mussen noch gegeben werden wie folgt:
"1 Kanne Clauss Schmidt undt Jacob Fredelandt,
"1 Kanne Herrn Dettloff undt Daniell Moller,
"1 Kanne Hinrich Davietzen undt Karsten Druhll,
"1 Kanne Jochim Kadauw undt Jacob Kohll.
"Noch 5 zinnerne Leuchter 2 )
"Noch 1 missingschen Arm mit einer Plate,
"Noch 1 Klocke so am Kreutzbauhm hanget,
"Noch ein eissern Fahnstangen, ein eissern Offenfuess, einige eissern Fensterschranken. 3 )
Ein solches Inventar konnte schon gelegentlich dazu benutzt werden, um aus der Noth zu helfen. In der That läßt ein im Protocollbuche liegender Zettel ohne Datum erkennen, daß Verpfändungen vorkamen. Es heißt auf ihm: "sind 6 Stuck ohn die Deckel bey Herrn Gabriel Muller, darauf 200 Rthlr. Kapital genommen von sehl. Hans Dettloffs Kinder Gelder."


|
Seite 110 |




|
Ein Rest des einstigen Schatzes hat sich in Gestalt eines schönen, großen, silbernen Willkommens erhalten, angeblich ein Geschenk des Herzogs Christian Ludwig.
Wie es sich mit demselben verhält, in welcher Veranlassung Serenissimus ihn den Schiffern verehrt hat, ist mir leider trotz eifrigen Nachforschens im Schweriner Archiv zu entdecken nicht gelungen. Doch habe ich wenigstens mit Hülfe des Herrn Archivars Dr. Saß feststellen können, daß in einer Kabinets=Ausgabe=Rechnung des Herzogs Christian Ludwig von 1748 unter dem Monat September eingetragen ist: "An Konow für den Pocal, welcher nach Rostock gekommen - 251 Rthlr. N. 2 / 3 ." Ob diese Notiz sich auf den erhaltenen Pokal bezieht, weiß ich so wenig, als ich anzugeben vermag, wer Konow war. Aus den am Willkommen befindlichen Merkzeichen "S" und "ALK" läßt sich schließen, daß Konow ein Goldschmied in Schwerin war, dem der Herzog die Anfertigung übertragen hatte.
In dem Maße, als das Silbergeschirr abhanden kam, trat Zinngeschirr, das in jenen Tagen gleichfalls ein Kapital repräsentirte, an seine Stelle. Von diesem besaß das Amt im Februar 1707:
| 40 | Potkannen, |
| 19 | Stuckkannen, |
| 4 | zinnerne Leuchter. |
Außerdem nannte es damals einen messingenen Leuchter (Arm) und eine "Klocke am Kreutzbaum" sein eigen.
Verhältnißmäßig wenig Nachrichten haben sich von dieser wichtigen und angesehenen Gesellschaft erhalten. Bei dem Verkauf des Gelagshauses ist das ganze damals reichhaltige Archiv in alle vier Winde gegangen und nur drei Rechnungsbücher haben sich erhalten, zur Zeit im Besitz des Herrn Stadtarchivars Dr. Koppmann. Die Lade der Schiffergesellschaft birgt gar keine Original=Urkunden, nur einige Abschriften und vereinzelte, für die Geschichte der Gesellschaft nicht immer erhebliche Nachrichten. Die Aufzeichnung der älteren Statuten fand sich unter Papieren des Gewetts vor, und gestattete Herr Senator Paschen freundlichst die Einsichtnahme. Ueber den Streit der Schiffer mit den Warnemündern ergab das Haupt=Archiv in Schwerin die nöthigen Anhaltspunkte, während das Rostocker Stadtarchiv, bis auf die in der Darstellung benutzte Mittheilung, keine darauf bezüglichen Acten besitzt, wie Herr Dr. Koppmann mir mitzutheilen die Güte hatte.


|
Seite 111 |




|
Auch aus der unvollständigen Erzählung wird man, so hoffe ich, den Eindruck gewinnen, daß es sich um einen tüchtigen, gesunden Kern in der Organisation eines ansehnlichen Berufszweiges handelte, die bis auf den heutigen Tag lebensfähig zu sehen nur erfreulich sein kann.
Beilagen.
Der Rostocker Rath beschränkt die Warnemünder in ihrer bisherigen Gewohnheit, Kaufmannsgüter in grösseren Fahrzeugen zur See zu verschiffen. 1567, April 14.
Nach einer Abschrift im Schweriner Geheimen und Haupt-Archiv.
In saken der Rostocker schippern clegern an einem gegen und wedder de Warnemunders beclageden am andern dele, erkennen wir burgermeister und raht der stadt Rostogk, dat de Warnemunder alle schuten und vorbuede bote, darmit se dess kopmanss guder thor schwart fohren, up didtmahl scholen affstahn und keine andere böthe gebruken, den mit einem upgesetteden spoleborde, wat se alsden darmit an kopmanss gudern fohren konnen, schal en hirmit unverbaden sundern frey und nagegeven sin, dess sick also de schippern kegen einem erbaren raht bedancket und hebben tho mehrer orkundt der warheit dat sulve mit unser stadt secret vorsegelt. Actum den 14. Aprilis anno foffteinhundert soven und sostich.
Die Ordnung des Rostocker Schonenfahrer - Gelags. 1576, September 26.
Rostocker Stadt-Archiv. Pap.-Orig. Auf der Aussenseite steht von anderer Hand: Eines erbarn rhadts der stadt Rostock ordnung, wie es ihm Schonfarerlage bei den Kauffleuten, den Schonenfarer, Börgerfarer und schiffergeselschop soll geholden werden; vorbessert und publicirtt ahm 26. Septembris anno 1576. Die Hand, welche die ganze Ordnung selbst schrieb, setzte auf die Aussenseite: "Schonefahrerlages ordnüng."
Ordenüng und statüt wo idtt van olders vnnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn coplüden der


|
Seite 112 |




|
Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werdenn, ock also van einem erbaren rade sampt den oldesten der gemeine vorsamling des gelages upt nie belevet, bewilliget unnd ahngenamen wordenn getrüwelich tho holdenn unnd ernstlich tho straffenn bi pene, who up einem ideren articüll vorvatet ist.
1. Idt schall ein ider, die hir in dissem gelage will sittenn unnd drincken, he sy, wehr he will, hoges edder nederigs standes, die schall sick aller erbarheit beflitigen unnd siner wordt in acht hebben unnd gedencken ahn die börgersprake, datt he nicht böslich rede up fürsten unnd herrn up riddermessige lüde, up einen erbaren wolwisenn radt disser stadt, up früwen unnd jünckfrüwen keine böse tünge hebben unnd einen ideren in sinem stande nicht boses nareden; werdt dar woll aver beslagen, die schall na gelegenheidt der saken darümb gestraffet werdenn.
2. Idt schall ock ein erbar radt disser güden stadt Rostock ahn erem gerichte unnd gerechticheiden nicht verletzet edder verkortet, ock ahn erem güden namen nicht ahngegrepen werden by pene unnd straffe, de darop geborrth.
3. Item idt schall ock ein ider, die hir drincket sick alle tücht ahnnhemen, datt he bi dem düren nhamen des heren alse sinen hilligen viff wünden, vorsetzlicher weise nicht floke edder schwere, dardorch Gottes nhame werdt gelastert unnd geschendett; so offt einer darover werdt beschlagen, die schall den armen in die büsse 1 sch. Lüb. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven ohne gnade.
4. Item im gelicken valle, dede vorsetzlicher wise den bösen mhan nomet unnd hitziger wise flöke unnd schendet, de schall einen schilling in die armenbüsse unnd 2 sl. Lub. in des lages büsse vorvallen sinn sünder gnade. Würde he sick der dinge nicht entholden unnd sick straffen laten, so schall men ehm thom lage uthwisen sünder gnade unnd des lages henfürder nicht mehr werdt sin.
5. Item idt schall ock nemant de gave gottes, alse der unnd kost, nicht modtwilliger wise vorgeeten, noch under die tafell werpen; worde einer daraver begrepen, de schall in de armenbüsse 1 schill. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven.
1 ) Ein später von anderer Hand sehr unleserlich an den Rand geschriebener Zusatz lautet: dar aver die lesterung tho groff whare, soll dan ein jeden richten unnd zuglich solchs antogen.


|
Seite 113 |




|
6. Item idt schall ock ein den anderen, he sy wehr he will, hir im lage nicht legen heten; well sülkes deit, die schall den armen 1 sl. unnd dem gelage 2 sl. Lüb. vorfallen sinn.
7. Item idt schall einer den anderen mit erenrorigen wörden in dissem lage nicht angripen; so jemandt, he sy wehr he will, de sülckes deidt, de schall dem lage 2 tunnen behr unnd den armen 2 sl. Lüb. in die büsse sünder gnade vorfallenn sinn.
8. Item allent wadt wünden unnd blodtrode saken
sin, de ahn den radt horen, de scholen idt
soeken, dar idt van rechte geboret tho s
 ken.
ken.
9. Item bede dar well van den lachbroderen einen
gast in dath gelach unnd de gast worde
brockfellich, de w
 rdt, de ene darinne gebeden hefft,
schall beteren vor den gast.
rdt, de ene darinne gebeden hefft,
schall beteren vor den gast.
10. Item were hir ein gast ungehorsam, de hir in ditt lach nicht gebeden were, deme schall men kein behr tappen unnd uth dem gelage wisen, dar schall he so lange uthebliven, datt he der oldesten unnd des lages willen maketh.
11. Item idt schall bi aventiden, wehn datt licht werdt angesticket, idt sy winter edder sommer, in dissem gelage nemant in der worptafel mit worpelen edder karten umb gelt edder geldes gewehr spelen, by pene einen ortes gülden, den he in des lages büssen schall vorfallen sinn.
12. Item wehn die lachbröder thosamende vorbadet werden, de dar nicht enkümpt, de schall dem gelage 2 sl. Lub. vorbraken hebben in des lages büsse, he hebbe den eine ehrhebliche orsake uthethobliven edder late sick entschüldigen.
13. Item wol tho einem schenken gekaren werdt, wehn freybehr vorhanden is, unnd datsülvige nicht don will, de schall dem gelage einen ortesgülden in die büsse geven.
14. Item welker lachbroder sick mit einem anderen vorünwilgede im gelage unnd ginge daruth, unnd halede dodtlige wehre up denn anderen, de schall nicht mehr werdich wesen unses gelages unnd geselschop, so lange sick de lachbroder darumme bespraken hebben, watt he darvor breken schall na lages gerechticheit.
15. Item wel hir im gelage by aventiden sitt unnd drincket, de schall darahn sin, datt he up den slach negen in der nacht sin vath lehr hebbe, den nemandes etwas mehr schal getappet werden by pene 2 sl. Lüb. in de büsse.
16. Item weren daröverst welcke, de so vele vadt lehr maken wolden, datt sie die gantze nacht darahn tho drinken


|
Seite 114 |




|
hedden, so schall densülvigen datt nicht vorgündt werden ohne der oldesten unnd schaffer willen.
17. Im geliken valle werret datt koplüde unnd schipper vorhanden, de undereinander gefrachteth edder gerekent, ock sünst ein lachbroder fromde ehrlicke lüde in datt gelach beden, so schall einem ideren nha gelegenheit der tidt unnd festenn, sülkes van den oldesten unnd schafferen vorgündt werdenn.
18. Idt schall ock de brede disck vor der lücht sick nemant ahnsetten, sünder schall vor die oldestenn frey bliven, idt sy denne datt he van den oldesten unnd schafferen dar worde by genodiget.
19. Item de hir im gelage will sitten unnd drincken unnd mordtliche wehre alse redderspete, degen, swerde, rappire, büssen, handtbile unnd dergelicken bi sick hedde, de schal diesülvigen van sick in vorwaring dohn, dewile datt he sittet und drincket, will he datt nicht don, so schal mehnn ehme thom lage uthstöten unnd kein behr tappen.
20. Item de hir ein lachbroder is, unnd he tho einem schaffer gekaren werdt, will he des nicht don, so schall he dem gelage eine halve last behr geven sünder gnade. 1 )
21. Item so van den lachbroderen edder anderen gesten sick miteinander haderden unnd ehn worde van den oldesten unnd schafferen frede gebaden, unnd sie wolden nicht thofreden sin edder gehör geven, so schall man densülvigen thom lage uthrüllen 2 ) unnd des lages hinfort 3 ) nicht mehr 3 ) werdt sein. 4 )
22. Item so dar jemant were, he were broder edder fromder unnd dem lagesknechte edder den sinen ohne alle gegevene ursake in unwillen etwas tho nha dede, de schall van den oldesten umb einen ortesgülden in des lages büsse tho geven gestraffet werden.
23. Item were dar woll, de modtwilliger wise im gelage ahn vinster, porten, benken, kannen, potte entwey sloge edder worpe, de schall dem gelege datt wedderümme so güdt maken laten, alse idt gewesen is, unnd dem gelage 1 tunne behr unnd den armen 2 sl. Lub. in de büsse darvor tho bröcke geven.


|
Seite 115 |




|
24. Item wehr modtwilliger wise den hof beflemmet unnd unreiniget, de schall in eine ider büsse 1 sl. Lub. geven sünder gnade.
25. Item idt scholen de schaffer up des lagesknecht güde achtinge geven, datt alle dische, kannen, bencken unnd potte reine unnd klahr sin, so offte he sülckes vorsümet, schall he dem gelage 2 sl. Lub. in beide büssen vorvallen sin.
26. Item des lages knecht edder sin volck scholen idermanne inn gelage güde worde geven unnd bereidt idermanne behr tho holen, worde he overst jemande unnütte edder zanckesche wordt geven, so schall he gelickest einem anderen gestraffet werden.
27. Item so des lages knecht ein anderwegen tho behr geidt, dobbelt edder speldt unnd sin bevalen hüss leddich ledt unnd up sine geste nicht wardt, so offte he daröver beslagen wert, schal he dem gelage einen halven daler vorvallen sin.
28. Item so im hüse edder have amptknechte seten edder sünst ander volck unnd sick unnütte makeden edder andere vor dem schorsteine breden unnd rokerden unnd des lagesknecht edder sin volck ehn over vorbaden artickell behr haleden unnd nicht vorboden, so schall he dübbelde straffe geven.
29. Im gelicken valle, so sick well im have unnütte makede, worpe edder sloge, dat sülve is mit in den 4 palen des hüses, de schal gelicke straffe geven nha eines ideren vorbrecking.
30. Item idt is ein oldt gebrück unnd van den oldesten also belevet, wehn einer under eren lachbroderen starvet edder einen doden hefft, dar schal men de lachbröder sampt ehren früwen dartho vorbaden laten dorch des lages knecht; im valle sie dorch nodige gescheffte halven werden vorhindert, datt sie nicht beide kamen konden, so schall dennoch einer van ehnn dem like volgen; worde de mahn, im valle he nicht thor see wart were, uthebliven, so schall he in de büsse 2 sl. Lub. geven ahne gnade unnd de früwe einen sl. Lub.
31. Item idt hebben sick ock de oldesten des lages mit den lachbroderen gentzlick geslaten, datt alle der armen geldt, so sie binnen schepes bordt edder sünst bekamen, schall den oldesten överantwordet werden, darmit henverner de armen schiplüde sampt anderen hüssarmen mogen ein weinich 1 ) bedt


|
Seite 116 |




|
vorsorget werden, alse süslange geschen; dede Jemandt darbaven, de schall van den oldesten darümme gestrafet werden.
32. Item idt willen ock de oldesten van wegen des gantzen gelages den schafferen ernstlick upehrlecht unnd bevalen hebben up datt gantze hüss ahm regimente in güder ordening bi idermanne tho holden, ock güdt behr in datt hus schaffen. So dem hüse dorch ere vorsümenisse schade geschege, den scholen sie vorböten, unnd dem gelage 2 tunnen behr darvor thor straffe geven.
33. Item idt schall sick ein iderman, he sy lachbroder edder nicht, des winraden 1 ) mit afritinge der bleder, stangen edder windrüfe 2 ) entholden; so offte einer dar wert over beslagen, de schal 3 ) dem gelage 2 tunnen behr thor straffe geven; so he nicht will recht don, so schall men ehm ein straff cordia geven unnd thom lage uthwisen.
34. Item idt schall de kleine dischk im have vor den vinsteren gelick wo ihm hüse de brede disck vor die oldesten im gelage frey geholden werden, unnd van des lages knechte nemandt ahne der oldesten willen bigestadet.
35. Item wehn vor de lachbröder frey behr vorhanden, so scholen dejennen, de nicht lachbroder sint, sick ahn einen ordt allein setten, so offte sick einer indrengede unnd mitdrincken wolde ahne vorloff der oldesten, den schall men umb einen halven daler straffen, 4 ) edder sine straffe cordia geven.
36. Item were idt sake, datt unwille twischen lachbroderen vorfille unnd die eine wolde dem anderen up der straten mit mordtlicker were overfallen, daröver ein ander konde tho schaden kamen, welckes die hogeste unfrede is, des schal sine straffe bi dem rade unnd gerichte sin unnd unses lages nicht werdich wesen.
37. Item idt willen de oldesten des lages im gelicken valle, de sy lachbroder edder nicht, getrüwelich vormanet hebben, de up der pilckentafell midt dem bosel spelen, de willen den düren nhamen des heren nicht unnütte gebrücken, ock sick marteren flokendes unnd schelden ock schenden entholden. So offte einer daraver vorbreken werdt, men will ehnn ernstlich straffen, wo de artickell vormogen unnd inholdenn.


|
Seite 117 |




|
38. Item idt schall ock nemant eine den anderen im gelage bi freyem bere edder sünsten in drünckenem mode manen, worde einer darover beslagen, de schall darümme erenstlicken gestraffet werden.
39. Idt hefft sick ock ein erbar radt midt den olderlüden disses lages ernnstlicken beslaten, dat dejennigen, de de sick hir willen frachten laten, he sy lachbroder edder nicht, idt sy van schepen, schüten efft böten, datt sülvige schal alhir in dissem lage gesehen, dede einer darbaven unnd sick ungehorsamlich worde anstellen, densülvigen schal men hir edder tho Warnemünde so lange arrestieren laten, beth he dem gelage darvor afdracht gedan, up dat de armen henferner darvan dat ehre mogen bekamen unnd nicht mehr so gentzlick vorgeten werden, who vormals geschehn. 1 )
40. Ock süth ein erbar radt sampt den oldesten disses lages vor nützsam ahn, so entwedder ein schipper midt sinen gesellen effte volcke, ock sünsten mit sinen koplüden worde in twist geraden unnd sie dattsülvige under sick nicht konden vorgelicken edder vordragen, so schal sülckes den oldesten des lages kündt gedan werden, alse denne scholen sie sick eine gelegene tidt bestemmen, darinne de sake moge vorgenamen unnd vorgelicket werden; im valle sie sülckes im gelage nicht konden vorgelicken, so mogen sie sülckes vor ere geborlicke overicheit söken.
41. Lestlich hebben sick ock de oldesten des lages mit ehren lagesbroderen beslaten, datt alle dejennigen, de de schippers sin und noch. nicht lages gerechticheidt gedan hebben, unnd sick henferner thor sewart willen begeven, datt dejennigen lages gerechticheit unnd bürden scholen dragen helpen unnd lachbroders werden; dede jemandt darwedder, de schal thor sehe wart van hir tho segelen nicht thogelaten werden bedt so lange he dem gelage darvör afdracht gedann. 2 )


|
Seite 118 |




|
Ein anderes, wie es scheint, zeitgenössisches Exemplar dieser Ordnung weist folgende Abweichungen auf.
Im Eingange ist die Erwähnung der Bestätigung durch den Rath (van einem erbaren rade) ausgelassen.
Art. 1 hat am Schlusse die Worte: jedoch einem erbarn rade eren broeke vorbeholden.
2=2.
3=3.
4=4.
5=5.
6=6.
7. Item schloge einer den ander mith unwyllen up de mundt, edder thöge syn mest up den andern, de schall den ungehorsam deme lage bethernn midt 2 tunnen bher und den armen 4 sl. Lub., worde he syck dariegen settenn, men schal ehne uth deme lage wisen und des lages nicht werth synn.
8=7.
9. Item idt schollen alle hadersaken, de hyr im gelage geschein, vor de olderlude und oldesten vor ersteu geclagett, und nha eines idern vorbrekynge vhan den oldesten nha gelegenheidt gestraffet werdenn.
10=8.
11. Item were dar wol ander parthyen, datt erenrorige wordt vorfallenn, de vhan den oldesten konden vordragenn werden und datt eine partt dar nicht inne bewilligen wolden, sunder vor de rychtter lepe, so schall desulve, de vor de hern wyl, unse lachbroder nicht mher wesen, edder he geve dem gelage 3 tunnen biher thor affdracht und den armen 6 sl. Lubsch in de busse.
12=9.
13=10.
14=11.
15=12.
16=13.
17=14.
18=15.
19=16.
20=17.
21=18.
22. Item idt wyllen de oldesten dess lages nicht
lyden und na disser tidt vorbaden hebben datt
bradent und r
 kenent vor dem schorsteine bhy
straffe ein ordtsgulden in des lages busse.
kenent vor dem schorsteine bhy
straffe ein ordtsgulden in des lages busse.


|
Seite 119 |




|
23=19.
24=20.
25=21.
26=22.
27=23.
28=24.
29=25.
30=26.
31=27.
32=28.
33=29.
34. Item idt is ein oldt gebruck und vhan den oldesten des lages belevet, wen einer under eren lachbrodern stervet edder einen doden hefft, dar schall men de lachbroder dorch des lagesknecht dartho vorbhaden lathen bhy brocke 2 sl. Lubss deme lyke tho grave folgenn (ähnlich §. 30).
Art. 31 der vorstehend abgedruckten Redaction fällt weg.
35=32.
36=33.
37=34.
38=35.
39=36.
40=37.
Art. 38, 39, 40, 41 der vorstehend abgedruckten Redaction fallen weg.
Schluss: Vor dissem allem wyl syck ein jeder wethen vhor schaden tho wachtenn, denn fuersehenn helpet nichtt.
Schiffer-Eid. 1616.
Nach einer Abschrift unter Papieren in der Lade der Schiffer-Gesellschaft.
Ich lobe und schwere, das ich in diese kiste das Lastgelt vor vorgangenen Jahre richtig und vollenkommen eingesteckt habe und das ich das kunfftige Jar von newen zu jeder zeit, so offt ich ausssegeln werde, die Ruder und Manzeichen von eines erbahren Raths Zolner richtig abfurdern und dem vorordenten Voigt oder in dessen Abwesen Jochim des Raths Diener zu Warnamundedieselbe uberandtworten, kein frembd Gutt vor Rostocker Gutt ansagen, noch frembde Bier an anderen


|
Seite 120 |




|
Orttern geladen vor Rostocker Bier verkauffen, noch einige frembde tunnen ohne eines erbahren Raths Wissen und Willen selbst brennen oder brauen lassen will, so war mir Gott helffe.
Ordnung der Schonenfahrer-Gesellschaft zu Rostock. 1714, Februar 1.
Ein kleines Buch in der Lade der Schiffergesellschaft, wie es scheint ursprünglich das Notizbuch eines der Aeltesten der Gesellschaft. Auf dem 2. Blatte steht: Anno 1823 ist dieses Buch von mir selbst angeschafft zu meiner Nachricht. Jacob Maack.
1
) Articuli, wornach ein jeder
Gelagsverwandter des l
 blichen Schonenfahrgelags bey
Zusanmenkünften und in Gelagssachen sich zu
richten hatt.
blichen Schonenfahrgelags bey
Zusanmenkünften und in Gelagssachen sich zu
richten hatt.
1. Vor allen Dingen soll ein jeder Gelagsbruder
sich eines ehrbahren und aufrichtigen Wanndels
und Lebens befleißigen, damit er keine b
 se Nachrede ihm und dem gantzen
Gelage verursache.
se Nachrede ihm und dem gantzen
Gelage verursache.
2. Bey des Gelags Zusammenk
 nften soll ein jeder Gelagsbruder
nach der Ordnung, als er ins Gelag gekommen,
seinen Sitz und Ort nehmen, und was von denen
Aeltesten proponiret wird, in der Stille anh
nften soll ein jeder Gelagsbruder
nach der Ordnung, als er ins Gelag gekommen,
seinen Sitz und Ort nehmen, und was von denen
Aeltesten proponiret wird, in der Stille anh
 ren.
ren.
3. Auch nach angehörter Proposition und Vortrage
der Aeltesten nicht sofort anfangen zu rufen
noch zu antworten, sondern es sollen die
gesambte Gelagsbr
 der einen Abtritt nehmen, sich
unter einander wegen dessen, waß die Aeltesten
vorgetragen ohne weitleuftig und verdrießlichen
Gezanck besprechen, und ordentlich ihre Meinung
davon gebenn.
der einen Abtritt nehmen, sich
unter einander wegen dessen, waß die Aeltesten
vorgetragen ohne weitleuftig und verdrießlichen
Gezanck besprechen, und ordentlich ihre Meinung
davon gebenn.
4. Wann alsdan die Gelagsbr
 der unter sich einig worden, waß
auf der Aeltesten Vortrag zu antworten, sollen
sie einen unter ihnen erw
der unter sich einig worden, waß
auf der Aeltesten Vortrag zu antworten, sollen
sie einen unter ihnen erw
 hlen, der im Nahmen der gesambten
Gelagsbr
hlen, der im Nahmen der gesambten
Gelagsbr
 der und in der Gegenwart
daßjenige, waß sie auf einen jeden vorgetragenen
Punckt resolviret und beliebet, wieder
andtworten, damit die Antword fein ordendlich
kan zu Papier gebracht werden.
der und in der Gegenwart
daßjenige, waß sie auf einen jeden vorgetragenen
Punckt resolviret und beliebet, wieder
andtworten, damit die Antword fein ordendlich
kan zu Papier gebracht werden.


|
Seite 121 |




|
5. W
 rde aber einer oder ander sich
unterstehen demjenigen, so in Nahmen der
gesampten Gelagsbr
rde aber einer oder ander sich
unterstehen demjenigen, so in Nahmen der
gesampten Gelagsbr
 der Relation abstatte, ins Word zu
fallen oder denen Aeltesten mit hartem Rufen
oder ungezemenden Reden zu begegenn, derselbe
soll mit eine Tonne Bier oder nach Befinden
h
der Relation abstatte, ins Word zu
fallen oder denen Aeltesten mit hartem Rufen
oder ungezemenden Reden zu begegenn, derselbe
soll mit eine Tonne Bier oder nach Befinden
h
 rter gestraft werden.
rter gestraft werden.
6. Ein jeder ehrliche Gelagsbruder soll
dasjenige, was die gesampte Gelagsbrüder oder
die meisten, so auff beschehene Beruffung des
ganzen Gelags erscheinen, belieben und schließen
werden, ohne Wiederrede ihren gefallen lassen,
und denselben sich nicht wiedersetzen bey w
 lk
lk
 hrlicher Straffe des Gelags.
hrlicher Straffe des Gelags.
7. Da auch zu des Gelags Besten etwaß an Gelde
bewilliget w
 rde, soll ein jeder Gelagsbruder
solches unweigerlich dennen Aeltesten erlegen
und sollen die Aeltesten, waß sie empfangen,
alles specificiren und zu Rechnung bringen.
rde, soll ein jeder Gelagsbruder
solches unweigerlich dennen Aeltesten erlegen
und sollen die Aeltesten, waß sie empfangen,
alles specificiren und zu Rechnung bringen.
8. Solle aber einer oder ander sich darin seumig bezeugen, den oder denenselben sollen keine Freyzettel gegeben werden, bis sie alles bezahlet. Wehren es aber keine Seefahrende, so sollen deren Leichen von dem Gelag nicht getragen noch gefolget werden, bis das alle Restanten bezahlet.
9. Ein jeder Gelagsbruder soll bey Gewinnung des
Gelages sofort sein Gelagsgeld richtig erlegen
und nachgehendes die Leichen tragen und folgen,
wenn ihn die Ordnung trift, auch wan er zum
Schaffer von denen Aeltesten und Deputierten
erw
 hlet und aufgeruffen wird, sich
sofort gestellen dem Gelage zum Besten schaffen,
wie es von Alters her gebrauchlich gewesen, es
w
hlet und aufgeruffen wird, sich
sofort gestellen dem Gelage zum Besten schaffen,
wie es von Alters her gebrauchlich gewesen, es
w
 hre den, daß die Aeltesten und
Deputirten geschehen lassen wolten, daß einer
oder ander gegen Erlegung der Gebühr wegen der
Schafferey sich abkaufen wolte, alßden er zur
Schafferey nicht kann gezwungen werden.
hre den, daß die Aeltesten und
Deputirten geschehen lassen wolten, daß einer
oder ander gegen Erlegung der Gebühr wegen der
Schafferey sich abkaufen wolte, alßden er zur
Schafferey nicht kann gezwungen werden.
10. Ein jeder Gelagsbruder soll bey Gewinnung des Gelags, eine Bricke dem Gelagswirth zustellen, die ihm allemahl wann er folgen, ins Haus gebracht werden soll, bey Strafe 1 Tonne Biers.
11. Wer einer Leuche nicht folget oder aber schon folget und die Bricke dem Gelagswirth oder dessen Leuten in der Kirche nicht einwirft, soll 4 ßl. Straffe geben; imgleichen, wenn daß Gelag gefordert wirdt und einer ausbleibet, soll ebenfallß mit 4 ßl. gestraft werden.
12. Welcher Gelagsbruder, wann ihm die Ordnung
trift, und es ihm angesaget wird, eine Leiche zu
Grabe zu tragen, vers
 umet oder keinen Andern in seine
Stelle verschafft, soll mit 5 Fl. gestraft
werden, die Aeltesten aber sollen von zwölf Per=
umet oder keinen Andern in seine
Stelle verschafft, soll mit 5 Fl. gestraft
werden, die Aeltesten aber sollen von zwölf Per=


|
Seite 122 |




|
sohnen mit langen M
 nteln getragen, und noch von 4
Gelagsbr
nteln getragen, und noch von 4
Gelagsbr
 dern bey der Leiche her geleitet
werden.
1
)
dern bey der Leiche her geleitet
werden.
1
)
13. Und sollen diejenigen, so die Leiche tragen,
mit schwarzen Flohren und M
 nteln erbahrlich erscheinen, daß
das Gelag desfals keinen Schimpf habe, bei 5 Fl. Strafe.
nteln erbahrlich erscheinen, daß
das Gelag desfals keinen Schimpf habe, bei 5 Fl. Strafe.
14. Wenn ein Schiffer im Fr
 hjahr, zum ersten mahl zur See
gehet, soll er von dem Aeltesten, so bey
derAdministrazion ist, einen Zettel abfordern,
auch zugleich seine Restanten alle bezahlen; wer
dawieder thut, soll willk
hjahr, zum ersten mahl zur See
gehet, soll er von dem Aeltesten, so bey
derAdministrazion ist, einen Zettel abfordern,
auch zugleich seine Restanten alle bezahlen; wer
dawieder thut, soll willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
15. Diejenigen, welche sich der Gelagsbeliebung
und Gewohnheiten freventlich entgegen setzen,
oder in ein oder ander sich ungehorsam bezeugen
w
 rden, der oder dieselben sollen
nach Befindung von den Aeltesten und Deputirten
bis auf 1/2 Last Bier zur Straffe gesetzet
werden, w
rden, der oder dieselben sollen
nach Befindung von den Aeltesten und Deputirten
bis auf 1/2 Last Bier zur Straffe gesetzet
werden, w
 rde er aber sich in der G
rde er aber sich in der G
 te nicht bequemen wollen, soll die
gerichtliche H
te nicht bequemen wollen, soll die
gerichtliche H
 lfe dazu ersuchet werden.
lfe dazu ersuchet werden.
16. Es soll keiner Vorsetzschiffer sich
gebrauchen lassen, der das Gelag nicht gewonnen,
wiedrigenfals sol derjenige, so solches thut,
nicht vor redlich gehalten, noch hink
 nftig zum Gelagsbruder angenommen werden.
nftig zum Gelagsbruder angenommen werden.
17. Bei des Gelags Zusammenkünften in Fastlabend
soll ein jeder Gelagsbruder mit ehrbahre
Kleidung erscheinen, keiner dem Andern mit
spitzigen, hönischen noch ehrenrührigen Worten
nicht begegnen, weniger alten Groll
hervorsuchen, sondern an seinen Ohrt fein stille
und sittsahm besitzen bleiben und mit den
aufgetragenen Speisen und Trinken sich bedienen
lassen; wer dawieder thut und Zanck, Schlagerey
und andere Unlust verursacht, soll nach
Befindung willk
 hrlich und hard gestrafet werden.
hrlich und hard gestrafet werden.
18. Wer einen Gast alsdan mit sich f
 hren will, der soll auch f
hren will, der soll auch f
 r ihm soviel, als ein jeder
Gelagsbruder sonsten giebt, an die Schaffer bezahlen.
r ihm soviel, als ein jeder
Gelagsbruder sonsten giebt, an die Schaffer bezahlen.
19. Die Schaffer sollen bey solcher Zusammenkunft
in Fastlabend Fleisch, Brodt, Bier und andere
nothd
 rftige einschaffen und dahin
sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch
gesetzet werden und
rftige einschaffen und dahin
sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch
gesetzet werden und
 berall kein Mangel sein m
berall kein Mangel sein m
 ge.
ge.
20. Jedoch sollen die Schaffer mit denen
Gelagsbr
 dern sich zu vergleichen, wieviel
ein jedweder ihnen zu solcher Aus=
dern sich zu vergleichen, wieviel
ein jedweder ihnen zu solcher Aus=
 dern bey der Leiche
hergeleitet werden und ein Gelagsbruder wird
von 14 Persohnen, 12 bei Abendzeit, beliebed
16. Februar 1781, aber kein mehrer f
dern bey der Leiche
hergeleitet werden und ein Gelagsbruder wird
von 14 Persohnen, 12 bei Abendzeit, beliebed
16. Februar 1781, aber kein mehrer f
 r Geld.
r Geld.


|
Seite 123 |




|
richtung zulegen wollen, und waß also den beliebet, soll ein jeder Gelagsbruder zu erlegen schuldig sein.
21. Die Schaffer sollen auch auf das Gelagsgebeude Achtung geben, das es in Bau erhalten bleibe, jedoch soll ihnen vom Gelage wieder gutgethan werden, waß sie dazu verwenden.
22. So sollen auch die Schaffer die Leichlacken
und zinnen Geschirr nach dem Inventario j
 hrlich einer dem andern liefern
und also, wenn j
hrlich einer dem andern liefern
und also, wenn j
 hrlich zwey abgehen, solches denen
antretenden wieder liefern.
hrlich zwey abgehen, solches denen
antretenden wieder liefern.
23. Eines jeden verstorbenen Gelagsbruders Wittwe
soll j
 hrlich 6 ßl. Tiedgeld erlegen,
hiegegen sollen auch solche Wittwen und deren
Kindern, wann sie unverheurathet st
hrlich 6 ßl. Tiedgeld erlegen,
hiegegen sollen auch solche Wittwen und deren
Kindern, wann sie unverheurathet st
 rben, mit dem Gelage getragen und
gefolget werden; der Herrn Aeltester Wittwen
aber sind von solchen Tiedegeld frey und werden
dennoch zu Grabe getragen und gefolget.
rben, mit dem Gelage getragen und
gefolget werden; der Herrn Aeltester Wittwen
aber sind von solchen Tiedegeld frey und werden
dennoch zu Grabe getragen und gefolget.
24 Wan unter den Gelagsbr
 dern wegen einiger Frachten,
Havereyen, Kaufmanschaften oder sonsten wegen
der Seefahrt als Docksheuren und dergleichen
Irrungen entstehen, k
dern wegen einiger Frachten,
Havereyen, Kaufmanschaften oder sonsten wegen
der Seefahrt als Docksheuren und dergleichen
Irrungen entstehen, k
 nnen sie dieselbe bey denen
Aeltesten in der G
nnen sie dieselbe bey denen
Aeltesten in der G
 ute abthun oder in Entstehung
derselben, dero Bedenken was in solchen Sachen
den Seerechten gem
ute abthun oder in Entstehung
derselben, dero Bedenken was in solchen Sachen
den Seerechten gem
 ß erfordern und begehren, worin
ihnen alsden soll willfahret werden.
ß erfordern und begehren, worin
ihnen alsden soll willfahret werden.
25. Wan auch ein oder ander Seefahrender
außerhalb Landes etwas erfahren sollte, waß zu
der Seefahrenden und des Gelags Besten und
Aufnehmen dienen k
 nnte, so soll er alsdan solches
dem Aeltesten hinterbringen, um darauf bedacht
zu sein, wie es zuwerk k
nnte, so soll er alsdan solches
dem Aeltesten hinterbringen, um darauf bedacht
zu sein, wie es zuwerk k
 nnte gesetzet werden.
nnte gesetzet werden.
26. So sollen auch die Seefahrenden in den
Volk=Heuren und F
 hrung eine Gleichheit halten und
einer nicht mehr als der andere an Heuer und
F
hrung eine Gleichheit halten und
einer nicht mehr als der andere an Heuer und
F
 hrung auf einen Platz geben, auch
keiner dem andern sein Volk entheuern. Wer da
wieder thut und darüber betroffen wird, soll
willk
hrung auf einen Platz geben, auch
keiner dem andern sein Volk entheuern. Wer da
wieder thut und darüber betroffen wird, soll
willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
27. Welcher Gelagsbruder von denen Aeltesten zum
Deputirten erw
 hlet wird, soll allemahl, wan er
gefordert wird, und insonderheit bey Aufnahme
der Gelagsrechnung sich einfinden, auch da in
Abwesenheit eines der Aeltesten streitige Sachen
unter den Gelagsbr
hlet wird, soll allemahl, wan er
gefordert wird, und insonderheit bey Aufnahme
der Gelagsrechnung sich einfinden, auch da in
Abwesenheit eines der Aeltesten streitige Sachen
unter den Gelagsbr
 dern wegen der Seefahrt und
Kaufmannschaft zu verh
dern wegen der Seefahrt und
Kaufmannschaft zu verh
 ren, wen er gefordert wirdt,
erscheinen und solchem mit beywohnen.
ren, wen er gefordert wirdt,
erscheinen und solchem mit beywohnen.
Anno 1714 den 1. Februar in Rostock sind die
uhralten Leges des l
 blichen Schonfahrergelags zur
Aufnahme des Gelags
blichen Schonfahrergelags zur
Aufnahme des Gelags


|
Seite 124 |




|
und mehrere Verbindlichkeit von denen Herren
Aeltesten, Deputirten Schaffers und s
 mtlichen Gelagsbr
mtlichen Gelagsbr
 der eigenhändig unterschrieben und
best
der eigenhändig unterschrieben und
best
 ndigs darauf zu halten versprochen worden.
ndigs darauf zu halten versprochen worden.
| Als |
Jochim
Danil
Hinrich Pegelau Jacos Fr  dlandt
dlandt
Hans Goltermann |

|
als Aeltesten. |
Sowie auch die Nahmen der Gelagsbr
 der 1714:
der 1714:
Ch. St
 demann
demann
Hinr. Meyer Hinr. Kreplien Pet. Krempien |

|
als Deputirten. |
|
Hans
Brinckmann
Mich. Kr  ger
ger
Hinr. Evers jun. Joh. Dawitz Joch. Brinckmann Mich. T  ppe
ppe
Joch. Meyer Claus Meyer Steff. Behn Joch. Grund Hans Heydemann Jb. Rohde |
Leonhard
Reus
Hans Redepenning Mart. St  demann
demann
Dav. Heytmann Hans Meyer Martin T  ppe
ppe
Peter Mackenaus Pet. Allwardt Abrah. Jentzen Hans Reis Lorentz Fehn Hinr. Krempien. |
Und wen ein neuer Wirth aufkompt, der daß Gelag nicht hat, der muß vorerst daß Gelag gewinnen, giebt 11 Rthlr. 4 ßl. mit daß Todtengeld, vor das Schaffent 7 Rthlr. 10 ßl., vor sein Contrackt den Herrn Aeltesten 4 Speciy = 5 Rthlr. 16 ßl., den Bothen in sein Beliebung, die Heur alle Jahr vorauß 36 ßl.
Gesuch des Schonenfahrer-Gelags beim Rath um Bestätigung seiner alten Statuten. 1715, Januar 23.
Rostocker Stadt-Archiv. Pap.-Orig. Adresse: Denen Hoch= und Wolledlen, Vesten, Hochachtbahren, Hoch= und Wollgelahrten, Hoch= und Wollweisen sonders Hochzuehrenden Herren Herrn Burgermeister und Rath der Stadt Rostock. Dazu von anderer Hand: Elteste und sämmtliche Verwandte deß hiesigen Schonfahrer=Gelags


|
Seite 125 |




|
wegen Confirmation oder Renovation ihrer Reglements. Product. den 11. Februar 1715, auch bereits in einigen vorhergehenden sessionibus amplissimi senatus.
Hoch= und Wolledle, Veste, Großachtbare, Hoch= und Wollgelahrte, Hoch= unnd Wollweise insonders Hochgeneigte Herren.
Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise Gestrenge
geruhen von Ihro Magnifici dem Herrn
Burgermeister Tieleken großgeneigt zu vernehmen,
welcher gestalt ohngefehr den 16. Octobris jetzt
verwichenen Jahres einige Deputirte von unserem
Gelage sich nach gedachter Ihro Magnifici alß
damals worthabenden Burgermeisters verf
 get und bey demselben wegen des
von seinem Herrn Stieffsohn Christian Rudolph
Stolten verschriebenen und nach Stockholm
gesanten fremden Schiffers protestiret, da sie
auch zur Antwort erhalten, daß solche
Protestation angenommen werden solte und m
get und bey demselben wegen des
von seinem Herrn Stieffsohn Christian Rudolph
Stolten verschriebenen und nach Stockholm
gesanten fremden Schiffers protestiret, da sie
auch zur Antwort erhalten, daß solche
Protestation angenommen werden solte und m
 chten die Eltesten nur deßwegen
mit einem Memorial zu Rathe einkommen. Gelanget
demnach an Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrengen hiemit unser dienstliches Bitten,
dieselben geruhen hochgeneigt die Verordnung zu
machen, daß hinf
chten die Eltesten nur deßwegen
mit einem Memorial zu Rathe einkommen. Gelanget
demnach an Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrengen hiemit unser dienstliches Bitten,
dieselben geruhen hochgeneigt die Verordnung zu
machen, daß hinf
 hro keinem Kauffman zugelassen
seyn solle, zumahlen wen er hier t
hro keinem Kauffman zugelassen
seyn solle, zumahlen wen er hier t
 chtige Leuthe haben kan,
anderwerts fremde zu verschreiben, es sei dan,
daß sie zuvor das B
chtige Leuthe haben kan,
anderwerts fremde zu verschreiben, es sei dan,
daß sie zuvor das B
 rgerrecht und unser
Schonenfahrer=Gelag gewonnen haben, denn da
dieses solte in Folge gezogen werden, w
rgerrecht und unser
Schonenfahrer=Gelag gewonnen haben, denn da
dieses solte in Folge gezogen werden, w
 rden ja nothwendig unsere eigene
Schiffer crepiren und consequenter unser Gelag
ohnfehlbaren Schaden nehmen müssen; zudem ja
auch solches an keinem einzigen Orte, alwo
Seehandel getrieben wird, gebr
rden ja nothwendig unsere eigene
Schiffer crepiren und consequenter unser Gelag
ohnfehlbaren Schaden nehmen müssen; zudem ja
auch solches an keinem einzigen Orte, alwo
Seehandel getrieben wird, gebr
 uchlich ist. Und da man auch in
sicherer Erfahrung gebracht, wie nicht nur in
L
uchlich ist. Und da man auch in
sicherer Erfahrung gebracht, wie nicht nur in
L
 beck, von wannen das vor einigen
Jahren hier
beck, von wannen das vor einigen
Jahren hier
 ber eingeholte Attestatum sub A in
copia hiebey gehet,
1
) Hamburg,
sondern auch in allen Seest
ber eingeholte Attestatum sub A in
copia hiebey gehet,
1
) Hamburg,
sondern auch in allen Seest
 dten von Alters her der l
dten von Alters her der l
 bliche Gebrauch gewesen, daß
gleichwie ein Schiffer, wen er in Seesachen vor
dem Gelage von einem Kauffmanne verklaget wird,
er sich allerdings vor dem Gelage auch stellen
m
bliche Gebrauch gewesen, daß
gleichwie ein Schiffer, wen er in Seesachen vor
dem Gelage von einem Kauffmanne verklaget wird,
er sich allerdings vor dem Gelage auch stellen
m
 sse, also auch ein Kauffmann, wenn
er Seesachen betreffend von einem Schiffer vor
das Gelag verklaget wird, er ohneweigerlich
seine Klage in prima instantia anh
sse, also auch ein Kauffmann, wenn
er Seesachen betreffend von einem Schiffer vor
das Gelag verklaget wird, er ohneweigerlich
seine Klage in prima instantia anh
 ren und g
ren und g
 tliche Handlung pflegen muß,
welches ja auch mit dem jure communi gar
deutlich übereinkomt (vid. Rubr. Tit. 2, Lib. 2 seq.).
tliche Handlung pflegen muß,
welches ja auch mit dem jure communi gar
deutlich übereinkomt (vid. Rubr. Tit. 2, Lib. 2 seq.).
Nach dem aber die Herrn Kaufleuthe sich hieran wenig oder gar nicht bis dato kehren wollen, alß ersuchen wir gleichfalls


|
Seite 126 |




|
hiedurch Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrenge, dieselbe wollen uns hierin
hochgeneigt erscheinen und die Verordnung
machen, daß ein Kauffman, wenn er hink
 nftig von einem Schiffer wegen
Seesachen vor das Gelag gefordert wird, er
daselbst in prima instantia zu erscheinen
gehalten seyn solle.
nftig von einem Schiffer wegen
Seesachen vor das Gelag gefordert wird, er
daselbst in prima instantia zu erscheinen
gehalten seyn solle.
So haben wir auch nicht
 bergehen konnen drittens
vorzustellen, welchergestalt unsere Leges durch
den ungl
bergehen konnen drittens
vorzustellen, welchergestalt unsere Leges durch
den ungl
 cklichen großen Brand Anno 1678
zimlich l
cklichen großen Brand Anno 1678
zimlich l
 cherich geworden und nur diese
wenige, welche sub L. B. in copia hiebei
geben,
1
) noch
cherich geworden und nur diese
wenige, welche sub L. B. in copia hiebei
geben,
1
) noch
 brig behalten haben, wan aber
unsere Vorfahren an denenselben sich wenig
gekehret, alß ersuchen wir Ew. Hochedle,
Herrliche und Hochweise Gestrenge wollen unß
hierin hochgeneigt erscheinen und gegenw
brig behalten haben, wan aber
unsere Vorfahren an denenselben sich wenig
gekehret, alß ersuchen wir Ew. Hochedle,
Herrliche und Hochweise Gestrenge wollen unß
hierin hochgeneigt erscheinen und gegenw
 rtig unsere Leges in 27 Puncten
bestehent mit dem Rathsinsiegel de novo zu
confirmiren, auch denenselben vorhergehende 2
Puncte entweder zugleich mit oder auch per
decretum absonderlich zu confirmiren und also
diese jenen g
rtig unsere Leges in 27 Puncten
bestehent mit dem Rathsinsiegel de novo zu
confirmiren, auch denenselben vorhergehende 2
Puncte entweder zugleich mit oder auch per
decretum absonderlich zu confirmiren und also
diese jenen g
 tigst beyzulegen.
tigst beyzulegen.
Wan auch letztens oftermahlen wegen gar zu großer
Ungleichheit in denen Volcksheuren wieder den
26. Artikel der uhralten Gelagsgesetze vor unß
Klage gef
 hret worden, da der eine mehr alß
der ander an Heuer und F
hret worden, da der eine mehr alß
der ander an Heuer und F
 hrung auf einem Platz giebet und
dahero der Seehandlung großer Schade zuw
hrung auf einem Platz giebet und
dahero der Seehandlung großer Schade zuw
 chset, alß ist hierin unsere
dienstliche Bitte Ew. Hochedle, Herrliche und
Hochweise Gestrenge wollen großgneigt geruhen
gegenw
chset, alß ist hierin unsere
dienstliche Bitte Ew. Hochedle, Herrliche und
Hochweise Gestrenge wollen großgneigt geruhen
gegenw
 rtiges Project sub L. C., welches
sich bloß auf die Billigkeit gr
rtiges Project sub L. C., welches
sich bloß auf die Billigkeit gr
 ndet und nur nach alter Gewohnheit
gesetzet ist
2
) zu confirmiren und mit
dem gew
ndet und nur nach alter Gewohnheit
gesetzet ist
2
) zu confirmiren und mit
dem gew
 hnlichen Raths= auch unseres
Gelages=Insigel best
hnlichen Raths= auch unseres
Gelages=Insigel best
 rcken lassen, umb solches in
unserm Gelage zu jedermanlichen Notitie
aufzuhengen, damit hink
rcken lassen, umb solches in
unserm Gelage zu jedermanlichen Notitie
aufzuhengen, damit hink
 nftig hier
nftig hier
 ber weiter Klage zu f
ber weiter Klage zu f
 hren vermieden werde. Wann dieses
und obiges alles sich auf die Billigkeit gr
hren vermieden werde. Wann dieses
und obiges alles sich auf die Billigkeit gr
 ndet, alß getr
ndet, alß getr
 sten wir unß auch desto mehr
geneigter Erh
sten wir unß auch desto mehr
geneigter Erh
 rung verharrende
rung verharrende
|
Ew.
Hochedlen, Herrlichen und
Hochweisen
Gestrengen Aeltesten des hiesigen Schonfahrer=Gelages. |
Rostock, d. 23. Januar 1715.


|
Seite 127 |




|
Beliebung des Schonenfahrergelags über die Höhe der dem Schiffsvolke zu bewilligenden Heuer. 1715, Januar 23.
Rostocker Stadt-Archiv. Als Beilage C zum vorhergehenden Schreiben.
Demnach wir Elteste des Schonfahrer=Gelages in
Rostock erfahren, daß die Seefahrenden, zum
großen Schaden der Seehandlung wieder den 26.
Articul der uhralten Gelagsgesetze keine
Gleichheit in deren Volckheuren und F
 hrung halten und einer mehr alß
der ander an Heuer und F
hrung halten und einer mehr alß
der ander an Heuer und F
 hrung auf einen Platz giebet, so
haben wir Aelteste zu Abschaffung solcher
Unordnung und sch
hrung auf einen Platz giebet, so
haben wir Aelteste zu Abschaffung solcher
Unordnung und sch
 dlicher Ungleichheit nachfolgende
Ordonance gemacht, was und wieviel ein jeder auf
jechlichem Platz in der Nord= und Ost=See an
Volckheuer geben soll, wornach sich ein jeder
Gelagsbruder und Seefahrender bey wilk
dlicher Ungleichheit nachfolgende
Ordonance gemacht, was und wieviel ein jeder auf
jechlichem Platz in der Nord= und Ost=See an
Volckheuer geben soll, wornach sich ein jeder
Gelagsbruder und Seefahrender bey wilk
 hrlicher Straffe des Gelages zu
richten haben soll. Solchem nach soll denen
Sedfahrenden an Volcksheuren gegeben werden:
hrlicher Straffe des Gelages zu
richten haben soll. Solchem nach soll denen
Sedfahrenden an Volcksheuren gegeben werden:
| Auf | Holland | 10 | Rthlr. | ||
| " | Drontheim | 12 | " | ||
| " | Bergen | 8 | " | ||
| " |
Norwegen
 berall
berall
|
8 | " | ||
| " | Gottenburg | 6 | à | 7 | " |
| " | Jevel | 8 | " | ||
| " | Stockholm | 6 | à | 7 | " |
| " |
Nordk
 ping
ping
|
6 | à | 7 | " |
| " | Westerwyck | 6 | " | ||
| " | Walmerswyck | 6 | " | ||
| " | Calmar | 6 | " | ||
| " | Carlskrohn | 5 | " | ||
| " | Carlshaven | 5 | " | ||
| " | Gottland | 6 | " | ||
und an F
 hrung
hrung
|
2 | " | |||
| " | Riga | 7 | à | 8 | " |
| " | Narva | 8 | " | ||
| " | Reval | 7 | " | ||
| " | Parnaw | 7 | " | ||
| " | Curland | 6 | à | 7 | " |
| " | Libau und | à | 7 | " | |
| Windau | à | 7 | " |


|
Seite 128 |




|
| Auf | Memel | 6 | à | 7 | Rthlr. |
| " |
K
 nigsberg
nigsberg
|
6 | " | ||
| " | Dantzig | 6 | " | ||
| " | Colberg | 6 | " | ||
| " | Hinterpommern | 6 | " | ||
| " | Stralsund | 4 | " | ||
| " | Copenhagen | 4 | à | 5 | " |
| " |
Helsing
 r
r
|
5 | à | 6 | " |
| " |
Malm

|
5 | à | 6 | " |
| " |
L
 beck
beck
|
3 | à | 4 | " |
| " |
Holstein
 berall
berall
|
4 | à | 5 | " |
| " | Ahlburg | 6 | " | ||
in den Belt
 berall
berall
|
5 | à | 6 | " |
Und auff alle obspezificirte Pl
 tze soll das Volck
tze soll das Volck
 ber der obigen Heuer seine
ordinaire F
ber der obigen Heuer seine
ordinaire F
 hrung wie von Alters her gebr
hrung wie von Alters her gebr
 uchlich gewesen, haben und genießen.
uchlich gewesen, haben und genießen.
Angebliche Bestätigung der Statuten des Schonenfahrergelags durch den Rath zu Rostock. 1715, ? Februar.
Rostocker Stadt-Archiv. Brouillon ohne nähere Angabe des Datums.
Nachdem uns B
 rgermeistern und Rath der Stadt
Rostock die Aeltesten des hiesigen Schonfahrer
Gelages per supplicationem zu vernehmen gegeben,
wie das von unseren Antecessoribus confirmirte
Exemplar ihres Reglements, durch die Anno 1677
entstandene große Feuersbrunst mit verbrannt,
sie aber noch einige den vorigen conform seyende
Articulos wieder aufgefunden und beybehalten
h
rgermeistern und Rath der Stadt
Rostock die Aeltesten des hiesigen Schonfahrer
Gelages per supplicationem zu vernehmen gegeben,
wie das von unseren Antecessoribus confirmirte
Exemplar ihres Reglements, durch die Anno 1677
entstandene große Feuersbrunst mit verbrannt,
sie aber noch einige den vorigen conform seyende
Articulos wieder aufgefunden und beybehalten
h
 tten, die sie uns zugleich
tten, die sie uns zugleich
 bergeben und dabey, um sie sich
derselben in Sachen ihres Gelagses zu dieses
Aufnahme n
bergeben und dabey, um sie sich
derselben in Sachen ihres Gelagses zu dieses
Aufnahme n
 tzlich gebrauchen k
tzlich gebrauchen k
 nnten, uns ersuchet: Wir solche,
nebst eines dabey mit eingelieferten sogenannten
Ordonnanze, was das Schiffsvolck oder
Schiffsleute an Heuer und Führung von hier auf
andere Oerter zu genießen haben sollten, damit
nnten, uns ersuchet: Wir solche,
nebst eines dabey mit eingelieferten sogenannten
Ordonnanze, was das Schiffsvolck oder
Schiffsleute an Heuer und Führung von hier auf
andere Oerter zu genießen haben sollten, damit
 berall hierunter Gleichheit
gehalten, ein jeder um so viel mehr und promter
vergn
berall hierunter Gleichheit
gehalten, ein jeder um so viel mehr und promter
vergn
 glich bedient werden und deswegen
unter Kaufleuten, Schiffern und Bothsleuten kein
Streit entstehen m
glich bedient werden und deswegen
unter Kaufleuten, Schiffern und Bothsleuten kein
Streit entstehen m
 gte, zu genehmigen und zu
confirmiren m
gte, zu genehmigen und zu
confirmiren m
 gten geruhen, so haben
gten geruhen, so haben


|
Seite 129 |




|
wir beydes (wovon wir jedoch die sogenannte Ordonnanze nichts anders, dann für ein Bedenken und Vorschlag hiesigen Schonfahrer=Gelags=Aeltesten angenommen) mit Fleiß durchgelesen wohl erwogen und, da wir befunden, daß verhoffentlich dasjenige, was in den Articulis verfasset, der Gestalt wie sie folgend lauten:
Articuli des Schonfahrer=Gelags=Reglements.
Es folgen nun die 27, von uns unter No. IV abgedruckten Artikel, indem jedoch Art. 16 und 26 geändert sind. Diese lauten nämlich in der Bestätigung des Rathes:
Art 16: Es soll hinfüro keiner, er sey fremder
oder einheimischer, als Setzschiffer hier
admittiret, noch mit dem Gef
 ß, worauf er gesetzet, von hier
aus dem Baum eher gelassen werden, bis
derselbige das hiesige Schonfahrer=Gelag
gewonnen hat. Dagegen sollen aber auch
diejenigen, so im hiesigen Gelage seyn, und kein
eigen Gef
ß, worauf er gesetzet, von hier
aus dem Baum eher gelassen werden, bis
derselbige das hiesige Schonfahrer=Gelag
gewonnen hat. Dagegen sollen aber auch
diejenigen, so im hiesigen Gelage seyn, und kein
eigen Gef
 ß haben, wenn sie vom Kaufmann auf
dessen Gef
ß haben, wenn sie vom Kaufmann auf
dessen Gef
 ß zu Setzschiffern verlangt
werden, sich dazu unweigerlich von der Heuer und
F
ß zu Setzschiffern verlangt
werden, sich dazu unweigerlich von der Heuer und
F
 hrung, so hieselbst durch die
Ordonanze gesetzt, gebrauchen lassen. Wer sich
dawider ohne jenige von den Aeltesten und
Deputirten des Gelags erheblich befundenen
Ursachen setzet, soll dem Kaufmanne dasselbe
bezahlen, was er vor einen außerhalb dem Gelage
seyenden Setzschiffer dem Gelage erlegen muß.
hrung, so hieselbst durch die
Ordonanze gesetzt, gebrauchen lassen. Wer sich
dawider ohne jenige von den Aeltesten und
Deputirten des Gelags erheblich befundenen
Ursachen setzet, soll dem Kaufmanne dasselbe
bezahlen, was er vor einen außerhalb dem Gelage
seyenden Setzschiffer dem Gelage erlegen muß.
Art. 26. So sollen auch die Seefahrende in den
Volcksheuren und F
 hrungen allerdings der Ordonnanze,
welche von E. E. Hochw. Rath nach der Aeltesten
des Gelags Vorschlage gefertiget, nachgehen, und
nicht mehr noch weniger geben dann in derselben
verordnet, und also hierunter Gleichheit halten,
auch solche selber in ihrer eigenen Heuer und
F
hrungen allerdings der Ordonnanze,
welche von E. E. Hochw. Rath nach der Aeltesten
des Gelags Vorschlage gefertiget, nachgehen, und
nicht mehr noch weniger geben dann in derselben
verordnet, und also hierunter Gleichheit halten,
auch solche selber in ihrer eigenen Heuer und
F
 hrung nicht
hrung nicht
 berschreiten; daneben keiner dem
andern sein Volck entheuern; wer dawieder thut
und dessen
berschreiten; daneben keiner dem
andern sein Volck entheuern; wer dawieder thut
und dessen
 berf
berf
 hret wird, soll willk
hret wird, soll willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
An Art. 27 schliesst sich an:
Zu des Gelags Frommen und Nutzen, so wir zu
gemeiner Stadt Wohlseyn gerne gef
 rdert sehen, ein nicht geringes
contribuiren werde, als haben wir dieselbe
Articulos vorstehenden Inhalts Kraft dieses
wissentlich confirmiret und wollen, daß
denenselben allerdings gelebet werde, wie wir
dann auch darüber feste zu halten gemeynet sein.
rdert sehen, ein nicht geringes
contribuiren werde, als haben wir dieselbe
Articulos vorstehenden Inhalts Kraft dieses
wissentlich confirmiret und wollen, daß
denenselben allerdings gelebet werde, wie wir
dann auch darüber feste zu halten gemeynet sein.
Nun kommt die von uns unter No. VI abgedruckte Beliebung über die Höhe der Heuer und dann wird fortgefahren:


|
Seite 130 |




|
Die Schiffer, wie es fast überall, bevorab in der Nachbarschaft gebrauchlich, genießen an Heuer noch eins so viel als einer vom Volcke und ist also auch hierunter nach Verschiedenheit der Oerter, das Quantum der Heuer der Schiffer zu rechnen.
Wegen des F
 hrung wird, wie oben gedacht, nach
Gottland jedem des Volckes an Gelde gegeben 2 Rthlr.
hrung wird, wie oben gedacht, nach
Gottland jedem des Volckes an Gelde gegeben 2 Rthlr.
Sonsten aber soll ein Schiffer, wann er ein
Schiff f
 hret, so an freyen Kaufmanns=Gut
h
hret, so an freyen Kaufmanns=Gut
h
 lt unter 20 Last nur 1 Last, wann
es aber 20 Last frey Kaufmanns=Gut und dar
lt unter 20 Last nur 1 Last, wann
es aber 20 Last frey Kaufmanns=Gut und dar
 ber h
ber h
 lt, 2 Last F
lt, 2 Last F
 hrung haben, nicht aber mehr.
hrung haben, nicht aber mehr.
Jeder von dem Volck hat, außer was die Reisen auf
Gottland seyn, an F
 hrung eine halbe Last, ist aber
darunter ein Kochsjunge, nur nach Proportion der
F
hrung eine halbe Last, ist aber
darunter ein Kochsjunge, nur nach Proportion der
F
 hrung die Heuer haben soll, wobey
zu observiren, daß, wann die F
hrung die Heuer haben soll, wobey
zu observiren, daß, wann die F
 hrung in Brettern bestehet, f
hrung in Brettern bestehet, f
 r 1 Last 8 zw
r 1 Last 8 zw
 lfter Bretter gerechnet werden.
lfter Bretter gerechnet werden.
Wir behalten uns aber expresse bevor obiges alles
nach Gelegenheit der Zeiten und des Publici
Besten zu
 ndern, zu mindern, zu mehren oder
auch wieder abzuthun. Und weil uns daneben die
Aeltesten des Schonfahrer=Gelags ersuchet, wir
auch nach dem Exempel benachbarter Seest
ndern, zu mindern, zu mehren oder
auch wieder abzuthun. Und weil uns daneben die
Aeltesten des Schonfahrer=Gelags ersuchet, wir
auch nach dem Exempel benachbarter Seest
 dte bevorab der Stadt L
dte bevorab der Stadt L
 beck verordnen m
beck verordnen m
 gten, daß wann zwischen Kaufmann
und Schiffern in Seesachen Streit entstehet, der
Kaufmann, wenn er ad instantiam des Schiffers
vor das Schonfahrer=Gelag gefordert wird, allda
sowohl als wenn er den Schiffer solcher Sachen
halber dahin citiren l
gten, daß wann zwischen Kaufmann
und Schiffern in Seesachen Streit entstehet, der
Kaufmann, wenn er ad instantiam des Schiffers
vor das Schonfahrer=Gelag gefordert wird, allda
sowohl als wenn er den Schiffer solcher Sachen
halber dahin citiren l
 sset, sich gestellen und daselbst
entweder g
sset, sich gestellen und daselbst
entweder g
 tliche Handlung pflegen oder auch
in deren Entstehung des Schonfahrer=Gelags
Bedencken zuf
tliche Handlung pflegen oder auch
in deren Entstehung des Schonfahrer=Gelags
Bedencken zuf
 rderst abwarten m
rderst abwarten m
 sse, und wir dieses nicht
unbillig, vielmehr heilsam und dazu n
sse, und wir dieses nicht
unbillig, vielmehr heilsam und dazu n
 tzlich erachten, daß hernach bey
unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich
daselbst melden, man so viel besser und promter
aus der Sache kommen k
tzlich erachten, daß hernach bey
unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich
daselbst melden, man so viel besser und promter
aus der Sache kommen k
 nne, so verordnen wir kraft
dieses, daß, wann auf Anhalten eines Schiffers
ein Kaufmann vor die Aeltesten des
Schonfahrer=Gelags in vorerwehnten Sachen
gefordert wird, derselbe sich dahin einzufinden
und seine Nothdurft, zu dem Ende, damit in
Entstehung der G
nne, so verordnen wir kraft
dieses, daß, wann auf Anhalten eines Schiffers
ein Kaufmann vor die Aeltesten des
Schonfahrer=Gelags in vorerwehnten Sachen
gefordert wird, derselbe sich dahin einzufinden
und seine Nothdurft, zu dem Ende, damit in
Entstehung der G
 te die Gelags
te die Gelags
 ltesten nach richtiger Erkundigung
aller Umstände ihr ertheilendes Bedenken desto
besser fassen und so viel gr
ltesten nach richtiger Erkundigung
aller Umstände ihr ertheilendes Bedenken desto
besser fassen und so viel gr
 ndlicher geben k
ndlicher geben k
 nnen, allda geb
nnen, allda geb
 hrend vorzutragen, schuldig seyn
soll: gestallt dann dieses, gleich in L
hrend vorzutragen, schuldig seyn
soll: gestallt dann dieses, gleich in L
 beck, nur blos um der Aeltesten
des Gelages als der Seesachen kundiger Leute
Bedencken vorher und ehe sie zu den ordentlichen
Gerichte gelangen, einzuholen, allhier
concediret wird, daher dann auch in solchen und
dergleichen Sachen
beck, nur blos um der Aeltesten
des Gelages als der Seesachen kundiger Leute
Bedencken vorher und ehe sie zu den ordentlichen
Gerichte gelangen, einzuholen, allhier
concediret wird, daher dann auch in solchen und
dergleichen Sachen


|
Seite 131 |




|
die Aeltesten des Schonfahrer=Gelags den Partibus
Strafe zu dictiren, und solcher wegen die
aussegelnden Seefahrenden von ihren Reisen
zurückzuhalten, nicht befugt sein: gestalt dann
der Artikel 14 des Reglements allein von dem zu
verstehen, was in dem Reglement den Aeltesten
des Schonfahrer=Gelags zu bestrafen verg
 nnet werden oder auch sonsten dem
Gelage selbst von ihren Gelags=Genossen geb
nnet werden oder auch sonsten dem
Gelage selbst von ihren Gelags=Genossen geb
 hret.
hret.
Dessen alle zur Urkunde haben wir diese unsere
resp. Confirmation, Ordonnanze und Verordnung
mit der Stadt gr
 ßeren Insiegel bedrucken und unter
unsers Protonotarii Subscription dem
Schonfahrer=Gelage, um solche auff dem Gelage
ßeren Insiegel bedrucken und unter
unsers Protonotarii Subscription dem
Schonfahrer=Gelage, um solche auff dem Gelage
 ffentlich zu affigiren,
ausfertigen lassen. So geschehen in Rostock den
? Februar 1715.
ffentlich zu affigiren,
ausfertigen lassen. So geschehen in Rostock den
? Februar 1715.
Uebersicht der Rechnungen des Schonenfahrer-Gelages, 1725 bis 1800.
Zusammengestellt aus einem alten Rechnungsbuch des Schonenfahrer-Collegiums, gegenwärtig im Besitz des Herrn Stadtarchivars Dr. K. Koppmann.
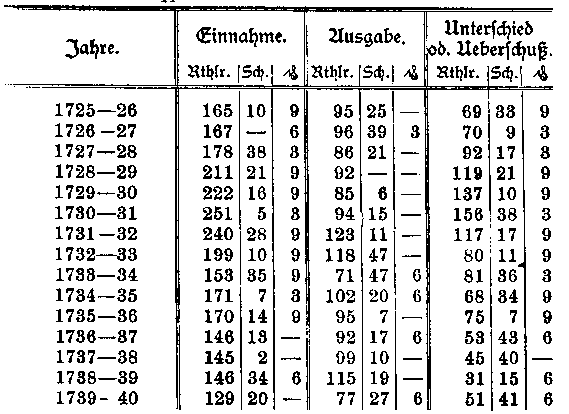


|
Seite 132 |




|
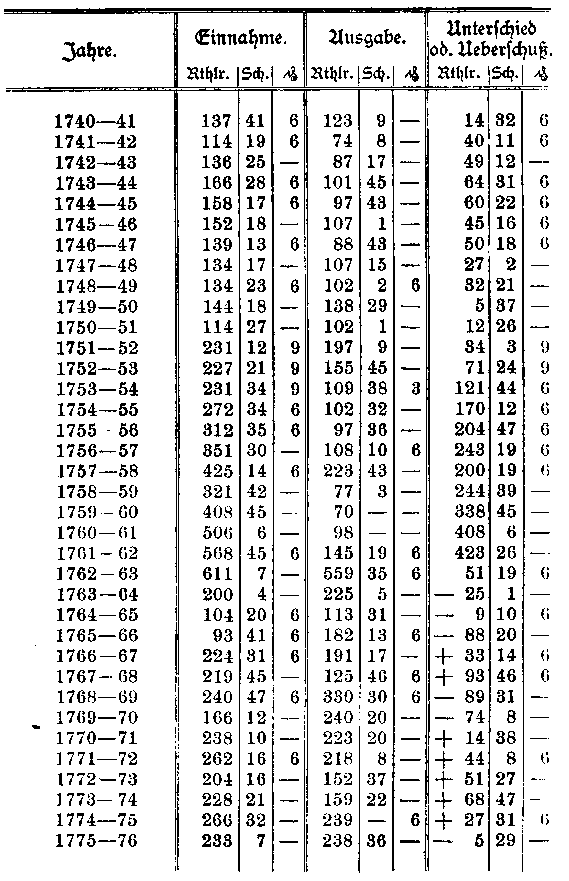


|
Seite 133 |




|
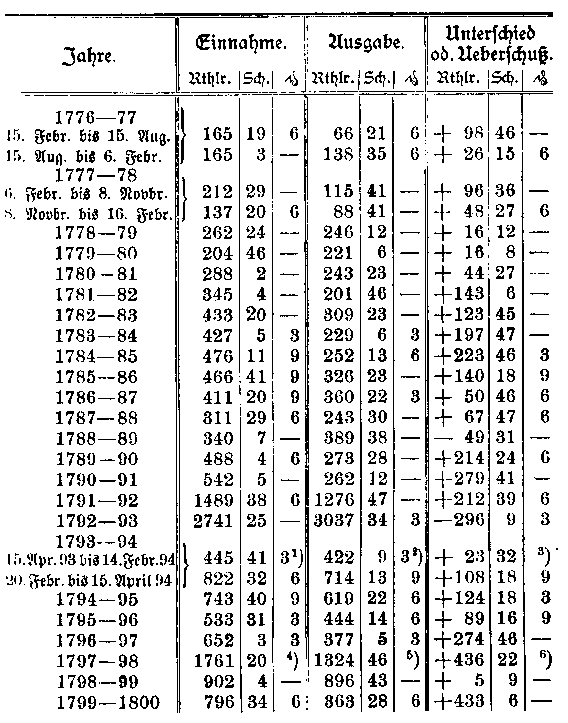
1) Außerdem 94 Rthlr.
N.
2
/
3
und 15 Thlr.
Pommersch Courant.
2) Außerdem 7 Thlr.
18 Sch. Pommersch Courant.
3) Außerdem
94 Rthlr. N.
2
/
3
und 75
Thlr. 34 Sch. Pommersch Courant.
4)
Außerdem 33 Thlr. 15 Sch. Pommersch
Courant..
5) Außerdem 28 Thlr.
Pommersch Courant.
6) Außerdem 5 Thlr.
15 Sch. Pommersch Courant.


|
Seite 134 |




|
Beliebung des Schonenfahrergelags über die sog. Vorsetzschiffer. 1767, Februar 17.
Rostocker Stadt-Archiv.
Anno 1767 den 17. Februar des Nachmittags um 2
Uhr war das l
 bliche Schonfahr=Gelag convociret
und versammlet, und von s
bliche Schonfahr=Gelag convociret
und versammlet, und von s
 mtlichen unterschriebenen
Gelagsbr
mtlichen unterschriebenen
Gelagsbr
 dern beliebet worden, daß einen
krancken Gelagsbruder oder einer Witwen
freystehen solle, zwey Reisen für sich thun zu
lassen und soll ihm nicht frey gelassen werden
vor Gewinnung des Gelags die dritte Reise anzutreten.
dern beliebet worden, daß einen
krancken Gelagsbruder oder einer Witwen
freystehen solle, zwey Reisen für sich thun zu
lassen und soll ihm nicht frey gelassen werden
vor Gewinnung des Gelags die dritte Reise anzutreten.
Dessen zu Urkund ist diese Beliebung von s
 mmtlichen Anwesenden zu mehrerer
Festhaltung eigenh
mmtlichen Anwesenden zu mehrerer
Festhaltung eigenh
 ndig in
mei
subscripti praesentia unterschrieben worden.
Actum Rostochii ut supra.
ndig in
mei
subscripti praesentia unterschrieben worden.
Actum Rostochii ut supra.
Jochim Jenßen, Eltester
Johann Heinrich Tarnau, Eltester
Peter Meyer, Eltester
Johan Johanßon, Dobertirter
Christoffer Heidtmann, Deputirter
Claus Johanßen, Deputicrter
Johann Christoph Tppe
Frantz Ruht
Jacob Rohde
Peter Bey
Joachim Meyer
Jochim Brinckmann
Jochim Bockholdt
Hinrich Davids
Peter Kembs
Jacob Bockholdt
Hans Jacob Seyer
Jochim Holtz
Jochim Busch
Johann Hinrich Krempien
Hans Jrges
Andreas Hudder
Hans Kadau
Christian Schmidt
Hinnerich Radeloff
Emanuel Otto Junius


|
Seite 135 |




|
Peter Harder
Hinrich Flindt
Michel Wichmann
Christian Jochim Mohnsen
Johann Jochim Hußfeldt
Ulrich Kemp
Hans Jochim Frdland
Lorentz Hanßen.
Statuten des Schonenfahrer-Gelags zu Rostock. 1825, Januar 10.
Nach dem in der Lade der Schiffergesellschaft erhaltenen Exemplar.
§ 1. Dem Schonenfahrer=Gelage stehen 4 Aeltesten
vor, deren zwey aus den Mitgliedern der hiesigen
Kaufmanns=Compagnie und die andern zwey aus den
Mitgliedern des Schonenfahrer=Gelags erw
 hlet werden; die aus der
Kaufmanns=Compagnie zu erw
hlet werden; die aus der
Kaufmanns=Compagnie zu erw
 hlenden Aeltesten müssen zugleich
Großbrauer seyn. Die Wahl der Aeltesten geschiet
in der Art, daß bey eintretender Vacanz eines
Aeltesten 3 Kaufleute und Großbrauer oder 5
Schiffer, je nachdem ein Schiffer oder ein
Kaufmann als Aeltester abgegangen ist, E. E.
Rath von den verschiedenen Aeltesten
vorgeschlagen werden, worauf dann E. E.Rath aus
diesen 3 M
hlenden Aeltesten müssen zugleich
Großbrauer seyn. Die Wahl der Aeltesten geschiet
in der Art, daß bey eintretender Vacanz eines
Aeltesten 3 Kaufleute und Großbrauer oder 5
Schiffer, je nachdem ein Schiffer oder ein
Kaufmann als Aeltester abgegangen ist, E. E.
Rath von den verschiedenen Aeltesten
vorgeschlagen werden, worauf dann E. E.Rath aus
diesen 3 M
 nnern einen Aeltesten w
nnern einen Aeltesten w
 hlet. Der solcher gestalt erw
hlet. Der solcher gestalt erw
 hlte Aelteste bekleidet dies Amt
auf seine Lebenszeit. Zwischen den 4 Aeltesten
alternieret j
hlte Aelteste bekleidet dies Amt
auf seine Lebenszeit. Zwischen den 4 Aeltesten
alternieret j
 hrlich die Administration und es
bestehet diese Administration 1) in F
hrlich die Administration und es
bestehet diese Administration 1) in F
 hrung der Gelagsbücher 2) in
Vortragung der n
hrung der Gelagsbücher 2) in
Vortragung der n
 tigen Propositionen in der
Versammlung 3) in Aufbewahrung der Lade und der
darin geh
tigen Propositionen in der
Versammlung 3) in Aufbewahrung der Lade und der
darin geh
 rigen Gelagsschriften 4) in
Ausfertigung der erforderlichen Zettel bey der
Abreise eines Schiffers von hier.
rigen Gelagsschriften 4) in
Ausfertigung der erforderlichen Zettel bey der
Abreise eines Schiffers von hier.
Der neuerwählte Aelteste wird von E. E. Rath beeydiget und zahlet:
| a. |
an jeden
 brigen 3 Aeltesten 7
Rthlr. 24 Sch. N
2
/
3
, Summa
brigen 3 Aeltesten 7
Rthlr. 24 Sch. N
2
/
3
, Summa
|
22 | Rthlr. | 24 | Sch. |
| b. |
an den Gelagssecret
 r
r
|
- | " | 32 | " |
| c. | fürs Buch | - | " | 16 | " |
| ------------------ | ----- | ----- | ------ | ----- | |
| Zu übertragen | 23 | Rthlr. | 24 | Sch. |


|
Seite 136 |




|
| Übertrag | 23 | Rthlr. | 24 | Sch. | |
| d. | den Bothen | - | " | 8 | " |
| e. | für daß Decrett E. E. Rath | - | " | 9 | " |
| f. | für seine Beeidigung | - | " | 40 | " |
| g. |
an die Armb
 chse
chse
|
- | " | 8 | " |
| h. |
an den B
 rgermeisterdiener
rgermeisterdiener
|
- | " | 32 | " |
| ------------- | ----- | ----- | ------ | ----- | |
| Rthlr. N 2 / 3 | 25 | Rthlr. | 25 | Sch. |
Die beyden Kaufm
 nnischen Aeltesten zahlen außerdem
jeder 2 Rhtlr. 24 Sch.
N
2
/
3
an die Todtenkasse
und leisten außerdem die gew
nnischen Aeltesten zahlen außerdem
jeder 2 Rhtlr. 24 Sch.
N
2
/
3
an die Todtenkasse
und leisten außerdem die gew
 hnlichen j
hnlichen j
 hrlichen Beytr
hrlichen Beytr
 ge.
ge.
§ 2. Außer diesen 4 Aeltesten bestehet das
Regiment noch aus 10 Deputirten, n
 mlich a) 2 Schaffers, welche
ja
mlich a) 2 Schaffers, welche
ja
 hrlich so wie die Sache nach dem
Alter sie trift, eintreten und hiefür jeder 12
Rthlr. N
2
/
3
an die
Gelagskasse und zusammen eine zinnerne Kanne
zahlen müssen. Sie haben darauf zu sehen, daß
die beiden Gelagshauser in guten baulichen
Stande erhalten bleiben und n
hrlich so wie die Sache nach dem
Alter sie trift, eintreten und hiefür jeder 12
Rthlr. N
2
/
3
an die
Gelagskasse und zusammen eine zinnerne Kanne
zahlen müssen. Sie haben darauf zu sehen, daß
die beiden Gelagshauser in guten baulichen
Stande erhalten bleiben und n
 thige Reparaturen, welche einzeln
10 Rthlr. N.
2
/
3
der dr
thige Reparaturen, welche einzeln
10 Rthlr. N.
2
/
3
der dr
 ber betragen, dem administrirenden
Aeltesten anzeigen, bey allen Zusammenk
ber betragen, dem administrirenden
Aeltesten anzeigen, bey allen Zusammenk
 nften und namentlich am Fastlabend
auf Ordnung zu halten und die Schl
nften und namentlich am Fastlabend
auf Ordnung zu halten und die Schl
 ssel zu den Gelagsger
ssel zu den Gelagsger
 thschaften an sich zu nehmen. Wenn
sie das Schafferamt ein Jahr verwaltet haben, so
treten sie
thschaften an sich zu nehmen. Wenn
sie das Schafferamt ein Jahr verwaltet haben, so
treten sie
b. als Deputierte bey der Todtenlade ein, und normiren dieserhalb die am 1. December 1821 obrigleitlich confirmirte Statuten. Wenn sie ein Jahr bey der Todtenlade gewesen sind treten sie
c. als Gelagsdeputirte ein.
d. Außerdem werden von der ganzen Geselschaft zwey Deputirte zur Wittwencasse und
e. zwey Deputirte zur Unterst
 tzungscasse erw
tzungscasse erw
 hlet, welche ihr Amt 3 Jahre
verwalten, so daß immer derjenige abgeht,
welcher im letzten Jahre die Rechnung geführt hat.
hlet, welche ihr Amt 3 Jahre
verwalten, so daß immer derjenige abgeht,
welcher im letzten Jahre die Rechnung geführt hat.
Alle diese Deputirte nehmen in Gemeinschaft mit
den Aeltesten die Rechnung des administrierenden
Aeltesten und der Deputirten auf, wozu besonders
die beiden Gelagsdeputirten concuriren m
 ssen, weil sie selbst keine
Rechnungen zu f
ssen, weil sie selbst keine
Rechnungen zu f
 hren haben. Die 4 Aeltesten, die
10 Deputirten und der Secret
hren haben. Die 4 Aeltesten, die
10 Deputirten und der Secret
 r erhalten f
r erhalten f
 r die Aufnahme gesammter
Rechnungen jeder 2 Rthlr.
N
2
/
3
, mithin zusammen
N
2
/
3
Rthlr. 30.
r die Aufnahme gesammter
Rechnungen jeder 2 Rthlr.
N
2
/
3
, mithin zusammen
N
2
/
3
Rthlr. 30.


|
Seite 137 |




|
Hierzu tragen bey
| a. | die Gelagscassa | 12 | Rthlr. | 24 | Sch. |
| b. | die Todtencassa | 12 | " | 24 | " |
| c. |
die Unterst
 tzungscassa
tzungscassa
|
2 | " | - | " |
| d. | die Wittwencassa | 3 | " | - | " |
§ 3. Der Consulent des Schonenfahrergelags wird
von der ganzen Geselschaft gew
 hlet und derselbe erh
hlet und derselbe erh
 lt seine Bem
lt seine Bem
 hungen nach specificirter Rechnung bezahlt.
hungen nach specificirter Rechnung bezahlt.
§ 4. Der Secretair wird von den Aeltesten erw
 hlet, und erh
hlet, und erh
 lt ein j
lt ein j
 hrliches Salair von 25 Rthlr.
N.
2
/
3
, zahlbar in
Quartalratis. Hief
hrliches Salair von 25 Rthlr.
N.
2
/
3
, zahlbar in
Quartalratis. Hief
 r muß er in allen Zusammenk
r muß er in allen Zusammenk
 nften das Protocoll f
nften das Protocoll f
 hren, die Protocolle in das
Protocollbuch eintragen, gesamte Papiere in
Ordnung bringen und erhalten, auch alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird. Es
h
hren, die Protocolle in das
Protocollbuch eintragen, gesamte Papiere in
Ordnung bringen und erhalten, auch alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird. Es
h
 ngt von dem Ermessen der Aeltesten
ab, ob einzelne besondere und ungew
ngt von dem Ermessen der Aeltesten
ab, ob einzelne besondere und ungew
 hnliche Arbeiten ihm außerdem
bezahlet werden sollen.
hnliche Arbeiten ihm außerdem
bezahlet werden sollen.
§ 5. Der Bothe wird von den Aeltesten gew
 hlet. Er erh
hlet. Er erh
 lt aus der Gelagscasse j
lt aus der Gelagscasse j
 hrlich 9 Rthlr.
N
2
/
3
in halbj
hrlich 9 Rthlr.
N
2
/
3
in halbj
 hrigen Ratis und außerdem
daßjenige, was ihm aus den einzelnen Cassen
zugestanden ist. Dagegen muß er nicht blos alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was ihm in
Beziehung auf die einzelnen Cassen obliegt,
sondern auch alle Mitglieder der Geselschaft zu
den Zusammenk
hrigen Ratis und außerdem
daßjenige, was ihm aus den einzelnen Cassen
zugestanden ist. Dagegen muß er nicht blos alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was ihm in
Beziehung auf die einzelnen Cassen obliegt,
sondern auch alle Mitglieder der Geselschaft zu
den Zusammenk
 nften einladen und alles
nften einladen und alles
 brige ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird,
ohne daß ihm hief
brige ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird,
ohne daß ihm hief
 r irgend etwas vergütet werde.
r irgend etwas vergütet werde.
§ 6. Das alte Gelagshaus wird alle 6 Jahre zur
Vermietung an einen hiesigen Schiffer
meistbietend zumAufbot gebracht. Es wird Niemand
zum Both zugelassen als wer ein Gelagsmitglied
ist, und muß der Meistbietende dies Haus selbst
bewohnen, auch die geh
 rige Aufsicht
rige Aufsicht
 ber das neue Haus f
ber das neue Haus f
 hren ohne einige Benutzung
desselben sich anmaaßen zu dürfen. Der
Miethsmann zahlet 6 Rthlr.
N
2
/
3
Contractsgebühr außer
dem Stempelsatze, welche zwischen den 4
Aeltesten und dem Secret
hren ohne einige Benutzung
desselben sich anmaaßen zu dürfen. Der
Miethsmann zahlet 6 Rthlr.
N
2
/
3
Contractsgebühr außer
dem Stempelsatze, welche zwischen den 4
Aeltesten und dem Secret
 r vertheilet werden, so daß Jeder
1 Rthlr. 16 Sch. erh
r vertheilet werden, so daß Jeder
1 Rthlr. 16 Sch. erh
 lt. Wenn Jemand zu B
lt. Wenn Jemand zu B
 llen, Conzerten,
Kunst=Ausstellungen oder sonst, die S
llen, Conzerten,
Kunst=Ausstellungen oder sonst, die S
 le in dem neuen Hause zu miethen
w
le in dem neuen Hause zu miethen
w
 nscht, so h
nscht, so h
 ngt die desfallsige Bewilligung
allein vom administrirenden Aeltesten ab, und
bekommt der Gelagswirth wegen der auch f
ngt die desfallsige Bewilligung
allein vom administrirenden Aeltesten ab, und
bekommt der Gelagswirth wegen der auch f
 r ihn hiemit verbundenen Bel
r ihn hiemit verbundenen Bel
 stigung den sechsten Theil der Miethe.
stigung den sechsten Theil der Miethe.
§ 7. Es ist vor einigen Jahren eine
Unterstützungscasse für h
 lfsbed
lfsbed
 rftige Mitglieder des hiesigen Schonenfahrer=Gelages
rftige Mitglieder des hiesigen Schonenfahrer=Gelages


|
Seite 138 |




|
errichtet, welche einen besonders verwalteten
Fond hat, und normiren dieserhalb folgende
Grunds
 tze:
tze:
a. Ein jeder Schiffer, er mag ein Seeschiff oder
ein Leuchterschiff fahren, zahlet von den
Monatgelde oder
 berhaupt von seiner Heuer, wenn er
bey der Reise f
berhaupt von seiner Heuer, wenn er
bey der Reise f
 hrt, welche er von Neujahr bis
Ende December eines jeden Jahres [macht], von
jedem Thaler einen Schilling an die Unterst
hrt, welche er von Neujahr bis
Ende December eines jeden Jahres [macht], von
jedem Thaler einen Schilling an die Unterst
 tzungscasse der hiesigen h
tzungscasse der hiesigen h
 lfsbed
lfsbed
 rftigen Schiffer.
rftigen Schiffer.
b. Jeder Schiffer, der in einem Jahre nicht
gefahren hat, und keiner Unterst
 tzung bedarf, bezahlet j
tzung bedarf, bezahlet j
 hrlich im December Monat 16 Sch.
an die Unterstützungscasse.
hrlich im December Monat 16 Sch.
an die Unterstützungscasse.
c. Im December Monate eines jeden Jahres werden
die Beytr
 ge, durch ein Circul
ge, durch ein Circul
 r eingefodert, wor
r eingefodert, wor
 ber Jeder seine zu zahlenden
Beytrag gewissenhaft anzugeben und die geschehen
Abgaben an den Bothen zu bemerken hat.
ber Jeder seine zu zahlenden
Beytrag gewissenhaft anzugeben und die geschehen
Abgaben an den Bothen zu bemerken hat.
d. Der bey dieser Casse angestellte Deputirte
kann aufs Neue wieder gew
 hlet werden.
hlet werden.
e. Die Lade der Unterst
 tzungscasse befindet sich beym
administrirenden Aeltesten und der Deputirte hat
den Schlüssel zu derselben.
tzungscasse befindet sich beym
administrirenden Aeltesten und der Deputirte hat
den Schlüssel zu derselben.
f. Im Schlusse eines jeden Jahres bestimt die
ganze Gesellschaft, welche hülfsbed
 rftige Schiffer unterst
rftige Schiffer unterst
 tzt werden sollen und wie groß
solche Unterst
tzt werden sollen und wie groß
solche Unterst
 tzung für jeden Einzelnen seyn
soll, da dann der Administrant hiernach die
Zahlung zu leisten hat.
tzung für jeden Einzelnen seyn
soll, da dann der Administrant hiernach die
Zahlung zu leisten hat.
g. Die abgelegte Rechnung wird der ganzen
Gesellschaft j
 hrlich vorgelegt.
hrlich vorgelegt.
h. Der Bothe erh
 lt für das Einfodern der Beyträge
2 Rthlr. N
2
/
3
.
lt für das Einfodern der Beyträge
2 Rthlr. N
2
/
3
.
i. Wenn ein Ueberschuß in dieser Casse sich befindet, so soll derselbe thunlichst zu Capital geschlagen werden.
§ 8. Es ist ferner ein Fond vorhanden, welcher zur1 Bildung einer Wittwencasse bestimmt ist, und es ist wegen solcher Wittwecasse Nachstehendes bestimmt.
a. Es soll darauf Bedacht genommen werden den
jetzigen Capitalfond thunlichst zu vergr
 ßern, daher von der j
ßern, daher von der j
 hrlichen Einnahme mindestens 25
Rthlr. N
2
/
3
j
hrlichen Einnahme mindestens 25
Rthlr. N
2
/
3
j
 hrlich zum Capital geschlagen und
hiemit so lange fortgefahren werden soll, bis
ein hinreichender Capitalfond gesammelt sein wird.
hrlich zum Capital geschlagen und
hiemit so lange fortgefahren werden soll, bis
ein hinreichender Capitalfond gesammelt sein wird.
b. Diejenigen Schiffer, welche vor den Anfang
dieses Instituts, also vor den 24. Febr. 1816,
Mitglieder des hiesigen Schonfahrergelags
gewesen sind, und ihren Beytritt zu dieser
Einrichtung nicht schon erkl
 rt haben, haben freye Wahl, ob sie
rt haben, haben freye Wahl, ob sie


|
Seite 139 |




|
hieran theilnehmen wollen oder nicht, und sind auch berechtiget für den Fall auszutreten, daß sie als Wittwer leben. Jeder, welcher aber nach dem 24. Februar 1816 in das Schonenfahrergelag eingetreten ist, und noch eintreten wird, ist verpflichtet, an dieser Einrichtung Theil zu nehmen, er mag verheyrathet oder unverheyrathet sein.
c. Jeder Schiffer, welcher Mitglied dieser
Errichtung ist, ist verpflichtet j
 hrlich im December Monath einen
Rthlr. N
2
/
3
an die
Wittwencasse zu zahlen und außerdem bey seinem
Eintritte den Receptionsschein mit 1 Rthlr.
N
2
/
3
zu l
hrlich im December Monath einen
Rthlr. N
2
/
3
an die
Wittwencasse zu zahlen und außerdem bey seinem
Eintritte den Receptionsschein mit 1 Rthlr.
N
2
/
3
zu l
 sen, welcher der Casse zu Guthe
berechnet wird.
sen, welcher der Casse zu Guthe
berechnet wird.
d. Dieser j
 hrliche Beitrag, Receptionsgeb
hrliche Beitrag, Receptionsgeb
 hren und die Zinsen des Kapitals
werden dazu verwendet, um zuerst einen j
hren und die Zinsen des Kapitals
werden dazu verwendet, um zuerst einen j
 hrlichen Betrag von wenigstens 25
Rthlr. N
2
/
3
zu Capital zu
machen und der Ueberrest wird nach Abzug der
Administrationskosten zwischen denjenigen
Wittwen nach dem Ermessen der Gesellschaft
vertheilet, deren M
hrlichen Betrag von wenigstens 25
Rthlr. N
2
/
3
zu Capital zu
machen und der Ueberrest wird nach Abzug der
Administrationskosten zwischen denjenigen
Wittwen nach dem Ermessen der Gesellschaft
vertheilet, deren M
 nner zu dieser Casse beygetragen
haben, und erh
nner zu dieser Casse beygetragen
haben, und erh
 lt vorl
lt vorl
 ufig und so lange die Kr
ufig und so lange die Kr
 fte der Casse dies verstatten,
jede Wittwe 5 Rthlr. N
2
/
3
.
Wenn diese Zahlung aus der Casse nicht weiter
geleistet werden kann, so muß der Betrag von 5
Rthlr. N
2
/
3
herabgesetzet werden.
fte der Casse dies verstatten,
jede Wittwe 5 Rthlr. N
2
/
3
.
Wenn diese Zahlung aus der Casse nicht weiter
geleistet werden kann, so muß der Betrag von 5
Rthlr. N
2
/
3
herabgesetzet werden.
e. W
 re aber eine Frau von ihrem Mann
geschieden oder durch einen Rechtspruch auch nur
von Tisch und Bett getrennt, so hat sie an diese
Casse kein weiteres Recht; auch f
re aber eine Frau von ihrem Mann
geschieden oder durch einen Rechtspruch auch nur
von Tisch und Bett getrennt, so hat sie an diese
Casse kein weiteres Recht; auch f
 lt ihre Theilnahme an der j
lt ihre Theilnahme an der j
 hrlichen Erhebung weg, wenn sie
zur zweyten Ehe schreiten m
hrlichen Erhebung weg, wenn sie
zur zweyten Ehe schreiten m
 gte.
gte.
f. Dagegen macht es kein Unterschied, ob die
Wittwe dieser Erhebung bed
 rftig ist oder nicht.
rftig ist oder nicht.
g. Es ist gleich, ob die theilnehmende Wittwe ihren Ehemann auf der See oder sonst durch den Tod verlohren hat.
h. Diejenigen Schiffer, welche nicht mehr zur See
fahren, müssen einen v
 llig gleichen Beytrag leisten.
llig gleichen Beytrag leisten.
i. Die Zahlung an jede einzelne Wittwe kann nie
h
 her wie auf 30 Rthlr.
N
2
/
3
steigen, und wenn der
Fall eintreten m
her wie auf 30 Rthlr.
N
2
/
3
steigen, und wenn der
Fall eintreten m
 gte, daß so wenige Wittwen
vorhanden w
gte, daß so wenige Wittwen
vorhanden w
 ren, daß von dem j
ren, daß von dem j
 hrlichen Geld
hrlichen Geld
 brig bliebe, so soll dasselbe zur
Vergr
brig bliebe, so soll dasselbe zur
Vergr
 ßerung des Capitals angewendet werden.
ßerung des Capitals angewendet werden.
k. Wenn das jetzige Capital sich merklich
vergr
 ßert hat, so sollen die j
ßert hat, so sollen die j
 hrlichen Beytr
hrlichen Beytr
 ge vermindert werden oder ganz aufhoren.
ge vermindert werden oder ganz aufhoren.
l. Diejenige Dividende, welche jede Wittwe
erh
 lt, darf nicht cedirt und nicht
mit Arrest beleget werden.
lt, darf nicht cedirt und nicht
mit Arrest beleget werden.


|
Seite 140 |




|
m. Zur Berechnung dieser Casse sind 2 Deputirten
angestellet, welche von der Gesellschaft gew
 hlet werden. Der abgehende
Deputirte kann wieder gew
hlet werden. Der abgehende
Deputirte kann wieder gew
 hlet werden.
hlet werden.
n. Die Lade ist bey dem administrierenden
Aeltesten und der administrierende Deputirte hat
den Schl
 ssel zu derselben. Die beyden
Deputirten und der Secret
ssel zu derselben. Die beyden
Deputirten und der Secret
 r erhalten für ihre Bemühungen aus
dieser Casse nichts.
r erhalten für ihre Bemühungen aus
dieser Casse nichts.
o. Der Bothe erh
 lt aus dieser Casse für daß
Einfodern der Beytr
lt aus dieser Casse für daß
Einfodern der Beytr
 ge 2 Rthlr. N
2
/
3
.
ge 2 Rthlr. N
2
/
3
.
§ 9.
1
)
Von umstehende Fremde, welche Schiffer werden,
ist Folgendes. Von denjenigen 4 Rthlr. 18 Sch.,
welche die 4 Aeltesten erhalten, bekommt der
administrierende Aeltester 10 Sch. mehr, wie die
 brigen. Ist der Fremder mit der
Tochter eines Gelagsmitglieds bereits
brigen. Ist der Fremder mit der
Tochter eines Gelagsmitglieds bereits
 ffentlich verlobet, so hat er zu
bezahlen 25 Rthlr. N
2
/
3
,
welche so vertheilet werden, wie ad b bemerkt ist.
ffentlich verlobet, so hat er zu
bezahlen 25 Rthlr. N
2
/
3
,
welche so vertheilet werden, wie ad b bemerkt ist.
§ 10. Jeder Schiffer muß seine Erlegnisse an die
einzelnen Cassen allersp
 tens dan bezahlen, wenn er vom
administrierenden Aeltesten sich den Freyzettel
holet, um von hier auszugehen. Der Freyzettel
wird ihm nicht eher verabfolget, als bis er alle
etwaigen R
tens dan bezahlen, wenn er vom
administrierenden Aeltesten sich den Freyzettel
holet, um von hier auszugehen. Der Freyzettel
wird ihm nicht eher verabfolget, als bis er alle
etwaigen R
 ckst
ckst
 nde bezahlet hat. F
nde bezahlet hat. F
 r diesen Freyzettel bezahlet er 2
Sch. f
r diesen Freyzettel bezahlet er 2
Sch. f
 r jede Last, wozu sein Schiff
taxirt worden ist. Durch dies Erlegniß macht er
sein Schiff f
r jede Last, wozu sein Schiff
taxirt worden ist. Durch dies Erlegniß macht er
sein Schiff f
 r 2 Ladungen, welche er auf den
Boden seines Schiffes nimmt, frey, so daß es
einerley ist, ob er diese beyden Ladungen
entweder in Rostock einnimmt und dahin zur
r 2 Ladungen, welche er auf den
Boden seines Schiffes nimmt, frey, so daß es
einerley ist, ob er diese beyden Ladungen
entweder in Rostock einnimmt und dahin zur
 ckbringt oder ob er diese beyden
Ladungen im Auslande einnimmt oder l
ckbringt oder ob er diese beyden
Ladungen im Auslande einnimmt oder l
 scht, da im allgemeinen der
Grundsatz gilt, daß durch diese 2 Sch.
Lastengeld 2 Ladungen frey werden. Es macht
keinen Unterschied, ob Jemand eine complete
Ladung gehapt hat, oder ob die Ladung nicht voll
gewesen ist. H
scht, da im allgemeinen der
Grundsatz gilt, daß durch diese 2 Sch.
Lastengeld 2 Ladungen frey werden. Es macht
keinen Unterschied, ob Jemand eine complete
Ladung gehapt hat, oder ob die Ladung nicht voll
gewesen ist. H
 tte der Schiffer
tte der Schiffer
a. aber nur eine Ladung auf den Boden seines
Schiffes gehapt, so erh
 lt er von den 2 Sch. Lastengeld
nichts zur
lt er von den 2 Sch. Lastengeld
nichts zur
 ck,
ck,
b. gar keine Ladung auf dem Boden seines Schiffes
gehapt und w
 re er also mit Ballast
ausgegangen, und [ohne] erhaltene Fracht mit
Ballast zurückgekommen, so werden ihm die 2 Sch.
Lastengeld zur
re er also mit Ballast
ausgegangen, und [ohne] erhaltene Fracht mit
Ballast zurückgekommen, so werden ihm die 2 Sch.
Lastengeld zur
 ckgegeben.
ckgegeben.
c. F
 r jede Ladung, welche er mehr wie
2 auf den Boden seines Schiffes gehapt hat,
zahlet er bey seiner Zuhausekunft 1 Sch. Lastengeld.
r jede Ladung, welche er mehr wie
2 auf den Boden seines Schiffes gehapt hat,
zahlet er bey seiner Zuhausekunft 1 Sch. Lastengeld.


|
Seite 141 |




|
Wer nach Stettien, innerhalb Bornholm, innerhalb
des Sundes, innerhalb der beyden Belten oder bis
L
 beck, jedoch nicht weiter als bis
Holtenau eine Reise macht, wird als K
beck, jedoch nicht weiter als bis
Holtenau eine Reise macht, wird als K
 stenfahrer angesehen und bezahlet
die H
stenfahrer angesehen und bezahlet
die H
 lfte des Lastengeldes mithin bey
seinem Abgange von hier 1 Sch. per Last, und
f
lfte des Lastengeldes mithin bey
seinem Abgange von hier 1 Sch. per Last, und
f
 r eine etwanige weitere als die
zweyte Ladung 1/2 Sch. pro Last.
r eine etwanige weitere als die
zweyte Ladung 1/2 Sch. pro Last.
Alle Zahlungen, welche 16 Sch. oder dar
 ber betragen, m
ber betragen, m
 ssen in N
2
/
3
bezahlet werden und es wird pommersches Curant
nur auf Summen angenommen, welche unter 16 Sch. betragen.
ssen in N
2
/
3
bezahlet werden und es wird pommersches Curant
nur auf Summen angenommen, welche unter 16 Sch. betragen.
Die Gesellschaft beh
 lt es sich vor dieses Lastengeld
zu erhöhen und zu erniedrigen oder auf eine
Zeitlang ganz abzuschaffen.
lt es sich vor dieses Lastengeld
zu erhöhen und zu erniedrigen oder auf eine
Zeitlang ganz abzuschaffen.
§ 11. Die Mitglieder des Schonenfahrer=Gelags
bestimmen j
 hrlich durch Stimmenmehrheit, ob
ein Fastelabend gehalten werden soll und wird es
dieserhalb bey der bisherigen Ueblichkeit
bleiben. In derjenigen Zusammenkunft, worin
hrlich durch Stimmenmehrheit, ob
ein Fastelabend gehalten werden soll und wird es
dieserhalb bey der bisherigen Ueblichkeit
bleiben. In derjenigen Zusammenkunft, worin
 ber den Fastelabend beschlossen
wird, werden diese Statuten verlesen.
ber den Fastelabend beschlossen
wird, werden diese Statuten verlesen.
§ 12. Wenn der administrirende Aelteste die
Mitglieder fodern l
 ßt, so sind selbige verpflichtet
sich zur angesagten Zeit einzufinden, und wenn
wichtige Sachen zur Besprechung und
Beschlußnahme vorzutragen sind, so ist der
administrirende Aelteste berechtigt bey 4 Sch.
Straffe fodern zu lassen. Als zul
ßt, so sind selbige verpflichtet
sich zur angesagten Zeit einzufinden, und wenn
wichtige Sachen zur Besprechung und
Beschlußnahme vorzutragen sind, so ist der
administrirende Aelteste berechtigt bey 4 Sch.
Straffe fodern zu lassen. Als zul
 ssige Entschuldigung gelten nur
Krankheit, Abwesenheit, Noth= und Ehrenf
ssige Entschuldigung gelten nur
Krankheit, Abwesenheit, Noth= und Ehrenf
 lle, wohin Hochzeit, Kindtaufe,
Wochenbett der Frau, Begr
lle, wohin Hochzeit, Kindtaufe,
Wochenbett der Frau, Begr
 bniß eines Anverwandten geh
bniß eines Anverwandten geh
 ren, entschuldigen auf 8 Tage,
L
ren, entschuldigen auf 8 Tage,
L
 schen und Laden seines Schiffes,
anderweitige gleichzeitige Gesch
schen und Laden seines Schiffes,
anderweitige gleichzeitige Gesch
 fte, welche nicht ausgesetzet
werden k
fte, welche nicht ausgesetzet
werden k
 nnen.
nnen.
Wer einen solchen Entschuldigungs=Grund für sich
nicht anf
 hren kann und gleichwohl
ausbleibt, wenn bey Strafe gefodert ist, muß 4
Sch. Strafe bezahlen und außerdem dem Bothen für
die Eincassirung 1 Sch. geben.
hren kann und gleichwohl
ausbleibt, wenn bey Strafe gefodert ist, muß 4
Sch. Strafe bezahlen und außerdem dem Bothen für
die Eincassirung 1 Sch. geben.
§ 13. In allen Zusammenkünften haben gesammte
Mitglieder des Schonenfahrer=Gelags sich
fernerhin eben so ruhig und anständig zu
betragen, wie dies bisher der Fall gewesen ist.
Sollte es sich gegen alle Erwartung ereignen,
daß Jemand sich auf eine unpassende Weise in den
Versammlungen betr
 ge, so ist das Regiment
berechtigt, ihn um 8 Sch., h
ge, so ist das Regiment
berechtigt, ihn um 8 Sch., h
 chstens 16 Sch. zu straffen.
Sollte eine Vorkommenheit eine gr
chstens 16 Sch. zu straffen.
Sollte eine Vorkommenheit eine gr
 ßere Straffe nach sich ziehen, so
ist gerichtliche Einleitung n
ßere Straffe nach sich ziehen, so
ist gerichtliche Einleitung n
 thig. Die Strafgelder fallen zur
H
thig. Die Strafgelder fallen zur
H
 lfte der Witwencasse anheim.Jedes
Mitglied wird nach wie vor sich befleißigen
durch Ruhe und Ordnung in den Versammlungen der
Gesellschaft Ehre zu machen.
lfte der Witwencasse anheim.Jedes
Mitglied wird nach wie vor sich befleißigen
durch Ruhe und Ordnung in den Versammlungen der
Gesellschaft Ehre zu machen.


|
Seite 142 |




|
§ 14. Die Propositionen des administrirenden
Aeltesten werden, so oft dies angehet, auf eine
Frage gestellet, welche mit Ja und Nein
beantwortet werden kann, und dann der Reihe nach
durch Striche auf dem Brette für Ja und Nein
gestimmet. Bey Wahlen wird per Schedulas
gestimmet Er[fordert]
1
) ein
Gegenstand eine n
 here Besprechung und Ueberlegung,
so stehet es allerdings einem jeden Mitgliede
frey seine Meinung und Ansichten vorzutragen,
wozu jeder in der Reihenfolge aufgefordert wird,
worin er im Eingange des Protokolls aufgef
here Besprechung und Ueberlegung,
so stehet es allerdings einem jeden Mitgliede
frey seine Meinung und Ansichten vorzutragen,
wozu jeder in der Reihenfolge aufgefordert wird,
worin er im Eingange des Protokolls aufgef
 hret ist. Es gilt allenthalben
Stimmenmehrheit und die abwesenden Mitglieder
sind an den gefaßten Beschl
hret ist. Es gilt allenthalben
Stimmenmehrheit und die abwesenden Mitglieder
sind an den gefaßten Beschl
 ssen gebunden. Wenn ein Mitglied
im Auslande oder sonst etwas erf
ssen gebunden. Wenn ein Mitglied
im Auslande oder sonst etwas erf
 hrt, was zur gr
hrt, was zur gr
 ßern Aufnahme und Nutzen des
Gelages gereichen kann, so ist er verpflichtet
dies dem administrirenden Aeltesten anzuzeigen
und berechtigt dieserhalb einen Vortrag an die
Gesellschaft bei der n
ßern Aufnahme und Nutzen des
Gelages gereichen kann, so ist er verpflichtet
dies dem administrirenden Aeltesten anzuzeigen
und berechtigt dieserhalb einen Vortrag an die
Gesellschaft bei der n
 chsten Zusammenkunft zu halten.
chsten Zusammenkunft zu halten.
§ 15. Jeder Schiffer mit Ausnahme der K
 stenfahrer, der mit Musterrolle
f
stenfahrer, der mit Musterrolle
f
 hrt, ist es bey 1 Rthlr. Strafe
durchaus verboten dem Schiffsvolke mehr Heuer zu
geben oder sonst andre Bedingungen zuzugestehen,
wie in der Musterrolle aufgeführet sind.
hrt, ist es bey 1 Rthlr. Strafe
durchaus verboten dem Schiffsvolke mehr Heuer zu
geben oder sonst andre Bedingungen zuzugestehen,
wie in der Musterrolle aufgeführet sind.
§ 16. Kein Schiffer darf dem andern sein Schiffsvolk abwendig machen.
§ 17. Kein Schiffer darf seinen Namen dazu
hergeben, daß ein Schiff auf seinen Namen
ausclariret und hern
 chst von einem andern, der noch
nicht Schiffer und Mitglied des Gelages ist,
chst von einem andern, der noch
nicht Schiffer und Mitglied des Gelages ist,
 ber See gebracht werde.
ber See gebracht werde.
§ 18. Die geringf
 gigen Ausgaben des Regiments bey
den Versammlungen f
gigen Ausgaben des Regiments bey
den Versammlungen f
 r Pfeifen, Taback, Bier, werden
aus der Gelagscasse bestritten.
r Pfeifen, Taback, Bier, werden
aus der Gelagscasse bestritten.
§ 19. Da oftmalen der Fall vork
 mmt, daß Jemand entweder von den
Aeltesten oder nach Beschaffenheit der Sache von
den Aeltesten und Deputirten, ein Erachten
mmt, daß Jemand entweder von den
Aeltesten oder nach Beschaffenheit der Sache von
den Aeltesten und Deputirten, ein Erachten
 ber einen einzelnen Fall begehret,
so werden die deßfallsigen Kosten für ein
Erachten der Aeltesten zu 2 Rthlr. 28 Sch. und
Deputirten aber um 10 Sch. h
ber einen einzelnen Fall begehret,
so werden die deßfallsigen Kosten für ein
Erachten der Aeltesten zu 2 Rthlr. 28 Sch. und
Deputirten aber um 10 Sch. h
 her f
her f
 r jeden anwesenden Deputirten
hiedurch festgesetzet. W
r jeden anwesenden Deputirten
hiedurch festgesetzet. W
 re aber der zum Erachten
aufgestellte Fall so umst
re aber der zum Erachten
aufgestellte Fall so umst
 ndlich; und verwickelt, daß eine
besondere Auseinandersetzung nothwendig w
ndlich; und verwickelt, daß eine
besondere Auseinandersetzung nothwendig w
 rde, so sind die deßfallsigen
Kosten nach Verh
rde, so sind die deßfallsigen
Kosten nach Verh
 ltniß auch gr
ltniß auch gr
 ßer. F
ßer. F
 r die Verzehrung in solchen
Zusammenk
r die Verzehrung in solchen
Zusammenk
 nften darf der Gelagscasse nichts
berechnet werden.
nften darf der Gelagscasse nichts
berechnet werden.


|
Seite 143 |




|
§ 20. Es sollen diese Statuten noch nicht bey E.
E. Rathe zur Confirmation eingereicht werden,
weil die Gesellschaft zuvor durch die Erfahrung
davon sich
 berzeugen will, daß selbige
zweckm
berzeugen will, daß selbige
zweckm
 ßig und vollst
ßig und vollst
 ndig sind, folglich keiner Ab
ndig sind, folglich keiner Ab
 nderung bed
nderung bed
 rfen, und es ist festgesetzet, daß
derjenige Schiffer, welcher w
rfen, und es ist festgesetzet, daß
derjenige Schiffer, welcher w
 hrend vier Jahre seine Beytr
hrend vier Jahre seine Beytr
 ge an die einzelnen Cassen
verweigert, f
ge an die einzelnen Cassen
verweigert, f
 r sich und respective f
r sich und respective f
 r seine Wittwe kein Mitglied
solcher Casse weiter bleibt, sondern von solcher
Casse ausgeschlossen wird.
r seine Wittwe kein Mitglied
solcher Casse weiter bleibt, sondern von solcher
Casse ausgeschlossen wird.
Rostock den 10. Januar 1825.
C. F. Koch. Jacob Maack
Aeltesten des Schonenfahrer=Gelags.
Eintrittsgelder eines jungen Schiffers:
| 1. | Klasse | 17 | Rthlr. | N 2 / 3 |
| 2. | " | 26 | " | " |
| 3. | " | 49 | " | " |
| 4. | " | 26 | " | " |
| 1. | Klasse: |
Schifferssohn oder Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
| 2. | " |
Inl
 nder, der nicht
Schifferssohn und nicht Br
nder, der nicht
Schifferssohn und nicht Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
| 3. | " |
Ausl
 nder (Verord. 13. Aug. 1810).
nder (Verord. 13. Aug. 1810).
|
| 4. | " |
der Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
Nach erneuerten Statuten:
| 1. | Klasse | 9 | Thlr. | 40 | Sch. | Courant |
| 2. | " | 30 | " | 16 | " | " |
| 3. | " | 58 | " | 16 | " | |
| 4. | " | nicht angegeben. | ||||