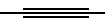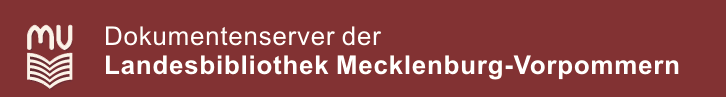|
[ Seite 19 ] |




|



|
|
:
|
II.
Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse
in
der Travemünder Bucht
von
Werner Strecker.


|
[ Seite 20 ] |




|
Viertes Gutachten des Mecklenburg=Schwerinschen Geheimen und Haupt=Archivs vom 12. Mai 1927 für das Mecklenburg=Schwerinsche Ministerium des Innern.
Inhalt.
- Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer
- Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs
- Fischerei und Strandrecht
Exkurs. Zum Meeresfischereiregal in Preußen
Anhang. (Zu den Exkursen a - d bei Rörig III, S. 29 ff.)


|
Seite 21 |




|
In unserem Gutachten vom 15. Dezember 1926 sind wir nur auf den Teil des letzten Rörigschen Gutachtens (vom 24. Juni 1926) eingegangen, der von der Travemünder Reede und ihren Grenzen handelt. Wir kommen jetzt, wie wir uns vorbehalten hatten, auf die übrigen Ausführungen Rörigs zurück, wobei wir auch sein vorletztes Gutachten vom 6. Juli 1925 gelegentlich streifen werden 1 ).
I. Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer.
Vorweg haben wir zweierlei zu bemerken:
Rörig hat die Meinung ausgesprochen, daß unsere Untersuchungen über das Hoheitsrecht am Küstengewässer der Ostsee sich allzu weit von dem eigentlichen Streitgegenstande entfernten, und wir entnehmen aus seinen Worten den Vorwurf, daß die Durchführung des Prozesses auf diese Weise erschwert werde 2 ). Wir brauchen uns hiergegen kaum zu verteidigen. Unsere Forschung war notwendig, weil sie für die spezielle Untersuchung der Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht die Voraussetzung bildet.
Ferner glaubt Rörig einen Widerspruch zwischen unseren Ausführungen in Archiv II und dem ersten Gutachten Langfelds feststellen zu können 3 ). Dies im einzelnen zurückzuweisen, wird gleichfalls nicht nötig sein. Ebenso wenig wie Rörig selbst haben wir es als unsere Aufgabe betrachten können, ein "Rechtsgutachten im engeren Sinne des Wortes" abzugeben 4 ). Und schon


|
Seite 22 |




|
Langfeld hat in seinem zweiten Gutachten zutreffend erklärt, daß seine und unsere Darlegungen sich nicht widersprechen, sondern ergänzen 5 ).
~~~~~~~~~
Den Nachweis, daß den mecklenburgischen Fürsten im Mittelalter ein Hoheitsrecht über das Meer an ihrer Küste und also auch an der Uferstrecke Priwall-Harkenbeck zugestanden habe, sucht Rörig 6 ) hauptsächlich mit den folgenden beiden Einwürfen zu bekämpfen:
- Die hierin von uns und v. Gierke vertretene Ansicht beruhe auf Analogieschlüssen.
- Die Urkunden, auf die wir uns stützen, seien dispositiver Art, nicht Beweisurkunden. Der Beweiswert dispositiver Urkunden werde aber dadurch verringert, "daß man im Mittelalter oft die Form eines Privilegs wählte, wo es sich in Wirklichkeit nur um die Legalisierung und Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte", sowie auch durch "das Überwuchern des Formelhaft-Schematischen in der äußeren Form der Urkunden" herabgesetzt.
Wir erwidern:
zu 1) Wenn für die ganze deutsche Ostseeküste einschließlich der mecklenburgischen eine Fülle von Material vorliegt, woraus ein landesherrliches Regal am Küstengewässer, im besonderen auch das Fischereiregal hervorgeht, so ist der Schluß, daß es sich hier um ein durchgängiges Recht handelte, und daß nicht etwa das Gewässer vor der 3 1/2 km langen Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck davon ausgenommen war, zwingend und kein Analogieschluß im eigentlichen Sinne. Niemand kann annehmen, daß den Landesherren dieses Recht an einzelnen Teilen der Küste zustand, an anderen dagegen nicht. Unser Schluß ist um so zwingender, als wir durch Quellen aus späterer Zeit nachgewiesen haben, daß Mecklenburg die Strandgerechtigkeit an der strittigen Küstenstrecke besaß. Unter der Strandgerechtigkeit aber verstand man die Hoheit über das Küstengewässer (vgl. besonders Archiv II, S. 84 f.).
zu 2) Was Rörig hier äußert, trifft nicht den Kern der Sache. sondern geht um ihn herum. Die Gegenüberstellung von Beweisurkunde und dispositiver Urkunde wirkt an dieser Stelle ver-


|
Seite 23 |




|
wirrend. Freilich meint Rörig nicht die Beweisurkunde im engeren Sinne der Urkundenlehre, sondern er meint Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge. Die Beweiskraft der dispositiven Urkunde oder Geschäftsurkunde steht außer Zweifel. Allerdings sind die von uns vorgebrachten Urkunden nicht ausgestellt worden, um das landesherrliche Meeresregal zu beweisen, sondern um ein Beweismittel für die durch die Urkunden vollzogenen Verleihungen zu schaffen. Für diese aber ist das Regal die Voraussetzung. Die Erwägungen Rörigs über die Art, wie Privilegien als Erkenntnisquelle zu werten sind, würden am Platze sein, wenn es uns darauf angekommen wäre, die Entwicklung der Seefischerei an der Ostseeküste zu untersuchen. Hätten wir unsere Arbeit hierauf gerichtet, so möchte im einzelnen, soweit das überhaupt möglich ist, zu prüfen sein, ob es sich bei diesem oder jenem Fischereiprivileg um die "Anerkennung eines bestehenden Zustandes" handelte und wie weit sich Seefischerei ohne Privileg gewohnheitsmäßig ausgebildet hat 7 ). Unsere Verwertung der Privilegien aber liegt in ganz anderer Richtung. Aus den landesherrlichen Verleihungen schließen wir auf das Recht der Landesherren, diese Verleihungen vorzunehmen, also auf Grund eines Regals zu handeln. Dieser Schluß ist bei der Fülle des vorliegenden Materials unbedingt zwingend.
Ist aber hiermit die Art des Ergebnisses festgestellt, das wir aus den Privilegien gewonnen haben, so weichen auch die Stützen, die Rörig (III, S. 58, Anm. 13) sich nutzbar machen will. Der von ihm angezogene Satz v. Belows trifft ja auf unsere Beweisführung gar nicht zu. Und wenn H. Hirsch in seinem Buche über die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter 8 ) auseinandersetzt, daß sich die Fortbildung von Immunitätsgerichten unabhängig von den Immunitätsdiplomen vollzog - eine Entwicklung, die nach Hirsch unter dem Einflusse bestimmter staatlicher und sozialer Verhältnisse und auf der Grundlage besonderer Rechtszustände vor sich ging, aber nicht durchgängig war -, so ist doch damit nicht gesagt, daß Rechte nicht aus Privilegien entstehen können - was in tausend Fällen geschehen ist -, und daß aus den Privilegien keine Schlüsse auf Hoheitsrechte der Aussteller


|
Seite 24 |




|
dieser Urkunden zu ziehen seien 9 ). Ebensowenig ist der Ausspruch Sombarts, wonach die Verordnung nicht das Leben schafft, auf unsere Beweisführung anwendbar. Die treibenden Kräfte für die Seefischerei liegen natürlich nicht in den Privilegien. Durch Privilegien aber konnte die Fischerei gefördert und von Abgaben entlastet werden.
Wenn man früher die Wirkung von Privilegien überschätzt hat, so darf man heute jedenfalls nicht in den gegenteiligen Fehler verfallen. Man kann auch nicht sagen, daß sich in den Urkundenstellen, die v. Gierke und wir herangezogen haben, ein "Überwuchern des Formelhaft-Schematischen" bemerkbar mache. Sie unterscheiden sich ja vielfach in dem, was sie gewähren, und die verschiedentlich darin enthaltenen besonderen Bestimmungen bilden zugleich Zeugnisse über "tatsächliche Vorgänge". Wir verweisen hier auf das Gesamtergebnis aus den Urkunden, das v. Gierke (Jb. 90, S. 56) festgelegt hat. In einzelnen Fällen ist geradezu nachweisbar, daß es sich bei der Verleihung von Seefischerei nicht nur um die Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte, sondern daß das Privileg das Primäre war 10 ). Schließlich übersieht Rörig


|
Seite 25 |




|
ganz, daß wir die Rechtsverhältnisse am rügischen Außenstrande bis ins 17. Jahrhundert 11 ), am mecklenburgischen Strande bis ins 18. Jahrhundert 12 ) verfolgt haben. Und hier handelt es sich ja überall um Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge und Zustände. Der Rechtszusammenhang aber zwischen diesen Zuständen und den aus den mittelalterlichen Quellen zu erschließenden ist ganz unabweisbar.
Aus den vorgebrachten Urkunden wählt Rörig (III, S. 62) einige aus, die seine Ansicht bestätigen sollen, daß Rechte an Meeresteilen zunächst von den an den Unterläufen von Flüssen gelegenen Städten ausgebildet seien. Er erwidert aber nicht auf die Ausführungen v. Gierkes (S. 13 f.), der diese Ansicht Rörigs bereits auf Grund des übrigen Materials widerlegt hat.
Zu den weiteren Einwürfen Rörigs bemerken wir noch: Seine Interpretation (III, S. 59, Anm. 14 ) der wichtigen pommerschen Urkunde von 1265 für das Kloster Dargun 13 ) ist unrichtig. Es handelt sich um die Worte: in mari salso terre nostre dominio adiacenti. Wir haben darauf aufmerksam gemacht 14), daß adiacere in der Urkundensprache im Sinne von pertinere gebraucht wurde 15 ), sich also auf ein Zubehör bezieht, ferner daß adiacenti zu dominio, der Herrschaft als Begriff, gehört. Demgemäß haben wir so wörtlich wie möglich übersetzt: in der zu unserer Landesherrschaft belegenen, ein Zubehör unserer Landesherrschaft bildenden salzigen See. Diese Übersetzung deckt sich dem Sinne nach mit der v. Gierkes (S. 52, Anm. 57): "in dem Salzmeere, das unserer Landesherrschaft zugehört". Wenn Rörig diese Übersetzung v. Gierkes für "eine willkürliche Vergewaltigung des Textes" erklärt 16 ), so ist dem zu entgegnen, daß seine eigene Auslegung ("in dem Salzmeere, das an das Herrschaftsgebiet unseres Landes angrenzt") das Entscheidende unberücksichtigt läßt. "Das Salzmeer als solches," so sagt er, sei "in der Urkunde mit aller Deutlichkeit als nicht zum Herrschafts-


|
Seite 26 |




|
bereich des Landesherrn gehörig gekennzeichnet." Merkwürdig, daß der Landesherr trotzdem Fischereigerechtigkeit in eben diesem Salzmeere erteilt 17 ). Auf verschiedene andere Urkundenstellen, die ebenfalls die Herrschaft über das Küstengewässer geradezu aussprechen, geht Rörig nicht ein. Er hat auch auf unseren Nachweis, daß für die Küstenfischerei vormals Abgaben erhoben wurden, nichts Stichhaltiges erwidert 18 ).
Zusammenfassend können wir sagen, daß Rörig unsere Beweisführung auch dort nicht erschüttert hat, wo er überhaupt versucht hat, sie anzugreifen.
~~~~~~~~~


|
Seite 27 |




|
In seinem ersten Gutachten (I, S. 44 f.) hat Rörig gesagt, daß sich eine Herrschaft Lübecks auf der Reede durch Okkupation ausgebildet habe, wenn sie nicht unmittelbar aus dem Barbarossaprivileg erwachsen sei. Diese Alternative kann man nicht aufstellen. Gesetzt nämlich den Fall, daß sich die bekannten Worte des Privilegs: "licebit . . piscari . . usque in mare" nicht nur auf Binnenfischerei, sondern auch auf Seefischerei bezögen, so wäre ja damit den Lübeckern nur ein Recht zum Fischfang bestätigt worden, das sie nach Angabe der Urkunde schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten. Sie würden keinerlei Fischereiregal erlangt haben, sondern nur eine bloße Nutzung, wie die lübischen Fischer sie bis auf den heutigen Tag tatsächlich ausgeübt haben. Eine Herrschaft, d. h. eine Gebietshoheit über das strittige Gewässer müßte also in jedem Falle auf andere Weise entstanden sein. Das Privileg könnte sie auch dann nicht begründet haben, wenn Rörigs Auslegung richtig wäre.
Nun aber hat ja Rörig seine These von der Entstehung der Lübecker Gebietshoheit vor der Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck auf der - a priori und ohne weitere Prüfung gebildeten - Vorstellung aufgebaut, daß es im Mittelalter keine landesherrliche Meereshoheit gegeben habe. Da die Irrigkeit dieser Vorstellung nachgewiesen ist, fällt selbstverständlich die Möglichkeit eines Erwerbes durch Okkupation im Rechtssinne weg 19 ). Viel schwieriger aber als die Okkupation eines herrenlosen Gebietes ist die Entstehung einer Gebietshoheit auf gewohnheitsrechtlichem Wege oder durch Unvordenklichkeit, weil hier mit den Ansprüchen und dem Widerstande des rechtmäßigen Herrn gerechnet werden muß.
Rörig, der immer noch an der Möglichkeit einer Okkupation festhalten möchte, klammert sich daran, daß wir für die Strecke Priwall-Harkenbeck keine besonderen Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgelegt hätten. Hat denn aber er selber für die angebliche Lübecker Gebietshoheit Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgebracht? Nicht eines! Die von ihm angezogenen Quellen beginnen im 16. Jahrhundert. Für eben dieses Jahrhundert ist aber bereits die mecklenburgische Ausübung des Bergerechtes an der Strecke Priwall-Harkenbeck belegt 20 ). Das Bergerecht aber galt als


|
Seite 28 |




|
Zeichen für die Hoheit über das Küstengewässer 21 ). Wir erinnern auch an den Fall von 1516, in dem sich die Herzöge gegen einen Übergriff des Travemünder Vogtes in ihre Strandhoheit verwahrten 22 ). Sodann sind aus den Jahren 1616 und 1618 Beweise dafür vorhanden, daß eine mecklenburgische Fischerei vor der strittigen Küstenstrecke seit über Menschengedenken, also sicher schon im 16. Jahrhundert bestand 23 ). Es ist eine durchaus unzutreffende Behauptung Rörigs, daß die ältesten Zeugnisse über Ausübung von Hoheitsrechten vor der Strecke Priwall-Harkenbeck "mit aller Deutlichkeit für Lübeck, nicht für Mecklenburg" sprächen 24 ). Die ältesten Quellen, die über den Strandrechtsfall von 1516, sprechen nicht für Lübeck. Denn wenn wirklich die eine der beiden Schuten bei Rosenhagen geborgen war, so handelt es sich unbedingt um einen Übergriff des Travemünder Vogtes. Das würde sich nicht nur daraus ergeben, daß Lübeck in seiner Erwiderung auf die Beschwerde es vermied, den Ort Rosenhagen zu nennen 25 ), sondern vor allem daraus, daß Lübeck späterhin niemals die mecklenburgische Strandhoheit vor Rosenhagen angezweifelt, sondern beim Fischreusenstreit ausdrücklich zugegeben hat 26 ). Für das Mittelalter aber läßt sich überhaupt nichts feststellen außer der landesherrlichen Hoheit über das Küstengewässer, von der die kleine Strecke Priwall-Harkenbeck nicht ausgenommen sein konnte.
~~~~~~~~~
II. Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs.
Will man die Worte usque in mare erklären, so ist man auf "vergleichende Stilkritik" angewiesen. Und wenn eine solche Fülle gleichartigen Materials vorgelegt werden kann, wie es von uns geschehen ist, - ein Material, das sich gewiß sehr vermehren ließe 27 ) -, so ist die Stilkritik kein so schwaches Mittel der


|
Seite 29 |




|
Urkundenforschung, wie Rörig (III, S. 64) meint. Er selber hat mit dieser Kritik begonnen, aber auf ganz unzureichender Grundlage 28 ). Nun bemerkt er, daß wir unser Material "nach der ganz zufälligen Anwendung der Worte ,usque in' im Sinne von ,usque ad' zusammengesucht" hätten. Indessen steht das "usque in" im Barbarossaprivileg in einer Grenzangabe, und lauter Grenzangaben sind es, die wir zur Vergleichung herangezogen haben. Er macht ferner darauf aufmerksam, daß vorher in dem Privileg die Worte vorkommen: usque ad villam Odislo, übersieht aber, daß es an anderer Stelle der Urkunde wiederum heißt: usque in Radagost. Wir haben ja gerade (Archiv II, S. 94) hervorgehoben, daß "usque ad" und "usque in" überall in derselben Bedeutung gebraucht wurden.
Für seine eigene sogenannte "vergleichende Stilkritik" glaubt Rörig die Urkunden "unter dem "Gesichtspunkt, daß in ihnen dieselbe Materie zu ordnen war", herangezogen zu haben. Aber es liegt auf der Hand, welche Verwirrung er hierbei anrichtet. In den drei Urkundenstellen, die ihm durch v. Gierke und uns bekannt worden sind und die er III, S. 64 f., bespricht, kommt ja das usque in überhaupt nicht vor. Wie kann man denn in dem Privileg für Treptow an der Rega von 1309 bei der Begrenzung "usque ad spatium miliaris unius in ipsum mare salsum" die Worte "usque" und "in ipsum mare salsum" durch Fettdruck hervorheben, als ob sie zusammengehörten 29 ). Genau so hat Rörig in dem Privileg für Rostock von 1252 das usque, das zu "Warnemunde" gehört, mit den Worten "in marinis fluctibus" in Verbindung gebracht 30 ). Er meint jetzt, wenn es in der Rostocker Urkunde heiße, "daß das beneficium piscature sich erstrecken soll: usque Warnemunde necnon extra portum in marinis fluctibus", so komme das "auf dasselbe hinaus, als wenn es auch für Rostock geheißen hätte: usque in mare". Eben nicht, sondern das "usque in mare" der Barbarossa-Urkunde ist nur mit dem "usque Warnemunde" des Rostocker Privilegs vergleichbar. Es hätte in diesem Privileg gerade so gut gesagt werden


|
Seite 30 |




|
können: per alveum fluminis Warnowe usque in mare necnon extra portum Warnemunde in marinis fluctibus.
Schließlich das Privileg für Schleswig von 1480: "wenthe an dat gemeyne Meer ofte solte See enen Wecke Sees buthen Schlyes Munde". Hier erführen wir nach Rörig, "daß, selbst wenn man sagte: bis ans Meer, damit in Wirklichkeit eine Verleihung bis weit ins Meer gemeint sein" könne. Indessen ist hier zwischen dem "gemeinen" Meere, das natürlich keiner Herrschaft unterworfen war, und dem Küstengewässer zu unterscheiden. Die Stelle ergibt ja deutlich, daß sich das Nutzungsrecht der Stadt nur bis ans gemeine Meer erstrecken sollte, nicht - wie sich von selbst verstand - in dieses hinein. Wir erfahren also, daß das Küstengewässer bis auf eine "Wecke Sees" (Meile) in Anspruch genommen wurde, ebenso wie in dem Privileg für Treptow von 1309 bis auf eine Meile. Demgegenüber ist die Ausdehnung der Meereshoheit bis zur schiffbaren Tiefe, wie sie 1616 im Fischreusenstreit von Mecklenburg vertreten wurde, sehr bescheiden. - In Wirklichkeit hat Rörig an dem "usque im mare" gar keine vergleichende Stilkritik geübt, sondern behauptet, daß Lübeck 1188 Meeresnutzung habe erhalten müssen, weil sie später anderen Städten zuteil wurde. Er begibt sich also selber auf den "Treibsand" eines Analogieschlusses, der hier allerdings als "trügerisch" bezeichnet werden muß; denn Privilegien können sich ja von einander unterscheiden. Ganz etwas anderes ist es, einen Schluß auf die landesherrliche Hoheit über das Küstengewässer vor der Strecke Priwall-Harkenbeck zu ziehen, weil die überall festgestellte Herrschaft über das Küstengewässer unbedingt durchgängig gewesen ist.
Dann wendet sich Rörig (III, S. 67 f.) gegen unsere Verwertung des Berichtes, den die Chronik Arnolds von Lübeck über das Barbarossaprivileg erstattet 31 ). Dieser Bericht soll "in der Hauptsache gar nicht auf den jetzt strittigen Satz über das Fischereirecht" passen, sondern auf "den ihm vorgehenden über Holz und Weidenutzungen". Hier sei bei Arnold und dem Privileg "die wirkliche Parallele vorhanden". Indessen liegt diese Parallele keineswegs nur in den Angaben über Holz- und Weidenutzung; sie liegt auch in der Gewährung von Fischerei. Es ist unvollständig, wenn Rörig angibt, daß der Streit um "pascua" ging, und daß auch Arnold das sage. Denn nach Arnold nahm der Streit seinen Ausgang von dem Travemünder Zoll und dehnte sich dann auf alle Nutzbarkeiten (quicquid commoditatis) aus, die Adolf von Holstein den Lübeckern - weil sie den Zoll nicht zahlen


|
Seite 31 |




|
wollten - nahm. Arnold faßt diese Nutzbarkeiten kurz zusammen. Es sind nach ihm Nutzungen in fluviis (also Fischerei), in pascuis, in silvis. Dann kaufen die Lübecker sich auf des Kaisers Vermittlung vom Zolle los, zahlen auch Geld für die Weidegerechtigkeit, erhalten aber die Gesamtheit der Nutzbarkeiten zurück: et sic a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis, pascuis, silvis. Die Begrenzung "a mari usque Thodeslo" schließt selbstverständlich Meeresfischerei aus. Wenn also die bekannten Worte des Barbarossaprivilegs schon nach dem Ergebnisse der vergleichenden Stilkritik nur "bis zum Meere" bedeuten können, so wird dies durch Arnolds Bericht um so gewisser.
Was Rörig demgegenüber aus der von Arnold mitgeteilten Vorgeschichte des Privilegs ableiten will, ist völlig verfehlt. Er versucht jetzt, die Worte usque in mare auf den Travemünder Zollstreit zurückzuführen. Von dem Zoll, den Graf Adolf von Holstein gefordert habe, seien ja auch die Lübecker Fischer betroffen worden, und so hätten denn "die Störungen unmittelbar am Ausgang zur See" die Veranlassung gegeben, daß das alte Gewohnheitsrecht der Fischerei, das die Lübecker schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten, "jetzt auch urkundlich festgelegt wurde". Die Worte usque in mare sollen daher bedeuten: "abgabefrei bis ins Meer hinein". "Sie können," so sagt Rörig, "unter diesen Umständen nicht nur ,bis ins Meer' bedeutet haben, sie müssen es vielmehr." Immer vorausgesetzt natürlich, daß die Lübecker damals schon Seefischerei betrieben (was gar nicht bewiesen ist) und daß die Meinung, es habe die Befreiung von dem Travemünder Zoll ausgesprochen werden sollen, richtig ist. Rörig merkt nicht, daß er sich im Zirkel dreht; seine Folgerung ist zugleich seine Voraussetzung. Auch hätte sichs dann ja gar nicht um Verleihung von Meeresfischerei, sondern um Verleihung von Zollfreiheit gehandelt.
Wo aber, fragen wir, steht an dieser Stelle des Privilegs ein Wort von Zoll oder Abgaben? Es heißt einfach: licebit . . piscari. Hätte hier die Ursache des Streites zwischen Lübeck und dem Grafen Adolf getroffen werden sollen, so würde dies doch natürlich deutlich gesagt sein. Überdies heißt es, daß die Lübecker usque in mare fischen dürften, "sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt". Zur Zeit des Herzogs Heinrich war ja aber gerade der Travemünder Zoll gezahlt worden. Arnold berichtet ausdrücklich, daß Graf Adolf den Lübeckern dies entgegengehalten habe 32 ). Sie hätten erwidert, es sei nicht de iure geschehen,


|
Seite 32 |




|
sondern sei auf Zeit und zur Erhaltung des Kastells Travemünde gewährt worden, weil der Herzog darum ersucht habe 33 ). Wenn also usque in mare heißen würde: abgabenfrei bis ins Meer hinein, so würde dies durch den Zusatz (sicut . . consueverunt) wieder aufgehoben sein. Damit erledigt sich Rörigs vermeintliche Feststellung, daß "das vom Archivgutachten zur Debatte gestellte Material" (nämlich Arnolds Bericht) "bei gründlicher Interpretation" die "beste Stütze" für die Übersetzung "bis ins Meer" sei.
Der ganze Travemünder Zollstreit wird in dem Barbarossaprivileg gar nicht erwähnt. Das war auch nicht nötig. Arnold berichtet, daß Graf Adolf gegen Zahlung von 300 Mark Silbers auf die Zollerhebung verzichtete und auch für die Weidegerechtigkeit 200 Mark erhielt. Hierüber muß zwischen ihm und Lübeck ein besonderer Vertrag geschlossen sein, der in dem kaiserlichen Privileg nicht zum Ausdrucke zu kommen brauchte. Hätte man den Wegfall des Travemünder Zolles noch eigens in dem Privileg betonen wollen, so würde dies natürlich im Hinblick auf die Schiffahrt und den Warenhandel und an den Stellen der Urkunde geschehen sein, wo wirklich von Zollfreiheit die Rede ist, nicht aber im Hinblick auf eine angebliche Meeresfischerei, für die der Zoll viel geringere Bedeutung gehabt haben würde 34 ).
Von den weiteren Einwürfen Rörigs haben wir die Behauptung, daß die Waghenaersche Seekarte von 1586 eine Trave "bis ins Meer" verzeichne, schon in unserem letzten Erachten als ganz unhaltbar zurückgewiesen 35 ). Rörig geht noch ein auf unsere Bemerkung in Archiv II, S. 99: "Wo sollte der Kaiser auch Meeresfischerei verliehen haben? Der Strand gehörte zu jener Zeit sicher schon den anliegenden Territorialherren. . . . Wo sind Beispiele einer Verleihung von Seefischerei an der deutschen Küste durch den Kaiser?" Dem gegenüber verweist Rörig (III, S. 69) auf das Privileg Friedrichs II. für den deutschen Orden von 1226, das v. Gierke (S. 47) herangezogen hat. Es ist aber doch ein großer Unterschied, ob - wie in diesem Falle - eine gesamte


|
Seite 33 |




|
Landeshoheit verliehen wird oder eine Nutzung am Strande bereits beherrschter Territorien. Rörig fügt die Frage bei, wo denn Belege erbracht seien, daß die Territorialherren schon im 12. Jahrhundert über den Strand in einem Umfange zu verfügen gehabt hätten, daß dadurch eine Anerkennung von städtischen Nutzungen berührt würde, wie sie das Lübecker Privileg von 1188 seiner Meinung nach enthält. Soll man denn aber glauben, daß die Herrschaft über das Küstengewässer erst mit dem zufällig erhaltenen Urkunden beginnt? Für das 12. Jahrhundert hat sich doch nur dürftiges Material über die in Betracht kommenden Gebiete erhalten. Gerade für Mecklenburg aber haben wir die beiden Doberaner Privilegien von 1189 und 1192, deren rechtsgeschichtliche Bedeutung dadurch nicht getroffen wird, daß das eine falsch, das andere zweifelhaft ist 36 ). Viel später können beide Urkunden nicht geschrieben sein. Einfach annehmen, daß Friedrich Barbarossa sich 1188 über Rechte der Territorialherren hinweggesetzt habe, geht nicht an. Einer solchen Vermutung widerspricht auch sein Verhalten gegenüber Adolf von Holstein, mit dem er sich ja vor der Erteilung des Privilegs an Lübeck verständigte.
Schließlich aber sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß die bisherige, auch von uns in Archiv II vertretene Interpretation, wonach sich die Grenzangaben der strittigen Stelle in dem Barbarossaprivileg auf den Travelauf beziehen sollen, überhaupt verkehrt ist. Es fällt doch auf, daß die Trave gar nicht genannt wird; es heißt einfach: "piscari per omnia (überall) a . . villa Odislo usque in mare preter septa comitis Adolfi". Nun gibt es ja im Holsteinischen zwischen Oldesloe und dem Meere noch verschiedene Fluß- und Bachläufe, die sich in die Trave ergießen, und die Fischwehren des Grafen Adolf brauchen auch nicht nur auf der Trave bestanden zu haben. Es ist dabei zu bedenken, daß die Chronik Arnolds von "fluviis", also von einer Mehrheit von Wasserläufen spricht. Wenn in der Chronik gesagt wird: "a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis", so ist damit offenbar dasselbe gemeint, was das Barbarossaprivileg mit den Worten ausdrückt, daß die Lübecker überall von Oldesloe bis zum Meere fischen dürften, wie oder in dem Maße, wie sie es zur Zeit Heinrichs des Löwen gewohnt gewesen seien. Die "fluvii" bei Arnold würden also dem "per omnia" des Privilegs entsprechen 37 ). Dann aber ist klar, daß Oldesloe und


|
Seite 34 |




|
das Meer als Grenzbestimmungen für ein dazwischen liegendes Landgebiet des Grafen Adolf aufzufassen sind, worin den Lübeckern Binnenfischerei zustand 38 ). Daß diese Grenzbestimmungen das Gebiet nur ungenau bezeichnen, kann um so weniger stören, als auch die übrigen Grenzangaben des Privilegs ganz unklar sind. Auch würde ja der Hinweis auf die Verhältnisse zur Zeit Heinrichs des Löwen den Umfang der Lübecker Berechtigung festgelegt haben. Überdies gibt es noch eine dritte Quelle, die geradezu beweist, daß unsere Auslegung richtig ist. Wir meinen die von Rörig III, S. 18 erwähnte Bestimmung über Fischereigerechtigkeit, die sich in dem Privileg der Grafen von Holstein für Lübeck vom 22. Februar 1247 findet. Die Stelle lautet:
Preterea concedimus civitati in perpetuum in aquis nostris ius piscandi, exceptis nostris septis, que war (Wehr) dicuntur, secundum omnem consuetudinem et libertatem, quam ipsi Lubicenses in piscationibus nostris noscuntur hactenus habuisse 39 ).
Dieser Satz ist selbstverständlich nichts weiter als eine Bestätigung der umstrittenen Stelle des Barbarossaprivilegs. Es wird ja gar nichts Neues gewährt, sondern nur die alte Gewohnheit anerkannt. Und zwar handelt es sich hier nicht um die einzige Bestimmung des Barbarossaprivilegs, die in der Urkunde von 1247 bestätigt wird. Die Worte aber "in aquis nostris" können sich nicht allein auf den Travelauf beziehen. Sie beziehen sich auf Fischerei in mehreren holsteinischen Binnengewässern. Das nimmt auch Rörig an, der jedoch den Zusammenhang dieser Stelle mit dem Privileg von 1188 nicht erkannt hat. Meeresfischerei am holsteinischen Strande wurde Lübeck dagegen erst durch das bekannte Privileg von 1252 verliehen, in dem kein Wort über eine bereits bestehende Gewohnheit gesagt wird.
In keinem Falle kann mehr zweifelhaft sein, daß die sogenannte Barbarossa-Urkunde für den obwaltenden Rechtsstreit ganz ausscheiden muß. Es läßt sich überhaupt nicht feststellen, ob der fragliche Satz genau so im Original gestanden hat wie in der Fälschung. Das ist aber schließlich einerlei; denn eine Gewährung von Meeresfischerei kann aus dem Satze unter keinen Umständen ge-


|
Seite 35 |




|
schlossen werden 40 ). Und gesetzt den Fall, daß Rörig recht hätte, so würde sichs doch immer nur um eine bloße Nutzung handeln. Ebensowenig aber wie die Fälschung selbst kann die Bestätigung Friedrichs II. von 1226 eine Rolle spielen, und zwar schon deswegen nicht, weil sie ja auch nur denselben Satz enthält, der von Meeresfischerei nicht handelt 41 ).
~~~~~~~~~
III. Fischerei und Strandrecht.
Die lübische Fischerei an der Strecke Priwall-Harkenbeck läßt sich seit dem 16. Jahrhundert verfolgen. Daß die bloße Tatsache ihrer Ausübung nicht für ein Regal Lübecks spricht, ist ohne weiteres klar. Denn die Lübecker fischten sowohl diesseit wie jenseit der Harkenbeck, ebenso am holsteinischen Strande, aber nirgends ausschließlich 42 ). Selbst wenn sie auf der heute strittigen Wasserfläche den Fischfang ohne Wettbewerb anderer ausgeübt hätten - was nachgewiesenermaßen nicht der Fall war -, so brauchte es sich doch keineswegs um eine de iure ausschließliche, auf Regal beruhende Fischerei gehandelt zu haben 43 ).


|
Seite 36 |




|
Wie aber ist es überhaupt dazu gekommen, daß die Lübecker an der Küste Mecklenburgs ungestört fischen durften, ohne daß sie hierfür ein Privileg, ähnlich dem holsteinischen von 1252, aufzuweisen hatten?
Rörig (III, S. 74) glaubt die Ausführungen v. Gierkes über das strittige Gewässer in folgendem "Bilde" zusammenfassen zu können :
"Zunächst mecklenburgisches Fischereiregal mit Erhebung von Abgaben 44 ). Dann: Wegfall der Abgaben und jedes Anzeichens für den Bestand des ehemaligen Regals. Endlich: Trotzdem, also diesmal "aus dem Nichts heraus" 45 ), mecklenburgische Fischereihoheit an derselben Strecke, wo gleichzeitig den Lübeckern Gemeingebrauch an der streitigen Strecke "von Mecklenburg zugestanden" (!) gewesen sein soll."
Eine solche Entwicklung, meint Rörig, habe "nicht gerade den Schein der Wirklichkeit" für sich. Es ist aber auch nur ein Bild, das Rörig gezeichnet hat. Den Ausführungen v. Gierkes entspricht es nicht. v. Gierke hat keinen solchen Bruch mit den mittelalterlichen Verhältnissen und dann - nach einem Vakuum - wieder eine den mittelalterlichen Verhältnissen ähnliche Neuschöpfung angenommen. Sondern nach ihm verlief die Entwicklung folgendermaßen: Mittelalterliches Regal der Landesherren am Küstengewässer nebst Erhebung von Fischereiabgaben, dann Wegfall dieser Abgaben, also Zulassung freier Fischerei, aber unter Wahrung der Hoheit über das Küstengewässer einschließlich der Fischereihoheit. Nach Rörig hätte sichs ja bei den Fischereiabgaben um einen gewöhnlichen Zoll gehandelt, was sicher nicht zutrifft. Aber würde denn nicht der Verzicht auf den Zoll ebenso auffallend sein wie der auf die Abgaben?
Seit wann man, im Gegensatze zu den Verhältnissen des 13. und noch des 14. Jahrhunderts, dazu überging, die abgabenfreie Seefischerei zu gestatten, können wir nicht genauer ermitteln. Wahrscheinlich ist es schon gegen Ende des Mittelalters geschehen infolge des immer stärkeren Eindringens römisch-rechtlicher Anschauungen. Aber nicht nur die Lübecker waren es, denen der Fang am landesherrlichen Strande Mecklenburgs freistand, son-


|
Seite 37 |




|
dern auch die Warnemünder 46 ), die Wismarer, ferner - wie die Akten über den Fischreusenstreit zeigen -, die in der Gegend der Küste wohnenden Dorffischer, wobei allerdings der fischländische Strand eine Ausnahme machte 47 ). Auch holsteinische Fischer lassen sich um 1580 bei Brunshaupten feststellen 48 ).
Wie man im 16. Jahrhundert über die Seefischerei dachte, ergibt sich aus einer Beschwerde, die Rostock 1583 wegen einer Pfändung Warnemünder Seefischer am Dars an den Herzog von Pommern richtete; es heißt darin, daß "vermüge des natürlichen und aller Volcker Rechtens" das "Mehr oder offenbare Sehe und die Fischerey in derselben wie dan auch die littora maris menniglich gemein" und niemand verhindert sei, sich ihrer zu gebrauchen 49 ). Ähnliches klingt uns aus den Briefen der Eigentümer jener 1616 von Lübeck zerstörten Fischreuse entgegen 50 ). Man hatte solchen Anschauungen, die indessen nur auf die Nutzung des Meeres zu beziehen sind, in der Praxis nachgegeben, und nicht nur in Mecklenburg. Für Preußen läßt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Auch dort bestand im Mittelalter noch jenseit der Haffe im Küstengewässer ein Fischereiregal des Ordens und der Bischöfe von Ermland und Samland, schon im 13. Jahrhundert 51 ). Auch in Preußen wurden Abgaben für die Seefischerei erhoben 52 ). Das preußische Landrecht von 1620 aber erklärte das Meer und alle anderen offenen Wasserströme für "männiglich frey und gemein", so daß jeder dort fischen dürfe 53 ). Vermutlich folgte
( ... )


|
Seite 38 |




|
diese Bestimmung einer schon bestehenden Gewohnheit. Auch am holsteinischen Strande scheint der Fischfang um 1600 bereits frei gewesen zu sein 54 ). Durchgängig allerdings ist diese Entwicklung nicht. So hat sich das mittelalterliche Seefischereiregal an der rügisch-neuvorpommerschen Küste bis auf den heutigen Tag erhalten 55 ).
Eine solche Bestimmung, wie sie das preußische Landrecht von 1620 enthält, findet sich für Mecklenburg nicht. Man wird daher den freien Fischfang am mecklenburgischen Strande als eine gewohnheitsmäßige Übung ansehen müssen, die auf Duldung durch die Landesherren beruhte. Diese Auffassung ergibt sich auch aus den Einwendungen, die 1621 von der Stadt Rostock gegen das Verbot der Warnemünder Seefischerei in der Gegend von Brunshaupten erhoben wurden; ebenso aus der herzoglichen Resolution, die daraufhin erging 56 ). Der Verzicht auf Fischereiabgaben bedeutet jedoch keinen Verzicht auf die Fischereihoheit. In der erwähnten Resolution von 1621 wird zwar den Warnemündern der weitere


|
Seite 39 |




|
Gebrauch der freien Seefischerei zugebilligt, aber die landesherrliche "Gerechtigkeit" vorbehalten. Ferner zeigen der Fischreusenstreit sowie die Fischereistreitigkeiten zwischen der Stadt Ribnitz und der Landesherrschaft im 17. und 18. Jahrhundert 57 ), daß die Fischereihoheit keineswegs aufgegeben war. Wie hätte man sonst auch dazu kommen sollen, den Seefischern in Tarnewitz und Boltenhagen noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts Fischereiabgaben aufzuerlegen, also tatsächlich auf das Regal zurückzugreifen 58 )!
Daß auch am holsteinischen Strande die Fischereihoheit bestehen blieb, ist aus den Kämpfen zu schließen, die Lübeck im 16. Jahrhundert wegen seines dortigen Fischereirechtes durchzufechten hatte 59 ).
Schon in Archiv II haben wir die Ausübung des Fischfanges durch die Lübecker an den Küsten Holsteins und Mecklenburgs in Parallele gesetzt. Es machte rechtlich kaum einen Unterschied, daß Lübeck für das holsteinische Küstengewässer das Privileg von 1252 besaß; denn an die Stelle eines Privilegs trat für den mecklenburgischen Strand die Gewohnheit. Als 1575 lübische Fischer im Holsteinischen, zwischen dem Pelzerhaken und der Niendorfer Wiek, gepfändet waren, berichteten sie ihrem Rate, es sei in jener Gegend von alters her "ein freier Strand" gewesen 60 ). Nicht anders ist die den Fischreusenstreit einleitende Beschwerde Lübecker Fischer von 1616 aufzufassen, daß sie "des Orts, da die Ruse stehet, auch woll jenseits derselben, die Wahde zu ziehen pflegen" 61 ). Die Harkenbeckmündung, bei der die Reuse sich befand, erscheint hier also durchaus nicht - überhaupt nicht im ganzen Fischreusenstreit - als Grenze. Auch beriefen sich die Fischer nicht auf eine Lübecker Gebietshoheit 62 ). In dem Schreiben, das dann der Lübecker Rat an die Eigentümer der Reuse richtete, heißt es, daß den lübischen Fischern durch die Reuse "der Ort, da sie ihren freyen Wadenzug zu haben pflegen, gentzlich benommen" werde 63 ). Dieser Ausdruck "freier Wadenzug" entspricht jener Bezeichnung "freier Strand" (im Holsteinischen) von 1575. Er allein widerlegt schon die Meinung Rörigs, daß Lübeck für den Fischfang im mecklenburgischen Küstengewässer Abgaben erhoben


|
Seite 40 |




|
habe 64 ). Freilich sprach der Rat gleichzeitig von seiner Reede. In Wahrheit aber war an der Strecke Priwall-Harkenbeck und darüber hinaus genau so "freier Strand" wie an der holsteinischen Küste. Und die Vernichtung der mecklenburgischen Fischreusen ist gar nicht anders zu beurteilen als die Zurückdrängung der Anliegerfischerei in der Niendorfer Wiek durch Lübeck. Eher waren die "Repressalien" berechtigt, die der Rat gegenüber der Störung der lübischen Fischerei an dem holsteinischen Strande anordnete 65 ).
In den Gründen für die einstweilige Verfügung des Staatsgerichtshofes für das Deutsche Reich vom 10. Oktober 1925 wird gesagt, es sei bisher nicht glaubhaft gemacht worden, daß es sich bei den Reusenzerstörungen von 1616, 1617 und 1658 um unrechtmäßige Übergriffe gehandelt habe. Diese Unrechtmäßigkeit ist aber schon 1616 und 1617 von Mecklenburg behauptet worden, während sich über den Fall von 1658 nur einseitiges Lübecker Material erhalten hat. Wäre Lübeck im Recht gewesen, so müßten natürlich die Aufstellungen der Reusen Übergriffe gewesen sein, also Unrechtmäßigkeiten auf mecklenburgischer Seite vorgelegen haben. Daß man aber in Mecklenburg nicht nur von seinem Rechte überzeugt war, sondern auch in den Ansprüchen Lübecks etwas völlig Neues erblickte, lehren die Akten von 1616 und 1617. Es ergriffen ja auch die Herzöge Maßregeln zum Schutze ihrer Rechte. Warum sollte dieser Standpunkt Mecklenburgs falsch gewesen sein, obgleich sowohl die allgemeine rechtsgeschichtliche Entwicklung wieder tatsächliche Rechtszustand in der Travemünder Bucht (mecklenburgische Strandhoheit, mecklenburgische Fischerei) für ihn zeugen? Wäre das umstrittene Meeresgebiet wirklich lübeckisch gewesen, so würden die Reuseneigentümer schwerlich gewagt haben, hier nicht etwa nur ein wenig Raubfischerei zu treiben, sondern ein sehr kostbares Fanggerät aufzurichten und es auf dessen Zerstörung ankommen zu lassen.
Wir haben Archiv II, S. 163 bemerkt, daß der Fischreusenstreit nicht im Gebietsrecht wurzele. Dies kann sich aber nicht auf Mecklenburg beziehen, das ja sein Gebietsrecht zu verteidigen hatte. Es soll nur für die Ursache gelten, aus der Lübeck den Streit begann. Sie lag, wie wir in dem früheren Erachten ausgeführt haben, in der Gefahr, die den wichtigsten Fangplätzen


|
Seite 41 |




|
der lübischen Fischer (Travemünder Bucht und Binnengewässer) von den ungeheuren Reusen drohte. Mit der Ansicht, daß die Reusenfischerei den übrigen Fang verderbe, stand ja Lübeck nicht allein 66 ). Die Gefahr wog so schwer, daß die Notwendigkeit, sie abzuwenden, über alle Bedenken hinwegsehen ließ.
Man gewinnt aus den Akten durchaus nicht den Eindruck, daß Lübeck an sein Recht glaubte. Dazu sind seine Erklärungen zu widerspruchsvoll 67 ). Sie sind selber das beste Zeugnis dafür daß die Zerstörung der Reusen sich nicht rechtfertigen ließ; denn es ist völlig unmöglich, in den krausen Lübecker Argumentationen 68 ) einen logischen Gedankengang aufzufinden. Der Spiegel der Kritik wirft diese Erklärungen in folgendem Bilde zurück: Wir


|
Seite 42 |




|
Lübecker behaupten, daß der Ort, wo die Reusen gestanden haben, zu unserer Reede gehört, die uns samt dem Travenstrom, von Oldesloe bis in die offenbare See, auf Grund von Privilegien zusteht. Zwar liegt die Reede nicht in der strittigen Gegend, sondern nahe bei Travemünde, aber weil keine Grenze für sie festgesetzt ist, so können wir sie beliebig weit rechnen. Auch enthalten unsere Privilegien eigentlich nichts von einer Reede, und die Stelle des Privilegs von 1188, die wir meinen, spricht überhaupt nicht von Gebietshoheit, doch muß man sie nur richtig auslegen. Ferner berufen wir uns auf actus possessorios, wenn wir auch die Frage offen lassen, was dies für Akte sind und ob sie just auf dem fraglichen Gewässer vorgenommen wurden. Bei alledem sind wir aber weit davon entfernt, die Strandgerechtigkeit am mecklenburgischen Ufer oder ein alleiniges Fischereirecht zu beanspruchen. Denn es ist schwer zu bestreiten, daß Mecklenburg die Strandgerechtigkeit an seiner Küste und damit auch die Hoheit über das Küstengewässer besitzt; wir sagen dies ungern mit klaren Worten, geben es aber implicite zu, und zum Beweise dessen, daß wir das umstrittene Küstengewässer in Wahrheit gar nicht begehren, führen wir an, daß wir die Reusen nicht beschlagnahmt, sondern die Trümmer haben im Wasser liegen lassen. Ferner leugnen wir nicht, daß die Mecklenburger von jeher mit Netzen und Waden auf unserer Reede gefischt haben. Wir gönnen ihnen dies gerne, bestreiten jedoch, daß sie in der "Possession" sind, Reusen auszusetzen. Dies ist der Punkt, auf den es uns ankommt; wir wünschen, daß die Fischerei sich in den Grenzen des Herkommens hält. Außerdem sind unsere Reede oder unser portus sowie die litora des Meeres nach dem römischen Recht 69 ) loca publica, wo nichts angerichtet werden darf, was den usus publicus behindert. Dies taten aber die Reusen, indem sie den Fischfang schädigten und die Schiffahrt gefährdeten.
So sieht der Mantel aus, mit dem Lübeck sein Unrecht zu verdecken sucht. Die Reede, auf die es sich berief, konnte man, wenn man wollte, zu einem sehr vagen Begriff machen, wird doch in einem Lübecker Wetteprotokoll von 1735 sogar das Gewässer der Niendorfer Wiek, vor Niendorf und Timmendorf, als Reede bezeichnet 70 ). Wäre die Ursache des Fischreusenstreites wirklich
( ... )


|
Seite 43 |




|
darin zu suchen, daß Lübeck eine bis zur Harkenbeck reichende Gebietshoheit verteidigen wollte, so müßte man doch auch erwarten, daß diese Grenze in den Akten eine Hauptrolle gespielt hätte. Daß nirgends gesagt wird, die Harkenbeck bilde die Scheide, fällt um so mehr auf, als die Reusen von 1616 und 1617 dicht bei der Bachmündung gestanden hatten. Wo sie standen, ob diesseit oder jenseit der Harkenbeck, ist gleichgültig gewesen. Lübeck würde sie in jedem Falle zerstört haben, zumal da es erklärte, auch am holsteinischen Strande, wo es ja sicher keine Gebietshoheit hatte, Reusen nicht dulden zu wollen 71 ).
Während um Priwall und Dassower See die Jahrhunderte hindurch immer wieder zwischen Mecklenburg und Lübeck gestritten und prozessiert wurde, hat die Stadt auf das Küstengewässer östlich vom Priwall vormals nur bei den Fischreusenstreitigkeiten Anspruch erhoben. Nachdem die Gefahr, die von den Reusen drohte, aufgehört hatte, vernimmt man von diesem Anspruche nichts mehr 72 ). Es blieb bei der mecklenburgischen Strandhoheit. Einige wenige Gewalthandlungen, die aus besonderer Ursache entsprangen und also erklärbar sind, können für den tatsächlichen Bestand eines Lübecker Hoheitsrechtes um so weniger etwas beweisen, als ihnen unzweifelhafte Hoheitsakte und Verfügungen Mecklenburgs bis in die neueste Zeit gegenüberstehen. Gewalthandlungen, die sich den Reusenzerstörungen an die Seite stellen ließen, haben sich auch anderswo ereignet.
Freilich begründet Rörig seine Meinung, es habe eine Lübecker Fischereihoheit auf dem strittigen Gewässer bestanden, nicht nur mit dem Vorgehen des Rates gegen die mecklenburgischen Reusen. Daß aber auch das übrige Material, das er dafür beibringt, nicht Stich hält, haben wir in Archiv II gezeigt, und v. Gierke hat es ebenfalls nachgewiesen. Hier seien noch einige Worte zur Beur-


|
Seite 44 |




|
teilung der Lübecker Fischereiordnungen und zur Bewertung dessen hinzugefügt, daß Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischergruppen über den Fang vor der Strecke Priwall-Harkenbeck von Lübecker Gerichten entschieden wurden.
Es ist nachgewiesen, daß die lübischen Fischereiordnungen nicht auf gebietsrechtlicher Grundlage aufgebaut sind, sondern auch Gewässer betreffen, die unstreitig nicht lübeckisch waren und sind. Die Ordnungen beruhen sowohl auf der Korporationshoheit des Lübecker Rates über die Fischerzünfte wie auf seiner Personalhoheit über alle lübischen Untertanen, was auf dasselbe hinauskommt 73 ). Sie sind aus demselben Rechte abzuleiten, mit dem der Lübecker Rat den Travemünder Fischern in den Jahren 1580 bis 1583 wiederholt befahl, die Fischerei an der holsteinischen Küste fortzusetzen, wo sie damals auf Widerstand stießen 74 ). Genau so hat Rostock im Oktober 1621 - nach dem Erlasse jener herzoglichen Resolution, die das gegen die Warnemünder Seefischer gerichtete Verbot wieder aufhob, - den Fischern durch den Vogt zu Warnemünde befehlen lassen, daß sie die Fischerei an der landesherrlichen Küste "vleißig warten und treiben" sollten, "darmit wir hinwieder zu vollem Besitz gelangen und sie hinferner wegen Mangels der Fische sich nicht zu entschuldigen haben muegen" 75 ). Und wenn der Rostocker Rat gleichzeitig den Vogt wissen ließ, es dürfe nicht wieder vorkommen, daß die Warnemünder sich gegen herzogliche Untertanen ungebührlich betrügen und deren Fischnetze verdürben, so beruht doch eine solche Verfügung, die das Verhalten der Fischer außerhalb des Stadtgebietes betrifft, ebenfalls nur auf personalhoheitlicher Grundlage.
In diesem Zusammenhange sei auf eine Bemerkung hingewiesen, die sich in dem bekannten Bericht des Travemünder Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828 über die Fischerei der Lotsen findet. Sie lautet: "So viel ich weiß, haben unsere Fischer kein Amt noch Zunft; und in der See hat wohl jeder gleiches Recht" 76 ). In der Tat waren die Travemünder Fischer, die mit den Lotsen in Streit lagen, damals nicht zu einer Zunft zusammengeschlossen 77 ),
( ... )


|
Seite 45 |




|
ebensowenig natürlich die Lotsen. Der Kommandeur war also offenbar der Meinung, daß der Lübecker Senat überhaupt nur kraft einer Zunfthoheit Vorschriften über die Seefischerei erlassen könne.
Was ferner die Entscheidungen Lübecker Gerichte angeht, so waren diese bei Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischergruppen über deren fischereiordnungsmäßige Berechtigungen in jedem Falle zuständig. In dem Prozesse, der 1823 ausbrach, weil die Schlutuper Fischer vor Rosenhagen ihre Waden über die Stellnetze der Travemünder, denen sie das Recht, hier zu fischen, bestritten, hinweggezogen hatten, entschied zunächst die Lübecker Wette, dann das Obergericht, schließlich das Oberappellationsgericht. Genau derselbe Fall hat sich aber 1802 in der Niendorfer Wiek ereignet, und auch über ihn entschied die Wette. So ergibt sich aus der Relation des Oberappellationsgerichtsrates Dr. Hach von 1825 zum Urteil über den vorhin erwähnten Prozeß von 1823. In der Relation wird gesagt, es sei von den Travemündern, um zu zeigen, daß die Schlutuper von der Wette nicht so zurückgesetzt würden, wie sie behaupteten,
"ein Wettebescheid vom 25. Sept. 1802 producirt, woraus sich ergebe, daß die Bekl." (Schlutuper) "damals nicht bloß eigene Straflosigkeit, sondern sogar Bestrafung der Kläger" (Travemünder) "verlangt und erhalten hätten, ungeachtet sie angeklagt worden, daß sie die Klr. in der denselben unstreitig zustehenden Strandfischerei in der Niendorfer Wiek - eine Meile über den Mevenstein hinaus 78 ) - turbiret hätten und daß sie, ohne diesen nur Zeit zur Einziehung ihrer Netze zu gönnen, die Waden darüber hingeworfen hätten" 79 ).
Ein Senatsdekret vom 19. Oktober 1803 sprach sich aber hernach für die Travemünder aus, indem es deren Fischerei in der Niendorfer Wiek in Schutz nahm. Und hierzu bemerkten die Schlutuper, daß, wenn der Senat von seiner Befugnis, die Rollen der Ämter zu ändern, Gebrauch mache, dies nur aus Rücksicht auf das Gemeinwohl geschehen könne 80 ). Also ganz entsprechend den


|
Seite 46 |




|
Schlüssen, die aus den Fischereiordnungen zu ziehen sind, ergibt sich, daß Senat und Wette die Berechtigungen der Fischer auch außerhalb des von Rörig angenommenen Reedegebietes, in der Niendorfer Wiek ebenso geregelt und über Streitigkeiten, die hier entstanden, ebenso entschieden haben, wie es in Hinsicht auf die lübische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck geschehen ist.
Gesetzt einmal den Fall, die Lübecker Gerichte hätten ihre Zuständigkeit überschritten oder gar die Niendorfer Wiek und das Gewässer bis zur Harkenbeck als lübisches Gebiet angesehen, was würde dadurch bewiesen sein? Gar nichts. Denn Lübecker Gerichte sind zu keiner Zeit imstande gewesen, über Hoheitsrechte eines fremden Staates zu präjudizieren, am allerwenigsten in einem internen Lübecker Prozeß, von dem Mecklenburg erst nach hundert Jahren etwas erfährt. In Wirklichkeit aber handelte es sich in diesem Fischereiprozeß von 1823-25 gar nicht um eine gebietsrechtliche Beurteilung der strittigen Wasserfläche, sondern nur um die Auslegung der alten Fischereiordnungen, besonders des Vergleichs von 1610. Und in den Entscheidungsgründen des Oberappellationsgerichtes, das ja seinen Sitz in Lübeck hatte und dem der Dr. Hach, ein früherer Lübecker Wetteherr, angehörte, steht folgender Satz:
"Bey der Beurtheilung der . . Beschwerde der Kläger kommt es nun freilich nicht auf die Grundsätze des gemeinen Rechtes an, wonach es sogar zur Injurienklage berechtigt, wenn man andere in der Befischung der See hindern oder stören will
L 13 § 7. L 14 ff. de iniuriis (47.10) coll.
L 2 § 9 ff. ne quid in loco publico (43.8),
sondern es beruht alles zunächst und hauptsächlich darauf, den richtigen Sinn des am 1. Oktober 1610 geschlossenen Vergleiches auszumitteln."
Der hier ausgesprochene Gedanke setzt voraus, daß man das Gewässer vor Rosenhagen als einen Meeresteil betrachtete, wo nach römisch-rechtlicher Anschauung an sich jedermann fischen konnte, nicht aber als ein mit allen Rechtsmerkmalen eines Binnengewässers ausgestattetes Lübecker Gebiet.
Auf den Prozeß folgte der Fischereivergleich von 1826, der nach Rörig ebenfalls zu Unrecht für die Lübecker Ansprüche ins Feld geführt worden ist. Bei der Vorbereitung des Vergleichs wurde eine Ortsbesichtigung veranstaltet. Hieraus aber, wie Rörig 81 ) will, auf eine "Ausübung der Lübecker Fischereihoheit"


|
Seite 47 |




|
zu schließen, ist ganz unmöglich. Warum hätten denn nicht Lübecker Kommissare auch einmal auf die Niendorfer Wiek hinausfahren sollen, um - etwa zur Vorbereitung des Niendorfer Vergleichs von 1817 - das dortige Fischereigebiet in Augenschein zu nehmen? Wir möchten glauben, daß es geschehen ist. Wenn ferner die Schlutuper Fischer in ihrer Eingabe vom November 1825 bemerkten, daß sie bisher "das ausschließliche Recht auf die ganze Strecke vom alten Blockhause bis zur Harkenbeck in Anspruch genommen" hätten 82 ), so ist klar, daß das Wort "ausschließlich" sich nur auf das Verhältnis der streitenden Fischergruppen bezieht, nicht aber auf fremde Fischerei. Da Rörig das "ausschließlich" durch Fettdruck hervorhebt, so will er es offenbar im Sinne eines Lübecker Fischereiregals auslegen. Dies ist aber eine unstatthafte Pressung der Aktenstelle. Ein Vergleich wie der von 1826 hätte zwischen den Lübecker Fischergruppen auch für die Niendorfer Wiek abgeschlossen werden können. Und eben weil der Vergleich nur die lübischen Fischer band, so war es auch nicht nötig, mecklenburgische Gerechtsame in ihm zu berühren. Auch die Fischereiordnung von 1585 und der Vergleich von 1610 erwähnen keine mecklenburgische Hoheit und Mitfischerei, die, wie wir in Archiv II nachgewiesen haben, gleichwohl bestanden, als die Ordnungen erlassen wurden.
Daß man in Lübeck noch über fünfzig Jahre nach dem Abschlusse des Fischereivergleichs von 1826 durchaus keinen rechtlichen Unterschied zwischen der Fischerei am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Bucht und der Fischerei in der Niendorfer Wiek machte, ergibt sich deutlich aus dem, was Rörig aus dem Gutachten des Senators Overbeck mitteilt 83 ). Es wird darin der "Seestrand" beider Buchten, d. h. das Gewässer in der Nähe der Küste, in Hinsicht auf die Fischerei gleichgesetzt. Schon die Ausführungen Rörigs lehren, daß dieses Gutachten eines Lübecker Senators, das nur 17 Jahre jünger ist als das Fischereigesetz von 1896 und nur 32 Jahre vor dem Ausbruche des Streites zwischen Mecklenburg und Lübeck (1911) verfaßt wurde, mit den heutigen Lübecker Behauptungen nicht zu vereinbaren ist, sondern ihnen widerspricht. Wir dürfen dies auch daraus schließen, daß der Lübecker Senat nach einer Mitteilung des Staatsarchivs es abgelehnt hat, uns eine Abschrift des Gutachtens zu erteilen, weil es eingehend interne Rechtsverhältnisse behandele. Eine Gebietshoheit Lübecks über das heute strittige Gewässer


|
Seite 48 |




|
hat Overbeck, der nur völkerrechtliche Meeresgrenzen kannte, sicher nicht angenommen. Und wenn Rörig meint, die von Overbeck gezogene Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld habe "nach Ansicht ihres geistigen Urhebers selbst" die Travemünder Reede nicht seewärts abgegrenzt, sondern durchschnitten, so könnte man aus den von ihm mitgeteilten Textstellen des Gutachtens doch höchstens das Gegenteil folgern. Tatsächlich liegt allerdings die Kriegsschiffreede bei 17 m Wassertiefe jenseit der Linie. Und dieses Gewässer rechnete Overbeck zur offenen See. Es kam ihm eben auf eine nautische Reede und Grenzen dafür nicht an. -
Der Anspruch, den Lübeck im 17. Jahrhundert, um die Zerstörung der Fischreusen zu bemänteln, auf das Küstengewässer bis zur Harkenbeck erhoben hat, wird durch seine gleichzeitig gemachten Zugeständnisse, insbesondere das Zugeständnis der mecklenburgischen Strandgerechtigkeit, tatsächlich wieder aufgehoben. Hätte die Stadt auch späterhin dieses Gewässer als ihr Eigentum angesehen, so würde sie hiervon niemals abgewichen sein. Niemals hätte dann der Lübecker Senat im 19. Jahrhundert die Regeln des Meeresvölkerrechts als maßgebend für die Abgrenzung seiner Hoheit anerkennen können. Gebietsrechte auf einer von den lübischen Fischern so oft besuchten Wasserfläche konnten nicht in Vergessenheit geraten.
Daß auch aus dem Fischereigesetz von 1896 nicht eine Absicht Lübecks gefolgert werden darf, das strittige Gewässer in seine Hoheit einzubeziehen, hat jetzt Wenzel in seiner Abhandlung über die Hoheitsrechte in der Lübecker Bucht (S. 89 ff.) überzeugend nachgewiesen. Und dem entspricht ja auch die Handhabung dieses Gesetzes in den Jahren nach seiner Erlassung. Auch die neuerdings, am 21. März 1927 gemachten Zeugenaussagen Dassower Fischer ergeben wiederum, daß die mecklenburgische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck noch nach 1896 nicht von Lübecker Seite beanstandet wurde.
Rörig (III, S. 103) meint, es sei kein Wunder, daß seit der Festsetzung der Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld "die Irrtümer über die Rechtsverhältnisse auf der Reede und der Niendorfer Wiek innerhalb der Lübecker Verwaltung selbst und in den Kreisen der Fischer sich häuften", daß man, "verführt durch die neue Linie, ein Gegenseitigkeitsverhältnis, zunächst zwischen Lübecker und Niendorfer Fischern annahm, und daß dann in den Kreisen der Fischer vorübergehend der Gedanke aufkommen konnte, sie hätten ein Interesse daran, gegenüber gelegentlicher Fischerei Mecklenburger Fischer auch innerhalb der Linie ein Auge zuzudrücken, weil sie ja


|
Seite 49 |




|
auch im mecklenburgischen Küstengewässer jenseits der Harkenbeck fischten: die einfache Übertragung des - an sich schon falschen - Gegenseitigkeitsstandpunktes den Niendorfer Fischern gegenüber auf die mecklenburgischen!" Diese Vorstellung Rörigs aber leuchtet, was die mecklenburgischen Fischer angeht, an sich nicht ein und entspricht in keiner Weise den Tatsachen. Die von Overbeck vorgeschlagene und 1879 vom Lübecker Senat festgesetzte Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld galt in ihrer ganzen Ausdehnung, sowohl für die Travemünder Bucht wie für die Niendorfer Wiek. Ihr Zweck war lediglich, eine Grenze zu bilden, jenseit der die Travemünder Einwohner, die keiner Innung 84 ) angehörten und nicht eigentlich Fischer waren, den Fang betreiben durften, während innerhalb der Linie die, wie Overbeck sich ausdrückte, "festgeordneten Berechtigungen" der lübischen Fischer und der aus dem Fürstentum Lübeck vorlagen. Wenn diese Linie zu etwas hätte "verführen" können, so würde es höchstens die Annahme gewesen sein, daß innerhalb der Linie nur die genannten Fischer fangberechtigt seien. Es hätte also höchstens die Meinung entstehen können, daß die mecklenburgischen Fischer nicht zugelassen, sondern ausgeschlossen werden müßten. In Wirklichkeit aber haben die Lübecker Fischer den Sinn der Linie, die ja nur für die Travemünder "wilde" Fischerei galt, natürlich gekannt.
In keinem Falle sind denn auch die mecklenburgischen Fischer erst nach 1879 in das Gebiet binnen der Linie eingedrungen. Bei dem jüngsten Zeugenverhör in Leipzig vom 21. März 1927 haben drei Dassower Fischer im Alter von 65, 56 und 43 Jahren ausgesagt, daß nicht nur sie, sondern auch ihre Väter und Großväter vor der Strecke Priwall-Harkenbeck gefischt hätten. Und der 41jährige Fischer Post aus Fährdorf auf Poel erklärte bei dem Verhör in Wismar vom 29. September 1924, daß "unsere alten Vorfahren" immer gesagt hätten, es dürfe in der Travemünder Bucht soweit gefischt werden, als das mecklenburgische Ufer reiche. Die jetzt von Lübecker Seite erhobene Behauptung, daß diese Fischerei auf einer stillen Duldung durch Lübeck beruht habe, kehrt die tatsächlichen Rechtsverhältnisse um. Im übrigen kommt es auf die Lübecker Meinung nicht an. Die mecklenburgischen Fischer haben, wie die Zeugenaussagen ergeben, ihre Berechtigung aus der Hoheit Mecklenburgs abgeleitet. Und es kann nicht zweifelhaft sein, daß der mecklenburgische Besitzstand durch diese Fischerei (der Dassower, Wismarer, Poeler, Barendorfer, wenn nicht noch anderer


|
Seite 50 |




|
Fischer) gewahrt worden ist, auch nach 1896. Wenn die lübischen Fischer, wie Rörig meint, wegen des "Gegenseitigkeitsverhältnisses" es für zweckmäßig hielten, "ein Auge zuzudrücken", so könnte dies nur in Hinsicht darauf geschehen sein, daß Mecklenburger Fischer auch den westlichen Teil der Bucht, nämlich das Gewässer vor der Lübecker Küste aufsuchten 85 ).
~~~~~~~~~
Da ja in Rörigs Beweisführung die These, es habe auf dem angeblichen Reedegebiete seit Jahrhunderten eine ausschließliche Fischerei Lübecks bestanden, eine große Rolle spielt, so ist es für den vorliegenden Streit von höchster Wichtigkeit, daß diese These inzwischen auch für die ganze Westküste der "Reede" zusammengebrochen ist.
Denn es ist nicht einmal so gewesen, daß nur Lübecker und Mecklenburger den Fang in der Travemünder Bucht betrieben. Zu ihnen kamen die Fischer aus den vormals domkapitularischen Dörfern des Fürstentums Lübeck hinzu. In dem kürzlich erschienenen ersten Teil der Arbeit von Kühn über den Geltungsbereich des Oldenburgisch-Lübeckischen Fischereivergleichs von 1817 und die Travemünder Reede wird nachgewiesen, daß die Niendorfer Fischer im 18. Jahrhundert an der Westküste der Bucht bis zum Traveauslauf hin gefischt haben 86 ). Sie fischten also innerhalb der Bucht nicht nur am Strande des Domkapitels, sondern auch an dem sich südlich anschließenden Lübecker Strande


|
Seite 51 |




|
bis zur Flußmündung 87 ). Ohne Zweifel ist diese Fischerei älter als die erste von Kühn dafür angezogene Quelle, ein Lübecker Wetteprotokoll von 1729. Es bestehen nicht einmal Gründe gegen die Möglichkeit, daß die Niendorfer Fischer auch vor der mecklenburgischen Küste erschienen sind.
Auch bei den Verhandlungen, die in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts zwischen dem Domkapitel und der Stadt Lübeck über einen Fischereivertrag zur Beendigung der vielfachen Streitigkeiten geführt wurden, ward die hergebrachte Fischerei domkapitularischer Fischer in der Travemünder Bucht berücksichtigt. Dies geht hervor aus den von Kühn abgedruckten beiderseitigen Vertragsentwürfen, dem des Justizrats Detharding, des Vertreters des Domkapitels, von 1771 und dem Gegenentwurf des Lübecker Syndikus Dreyer von 1774 88 ). Detharding sah den Geltungsbereich des abzuschließenden Vertrages in dem ganzen Strande "von der Trave an, bis an die Gosebeck", also bis zum Ende der Niendorfer Wiek. Und auch nach Dreyer sollten beide Parteien die Freiheit "behalten", Netze, Angeln und Schnüre "allenthalben außerhalb der Trave zu setzen". Daß dies nur heißen kann: außerhalb der Travemündung, ist nach den Darlegungen Kühns nicht mehr zu bestreiten. Dagegen machte Dreyer für die Fischerei mit Waden zwar in der Niendorfer Wiek Zugeständnisse 89 ), wollte aber diese Geräte der Gegenpartei nicht bis zur Trave zulassen. Nach ihm sollten die Heringswaden der domkapitularischen Fischer nur "außerhalb des Traven-Strohms jenseits der Travemunder-Rheede" gezogen werden, während er für die Tobiaswaden die einzelnen Strandstrecken bis zur Gosebeck aufzählte, beginnend mit dem Gneversdorfer und dem Brodtener Strande, von denen der erste ganz, der zweite zum Teil an der


|
Seite 52 |




|
Westseite der Travemünder Bucht liegt 90 ). Daß der Gneversdorfer Strand südlich bis zum Möwenstein gerechnet wurde, macht Kühn sehr wahrscheinlich. Und er erblickt den Anfangspunkt für die Heringsfischerei (jenseit der Travemünder Reede), einen Punkt also, der sich mit dem Endpunkte der Reede deckt, gleichfalls im Möwenstein. Die näheren Nachweise hierfür sind in dem zweiten, uns bisher noch nicht vorliegenden Teile seiner Arbeit zu erwarten 91 ).
Wenn Kühn recht hat, so wäre natürlich auch im Niendorfer Fischereivergleich zwischen Oldenburg und Lübeck von 1817 92 ) die Grenzbestimmung "von der Travemünder Rehde an" auf den Möwenstein zu beziehen. Auch in dem Vergleich gilt diese Grenzbestimmung nur für die oldenburgische Fischerei mit Heringswaden und Tobiaswaden, für deren Gebrauch der Strand nördlich vom Mövenstein wegen seiner steinigen Beschaffenheit allerdings ungeeignet ist. Ferner ist die Bestimmung des Dreyerschen Entwurfes von 1774, wonach beide Parteien mit Netzen, Angeln und Schnüren "allenthalben außerhalb der Trave" fischen dürften,


|
Seite 53 |




|
wörtlich in den § 4 des Niendorfer Vergleiches aufgenommen, doch sind Beschränkungen für die oldenburgischen Fischer hinzugefügt. Wir nehmen an, daß Kühn sich über diesen § 4 noch äußern wird. Soviel aber steht schon jetzt fest, daß der Vergleich den Oldenburgern Fischereiberechtigung in dem angeblichen Reedegebiet zubilligt, und es fragt sich nur noch, wieweit diese Berechtigung geht. Noch das Lübecker Fischereigesetz von 1896 sagt in seinem § 4 unter ausdrücklicher Berufung auf den Niendorfer Vergleich: "Durch die Bestimmungen des § 3" (der die Verteilung der einzelnen Fischereibezirke auf die Lübecker Genossenschaften regelt) "wird nicht berührt das vertragsmäßige Mitbefischungsrecht der Oldenburgischen Fischer in der Travemünder Bucht."
Mithin: Die Behauptung Rörigs, daß Lübeck ein ausschließliches Fischereirecht auf der "Reede", von der Harkenbeck bis zum Brodtener Grenzpfahl besessen habe und besitze, ist nicht nur gegenüber Mecklenburg, sondern auch gegenüber Oldenburg unhaltbar. Seine Auffassung des Niendorfer Vergleichs beruht auf der Annahme, daß man die ganze Wasserfläche bis zum Brodtener Grenzpfahl hin zur Reede und sogar noch zur Trave gerechnet habe, was beides völlig ausgeschlossen ist. Und für den Umstand, daß in dem Dreyerschen Vertragsentwurf von 1774 der Gneversdorfer und der Brodtener Strand eigens aufgezählt werden, hat er eine Erklärung zu geben versucht, die man nur als gewaltsam bezeichnen kann 93 ).
Wichtig ist ferner der Nachweis Kühns, daß das Lübecker Domkapitel noch im 18. Jahrhundert an seinem in die Travemünder Bucht hineinreichenden Strande das Strandrecht ausgeübt hat, und zwar, wie die Nachrichten darüber ergeben, unter voller Anerkennung durch Lübeck 94 ). Auch das Fahrrecht des Kapitels wird für den Brodtener Strand in einem Fall von 1757 bezeugt 95 ). Natürlich hat das Kapitel diese Hoheitsrechte bis zu seiner Auflösung (1803) besessen. Und ganz unmöglich ist demgegenüber die auch von Kühn zurückgewiesene Behauptung des Lübecker Baumeisters Soherr von 1775, daß der Brodtener Strand der Stadt gehöre 96 ). Diese Behauptung aber steht auf gleicher Stufe wie die


|
Seite 54 |




|
des Zöllners Tydemann von 1547, wonach Lübeck über Strom und Strand bis zur Harkenbeck sollte zu gebieten haben.
1599 trug der Großvogt des Domkapitels in einer Kapitelsitzung vor, daß "das ganze littus maris vom Travemünder Felde bis an den Gronenberge und Scharboiß dem Capitul zugehörte". Hiermit brachte er nach Kühn (S. 10) "in Verbindung, daß das Domkapitel in possessione iuris piscandi sei, und folgerte aus beidem das Recht eines Untertanen des Domkapitels, überall an der genannten Strandstrecke zu fischen. Diese ,Capituls Gerechtigkeit' wurde dessen Sekretarius beauftragt, den Wetteherren in einer schwebenden Streitsache in Erinnerung zu bringen. Er tat dies mit dem Erfolge, daß der über ein Guthaben des betr. Kapitelsuntertanen in der Stadt verhängte Arrest aufgehoben wurde." Es war eben überall dasselbe: Strandhoheit schloß die Fischereigerechtigkeit ein. Und es sind nur entsprechende Erscheinungen, daß Lübeck auf der einen Seite die Wadenfischerei der domkapitularischen Fischer zu deren Unwillen 97 ) wider alles Recht stark beschnitt und mit Beschlagnahme von Geräten gegen sie vorging, auf der anderen Seite aber ein paar mecklenburgische Fischreusen zerstörte.
~~~~~~~~~
In seinem zweiten Gutachten (S. 294 f.) behauptet Rörig, daß das Schweriner Archiv an einer "gänzlichen Aktenlosigkeit für das fragliche Gebiet" leide im Gegensatze zu dem "durch die Jahrhunderte hindurch lückenlosen Aktenbefund über ungestörten Genuß der Hoheitsrechte in Lübeck." Hoheitsrechte (Mehrzahl)! Wir müssen dem entgegnen, daß wir mit unseren Aktenbeständen zufrieden sind. Sie haben uns ermöglicht, im Archiv II die mecklenburgische Strandhoheit einschließlich des Fahrrechts nachzuweisen 98 ), während von den gleichartigen Rechten, die Rörig für Lübeck glaubte feststellen zu können, nichts übrig bleibt. Und über die Fischerei konnten, solange man keine allgemeinen Fischereigesetze, auch nicht für die Binnengewässer, erließ, Akten - von Privilegien sehen wir dabei ab -immer nur bei Streitigkeiten entstehen; so die Akten über den Fischreusenstreit und das wichtige Rostocker Protokoll von 1618 99 ). Das war überall dasselbe. Was wüßten wir denn von den Fischereiverhältnissen in der Travemünder Bucht während früherer Jahrhunderte, wenn es keine Konflikte gegeben hätte? Gar nichts! Auch die alten


|
Seite 55 |




|
Lübecker Fischereiordnungen sind ja, wie sie selber lehren, aus Zwistigkeiten der Fischergruppen hervorgegangen. Und ebenso steht es um die Niendorfer Wiek. Für die Fischerei der Niendorfer ist das Quellenmaterial nach Kühn (S. 13) "außerhalb der Zone beständigen Streites äußerst dürftig". Wollte man jedoch aus dem Mangel an Streitakten für irgendein Gewässer folgern, daß überhaupt nur eine Partei gefischt habe, so wäre das ein grober Trugschluß.
Daß aber die tatsächlich für verschiedene Zeiten nachgewiesene mecklenburgische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck auf privater Berechtigung der Fischer beruhte, daß also die Mecklenburger an der Küste ihres eigenen Landes und dennoch in fremdherrlichem Gewässer gefischt hätten, kann nicht angenommen werden. Ein solches Verhältnis wäre von Haus aus sehr unwahrscheinlich. Das Umgekehrte dagegen, die Nutzung des mecklenburgischen Küstengewässers durch Lübecker Fischer, entspricht der auch sonst festgestellten Entwicklung. Überdies haben wir sichere Anzeichen für die mecklenburgische Hoheit in der Gerichtsbarkeit (Fahrrecht) und besonders in dem Strandrecht im engeren Sinne, dem Bergerecht. Es war allgemeine Regel, in der Ausübung des Bergerechts einen Beweis für den Besitz des gesamten Strandregals, d. h. der Hoheit über das Küstengewässer zu erblicken 100 ). Und daß das Bergerecht vor der Strecke Priwall-Harkenbeck Mecklenburg zustand, darüber kann es keinen Zweifel geben. Hier ist das Bild geschlossen bis zu der mecklenburgischen Verordnung vom 17. Dezember 1874 hin, die zur Ausführung der Reichsstrandungsordnung erlassen wurde und ausdrücklich bis zur Grenze des Lübecker Gebietes, also bis zur Staatsgrenze am Priwall gilt. Die Verordnung ist noch heute in Kraft. Sie setzt, wie es das Bergerecht von jeher getan hat, die Hoheit über das Küstengewässer voraus. Und es entspricht ihr, daß Lübeck in seiner eigenen Ausführung zur Reichsstrandungsordnung vom 2. November 1874 den Lübecker Ostseestrand "von der Mecklenburgischen bis zur Oldenburgischen Gränze", also ebenfalls von der Staatsgrenze am Priwall an, rechnete 101 ).
Demgegenüber kommen die ein bis zwei Übergriffe Lübecks, die aus Jahrhunderten bekannt geworden sind, gar nicht in Betracht. Es handelt sich um die Fälle von 1516 und 1750. Über den von 1516 ist unbedingte Klarheit nicht zu gewinnen. Weil


|
Seite 56 |




|
Rörig (III, S. 119 f.) meint, daß Lübeck damals vor Rosenhagen "das Bergerecht", also ein Regal ausgeübt habe, und daß sich der Fall "ganz ungezwungen in die Nachrichten über die Ausdehnung der Reede" einfüge, so müssen wir noch einmal darauf eingehen 102 ).
Mecklenburg beschwerte sich darüber, daß der Travemünder Vogt zwei landrührige Schuten widerrechtlich geborgen habe, eine am Priwall, die andere bei Rosenhagen. Davon kommt die erste hier nicht in Betracht, weil der Priwall strittig war und Streitigkeiten wegen des Strandrechts dort oft vorkamen. Der Lübecker Rat wiederholte in seiner Entgegnung zunächst die mecklenburgische Behauptung über den Strandungsort beider Schiffe. Man habe inzwischen Erkundigungen eingezogen, wonach beide Schuten auf städtischem Strom und Gebiet Schiffbruch erlitten hätten, die eine hart am Hafenbollwerk und am Priwall, die andere jenseit des Bollwerks auf der Reede 103 ). Ist diese letzte Ortsbestimmung richtig, dann ist die mecklenburgische (Rosenhagen) falsch, und das Schiff war auf der Reede, also nicht weit von der Travemündung, schiffbrüchig geworden. Stimmt es aber mit Rosenhagen - und das ist das Wahrscheinlichere -, dann liegt in dem Lübecker Schreiben eine absichtliche Ungenauigkeit vor; denn die Ortsbestimmung "af gensydt Bolwarkes up der Reyde" konnte kein Mensch auf den Rosenhäger Strand beziehen, der vom Bollwerk ungefähr 3 km weit abliegt. Der Lübecker Rat würde dann eben nur die Strandung am Priwall zugegeben, um den zweiten Fall aber herumgeredet haben 104 ). Warum ging er denn im weiteren Verlaufe des Schreibens nur auf sein Recht am Priwall ein, nicht aber auf ein Recht am Strande vor Rosenhagen, obwohl doch der mecklenburgische Protest beide Örtlichkeiten betraf? Das ganze Schriftstück ist so abgefaßt, daß man es in Mecklenburg gar nicht anders verstehen konnte, als daß beide Schuten am Priwall gestrandet sein sollten. Und wie die Erwiderung der Herzöge lehrt, verstand man es in der Tat so 105 ).
Aber auch wenn wir voraussetzen, daß das eine Fahrzeug bei Rosenhagen gescheitert war, so ist das Verhalten Lübecks dennoch begreiflich. Die Seestädte verwarfen das Bergerecht überhaupt und sprachen den Schiffbrüchigen die Befugnis zu, selber für Ber-


|
Seite 57 |




|
gung zu sorgen 106 ). Sie konnten sich dabei auf gewisse Reichssatzungen und päpstliche Verordnungen gegen das Strandrecht stützen, an deren Erlassung Lübeck großen Anteil hatte 107 ). Außerdem lagen für den mecklenburgischen Strand landesherrliche Privilegien vor, die ebenfalls von Lübeck erwirkt waren, und zwar eine allgemeine Aufhebung des Strandrechts von 1220, eine Bestätigung von 1327 und eine weitere Bestätigung von 1351 worin Herzog Albrecht II. speziell den Lübeckern die selbständige Bergung bei Schiffbrüchen an der ganzen mecklenburgischen Küste zugestand und seinen Beamten verbot, sie dabei zu stören 108 ). Demgemäß, wenn auch ohne die mecklenburgischen Privilegien zu nennen, betonte der Lübecker Rat 1516, daß beide Schuten Lübeckern gehörten und von ihnen selbst geborgen seien. Ferner heißt es in dem Schreiben, die Herzöge würden doch nicht verkürzen wollen, was die gemeinen Rechte und die "naturlike Rede" (d. h. die allgemeine Rechtsempfindung) in diesem Falle gestatteten und den Lübeckern auch durch päpstliche und kaiserliche Begnadungen erlaubt sei.
In Wirklichkeit aber war es Lübeck bekannt, daß die mecklenburgischen Landesherren seit dem 15. Jahrhundert irgendwelche Satzungen gegen das Strandrecht ebensowenig mehr gelten ließen wie die Strandungsprivilegien ihrer Vorfahren. Sie vertraten statt dessen das Bergerecht in seiner schärfsten Gestalt und betrachteten schiffbrüchiges Gut als dem Strandherrn anheimgefallen. Von den beiden Herzögen, an die das Schreiben des Rates von 1516 erging, war Heinrich V. ein ausgesprochener Anhänger dieser Auffassung 109 ) und sein Mitregent Albrecht VII. gewiß nicht minder. Dazu kam, daß die Stimmung der beiden Fürsten gegen Lübeck ohnehin nicht die beste sein konnte. Einige Jahre früher (1506-1508) hatte man wegen des Priwalls und Dassower Sees in offener Fehde gelegen, wobei die Lübecker schwere Verwüstungen auf mecklenburgischem Boden angerichtet hatten 110 ). Wurde


|
Seite 58 |




|
die eine Schute bei Rosenhagen von den herzoglichen Beamten geborgen, so sah man in Lübeck von dem Strandgute nie etwas wieder oder doch besten Falles erst nach langen Verhandlungen und gegen Zahlung von Lösegeld. Das wußte natürlich der Travemünder Vogt so gut wie der Lübecker Rat und die Eigentümer des Schiffes. Deshalb griff der Vogt zu oder lieh wenigstens seine Unterstützung bei der Bergung, und deshalb trat der Rat für ihn ein. Hätte dieser, wie die Herzöge verlangten, das Strandgut an Ort und Stelle zurückbringen lassen, so hätten die Eigentümer es büßen müssen. Wie die Dinge lagen, ist es einigermaßen verständlich, daß der Rat die Bergung nicht nur mit allgemeinen Rechtssätzen, Privilegien und Verordnungen rechtfertigte, die ja überhaupt nur für fremdherrlichen Strand Bedeutung haben konnten, von den Herzögen aber notorischer Weise nicht anerkannt wurden, sondern daß er einen nahe der Grenze vorgekommenen Fall auch gebietsrechtlich zu decken suchte, indem er den Strandungsort leise nach dem Priwall zu verschob. Lübecks Recht auf den Priwall setzte der Rat doch nur deswegen in dem Schreiben auseinander, weil es klar war, daß die Hoheit über die Halbinsel auch deren Strand mit umfaßte, auf dem eines der Schiffe ja zugegebenermaßen gelegen hatte. Jenseit des Priwalls aber gehörte das Ufer unbestritten Mecklenburg. Soll man denn annehmen, daß der Rat sich hier - östlich von Priwall - den überfluteten Strand zuschrieb, am Priwall aber nur unter der Voraussetzung des Eigentums am festen Lande? Gewiß nicht, sondern wenn die eine Schute bei Rosenhagen geborgen war, so liegt in dem Schreiben eine Verschleierung des Tatortes vor. Daraus aber kann man nur folgern, daß Lübeck sich östlich vom Priwall kein Bergeregal und also auch das Strandgewässer nicht beilegte. Das hat es auch später nicht getan, nicht einmal in seinen verworrenen und ganz singulären Erklärungen beim Fischreusenstreit. Rörig will den Fall von 1516 einem anderen von 1660 111 ) gleichsetzen. Aber 1660 hat Lübeck mit keinem Worte behauptet, daß die damals bei Rosenhagen verunglückten Schiffe auf seiner Reede gesunken seien. Es sagte, sie seien "nicht auf dem Unsern angetrieben, sondern an Seiten E. F. Durchl. Lande beschädiget", aber "nicht an den Strandt kommen, sondern drey Klafter (5,17 m) tief in See geblieben". Es bestritt also lediglich, daß solche Tiefe noch zum Strande zu rechnen sei. Darin aber liegt das Zugeständnis, daß


|
Seite 59 |




|
der gesamte Strand vor Rosenhagen, trockener und bespülter, zu Mecklenburg gehöre. Ferner ergibt sich aus dem Falle von 1660, daß der Herzog Christian auch noch das tiefe Wasser vor seiner Küste beanspruchte, also eine Lübecker Hoheit darüber nicht in Betracht zog. Dagegen ergibt sich nicht, das Lübeck eine solche Hoheit vor Rosenhagen geltend machte.
Während Mecklenburg 1516 Protest erhob, hat es von dem weiteren Falle von 1750 wahrscheinlich gar nichts erfahren. Wir haben in unserem Archiv jedenfalls nichts darüber gefunden. Nach dem Material, das Rörig vorlegt 112 ), handelte es sich um Holz, das von einem dicht vor der Travemündung gesunkenen Ballastboote 113 ) weggetrieben und "unter Rosenhagen an der mecklenbürgischen Seiten angeschlagen" war. Die Bergung dieses Holzes durch Lübeck ist nach Rörigs eigener, in seinem zweiten Gutachten 114 ) vertretenen Anschauung ein Übergriff gewesen. Denn wenn - seiner Meinung nach - Mecklenburg das Bergerecht über Fahrzeuge zustand, die "angeschlagen" waren, "so daß vom Strand aus die Bergearbeiten vollzogen werden konnten", so hätte dasselbe doch auch für angeschlagenes Holz gelten müssen. Ein Teil des Holzes war schon am Tage vorher am Priwall angetrieben, und der Leutnant Hinzpeter, der über diesen Fall berichtete, hatte es von Soldaten bewachen lassen, die während der Nacht patrouillierten, "soweit die obrigkeitliche Jurisdiction gehet", d. h , wie auch Rörig angibt, bis zum Ostende des damals noch strittigen Priwalls. Der Strand weiter östlich, an den der Rest des Holzes
angeschwemmt wurde, lag also jenseit der lübischen Jurisdiktion. Und diesen Strand mußten doch die Lübecker beim Bergen betreten.
Immer jedoch bleibt zu bedenken, daß in den Fällen von 1516 und 1750 Übergriffe zwar nach der in Mecklenburg herrschenden Auffassung vorlagen, nicht aber nach der Lübecks, das ganz allgemein die Berechtigung in Anspruch nahm, ohne Einmischung der Strandherren selber zu bergen. Dies hat es z. B. 1660 besonders klar ausgesprochen 115 ). Auch konnte sich Lübeck schon allein auf
( ... )


|
Seite 60 |




|
Grund der oben genannten mecklenburgischen Privilegien zu jeder Bergung von schiffbrüchigem Gut am Mecklenburger Strande befugt halten. Auf diese Privilegien berief es sich noch 1712 und 1728 116 ). Dagegen ist es ganz unmöglich, aus den Fällen von 1516 und 1750 ein Lübecker Bergeregal vor Rosenhagen zu folgern. Denn dieses Regal wie die gesamte Strandhoheit hatte immer der, dem die Hoheit über das Ufer gehörte. Das war allgemein Regel. Hierin liegt auch der einzige Grund dafür, daß Lübeck sich 1329 jenen schmalen Landstreifen nördlich von Travemünde bis zur Brodtener Grenze hin übertragen ließ. Als aber ein Teil dieses Streifens von der See weggespült war und infolgedessen das Gneversdorfer Gebiet ans Meer herantrat, nahm das Lübecker Domkapitel hier das Bergerecht in Anspruch 117 ), auch ein Zeichen dafür, daß dieses Regal vom Uferbesitz abhängig war. Wie hätte denn Mecklenburg seine Strandhoheit nicht behaupten sollen, die sogar das schwache Domkapitel an seiner Küste wahren konnte!
~~~~~~~~~
Im 19. Jahrhundert hat dann Mecklenburg früher als Lübeck allgemeine Verordnungen über den Fischereibetrieb am Außenstrande der Ostsee sowie in den Ostsee-Binnengewässern (Salzhaff, Wismarer Bucht usw.) erlassen. Es sind die Verordnungen von 1868 und 1875. In den Gründen für die einstweilige Entscheidung des Staatsgerichtshofes wird, wenn wir die Stelle recht verstehen, bezweifelt, daß diese Verordnungen auch das Gewässer vor der Strecke Priwall-Harkenbeck betreffen. Dies ergibt sich aber schon daraus, daß Mecklenburg um dieselbe Zeit in anderen Verordnungen, die noch nach 1868 erlassen sind, über das strittige Gewässer, und zwar unter Anerkennung durch Lübeck, verfügt hat,


|
Seite 61 |




|
nämlich in der Verordnung vom 10. Oktober 1874 zum Schutze der Dünen des Ostseestrandes bei Rosenhagen, Barendorf usw. sowie in der Ausführungsverordnung zur Reichsstrandungsordnung vom 17. Dezember 1874 118 ). Unmöglich konnte Mecklenburg das strittige Gewässer das eine Mal als seiner Hoheit unterworfen betrachten, das andere Mal aber nicht 119 ). Und ebensowenig konnte Lübeck diese mecklenburgische Hoheit bald anerkennen, bald bestreiten.
Die Seefischereiverordnung von 1868 wird durch die von 1875 revidiert und außer Kraft gesetzt, ebenso die Verordnung von 1875 durch die von 1891. Diese letzte Verordnung regelt den gesamten Fischereibetrieb sowohl in den Binnengewässern wie in den Küstengewässern. Der Fischereibetrieb in den Küstengewässern aber umfaßt nach § 1 "die Fischerei am Außenstrande der Ostsee" sowie in den Ostsee-Binnengewässern. Der Ausdruck "Außenstrand der Ostsee" wird schon in den Verordnungen von 1868 und 1875 gebraucht. Mithin ist gar kein Zweifel, daß die Verordnung von 1891 denselben Geltungsbereich hat wie die Regelungen von 1868 und 1875. Auch die Verordnungen zum Schutze der Fischerei auf Plattfische von 1904 und 1913 betreffen den Fang "an der ganzen Ostseeküste Unseres Landes". Wäre hier die Strecke Priwall-Harkenbeck nicht mitgerechnet worden, so hätte dies unbedingt ausgesprochen werden müssen 120 ).


|
Seite 62 |




|
Zwischen diese mecklenburgischen Verordnungen fällt zeitlich das Lübecker Fischereigesetz von 1896. Wenzel (S. 89 ff.) hat im einzelnen gezeigt, daß es nicht so auszulegen ist, als ob die vorher von Lübeck anerkannten völkerrechtlichen Grundsätze darin durchbrochen werden sollten. Hierzu stimmt auch die 1879 vom Senator Overbeck vertretene Rechtsanschauung. Und weil Overbeck die völkerrechtliche Ausdehnung der Meereshoheit (Kanonenschußweite) noch auf "etwa eine Seemeile vom Ufer" berechnete, so muß wohl die ebenfalls in der Lübecker Verwaltung zeitweilig vertretene Anschauung, daß diese Ausdehnung drei Seemeilen betrage 121 ), erst nach 1879 aufgekommen sein.
Freilich hat Lübeck sich später auf Grund des Fischereigesetzes von 1896 eine alleinige Hoheit in der Travemünder Bucht zugeschrieben. Da wir aber in der Grenzverlegung von 1923 ein Beispiel dafür haben, wie schnell und unter wie brüchiger Begründung Lübeck sich zu entschließen vermag, Hoheitsrechte in Anspruch zu nehmen, so könnte die nach 1896 bemerkbare Wandlung in seiner Ansicht über das, was ihm in der Travemünder Bucht zusteht, sich allerdings schon aus der mißverständlichen Fassung des Gesetzes von 1896 selbst erklären lassen. Aus der in § 2 gegebenen Umschreibung des Fischereibezirkes III, wonach dieser hauptsächlich durch "die Travemünder Bucht bis zur Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld" gebildet werden soll, vermochte ja sogar die Meinung zu entstehen, daß hier auch noch die Niendorfer Wiek, also die gesamte Wasserfläche binnen der bezeichneten Linie gemeint sei 122 ). Leichter jedenfalls ließ sich aus dem Gesetze eine Einbeziehung des mecklenburgischen Gewässers bis zur Harkenbeck folgern.
Indessen spricht aus dem ganzen Verhalten Lübecks nach 1896 zunächst eine große Unsicherheit. Weder gelang es, die mecklenburgischen Fischer zu verdrängen, noch wurde ihnen gegenüber ein irgendwie konsequentes Verfahren beobachtet, nicht einmal nach 1911. Und höchst bezeichnend ist es, daß der Lübecker Senat seine Erwiderung auf die Anfrage der mecklenburgischen Regierung von 1911 solange hinauszögerte, bis ihm ein Archivbericht vorlag, in dem nur der erste (ungedruckte) Bericht Rörigs erblickt werden kann 123 ). Mithin ist zu schließen, daß Lübeck seine eigentliche Rechtsüberzeugung erst aus den Rörigschen Darlegungen geschöpft hat. Sehr wünschenswert aber wäre es zu erfahren, welches denn "die letzten gutachtlichen Äußerungen" sind, die Rörigs "unge-


|
Seite 63 |




|
druckten vom Jahre 1912 vorausgingen" und die noch ganz von völkerrechtlichen "Vorstellungen beherrscht waren" 124 ). Von wem und wann sind diese gutachtlichen Äußerungen verfaßt? Jedenfalls können wir nur wiederholen, was wir schon oben einmal gesagt haben: Es ist ausgeschlossen, daß Hoheitsrechte, wie Lübeck sie seit Jahrhunderten vor der Strecke Priwall-Harkenbeck besessen haben will, in Vergessenheit gerieten. Und wer hätte denn je seine Rechte eifriger gewahrt als Lübeck!
Schließlich bemerken wir, daß es unseres Erachtens für die endgültige Entscheidung des Streites auf die Zustände der letzten Zeit überhaupt nicht ankommen kann. Denn eine Verjährung der mecklenburgischen Rechte ist ja unter keinen Umständen eingetreten. Mithin ist die Auffassung und das Verhalten Lübecks in der Zeit nach 1896 nur seinen Behauptungen gleichzusetzen, die es beweisen muß. Durch die Rörigschen Gutachten aber wird nichts bewiesen, weder Lübecker Hoheitshandlungen auf dem strittigen Gewässer noch die für die Beanspruchung eines Gebietes notwendigen Grenzen. Im Hinblick auf die Seegrenze hat übrigens Lübeck in seinem dem Staatsgerichtshofe eingereichten Schriftsatze vom 25. Juli 1925 unter VI behauptet, daß die Änderung der Grenzlinie der Travemünder Reede, die es durch die Bekanntmachung vom Januar 1923 vorgenommen habe, "nur eine sachlich geringfügige geographische Berichtigung" enthalte. Indessen lehrt ein Blick auf die Kartenskizze 2 bei Rörig I, daß diese Behauptung ganz unzutreffend ist. Das 1923 hinzugenommene Gebiet, das jenseit der Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld liegt, ist ja nur etwa um ein Viertel kleiner als die ganze Travemünder Bucht.
Auch die auf dem Termin in Leipzig am 21. März d. J. übergebene Lübecker Karte mit der blaugefärbten Plate erkennen wir in keiner Weise an. Es ist über diese Karte noch Verschiedenes zu sagen, doch wollen wir uns einen Nachtrag zur Reedelage vorbehalten, bis wir den zweiten Teil der Abhandlung von Prof. Kühn über den "Geltungsbereich des oldenburgisch-lübeckischen Fischereivergleichs von 1817 und die Travemünder Reede" in Händen haben.
~~~~~~~~~


|
Seite 64 |




|
Exkurs.
Zum Meeresfischereiregal in Preußen.
Über dieses Regal vgl. v. Gierke, S. 47 f., und die von ihm zitierte Abhandlung v. Brünnecks, Zur Geschichte des altpreußischen Jagd- und Fischereirechts, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., Bd. 39, S. 120 ff. Rörig (III, S. 57, Anm. 12) ist auf diese Abhandlung und das preußische Seefischereiregal eingegangen und glaubt, auch hier wieder eine Sonderbildung feststellen zu können. Indessen liegen die Dinge doch so, daß die Zustände, die v. Brünneck für das preußische Küstengewässer nachweist, in die jetzt für die ganze deutsche Ostseeküste ermittelten Rechtsverhältnisse eingeordnet werden müssen. Wenn v. Brünneck meint, es sei daraus, daß das Privileg Kaiser Friedrichs II. für den deutschen Orden von 1226 die Landeshoheit nicht nur am Binnenlande, sondern auch am vorgelagerten Meere übertrug, "allein noch nicht die Schlußfolgerung zu ziehen", daß ein Fischereiregal im Küstengewässer entstanden sei, so ist das natürlich richtig. Denn die Übertragung der Meereshoheit beweist noch nicht die tatsächliche Ausübung eines Fischereiregals. Dieses ist erst aus den preußischen Urkunden zu folgern. Der weiteren Bemerkung v. Brünnecks aber, daß außer dem Privileg noch andere Umstände hätten hinzukommen müssen, um die Ausdehnung des landesherrlichen Binnenfischereiregals in Preußen auf die Küstengewässer "zu ermöglichen und zu rechtfertigen", nicht mehr zuzustimmen. v. Brünneck erörtert dann, daß man im Mittelalter die beiden preußischen Haffe weder als Landseen noch als eine Erweiterung der darin mündenden Flüsse betrachtet, sondern sie mit den jenseit der Nehrungen belegenen Küstengewässern "unter dem einen Begriff Meer" zusammengefaßt habe. "Innerhalb dieses weiteren Gattungsbegriffs" habe man nach der Beschaffenheit des Wassers zwischen "mare recens" und "mare salsum" unterschieden. Weil die Haffe durch das Pillauer und dem Memeler Tief mit dem Meere in Verbindung ständen, so habe es nahe gelegen, die Küstengewässer ihnen rechtlich gleichzustellen. Wichtiger aber noch als die geographische Lage der beiden Haffe "und das darin beruhende nahe Verhältnis, in dem sie sich zur Ostsee und den Küstengewässern befanden", sei ein rechtsgeschichtlicher Vorgang gewesen, der zur Zeit, als der Orden Preußen eroberte, im benachbarten Pommerellen "entweder schon vollendete Tatsache geworden war oder doch im Begriffe stand, verwirklicht zu werden". Gemeint ist das Meeresfischereiregal der Herzöge von Pom-


|
Seite 65 |




|
merellen, das v. Br. mit einer Urkunde von 1257 belegt. Nach diesem Beispiel habe man sich in Preußen gerichtet und sich dabei auf das Privileg von 1226 berufen können. v. Br. hat aber nicht, wie Rörig meint, die Ansicht ausgesprochen, daß das Regal zunächst auf die Haffe und dann auf das Wasser davor ausgedehnt worden sei. Sondern seine Darlegungen können nur so verstanden werden, daß er glaubte, es sei das Binnenfischereiregal auf Haffe und Küstengewässer zugleich übertragen worden. Die rechtsgeschichtliche Beurteilung der Haffe durch v. Brünneck widerspricht der Ansicht Rörigs, daß die Haffe, im Gegensatze zum Meer, wie Binnengewässer behandelt seien.
Nun kommt es für unsere Zwecke nicht darauf an, seit wann das preußische Meeresfischereiregal unter noch unfertigen Verhältnissen ausgeübt sein mag, sondern nur darauf, daß es tatsächlich festzustellen ist. Die Entwicklung, mit der v. Brünneck rechnet, wäre möglich, ist aber nicht bewiesen. Es hindert nichts, anzunehmen, daß das Seefischereiregal ebenso alt ist wie das Binnenfischereiregal, so daß man nicht von diesem auszugehen braucht. Der Hauptgrund für v. Brünnecks Auffassung ist ja die Vermutung, daß der Orden das Meeresfischereiregal nach dem Muster Pommerellens ausgebildet habe. Es erklärt sich aber doch diese Vermutung daraus, daß v. Br. außer dem preußischen allein das Regal der Herzöge von Pommerellen bekannt geworden war, nicht aber der Rechtszustand an der Ostseeküste weiter westlich. Sonst würde er sicher auf diese verwiesen haben, so auch auf Pommern für den Unterschied zwischen "mare recens" und "mare salsum", der sich in pommerschen Urkunden genau so findet. Das
jetzt für die ganze deutsche Ostseeküste zusammengestellte Material läßt ja die mittelalterlichen Rechtsverhältnisse des deutschen Küstenmeeres in neuem Lichte erscheinen. An diesem Material aber redet Rörig immer vorbei, ohne es ernstlich anzupacken. Mit "Sonderbildungen" ist da nicht mehr auszukommen. Wir sind überzeugt, daß v. Brünneck, wenn er noch lebte, uns zustimmen würde; denn was er für Pommerellen und Preußen aus Urkunden über Fischereiverleihungen geschlossen hat, hätte er auch für Pommern, Mecklenburg usw. aus Urkunden gleicher Art gefolgert. - Die weiteren Ausführungen Rörigs erklären sich aus seiner Neigung, Rechtsentwicklungen aus allgemeinen Vorstellungen abzuleiten. Die Quellen widersprechen dem aber. Wie schließlich das preußische Seefischereiregal durch den Hinweis auf Caspar, Hermann von Salza, in Zweifel gezogen werden soll, wissen wir nicht. Die Darlegungen v. Gierkes über dieses Regal bleiben in jedem Punkte unerschüttert.
~~~~~~~~~


|
Seite 66 |




|
Anhang.
Auf die Exkurse a-d bei Rörig III, S. 29 ff., in jedem Punkte zu erwidern, sehen wir uns nicht veranlaßt. Wir bemerken nur:
zu a) Es ist unvorsichtig, daß Rörig sich zum Beweise der Wissenschaftlichkeit seiner Gutachten auf seine "vollkommen unabhängige Stellung beiden Parteien gegenüber" beruft, zu der unsere "dienstliche Abhängigkeit" von einer der Parteien im "seltsamen Gegensatz" stehe. Denn Rörig verteidigt doch nur immerfort, was er als Lübecker Archivar behauptet hat. Eine "dienstliche Abhängigkeit" bei der Gestaltung von Archivberichten hat es in Mecklenburg selbstverständlich nie gegeben, und es liegt uns fern anzunehmen, daß es in Lübeck je anders gewesen sein könnte. - Für die Fischerei vor 1500 verweisen wir auf unsere Ausführungen in Archiv II, S. 137 ff., die Rörig noch nicht vorlagen, als er den Exkurs schrieb, und auf die er später nichts entgegnet hat (vgl. Rörig III, S. 61, Anm. 15 am Schlusse). Das Buch von Giesebrecht, Wendische Geschichten, ist zwar schon von 1843, aber noch sehr brauchbar. Leider hat Rörig nicht das richtige Zitat untersucht. Es kommt nicht auf die Note 1 bei Giesebrecht I, S. 16, sondern auf die Note 2.
zu b) Auf Rörigs Behauptung, daß wir in unserem ungedruckten Erachten von 1923 "oberflächlich" geurteilt hätten, entgegnen wir, daß das Erachten zwar ergänzt und vertieft werden konnte, sich aber in den wesentlichen Punkten bewährt hat. Der Aufsatz von Techen über das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste, Hans, Geschbl. 12 (1906), ist nach seinem Erscheinen unserem Archiv nicht unbekannt geblieben, wie die Besprechung im Jahrbuche für mecklenburgische Geschichte 72, Jahresbericht, S. 19 f. beweist. Wir haben uns der Arbeit 1923 bedauerlicherweise nicht erinnert. Aber das Dogma, daß man keine Literatur übersehen dürfe, gilt immer nur solange, bis der Dogmatiker selber einmal dagegen verstößt. Da Rörig sich auf den Aufsatz besonders beruft, so hätte er auch wohl erwähnen können, daß Techen zwar für die Zeit bis zum Ende des 15. Jahrhunderts allen gedruckten Quellenstoff benutzt hat, für die spätere Zeit aber, wie er ausdrücklich


|
Seite 67 |




|
feststellt (S. 291), nur die Akten des Wismarer Ratsarchivs über die Strandungsverhältnisse in der Wismarer Bucht. Er konnte und wollte also für die Zeit nach 1500 nur einen Ausschnitt geben. Die Hauptakten für die ganze mecklenburgische Küste liegen in Schwerin, und sie schaffen über das Strandrecht in mancher Hinsicht erst Klarheit.
zu c am Ende) Die Wismarer Zeugenaussage von 1597 (Archiv II, Anlage I, S. 194, Zeuge 6): "Außer dem großen Bohme heiße es uf der Reide oder im Tiefe" ist wohl nicht so zu verstehen, als ob der Zeuge "das Wismarer Tief selbst eine Reede" habe nennen wollen, sondern er wollte wahrscheinlich sagen, außerhalb des Hafenbaums komme zunächst die Reede, dann das Tief. Der Ausdruck "Reede" erscheint hier ja ganz vereinzelt; die übrigen Zeugen sprachen nur vom Wismarer Hafen und Tief, und manche unterschieden ausdrücklich zwischen beiden. Im übrigen kommt es auf solche Benennungen nicht an. Und wenn der Zeuge 10 meinte, ein Hafen sei dort, wo man Schiff und Gut bergen könne, wie es im Wismarer Tief möglich sei, und dann hinzufügte: Vor Lübeck und Rostock heiße es eine Reede, so ist es doch ganz ausgeschlossen, in solchen Bezeichnungen, die eben nichts sind als Namen für Wasserflächen, auf denen man ankerte oder ankern konnte, einen Beweis für gebietsrechtliche Sonderbildungen zu erblicken. Auch erklärte der Zeuge 4 (Archiv II, S. 197), wenn die Schiffe sich vor anderen Städten außerhalb des Hafenbaumes befänden, so sage man, "daß sie in der See liegen".
zu d) Rörig hat behauptet, daß die Seestädte am landesherrlichen Strande Mecklenburgs bis ins 16. Jahrhundert eine Art von Herrschaft ausgeübt hätten, und erklärt dies mit dem politischen Übergewicht der Städte über die Territorien während des ganzen Mittelalters. Dem gegenüber haben wir auf die starke Stellung der Herzöge im 14. und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hingewiesen, die eine anerkannte geschichtliche Tatsache ist und sich auch im Verhältnisse zu den Städten geltend machte. Hierüber kann man sich aber nicht aus der Rörig in die Hände geratenen Geschichtlichen (d. h. rechtsgeschichtlichen) Übersicht unterrichten, die Böhlau seinem Mecklenburgischen Landrecht (I, 1871) vorangestellt hat. Diese Übersicht ist ohnehin zu einem guten Teil veraltet. Es hat mit dem herzoglichen Strande nicht das Geringste zu tun, daß Rostock sich im Verhältnisse zu anderen Territorialstädten innerhalb seines eigenen Gebietes großer Selbständigkeit erfreute, kraft seiner immer wieder von ihm betonten landesherrlichen Privilegien. Diese hat Herzog Albrecht II.


|
Seite 68 |




|
1358 durch den Verkauf der hohen Gerichtsbarkeit gekrönt. Daß aber Albrecht II. stärker war als Rostock, mag ja wohl auch Rörig nicht bestreiten wollen. Innere Selbständigkeit einer Stadt ist überhaupt noch kein Beweis für politische Macht. Und trotz seinen Vorrechten ist Rostock, ebenso wie Wismar, stets eine erbuntertänige Stadt geblieben, hat dies auch selber nie geleugnet. - Wegen der Enthauptung des Schwaaner Vogtes schließlich hätte Rörig sich mit unserer Anmerkung 96 in Archiv II (S. 59) auseinandersetzen sollen, nicht aber uns auf Koppmanns Geschichte der Stadt Rostock verweisen dürfen, die wir in der Anmerkung selbst und auch sonst mehrfach zitiert haben. Wir haben die Strand-These Rörigs überdies im einzelnen widerlegt. Sie kann in keiner Weise mehr in Betracht kommen, wenn sich auch Rörig (III , S. 121, Anm. 114) noch darauf berufen will.