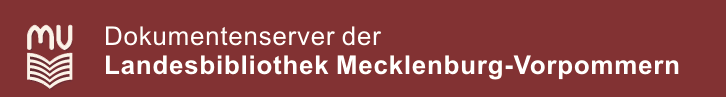|
[ Seite 27 ] |




|



|
|
:
|
II.
Mecklenburg
und die Reichsgründung.
Die Politik der mecklenburgischen
Regierungen
1866 - 1870/71.
Von
Dr. Karl Pagel in Berlin-Wilmersdorf.
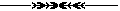


|
[ Seite 28 ] |




|
Die hier zum Abdruck gelangende Arbeit ist ein Teil der Dissertation "Mecklenburg und die deutsche Frage 1866 - 1870/71" (Rostock 1922), die auf Anreguug von Prof. Dr. W. Andreas, jetzt an der Universität Berlin, entstanden und unter dessen Leitung ausgeführt ist. Die Dissertation sucht das politische Leben in Mecklenburg in all seinen Elementen zu erfassen, die sich mit der deutschen Frage auseinanderzusetzen hatten. Neben den Regierungen werden als politische Faktoren Stände und Volk gewertet und in den Rahmen der Untersuchung gezogen.
In diesem Aufsatz beschränkt sich die Darstellung, in räumlicher Zusammendrängung, auf die Politik der Regierungen.
Exemplare der Dissertation sind in der Rostocker Universitätsbibliothek zugänglich. Dort sind die Quellen, auf die sich die Untersuchung stützt (meist unbenutztes Aktenmaterial), bezeichnet. Hier ist auf die Aufreihung von Quellennachweisen verzichtet. Zitate sind im Druck kenntlich gemacht.
Dankbar sei darauf hingewiesen, daß Herr Dr. Witte in Rostock eine Geldsumme zur Verfügung gestellt hat, die für die Kosten der Drucklegung mitverwandt worden ist.


|
[ Seite 29 ] |




|
D ie Staatsbildung Mecklenburgs hatte ihre Voraussetzung in geographischen Verhältnissen. Seine selbständige Existenz beruhte auf einer geographischen Abgelegenheit, die seine Geschlossenheit ausmachte. Zwischen den Stromgebieten der Elbe und der Oder lag es nach dem Inlande zu in einem toten Winkel. Seine Ostseeküste vermochte diesen Mangel nicht auszugleichen. Sie bedeutete, von den beiden Hafenplätzen, die ihre Kraft mehr außerhalb als innerhalb des Landes fanden, abgesehen, viel eher Abgeschlossenheit als Offenheit. Der passive Charakter des mecklenburgischen Staatsgebildes findet darin eine Erklärung.
Historische Bedingungen trafen mit diesen Tatsachen, aus denen sich wirtschaftliche Folgerungen ergaben, zusammen, verstärkten ihre Wirkung. Das Verhältnis des Fürstenhauses zu den Ständen des Landes, in dem die politische Auswirkung seiner materiellen Gegebenheiten erscheint, ließ eine dauerhafte Bildung politischer Aktivität nicht zu. Die innerpolitische Lage absorbierte alle politisch mögliche Entfaltung. Mecklenburg war in der Politik eine passive Rolle zugewiesen.
Eine Folge dieser Umstände war, daß es in den Bann des entstehenden brandenburgisch-preußischen Nachbarstaates gezogen wurde. Je stärker dieser wurde, desto mehr. Die wirtschaftliche Entwicklung, die in enger Verknüpfung mit der politischen einen Schwerpunkt im inneren Deutschland schuf, wirkte beträchtlich in dieser Richtung. Wirtschaftliche und politische Konzentration Deutschlands um den preußischen Kern zog auch Mecklenburg an, machte vor der bestehenden Abscheidung nicht Halt. Der Widerstand, den sie fand, war vor ihrer Kraft zu schwach. Er wurde überwunden.
Politisch gipfelte dieser Prozeß der Zusammenballung der deutschen Staatenwelt, der auch Mecklenburg nicht ausweichen konnte, in der Reichsgründung. Seine letzte Phase begann mit dem Faustschlag Bismarcks auf den Spieltisch des deutschen Bundes.
Wie Mecklenburg sich in seiner staatlichen Sphäre mit dem Werdeprozeß des Reiches von Königgrätz bis Versailles auseinandersetzte, sollen die folgenden Blätter schildern.
* *
*


|
Seite 30 |




|
1850 hatte Österreich Preußen gedemütigt, doch Preußen hatte die damalige Schwäche überwunden. Seine Zügel wurden in eine Faust gelegt, die alle Kräfte zu erzwingen wußte. Preußen erstarkte neben Österreich, und am Ende wurde Österreich von ihm geschoben und geleitet. Österreich ließ sich vor den Wagen Preußens spannen und leistete preußische Arbeit, bis es hieß Unterwerfung oder Kampf. Preußen war bereit, Bismarck wollte den Krieg, und Österreich ging leicht in die Falle.
Die Kleinstaaten suchten zu vermitteln, aber sie waren ihrer Sache zu ungewiß und zu schwach, als daß sie sich zu entscheidenden Schritten hätten aufraffen können. Selbst der Betriebsamkeit mittelstaatlicher Politiker vom Zuschnitt der Beust, Dalwigk und v. d. Pfordten gelang es nicht, das "dritte Deutschland" zusammenzufassen. Abwarten hieß ihre Parole, und klare Stellungnahme wurde ängstlich vermieden.
Mecklenburg tat nichts anderes. Auf preußische Anfragen, wie es sich im Falle des Konfliktes verhalten werde, gab es ausweichende Antwort. Die Notwendigkeit einer Bundesreform war anerkannt worden, so konnte man das Streben danach jetzt nicht abweisen. Jedoch: Reformen nur in den Grenzen des Bundesrechts. Man wollte sich nicht vorzeitig binden. Man wußte nicht, was kommen sollte.
Bismarck klärte bald über seine Absichten auf. Er legte am 9. April 1866 seinen Reformplan in Frankfurt vor. Er kritisierte die Unfähigkeit des Bundes und seine Mängel. Er wollte einen neuen Bund an seine Stelle setzen. Dazu rief er die Nation zu Hilfe. Er forderte eine Volksvertretung auf Grund direkter Wahlen und des allgemeinen Stimmrechts. Am Bunde war die Abneigung und die Verlegenheit, mit der man auf diese Pläne sah, groß. Nichts hatte man weniger erwartet. Man zweifelte sogar die Ernsthaftigkeit des preußischen Vorschlages an. Mit gewohnter Umständlichkeit beriet man ihn in einem Ausschuß.
Preußen hatte die Wahl des mecklenburgischen Gesandten für diesen Ausschuß nicht gewollt. Herr v. Wickede war gut freund mit Herrn v. Kübek, der Österreichs Stimme führte. Seine Regierungen waren in ihren Gesinnungen ihm verwandt. Immerhin wußte man in Berlin, daß der ausschlaggebende Faktor in Mecklenburg-Schwerin, der Großherzog Friedrich Franz, anders dachte und auch anders handeln werde, wenn es ans Handeln kommen würde. Die Unstimmigkeit zwischen Fürst und Regierung in dieser Frage war für Preußen eine feste Größe, mit der man rechnete.
Es bestand in der Tat keine Übereinstimmnng zwischen Friedrich Franz und seinen Ratgebern, unter denen die Meinung


|
Seite 31 |




|
v. Oertzens maßgebend war. Der Großherzog war seit Anfang April entschlossen, Preußen in seinem Vorgehen zu unterstützen. Und v. Oertzen hatte, obwohl er schon damals von Rücktritt sprach, seine Ansicht nicht durchzusetzen vermocht, die auf Erhaltung der Neutralität hinausging. Aber der Großherzog ließ es zu, daß er den Versuch machte, eine Koalition der norddeutschen Mittelstaaten nach dem Vorbild der süddeutschen herbeizuführen. Sie sollte sich richten gegen einen eventuellen Majoritätsbeschluß in der Parlamentsangelegenheit, dem man keine Folge leisten wollte. Dafür hatte sich der Großherzog gewinnen lassen, denn er war wie seine Minister Gegner des allgemeinen Wahlrechts und die Meinungsverschiedenheiten entsprangen mehr den Fragen der "auswärtigen" - der deutschen Politik. Doch kam es mit diesem Versuch zu keiner bindenden Abmachung, noch weniger zu einem praktischen Erfolg.
Als Österreich die schleswig-holsteinische Streitfrage vor den Bundestag brachte (1. Juni), trat die Reformangelegenheit formal in den Hintergrund, wenn sie tatsächlich auch gerade damit neue Nahrung erhielt und sich auf eine Stufe stellte, die jederzeit den Ausbruch der Krisis erwarten ließ. Schon am 11. Juni stellte Österreich den Antrag auf Mobilmachung aller nichtpreußischen Truppen. Mecklenburg nahm offiziell den Standpunkt ein, daß die schleswig-holsteinische Angelegenheit von Österreich und Preußen als europäischen Mächten geführt sei und auch erledigt werden müsse, als eine Sache, die den Bund nichts angehe. Die Beteiligung des Bundes am Kriege würde nicht, wie es seine Aufgabe sei, die Einzelstaaten in ihrer Existenz schützen, sondern sie in Gefahr bringen. So lehnte Mecklenburg den Antrag ab.
Wenn es auch übertrieben war, Mecklenburg im allgemeinen als zur "preußischen Partei" zugehörig anzusehen, so hatte man doch diese Haltung erwarten können. Bereits am 14. Mai hatte der "Norddeutsche Korrespondent" sich gegen die Behauptung fremder Zeitungen gewandt, daß er österreichische Politik treibe. (Seine Stellung zur Schweriner Regierung gestattet, ihn als zuverlässigen Zeugen anzusehen, wenngleich die Redaktion mehrmals die Bezeichnung eines Regierungsblattes abzulehnen versuchte.) "Wir sind," so heißt es dort, "nicht der Ansicht, daß ein Staat von den realen Bedingungen seiner Lage absehen und in einem Konflikte wie dem gegenwärtigen seine Stellung nach politischen Deduktionen nehmen dürfe. Aber gesetzt, es läge an uns, eine solche Einwirkung auf die Politik Mecklenburgs auszuüben, so würden wir es sicher nicht in das Lager Österreichs führen."
Eine entschiedene Hinwendung zu Preußen war damit nicht


|
Seite 32 |




|
ausgesprochen. Es gab manches an diesem Staat, was daran hinderte. Zwar das Bismarcksche Preußen, mit dessen "Parlament" man nichts anzufangen wußte, war nicht Preußen schlechthin. "Wir unterscheiden sehr wohl zwischen dem königlichen Preußen, mit welchem Mecklenburg durch Bande der Natur und der Geschichte in schwer löslicher Weise verbunden ist, und der jeweiligen Politik der obersten Räte des Königs." Diese aber lehnte man ab. "Drei Punkte sind es, in welchen wir mit der Politik des jetzigen preußischen Ministeriums nicht übereinstimmen: einmal die Begründung des Strebens nach dem einseitigen Besitz der Herzogtümer - dann die Berufung eines deutschen Parlamentes aus allgemeinen Wahlen - endlich das Zusammengehen Preußens mit Italien und die damit gegebene Eventualität indirekter Beihilfe zum Verlust Veneziens."
Das Machtstreben des preußischen Staates, das man aufs engste verband mit dem Ministerium Bismarck, das nicht Halt machte vor der ewigen unantastbaren Schranke des Bundesrechts, das sich nicht scheute, die revolutionären Kräfte der Tiefe zu beschwören, das auch vor dem Verrat am heiligen Österreich, zu dem man pietätvoll aufzuschauen gewohnt war, nicht zurückschreckte, das alles war einem ständisch-konservativ empfindenden Gemüte fremd und unverständlich und erweckte ihm Besorgnis. Daß dieser rücksichtslosen Entfaltung des preußischen Staates eine nationale Bedeutung zukam, erkannte man nicht, oder man übersah es. Haftete doch für jene Kreise der nationalen Idee ein revolutionärer Geschmack an, der es ihnen schwer machte, sich ihr zu nähern.
Inzwischen verlangte Bismarck in Mecklenburg Einverständnis über militärische Hilfeleistung - die kritische Abstimmung in Frankfurt hatte stattgefunden - und Einverständnis über den Eintritt in den neu zu errichtenden Bund. Voraussetzung für diesen Bund war Ausschließung Österreichs und Schaffung einer Nationalvertretung. Der Notenwechsel zwischen Schwerin und Berlin zeigt deutlich den Punkt, von dem der Widerstand gegen Preußen und seinen norddeutschen Bund seine Hauptnahrung erhielt: die Einführung des allgemeinen Wahlrechts griff das Prinzip des mecklenburgischen Staatswesens an.
Zunächst handelte es sich um eiligere Dinge: es war zu wählen: mit oder gegen Preußen? Die Entscheidung führte der Großherzog herbei, unwillig folgte sein Minister. Zwischen Friedrich Franz und dem preußischen König hatte eine Unterredung stattgefunden. Der Oheim hatte unschwer den Neffen bewegen können, auf seine Seite zu treten. Seine Truppen sollten als Besatzung nach den Elbherzogtümern gehen und dadurch preu-


|
Seite 33 |




|
ßische Kräfte frei machen. Als dann doch direkte Teilnahme am Kriege gegen Österreich und dessen Bundesgenossen verlangt wurde, sträubte der Großherzog sich anfangs. Aber eindringliche Mahnung an persönliche Freundespflicht fand erhofften Widerhall. Ein Briefwechsel (s. Anlage S. 69) stellte die Übereinstimmung wieder her. Er kennzeichnet die engen persönlichen Beziehungen beider Fürsten. Er zeigt, daß der persönliche Einfluß des Königs auf seinen Neffen nicht hoch genug angesetzt werden kann.
Durch das dringliche Wort des preußischen Königs bestimmt, ging der Großherzog über den Widerstand seines Ministeriums hinweg, das die Gesinnung der herrschenden Schicht des Landes repräsentierte, um den als richtig erkannten Weg entschlossen zu Ende zu gehen. Er zögerte nicht, sich an die Spitze seiner Truppen zu stellen und sie ins Feld zu führen für eine Sache, der er nach bester Überzeugung und nach schweren inneren Kämpfen Berechtigung zugestehen mußte. Seiner ernsten Natur und einem peinlichen Pflichtbewußtsein entsprach es, daß er nicht schnell und ohne gewissenhafte Überlegung handelte. Doch als er für sich eine Entscheidung gewonnen hatte, vertrat er sie mit Konsequenz. Seine Haltung zeigt, daß er nicht dem Zwange der Gewalt, sondern einem freien Entschluß folgte.
Während Oertzen an strengster Neutralität festhalten wollte und das Eingreifen in den preußisch-österreichischen Konflikt ablehnte, sah der Großherzog von vornherein, daß die Situation ein Zusammengehen mit Preußen erforderte. Der Staatsmann erkannte die Notwendigkeit, den Gesetzen der geographischen und politischen Lage zu folgen. Dem Soldaten war der Anschluß einer kleineren Truppe an eine große ehrengewohnte Armee seit Jahren erwünscht. Dem Sohn einer preußischen Königstochter erleichterten die Beziehungen zum Berliner Hof die Überwindung dynastischen Stolzes und Selbstgefühls zugunsten eines höheren Zweckes. Der Großherzog ergriff im Bewußtsein der Mängel der Gegenwart entschlossen die Hand der Zukunft. Sein Minister stellte sich schützend vor die Vergangenheit, die Zukunft furchtsam abwehrend.
In Mecklenburg-Strelitz hatte man sich eine Äußerung zu der preußischen Note vom 16. Juni, welche Mobilisierung und Anschluß an Preußen forderte, vorbehalten, bis der in England weilende Großherzog Friedrich Wilhelm zurückgekehrt sein würde.
Die zwar nur sehr sparsamen Aufzeichnungen, die der blinde Großherzog nach seinem Diktat niederschreiben ließ, lassen erkennen, welchen Eindruck der dann erfolgende Austritt Preußens aus dem Bunde auf ihn machte. Die Nachricht von der Besetzung Han-


|
Seite 34 |




|
novers, Sachsens und Hessens durch Preußen brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Erbittert kehrte er heim, durchaus nicht geneigt, den preußischen Forderungen nachzugeben. In Berlin stieg er auf der englischen Botschaft ab. Den König suchte er nicht auf.
Seine Regierung, die v. Bülo 1 ) leitete, hatte sich inzwischen völlig abwartend verhalten. Bülow hatte bei der Schnelligkeit der Ereignisse fast die gewohnte Fühlung mit Schwerin verloren. Um einheitliches Vorgehen wiederherzustellen, legte Bülow dem Schweriner Kollegen in einem ausführlichen Schreiben vom 18. Juni seine und des Großherzogs Auffassung dar. Die Absicht Friedrich Wilhelms, seit die deutsche Krisis diese ernste Wendung genommen, sei dahin gegangen, unter Festhalten an den Bundesverträgen und der unauflöslichen Bundesverfassung sich auf neutraler Seite zu halten, möglichst für Erhaltung des Friedens zu wirken und weder an einer Koalition oder an Bundesbeschlüssen gegen Preußen, aber auch nicht an Reformversuchen sich zu beteiligen, "welche mit Geist und Grundlagen der Bundesverfassung unvereinbar sind". Davon versprach er sich die Erhaltung einer selbständigen Stellung.
Ob das unter den eingetretenen Verhältnissen noch gelingen könne, bezweifelte Bülow - "jetzt, wo die Sachen so stehen, daß eine Berufung auf das bisherige Bundesvertragsrecht vielleicht als eine Kriegserklärung gegen Preußen aufgefaßt werden würde". Aber eine Berechtigung, diese Verträge für null und nichtig zu erklären, erkannte er nicht an, auch wenn sie vermeintlich von der "Mehrheit der Bundesgenossen verletzt und gebrochen seien, nicht für Preußen als den verletzten, geschweige denn für andere unbeteiligte Staaten". Jedes Staats- und Vertragsrecht würde wertlos sein, wenn es durch einseitige Erklärung beiseite geschoben werden könne. "Auf solcher Basis würde der neue Bund von höchst
Vgl. Hermann v. Petersdorff: "Deutsche Männer und Frauen" Artikel über Bülow. S. 100.


|
Seite 35 |




|
problematischem Wert sein, ganz abgesehen, daß ein Bund nicht durch einen Bürgerkrieg begründet werden kann und ein Bundesstaat, der in allen wichtigen Entscheidungen eine nach Volkszahl zu ermittelnde Majorität als Regulator in Aussicht nimmt, gegen den jetzigen Bund mit seinen weisen und zahlreichen Rechtsbürgschaften ein schlimmer Rückschritt ist." "Es scheint mir daher," so heißt es wörtlich, "ungeachtet aller politischen Gefahren doch im Interesse unserer politischen Stellung, der Unabhängigkeit unserer Fürsten und der Wahrung unserer Landesverfassung dringend geboten, die noch immer zu Recht bestehende Bundesverfassung nicht aufzugeben. Dieselbe ist tatsächlich leider suspendiert . . .. ein Sonderbündnis aber vor und während eines inneren Krieges ist für konservative Staaten, die fest und treu zur Bundesverfassung gehalten und keinen anderen Wunsch als Herstellung eines haltbaren Friedens haben, um so bedenklicher, als wir dann keine andere Garantie haben als das unsichere Kriegsglück oder den guten Willen eines übermächtigen Nachbars. Die Ereignisse gehen so rasch, und die Rechts- und Machtverhältnisse in Europa haben sich . . . so geändert, daß die Mittel- und Kleinstaaten kaum noch ein Gewicht in die Wagschale legen können und ihnen die Existenz näher liegt als Rechtsfragen - zumal in einem Augenblick, wo gleichzeitig Frankreich die Reduktion der Zahl der deutschen Staaten und Preußen die Lösung der "unauflöslichen" Verträge proklamiert - mir scheint indes, daß, wie die Existenz am Ende doch vom Recht abhängt . . ., nicht bloß eine Manifestation zugunsten des Rechtes den mecklenburgischen Großherzogtümern, als den konservativsten deutschen Ländern, wohl anstehe, sondern darin auch das vielleicht einzige Mittel zu finden sein würde, die jetzt gestellten Verlangen in angemessener Weise ablehnen, die Neutralität behaupten zu können und nach Ausgang des Krieges auf dem Rechtsstandpunkt befunden zu werden."
Hier spricht dieselbe Welt, die den Gedanken der Heiligen Allianz zur Reife brachte, eine Welt, die nicht wissen will, daß Macht wohl stärker ist als Recht, die nichts ahnt von dem Konflikt von Macht und Recht und von der Problematik ihrer Abgrenzung und der Bedingtheit ihrer Geltung, - eine Welt, die für Recht hält, was beschworen und in alten Verträgen geschrieben steht. Und doch: hinter diesem unbedingten Festhalten des "Rechtsstandpunktes" birgt sich ein Instinkt für die Realität der Lage, der nicht bloß das Recht um des Rechtes willen hochhält, sondern ein Instinkt, der sehr reale Interessen mit diesem Schilde deckt. Ein Anschluß an diese oder jene Partei brachte unweigerlich, wenn überhaupt eine Entscheidung erzielt wurde, den Verlust der bis-


|
Seite 36 |




|
herigen selbständigen Existenz. Eine Entscheidung zwischen den beiden Großmächten, die die eine zum Sieger über die andere machte, mußte den alten Bund, und damit das Lebenselement der deutschen Kleinstaaten, zerstören. Mecklenburg besonders war durch seine geographische Lage, sobald der Schutz des Bundes aufhörte, an Preußen ausgeliefert ohne eine Möglichkeit des Widerstandes. Bevor aber der preußische Sieg mit Sicherheit vorauszusehen war, war ein Aufgeben des Rechtsbodens ein "politischer Selbstmord".
Zwar mußte das Vorgehen Preußens gegen Hannover und Sachsen zur Vorsicht mahnen, und es blieb sicher nicht ohne Einfluß auf die Entschlüsse in Mecklenburg. Aber der Versuch, die Selbständigkeit zu wahren, solange es anging, war Pflicht für jeden Staat, solange er an die Berechtigung seiner Existenz glaubte - wenn nicht, wie bei Friedrich Franz, irgendwelche Momente die Lösung von diesem natürlichen Gedanken vermittelten. Die Schweriner Regierung dachte wie Bülow und sein Landesherr. Hätte Friedrich Franz die Gesinnung Friedrich Wilhelms von Strelitz geteilt - die Dinge hätten einen anderen Lauf nehmen können.
Auch Friedrich Franz war nicht frei von legitimistischen Anschauungen, und auch sein Rechtsempfinden regulierte sich keineswegs allein nach Tatsachen und Machtverhältnissen, aber er war imstande, diesen ihre Berechtigung zuzugestehen und sie mit in seine Rechnung zu setzen. Und ihm wurde diese Rechnung leichter, weil er auch Resultate daraus zog, die ihm erwünscht waren.
Wenn Friedrich Franz eine klare Entscheidung für sich und sein Land herbeigeführt hatte, so folgte ihm auch jetzt noch seine Regierung darin nicht. Oertzen spielte (in offiziellen Noten an Nachbarstaaten!) noch eine Zeitlang mit dem sophistischen Gedanken einer "Suspendierung" des Bundes. Zu einer amtlichen Absage, zu einem Austritt kam es erst in der Schlußsitzung des Bundestages im Juli.
Als der Strelitzer Großherzog in sein Land zurückgekehrt war, mußte es sich darum handeln, eine Entscheidung über die Stellung zu Preußen auch für Strelitz herbeizuführen. Eine Unterredung mit dem Schweriner Vetter hatte ihn diesen sehen lassen als "theoretisch ganz korrekt, wenn auch praktisch eigentlich mit den gräulichen Preußen schon verbunden" 2 ) Offenbar hatte man sich


|
Seite 37 |




|
nicht völlig ausgesprochen. Und während von Schwerin am folgenden Tage ein Bevollmächtigter zum Abschluß einer Militärkonvention nach Berlin geschickt wurde, begab sich der Strelitzer Landesherr dorthin, um für sich Neutralität zu erlangen, die ihm vom König auch zugesagt wurde 3 )
Die Neutralitätszusage war die Basis für die Antwort auf die preußische Note vom 16. Juni.
Die darin vertretenen Ausführungen decken sich mit den Auffassungen, die Bülow Oertzen gegenüber in dem Schreiben vom 18. Juni ausgesprochen hatte. Sie gipfeln in bezug auf den Reformvorschlag darin, daß in einem Augenblicke, in dem noch alles völlig ungewiß und unbestimmt sei, eine Zusage eine definitive Zustimmung nicht sein könne. "Der Großherzog erblicke nur in einer auf den Grundlagen des Rechts und der eingehenden Prüfung zustande gebrachten Vereinbarung die Gewähr der Einigkeit und Dauer."
Infolge des erhaltenen Neutralitätsversprechens sah man sich nicht veranlaßt, auf die Militärforderungen einzugehen.
Diese Antwort erweckte bei der preußischen Regierung keinen sonderlich guten Eindruck. Im Gegenteil wird in der Antwort vom 7. Juli, also nach der Schlacht von Königgrätz, die Verabredung mit dem König einfach übergangen und in sehr deutlicher Form die dortige Auffassung ausgesprochen: "Der Unterzeichnete ist beauftragt, wiederholt um eine unverweilte Erklärung, und zwar nunmehr über den unbedingten Beitritt des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz zu dem Vorschlage wegen der Bundesreform und zu dem Sr. K. H. dem Großherzog angetragenen Bündnisse zu bitten. Sollte diese Erklärung nicht in zufriedenstellender Weise erfolgen, so werden S. M. der König allerhöchst sich genötigt sehen, das Großherzogtum besetzen zu lassen."
Dieser entschiedene Ton tat selbstverständlich seine Wirkung. Der Großherzog gab am 11. Juli den Befehl zur Mobilisierung 4 )
In dem Widerstand, den mehr oder weniger hartnäckig beide mecklenburgischen Regierungen gegen das preußische Vorgehen


|
Seite 38 |




|
leisteten, war natürlich als stärkster Faktor ein nackter Selbsterhaltungstrieb enthalten, der um so begreiflicher war, als die Ausführung des preußischen Reformvorschlages aufs schwerste die Grundlagen des mecklenburgischen Staatswesens, seine ständische Verfassung, zu erschüttern drohte, mit der nach der Anschauung der herrschenden Schicht das Wohl des Landes sich verband. Aber es waren nicht nur Nützlichkeitserwägungen, die zum Widerstand aufriefen. Es bestand ein geistiger Gegensatz zu dem geplanten preußischen Bunde, in seiner innerpolitischen Gestaltung nicht nur, sondern auch in der allgemeinen Auffassung des Staates, als dessen Grundlage man das "Recht" ansah, das im Deutschen Bunde verkörpert war. Man dachte noch völlig in den Anschauungen der Heiligen Allianz, deren Kind der deutsche Bund war, daß man den Gedanken nicht los wurde, der "deutsche und europäische Friede könne nur auf einem allgemeinen Kongreß" wiederhergestellt werden. Mochte sich dahinter hier und da vielleicht auch der Wunsch verbergen, daß durch das Eingreifen des Auslandes die Erhaltung der eigenen Selbständigkeit erleichtert werde, so ist doch der Gedanke "einer neuen dauernden Rechtsgrundlage" auch ohne jeden egoistischen Nebengedanken ausgesprochen worden, und die "Rechtsgrundlage" war damals noch manchem mehr als ein bloßer Rettungsanker in dem Strudel unitarischer Zeitströmungen. In ihr verkörperte sich der Wille Gottes - das Heilige "von oben" gegen das Unheilige "von unten".
Unter dem Zwange einer politischen Notwendigkeit, nicht nach eigenem freien Wunsche stellten sich die beiden Mecklenburg an Preußens Seite. Der Großherzog von Schwerin fand sich leichter in die Situation hinein. Er stellte sich dem König von Preußen


|
Seite 39 |




|
zur Verfügung und übernahm die Führung eines Reservekorps, dem auch seine mecklenburgischen Truppen angehörten, und führte es nach Bayreuth und Nürnberg, wo er als Sieger einzog. Er bekundete so öffentlich die Aufrichtigkeit seiner Haltung zu Preußen und gewann sich dadurch eine geachtete Stellung im Bunde.
Seine Regierung, seine Minister hatten es schwer, ihm zu folgen. Oertzen stand auf gänzlich anderem Boden. Oft gab es Verstimmungen und Meinungsverschiedenheiten zwischen Minister und Fürsten. Oertzen wollte seinen Abschied nehmen und blieb nur auf den dringlichen Wunsch seines Herrn in einer Stellung, welche ihn zu Handlungen zwang, die gegen seine Überzeugung liefen.
In Strelitz hatte Bülow am klarsten die Situation erkannt. Er sah am unbefangensten in die Zukunft. Er wußte, was zu erwarten stand, und richtete sein Handeln danach. Wohl fühlte er mit seinem Herrn. "Allerhöchstdieselben haben nicht bloß getan, was möglich war, und immerhin einige Wochen gewonnen, sondern es wird auch die Geschichte nicht vergessen, daß Ew. K. H. als der letzte unter den nord- und mitteldeutschen Souveränen die Fahne des Bundesrechts hochhielten und nicht den preußischen Lockungen, sondern nur der Übermacht nachgaben. . . In Gottes Hand stehen Folgen und Zukunft, und solange das Land seinen angestammten Herrn hat, ist auch noch Hoffnung auf bessere Zeiten."
Jedoch Sicherheit des Blickes für die Realitäten des Lebens hütete ihn vor falschen Hoffnungen, die man wohl in Strelitz hegen mochte. Von einer Hilfe des Auslandes erwartete er nichts. "Die Mainlinie ist Preußen sicher." Ob aber". . . wirklich ein siebentägiger Krieg ausreicht, um alle Monarchen zu stürzen und Deutschland zu unterwerfen", schien ihm doch noch ungewiß. Er erkannte auch die schwierige Lage Preußens. Würde es die Geister bannen können, die es rief? "Die preußische Regierung wird es schwer haben, daß nicht die liberale und radikale Partei sie weiter treibt, als sie selbst es will." Auch ohne die spätere Entwicklung Bülows zu kennen, spürt man doch schon in solchen Äußerungen einen Mann, dessen Blickfeld nicht durch doktrinäre Einseitigkeit beengt ist. Man fühlt hier einen politischen Geist, der nicht in engen Formeln denkt, der einen Sinn hat für lebendige Zusammenhänge der Welt und die Fähigkeit, ihre Kräfte gegeneinander abzuwägen, wenn er auch die Spuren seiner Herkunft nicht verleugnen kann. Aber in ihm leben Kräfte, die ihn seinen Platz finden lassen werden in der neu entstehenden Welt, die die Hemmungen überwinden lassen, die ihm anhaften in der Stellung zu den umwälzenden Ereignissen des Revolutionsjahres 1866.


|
Seite 40 |




|
Er rückt damit in eine Linie mit Friedrich Franz II., wie Oertzen und Friedrich Wilhelm von Strelitz als Männer einer abgeschlossenen Epoche eine gewisse Gleichstellung einnehmen. Wie Oertzen niemals die Aussöhnung mit der Neugestaltung vollziehen konnte, so gilt das noch mehr von dem blinden Friedrich Wilhelm, der bis an seinen späten Tod nicht vergessen konnte.
Der Schweriner Großherzog zog 1870 nach Frankreich, für Deutschlands Größe zu kämpfen, der Strelitzer Ministe 5 ) wurde im Reich ein Mitarbeiter des großen Bismarck.
* *
*
Das mecklenburgische Volk hatte an der Entscheidung keinen Teil. Es sah sich vor eine Tatsache gestellt.
Die große Masse blieb unbeteiligt. Politische Dinge lagen ihr fern. Der Adel, die politisch herrschende Schicht in Mecklenburg, äußerte leidenschaftliche Abneigung. Ein liberales Bürgertum erkannte, nachdem altes Mißtrauen gegen Bismarck überwunden, in Preußen den Bundesgenossen in der nationalen Frage und in der Gegnerschaft gegen den ständischen Staat, dessen geschworener Feind es war. Politische Bedeutung kam der Stimmung des Volkes erst zu, als es sich rüstete zur Wahl seiner Vertreter im Parlament des norddeutschen Bundes (s. Vorbemerkung).


|
Seite 41 |




|
Inzwischen stürmten die Ereignisse unaufhaltsam vorwärts. Es kam der Tag von Nikolsburg. Bismarck übersah den Erfolg des Kampfes, den er entfesselt, und wußte die Geister zu bannen. Es galt, die Fäden, die er ausgeworfen hatte, zu einem festgespannten Netz zusammenzuziehen. Die Bundesgenossen wurden aufgefordert (4. August), zum Abschluß eines Bündnisvertrages auf Grund der Note vom 16. Juni Bevollmächtigte nach Berlin zu entsenden. Der Entwurf dieses Vertrages wurde gleichzeitig übergeben.
In Mecklenburg zögerte man mit einer offiziellen Antwort. Aus einer Korrespondenz mit dem oldenburgischen Ministerium erkennt man, daß die Zurückhaltung sich aus der Abneigung gegen die Schaffung einer Volksvertretung herleitete. Militärischen Anforderungen des Bundes war man bereit nachzugeben. Aber vor der "Kopfzahl" des Parlamentes wollte man eingewurzelte Prinzipien nicht preisgeben. Gegen Berlin deckte man sich mit der Abwesenheit des Großherzogs von Schwerin. Es wurde auch die "vielleicht" notwendig werdende Einberufung des Landtages angekündigt.
Auf preußisches Drängen jedoch gab man nach. Wenn auch nur unter Vorbehalten. Die mecklenburgischen Vertreter gingen zu Unterhandlungen nach Berlin. Oertzen war zäh genug, zu erreichen, das die freie Entscheidung noch bis zur Zustimmung der Stände offengehalten wurde. So kam am 21. August ein besonderer Bündnisvertrag der beiden Mecklenburg mit Preußen zustande. Alle übrigen Bundesgenossen hatten bereits am 18. August unterzeichnet.
Man wird fragen, warum die mecklenburgischen Regierungen so fest und zäh das Recht ihrer Stände verteidigten, obwohl es doch begreiflich gewesen wäre, wenn etwa das Fürstenhaus unter der Gunst dieser Umstände die Gewalt der Stände gebrochen hätte, die doch das Machtgebiet der Fürsten außerordentlich beschränkte. Wenn bei den Großherzögen dazu der Wille vorhanden gewesen wäre, so würde es ein Leichtes gewesen sein, die ständische Verfassung zu beseitigen. Aber beiden Fürsten lag diese Absicht fern, und ihr Eintreten für das ständische Recht entsprach völlig ihrer Gesinnung. Es war auch nicht so, daß man die Bindung an Preußen hinausschieben wollte, etwa in der Hoffnung auf das Nichtzustandekommen des preußischen Bundeswerkes durch das Eingreifen Europas. Selbst wenn solche Hoffnungen hier und da auch an maßgebender Stelle genährt sein mögen, so hat man in dem Ausspielen der ständischen Rechte doch nichts weiter zu erkennen als den Versuch, mit diesen die staatliche Selbständigkeit nach


|
Seite 42 |




|
innen, die "Landesverfassung" und die "Unabhängigkeit der inneren Gesetzgebung" zu erhalten. Das war um so natürlicher, als die Minister sämtlich aus der ständischen Sphäre hervorgingen und durchaus in ihr wurzelten - materiell wie geistig. Sie hielten die Rechtsgrundlage fest und wehrten jede Verletzung ab. Ihren praktisch-politischen Zielen stand eine ideelle Begründung zur Seite. Es ist der Kampf des "Rechts" gegen die "Macht", der hier und immer wieder in immer neuen Formen gekämpft wird - eines Rechtes allerdings, das sich verknüpft oft mit sehr handgreiflichen Interessen. Der Glaube aber an seine unbedingte Gültigkeit ist in dem Bewußtsein der Kämpfer durch Generationen hindurch eingewurzelt, und seine materielle Form steht für sie unantastbar da als der erhabene Ausdruck göttlichen Willens, als dessen Werkzeug man sich fühlt. Man würde Unrecht tun, wollte man in diesem zähen Festhalten an Recht und Gerechtigkeiten nur Eigensucht erblicken und heuchlerische Maske. In ihm steckte ein edler Kern sittlichen Wollens und Glaubens, der sich zur Wehr setzt wider die unheiligen Kräfte der neuen Zeit, die einzubrechen drohen in den sorgfältig gehegten Frieden eines sozialen Lebensideals - eines Lebensideals allerdings, das einem robusten Klassenegoismus gleichsieht, wenn das Bewußtsein der aus ihm erwachsenden sittlichen Verpflichtungen seinen Trägern fehlt und verloren gegangen ist. Daß unter dem Rankenwerk menschlicher Triebe und Leidenschaften jener Kern gar oft überwuchert wurde und mit dem Guten viel Böses sich vereinigte, wer wollte sich darüber verwundern? - Aber der Glaube an jenes Gute war da, und er macht seine Bekenner liebenswert bei allen Verirrungen und Schwächen menschlicher Natur. - -
Die Regierungen mochten glauben, daß, wenn Preußen die volle Rechtskraft der Verträge von der ständischen Ratifikation abhängen ließ, damit eine Anerkennung der Stände ausgesprochen sei, auf die man in Zukunft zurückgreifen konnte.
Die Regierungen gingen alsbald an die Einberufung des Landtages. Gleich nach Rückkehr der Staatsminister von Berlin verabredeten sie die Ausschreibung eines Landtages auf den 26. September. Man einigte sich auf Schwerin, obwohl der Großherzog von Strelitz eine der stillen Landtagsstädte vorgezogen hätte, um den Charakter des Ungewöhnlichen wenigstens äußerlich zu unterdrücken.
Für die Regierungen lag der Wert des Landtages darin, daß sie einen Rückhalt gewannen in ihrer Defensivstellung. In den zu erwartenden Verhandlungen über die Bundesverfassung würde man sich auf den Willen des Landtages berufen können, der doch


|
Seite 43 |




|
irgendwie als Ausdruck des Volkswillens gedeutet werden konnte. Deshalb brauchten sie die Zustimmung der Stände. Eine Ablehnung der preußischen Forderungen durch den Landtag hätte die Regierungen ebenso in Schwierigkeiten gebracht, als sie die ständische Position unhaltbar gemacht hätte.
Die Stände waren klug genug, im letzten Grunde doch nachzugeben und die Politik der Regierungen zu sanktionieren, wie groß auch in Wirklichkeit ihre Feindschaft war.
Die Regierungen waren damit an der Gefahr vorüber, durch die Ablehnung ihrer Propositionen an Preußen ausgeliefert zu werden. Im Gegenteil, sie konnten das Votum der Stände, das möglichste Erhaltung der innerstaatlichen Selbständigkeit verlangte, als Rückhalt benutzen in ihrer Abwehr dem Bunde gegenüber.
* *
*
Mit den Bündnisverträgen vom 18. und 21. August und mit den Friedensschlüssen mit Sachsen und Hessen war die Grundlage gegeben zu den Verhandlungen über die Bundesverfassung. Es ist bekannt, daß die Krankheit Bismarcks den sofortigen Beginn der Verhandlungen hinausschob, so daß sie erst nach dessen Genesung aufgenommen wurden. Als dann der Verfassungsentwurf unter Bismarcks Leitung fertiggestellt war, wurde er den Bevollmächtigten der verbündeten Regierungen am 15. Dezember in Berlin vorgelegt.
Schon vor dem Abschluß des Bündnisvertrages vom 21. August war nach Mecklenburg eine Aufforderung ergangen, die Maßnahmen zur Wahl des Parlaments vorzubereiten (16. Juli). Die Frage des Bundes nahm damit greifbarere Formen an und zwang zu einer Auseinandersetzung. Über die Besprechungen, die über diesen Gegenstand in den Ministerien geführt worden sind, liegen Aufzeichnungen nicht vor. Jedoch versteht es sich von selbst, daß man nicht ergebungsvoll die Dinge an sich herankommen ließ, sondern sich so gut es ging zur Abwendung des zu erwartenden Übels rüstete.
Ein in dieser Beziehung sehr interessanter Brief Oertzens (Entwurf - 19. Juli 1866) an den Professor V. Amadeus Huber, einen bekannten Sozialpolitiker konservativer Richtung, mit dem Oertzen schon in den vierziger Jahren, als Huber der Rostocker Universität angehörte, in nähere Berührung gekommen war, bietet Gelegenheit, die Gedanken kennenzulernen, welche damals den Minister bewegten und die wohl Gegenstand solcher Beratungen gewesen sind. Zu einem gewählten Parlamente, so war seine Mei-


|
Seite 44 |




|
nung, werde es kommen müssen. Dagegen zu opponieren, werde zwecklos sein. Wenn damit auch die Form des zukünftigen Staatswesens bestimmt schien, so hielt er es doch für möglich, deren Inhalt den eigenen Wünschen anzupassen. Und "um für diesen freilich ungleichen und hoffnungslosen Kampf eine einigermaßen gesicherte Position zu gewinnen", hielt er es für "das beste, vielleicht einzige Mittel, sich auf die englischen Parlamentseinrichtungen zu berufen". Wenn die englische Verfassung zwangsweise in Deutschland eingeführt werden solle, so werde man sich doch auf den richtigen Sinn der englischen Einrichtungen beziehen dürfen. Er bezeichnet es als sein Streben, "das deutsche Parlamentswesen seines durch und durch revolutionären Charakters zu entkleiden und dem englischen soviel als möglich ähnlich zu machen". Die spezielle Kenntnis Hubers in den englischen Verhältnissen nun veranlaßt Oertzen, sich bei ihm Rats zu holen. Er fragt nach den gegenwärtigen Verhältnissen der englischen Verfassung und nach ihrer historischen Entwicklung. Die Notwendigkeit eines Oberhauses neben dem Unterhause steht ihm fest. Das allgemeine Wahlrecht möchte er durch einen "sog. Zensus" eingeschränkt wissen. Passive und aktive Wahlfähigkeit sollen auf verschiedener Rechtsgrundlage ruhen. Um den bestehenden Ständeversammlungen nicht schroff und unvermittelt ein neues Parlament gegenüberzustellen, denkt er daran, jenen ein Vorschlagsrecht einzuräumen, das die Zahl der wählbaren Kandidaten einschränkt. Auch die Befugnisse des Parlamentes möchte er auf "Bewilligung neuer Gesetze und neuer Steuern" beschränkt wissen, wie er es für England annimmt, bevor das Parlament zu seiner "gegenwärtigen Omnipotenz" gelangt sei.
Die zu Anfang bekundete Absicht der Entrevolutionierung leuchtet in allen Fragen hervor. Sein Streben ist gerichtet auf die Schaffung konservativer Sicherungen. Aber der fragebogenartige Brief, der keine bedeutende Kenntnis der englischen Verhältnisse erkennen läßt, blieb unbeantwortet. Huber lag schwer krank und konnte die erwünschte Auskunft nicht geben. Der Minister blieb ohne den Rat des Gelehrten. Doch die damals ausgesprochenen Gedanken begleiteten ihn auf die Ministerkonferenzen, wo die Umstände es allerdings nicht erlaubten, sie hervorzudrängen oder gar zu verwirklichen.
Es hätte nahe gelegen, daß die Kleinstaaten sich untereinander verständigten, bevor sie nach Berlin gingen, und Verabredungen über eine gemeinsame Haltung getroffen hätten. Die Akten ergeben für Mecklenburg darüber nichts. Vielleicht verzichtete man darauf, weil man durchaus im Ungewissen war, was für ein Ge-


|
Seite 45 |




|
richt man von Preußen würde vorgesetzt bekommen. Vielleicht hielt man sich auch von vornherein zurück, um bei der etwas prekären Lage Mecklenburgs (wegen der Verfassung) durch solches Vorgehen nicht Preußens und Bismarcks Unwillen zu erwecken.
Wie empfindlich die Preußen in diesem Punkte waren, zeigte sich im Laufe der Verhandlungen. Jede nähere Berührung der Bevollmächtigten untereinander wurde mit Mißtrauen angesehen.
Einem Zusammengehen der Kleinstaaten stand auch die ungewisse Haltung gegen die größten unter ihnen, Sachsen und Hessen, im Wege. Daß aber auch die Stimmung aufkommen konnte, in der bevorzugten Behandlung der "Besiegten" eine Zurücksetzung der "Bundesgenossen" zu erblicken, ist begreiflich. Auch die mecklenburgischen Regierungen waren nicht frei davon.
Am 15. Dezember traten die Bevollmächtigten zur Beratung des Verfassungsentwurfes zusammen. Es gab bald auf Wunsch Sachsens eine Unterbrechung. Im Januar setzte man die Verhandlungen fort. Der Entwurf hatte keinen guten Eindruck gemacht. Er ließ keine befriedigte Stimmung aufkommen. Man fühlte sich wegen der angesonnenen Opfer bedrückt. Ein rascher Abschluß des Verfassungswerkes schien nicht in Aussicht.
In Mecklenburg teilte man die Unzufriedenheit über den preußischen Entwurf. Friedrich Franz schrieb am 18. Dezember, als ihm der Inhalt der Bündnisvorlage bekannt geworden war, in sein Tagebuch: "Zu stramm, nicht annehmbar ohne Änderungen." Daß Hof- und Regierungskreise mit dem Entwurf nicht einverstanden waren, war von vornherein zu erwarten. Aber auch der Großherzog, der, als im Sommer die Entscheidung drängte, nicht lange geschwankt hatte und zu ihrer Herbeiführung entschieden auf die Seite Preußens getreten war; dem seit Jahren eine Lösung der deutschen Frage durch Preußen als die richtige vorgeschwebt hatte, auch er war durch die preußischen Anforderungen betroffen und hielt sie für unannehmbar. Es ist ohne Zweifel, daß seit den Kriegswochen, die den Soldaten unter preußischen Fahnen hatten kämpfen sehen, die Stimmung des Fürsten, der für die Selbständigkeit seines Landes fürchtete, Preußen gegenüber eine andere geworden war. Der atemraubende Schwung jener Entscheidungstage, der sich auch dem Großherzog mitgeteilt hatte, war zurückgeebbt. Das soldatische Siegergefühl, das ihm vergönnt gewesen war, war einer nüchternen Ruhe gewichen, die die Dinge in ihrer nackten Wirklichkeit und Eindeutigkeit sehen ließ. Die Auffassung war nicht selten, daß die preußischen Siege nicht im Interesse Deutschlands erfochten waren, oder daß doch die preußischen Macht-


|
Seite 46 |




|
haber nur an eine Verstärkung der preußischen Machtstellung gedacht hätten. Das mußte verstimmen und verletzen.
In seinem Lande war der Großherzog von vielen Seiten angefochten. Seine Minister vertraten einen entgegengesetzten Standpunkt. Die Ritter boykottierten ihn, und es konnte keine Empfehlung für die Neugestaltung sein, daß die als revolutionär und umstürzlerisch angesehenen Liberalen und Demokraten sich zu ihr bekannten. Es kommt noch hinzu, daß verwandtschaftliche Einflüsse ihn unsicher machen mochten. Briefe der Königin von Bayern erlauben eine Andeutung in dieser Richtung. Das Schicksal der hannoverschen Königsfamilie, zu der der Großherzog in persönlichen Beziehungen stand, konnte nicht ohne Eindruck bleiben. Und hatte Friedrich Franz auch das Verhalten Georgs von Hannover tadeln können, so mußte doch die rücksichtslose Verletzung des monarchischen Prinzips ihm Mißfallen erwecken. Und die ersten Monate des Jahres 1867, bis hinaus über den Abschluß des Bundes, bedeuteten für ihn eine Zeit seelischer Bewegtheit und Erschütterung, wie sie aus seinem Tagebuch spricht. Sie mußte eine Unsicherheit der Haltung zur Folge haben.
An dem Zustandekommen der Bundesverfassung entscheidend mitzuwirken, hatten Mecklenburg und seine Vertreter kein Gewicht. Man blieb auf die Äußerung von Wünschen beschränkt.
Eine Reihe von Randbemerkungen von Oertzens Hand in dem von ihm benutzten Handexemplar des Verfassungsentwurfes läßt den Geist erkennen, in dem er auf die Verhandlungen einzuwirken suchte. Alle lassen sie das Streben erkennen, den Bund "föderativer" zu gestalten. So findet sich die Notiz, die sich gegen Verfassungsänderungen und Kompetenzerweiterungen richtet und besagt, daß die "Ausdehnung der Bundeskompetenz nur durch Verträge" zulässig sein solle. Die Stellung des Bundesrates ist zu wenig präzisiert. "Er sollte das Organ sein, durch welches der Bund seine Entschließungen faßt," so daß er also manche Rechte des Präsidiums übernehmen soll. Deshalb sollten "auch politische Verträge dem Beschluß des Bundesrates" unterliegen. Zur Verstärkung des föderativen Prinzips solle Preußen im Bundesrat weniger Stimmen führen, lieber solle ihm ein Veto eingeräumt werden. Preußen dürfe auch nicht die Ausschüsse ernennen, dem Bundesverhältnisse entspräche freie Wahl. Einzelne Befugnisse, die dem Bundesfeldherrn zugewiesen waren, wie die Verfügung über die Bundesfestungen und die Herbeiführung der Exekution gegen Bundesmitglieder bei Verletzung ihrer Bundespflichten, sollen ebenfalls dem Bundesrat überwiesen, oder es soll Übereinstimmung zwischen beiden Instanzen hergestellt


|
Seite 47 |




|
werden. Der Frankfurter Bundestag schwebt immer als ideales Wunschbild vor. Der in dem Brief an Huber erwähnte Gedanke des Oberhauses taucht hier noch einmal auf. Auslassungen über den Reichstag geben den Wunsch zu erkennen, diesem sein Finanzrecht zu schmälern ("Bewilligung des Reichstages hinsichtlich der nicht im Etat vereinbarten Ausgaben" - soll heißen nur Neueinnahmen des Staates hängen von der Volksvertretung ab!) Um das so unerwünschte allgemeine Wahlrecht später beseitigen zu können, sollte es nicht verfassungsmäßig festgelegt werden.
Mit wieviel Nachdruck diese Gedanken. vertreten wurden, ob sich Unterstützung dafür fand, ob sie von Oertzen ausgingen, oder ob andere die Anregung dazu gaben, ist nicht mit Sicherheit festzustellen - durchgesetzt wurde keine einzige dieser Forderungen und keiner dieser Wünsche, die ihre Wurzeln hatten in der Opposition gegen die verschleierte Tendenz der Bundesverfassung zum Einheitsstaat. Sie kamen her aus der Welt des alten Bundes, der die Überheblichkeit der Kleinstaaten legalisiert und zur Selbstverständlichkeit gemacht hatte. Die Verfassung des neuen norddeutschen Bundes wies in eine andere Welt - eine Welt, die sich gründete auf Tatsachen und reale Machtverhältnisse, die es ablehnte, diese durch legitimistische Formeln zu vergewaltigen.
* *
*
Die preußische Regierung hatte schon im Januar die Ermächtigung erhalten, die Vorbereitungen zur Eröffnung des Parlamentes zu treffen. So war es möglich, sofort nach Beendigung der Ministerkonferenzen (24. Februar) den Reichstag zu eröffnen.
Die inzwischen abgehaltenen Wahlen hatten in Mecklenburg - beide Großherzogtümer bildeten sieben Wahlkreise - den Sieg der liberalen Opposition gebracht. Nur zwei ständische Abgeordnete waren gewählt. Die übrigen zählten sich zur liberalen Partei.
Es bestand die Möglichkeit, daß eine Einigung mit dem Reichstage nicht erzielt würde. Für diesen Fall hatte Bismarck auf eine endgültige Regelung des Bundesverhältnisses durch die Regierungen vorbereitet, da die Verträge vom August nur auf ein Jahr liefen. Als dann im Laufe der Verhandlungen ernste Spannungen zwischen Reichstag und Regierungen eintraten, als auch drohende Wolken am Horizonte der auswärtigen Politik eine Klärung der Lage notwendig erscheinen ließen, erwirkte die preußische Regierung den endgültigen Abschluß der Bündnisverträge, an deren Stelle dann nach der Einigung mit dem Reichstag die Bundesverfassung trat.
Für den Schweriner Großherzog, der schwer um die Ver-


|
Seite 48 |




|
söhnung mit der letzten Entwicklung der Dinge in der Bundesangelegenheit, wie sie sich in der Verfassung dokumentierte, zu kämpfen hatte, war die endgültige Zustimmung ein schwerer Schritt. Er befand sich seit Anfang des Jahres in einer seelischen Krisis und trug sich mit Todesahnungen. Zwar brachte das seine gesunde und robuste Natur nicht aus dem Gleichgewicht, das ihm sein in sich gesichertes Gottvertrauen verlieh, aber seine Entschlossenheit wurde dadurch gelähmt. Oertzen mochte das fühlen und mußte jetzt selber seinem Herrn gut zureden. Aber dem Großherzog wurde die Entscheidung nicht leicht. Nur die Hoffnung, daß das Opfer, das er mit der Aufgabe seiner Souveränität brachte, dem größeren Vaterlande zum Segen werden möge, konnte ihn dazu bestimmen 6 )
Bei Hirschfeld, dem Biographen Friedrich Franz', ist diese Unsicherheit in der Haltung des Großherzogs zu der Angelegenheit der Bundesverfassung gegenüber der Entschiedenheit seines Eintretens für Preußen bei Ausbruch des Krieges nicht hervorgehoben, wie es ja in der Tendenz dieses Historikers liegt, seinen Helden auf ein Geleise zu schieben, das geradenwegs auf die Reichsgründung zuläuft. Daß aber dieses Geleise zumindest sehr starke Kurven aufzuweisen hat, ist zweifellos. Dafür ist ein unanfechtbarer Beweis die Bemerkung, die der Großherzog am 18. April in sein Tagebuch eintrug: "Bedenkliche Nachrichten aus Frankreich, dem Könige geschrieben. Ich will wieder festen Kours segeln: nach außen: aktive Beteiligung beim unvermeidlichen Kampf um Deutschlands Größe: nach innen rechtzeitiges Eintreten der notwendigen Reformen: Bauern, Niederlassung, Rekrutierung."
Wenn auch selbstverständlich solches Schwanken in der Stimmung des Großherzogs nicht mehr von entscheidender politischer Bedeutung sein konnte, so mußte es doch zur Stärkung des ständisch-oppositionellen Elementes, namentlich in der Regierung, beitragen.
Die nämliche Tagebuchstelle bedeutet auch eine Stütze für die Auffassung, daß der Großherzog namentlich als Soldat zum Anschluß an Preußen neigte und daß er, von dieser Basis aus, sich in die neuen Verhältnisse des Bundes und später des Reiches hinein-


|
Seite 49 |




|
fand. Ein Gefühl für "Deutschlands Größe", ein Instinkt für die Machtstellung des Vaterlandes trennte ihn von der Gesinnung jener ständischen Elemente, in denen die Befürchtung aufkam, daß dadurch "der Friede der europäischen Großstaaten in Gefahr gebracht und die Rechtssicherheit inner- und außerhalb Deutschlands erschüttert werden könnte." Mochte es auch keineswegs zutreffen, daß Friedrich Franz "der liberalste Mann im Lande" war, wie Richthofe 7 ) mit reichlicher Übertreibung ihn bezeichnete, so hatte er doch recht, wenn er sagte, daß "von ihm diejenige Mitwirkung für die allgemeinen deutschen Interessen zu hoffen sei, die sich nach seiner Macht im Lande irgend erreichen ließe".
Die Stellung des Großherzogs zum konstitutionellen Liberalismus mag hier genauer untersucht werden. Sie erklärt die Zwitterhaftigkeit, die seiner Politik anhaftete.
Die öffentliche Meinung ging dahin, daß der Großherzog den Volkswünschen nach "Reformen" geneigt sei. Er, der 1848 das Staatsgrundgesetz beschworen, der es verteidigt habe gegen den Einfluß seiner Verwandten und gegen seine Stände, der schließlich nur der Gewalt (Preußen 8 ) gewichen sei, als er sich dem Spruch des Freienwalder Schiedsgerichts unterwarf, er könne nicht für die volksfeindlichen Maßnahmen verantwortlich gemacht werden, die nach der Wiederherstellung der Stände von seinen ständischen Ministern getroffen wurden.
Gewiß, Reformen wollte der Großherzog, aber die verfassungspolitischen Gedanken und Erwägungen, die ihn 1848 geleitet hatten, unter dem Druck überschäumender Ereignisse und unter dem Einfluß seines Ministers v. Lützow, diese Gedanken waren ihm jetzt fremd. Daß er in einem gewissen Gegensatz zu den Ständen sich befand, traf jedoch zu. Er hielt tatsächlich an der Notwendigkeit von Reformen fest, zu der diese die Hand nicht reichen wollten. In ihm lebte aber ein zu ängstliches Rechtsgefühl, als daß er gewaltsam sich über die Rechtslage hätte hinwegsetzen können. Er war im Laufe der Jahre dahin gekommen, auch für sich den Freienwalder Schiedsspruch als Rechtsbasis an-


|
Seite 50 |




|
zuerkennen, die nur auf dem Wege des Rechts zu ändern sei. Kirchliche Einflüsse werden diese seine Gesinnungswandlung begünstigt haben. Das orthodoxe Luthertum war in Mecklenburg ein Bundesgenosse der ständischen Ordnung - und der Großherzog stand unter Einflüssen aus dieser Richtung.
Als ein Mann von schlichtem und unprobtematischem religiösen Empfinden hielten ihn zwar seine natürlichen Anlagen völlig frei von schwärmerischer Mystik oder pietistischer Frömmelei; aber aus seelischen Konflikten und Krisen rettete er sich, dem persönliche Schicksalsschläge nicht fremd blieben, in die schützenden Arme der Kirchenlehre, und seine unerschütterliche Gottgläubigkeit verlieh seinem Wesen einen fast fatalistischen Zug, der sich um so mehr geltend machen konnte, als er nicht der Mann kurzer Entschlossenheit war. Sein Christentum nahm in seinem Leben eine breite Stellung ein und bestimmte seinen Charakter entscheidend. Sein religiöser Glaube, der ihm die Verantwortung vor einem persönlichen Gott auferlegte, schuf ein peinliches Pflichtbewußtsein. Er übte sein Fürstenamt mit sittlichem Ernst und hatte stets den besten Willen. Daß er oft erlahmte, lag in seiner Unentschlossenheit und auch in dem Widerstand, den er fand. Die Geneigtheit, fremdem Einfluß zu erliegen, machte ihn nur schwächer. In sehr jungen Jahren zur Regierung berufen, aus einem unabgeschlossenen Entwicklungsgang vorzeitig herausgerissen, machte ihm ein wechselvolles Geschick unsicher und ließ ihn an seinen Fähigkeiten zweifeln. So suchte er äußeren Halt. Seine Abhängigkeit von seinen preußischen Oheimen war mehr als bloße verwandtschaftliche Anhänglichkeit. Und immer fanden sich in seiner Umgebung Männer, die Einfluß auf ihn gewannen. Von seinem Vater übernahm er als Freund des Hauses den Ludwig v. Lützow, unter dessen Einwirkung der junge Großherzog seinem Lande eine konstitutionelle Verfassung gab, wenn er sich selber auch zu dem konstitutionellen System nicht unbedingt bekannte. In der folgenden Reaktionszeit waren es der Minister v. Schroeter, die Männer des Oberkirchenrats Kliefoth und Kaysel, unter deren Einfluß er sich von der Vergangenheit des Jahres 1848 abwandte und das auch äußerlich bekundete, indem er den Führer der Ritterschaft, Jasper v. Oertzen, auf den Posten des Ministerpräsidenten berief, als der Graf Bülow, den er aus preußischen Diensten übernommen hatte, starb. Seitdem hatte er sich dem ständischen Lager immer mehr genähert. Das Ministerium war aus Männern von ständischer Gesinnung zusammengesetzt, und er ließ ihnen freie Hand. Zu dem preußischen Gesandten v. Richthofen äußerte er im Jahre 1859: "Wenn es bei der allerdings sehr demokratischen Ver-


|
Seite 51 |




|
fassung von 1848 geblieben wäre, so wäre er mit Hilfe der vernünftigen Leute im Lande zu einer solchen Abänderung gelangt, wie er sie nur irgend hätte wünschen können. Nachdem ihm dieser Weg abgeschnitten, habe er eine Regierung gewählt, die mit Mäßigung an den alten Prinzipien festhalte." Damit war eine Ablehnung des liberalen Konstitutionalismus ausgesprochen, die auch den Tatsachen entsprach. Und wenn auch durch die Ereignisse des Jahres 1866 der Großherzog wieder von seinen Ständen getrennt wurde, auch vorher nie ganz einer der Ihren geworden war, wie das eher zutrifft für den Strelitzer Vetter, so ließ er in verfassungspolitischen Fragen sich dadurch nicht beeinflussen. Oertzen blieb trotz wiederholter Abschiedsgesuche (hervorgerufen durch Meinungsverschiedenheiten in außenpolitischen Fragen) im Amte und blieb mit dem Großherzog in Übereinstimmung in der Verteidigung der ständischen Verfassung. Dessen Nachfolger wurde später ein anderer ständischer Führer, der Graf Bassewitz-Schwießel. Zur Wiederherstellung des Staatsgrundgesetzes von 1848 war beim Großherzog Friedrich Franz nicht die geringste Neigung. Und so wäre ein Versuch der Liberalen, wie er angeregt worden ist, mit ihm zu diesem Zwecke Fühlung zu gewinnen, erfolglos gewesen. Die lakonische Notiz im Tagebuch über das Ergebnis der Wahlen ("Wahlen schlecht") spricht sein Verhältnis hierzu klar genug aus. Das ganze Wahlgetriebe jener Wochen hatte ihm Unbehagen bereitet. Er hatte zu diesen Dingen keine Verbindung und zog sich von ihnen zurück. Gewiß war er nicht für restlose Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse, und das Volksempfinden hatte darin Recht, aber die ständische Basis wollte er nicht verlassen, und wie weit seine Reformpläne gingen, zeigt die Aufzeichnung vom 18. April 1867: "Nach innen rechtzeitiges Eintreten der notwendigen Reformen: Bauern, Niederlassung, Rekrutierung." Auch wenn man diesen Worten die weiteste Deutung gibt, so bleibt ihr Inhalt weit zurück hinter liberalen Wünschen und berührt in keiner Weise das Hauptverlangen der Partei. Mit vielen Zeitgenossen hatte der Großherzog gemein, daß er nur die eine Seite der neuen Zeit begriff. Nur einen Fuß setzte er hinweg über die Schranken, die ihm die Sphäre zog, in der er groß geworden war, den andren nachzuziehen, vermochte er nicht.
Obwohl der Reichstag in der Umgestaltung des Verfassungsentwurfes so weit ging, daß eigentlich nur das Grundgerüst stehen blieb, kam eine Einigung mit den Regierungen zustande. Bismarck belastete den neuen Bund nicht mit der Gegnerschaft der Nation.
Den großherzoglichen Regierungen in Mecklenburg lag nun-


|
Seite 52 |




|
mehr gemäß des Versprechens im Landtagsabschied 1866 ob, die Bundesverfassung den Ständen zur Abgabe ihrer verfassungsmäßigen Erklärung vorzulegen. Sie waren sich dabei bewußt, daß eine Ablehnung seitens der Stände nicht zugelassen werden dürfte, so daß der Landtag nur die Bedeutung haben konnte, die Stellung der Stände zu den Regierungen zu klären.
Die Bundesverfassung erkannte die bestehenden Verfassungen der Länder an. Sie schützte damit auch die ständische Verfassung Mecklenburgs gegen Eingriffe. Damit war die Hauptsorge der Stände beseitigt. Daß sie von ihnen genommen war, machte sich in der Haltung des Landtages bemerkbar. Richthofen hatte schon im Februar bei der Geburtstags- und Jubiläumsfeier Friedrich Franz' feststellen können, daß auch in den Kreisen der Ritterschaft die Überzeugung Platz zu greifen anfange, daß der Großherzog durch den von ihm offen verkündeten engsten Anschluß an Preußen den auch für Mecklenburg allein richtigen Weg eingeschlagen habe.
Das Hauptbedenken, das die Landtagsversammlung erhob (unter Vorangehen des Grafen Bassewitz), richtete sich gegen den § 78 der Bundesverfassung, der Verfassungsänderungen im Wege der Gesetzgebung zuließ, nur mit der geringen Sicherung, daß auch im Bundesrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit gefordert wurde. Da damit auch Kompetenzerweiterungen möglich waren, sprach die Versammlung die Erwartung aus, daß die Regierung dazu nur im Einvernehmen mit den Ständen zustimmen würde.
Die Regierung sagte "tunlichste Berücksichtigung" dieses Wunsches zu. Das bedeutete so gut wie nichts. Sie übernahm damit keine besondere Verpflichtung. Vollends konnten die Stände daraus keine Rechtsansprüche herleiten.
Aber wenn so die Regierung in Zukunft juristisch nicht verpflichtet war, in Angelegenheit des Bundes die Wünsche der Stände zu berücksichtigen, so wurde das tatsächliche Verhalten doch so, daß sie sich jenes ständische Verlangen zum Leitsatz ihrer künftigen Politik machte und sich dem Bunde gegenüber mit ständischen Interessen identifizierte.
Der Strelitzer Großherzog Friedrich Wilhelm hatte an seiner konsequenten Ablehnung der preußischen Politik festgehalten. Für ihn fehlten die Voraussetzungen, die Friedrich Franz die Einordnung in die neuen Verhältnisse erleichterten. Die Familienbeziehungen, die den Schweriner Hof mit Berlin so eng verknüpften, wiesen hier in eine gänzlich fremde Richtung. Die Mutter des Großherzogs war eine Tochter des Landgrafen Friedrich von Hessen-Cassel, seine Gemahlin war eine Tochter des Herzogs von


|
Seite 53 |




|
Cambridge, deren Tradition mit England verbunden war. Die nahen Beziehungen, die durch die Königin Luise, zwischen der Strelitzer Familie und dem preußischen Königshause bestanden hatten, waren durch den regierenden Großherzog nicht aufrecht erhalten worden. Er galt vor der Sprengung des Bundes als "österreichisch", und sein Blick richtete sich mehr nach Wien als nach der preußischen Hauptstadt. In politischer Beziehung stand er auf dem Boden ständischer Anschauungen. Er hielt an der Überlieferung seines Vaters, des Großherzogs Georg, fest, der 1848 Schwerin die Gefolgschaft in der Verfassungsangelegenheit versagt und den Anstoß zur Beseitigung auch der Schweriner Konstitution gegeben hatte. Der damalige Erbgroßherzog und sein Bruder, der Herzog Georg, waren daran nicht unbeteiligt gewesen. Der Herzog Georg wurde zum Dank dafür in die Ritterschaft aufgenommen und nahm an den Landtagen teil. Und sein Bruder blieb auch als Großherzog ständisch und bekannte sich bei seinem Regierungsantritt aufs lebhafteste zur mecklenburgischen Verfassung. Er war ein Demokratenhasser par excellence. In der Revolutionszeit regte er an, den Beamten die Demokratenbärte abschneiden zu lassen, und als er zur Regierung kam, geschah es 9 )
An den Anschauungen jener Zeit, die in seiner Familie so tief wurzelten, hielt er fest. Trotz eines stark entwickelten dynastischen Stolzes und Selbstgefühls war er nach seiner Gesinnung ein Junker. Es ist bekannt, daß sein Vater das Wort Souveränität nicht in den Mund genommen hat.
Seine englischen Familienbeziehungen ließen ihn oft in England weilen. Er übernahm viel von englischem Wesen und wurde ein halber Tory wie sein Vetter Georg von Hannover. Als Deutscher blieb er ein Sohn des alten Bundes mit seinen ständischlegitimistischen Idealen. Die weitere Entwicklung machte er nicht mit.
Schon zu Anfang der fünfziger Jahre wurde Friedrich Wilhelm von einem Augenleiden befallen, das schließlich zu völliger Erblindung führte. Ein solches Leiden konnte nicht ohne Einfluß auf die innere Entwicklung des Fürsten bleiben und mußte vieles


|
Seite 54 |




|
an seinem Wesen bestimmen. Es zwang ihn zu Vereinsamung und zu Zurückhaltung, und manche Schroffheit und eigensinnige Hartnäckigkeit seines Charakters mochte darin ihren Ursprung haben. Er hatte wohl viele Eigenheiten, und oft wurde seine Haltung mißdeutet. Aber gerade seine Krankheit prägte seinem Wesen auch die Züge auf, die Sympathie erwecken und mit seiner oft unerfreulichen politischen Haltung versöhnen. Er besaß eine Innigkeit und Sanftheit der Empfindung, wie man sie bei leidenden Menschen findet. Seinen Freunden brachte er eine herzliche Zuneigung entgegen, wie er seine Feinde zu hassen wußte. Es ist ergreifend, in seinem Tagebuch von dem "wehmütigen Wiedersehen" mit dem König Georg von Hannover zu lesen, den er 1869 in der Verbannung besuchte. Und es rührt, zu sehen, daß er, der blinde Mann, in den Gärten seines Schlosses die Pracht der Fliederblüte genießt und den Eindruck in seinem Tagebuche festhält. Und Nachtigallen und Schwalben, sie erfreuen sein lichtloses Dasein, und er findet es wertvoll genug, es aufzuzeichnen.
An seinem Hofe werden geistige Interessen gepflegt. Er besucht fast täglich das Theater, das schon in seines Vaters Zeit eines guten Rufes sich erfreute, und läßt sich Dichtungen vorlesen. Er liebt es, sich den Tag zu füllen. Die Staatsgeschäfte nehmen seine Zeit nicht voll in Anspruch, und viel ist er auf Reisen. In seinem Lande ist er der patriarchalische Herr, der seine getreuen Untertanen besucht und mit ihnen spricht, und sie erhalten pünktlich zur goldenen Hochzeit ein Bild oder eine Bibel. Mit peinlicher Sorgfalt werden die kleinen Ereignisse des Tages sein ganzes Leben hindurch in knappen Worten aufgezeichnet, und vorsorglich wird gleich das Datum des folgenden Tages daruntergesetzt. Er liebt die behagliche Teestunde im Ahnenzimmer und empfängt gerne die gleich-gesinnten Ritter, die zu ihm in seine stille Residenz kommen. Er hat auch Freude an galanten Geschichtchen, die in den Städten der Welt passieren, und sein Gesandter in Berlin schickt sie ihm in Zeitungsausschnitten und weiß in seine Berichte manches Bonmot einfließen zu lassen, das seinen Herrn erfreut. - Spürt man auch wohl in seiner äußeren Ruhe einen verhaltenen Willen zu rascherem Leben, so erhielt er sich doch in seinem Leiden ein heiteres Gleichgewicht, das wohl rasche Eindrücke erschüttern konnten, das sich aber wiederherstellte, wenn sie überwunden waren. Und so trug er sein schweres Geschick bis an seinen späten Tod (1904) fast ein halbes Jahrhundert.
Wie er die Umwälzungen des Jahres 1866 aufnahm, ist angedeutet worden. Das schroffe Vorgehen Preußens verletzte ihn sehr, und er verwand es nie. Er konnte sich nicht mit der neuen


|
Seite 55 |




|
Zeit aussöhnen. Und was irgend mit dieser Entwicklung zusammenhängt, das erscheint in seinem Tagebuch mit dem Beiwort "gräulich", und mit dem traurigen Stand der Dinge" vermag er sich nicht abzufinden. Jedoch leistete er keinen erheblichen Widerstand. Auf einen unvoreingenommenen Beobachter, den französischen Gesandten in Hamburg, Baron Rothan, machte er den Eindruck eines Ehrenmannes, der zwar mit der Neugestaltung Deutschlands unzufrieden sei, der aber, nachdem er dem Bunde beigetreten, alle seine Verpflichtungen auf das Pünktlichste erfüllen werde. Daß er in voller Passivität blieb, wird man von einem Charakter, wie er es war, begreifen. Ob es politisch klug war, steht auf einem anderen Blatt. Er wollte die Gewalttätigkeiten Preußens nicht anerkennen, und er übersah sie. Und im Hofkalender des Jahres 1867 war unter den Titeln des Großherzogs auch der eines königlich hannoverschen Generals aufgeführt.
Bei dem preußischen Gesandten erregte dies "Redaktionsversehen" begreifliche Entrüstung.
Über das Verhältnis zum Schweriner Hofe braucht nach diesem nichts mehr gesagt zu werden. Es waren zwei Generationen, die sich in den beiden Großherzögen - obwohl fast gleichaltrig - gegenüberstanden, zwei Welten, die nur leise miteinander verbunden waren. Man wahrte die Form, machte sich gegenseitig Besuche und sprach auch wohl über Politik, aber es gab auch Zeiten, in denen man auf dem Umwege über den gemeinsamen Gesandten miteinander verkehrte. Als in Schwerin bei einer Taufe (1871) der Kronprinz Friedrich, der spätere Kaiser, zu Besuch war, fragte er, ob auch von Strelitz Gäste kämen. Der ihm zugeteilte General Bilguer verneinte dies und fügte erklärend hinzu: "Wir sind ja auch sehr verschieden." Als der Kronprinz meinte: "Sie sprechen aber doch dieselbe Sprache" - entgegnete der General: "Jawohl, Ew. K. H., aber einen ganz verschiedenen Dialekt."
Die Männer, mit denen sich Friedrich Wilhelm umgab, teilten seine Gesinnung. Bülow, der ihr fremd geworden war, dem sie zu eng wurde, verließ den Strelitzer Dienst. Dafür trat der Welfe Hammerstein in die Regierung ein. Die Übernahme noch anderer Hannoveraner sollte Friedrich Wilhelm später ernste Unannehmlichkeiten bereiten. Das Jahr 1870 bedeutete für ihn in dramatischer Form eine erneute Auseinandersetzung mit dem neuen Deutschland, in dem er nicht heimisch zu werden vermochte. Er teilte das Schicksal der Zuspätgeborenen, die als Fremdlinge in einer unverstandenen Welt ihr Leben führen müssen.


|
Seite 56 |




|
Es konnte nicht zweifelhaft sein, welche Haltung die mecklenburgischen Regierungen dem Bunde gegenüber einnehmen würden. Sie hatten sich in das Unvermeidliche gefügt. Die Abneigung aber, die sie von vornherein gegen das preußische Bundesprojekt bewiesen hatten, verleugneten sie nicht, auch als es ein Faktum geworden war. Den in der Bundesverfassung festgelegten Bestimmungen offenen Widerstand zu leisten, verbot die übernommene Vertragspflicht, die einzuhalten eben dieselben Gründe zwangen, die maßgebend gewesen waren, sie einzugehen. Mehr zu tun aber und willig auf der mit der Verfassung beschrittenen Bahn voranzuschreiten, konnten sie nicht bereit sein.
Das Gespenst des Einheitsstaates, das sich drohend hinter dem Bunde erhob, war für die Parteigänger des mecklenburgischen Staates die Gefahr. Es zu bannen, war die vornehmste Aufgabe.
Verglichen mit anderen Bundesstaaten befand sich Mecklenburg in einer erheblich schwierigeren Lage - nicht nur, weil seine inneren Verhältnisse der hemmungslosen Einordnung tatsächlich Schwierigkeiten bereiteten, sondern auch, weil es sich zum Verteidiger eines dem neuen Staatswesen fremden Prinzipes machte. Eines Prinzipes, das die Ursache jener besonderen Verhältnisse war. Nicht nach materieller Zweckmäßigkeit bestimmt sich seine Politik - und auf dem Prinzip der Zweckmäßigkeit beruhte der Bismarcksche Staat -, es stand im Mittelpunkt die Rücksicht auf eine Verfassung, deren Basis "das Recht" war, nicht die verachteten "Tatsachen". Hatte man sich den Tatsachen unterworfen, als man sich dem Bunde anschloß, im eigenen Lande wollte man sich nicht vor ihnen beugen.
Diese Position konnte nur verteidigt werden, wenn die innere Selbständigkeit des Landes erhalten blieb. Jedes Fortschreiten auf dem Wege der Zentralisation war ein Schritt näher zur Niederlage. Was retten konnte, war allein Erhaltung des "föderalistischen Prinzips" im Bunde. Deshalb rief man abwehrend "Kompetenz!" und hoffte auf den Anschluß der Süddeutschen als Gegengewicht gegen das übermächtige Preußen.
Für die Politik der Regierungen war die Gesinnung der leitenden Männer entscheidend.
In Schwerin stand neben Friedrich Franz immer noch Jasper v. Oertzen, der für die Haltung der Regierung ausschlaggebend war, da der Großherzog nur im einzelnen Falle bestimmend eingriff. Wenn Oertzen sich auch durch die Bitten seines Fürsten hatte im Amte halten lassen, so hatte er sich doch keineswegs von seiner Vergangenheit losgesagt: er blieb ein Anhänger des alten Bundes


|
Seite 57 |




|
und wollte von den Neuerungen des Bismarckschen Staates nichts wissen. Wenn er sie mit seinem Namen deckte, so tat er es im Bewußtsein, seinen Ständegenossen und dem mit ihnen identifizierten Mecklenburg durch seine Person zu nützen. Vielleicht auch, daß er nicht gesonnen war, die Macht aus der Hand zu geben, auch wenn er sie nicht immer üben konnte, wie er es gemocht hätte.
Neben ihm standen in gleicher Gesinnung der ehemalige Professor des Staatsrechtes Wetzell (Inneres), von dem das Wort ging, daß er die mecklenburgische Verfassung für die beste Europas halte, und nach Levetzows Abgang Herr v. Müller. Beide galten als Feudalisten und waren es auch, wenngleich wohl Wetzell durch seine Herkunft und seine Vergangenheit eine andere Färbung aufzuweisen haben mochte als sein Kollege, der aus der mecklenburgischen Ritterschaft herkam. Die Justiz verwaltete der Staatsrat Buchka, der von allen die freieste Auffassung hatte. In Strelitz leitete anfangs noch Bernhard E. v. Bülow die Geschäfte. Ihm standen zur Seite ein Herr v. Kardorff und der Staatsrat Piper, die im großherzoglichen Beamtendienst groß geworden waren. Wenn in Schwerin der erste Minister das stärkste Gewicht war gegen eine willige Politik im Bismarckschen Sinne, so war in Strelitz dafür der Großherzog anzusehen, und Bülow befand sich in der Lage, den Fürsten auf gemäßigten Bahnen zu erhalten, auch wenn er selber wohl nicht immer von Herzen zustimmte. Aber er bestimmte seine Politik nach staatsmännischen Erwägungen, und ein freierer Blick hinderte, daß er sich allzu sehr an Dogmen band.
Die Resultante dieser Kräfte stellt sich dar als Verteidigung und Abwehr. Genau wie vor und während der Krisis die Haltung Abwehr und Verteidigung gewesen war, von den Augenblicken abgesehen, wo der Großherzog von Schwerin durch persönliches Eingreifen seinen Willen durchsetzte und nach seiner Erkenntnis handelte.
Das blieb auch so, als Personalveränderungen eintraten. Die Einrichtung des Bundesrates brachte es mit sich, daß die Stellung des Gesandten in Berlin, wenn dieser mit der Stimmführung beim Bunde beauftragt werden sollte, an Bedeutung gewann. Die Stellung eines mecklenburgischen Gesandten war sonst recht bedeutungslos. Gealterte, pensionierte Offiziere wurden auf diese Posten geschickt, und ihre Tätigkeit war die eines Reporters mit gesellschaftlichen Verpflichtungen und mit Zutritt zur Hofgesellschaft. Für die Stellung eines Bevollmächtigten am Bundesrat bedurfte es eines anderen Mannes. In der Erkenntnis dieser Notwendigkeit wurde der alte Herr v. Sell, der in Berlin eine Reihe von Jahren Mecklenburg vertreten hatte, in den Ruhestand


|
Seite 58 |




|
versetzt. Die fähigste Kraft, die die mecklenburgischen Ministerien aufzuweisen hatten, trat an seine Stelle. Es ist auch möglich, daß Bernhard Ernst v. Bülow ein anderes Betätigungsfeld sich wünschte, und daß ihm die Strelitzer Verhältnisse zu eng wurden. Wenn er gleich keine hinstürmende Kämpfernatur war, so war ihm doch ein verhaltener Ehrgeiz eigen, auch wenn er sich mit liebenswürdiger Anspruchslosigkeit zu geben wußte. Daß ihm kleinliche Verwaltungsgeschäfte hätten befriedigen können, dazu war er zuviel Diplomat. Bismarck rühmte an ihm die Fähigkeit, "zu sprechen, ohne dem Zuhörer einen Eindruck des Gesagten zu hinterlassen", und Berlin bot für eine solche Persönlichkeit mehr Raum als das kleine Strelitz.
Sein Nachfolger in Strelitz wurde der ehemals hannoversche Minister v. Hammerstein, der keine bundesfreundliche Gesinnung mitbrachte. Dessen Berufung in den mecklenburgischen Dienst war von seiten Friedrich Wilhelms ein Bekenntnis und wurde in Preußen als solches angesehen. Der Großherzog nahm noch mehr Welfen in seinen Dienst. Später sollten ihm daraus nicht unbedenkliche Schwierigkeiten erwachsen. Die Strelitzsche Opposition blieb auch jetzt, an Schwerin gemessen, um eine Note schärfer.
Am 30. Juni 1869 ging auch in Schwerin die Leitung der Staatsgeschäfte in andere Hände über. Krankheit und erneute Verstimmung mit dem Großherzog (über Militärangelegenheiten) veranlaßten Oertzen, sein Amt niederzulegen. Der Landrat und Reichstagsabgeordnete Graf Hennig v. Bassewitz wurde Ministerpräsident in Mecklenburg-Schwerin. Einen Systemwechsel bedeutete seine Ernennung nicht. Jedoch war er eine frischere Kraft als Oertzen. Bülow nannte ihn eine "bedeutende Persönlichkeit". Aber in der Gesamthaltung der Regierung bewirkte sein Eintritt keine Änderung. Seine Erfahrungen im Reichstag hatten ihn zwar Vorsicht gelehrt. Er war bestrebt, keine unnötige Aufmerksamkeit auf Mecklenburg und seine Verfassung zu lenken. In mecklenburgischen Dingen aber dachte er ständisch wie sein Kollege v. Müller oder wie auch Hammerstein. Die Angelegenheiten des Bundes sah er von etwas anderem Standpunkt aus. Er wollte beide Sphären trennen. Der staatsmännische Blick, den er manchmal bewies, hinderte ihn nicht an dieser Inkonsequenz. Auch er war nicht fähig, sich von seinem ständischen Boden zu lösen.
Die Abneigung gegen die neuen Verhältnisse, wie sie sich bei den leitenden Männern kennzeichnet, reichte naturgemäß in die Hof- und Beamtenkreise hinab, die wie jene mit der Vergangenheit verwachsen waren, und denen die Zukunft ungewiß erschien. Die vorhandene prinzipielle Antipathie wurde gemehrt durch die


|
Seite 59 |




|
Aussicht auf finanzielle Überbürdung des ganzen Landes wie des einzelnen. Der preußische Gesandte weiß immer wieder von der "gedrückten Stimmung" zu berichten, die in jenen Kreisen vorherrscht. Dieses Mißtrauen in die Zukunft zog die Unmöglichkeit nach sich, die einmal geschaffenen Verhältnisse ehrlich anzuerkennen, oder sich mit ihnen abzufinden. Und gerade da, wo es am nötigsten war, in der Regierung, geschah es nicht. Hier ist eine Unsicherheit vorhanden, die sich überall kundgibt. Vielleicht kommt auch eine gewisse Unfähigkeit 10 ) hinzu, die wohl nicht geringen Schwierigkeiten bei der Überleitung in die neuen Verhältnisse zu überwinden. Aber das Entscheidende war wohl, daß man "der unberechenbaren Zukunft nichts vergeben wollte". Nur unter dieser Annahme ist die befolgte Politik der steten Abwehr und der passiven Resistenz zu begreifen. "Man ist entschlossen, dem Bunde alle Quoten an Geld und Menschen auf die loyalste Weise zu gewähren, man wird auch jeder ganz bestimmten Forderung alsbald nachgeben. Weiter aber wird die Bundestreue nicht gehen. Man wird namentlich die Grundsätze des Landes nicht in einem dem Geiste der Bundesverfassung entsprechenden Sinne ändern, sondern sorgfältig bemüht sein, von dem Landesvergleiche von l755 zu erhalten, was noch erhaltungsfähig ist. Dabei weiß man sehr wohl, daß, wenn der norddeutsche Bund sich friedlich weiterentwickelt, eine solche Strategie auf die Dauer keinen Erfolg haben kann. Man rechnet aber auf Zwischenfälle, als da sind: Krieg, Personenwechsel usw."
Daß diese Hoffnung nur ein Greifen nach einem Strohhalm war, mußte ruhigen Gemütern bald klar werden, aber sie kennzeichnet die Haltlosigkeit, in die jene Kreise durch das Jahr der Schlacht von Königgrätz gestürzt waren.
Mochte man solche Hoffnungen in den maßgebenden Stellen auch nicht teilen, da man hier die Sache besser übersah, so teilten diese mit jenen doch die Haltlosigkeit und Unsicherheit der Handlung, die sie verhinderte, konsequent die Folgerungen zu ziehen und sich ein positives Ziel zu stecken. So blieb keine andere Mög-


|
Seite 60 |




|
lichkeit, als die gezwungen anerkannte Bundesverfassung in ihrer günstigsten Auslegung zu verteidigen und jeden Schritt darüber hinaus abzuwehren. Man klammerte sich an die "Kompetenz" und verteidigte das "föderalistische Prinzip" der Verfassung. Aber dahinter stand die Ablehnung des neuen Staatswesens, gegen das man die Schatten der Vergangenheit hervorrief. Stück für Stück ging von dem verteidigten Boden verloren, aber unendliche Hartnäckigkeit war immerfort zu neuem Widerstand bereit. Es war ein Kampf, der in der Art seiner Führung im Einzelfall oft kleinlich und verächtlich erscheinen kann, wenn man den Geist verkennt, der hinter ihm steht. Aber die Ausdauer, mit der dieser als hoffnungslos erkannte Kampf geführt wurde, zwingt zu einer gewissen Anerkennung und Achtung.
Seine Einzelheiten zu verfolgen, wäre ermüdend und auch nicht die Mühe lohnend. Es mag genügen, ihn in einigen Hauptzügen aufzuweisen, um seine Art kennenzulernen und den Geist, in dem er geführt wurde.
Die Bundesverfassung hatte für die inneren Verhältnisse des Bundes die Richtlinien aufgestellt, die erst durch eine umfassende Gesetzgebung wirksam gemacht werden konnten. Die preußische Regierung hatte die Initiative in der Hand, und durch ihr natürliches Übergewicht nahmen die meisten Gesetzesvorschläge die von ihr gewünschte Form an. Es war berechtigt, daß Preußen sich selbst als Maßstab nahm und über die Sonderverhältnisse der kleinen Staaten hinwegging. Durch den jeweiligen Stand der Gesetzgebung bedeutete das den Bundesstaaten oft recht erhebliche Schwierigkeiten. Daß sich aus diesem Grunde Widerstand erhob, war verständlich. Auch von seiten Mecklenburgs wurde gegen den materiellen Inhalt der Gesetzgebung opponiert, aber in erster Linie stand hier immer die Verteidigung des föderalistischen Prinzips, als Verkleidung eines ständischen Egoismus, aber auch als Kampfruf eines dem neuen Staatswesen fremden Geistes.
Schon in der ersten Sitzungsperiode des Bundesrates legte Preußen einen Gesetzentwurf über Freizügigkeit vor. Das Prinzip war in der Bundesverfassung anerkannt, und auch Mecklenburg hatte sich daran gebunden. Auf dem Landtage hatte man sich mit dieser Frage beschäftigt und lebhafte Abneigung ausgesprochen. Man erwartete durch die Einführung der Freizügigkeit "sehr weitgehende Folgen" und Nachteile. Das platte Land zwar würde durch die beschränkte Zahl der vorhandenen Wohnanlagen vor dem Zustrom der "Ausländer" bewahrt bleiben, aber die Städte würden "zum Ablagerungsplatz der Vagabondage" werden. Die Regierungen teilten diese Bedenken und argumentierten ähnlich,


|
Seite 61 |




|
obwohl Mecklenburg auf das Notwendigste eine Umbildung der Heimatgesetzgebung nötig hatte, da es nur ein örtliches Heimatsrecht besaß; - denn nicht einmal in Mecklenburg selber bestand in irgendeiner Form eine Freizügigkeit, und jeder Wechsel des Wohnortes hing von der Gnade der betreffenden Ortsobrigkeit ab. Es ließ sich aber gegen das Zustandekommen des Gesetzes nichts erreichen. Wohl aber war seine Wirkung erheblich abzuschwächen durch eine entsprechende Regelung der Gesetzgebung über den Unterstützungswohnsitz, ohne welche Freizügigkeit nahezu wertlos war. In diesen Bestrebungen war Mecklenburg im Verein mit anderen Staaten - die meist aus gänzlich anderen Motiven heraus sich gegen die preußischen Pläne sträubten - durch mehrere Jahre erfolgreich. Man erkannte im Ausschuß des Bundesrates auf Kompetenzerweiterung und auf Mecklenburgs Verlangen auf Verfassungsänderung. Erst 1870 gelang es, eine für Preußen annehmbare Form der Einigung zu finden.
Griff schon die Angelegenheit des Unterstützungswohnsitzes nach der mecklenburgischen Auffassung über die Kompetenz des Bundes hinaus, so war das noch mehr der Fall mit dem Bestreben, da preußische Ministerium des Auswärtigen auf den Etat des Bundes zu übertragen. Schon Ende 1868 hatte der Bundeskanzler dem preußischen Abgeordnetenhause die Zusage in diesem Sinne gemacht. Der Bund wurde bisher völkerrechtlich durch das Präsidium vertreten, doch gewissermaßen nur im "Nebenamt", denn die preußischen Botschafter blieben Vertreter des Königs von Preußen und verwalteten nur nebenher die Interessen des Bundes, so daß an sich gegen dieses Verlangen nichts einzuwenden war. Es war aber nun die Frage, ob mit der geplanten Maßnahme das Gesandtschaftsrecht der Einzelstaaten aufhören solle. Bisher war den Einzelstaaten das aktive und passive Gesandtschaftsrecht belassen worden, und Mecklenburg hielt neben der Gesandtschaft in Berlin auch eine solche in Wien und Paris. Man erwog auch die Möglichkeit, ob folgerichtig auch das preußische Kriegsministerium unter das Bundeskanzleramt gelegt werden sollte, so daß es zu einer Exekutivbehörde des Bundes wurde, vielleicht sogar mit konstitutioneller Verantwortlichkeit. Man fürchtete vor allem das Vordrängen des Reichstages, das sich auch hierbei geltend machte. Diese beabsichtigte Neuerung wurde unwillig als ein Nachgeben gegenüber dem Drängen auf den Einheitsstaat hin angesehen. "Früher hieß es, die Frucht solle reif werden, jetzt wird offenbar der Baum tunlichst geschüttelt."
Obwohl die Neuerung erst von 1870 ab durchgeführt werden sollte, glaubte man in Strelitz schon jetzt die Zeit zum Einspruch


|
Seite 62 |




|
gekommen. Bülow wurde angewiesen, sich gegen die Übernahme zu erklären, weil die Verfassung darüber nichts bestimme. Man hielte es nicht für geraten, daß eine Verfassungsänderung eintrete, "welche nach kaum zwei Jahren einen Grundstein der Verfassung wegräume und das Königreich Preußen in das Königreich Norddeutschland umwandle". Bülow besänftigte ein wenig und empfahl noch zu warten. "Ganz im reinen scheint man hier noch nicht damit zu sein. " In altpreußisch-partikularistischen Kreisen hatte man wenig Geschmack für die Sache. Aber im Bundesrat war die Stimmung anders. "Die meisten Staaten werden einfach zustimmen, weil man überall die Sache als eine reine finanzielle ansieht."
Die Frage wurde dahin gelöst, daß die Staaten, die Spezialgesandtschaften hielten, zum Etat der Diplomatie nur die Hälfte des für sie festgesetzten Teiles beitragen sollten. Man hatte errechnet, daß durch das Bestehen der Einzelgesandtschaften der Bund Ersparnisse mache.
Mecklenburgs Wünsche waren damit gewiß nicht erfüllt, aber man tröstete sich mit beschwichtigender Selbsttäuschung damit, daß darin eine "Anerkennung des Rechtes der selbständigen Fortexistenz" ausgesprochen sei.
"Der Antrag," schrieb Bülow, "zeigt deutlicher als vieles andere die unfertige Ent- oder Verwicklung der Bundesverhältnisse" und "im Reichstag macht man kein Hehl daraus, daß man die Sachlage nicht befriedigend finde, nicht mehr unterscheiden könne, wo Preußen und wo der Bund anfange und aufhöre. Wie es heißt, stehen Anträge auf verantwortliche Bundesministerien bevor". Es war nicht ermutigend, "daß Demokraten, Liberale und Konservative in der Klage über die Kompetenzkonfusion und den Mangel verantwortlicher Bundesorgane so ziemlich übereinstimmten, jeder freilich von seinem Standpunkt aus und zu seinem Ziele hin. Diese Ziele aber können leicht auf Kosten dessen, was uns an Selbständigkeit noch übriggeblieben ist, zusammenlaufen."
Für Bülows Haltung war es nicht unwichtig gewesen, wie sich Sachsen und Hessen verhielten. Die finanzielle Erleichterung war durch das Zusammenhalten dieser Staaten mit Mecklenburg erreicht worden, und Friesen 11 ) hatte Bülow ihm von Bismarck gemachte Zusagen mitgeteilt, nach denen an dessen Absichten, Übergänge möglichst schonend einzuführen, kein Zweifel sein konnte. "Verdrießlich ist dabei, daß die kleinsten Staaten den Augenblick nicht erwarten können, wo die Sache sich realisiert und dabei gegen alle Rücksichten der, wenn man noch den Ausdruck gebrauchen darf: Mittelstaaten, wirken."


|
Seite 63 |




|
Bei dem drohenden Vordringen des Reichstages erschien Bismarck als der einzige Faktor, auf den zu rechnen war. Bismarck rechtfertigte auch das Vertrauen, das Bülow auf ihn setzte, indem er im Bundesrat ankündigte, er würde "den zur Beseitigung der Verfassung führenden Antrag auf Einführung verantwortlicher Ministerien auf die Tagesordnung setzen, um darüber einen Beschluß des Bundesrates zu provozieren, und würde solches auch in anderen Fällen für seine Pflicht erachten". Er betonte, daß er eine Erweiterung der Präsidialrechte nicht für wünschenswert halte, "vielmehr im Vertrauen der Regierungen und in der Erhaltung des Rechtes des Bundesrates eine bessere Grundlage für die Zukunft erblicke als in jenem Streben des Reichstages nach Bundesministerien, erster Kammer und dergleichen."
Der vom Reichstag kommende Antrag auf verantwortliche Bundesministerien wurde dann auch "als weiterer Erwägung nicht mehr bedürfend" zu den Akten genommen. "Die Sache selbst freilich", zweifelte Bülow, "wird schwerlich wieder einschlafen."
Noch andere Bundesorganisationen von schwerwiegender politischer Bedeutung bereiteten sich im Laufe des Jahres 1869 vor. Sie alle mußten die Selbständigkeit der Einzelstaaten immer weiter einschränken und riefen unter den Bevollmächtigten, die für deren Erhaltung eintraten, "allgemeine Mißstimmung" hervor. "Daß wir in einem auf die Länge unhaltbaren Übergangssystem sind, empfindet hier jeder. Da man aber den Reichstag wegen der öffentlichen Meinung nicht entbehren zu können glaubt, wird dieser aufreibende Zustand dauern, bis einmal große Ereignisse dazwischentreten."
Auf Antrag Sachsens wurde die Errichtung eines obersten Gerichtshofs für Handelssachen beschlossen. Schon im Juni erfolgte vom Reichstag ein Antrag auf Erweiterung der Bundeskompetenz auf das gesamte bürgerliche Recht. Bülow hatte diese Befürchtung schon ausgesprochen, als von dem Oberhandelsgericht die Rede gewesen war. Im Bundesrat zeigte sich Neigung "mit Rücksicht auf den zugrundeliegenden nationalen Gedanken, dem Antrag einen gewissen Spielraum für die Zukunft zu eröffnen." Nur über das Maß dessen war man im Zweifel. Bülow betonte energisch die Inkompetenz des Bundes. Er war von Strelitz angewiesen, die Auffassung auszusprechen, "Eingriffe in die Kompetenz der Einzelstaaten sollten nicht durch die Form des Artikels 78 der Bundesverfassung, vielmehr nur durch Zustimmung aller Bundesmitglieder legalisiert werden können." Der Bundestag in Frankfurt war immer noch nicht vergessen.
Noch erreichte Bülow, daß man davon absah, auf den Gegen-


|
Seite 64 |




|
stand einzugehen. Aber er glaubte damit selber nicht an endgültigen Erfolg. Es war nur ein Aufschub erreicht. "Es wird im Reichstag immer wieder auf das Thema zurückgegriffen werden, je nachdem es den Parteien und den weitgehenden Plänen des Justizministers konveniert."
Und aus dem Bundesrat selbst kam fast gleichzeitig ein Antrag auf Errichtung eines obersten Gerichtshofes. Doch fand er keine Mehrheit. Noch ging der Kelch vorüber.
Aber das Vorgehen gegen die Selbständigkeit der Einzelstaaten in diesen und anderen Plänen hatten gezeigt, wie es unaufhaltsam den Weg zum Einheitsstaat hinabging. Und wenn auch wohl Bismarck selbst die Hand dazu nicht reichen wollte, so erkannte doch Bülow ein zwangsläufiges Fortschreiten auf dieser Bahn. "Er muß vorwärts oder zurück und vorwärts heißt eben einen Schritt weiter zum Bundesstaat", soll heißen: Einheitsstaat. Zurück würde Bismarck nicht gehen. Mit dem Reichstag wollte er offenbar nicht brechen, um nicht die Möglichkeit aus der Hand zu geben, ihn zu größeren Plänen zu benutzen. An eine ruhige Entwicklung und Entspannung der Situation glaubte Bülow nicht. Er erwartete Unheil aus der Zukunft. "In den konservativen Kreisen glaubt man auch an eine Krisis, hofft aber, daß auf die Länge die Unmöglichkeit, mit dem suffrage universel und einem solchen Reichstag zu regieren, die Krisis zum Guten führen und man sich zum Einlenken noch entschließen könne. Die Bundesverfassung sei nicht lebensfähig. Man werde die Nationalvertretung über Bord werfen und mit einem deutschen Bunde endigen, in welchem Preußen die Hegemonie für Politik und Heer habe. Ich fürchte aber, die Dinge sind zu weit gediehen, namentlich durch die nivellierende Gesetzgebung, als daß ohne eine alles erschütternde Katastrophe dieser einfache Ausweg noch wahrscheinlich genannt werden könnte. Man wird es hier doch immer leichter finden, auf dem Wege der allmählichen Annexionen fortzugehen, als zum Föderativsystem, das feste Rechte und ein Veto voraussetzt, zurückzukehren." Noch war zwar die Person des Königs eine Sicherung. "Gewisse Dinge wird König Wilhelm nicht tun: der Kriegsminister wird preußisch bleiben, die Färbung der Ministerien und der Regierung konservativ, die Existenz der Bundesgenossen von 1866 äußerlich die von Souveränen. Aber wenn einmal ein Thronwechsel eintritt, so fallen nicht bloß eine Menge noch sehr mächtiger altpreußisch-royalistischer Traditionen fort, sondern es treten an die Stelle bestimmter Abneigungen des durch alle Ereignisse und durch seine Persönlichkeit überaus mächtig gewordenen Monarchen neue Ideen und wahrscheinlich ganz bestimmte Aspira-


|
Seite 65 |




|
tionen auf das deutsche Kaisertum. Alle Politiker wissen und müssen in Rechnung bringen, wie sehr die koburgische Politik dereinst von Einfluß sein wird: über die Sympathien einer erlauchten Dame, welche den Herrn v. Bennigsen und Herrn Miquel den märkischen Konservativen bei weitem vorzieht, ist nicht der geringste Zweifel. Und inzwischen," so schließt er klagend den Ausblick, "erwächst eine neue Generation, die von der Überlieferung Friedrich Wilhelms III. ebensowenig weiß wie von der Stahl-Gerlachschen Schule."
Die bange Sorge, mit der Bülow in die Zukunft blickte und sich über die Zukunft klar zu werden suchte, wurde auch in anderen Bundesstaaten geteilt. Bülow berichtet den Ausspruch des weimarischen Staatsministers v. Watzdorf, der als der "liberalste deutsche Minister" (wie er sich bezeichnete) sagen zu müssen glaubte, daß man mit der fortschreitenden Zentralisation der Revolution in die Hände arbeite. Auch in Sachsen waren solche Stimmungen lebendig, und Unzufriedenheit war überall. "Kaum ein Tag vergeht, wo nicht durch das eine oder andere Gesetz, durch eine oder die andere Zusatzbestimmung das Recht der Selbstverwaltung der kleineren Staaten gefährdet oder verletzt wird." Das einzige Mittel der allmählichen Absorbierung zu entgehen, sah Bülow in einem engeren Verhältnis zu den süddeutschen Staaten.
Wenn auch die Hauptgefahr vom Reichstag drohte, so war doch auch die Gesamtrichtung der deutschen Politik Bismarcks geeignet, hier Besorgnisse zu erwecken und die Unzufriedenheit zu vertiefen. "Seine Auslassungen über die Notwendigkeit der Rechtseinheit, illustriert durch die Bemerkung, daß er nicht Sachsen oder Hessen kenne, sondern nur Norddeutsche, zeigten deutlich die Richtung, in der das Unifikationswerk fortschreiten wird."
Immer wieder und immer stärker klingt aus den Berichten Bülows die Unzufriedenheit und die Mutlosigkeit. Und seine Regierungen teilten sie. Ja, ihre Ablehnung war nur unnachgiebiger. Sie sahen sich einer schicksalhaften Gewalt wehrlos ausgeliefert. Sie erkannten wohl, daß sie ihr erliegen würden. Aber sie wollten nicht mit ihr paktieren.
Das Prinzip ihrer Haltung war, scharf und konsequent jede Überschreitung der Kompetenz des Bundes zurückzuweisen, ohne sich durch die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Maßnahme gewinnen zu lassen. Es ist kaum ein Fall aufzuweisen, wo Mecklenburg auf der Seite der Majorität stand. Das geschah nur, wenn sich diese Majorität zur Ablehnung einer Vorlage zusammenfand. In den meisten Fällen gab es seine Stimme gegen die Entwürfe der preußischen Regierung ab, da überall Zentralisierung und


|
Seite 66 |




|
Unifikation gesehen wurde und auch wohl vorhanden war. Wurde es überstimmt, so gab es seine abweichende Meinung durch wirkungslose Proteste und Verwahrungen kund, die zurückzuhalten nicht würdelos gewesen wäre. Aber man glaubte, "daß, wenn nicht die Frage der Kompetenz fortwährend wach erhalten wird, das Bestreben, die Einzelstaaten ihres Marks zu berauben, immer wieder auftauchen und zuletzt zum Ziele gelangen werde." Und danach handelte man. Man erhob die Kompetenzfrage in wichtigen und unwichtigen Dingen, von der gewiß bedeutsamen Angelegenheit der Bundesministerien herab bis zu der fast grotesk anmutenden Betonung der Inkompetenz bei Zuschüssen zum Germanischen Museum in Nürnberg und zur Gotthardtbahn.
Man berief sich auf Paragraphen und Artikel, wo es sich um lebendige Verhältnisse handelte, die nicht durch juristische Formeln einzufangen waren.
Auf die Dauer sah man sich ohne Erfolg. Aber man war nicht bereit, den nutzlosen Widerstand aufzugeben. Man protestierte weiter, mechanisch fast, als ständige Unruhe, um nicht in Vergessenheit zu geraten. So tief war der Gegensatz zum Bunde, so zäh der Wille, sich den Rest der Selbstäntigkeit und die alten Zustände zu erhalten.
Wenn Bismarck Mecklenburg "als den treuesten Verbündeten Preußens" (gegen Bülow) bezeichnete, so dürfte er es mit einem leisen Lächeln getan haben. Gewiß, man kann nicht sagen, daß es zu anderen Mitteln griff als zu Protesten. Mecklenburg war in seiner ganzen Lage nicht geeignet, einen Dalwigk hervorzubringen und groß werden zu lassen. Wohl mochte hier und da die Hoffnung auf "bessere Zeiten" gehegt werden, aber der Spekulation auf eine gewaltsame Umwälzung praktisch Vorschub zu leisten, dazu sah man die Lage mit zu nüchternen Augen an. Dem Bunde gegenüber kam man indes nach der positiven Seite nicht über eine passive Resistenz hinaus.
* *
*
Dann kam der Krieg mit Frankreich. Er lockerte mit der nationalen Begeisterung, die er entfachte, auch in Mecklenburg manche unlöslich scheinenden Bindungen an die Vergangenheit. Er verknüpfte enger mit Deutschland.
Mecklenburg hatte naturgemäß auf die Entwicklung der Dinge keinen Einfluß. Es stand den Ereignissen beobachtend gegenüber, und seine Leiter suchten sich aus all den fließenden Kräften, die nach neuen Formen strebten, die Zukunft zu deuten. Mit der Aussicht auf den Sieg war es klar, daß "der Main jetzt ein Ende haben"


|
Seite 67 |




|
werde. "Angesichts der gewaltigen Ereignisse der letzten Monate werden sich auch Bayern und Württemberg einem deutschen Kaiser unterwerfen. . . . Es wird nur noch auf den Grad der Autonomie für die inneren Angelegenheiten ankommen, die bei dieser Evolution allen Bundesgliedern reserviert bleiben." Die Erweiterung des Bundesrates und des Reichstages durch Bayern und die übrigen süddeutschen Staaten wird eine Förderung der Interessen der Gesamtheit und der Einzelstaaten bedeuten. Der allgemein deutsche Gesichtspunkt des Bundes wird im Eintritt der Südstaaten seine Bürgschaft finden.
Dieser Gedanke war in Mecklenburg ja schon vor dem Kriege geläufig gewesen: der Eintritt der Süddeutschen bedeutete eine Stärkung des föderalen Elementes im Bunde. Dem Partikularismus wurde Schutz und Raum gegeben. Die Gefahr der "allmählichen Annexion" und der "Absorbierung" schien überwunden. Das Gespenst des Einheitsstaates schien gebannt.
Anlaß zu Befürchtungen gaben nur die europäischen Konsequenzen des Krieges. Man sah in dem Streben nach der Wiedergewinnung des Elsaß folgenschwere Verwicklungen sich anbahnen. "Die öffentlichen Stimmen in Deutschland verlangen mit Entschiedenheit den Elsaß und Sicherstellung gegen die von Frankreich drohende Kriegsgefahr - beide Forderungen widersprechen sich, denn, wenn Frankreich Straßburg verliert, wird wenigstens dies Jahrhundert keinen gesicherten Frieden haben." Bülow, der diese Worte schrieb, sah aber auch, "daß es schon einem besiegten Frankreich gegenüber nicht leicht sein werde, Garantien gegen einen neuen Friedensbruch und beständige Eifersucht zu finden".
Als dann die Kaiserfrage aufgerollt wurde, legte Mecklenburg Verwahrung ein gegen eine darin etwa beabsichtigte materielle Änderung der Rechte und Rechtsverhältnisse der Bundesstaaten. An Ablehnung konnte man natürlich nicht denken und dachte man auch nicht. Aber die uneingeschränkte Begeisterung, mit der die Ereignisse in der Öffentlichkeit auch in Mecklenburg aufgenommen wurden, findet man bei den mecklenburgischen Staatsmännern nicht. Bülow kam noch am weitesten hinweg über das alte Mißtrauen kleinstaatlicher Denkart gegen den wesensfremden preußisch-deutschen Machtstaat, der die Existenz der Kleinstaaten bedrohte. Die Sünden des Jahres 1866 waren noch nicht vergessen - und das Wesen des preußischen Staates ging auf das Reich über. Das Ideal aber dieser Männer, das ihnen in der Jugend vorgeschwebt haben mochte, war ein anderes Reich. Im Grunde hatten sie doch alle ein heimliches Mißtrauen gegen dieses Preußen, das halb mit Gott und halb mit dem Teufel im Bunde war.


|
Seite 68 |




|
Eine Tröstung war immer wieder die Tatsache der Zugehörigkeit der Süddeutschen zum neuen Reich, welche Preußen ein Gegengewicht, den Kleinstaaten ein Rückhalt sein konnten. Die Strelitzer Regierung kam von diesem Gedanken aus dazu, sich für die Aufnahme der Bestimmungen des bayrischen Schlußprotokolls in die Reichsverfassung einzusetzen. Schwerin lehnte das ab. Der Verfassung des Reiches wurde von mecklenburgischer Seite ohne Vorbehalt zugestimmt. Eine innere Verschmelzung aber, eine innere Übereinstimmung deckte diese formale Handlung nicht.
Für das mecklenburgische Staatswesen bedeutete die Einbeziehung in das Reich keine Änderung. Dieselbe Verteidigungsstellung, die es dem norddeutschen Bunde gegenüber innegehabt hatte, nahm es dem Reiche gegenüber ein. Mochte aus der preußischen Zentralisierung eine deutsche geworden sein, es setzte sich nach wie vor dagegen zur Wehr. Wie der norddeutsche Bund des allgemeinen Wahlrechtes den mecklenburgischen Anachronismus übersehen und geduldet hatte, so billigte auch das neue Reich sein Bestehen. Und solange die ständische Verfassung in Kraft war, mußte das staatliche Mecklenburg in dem auf anderen Prinzipien beruhenden Reiche ein Fremdkörper sein. Ein innerer Gegensatz blieb bestehen. Es gab keine Basis, auf der er hätte überwunden werden können.


|
Seite 69 |




|
Anlage.
Zu Seite 33.
Brief des Großherzogs Friedrich Franz vom 18. Juni 1866 an König Wilhelm:
Du wirst Dich gnädigst erinnern, daß Du mir eine Verwendung meiner Truppen in den Herzogtümern vorschlugst, mir dagegen die Integrität meines Landes zusagtest, und ich mich dankbar dafür und bereit zu dieser Leistung erklärte, inmittelst auch auf Deine Aufforderung die Einleitung zur Mobilmachung getroffen habe.
Nun traf gestern eine Note von Richthofen ein, welche, als wenn Obiges gar nicht verabredet wäre, die Mobilmachung verlangt und dagegen Preußens Schutz verheißt. Ich habe nicht umhin gekonnt, in der offiziellen Antwort, wenn auch nur ganz allgemein, auf unsere direkten Abmachungen hinzuweisen.
Indem ich hiermit nun bestimmt die Zusage wiederhole, daß ich nach vollendeter Mobilmachung bereit bin, wenn Du es verlangst, meine Truppen (2 Infanterieregimenter, jedes zu 2 Bataillonen, 12 Geschütze und das Dragonerregiment zu 4 Eskadrons) zur Besetzung von Schleswig abrücken zu lassen, ersuche ich Dich, Deinen Behörden die dazu nötigen Befehle zu geben und mir darüber eine kurze, wenn auch nur telegraphische Mitteilung zugehen zu lassen. --
Indem ich mit felsenfestem Vertrauen auf die Erfüllung Deiner gnädigen Zusage baue, verbleibe ich
Dein
gehorsamer
Neffe
Fritz."
Brief König Wilhelm an Friedrich Franz (nach der letzten Fassung des Entwurfs * )):
"Dein Brief vom 18. Juni hat mich überrascht; ich hatte gehofft, daß Du unter den veränderten Umständen auf jede Beschränkung Deiner Kooperation verzichten würdest. Daß ich mit Dir empfinden konnte, wie schmerzlich es ist, gegen frühere Bundesgenossen zu kämpfen, habe ich gezeigt: wenn ich aber sehe, mit welchem Eifer die Freunde und Verbündeten Österreichs sich beeilen, ja dazu drängen, gegen Preußen zu kämpfen; wenn ein jeder Tag mehr Beweise gibt, wie fest und lange vor-


|
Seite 70 |




|
bereitet die Koalition gegen mich war, die im Beschluß vom 14. ihren Ausdruck fand - so ist es mir schmerzlich, daß ich nur bei meinen Freunden und nächsten Verwandten den Gefühlen begegne, die in dem entgegengesetzten Lager so gar nicht vorhanden sind. Ich hoffte, Du namentlich würdest in diesem Augenblick kein anderes Gefühl haben als das Bedürfnis des Zusammenhaltens mit mir auf jede Gefahr hin!
Ich muß jetzt von Dir erwarten, daß Du die Ausrüstung Deiner Truppen auf das Äußerste beschleunigst, damit sie mir wenigstens die volle Verwendung der meinigen möglich machen. Wenn es noch Dein Wunsch wäre, der damals vor Sprengung des Bundes noch zurücktrat, Dein Kontingent in seiner Aktion verwendet zu sehen, statt dasselbe Garnisondienst in Schleswig-Holstein versehen zu lassen, so werde ich es mit den Thüringischen und Anhaltischen in der Gegend von Dessau konzentrieren, zu einem Reservekorps à tout évènement. Jedenfalls hoffe ich, daß Du Deinen Bundestagsgesandten nicht länger an den Verhandlungen in Frankfurt wirst teilnehmen lassen. Das wäre ja im gegenwärtigen Augenblick eine direkte Feindseligkeit. Der Großherzog zu Oldenburg hat aus einem Gefühl, wofür ich ihm dankbar bin, aus freien Stücken seinen Austritt angezeigt; und ich darf dasselbe Gefühl bei Dir voraussetzen.
Daß ich die Integrität Deines Landes Dir gerne gewährleiste, ist selbstverständlich. Die Formen eines Bundes, den ich zu schließen bereit bin, werden sich ja finden; - ein Bund freilich, in welchem falsche Machinationen und geradezu Intrigen vorkommen können, wie die von der 16. Curie an dem verhängnisvollen Tage in Frankfurt abgegebene Abstimmung, darf es nicht wieder werden. Der alte Bund ist lange genug der Tummelplatz der Intrigen gegen Preußen gewesen; wir wollen unser neues Verhältnis in Ehrlichkeit und gegenseitigem Vertrauen begründen."
Tagebuchnotiz Friedrich Franz' vom 21. Juni 1866:
"Wichtiger Tag. Nach 8 Uhr Flügeladjutant Graf Finkenstein in Steinfeld mit Brief des Königs und Aufforderung, Truppen nicht nach Schleswig, sondern zur Armee stoßen zu lassen. Entscheidung sofort gefaßt. 10 zur Stadt. Mobilmachung befohlen . . .. 5 Finkenstein Antwort mitgeteilt. 8 Brandenstein und Zülow. Ersterem Schreiben an König und Instruktionen gegeben. Gott Schütze mein Land und Volk und lasse diesen unvermeidlichen und nach meiner besten Überzeugung richtigen Schritt zum Guten ausschlagen."