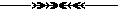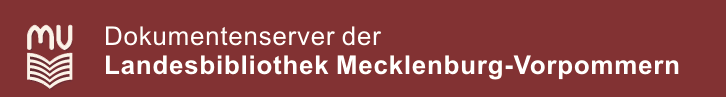|
Seite 190 |




|



|
|
:
|
VII.
Die Politik des Herzogs Friedrich
von Meklenburg=Schwerin
(1756 - 1785)
in Kirchen= und Schulsachen.
Nach den Urkunden dargestellt
von
Dr. U. Hölscher,
Oberlehrer am Realgymnasium in Bützow. 1 )
W enn man den Ursachen nachforscht die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine so radicale Linkswendung der religiösen Denkart herbeiführten, so möchte man nicht weit vom Rechten abirren, wenn man dieselben sucht theils in dem Widerspruche, in welchen manche Dogmen oder Bräuche der Kirche zu den Ansichten und Bedürfnissen einer fortgeschrittenen Zeit gerathen waren, theils in dem gesteigerten Wohlstand und der damit zusammenhängenden Genußsucht, theils in der bei den herrschenden Staatsmännern aufgekommenen Meinung, daß zur Aufrechterhaltung und Regierung der Staaten es nur materieller Mittel bedürfe. Wie soll man sich anders den Beifall erklären, dessen sich irreligiöse Schriften erfreuten, wie jene Frivolität, die zur Mode geworden war? Wo aber der sittliche Ernst vergeht, erlischt auch die fromme Gesinnung und der Glaube, und wo diese aus der Seele entwichen sind, findet der Mensch mit seiner Vernunft in allem, was Andacht oder Gottesdienst heißt, nur Gegenstände seines Tadels oder Spotts.


|
Seite 191 |




|
Die Meinung war allgemein, daß gute Finanzen, gute Polizei und ein wohlgedrilltes Heer die einzigen unentbehrlichen Erfordernisse zur Blüthe eines Staates seien; und indem man daher immer nur von einer Staatsmaschine redete, vergaß man die größere Macht, welche Ideen, Grundsätze und Sitten auf die Menschen ausüben. Die großen Ereignisse der folgenden Zeit gaben die Lehre vom Gegentheil. Als die wohlgeschulten Heere geschlagen waren, die Polizei sich ohnmächtig erwies und die Staaten sich auflösten, lernte man von der Ueberschätzung der materiellen Kräfte zurückkommen und einsehen, daß zur Lenkung von Völkern und Staaten vor allem es der Macht der Idee und der guten Gesinnung bedürfe; man erkannte, welche hohe Bedeutung das wahre Christenthum für das Leben und Gedeihen der Staaten habe; und damit begannen auch die Fürsten wieder die Kirche zu ehren und ihr Wirken zu unterstützen, durch bittere Erfahrung belehrt, daß grade die Kirche in den menschlichen Gemüthern jene Gesinnung hervorrufe und fördere, aus welcher allein die bürgerliche und häusliche Tugend der Völker hervorgeht. Das Wort des Heilandes: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Andere zufallen", läßt sich auch in der Politik nicht ungestraft verachten.
Auch unserm lieben meklenburgischen Lande blieb jene bittere Erfahrung nicht erspart. Beinahe dreißig Jahre lang hatte der fromme Herzog Friedrich, "der Gesalbte des Herrn", es seine vorzüglichste Regierungssorge sein lassen, den verderblichen Geist der Aufklärung von seinem Lande fern zu halten; aber kaum hatte er die Augen geschlossen († 24. April 1785), als der gewaltsam unterdrückte Wille des Volkes, schon lange des verhaßten pietistischen Joches überdrüssig, mit stürmischer Leidenschaft die Fesseln abwarf und dem schmerzlich entbehrten Genuß der goldenen Freiheit sich hingab: ein Umschlag trat ein, wie ihn ähnlich kaum die Geschichte sonst kennt. Da zeigte sich, wie es selbst dem ernsten Willen eines kräftigen Fürsten unmöglich ist, dem Geist der Zeit einen haltenden Damm entgegenzuwerfen. Nur eine kleine Gemeinde von Frommen blieb übrig, von Gott ausersehen, durch den Sturm hindurch die Gnade in die neue Zeit zu übertragen; die Andern fielen alle ab zu dem bequemeren Rationalismus. Die Gährung aber in den Gemüthern war so tief, daß auch die Zeit der folgenden bösen Noth nicht beten lehrte, und die wiederholte ernste Mahnung des volksbeliebten Herzogs Friedrich Franz, "den hochseligen Friedrich nicht zu vergessen", ungehört verklang. Man wollte von den Wohlthaten dieses Fürsten, in dem man nur den "Unterdrücker


|
Seite 192 |




|
der Freiheit" den "frommen Eiferer", den "Pietisten" sah, nichts wissen noch hören. Erst nach und nach kehrte die ruhige Besinnung und damit auch das gerechtere Urtheil zurück. Meklenburg beginnt jetzt in ihm einen seiner trefflichsten Fürsten zu verehren.
So darf denn nunmehr auch ich die Zeit für gekommen halten, mit einer reiner rein sachlichen Darstellung der Politik des Herzogs Friedrich in Kirchen und Schulsachen hervorzutreten. Ich versichere dabei noch ausdrücklich, daß kein Augenmerk mir wichtiger sein soll, als die Zurückdrängung jeder persönlichen Theilnahme. Wenn ich nur das erreiche, daß jedermann, er stehe links oder rechts, bekennt, der Herzog Friedrich verdiene, als Wohlthäter seines Volkes von keinem Meklenburger vergessen zu werden, so habe ich meine Aufgabe gelöst.
Erster Theil. Das Kirchenwesen.
I. Der Herzog Friedrich.
Dem Geheimen Archivrath Dr. Wigger in Schwerin verdanken wir die Lebensgeschichte des Herzogs Friedrich bis zu dessen Regierungsantritt (Bd. XLV dieser Jahrbücher). Dank dieser eingehenden Arbeit steht die geistige Entwickelung, der Charakter, überhaupt das ganze Wesen des Fürsten so ausgeprägt vor unsern Augen, daß ich mich mit einem Hinweis darauf begnügen könnte, wenn es nicht nothwendig erschiene, wenigstens einige Bemerkungen über die Persönlichkeit und die persönliche Stellung des Herzogs zur Landeskirche und ihrer Lehre vorauszuschicken.
Der Herzog Friedrich 1 ), der Sohn des Herzogs Christian Ludwig II. von Meklenburg=Schwerin und der Herzogin Gustave Caroline von Meklenburg=Strelitz, war am 9. November 1717 auf dem Schlosse zu Grabow geboren. In den ersten 8 Jahren war er als der noch einzige Sohn seiner hohen Eltern der verhätschelte Liebling des ganzen Hofpersonals, darnach bekam er an Ludwig Jacob Weißensee einen ernst gerichteten, fast peinlich gewissenhaften Informator, der neben tüchtigem Unterricht besonders auch für eine strenge sittliche Erziehung sorgte. Wiederholte Besuche bei der Großtante in Dargun, der frommen Herzogin Augusta, trugen dazu bei, den unter der Noth des Landes auch selbst schwer leidenden Prinzen ernst zu stimmen. Von 1737 an war er 26 Mo=


|
Seite 193 |




|
nate auf Reisen in Holland, Belgien, Frankreich und England, überall die Merkwürdigkeiten mit großem Verständniß in Augenschein nehmend. Die Absicht des Vaters, eine Mariage mit einer englischen Prinzessin herbeizuführen, scheiterte an der Abneigung des Prinzen. Auch in Berlin, wohin ihn die Rückreise führte, suchte der Hof ihn vergebens zu fesseln. Im September 1739 kehrte er reich an Erfahrung in die lang entbehrte Heimath zurück.
Hier zeigte sich bald, daß die Welt mit ihrer Lust den Prinzen nicht zu befriedigen vermochte; unter dem Einfluß der frommen Großtante begann er von den Vergnügungen des Hofes sich zurückzuziehen und in der Stille Andachtsübungen und biblischen Studien so ganz sich zu widmen, daß der Vater nicht mit Unrecht fürchtete, daß der Sohn, von den Darguner Pietisten umstrickt und in den Irrgängen ihrer dunklen Lehren verloren, das rechte Verständniß für seine hohen Pflichten verlieren möchte. Als bestes Mittel, denselben wieder in die Welt zurückzurufen, wurde deshalb seine baldige Verheirathung mit einer weltlich gesinnten Prinzessin angesehen. Während aber der Vater noch unentschlossen suchte, hatte der Prinz bereits gewählt. Am 11. Mai 1744 wurde seine Verlobung mit der damals 22 Jahre alten würtembergischen Prinzessin Louise Friderike, der wegen ihres Reichthums viel umworbenen Enkelin des Herzogs Eberhard Ludwig von Würtemberg=Stuttgart, am Hofe ihres Oheim, des Markgrafen von Brandenburg=Schwedt, gefeiert. Am 2. März 1746 fand die Trauung ebendaselbst statt. Indessen die vom Vater erwartete Wirkung hatte diese Vermählung nicht: der Prinz hielt sich nach wie vor möglichst von rauschenden Vergnügungen des Hofes fern.
Bedenklicher indessen erschien es, das auch da noch, als mit dem Tode des Herzogs Karl Leopold (28. November 1747) dem Vater zahllose Geschäfte und Schwierigkeiten aus den Vergleichsverhandlungen mit den widerstrebenden Ständen erwuchsen, der Erbprinz, abgesehen von den kirchlichen Streitigkeiten, kaum hervorragenden Antheil an den Staatsgeschäften nahm und sein Interesse nach wie vor fast ausschließlich den wissenschaftlichen Studien widmete. Man bemerkte, daß der Gedanke, die lastende Sorge der Regierungsgeschäfte bald übernehmen zu müssen, etwas Beunruhigendes für sein Gemüth hatte, als ob es ihm dabei unmöglich sein werde, in Gottes Gnade zu bleiben; er bat und flehte zu Gott, "doch nur immer die Freude an Ihm seine einzige Freude sein zu lassen, da er sonst von keiner Freude wissen wolle." Und am Tage seines Regierungsantritts (30. Mai 1756) erflehte er


|
Seite 194 |




|
von Jesu: "ihn doch ferner so zu erhalten, und wenn er bei dieser seiner angetretenen Regierung nach seinem heiligen Willen handelte, und Er es ihm, wie schon geschehen, sehr segnete, er doch keinen andern Gefallen daran hätte, als daß sein heiliger Wille geschehen sei, und er immer wohl einsehe und bedenke, daß Er es gethan, und also immer in seiner Liebe wachse und immer zunehme und Sein Reich mächtig befördere und treu nach Seinem besten Willen handele." -
Bei dieser reinen Herzensgesinnung und tiefgegründeten Frömmigkeit, bei diesem rastlosen Streben nach dem Wahren, Guten und Schönen konnte es dem zum Throne berufenen jungen Fürsten an der allgemeinen Liebe im Lande zwar nicht fehlen; aber zum Herrschen gehörte doch mehr: dazu gehörte vor allem politische Klugheit und Erfahrung, besonders in einer Zeit, wo der große preußische König mit seinem gefürchteten Heere das Land mit Krieg zu überziehen im Begriff war. Beide Eigenschaften aber schien der Herzog wenig zu besitzen; war ihm doch nichts verhaßter als Intriguen und Winkelzüge; hielt er es doch für das größte Unrecht, auch um des größten Vortheils willen nur einen Schritt wider das Gewissen zu thun! Dazu lag in seinem ganzen Wesen nichts Kühnes, Heldenhaftes, vielmehr erschien er dem Fremden auf den ersten Blick zu wenig lebhaft und thatkräftig, wohl gar etwas pedantisch gemessen; und nur wer Gelegenheit hatte, dem Fürsten im Umgange oder im Rathe oder in dringender Noth näher zu treten, nahm wahr, daß die äußere Ruhe nicht dem angeborenen heftigen Temperamente entsprach, daß sein mildes, zurückhaltendes Urtheil doch auf natürlichem, scharfem Verstand und der vielseitigsten Bildung beruhte, und daß seine Seele bei aller Milde und Barmherzigkeit doch von einem gewissen Trotz und Argwohn nicht frei war. Daher war denn auch das Vertrauen des Landes zu der Politik des Herzogs nicht groß; man sah voraus, was kam: daß der Herzog, getrieben von seiner auch persönlichen Abneigung gegen den gewaltigen Nachbar, unabsehbares neues Kriegselend über sein kaum aufathmendes Volk bringen werde. Ebensowenig täuschte man sich über die kirchliche Politik des Herzogs, welcher schon als Erbprinz entschieden für die Pietisten von Dargun Partei genommen und ihrer Sache zum ersten Siege verholfen hatte; wieviel mehr ließ sich erwarten, daß er als Fürst diesen der Orthodoxie feindlichen Geist durch die Kirche über das ganze Land auszubreiten bestrebt sein werde! Und in der That, er machte Ernst mit dieser Sache. Wie er streng gegen sich selbst war, so war er es auch gegen seine Unterthanen, indem er von allen, den höchsten


|
Seite 195 |




|
wie den niedrigsten, die gewissenhafteste Erfüllung ihrer Pflichten forderte und in beinahe fanatischem Haß Alles verfolgte, was ihm sündlich oder verführerisch erschien. In seinem Leben war er so einfach, daß Viele daran Anstoß nahmen und den Hof mieden, der außer Andachtsübungen und erbaulichen Gesprächen oder wissenschaftlichen Discursen wenig Reizendes bot. Mochten aber die Schranzen und Schwätzer davon reden, was sie wollten, der Herzog pflegte mit Luther zu sagen: "Es zürne oder lache, wer will, so sehe ich doch und frage nach keinem Menschen, sondern sehe allein auf Christum; was der mir vorbehalten hat, das thue ich ihm zu Liebe um seines theuren Blutes willen. Wo solch Herz und Muth nicht ist, da bleibt kein Christ fromm und gläubig." Das Bewußtsein der mit seinem fürstlichen Amte verknüpften schweren Verantwortung vor Gott und Menschen erfüllte seine Seele mit unablässiger Angst und ließ ihn nur um das Eine stündlich beten, daß es ihm gelingen möge, seinem Volke "ein rechter Hoherpriester zu werden." Es ist ein köstliches Wort in dem Munde dieses, seinen Unterthanen durch alle Tugenden, durch Frömmigkeit, Fleiß und Sparsamkeit voranleuchtenden, gerechten Fürsten: "daß er sich immer vorhalte, wie seine Unterthanen auch Menschen gleich ihm seien, und er regieren müsse, wie die Gesetze es geböten, als Einer, der nicht ewig das Scepter führe, sondern stündlich abgerufen werden könnte, um vor dem Fürsten über alle Fürsten Rechenschaft abzulegen. Darum sei es auch sein höchstes Bestreben, seinem Volke ein rechtes Muster zu sein, da es eines Fürsten würdiger sei, durch den Lebenswandel als durch den Glanz der Hoheit die Liebe und Ehrfurcht der Unterthanen sich zu erwerben." Um dieses seines frommen Eifers willen hat die Geschichte dem Herzog Friedrich den Namen "Pius" gegeben, wohl nicht ohne bewußte Anspielung auf sein nahes Verhältniß zu dem von seiner Großtante, der Herzogin Augusta, im Lande angepflanzten und darnach von ihm selber verbreiteten s. g. Halleschen Pietismus. Daraus aber etwa zu folgern, daß ihm die gesunde evangelische Frömmigkeit fremd, er ein Kopfhänger oder gar ein Freund bigotter Frömmelei gewesen sei, wäre sehr verkehrt. Im Gegentheil, wie sehr der Fürst auch die Zurückgezogenheit liebte, so blieb er doch mit der Welt um ihn in engstem Verkehr; und man könnte kaum nachweisen, daß seine wissenschaftlichen Studien oder Andachtsübungen ihn jemals abgehalten hätten, seine Regierungsgeschäfte mit aller Gewissenhaftigkeit zu besorgen. Trotz der inneren Ueberzeugung, daß allein aus dem Gebete und dem Glaubensleben die rechte Kraft und Weisheit zu allen weltlichen Geschäften flösse, war er


|
Seite 196 |




|
doch weit entfernt, weltliche und geistliche Dinge zu vermischen. Es erscheint mir sogar ganz unglaublich, daß Herzog Friedrich bei seinem klaren Verstande die pietistischen Irrthümer nicht erkannt haben sollte. Als der Herzog Karl Leopold ihm einmal den Vorwurf machte, daß er ein Herrnhuter sei - verstanden waren darunter aber die Darguner Pietisten, welche Anfangs stark zu Zinzendorfs Lehre hinneigten -, antwortete der Prinz recht deutsch: "er sei sein Herrnhuter, habe vielmehr, lange bevor er nach Dargun gekommen, Gott gesucht und gefunden gehabt, in Dargun aber erst erfahren, was lebendiges Christenthum, was Buße und Belehrung sei." Indem er aber bei dieser Gelegenheit betheuerte, er sei ein gut lutherischer Christ, bezeichnete er klar die weite Kluft, welche ihn von den heterodoxen Sectirereien der Pietisten trennte. 1 ) Dennoch war der Herzog auch mit der Orthodoxie, wie sie damals war, gründlich zerfallen; er kehrte nicht allein in seinem Glaubensleben eine größere Schärfe gegenüber den s. g. Mitteldingen hervor, sondern hatte auch unter dem Einfluß des Hofes von Dargun sich gewöhnt, an der Orthodoxie nur ihre Schattenseiten, den Formalismus, das scholastische Begriffe spalten, die Polemik ihrer dogmatischen Systeme, zu erblicken. Also nicht die Lehre der Darguner war es, die ihn fesselte, sondern der fromme Bekehrungseifer der fremden Prediger, denen er darin beistimmte, daß bei der buchstabenstarren Orthodoxie der wichtigste Theil des evangelischen Gottesdienstes, die erbauende Predigt und das Sacrament, keinen rechten Bestand habe. Darum galten ihm auch die Prediger, die nicht "bekehrt" waren, wenig, und Christen, die nicht bibelfest und durch das Wort Gottes nicht erweckt, bekehrt und geheiligt waren, dünkten ihn unnütze Knechte; wer aber mit Angst und Zittern der Wiedergeburt und Erleuchtung nachjagte, der war der höchsten Gnade des Fürsten gewiß. Daß dadurch viele zu Heuchelei und Scheinheiligkeit verleitet wurden, ist leicht begreiflich; und nichts macht mir die nach dem Tode des Herzogs eintretende Reaction widerlicher als der offene Abfall so vieler Prediger und Hofbedienten zum crassesten Rationalismus; denn damit bewiesen sie, daß sie mehr dem Fürsten als Gott gedient hatten. Dem Herzog erwächst daraus kein Vorwurf, wenn ich auch nicht leugnen will, daß derselbe wohl etwas mißtrauischer hätte sein können und sollen; er


|
Seite 197 |




|
selbst meinte es ernst und wurde nicht müde, in fleißigem Gebete und gewissenhafter täglicher Selbstprüfung nach der Krone zu ringen. Alle Zeitgenossen ohne Ausnahme bezeugen es, daß sein Leben ein beständiger Gottesdienst, Gegenstände des Glaubens seine liebste Unterhaltung waren. Nahm er doch, um das Alte Testament in der Grundsprache lesen und den eben damals entbrennenden Streit über die Auctorität des Textes desselben beurtheilen zu können, noch im Alter von 52 Jahren Unterricht in der hebräischen Sprache!
Dies führt uns auf eine andere, nicht minder wichtige Frage: Wie stand der Herzog zu den Wissenschaften? Es ist ja bekannt, daß die bedenklichste Schwäche des Pietismus in der Geringschätzung aller nicht mit der Theologie zusammenhängenden Wissenschaften zu suchen ist; von dieser Einseitigkeit hielt sich aber der Herzog ganz fern; es wird ihm sogar nachgerühmt, daß er in der Philosophie, Mathematik, besonders aber in der Geschichte hervorragende Kenntnisse besessen habe. Wenn uns auch nicht ausdrücklich bezeugt würde, daß derselbe wiederholt in seinen Gesprächen das Wissen als ein hohes Gut gepriesen, welches hoch über Adel und Reichthum erhaben stünde, und bei allen Berufungen neben der Treue in erster Linie Gelehrsamkeit ihm als das nothwendigste Erforderniß gegolten: wir würden es allein aus dem innigen Verhältniß des Fürsten zu dem Geh. Rath Johann Peter Schmidt schließen dürfen. Denn dieser, früher Professor in Rostock, verdankte seine hohe Stellung und sein Vertrauen einzig seinem Wissen; ja, Dank diesem durfte er sich sogar erlauben, ohne das es ihm schadete, dem Pietismus entschieden Opposition zu machen. Während aber der Herzog mit solchen gelehrten Männern sich gern unterhielt und in Ernst oder Scherz die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens besprach, war ihm dagegen Gelehrsamkeit ohne Religiosität, alle Aufgeblasenheit und dünkelhafte Prahlerei aufs Tiefste verhaßt.
Neben den Wissenschaften liebte der Herzog besonders die Künste, die höheren wie die niederen; wie er für einen nicht gewöhnlichen Kenner von Gemälden galt, auch hervorragende Maler an seinen Hof zog, so besaß er auch selbst nicht geringe mechanische Fertigkeiten. In der Musik fand er die schönste Erholung, aber theatralische Vorstellungen duldete er nirgends im Lande, "da sie nur zu Müssiggang und Verschwendung neigten." Das beste Zeugniß für den hohen Kunstsinn desselben legen noch heute das Schloß und die großartigen Anlagen in Ludwigslust ab.


|
Seite 198 |




|
"Der Herzog Friedrich", heißt es in einer Predigt, die ein hervorragender Geistlicher dem Gedächtniß des frommen Fürsten weihte, stützte sich in dem Kampf gegen Welt, Teufel und Fleisch auf den starken Gottesarm; er war ohne Unterlaß mit und bei Gott. Um im Gebet in Andacht mit seinem Gott zu verkehren, hielt er sich von aller Eitelkeit und weltlichem Getümmel fern. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, führte er daheim und auf Reisen mit sich. Sein Stolz war, Gottes Ehre und Namen zu erweitern und zu verherrlichen. Er errichtete seinem Gott den prächtigen Tempel zu Ludwigslust; er unterstützte nach Möglichkeit die Geistlichkeit und verbesserte ihre Einkünfte; er hatte für alle Nothleidenden stets eine offene Hand; Ludwigslust war der Ort, wo Allen geholfen wurde. Den Kranken war er ein rechter Samariter; er unterstützte freigebig alle Spitäler und Krankenhäuser und öffnete sie für Alle ohne Unterschied der Confession. Dabei zeigte er eine seltene Demuth; er hielt sich selbst für den größten Sünder und verewigte in goldenen Buchstaben über der Thür der Kirche zu Ludwigslust dies Bekenntniß: Friedrich, Herzog zu Meklenburg, der erlöste Sünder, hat Christo, dem Erlöser der Sünder, diesen Tempel errichtet. In seiner Leutseligkeit und Freundlichkeit übertraf er Alle am Hofe. Er hielt sich nicht für besser als Andere, und wollte daher auch nach dem Hinscheiden Allen in der Ruhestätte auf dem Gottesacker gleich sein: mitten unter seiner Gemeinde in Ludwigslust wollte er begraben sein. Die Heilige Schrift sagt von Mose: er sei Gott und den Menschen lieb gewesen; auch von unserm Friedrich sage ich: er war Gott und den Menschen lieb, und sein Gedächtniß wird bei allen Rechtschaffenen in Ehren bleiben."
So groß dies Lob ist, wir würden doch allzu einseitig zu urtheilen scheinen, wenn wir des Tadels daneben vergessen wollten. Derselbe pietistische Feuereifer, welcher die ganze Thatkraft des Fürsten anregte und ihn zu gesegnetem Wirken in Staat und Kirche begeisterte, verleitete ihn auch oft, Zielen nachzujagen, welche dem Wohle des Ganzen widerstrebten, oder auch die Menschen anders voraussetzten, als sie sind. Das Schlimme dabei war, das die heftige Art des Fürsten sich durch keine Schwierigkeiten abschrecken ließ, vielmehr sein trotziger Eifer die Ursache davon nicht in dem verkehrten eignen Bestreben, sondern in der Sünde der Menschen sah. Und, wie zu geschehen pflegt, in solchen Fällen traute er den bösen Rathgebern, die ihm in niederträchtiger Gesinnung dienten, leichter als denen, die es wohl meinten. Ueberhaupt war es, wie bereits angedeutet, eine der gefährlichsten Schwächen des Fürsten, das er das Licht nicht genügend von der


|
Seite 199 |




|
Finsterniß zu scheiden vermochte, und daher manche heuchlerische oder sonst schlechte Subjecte sich sein Vertrauen erwarben und mit ihren Einflüsterungen oder Intriguen den Hof zu Ludwigslust in Verruf brachten. Aber die Schande trifft nur diese Frömmler, die reißenden Wölfe in Schafskleidern, welche die fürstliche Gnade in frecher Weise zu mißbrauchen wagten.
Der Lieblingsaufenthalt des Herzogs war das "paradiesische Ludwigslust", wo er am liebsten ungezwungen in engstem Kreise verkehrte. Seine Gemahlin Louise Friderike liebte von Natur harmlose weltliche Freuden, war aber klug genug, ohne Widerstreben zu den Reiz des stillen Lebens sich allmählich zu gewöhnen und durch treuen Samariterdienst als würdige Gattin ihres frommen Eheherrn zu erscheinen. Ihr Schicksal kinderlos zu sein ertrug sie mit gottergebenem Herzen; an dem innigen Verhältniß der beiden Gatten vermochte es nichts zu ändern. Doch mochte sie nicht ganz verzichten auf die Lust des Lebens, besonders aber nicht auf den Besuch des Theaters; es war ihr daher verstattet, alljährlich einige Wochen in Hamburg zu verleben, wo sie an der Alster ein eignes Haus hatte. Dem Prinzen Ludwig, dem jüngeren Bruder des Herzogs, war es am Hofe zu still; er lebte mit seiner Gemahlin, Charlotte Sophie, und den beiden Schwestern in Schwerin, ohne sich um die Regierungsgeschäfte zu kümmern. Dagegen hatte der Erbprinz Friedrich Franz bei seinem Oheim in Ludwigslust seine Residenz, wo ihm besonders die Bearbeitung der Domänen= und Kammersachen oblag.
Oberhofmarschall war der durch Gelehrsamkeit ausgezeichnete Herr v. Lützow, Oberhofmeister der beim Herzog wegen seines unfrommen Lebenswandels wenig geltende Herr v. Forstner, ein geborener Würtemberger, Oberschenk der junge "lustige" Herr v. Zülow, Mundschenk und Bibliothekar Cornelius: lauter Persönlichkeiten, welche mit der Lebensanschauung ihres Landesherrn nicht harmonirten und, wie der Adel des Landes überhaupt, von dem Pietismus nichts hielten.
Ebenso stand der Kreis der Juristen. Von J. P. Schmidt, dem Geh. Rath, war bereits die Rede, er war die rechte Hand des Präsidenten Grafen v. Bassewitz; beide von der Regierung Christian Ludwigs her übernommen, setzten die Politik des Vaters unter dem Sohne fort und waren in ihrem Zusammengehen stark genug, jeden Versuch pietistischer Streberei innerhalb der juristischen Carrière zu vereiteln. Wie dieselben z. B. als Curatoren der Friedrichs=Universität in Bützow Döderlein und seinen Anhang niederhielten, ist von mir in meiner Geschichte jener Universität er=


|
Seite 200 |




|
zählt worden. Die tüchtigen Regierungsräthe Faull und zur Nedden dachten ebenso. Dem Herzog war diese Abneigung der Juristen gegen den Pietismus wohl bekannt; er war aber einsichtsvoll genug, Staat und Kirche zu sondern. Andererseits aber faßte der Herzog die Verwaltung seines oberbischöflichen Amtes als eine persönliche Gewissenssache auf, bei der niemand mitzureden hätte, als wer besonders dazu von ihm berufen würde. Die Einzigen, welche als ständige Berather sein volles Vertrauen besaßen, waren der Cabinetssecretär Ludewig, der die Kirchen=, und der Rentmeister Kychenthal, der die Schulsachen zu behandeln hatte, beide Männer, welche dem Pietismus wenigstens sehr nahe standen.
Und endlich die Geistlichkeit? Der Herzog liebte es zwar, mit tüchtigen Predigern über Fragen der Religion sich zu unterhalten, hörte auch gern ein freimüthiges Wort oder Urtheil, im Uebrigen aber hielt er die Geistlichen von seinem Hofe fern. 1 )
II. Das Consistorium.
Als der Herzog Friedrich den Thron bestieg (1756), herrschte in Meklenburg auf keinem Gebiet größere Verwirrung als in geistlichen Sachen, so daß niemand recht wußte, was Recht war, und wie weit das Recht galt. In den verschiedenen Theilen des Landes waren nicht allein ganz verschiedene, sondern oft gar sich widersprechende Verordnungen in Kraft. Alle Versuche der vorangegangenen Zeit, eine für das ganze Land geltende Ordnung wieder herzustellen, waren an dem Widerstande der Stände oder der Schwierigkeit der Sache gescheitert. Nun war zwar im LGG. Erbvergleich von 1755, womit der Herzog Christian Ludwig seinem Sohne die Bahn geebnet hatte, die Nothwendigkeit einer Revision der bestehenden Kirchenordnung anerkannt, auch der Wunsch ausgesprochen, daß der Herzog die Initiative dazu ergreifen möchte, aber dabei zugleich zur Bedingung gemacht, das derselbe nichts unternehmen dürfe, ohne zuvor den Landtag gehört zu haben, da Kirchensachen die Wohlfahrt des ganzen Landes beträfen. Und


|
Seite 201 |




|
damit nicht genug, es war, um jedem Fürsten die Lust zum Vorgehen von vorne herein zu benehmen, die Competenz des Fürsten ausdrücklich auf Sachen allgemeiner Art beschränkt worden, zu allen übrigen aber, so weit sie nur irgend die Privilegien der Ritter= und Landschaft beträfen, ausdrücklich die Bewilligung der Stände vorbehalten. Deswegen unterließ der Herzog Friedrich auch die Arbeit im Großen anzufassen, die doch ohne schweren Conflict zu einem befriedigenden Resultat nicht gebracht werden konnte. Er begann zunächst mit einer Neuordnung der Geschäfte des Consistoriums 1 ) zu Rostock; denn diese oberste Kirchenbehörde hatte unter dem wankelmüthigen Regimente Karl Leopolds einen schlimmen Stoß bekommen und in dem Streite gegen die Darguner Pietisten beinahe ihr letztes Ansehen eingebüßt. Bereits am 30. November 1756 verordnete der Herzog: daß hinfort dem Consistorium alle Civil= und Proceßsachen abgenommen und den Landesgerichten zugewiesen sein sollten. Damit hörte die Gerichtsbarkeit desselben in weltlichen und Ehesachen (doch die Sponsalien und Ehesachen der Domanial=Unterthanen ausgenommen) auf, und die bürgerlichen Sachen waren den bürgerlichen Gerichten zurückgegeben. Was den Herzog zu dieser Aenderung der Consist.=Ordnung von 1570 2 ) bewog, war in erster Reihe wohl der Wunsch, die verwirrende Concurrenz zwischen den Landesgerichten und dem Consistorium zu beseitigen, daneben aber die Nothwendigkeit, sein altes fürstliches Recht klar zu stellen; er wollte beweisen, daß alle Ehesachen unter ihm ständen, und die der Ritter= und Landschaft, auch der Stadt Rostock eingeräumte Jurisdiction in Ehesachen Gnade sei, welche jeden Augenblick zurückgenommen werden konnte. Dies beweist auch der Vorbehalt bez. der Domanial=Unterthanen und wird klar ausgesprochen in der VO. vom 16. Mai 1776: "Die ritterschaftlichen Patrimonial= und Stadtgerichte sollten sich keine Jurisdiction in matrimonialibus anmaßen, sondern die Fassung des Endurtheils den Landgerichten überlassen."


|
Seite 202 |




|
War nun auch die Competenz des Consistortums 1756 sehr eingeschränkt, indem es jetzt wesentlich nur noch Doctrinalia, Ceremonialia, Disciplinalia unter sich hatte, so konnte es nun seine ganze Aufmerksamkeit dieser wichtigen Aufgabe, eine Disciplinarbehörde zu sein, zuwenden; und eben dies wollte der Herzog, wie wir aus dem gleichzeitigen Befehl an den Consistorial=Fiscal ersehen: hinfort "ohne alles Ansehen der Person rücksichtslos alle Excesse der Prediger und Küster zu verfolgen." Klarer noch sprach er diese Absicht aus in seiner Antwort an den Engeren Ausschuß der Ritter= und Landschaft, der sich über die einseitige Veränderung einer altbestehenden Ordnung beschwert hatte: "Die ganze Pflicht und Berechtigung des Consistoriums solle hinfort nur mehr in der Beobachtung, Ermahnung, Bescheidung Aller und Jeder, besonders aber der Prediger, Kirchen= und Schulbedienten nach der Kirchenordnung in allen Doctrinalibus, Ceremonialibus, Disciplinalibus, mithin allenfalls in der gehörigen Anzeige und Denunciation der gegen die Kirchen=Ordnung im Lande zu bemerkenden Vergehungen bestehen. Wenn daraus ein Proceß oder gerichtliches Verfahren erwachse, so gehöre die weitere Verfolgung der Sache dem weltlichen Gerichte."
In diesem Sinne entschied auch später im Jahre 1773 der Herzog den Streit, ob weltliche Sachen zu den Disciplinalibus gehörten, indem er bestimmte, daß alle Vergehungen, welche in geistlichen und weltlichen Sachen die Kirchen=Ordnung verletzten, zu den Disciplinalibus gerechnet würden; so sollten auch die causae stupri, adulterii, incestus, sowie die Irrungen zwischen Verlobten und Eheleuten zu den Consistorialsachen gehören qua primam notionem und summarischen Verfahrens; wenn aber Processe daraus entständen, so sollten die Landesgerichte die Sache annehmen; nur bei den Domanial=Unterthanen hätten die Beamten die Voruntersuchung und Instruirung bis zum rechtlichen, dem Consistorium zufallenden Entscheid zu führen. Die ganze Competenz des Consistoriums wurde dann in der VO. vom 20. Juni 1776 zusammengefaßt; sie sollte sich erstrecken
1) in Ansehung der Prediger und übrigen geistlichen Personen auf die Doctrinalien, Ceremonialien und Disciplinalien;
2) in Ansehung der übrigen Unterthanen a. auf alle groben Skandale und ärgerlichen Ausbrüche des Lasters, b. auf alle Irreligion und Verachtung der Gnadenmittel, c. auf Alles, was überhaupt gegen die Kirchen=Ordnung in geistlichen und kirchlichen Dingen verstoße;


|
Seite 203 |




|
3) auf die Matrimonial= und Sponsaliensachen der Amtsunterthanen, wozu gerechnet werden alle Irrungen zwischen Verlobten und Eheleuten, alle Ehescheidungen und Lösungen des Verlöbnisses, endlich die Desertionsprocesse;
4) auf alle Dispensationen naher Anverwandten in den bekannten 13 Fällen, in der gesetzlich geschlossenen Zeit, ohne vorherige dreimalige Aufkündigung, ferner zur Veränderung des Beichtvaters, zur Privat=Communion und Confirmation, zur stillen Beerdigung.
In Bezug auf Nr. 2 wurde noch beschränkend hinzugefügt, daß dem Consistorium nur die Einsendung der Klagesache an die Herzogl. Regierung obliegen solle, damit von dort aus nach höchsteigener Herzogl. Genehmigung die Sache zur weiteren Cognoscirung an eines der Landesgerichte hingewiesen werde. "Denn in allen wichtigen Sachen, wobei Gewissensfälle und solche Fragen, deren Entscheidung nicht certi iuris et constituti ist, zu Grunde liegen, will Serenissimus selber Richter sein." Im Jahre 1782, als das Ansehen des Consistoriums wieder zu wanken anfing, sah sich der Herzog genöthigt, zu bestimmen, daß nicht nur in wichtigen und bedenklichen, sondern überhaupt in allen Fällen die Consistorial=Erkenntnisse mit den einzelnen Votis vor der Publication an die Regierung und durch diese an den Herzog persönlich ergehen sollten. -
Soviel über die Befugnisse des Consistoriums. Die Appellation gegen die Erkenntnisse desselben ging an das Hof= und Landgericht in Güstrow; eine Appellation an die Reichsgerichte in Kirchensachen fand nur statt, wenn Landstände sich in ihren Privilegien beschwert fühlten.
Mit solchen Verordnungen und Befehlen war indessen wenig gethan, wenn nicht die Männer da waren, welche denselben Achtung verschafften. Von dem Consistorium aber, welches der Herzog bei seinem Regierungsantritt vorfand, war ein schärferes Eingreifen nicht zu erwarten; dazu besaß es auch, nachdem es in seinem Processe gegen die Darguner so schmählich unterlegen war, zu wenig Ansehen im Lande, als daß viel Gutes von ihm noch zu hoffen war. Als daher der Herzog sah, daß alle seine Ermahnungen zu gewissenhafter Amtsführung nichts fruchteten, da die Räthe ihre Auctorität durch Strafbefehle und Executionen geltend zu machen Anstand nahmen, entschloß er sich eine neue Kraft zu berufen.
Es war dies der am 16. Januar 1758 ins Consistorium eingeführte Professor Dr. Döderlein. Da wir von diesem für die Geschichte unsers Landes so merkwürdigen Manne noch keine Bio=


|
Seite 204 |




|
graphie besitzen, so möge mir ein längeres Wort, übrigens unter Hinweisung auf meine Arbeit über die Friedrichs=Universität 1 ), hier gestattet sein. Es geschieht dieses in dem vollen Bewußtsein, daß damit eine alte Ehrenschuld unserer patriotischen Geschichtsschreibung getilgt wird, welcher es längst zukam, das nebelhafte Zerrbild zu zerreißen, in dem das Andenken dieses von der Bosheit seiner Feinde tief gekränkten Mannes fortlebt, eines Mannes, dessen Grundzug Treue ohne Falsch war, der in einer Zeit, wo Heuchelei und Schein den Thron des besten Fürsten umgaben, selbstlos das eine Ziel verfolgte, seiner ihm durch Gottes und des Herzogs Gnade gestellten Aufgabe gemäß unser durch viel Noth und Elend tief gesunkenes Volk an der lebendigen Kraft des göttlichen Worts wieder emporzuheben. Es ist wahr: Döderlein hatte seine Schwächen, und die größte war seine ungezügelte Leidenschaft, wodurch er sich manche Blöße gab. Aber wo er fehlte, geschah es nirgends aus Eigennutz oder Herrschsucht, sondern einzig aus Eifer für seinen Beruf, welcher ihm schließlich auch einen Kampf zur Pflicht machte, in dem er unterliegen mußte. Nicht vermögend, dem neuen Geiste einen Damm entgegenzuwerfen, wurde er zuletzt von der Fluth mit fortgerissen, und das Große, was er geleistet hatte, von dem Undank der Welt vergessen.
Christian Albrecht Döderlein wurde am 11. December 1714 zu Seegringen, einem fruchtbaren Dörfchen des Ries, wo sein Vater Prediger war, geboren. Die erste Bildung verdankte er seinem Vater, nachher besuchte er das Gymnasium zu Oettingen. In der Wahl des theologischen Studiums folgte er mehr dem Wunsche der Eltern als der eignen Neigung. Nach beendigtem Studium in Jena, wo er sich dem herrschenden freieren Geiste hingegeben und mehr an philosophischen Speculationen und allgemein wissenschaftlichen Fragen als an der eigentlichen Theologie Gefallen gefunden hatte, zwang ihn sein Vater, indem er ihm die Mittel, als Docent in Göttingen sich zu habilitiren, verweigerte, nach einer Hauslehrerstelle sich umzusehen. Die Vorsehung brachte ihn nach Teschow (im Amt Güstrow), wo er mit den Darguner Pietisten in nächste Berührung kam und, einmal in die Bewegung hineingezogen, selbst den ganzen methodischen Bußgang durchmachte. Das ihm bald hernach von Herrn v. Maltzahn in Aussicht gestellte Predigeramt zu Camin (A. Güstrow) reizte ihn nicht: er ging 1751 als Hofmeister zweier Söhne des Grafen v. Promnitz aus der Nieder=Lausitz nach Halle, wo er sich eng an den Professor Knapp und den Kreis der


|
Seite 205 |




|
Pietisten anschloß. Nach Kurzem wurde er Inspector des Waisenhauses und 1753 Prediger an der Moritz=Kirche.
Von hier begann Döderleins öffentliche Thätigkeit. Denn seine Predigt von der Erlösung der sündigen Menschheit durch Christi Opfertod, sein gewaltiger Bekehrungseifer brachte ihn bald in Streit, sowohl mit den Orthodoxen, wie mit den Neuerern, deren Haupt Semler war; jenen warf er vor, daß sie mit ihrer dürren und des lebendigen Odems entbehrenden Logik keine trostbedürftige Seele laben und erquicken könnten, diesen verwies er den Mißbrauch, welchen sie mit der Vernunft trieben. Aufs Heftigste bestritt er der Philosophie das Recht, mit blendend=bethörendem Schein Menschenweisheit über die Offenbarung zu erheben; die einzige Quelle reiner Gotteserkenntniß und seligen Gnadenlebens, das Buch aller Weisheit sei die Heilige Schrift. Diese Angriffe, mit Leidenschaft geführt und mit Leidenschaft erwidert, mußten Döderlein in den Ruf des intolerantesten Fanatikers bringen, und ohne Zweifel wäre der Streit mit der Niederlage des streitbaren, aber allzu heftigen Gottesmannes geendigt worden, wenn die Vorsehung ihn nicht als Werkzeug auserkoren hätte, im höheren Amte reichen Segen einem armen, schwer heimgesuchten Volke zu bringen.
Der Herzog Friedrich von Meklenburg=Schwerin, zweifellos genau von Allem, was in Halle vorging, unterrichtet, stellte schon im ersten Jahre seiner Regierung (1756) die Anfrage an Döderlein, ob er bereit wäre, eine Anstellung an der Rostocker Universität anzunehmen, worauf Letzterer weder zusagend noch ablehnend antwortete. Zwar entsprach die neue Stellung seinem alten Wunsche akademischer Lehrer zu werden, es war ihm aber doch selbst bedenklich, ob er auch das Rüstzeug zu einem Professor der Theologie hätte. Dazu kannte er aus eigner Erfahrung den bittern Haß der orthodoxen Rostocker Facultät gegen alles Pietistische; er wußte, daß seine Berufung den bestimmten Zweck hatte, den Dargunern die letzte Genugthuung zu verschaffen. So zog die Verhandlung sich hin; das Zureden der Freunde vermochte die gerechten Bedenken in Döderlein nicht zu überwinden. Im folgenden Jahre bot ihm der Herzog außer der Professur noch die Stelle eines Raths im Consistorium und ein Einkommen von 1000 Thlrn. an, bedang aber dabei aus, daß Döderlein bis zum Ende des Jahres sich die Doctorwürde in Halle erwerben sollte. Die Verlockung war zu groß: "im Vertrauen, daß die göttliche Vorsehung durch die überschwengliche Kraft des Heiligen Geistes ihn kräftig machen werde, als Gefäß der Barmherzigkeit zum Dienste der Kirche und des


|
Seite 206 |




|
gemeinen Wesens den christfürstlichen Endzweck Serenissimi fördern zu helfen", nahm er am 20. October 1757 den Ruf an.
Der Haß der Feinde, durch die große Ehre des Gegners noch mehr gereizt, wollte ihn nicht ungezeichnet von dannen ziehen lassen; der Professor Semler sprach es offen aus, daß er die Ehren=Promotion Döderleins dazu benutzen wolle, den Candidaten als pietistischen Fanatiker und Schwärmer vor der gelehrten Welt bloßzustellen. So fand vor einem großen Publicum die von Morgens bis Abends dauernde Disputation statt, und die Gegensätze wurden von beiden Seiten aufs Schärfste hervorgekehrt, bis zuletzt der Angegriffene die Hand zum Frieden bot: er bat Semler, die Augen vor dem der evangelischen Kirche drohenden Verderben nicht zu verschließen und die Stätte, wo einst Spener und Francke leuchtende Vorbilder christlichen Glaubens und Wandels gewesen, allen wahren Christen nicht zum Aergerniß zu machen; er bezeuge vor Gottes Angesicht, daß er in keinem wesentlichen Punkte von der reinen Lehre der evangelischen Kirche abweiche. Semler wies die Versöhnung zurück, er war mit seiner Theologie bereits zu weit in den Rationalismus verrannt; aber später sah er das Unrecht, welches er Döderlein zugefügt hatte, ein und bekannte es öffentlich.
Am 16. Januar 1758 wurde Döderlein in das Consistorium eingeführt. An ein energisches Durchgreifen war aber bei der Kriegsnoth des Landes nicht zu denken; auch lähmte der erbitterte Streit mit der theologischen Facultät in Rostock wegen der Reception Döderleins Thatkraft. Wie viel der Herzog zu strengerem Eingreifen ermahnte 1 ), das Consistorium verblieb in seiner alten Passivität. Die beiden Juristen, Kanzlei=Director Taddel und Vice=Director v. Hannecken, die mit Döderlein das Consistorium ausmachten, waren nicht zu bewegen, Doctrinalien, außer wenn sie zu grobem Aergerniß Anlaß gegeben hatten, zu verfolgen. Dazu


|
Seite 207 |




|
kam, daß Döderlein als Director der neu gegründeten Universität zu Bützow seit Michaelis 1760 vollauf beschäftigt war, so daß man nur die riesige Arbeitskraft des Mannes bewundern kann, der es trotz aller Geschäfte fertig brachte, die ihm vom Herzog aufgetragene Revision des neuen Gesangbuches 1 ) 1764 "zur A. H. Befriedigung Serenissimi" zu vollenden.
Die Allerhöchst befohlene Einführung dieses Gesangbuches in allen Gemeinen des Landes war der Anlaß zu neuen erbitterten Angriffen auf Döderlein. Der Herd der Opposition war diesmal Güstrow, wo die schon lange gährende Wuth auf die Pietisten durch die Berufung Keßlers als Superintendenten daselbst zu öffentlichem Skandale führte. Das Militär mußte den Pöbel, "der dem Pietisten zu Leib wollte", mit Gewalt auseinander treiben. Der Magister Hahn schimpfte die Pietisten auf der Kanzel Lügenprediger, Lästerer, Heuchler und Rottenmacher, deren Gedächtniß ausgetilgt werden müßte; und der Senior Jantke verstieg sich 1767 zu Aeußerungen über das neue Gesangbuch, welche eine Beleidigung des Landesherrn enthielten. Er wurde daher von Keßler wegen Aufreizung der Gemeinde gegen den Herzog beim Consistorium denuncirt: Mit Berufung auf Ephes. 5, 19 habe er gesagt, zu dem Beten und Lobsingen müsse eine Gewißheit des Herzens treten, daß das Beten und Lobsingen auch nach dem im Worte Gottes geoffenbarten Willen des Höchsten geschehe, und man wisse und verstehe, was man singe und bete. Dies könne aber nicht wohl allerwege geschehen, wenn in dem neuen Gesangbuche manche alte schriftgemäße und geistreiche Lieder weggelassen würden, die bekannt und in allen Kirchen gebräuchlich seien, an deren Statt aber neue eingeführt würden, die unbekannt, auch wohl in manchen Dingen undeutlich und unverständlich seien; wer also solches singe, und doch nicht wisse und verstehe, was er singe, zumalen nicht Jeder den geübten Sinn habe, der könne nicht wissen, daß er nach dem Willen Gottes thue und Gott gefalle."
Diese Aeußerung des im Dienste bereits ergrauten Predigers wäre wohl ohne besondere Folgen geblieben, wenn sie nicht mit einer durch das ganze Land gehenden Gährung wider das "pietistische Gesangbuch, das den Gemeinden aufgezwungen würde", in Verbindung gestanden, und daher die Verfolgung der Klage dem am meisten betheiligten Consistorialrath Döderlein das Mittel an


|
Seite 208 |




|
die Hand gegeben hätte, durch Statuirung eines Exempels an einem hochangesehenen Geistlichen die andern Widersacher abzuschrecken. Döderlein kannte gut genug die schwache Stelle des Herzogs; es hätte völlig hingereicht, daran zu erinnern, daß die eben glücklich unterdrückten pietistischen Wirren aufs Neue der Ruhe des Landes gefährlich zu werden im Begriff ständen, um Jantke zu einem verlorenen Mann zu machen, aber Döderlein ging weiter. In einer persönlichen Audienz stellte er dem Herzog vor, daß es sich um nichts Geringeres als um ein höchst sträfliches, vollbewußtes Eingreifen in das oberbischöfliche Recht des Fürsten handele, welches als Sühne die alsbaldige Entlassung Jantkes aus dem Amte verlange. In Folge dessen wurde der Angeklagte sofort, ohne gehört zu sein, suspendirt. Aber die beiden Directoren Taddel und v. Hannecken, welche in dem Streit nur eine persönliche Reibung zwischen Keßler und den Güstrower Predigern sehen wollten, bestürmten die Regierung, dem würdigen und im Amte ergrauten Angeklagten wenigstens eine schriftliche Verantwortung auszuwirken, da sie überzeugt seien, daß leicht eine gütliche Beilegung der Sache sich finden ließe. Jedoch durch diese Machinationen seiner Collegen im Consistorium noch mehr gereizt, erklärte Döderlein, sein Amt niederlegen zu wollen, wenn er in dieser Sache keine Unterstützung fände. So blieb es bei der Suspension; aber Jantke erhielt die Erlaubniß, sich schriftlich vor dem Consistorium zu rechtfertigen. Erst am 6. Juli 1770 reichte er seine Vertheidigung ein. Der alte Mann hatte nicht den Muth zum entschiedenen Auftreten und suchte sich durch die Erklärung zu retten, er habe garnicht das neue Gesangbuch gemeint, auch von einem hzgl. Befehl, das Gesangbuch in allen Gemeinden einzuführen, nichts gewußt. Im Uebrigen könne er aber das Buch nicht von allen Irrthümern freisprechen und halte dies auszusprechen für sein Recht; es sei ein zu harter Gewissenszwang, von ihm zu fordern, daß er dasselbe glauben solle wie Döderlein, vor dem er sonst persönlich alle Achtung habe.
Die Absetzung Jantkes ohne Verhör trug aber nicht dazu bei, die Aufregung im Lande zu mindern, sondern lenkte die Aufmerksamkeit Aller, auch da, wo schon die Opposition verstummt war, auf das neue Gesangbuch und seinen Verfasser. Man suchte und fand, was man suchte: den Anstoß und das Aergerniß. Die von Güstrow ausgegangene Opposition verbreitete sich über das ganze Land; Ritter= und Landschaft, Gemeinden und Prediger - Alles protestirte gegen das pietistische Gesangbuch. Unangenehmer noch als dieser unerwartete Widerstand war dem Herzog, daß der


|
Seite 209 |




|
Streit in öffentlichen Blättern, besonders in den Hamburger Nachrichten, mit scharfen Federn geführt wurde: was konnte ihm auch widerlicher sein, als in Zeitungen Dinge, welche die höchste Ehrfurcht fordern, mit Spott und Hohn behandelt zu sehen? Zwar dem Engeren Ausschuß, der am 25. April 1768 für den Angeklagten eingetreten war, mit dem Hinweis darauf, daß das neue Kirchengesangbuch so Vielen, nicht bloß den meisten Predigern, anstößig sei, und Jantke nur ausgesprochen habe, was Viele dächten, antwortete der Herzog noch sehr ungnädig; aber seiner natürlichen Gerechtigkeit war es nicht unwillkommen, als die Directoren im Consistorium Jantke für einen durch seine Vertheidigung als einfältig erwiesenen Mann in Schutz nahmen und die Sache der juristischen Facultät in Kiel zur Begutachtung zu übergeben riethen. Trotz Döderleins Widerspruch ging der Herzog darauf ein, und so wurde der Angeklagte von der Facultät zwar als schuldig der Unehrerbietigkeit gegen Serenissimum erkannt, aber als Milderung geltend gemacht, daß wirklich das neue Gesangbuch nicht ganz frei von Anstößen sei. In Folge dessen wurde Jantke am 6. Mai 1771 (kurz vor seinem Tode) wieder in sein Amt eingesetzt, aber zur Tragung aller Kosten verurtheilt.
Inzwischen war aber auf Döderleins Vorstellung eine durchgreifende Aenderung im Consistorium vorgenommen worden: im Jahre 1768 war der Superintendent Keßler, und im folgenden Jahre der Professor der Theologie zu Bützow Mauritii als ordentliche Räthe berufen worden. So brauchte Döderlein nicht mehr zu fürchten, von den beiden juristischen Collegen niedergehalten zu werden. Auf die neuen Mitglieder konnte er sich verlassen; sie waren seine Gesinnungsgenossen und darin mit ihm einig, daß im äußersten Falle die Opposition im Lande mit Gewalt unterdrückt werden müßte. Während aber Keßler ein schneidiger Mann war, der keinem Streit auswich, war Mauritii mehr für das Gehenlassen, soweit es ihm mit dem Wohl der Kirche verträglich erschien; und da er seine Ruhe und Ueberlegung auch in der größten Hitze des Streits niemals verlor, beherrschte er, ohne hervorzutreten, die beiden Parteien. sein gerechter Sinn machte ihn zum besondern Liebling seines Fürsten und zum Vertrauensmann der Regierung.
Der Streit wegen des neuen Gesangbuchs war noch nicht beendet, als eine neue und größere Sorge erwuchs: es zeigte sich, daß der Rationalismus in Meklenburg Boden zu fassen begann. Um keinen Preis wollte aber der Herzog diesen Angriff auf den Frieden der Kirche in seinem Lande dulden. Er befahl daher dem


|
Seite 210 |




|
Consistorial=Fiscal auf alle im Herzogthum erscheinenden Schriften ein wachsames Auge zu haben und jede Antastung der Fundamental=Artikel von Seiten der Landesprediger ohne Rücksicht zu verfolgen. Aber schon hatte, ohne daß der Herzog sich dessen bewußt war, die Lehre der neuen Reformatoren selbst bei Hofe sich eingebürgert, ja der Herzog hatte die Dedication einer solchen Schrift dankend angenommen. Der Präpositus zu Waren nämlich, Johann August Hermes, der Schwiegersohn des Superintendenten Zachariä zu Parchim, hatte den ersten Band seiner "Wochenschrift" am 30. September 1771 mit folgendem Schreiben dem Herzog, unterthänigst zugeeignet:
"Der Herr meiner Väter führte mich nach Meklenburg, um Ew. Herzogl. Durchlaucht Unterthan zu werden und in Dero Landen das evangelische Lehramt zu führen. Nach seinem untadelhaften Willen und auf Dero Höchstgnädigstem Rufe stehe ich nun als Lehrer bei der dritten Gemeinde. Ich verehre diese Wege der Vorsehung, obgleich sie nicht immer mit meinen natürlichen Wünschen übereinstimmen, ob ich gleich durch Ehre und Schande, durch böse und gute Gerüchte und durch manche Noth bis hieher fortgehen müssen. Nicht weniger erkenne ich die Gnade, welche Ew. Herzogl. Durchlaucht mir als einem Fremdling erwiesen haben, mit dem lebhaften Gefühle des unterthänigsten Dankes. Noch nie habe ich das Glück empfunden, Ew. Herzogl. Durchlaucht nähere Rechenschaft von den Gesinnungen bei der Führung meines Amtes geben zu dürfen. Jetzt kann es einigermaßen durch die öffentlichen Arbeiten geschehen, welche ich seit einem Jahre zur Beförderung der Gottseligkeit unternommen habe. Und dies brachte mich zu dem Entschluß, sie Höchstdenenselben in Demuth zuzueignen. Manche Mängel der Schrift sind mir selbst nicht unbekannt, ja es ist möglich, daß ich hin und wider irre. Bei einer sorgfältigen, unparteiischen Untersuchung behalten auch nicht alle sonst wohl beliebten Methoden im praktischen Christenthum ihr altehrwürdiges Ansehen und lange behaupteten Werth. Wer mit einem zärtlichen Herzen der Wahrheit nachforscht und sich nicht sklavisch nach dem oder jenem redlichen Manne bildet, der findet wirklich zuweilen in seinem Gewissen sich gedrungen von der gebahnten Heerstraße abzuweichen und manche verjährte Vorurtheile zu bestreiten. Ich gestehe es mit vieler Freimüthigkeit, daß es mir bei Ausarbeitung der Schrift manchmal so ergangen ist. Indeß bin ich mir meiner redlichen Absicht so vollkommen bewußt, daß, wenn auch Menschen nicht richten oder verurtheilen wollten, ich mit getrostem Muthe vor den Allerhöchsten hinträte und sagte: Du Allsehender weißt


|
Seite 211 |




|
es, daß ich die Weisheit lieb habe, daß ich bei dieser geringen Arbeit nur die Wahrheit, die Ausbreitung richtiger Erkenntniß und wahrer Gottseligkeit suche. Gott allein kann die Absichten segnen und fördern; voll Zuversicht erwarte ich solches von ihm, und mit entzückender Freude betrachte ich Ew. Herzogl. Durchl. als den gesegneten Regenten, unter dessen Schutze ich diese Bemühungen fortsetzen kann, ja als das erste und vornehmste Werkzeug in der Hand Gottes zur Beförderung der Wahrheit und Gottseligkeit in den meklenburgischen Landen. Glückliche Fürsten, welche der König aller Könige zur Ausführung so besonderer Absichten gebrauchen kann! Er, der Herr, den Ew. Hzgl. Durchl. so kindlich fürchten und zärtlich lieben, lenke und heilige Dero Anschläge, so oft Sie vor ihm in der Stille über das wahre Wohl Dero Unterthanen nachdenken! Er mache da Bahnen, wo bisher noch keine waren, Er schenke treue Diener und Lehrer, die mit Weisheit, Rechtschaffenheit und standhaftem Muthe begabt sind! Das wünscht und erbittet" u. s. w.
Der Herzog nahm, wie gesagt, dankend die Zueignung entgegen, und die Schriften des Präpositus wurden sogar während der Tafel vorgelesen, ohne daß Einer die gefährliche Tendenz deutlich erkannte, welche doch klar genug in dem obigen Schreiben ausgesprochen war. Hermes galt für durchaus zuverlässig; war er doch einer von den fremden, dem Kreise der Hallenser zugehörigen Prediger! 1 ) Um so mehr war man verwundert, als plötzlich jene selbige Wochenschrift von verschiedenen Seiten aufs Heftigste angegriffen wurde, und sich immer klarer in der Entwickelung des Streites ergab, daß der Präpositus, in enger Verbindung mit den Rationalisten in Berlin, mit vollem Bewußtsein die Lehren der evangelischen Kirche angriff. Das Consistorium, wohl bekannt mit der Gunst, deren sich die Schriften des Präpositus bei Hofe erfreuten, wußte Anfangs nicht, wie es sich dem dreisten Angreifer gegenüber verhalten sollte. v. Hannecken warnte dringendst vor dem Prozeß; auch Mauritii meinte, daß der an sich unbedeutenden Sache damit eine unverdiente Wichtigkeit beigelegt würde. Aber für Döderlein und Keßler bestand nur die eine Frage, ob der Herzog für das Processualverfahren zu gewinnen sei. Döderlein stellte daher in einem längeren Pro memoria dem Herzog die Verwirrung vor, in welche Hermes die Gewissen bringe, indem derselbe, auf die Gnade seines Landesherrn bauend, offen als So=


|
Seite 212 |




|
cinianer die Heilige Schrift aufs Unverantwortlichste mißhandle und mit all den verwerflichen Auslegungsregeln naturalisch Gesinnter die Grundfesten der christlichen Religion untergrabe und dadurch, daß er öffentlich von den symbolischen Büchern sich lossage, bei allen Rechtdenkenden großes Aergerniß errege; er bäte daher dringendst um Verfolgung der Sache im Consistorium. Der Herzog erwiderte kurz: die Theologen in consistorio möchten das Aergerniß beseitigen. Damit war aber die Schwierigkeit nur gewachsen; denn in wessen Namen sollten die Theologen vorgehen? Ein processualisches Verfahren im Namen des Herzogs ohne Consistorial=Beschluß war nicht herkömmlich und konnte leicht als Inquisition angesehen werden. Durfte man die Spottgeister und Lästerer reizen ?
In eben dieser Zeit trat als neues Mitglied der "Proselyt" Ferdinand Ambrosius Fidler, Professor der Theologie zu Bützow, ins Consistorium ein, ein Mann, dessen Lebensgang zu merkwürdig ist, um nicht an dieser Stelle seinen Platz zu finden. Es ist einer jener Elenden, die durch Heuchelei und Schein in das Vertrauen des Herzogs sich einzuschmeicheln verstanden und hinterher den besten Fürsten ruchlos prostituirten.
Ferdinand Ambrosius Fidler, der Sohn eines Bürgers in Wien, dem es schwer fiel, für seine zehn Kinder das redliche Brot zu verdienen, war von der Stunde seiner Geburt an dem Dienste der Kirche bestimmt. Dank seiner seltenen Geschmeidigkeit und Begabung wurde er schon im Alter von 24 Jahren als Correpetitor ins Kaiserliche Hofkloster der Augustiner zu Wien berufen und im folgenden Jahre zum Geheim=Protocollisten der ganzen Augustiner=Provinz ernannt. Eine glänzende Zukunft war ihm damit gewiß. Vier Jahre später war er auf der Flucht, der Untersuchung wegen schwerer Vergehen sich entziehend. Worin dieselben bestanden, ist mit Bestimmtheit aus der vorliegenden Correspondenz Fidlers mit seinen Brüdern Marianus und Dominicus nicht mehr zu ersehen; es scheint aber, daß er aus dem ihm zugänglichen Archiv seines Ordens Geheimnisse verrathen hat. Daß er der Schuldige war, ersieht man deutlich aus dem Verhalten der Brüder, von denen der eine ihn den Auswürfling der Familie nennt, der andere seinem Gedächtniß flucht.
Nach einjährigem Aufenthalt in Leipzig trat Fidler zur lutherischen Kirche über; aber Schulden zwangen ihn, bei einem Vetter in Hamburg, Namens Vogel, seine Zuflucht zu suchen. Hier gelang es dem "armen, gehaßten, verfolgten, in seinem Leben bedrohten Proselyten" Gönner zu finden, die sich aber bald wieder


|
Seite 213 |




|
von ihm abwandten, als sein leichtsinniger Lebenswandel bekannt wurde. Vergebens suchte er die Schuld auf den "unsauberen Vetter" zu wälzen; mit der Noth des Lebens ringend, mußte er suchen, selbst sein Brot zu verdienen. Er wurde Schriftsteller, und sein Glück war es, daß er an dem Prediger Aloysius Merz von der Societät Jesu in Augsburg (dem bekannten "leibhaftigen Pater Merz") einen ebenso leidenschaftlichen als ungeschickten Gegner fand. Denn nur diesem Federkriege verdankten die mit Schmutz und Unflath erfüllten Schandblätter Fidlers, "Der Proselyt" und "Das antipapistische Journal", ein gewisses Ansehen.
Auf dieses gestützt, näherte sich Fidler dem Thron des Herzogs Friedrich mit der Bitte, ihm in Meklenburg Schutz vor den Nachstellungen seiner Todfeinde zu gewähren. Die Audienz, in welcher er sich als eifriger Crusianer aufspielte, endete mit dem Siege der gleißnerischen Heuchelei und unverschämtesten Offenherzigkeit. Nachdem er wiederholt vor dem Herzog gepredigt hatte, erhob dieser in mitleidigem Erbarmen den "armen Verfolgten" am 17. Januar 1772 zu seinem Hofprediger, "als was er schon vordem in Wien gewesen." Der 17. Januar war der Jahrestag der Flucht Fidlers aus dem Kloster.
In dieser seiner neuen Stellung wagte der Freche unter den Augen seines Landesherrn und zum Schimpfe der Kanzel die ekelhafte Comödie zu spielen in der Rolle eines zweiten Luther; und meisterlich verstand er es, den Seelenkampf, der ihn aus dem Kloster getrieben, darzustellen und die Menschen zu täuschen. Die Hölle triumphirte auf Erden.
Das Amt eines Hofpredigers befriedigte den Ehrgeiz des Lügenapostels nicht lange. Er wußte dem Herzog als bloße Gerechtigkeit darzustellen, daß er wieder zu der Stellung eines Professors, die er vordem im Orden eingenommen hätte, emporgehoben würde. Am 13. September 1772 erhielt er die Zusage und am 12. October die Vocation als Professor der polemischen Theologie in Bützow und zugleich als Consistorialrath.
Von Fidlers Thätigkeit in Bützow habe ich in meiner Geschichte der Universität Bützow gehandelt; fassen wir hier seine Wirksamkeit im Consistorium ins Auge! Bei seinem Eintritt in dasselbe am 23. Januar 1773 harrte eben, wie wir sehen, die Sache gegen Hermes ihrer Entscheidung. Der schlaue Fidler wußte Rath: er bearbeitete den Fiscal Rath Weinland so lange, bis dieser am 28. Mai 1773 den Präpositus Hermes denuncirte, daß er "seinen Eid auf die symbolischen Bücher gebrochen" habe. Entrüstet wies zwar der Director v. Hannecken (Taddel war vor


|
Seite 214 |




|
Kurzem gestorben) einen solchen Proceß zurück, er konnte aber nicht durchdringen; allein gegen Viele stehend, mußte er in die Vorforderung des Denuncirten einwilligen. Das ausführliche Votum Döderleins, welches ich folgen lasse, hatte durchgeschlagen.
"Ich bin so weit von der Verfolgungssucht entfernt als nur irgend Einer sein kann. Aber wir müssen uns auch vor dem andern Extrem hüten, das: vielleicht diejenigen, welche die Fundamente unserer Kirche angreifen, in übertriebener Nachsicht treiben lassen, was sie wollen, und damit die Rechte unserer evangelischen Kirche preisgeben, wodurch wir Aergerniß gäben. Die Kirche hat gewisse von Christo und den Aposteln gesetzte Rechte, Vollmachten und Befugnisse, wozu vor Allem gehört, daß sie Alle, welche ihren Grundlehren zuwider handeln oder lehren, ausschließen kann. Sogar die auf den Umsturz unserer Kirche hinarbeitenden Männer bekennen, daß jede kirchliche Gesellschaft das Recht habe, den Lehrbegriff, den sie als Grund ihrer Religion, ihres Trostes und ihrer Beruhigung unter sich gemeinschaftlich gehalten haben will, festzusetzen, daß ein Jeder, der ein Glied solcher Gemeinschaft und gar ein Lehrer derselben sein will, sich darnach zu richten, oder aber dieselbe zu meiden verbunden sei; und daß selbst der bürgerliche Staat hierin eine kirchliche Gesellschaft nicht beeinträchtigen dürfe, so lange sie in ihren angenommenen Grundsätzen nichts hat, was der Wohlfahrt des Staats entgegen wäre. Es wäre gegen alle Billigkeit, die kirchliche Gesellschaft darin zu behindern."
"Daraus folgt, daß
a. die Behauptung dieser Rechte unserer evangelischen Kirche und die sorgfältige Verhütung, daß die Grundlehren nicht angetastet werden, kein Verfolgungsgeist sei. Vielmehr würde es das sein, wenn man unsere Kirche hindern wollte diese ihre Rechte auszuüben, und wenn man insbesondere ihr Lehrer aufbürden wollte, die geradezu erklären, nach den symbolischen Büchern und den gemeinschaftlichen Grundsätzen sich nicht richten zu wollen, welche sie heruntermachen und die Verehrer derselben davon abführen wollten. Unsere Kirche erfährt heutzutage wirklich hin und wieder solche Bedrückung von Leuten, welche, wenn man sie Juden und Muhamedanern zufügte, laut schreien würden."
"b. daß diejenigen, welche die Kirche zu Administratoren ihrer Rechte und Wohlfahrt gesetzt hat, wider alle Pflicht und Gewissen handeln würden, wenn sie diese Rechte widriggesinnten Leuten preisgäben. Sind dieselben von dem Grundsystem ihrer Kirche nicht überzeugt und halten das Hauptsächliche für Bagatelle, so hinter=


|
Seite 215 |




|
gehen sie die Kirche und beleidigen sie, obwohl sie doch Vorsteher bleiben; sind sie aber von der Wahrheit ihrer Kirche überzeugt, so handeln sie gewissenlos."
"c. daß es nur dann Verfolgungsgeist wäre, wenn man entweder solche, welche man nach dem Rechte der Kirche nicht für Mitglieder erkennen könnte, auch im bürgerlichen Staate nicht leiden und sie mit bürgerlichen Strafen verfolgen wollte; oder wenn man solche, welche das Grundsystem aufrichtig annehmen, um einiger Nebendinge willen, welche non fundamentalia, bedrücken und ausstoßen wollte."
"Es kommt nicht darauf an, ob der Präpositus Hermes sich gegen irgend ein menschliches Gesetz vergangen, auch nicht, ob er civiliter klug oder thöricht gehandelt habe, sondern, ob seine Lehren und Betragen nach den göttlichen Kirchengesetzen so beschaffen sind, daß sie den Grundsätzen der evangelischen Kirche entsprechen; und ob wir unserer Pflicht genügen? Da ist es aber klar, daß die Lehre des Präpositus Hermes den Grund unserer Kirche antastet, daß er die Grundsätze unserer Kirche, ohne welche kein praktisches Christenthum und kein wahrer Weg zur Seligkeit möglich ist, gering schätzt, daß er den symbolischen Büchern Hohn spricht, daß er solche Hypothesen annimmt, welche den Umsturz nicht nur unserer evangelischen Kirche, sondern der ganzen christlichen Religion nach sich ziehen und die Bibel zu einem unnützen, verächtlichen Buche machen würden. Es ist keine Entschuldigung, daß er noch Christum als den Grund der Seligkeit gelten läßt; was er von der Versöhnung u. s. w. spricht, ist ein bloßes Spielwerk um die Begriffe herumzukommen; ebenso wenig entschuldigt ihn, daß er sein System für evangelisch ausgiebt, da es sich weit von dem evangelischen Grunde entfernt. Und wenn er kein Erzheuchler ist, so ist es unmöglich, daß er nicht auch auf der Kanzel der Gemeinde anstößig wird."
"Es ist ferner zu bedenken, daß die evangelische Kirche in Waren einen evangelischen Kirchenlehrer von Serentissimo verlangt hat, der ihr das Evangelium lauter und rein nach den Grundsätzen der Kirche predige; und sie hat das Recht, solches von Serenissimo zu verlangen. Ich bin unterthänigst versichert, daß Serenissimus diese Höchstdero Verpflichtung gegen Gott und die Kirche erlauchtest erkennen und fühlen und redlichst zu erfüllen bemüht sind; was mir auch durch das jüngste Rescript bestätigt scheint, wornach uns qua consistorium aufgegeben wird, daß wir sorgfältig in ceremonialibus et disciplinalibus die Rechte der mekl. Landeskirche wahren sollen. Ich bin überzeugt, daß, wenn wir nicht mit allen


|
Seite 216 |




|
Kräften den Irrlehren des Präpositus Hermes vorbeugen, wir uns nicht verantworten können, nicht vor Gott und unserm Gewissen, nicht vor dem ganzen meklenburgischen Lande, nicht vor der evangelischen Kirche überhaupt."
"Der Fiscal hat demnach nur gehandelt, wie er es schuldig war, und wir dürfen nicht eher an Serenissimum berichten, bis wir gethan haben, was uns zukommt vermöge unserer Instruction, und Alles von uns zur Definitiv=Erkenntniß reif gemacht ist. Was würde Serenissimus denken, wenn wir zuvor fragten, ob wir auch thun sollten, was zu thun wir schuldig sind? Meiner Meinung nach müssen wir dahin sehen, ob wir nicht unter göttlichem Segen diesen irrenden Mann zurechtweisen können; dazu scheint aber eine schriftliche Vertheidigung gar nicht zweckdienlich. Wir würden uns in einen weitläufigen Schriftwechsel einlassen müssen. Ist die mündliche Zurechtweisung vergeblich, so haben wir alsdann darauf anzutragen, daß mit reo nach dem evangelischen Kirchenrecht verfahren werde; man communicire also dem Präpositus die Fiscal=Eingabe und citire ihn, mündlich sich vor dem Consistorium zu erklären; in consistorio versuche man den Mann mit aller Sanftmuth von seinem Irrthum abzubringen; gelingt dies, so ist es erfreulich, wo nicht, so sende man das ganze Examen, welches sorgfältigst von Wort zu Wort protocollirt werden muß, unterthänigst an Serenissimum mit Beifügen unsers Erachtens und trage an, daß dem Consistorio erlaubt sein möge, das Definitiv=Urtheil von einigen unverdächtigen theologischen und juristischen Facultäten einzuholen.
C. A. Döderlein.
Sic voto, sic sentio!
Rostock, den 3. Juni 1773."
Diesem "gründlichen und gewissenhaften" Votum Döderleins trat Keßler "in allen Stücken und Worten" aus völliger Ueberzeugung bei. Fidler votirte: "Entweder er widerruft - oder er suche sich eine Gemeinde von Socinianern." Mauritii, "der valetudinarius", meinte auch, "das Consistorium dürfe diese Verbreitung der gröbsten Irrlehren zum Anstoß und Aerger aller Christen im Lande nicht leiden", wenngleich er zur Milde rieth; er kenne den Präpositus und wisse, daß er den Frieden wünsche. v. Hannecken erklärte, mit der Sache sich nicht weiter befassen zu wollen, der Herzog habe den Theologen die Erledigung aufgetragen, so möchten sie sehen, wie sie fertig würden.
Am 29. Juni erfolgte die Ladung, welche Hermes vorbereitet fand; er bat den Herzog, in Anbetracht, daß er einen ehrenvollen und


|
Seite 217 |




|
verlockenden Ruf in seine Heimath, als Prediger und Inspector nach Jerichau, bekommen habe, ihm bis zur Erledigung dieser Sache Aufschub zu gewähren. Als aber die Frist nur auf 3 Wochen bemessen wurde, bat er aufs Neue um gnädigen völligen Dispens, da er sich entschlossen habe, dem Rufe zu folgen. Unter solchen Verhältnissen erschien dem Herzog eine möglichst friedliche Endigung des Processes wünschenswerth, um so mehr, als Hermes nicht aus böser Lust oder Eitelkeit, sondern von seinem Gewissen in die Opposition gedrängt war. Er gab daher dem Rath Fidler den Auftrag, mit Hermes vertraulich zu reden, damit sich zeige, ob die Sistirung vor das Consistorium nothwendig bleibe. Aber Fidlers Ungeschick verdarb Alles; er scheute sich, mit Hermes in eine Disputation einzutreten, bei der er in seiner Unwissenheit der Unterliegende sein mußte. Er bat daher, "wegen der großen Verantwortung" ihm Döderlein zuzugesellen, obwohl dieser dringendst vorstellte, daß es ihm unmöglich sei, anders als nach seiner Instruction als Consistorialrath zu handeln. Aber Fidlers Bitte fand Gehör. Döderlein, an ein Nachgeben nicht gewöhnt, griff die Sache mit Eifer an und trieb bei dem Colloquium in Waren den Gegner so in die Enge, daß dieser bereits am zweiten Tage sich krank meldete und den Herzog um seine Entlassung bat.
Begreiflicher Weise war der Herzog über diesen Ausgang der Commission sehr unwillig und forderte Rechenschaft. Döderlein antwortete: "Wir haben einen Mann gefunden, der alles dasjenige, was ein Verbesserer der Religion haben sollte, gerade nicht hatte. Die Grundsätze einer gesunden Philosophie sind ihm unbekannt. Die Theologie besitzt er, ohne ein gewisses System zu haben, oder nur zu wissen, was ein eigentliches System ist. In der Hermeneutik und Exgese folgt er den Regeln, welche seinen Grundsätzen schmeicheln; er ist Polemiker, aber nur dann, wenn die Frage entsteht, ob ein Jeder im Lande von der Religion denken, reden und schreiben könne, was und wie er wolle. Die Kirchengeschichte hat er nie gelesen, sondern nur einige Auszüge aus Semlers Werken durchgeblättert. Wie viel wir in Liebe und Bescheidenheit mit ihm geredet, so haben wir doch keine einzige kategorische Antwort bekommen, sondern immer nur das alte Lied gehört: er könne sich nicht sogleich besinnen, aus dem Stegreif könne er das nicht beantworten. Da er also sah, daß er nicht einmal die ersten Seiten seiner Pièce vertheidigen konnte, ergriff er das Mittel, sich krank zu melden. Wir sahen also, daß keine Besserung von ihm zu erreichen war, und mußten gar auf den Gedanken kommen, daß nicht er selbst, sondern Andere die Ver=


|
Seite 218 |




|
fasser der von ihm herausgegebenen Schriften seien." Der Herzog mit dieser Rechtfertigung nicht zufrieden, forderte zugleich mit der Einsendung des Protocolls ein Erachten Fidlers über das Benehmen Döderleins: "ob es wahr sei, daß dieser, wie Hermes klage, aus jeder Periode der Streitschrift Gift gesaugt habe?" Der schlaue Fuchs, welcher sich gehütet hatte in das Colloquium einzugreifen, und daher auch wegen seiner "Mäßigung" das äußerste Lob von Hermes bekommen hatte, bezeugte bei seinem guten Gewissen, daß sein College dem Präpositus "keine einzige verfängliche Frage" vorgelegt, auch aller harten Anstichelungen und bittern Vorwürfe sich enthalten habe; im Uebrigen aber könne er nur unterschreiben, was Döderlein von dem theologischen Wissen des Angeklagten berichtet habe.
Bei solcher Lage der Dinge suchte der Herzog dem bösen Streite ein möglichst gutes Ende zu geben. Am Weihnachtstage 1773 gab er Hermes in folgendem Schreiben seine Entlassung:
. . . . . . "daß Wir Unser äußerstes Mißfallen über euer doppelt anstößiges Benehmen sowohl in Ansehung eurer durch den öffentlichen Druck eigenmächtig geäußerten, von dem Lehrbegriff unserer Kirche abweichenden Meinungen, als auch in Ansehung eurer Widersetzlichkeit gegen Verfügungen Unsers Consistoriums nicht unbezeugt lassen können noch wollen. Nur in Hinsicht eurer erhaltenen und angenommenen auswärtigen Vocation wollen Wir euch hiemit der sonst unausbleiblich erfolgten verdienten Beahndung bei weiterem rechtlichen Verfahren übersehen, und sollet auf euer unterthänigstes Ansuchen des bisher in Unserer Stadt Waren geführten Predigtamts hierdurch entlassen sein. Aus vordringender Gnade und bei dem von euch unterthänigst vorgestellten Umstande, daß die euch angetragene Pfarrstelle erst zu Ostern k. J. von euch angetreten werden kann, lassen wir es auch geschehen, daß ihr bei eurem bisherigen Amte und Genuß eurer Einkünfte in Waren verbleiben möget. Doch habet ihr die Kosten der verursachten Commission zu berichtigen."
Dies ist die actenmäßige Darstellung des Processes gegen Hermes, aus welcher jeder Unparteiische erkennen muß, daß in erster Reihe die Schuld des bösen Ausgangs an Fidler lag, dem eine Ausgleichung im Sinne des Herzogs leicht geworden wäre, wenn er gewollt hätte. Die Furcht vor Hermes ließ ihn aber das Zusammengehen mit Döderlein wünschen, welcher zu einer Versöhnung gewiß die ungeeignetste Mittelsperson war, besonders wo ein solcher Trotzkopf wie Hermes gegenüberstand. Konnte Döderlein


|
Seite 219 |




|
anders handeln? Das ist eine andere Frage, die Jeder beantworten mag, wie er will. Ich sage: nein!
Es ist bekannt, daß dieser Streit mit großer Erbitterung diesseits und jenseits, besonders von Berlin aus, weitergeführt wurde und am meisten das Geschrei der Freigeister über das dunkle Meklenburg wachrief; man wagte sogar, die Person des Herzogs in den Kampf hineinzuziehen. Als das Spotten und Zetern zu arg wurde, beauftragte der Herzog das Consistorium eine Gegenschrift auszuarbeiten, "bei der Darlegung und Widerlegung der Irrthümer in den Schriften des fr. Präpositus Hermes aber aller einem rechtschaffenen Geistlichen so anständigen als natürlichen Sanftmuth sich zu befleißigen und insbesondere aller Beleidigungen der Gegner und aller sectirerischen Schimpfnamen sich zu enthalten." Der ihm vom Consistorium gestellten Aufgabe unterzog sich Döderlein mit solchem Geschick, daß selbst die "Nicolaiten" ihr Anerkennen nicht versagten.
Ein weiteres Eingehen auf diesen Proceß lehne ich ab, die Druckschriften geben alle gewünschte Auskunft.
Für das Consistorium hatte aber diese Sache bedeutsame Folgen. Der Director v. Hannecken nämlich nahm seinen Abschied, und an seine Stelle trat der Professor jur. prim. Adolf Friedrich Reinhard von Bützow 1 ), ein Mann, welcher Döderlein nicht allein an Schärfe des Verstandes und Vielseitigkeit des Geistes überlegen war, sondern auch in der Gunst des Herzogs so fest stand, daß er Alles, was er wollte, durchsetzte. Seine entschiedene Hervorkehrung des Crusianischen Standpunktes gegenüber dem Hallischen Pietismus, welcher damals bereits kraftlos zu werden begann, war noch nicht Döderleins größter Aerger, sondern Reinhards gewaltsames, keine Opposition duldendes Wesen verhinderte geradezu jedes fruchtbare Zusammenwirken. Döderlein sah sich daher veranlaßt, als der Herzog im Jahre 1777 seinem Gegner Reinhard den Charakter eines beständigen Consistorialdirectors beilegte und dadurch vor dem ganzen Lande zu erkennen gab, daß er in der Wahl zwischen beiden jenem den Vorzug gäbe, sein Amt niederzulegen. Bis zum Jahre 1780 blieb Reinhard in seiner Stellung.
War schon Döderlein von den Geistlichen im Lande gefürchtet gewesen, so wurde Reinhard geradezu der Schrecken derselben; denn von ihm hatte Keiner, der mit dem Consistorium in Streit gerieth,


|
Seite 220 |




|
irgend welche Nachsicht zu erwarten. Daher war denn auch die Zeit, in welcher Reinhard das Consistorium nach seinem Willen lenkte, an hervorragenden Processen sehr arm; aber allein der kurzsichtige könnte daraus schließen, daß Alles in der Kirche so stand, wie es sollte. Mochte der Herzog auch die Zeit für gekommen halten, wo er mit den durchgreifendsten Reformen hervortreten dürfte, mochte er auch das harte Verfahren Reinhards billigen und jede Abweichung von der reinen Lehre auf das Härteste ahnden 1 ): dem scharfen Beobachter entging doch nicht die wachsende Gährung unter den Predigern und der zunehmende Unwille gegen ein Regiment, das jede freie Bewegung unterdrückte. Ja, wenn die Räthe im Consistorium selbst in Wandel und Lehre noch unsträflich gewesen wären! Aber daran fehlte viel. Die bittere Feindschaft der "Hallenser" und "Crusianer" war noch das Wenigste: was sollte das Land dazu sagen, daß von einem Mitglied des Consistoriums die gesammte Geistlichkeit öffentlich an den Pranger gestellt wurde? Mit unglaublicher Dreistigkeit hatte nämlich der hochmüthige Fidler in seinem antipapistischen Journal zur folgenden Charakteristik der meklenburgischen Geistlichkeit ohne allen Anlaß sich hinreißen lassen:
"Man kann Meklenburg in Ansehung der Gelehrten füglich in drei Classen eintheilen. Es giebt einige, die ihre ganze Gelehrsamkeit in eine gewisse altväterliche Methode setzen und steif und fest glauben, daß keine Predigt tauge, in der nicht die ganze Heilsordnung eben nach ihrer Methode enthalten ist. Solche Männer sind wohl gar so kühn und dreist, man möchte bald sagen: so dumm und einfältig, daß sie Alles für ketzerisch und teuflisch erklären, was auf eine gesunde, natürliche Philosophie gegründet und mit dem Worte Gottes befestigt und ergänzt wird. Erst ein Christ, dann ein Mensch (nein, nie ein Mensch, wollen sie sagen) - dies ist ihr Wahlspruch. Andere giebt es, die garnichts gelernt


|
Seite 221 |




|
haben und sich befriedigen, wenn sie ein Bischen ohne Empfindung aus dem Herzen beten können; solche Extemporanei treten auf die Kanzel, winseln und seufzen, ohne dabei gerührt zu sein oder Etwas zu denken, verdrehen die Augen, wiegen mit dem Körper und stellen sich an, daß einem angst und bange wird; und wenn Einer sich mit ihnen in die geringste Unterhaltung einläßt, um zu erfahren, was sie denn eigentlich gelernt haben, so nicken sie mit dem Kopfe und wissen weiter nichts zu sagen als: Ach Gott, Herr Amtsbruder! Der natürliche Mensch begreift nichts von dem, was vom Geiste Gottes ist; ich habe das, ach Gott! sehr oft in meiner Gemeinde erfahren! Und unter dieser Classe giebt es noch andere, die wirklich redlich denken und in Ansehung ihres praktischen Christenthums hoch zu schätzen sind, die aber lieber ein Handwerk als die Theologie hätten lernen sollen; denn sie sind gute Schafe, aber schlechte Hirten. Andere endlich giebt es, die wirklich etwas Gründliches gelernt haben, die nicht allein das praktische Christenthum predigen, sondern es auch schön predigen, die die rechte Sache der Bekehrung mit den Worten und die Worte mit den Sachen zu verbinden wissen, kurz, die sich in unsere böse Zeiten zu schicken wissen und das freigeistische Gift mit eben der Beredsamkeit aus dem Kopf zu bringen wissen, mit der es hineingekommen ist. Solche Männer machen unserm Meklenburg Ehre; aber es giebt nur wenige von dieser Classe, weil sie von dem großen Schwarm der Methodisten und Ungelehrten verachtet und für Teufelskinder ausgescholten werden."
Eine Erregung ohnegleichen entstand unter der geschmähten Geistlichkeit, um so mehr, als diese vom Consistorium, wie man meinte, ausgehende Charakterisirung den durch den Proceß gegen Hermes bereits geöffneten Spottmäulern ein neuer Beweis für die traurige Lage der pietistischen Kirche Meklenburgs war. Von allen Seiten wurde Fidler aufgefordert, seine Behauptungen zu beweisen oder zu widerrufen; er that aber keines von beiden, sondern rechtfertigte sich nur vor dem Herzog: "daß es nicht ohne Gottes Willen und Eingebung geschehen sei" (sic!). Um das Consistorium von dem Verdacht zu befreien, daß es mit Fidler einer Meinung sei, auch zugleich als Rächer der beleidigten Ehre der meklenburgischen Geistlichkeit, erhob sich Keßler und erklärte rundweg, Fidler sei außer Stande, auch nur einen einzigen von allen Vorwürfen zu beweisen; vielmehr müsse er (Keßler), genau bekannt mit dem Leben der Kirche, öffentlich bezeugen, daß das Land auf die Bildung und den Eifer seiner Geistlichkeit stolz sein dürfe.


|
Seite 222 |




|
Diese öffentliche Zurechtweisung nahm der Verläumder selbst zwar stillschweigend hin; aber er reizte einen Bekannten, den Pastor Wichmann zu Zwäzen und Löbstedt in Obersachsen, auf, in einem anonymen Sendschreiben Keßler zu verdächtigen, daß er nur deswegen gegen Fidler aufgetreten sei, weil er sich getroffen gefühlt habe; "denn wer Meklenburg kennte, wüßte, daß dieser der Führer der von Fidler so treffend als "Methodisten" bezeichneten Secte sei, die das reine Evangelium von den Kanzeln verdränge und dafür ein herz=, geist= und trostloses Gewäsch von Buße, Durchbruch und Bekehrung, von Teufeln und Teufelswerken einführe."
Der Streit, Anfangs mit großer Hitze von beiden Seiten geführt, verstummte sofort, als ein Landsmann dem verkappten Ritter die Lanze zerbrach, indem er zeigte, daß der Verfasser des Sendschreibens an Keßler kein Anderer als der berüchtigte Wichmann, der Urheber der "Bibliothek der elenden Scribenten", sei. Der Freund war Fidlers würdig.
Man ist indessen versucht, in dem Angriffe mehr zu sehen als eine bloße Unverschämtheit des verruchten Proselyten: er muß, meine ich, gewußt haben, daß der Anlauf gegen den herrschenden Pietismus, der sich als unfähig das innere Leben der Gemeinden zu erneuern erwiesen hatte, ihm nicht zu großem Schaden gereichen werde; es ist das erste Zeichen der hereinbrechenden neuen Aera, wo der Pietismus, soweit er nicht in seiner breiten Masse zum Rationalismus sich bekannte, überschwenkend in Crusius' Lehre, einen neuen Halt sucht und findet. Die Todten begräbt man aber schnell. Reinhards Sieg über Döderlein (1777) bezeichnete den Sieg Leipzigs über Halle.
Der Stern Fidlers neigte sich zum Untergange. Im Jahre 1774 hatte er das letzte Ziel seiner Wünsche erreicht, er war Superintendent mit dem Wohnsitz in Doberan geworden. Das lasterhafte Leben, welches er hier führte, schrie zum Himmel. Dazu zeigten verschiedene Untersuchungen, welche er im Auftrage des Consistoriums gegen Prediger führte, seine gänzliche Unfähigleit. So behandelte ihn der Pastor Hacker in Westenbrügge wie einen Schulbuben, so daß Reinhard nach Durchlesung der Acten urtheilte: "Der Herr Rath solle doch bei dem Pastor in die Lehre gehen." - Ein ander Mal ließ er einen "Catechismus" die Censur passiren, der förmlich von Irrlehren strotzte. Mehr Noth aber verursachte Fidler die Aufbringung der Gelder zur Bestreitung seiner "lustigen Wirthschaft". Die Schulden wuchsen trotz der unterschlagenen Collectengelder und des angetasteten Vermögens vieler Kirchen ins Ungeheure. Der Versuch, seinen Ruf durch ein


|
Seite 223 |




|
neues Werk: "Die Geschichte der Ceremonien in der römischen Kirche", 1777 wieder herzustellen, schlug gänzlich fehl; die Kritik nannte es einen wahren Skandal für die meklenburgische Gelehrtenwelt, und der Witz der Rostocker: "dat Book van dei Kattenjagd".
Am 22. Januar 1778 floh Fidler, wegen betrügerischen Bankerotts, wegen Unterschlagung von Kirchengeldern, wegen Ausstellung eines falschen Todtenscheins angeklagt, aus Meklenburg; er konnte sich, wie er selbst schrieb, "weder vor Gott, noch Hzgl. Durchlaucht, noch vor der Welt rechtfertigen." 1 )
Die von der Justiz=Kanzlei eingeleitete Untersuchung gegen den Bösewicht wurde zwar auf landesherrlichen Befehl sistirt; aber die Menge dessen, was landeskundig, war groß genug, um die Erbitterung gegen das herrschende Kirchensystem so zu steigern, daß der Herzog, um dem lauten Geschrei ein Ende zu machen, sich zuletzt entschloß, Reinhard zu opfern. Denn es half diesem Manne nichts, daß er alle Schuld daran von sich abwies, daß er öffentlich erklärte, den bösen Ausgang vorhergesehen und deshalb bereits in den letzten Jahren Fidler möglichst von allen wichtigeren Verchandlungen ausgeschlossen zu haben: die Pietisten sagten, so etwas sei unter Döderleins Leitung ganz unmöglich gewesen, und nur die Secte der Crusianer könne solche Ausgeburten der Hölle erzeugen. Die Katholiken triumphirten laut, daß ihr Todfeind seinen gerechten Richter gefunden hatte; das lauteste Geschrei aber erhoben Hemes' Freunde, welche das Gedächtniß an den "famosen" Proceß erneuerten und darauf hinwiesen, daß dieser jetzt zum Schelm gewordene Erzheuchler als Richter das Condemno über einen so hochachtbaren, in der ganzen protestantischen Kirche angesehenen Mann wie Hermes ausgesprochen habe. Es konnte nicht anders sein: im Publicum mußten diese Stimmen Recht behalten. Bei solcher Lage der Dinge wäre es vielleicht besser gewesen, wenn der Herzog dem Proceß gegen Fidler seinen Gang gelassen hätte; denn dabei würde klar geworden sein, wie viel oder wie wenig Schuld auf Reinhard und die andern Mitglieder des Consistoriums mit


|
Seite 224 |




|
Recht geworfen werden konnte; indem aber, in der lautern Absicht, den Skandal der Kirche möglichst zu unterdrücken, das Verfahren eingestellt und alle Acten und Privatpapiere Fidlers confiscirt wurden, erwachte nothwendig der Verdacht, daß die Enthüllungen auch Andere, besonders aber Reinhard, compromittirt hätten. Da das Geschrei nicht verstummte, und man immer offener den verhaßten Reinhard als Einen, der auch zu der infalliblen und incorrigiblen Rotte der Crusianer gehörte, für allen Skandal verantwortlich zu machen anfing, bat dieser um des Heiles der Kirche willen um seinen Abschied. Der Herzog aber, der den gewandten und verdienstvollen Mann nicht fallen lassen wollte, gab ihm den ehrenvollen Auftrag, auf ein Jahr in Wetzlar als Assessor beim Reichskammergericht zu fungiren, in der Hoffnung, daß inzwischen sich der Sturm legen würde. Als jedoch nach Reinhards Rückkehr klar wurde, daß dies nicht der Fall war, enthob er unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken denselben seines Amtes und ernannte ihn zu seinem beständigen Assessor in Wetzlar (1780). Mit Reinhard fiel die letzte Stütze der Orthodoxie im Consistorium. Denn von denen, welche darin verblieben, war kein Einziger fähig, seine Stelle zu vertreten: der Jurist Dr. Friedlieb (1773 berufen) besaß weder die erforderliche Schneide, noch auch als Döderleins Schwiegersohn das erforderliche Vertrauen; der Superintendent Keßler hatte sich mit seinem Pietismus überlebt, der Professor Mauritii war ein kranker Mann, und endlich der auf Reinhards Vorschlag mit der Leitung der Sachen betraute bisherige Fiscal Weinland war in mehr als einer Hinsicht ein verdächtiger Charakter. Der neuernannte Fiscal Dr. jur. Sprewitz ließ daher Alles gehen, wie es wollte. Um diesem Unwesen zu steuern, wurde 1782 Döderlein aufs Neue mit der Leitung des Consistoriums betraut. Aber zugleich mit ihm trat an Stelle des aus Meklenburg fortziehenden Raths Weinland der Professor jur. Prehn aus Bützow ein, der sich darin gefiel, die Rolle seines Freundes Reinhard zu spielen und alle wohlgemeinten Vorschläge Döderleins zu vereiteln. In diesem Unfrieden ging dem Consistorium die letzte Kraft energischen Handelns verloren. Der Herzog ließ es an Vorstellungen, daß nur ein einmüthiges Zusammenwirken das bedrohte Ansehen des Consistoriums wieder zu Ehren bringen könnte, nicht fehlen, griff auch selbst wohl, wenn aus dem schleppenden Verfahren Gefahren erwuchsen, energisch ein, aber auch sein Vertrauen war so sehr erschüttert, daß er sein Erkenntniß dieser Behörde mehr rechtskräftig werden ließ, bevor nicht die Acten zu seiner persönlichen Einsicht vorgelegen hatten. Es kam in diesen letzten


|
Seite 225 |




|
Jahren sogar wiederholt vor, daß der Herzog, da die Processe "in consistorio doch nur unnütz verschleppt würden und nur als Mittel zu höchst verwerflichen unchristlichen Reibereien unter den Räthen dienten", mit Uebergehung des Consistoriums über die Prediger, die sich in Wandel oder Lehre Etwas zu Schulden kommen ließen, sofort Suspension vom Amte verfügte; denn er wollte zeigen, daß er noch das Regiment habe und nicht gewillt sei, Ausschweifungen seiner Prediger zu dulden.
Im Jahre 1785, kurz vor dem Tode des Herzogs, nahm Döderlein abermals seinen Abschied; denn der an die Stelle von Dr. Sprewitz berufene Fiscal Dr. Ditmar hatte ihm zu laxe Principien. "Wenn man in der Kirche Alles vertusche, anstatt dem Hzgl. Befehl zufolge ohne Ansehen der Person Alles, was nicht recht sei, zu rügen, so sei das unchristlich; und er könne und wolle in einem Consistorium nicht mehr Sitz und Stimme haben, welches bei den Predigern in so geringem Ansehen stehe, daß sie sich schon als über ein Unrecht beschwerten, wenn sie citirt würden, um sich von einem Verdachte zu reinigen."
Die Saat war reif. Der neue Geist des Rationalismus brach durch. Lange gewaltsam unterdrückt, konnte die Umwälzung auch keine andere als eine gewaltsame sein.
Der Rationalismus hat Recht, wenn er von seinem Standpunkte aus den Herzog Friedrich der Intoleranz beschuldigt; indessen auch nur von diesem Standpunkte aus hat diese Anklage ihre Berechtigung. Im Allgemeinen war der fromme Fürst, wie wir das nachher beweisen werden, im besten Sinne des Wortes duldsam im höchsten Maße, indem er jeden Glauben, bei dem die wahre Gottesfurcht bestehen konnte, ehrte und schützte; verhaßt war ihm allein jenes "wüste" Verneinen der letzten Grundwahrheiten, womit sich damals die Gottesgelehrten und Unbekehrten breit machten. Und darin hatte er Recht; denn die Gottesfurcht ist die Stütze des Staates; wo sie schwindet, wanken die Throne und herrschen die Leidenschaften. Und um so größeren Lobes werth erscheint diese Energie des frommen Fürsten, als, wie gesagt, ringsum höchst gefährliche Grundsätze das politische Leben des deutschen Volkes zu leiten begannen. Inmitten der großen Bewegung, welche, Fürsten und Völker ergreifend, eine Umwälzung aller Verhältnisse hervorrief, stand der Herzog Friedrich fest in dem Entschluß, sein Land und Volk vor der Revolution zu bewahren und in dem Worte Gottes gegen alle Verführungen stark zu machen. Daß es ihm nicht gelang, war nicht seine Schuld: der


|
Seite 226 |




|
Geist der Zeit ist mächtiger als Fürstenwille; aber so Großes gewollt zu haben, bleibt des Herzogs ewiger Ruhm.
Und wenn man den Namen des edlen Herzogs nennt, darf man den Namen Döderleins, des treuesten Dieners seines Herrn, nicht vergessen. Wir müssen noch einen Augenblick bei ihm verweilen; denn wir würden ihm Unrecht thun, wenn wir seine übrigen Consistorialarbeiten, die uns seine Pläne und Gedanken zeigen, unerwähnt ließen. In den Archivacten findet sich nämlich noch eine Reihe von merkwürdigen Entwürfen. Da ist zunächst vom Jahre 1774 ein im allerh. Auftrage ausgearbeiteter Entwurf zu einer neuen Kirchen=Ordnung, der wegen der Schwierigkeiten, die sich entgegenstellten, unbeachtet gelassen wurde. Wenn es nach Döderleins Sinne gegangen wäre, so würde eine, wenn auch unter möglichster Schonung der bestehenden Verhältnisse, doch radicale Aufräumung mit den vielen Uebelständen vorgenommen worden sein; aber sein heftiger und wenig praktischer Geist, dessen Ideal es war, alle Gewalt über die Kirche dem Fürsten anzuvertrauen, verkannte die damit verbundenen Gefahren für die Kirche und die Unmöglichkeit, ohne grobe Verletzung des Rechts die einmal vorhandenen politischen Verhältnisse in Meklenburg, von denen doch die kirchlichen abhingen, zu Gunsten eines fürstlichen Absolutismus zu ändern. Darum ging der Herzog, dem ein solcher Rechtsbruch wider das Gewissen war, auf die Vorschläge Döderleins nicht weiter ein: er wollte lieber auf dem hergebrachten Wege der Verhandlungen mit den Ständen nach und nach zu bessern suchen, was nöthig war, und erlangte dadurch auch mehr, als einem seiner Vorgänger eingeräumt war. - Eine zweite Arbeit ist überschrieben: "Von der Nothwendigkeit eines Examens der Candidaten vor dem Consistorium." Nach der alten Ordnung fand nämlich das Tentamen der Candidaten vor einem Superintendenten statt, welcher auch die licentia conciodandi ertheilte. Dieses Zeugniß konnte jeder Superintendent ausstellen. Das zweite dagegen, das examen rigorosum, lag bei dem Superintendenten (nebst Zuziehung einiger clerici) desjenigen Kreises, in welchem der Candidat präsentirt worden war. Ohne ein solches Zeugniß sollte Keiner, auch wenn er auswärts schon Prediger gewesen war, angestellt werden. Diese Ordnung war im Allgemeinen in Geltung geblieben. Döderlein wünschte eine Aenderung dahin, daß das erste Examen vor dem Superintendenten bestehen bliebe, das zweite aber dem Consistorium übertragen würde, "damit der Unwissenheit der meisten zum Predigeramte tretenden Candidaten ein gründliches Ende bereitet werde." Er wollte, daß die Candidaten einer scharfen Prüfung a. in der


|
Seite 227 |




|
Kenntniß der biblischen Grundsprachen, b. in der Exegese, c. in der Kirchengeschichte, d. in der Dogmatik und Moral unterworfen würden; denn auch in anderen evangelischen Ländern hätten sich die guten Früchte eines solchen Examens, namentlich hinsichtlich des anständigen Lebenswandels der Theologen auf der Universität und in ihrem Candidaten =Amte, gezeigt. Das Schicksal dieses Vorschlages ist mir unbekannt. In Zusammenhang damit mag die VO. vom 27. Sept. 1776 stehen, wornach "kein Prediger im Lande angestellt werden solle, der nicht gehörig tentirt worden sei."
Ueber eine dritte Arbeit, betreffend die Einsetzung von Special=Superintendenten, werden wir bald Weiteres hören. Ueberhaupt aber müssen wir bei unserer ganzen Betrachtung immer lebendig im Bewußtsein behalten, daß der Herzog bei Allem, was er zur Verbesserung des Kirchenwesens unternahm, nie des Rathes und der Unterstützung Döderleins entbehren mochte. Auch in den Jahren von 1777 - 1782, wo Döderlein nicht im Consistorium war, fand ein unausgesetzter Verkehr zwischen dem Fürsten und seinem Rathe statt; und wenn nach dem Tode des Herzogs die Reaction den überlebenden Döderlein für Alles verantwortlich machte und ihn ihren ganzen Haß fühlen ließ, so hatte sie ein volles Recht dazu: nicht moralisch, denn Döderlein stand in der Reinheit seines Gewissens und in dem Bewußtsein, nur das Beste gewollt zu haben, hoch über seinen Gegnern erhaben, sondern factisch. Sollte Einer das Regiment des Pietismus entgelten, so war in ihm der Rechte getroffen.
III. Die Superintendenten.
Der Superintendentur=Ordnung gemäß umfaßte das Herzogthum Meklenburg die sechs Kreise: 1) Superintendentur Meklenburg (Wismar), 2) Sup. Wenden, östlicher Kreis (Güstrow), 3) Sup. Wenden, westlicher Kreis (Parchim), 4) Sup. Schwerin (Schwerin), 5) Sup. Rostock (Rostock), 6) Sup. Stargard (Neubrandenburg). Der letzte strelitzsche District geht uns hier nicht weiter an.
Diese ursprünglich politische Eintheilung war im Großen und Ganzen von Bestand geblieben, wenn auch innerhalb der einzelnen Districte die mannigfachsten Verschiebungen hinsichtlich der Parochien stattgefunden hatten, und besonders auch die unpraktische Eintheilung derselben nach Aemtern und Städten fallen gelassen war. Der größte Uebelstand war die Ungleichheit der einzelnen Districte. Als


|
Seite 228 |




|
der Herzog Friedrich 1756 die Herrschaft antrat, umfaßte die Rostocker Superintendentur 50 Kirchen und 27 Filialen,
die Schweriner 16 Kirchen und 11 Filialen,
die Güstrower 86 Kirchen und 80 Filialen,
die Parchimer 82 Kirchen und 70 Filiaen,
die Meklenburgische 65 Kirchen und 17 Filialen.
Ebenso ungleich war das mit den Stellen verbundene baare Einkommen: bei der Rostocker trug es etwa 200 Thlr., bei der Schweriner 400 Thlr., der Güstrower 650 Thlr., der Parchimer 400 Thlr. der Meklenburger 550 Thlr.
Diese Ungerechtigkeit wollte der Herzog zunächst beseitigen, indem ohne jede Rücksicht auf die doch ganz veraltete und bedeutungslose historische Eintheilung des Landes nur 3 Superintendenturen, jede mit etwa 100 Kirchen nnd mit gleichem baarem Einkommen, von Bestand bleiben sollten: 1) die Güstrower, 2) die Schweriner, 3) die Parchimer.
Aber in den ersten zehn Jahren blieb dieser, wenngleich viel bearbeitete Plan in Folge der Kriegswirren unausgeführt; erst 1767 wurde mit der Sache Ernst gemacht, indem die Rostocker Superintendentur mit der Güstrower, die Meklenburgische 1768 mit der Schweriner vereinigt wurde. Es zeigte sich aber bald, daß, abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich der neuen Vertheilung der Sprengel entgegenstellten, die Arbeitslast für nur drei Superintendenten zu groß war. 1774 wurde die Superintendentur Doberan von Güstrow abgetrennt und 1775 in Sternberg eine neue Superintendentur für Meklenburg eingerichtet. Nachdem die Doberaner Superintendentur 1779 wieder eingegangen war, blieben die Geschäfte derselben unter die drei andern vertheilt. 1 )
Demgemäß war die Eintheilung des Landes seit 1779 folgende:
1) Die Güstrower Superintendentur umfaßte die Präposituren Plau, Lüssow, Teterow, Goldberg, Penzlin, Röbel, Malchin;
2) die Parchimer: Neustadt, Wittenburg, Waren, Lübz, Hagenow, Grabow, Crivitz;
3) die Schweriner: Meklenburg, Lübow, Doberan, Bützow;
4) die Sternberger: Schwan, Ribnitz, Gnoien, Bukow, Rehna, Neukalen, Grevesmühlen, Boizenburg.


|
Seite 229 |




|
Die beabsichtigte Aufhebung der Ungleichheit war also nur zum Theil ausgeführt.
Die Geschäfte der meklenburgischen Superintendenten waren sehr weitgehend: sie hatten das Leben und die Lehre der einzelnen Prediger genau zu überwachen, die Candidaten zu prüfen, zu präsentiren, zu ordiniren und zu introduciren. die Kirchenökonomen zu beaufsichtigen, die Kirchenvorsteher zu beeidigen, in den lateinischen Schulen das Scholarchat zu üben, die Küster, Organisten und Schulmeister zu prüfen u. a. m. Tüchtige Superintendenten zu haben, auf die er sich verlassen konnte, die neben der erforderlichen Energie auch sanfte, die Herzen ziehende Liebe zeigten, - das war das vorzüglichste Augenmerk des Herzogs. Dabei aber ging er von der allerdings verkehrten Ansicht aus, daß Nicht=Meklenburger, weil sie durch keine andere Beziehungen gebunden noch gehindert würden, zur Verwaltung eines so verantwortungsvollen Amts vorzuziehen seien; und da er bei seiner Großtante, der Horzogin Augusta in Dargun, den Eifer der fremden Prediger kennen gelernt hatte, so war es nur natürlich, daß Pietisten die Stellen bekamen.
Unter den Superintendenten war der einflußreichste ohne Zweifel der am 28. August 1756 nach Parchim berufene Karl Heinrich Zachariä, von dessen Thätigkeit in Dargun Wilhelmi ein so fesselndes Bild entworfen hat. (S. Jahrb. XLVIII, S. 141 f.) Von ganzer Seele dem Pietismus zugethan, hatte sich Zachariä doch bereits in Dargun nicht allein als den entschiedensten Gegner aller Ausschweifungen in der Lehre, sondern auch als praktischen Mann bewiesen. Bei seiner Berufung nach Parchim war er sich der neuen Pflicht in der neuen Stellung voll bewußt. "Ich werde", schrieb er am 6. September an den Herzog, "dahin gehen, wohin mein Heiland mich ruft; er hat mir ein erbarmendes Herz gegen die armen Sünder gegeben; die armen Sünder will ich nicht aufhören mit Bitten und Flehen zu ihrem großen und freundlichen Erlöser zu locken. Die Liebe ist geduldig und langmüthig: so werde ich mich mit dem Evangelium durchzudrücken suchen. Mein theurer Immanuel, den ich bisher treu, weise, mächtig erfunden, wird mit mir sein und mich gewiß zum Segen setzen. Er hat bisher mein armes Gebet in allen Stücken gnädig erhöret und mein Vertrauen auf seine Verheißungen nicht vergeblich sein lassen."
Also nicht durch heftigen Bekehrungseifer, der den Pietismus den Predigern und Gemeinden bisher anstößig gemacht hatte sondern durch Liebe wollte er die Seelen locken. Und in der That,


|
Seite 230 |




|
die unermüdete Thätigkeit, die mit Milde verbundene stramme Zucht machte ihn zum beliebtesten Vorgesetzten. Wie große Achtung er sich erworben hatte, zeigte der 10. November 1776, als er sein 50jähriges Amtsjubiläum feierte. Von allen Seiten wurden ihm die Beweise innigster Verehrung zu Theil. Den ganzen Mann aber zeigt sein Verhältniß zum Herzog, dem er oft mit seltenem Freimuthe begegnete, wenn falscher Eifer das Heil der Kirche zu bedrohen schien. Die Gefahr der Ungnade schreckte ihn nicht; denn Unrecht leiden schien ihm besser als Unrecht thun. An Spannungen fehlte es daher nicht; aber der Herzog erkannte zuletzt doch immer, daß Zachariä Recht hatte, und nur brennende Liebe ihn in Allem leitete. Zachariä starb am 21. October 1782. Sein letzter Wunsch war gewesen, den durch Amtstreue und Frömmigkeit ausgezeichneten Hofprediger zu Ludwigslust Georg Gottlieb Beyer als Nachfolger zu erhalten. Sein Wunsch ging 1784 in Erfüllung trotz der Intrigue des Superintendenten Martini. Da der Herzog Beyer an seinem Hofe behalten wollte, bekam derselbe seinen Wohnsitz zunächst in Ludwigslust.
In Schwerin war 1756 Superintendent Karl Witsche, der Sohn des ehemaligen Beichtvaters der Herzogin Augusta in Güstrow. Wie der Vater, so stand auch der Sohn zu den Halleschen Pietisten in enger Beziehung, ohne aber, so weit ich sehe, mit den Dargunern gemeinsame Sache zu machen. Da er beim Regierungsantritt des Herzogs schon hochbetagt war, wurde ihm Menckel als Adjunct beigegeben, der 1757 sein Nachfolger wurde.
Johann Christian Menckel, am 2. November 1702 zu Bromskirchen in Hessen=Darmstadt geboren, Sohn eines pietistischen Predigers, hatte seit 1721 in Halle studirt und darnach von 1725 bis 1729 in Rußland als Prediger gewirkt. Auf Callenbergs Empfehlung hatte ihn der Herzog Karl Leopold bei seinem Hofstaat in Danzig angenommen und im Mai 1730 als Hofprediger an der Schloßkirche zu Schwerin angestellt. Als ihn später 1735 der Herzog von hier fort nach Wismar zu sich beschieden hatte, war er nicht gefolgt, da sein Gewissen ihm verbot, die Gemeinde zu verlassen; aber daß er sich trotz der schlimmsten Drohungen seines Herrn unter den Schutz des Administrators Christian Ludwig stellte, konnten ihm der Herzog Karl Leopold und die Schweriner nie verzeihen.
Im November 1756 machte der Herzog Friedrich ihn zum ersten Prediger der Domgemeinde zu Schwerin, gleichzeitig auch zum Adjuncten Witsches und zum Superintendenten des Stifts Schwerin. Im folgenden Jahre wurde er Witsches Nachfolger,


|
Seite 231 |




|
Obgleich Menckel nach dem Zeugniß seiner Zeit ein tüchtiger Prediger war, "bemüht das Bild des Satans in den Seelen der Sünder zu zerstören und dagegen das Bild Jesu, des Heilandes, aufzurichten, unermüdlich, die Unwissenden zu belehren, die Gottlosen zu strafen, die Mühseligen und Beladenen zu dem offenen Born der Wunden Christi zu locken", - so hatte er doch keinen Dank davon: die Gemeinde konnte ihm seinen vermeintlichen Treubruch nicht verzeihen. Dazu lebte er in beständigen Reibungen, besonders mit den Lehrern an der Domschule, und sein Amtsbruder Martini trug auch nicht dazu bei, die Bürde des Amts ihm zu erleichtern. Als Superintendent bewies er sich trotz dem Herzog, der bei allem sonstigen Wohlwollen den Feuereifer an ihm vermißte, als tüchtigen Hirten; mild geworden durchs Alter, war er eifrig im Dienste der Kirche, ohne Hitze. Im Jahre 1768 wurde ihm auch die Meklenburgische Superintendentur ad interim anvertraut, die er bis 1774 verwaltete. Bei der Abnahme dieser dem Greise zu großen Bürde verlieh die Herzogliche Gnade "dem treuen Diener" den Titel eines Consistorialraths. Im folgenden Jahre, am 2. Juli 1775, feierte Menckel noch sein 50jähriges Amtsjubiläum; wenige Tage darauf, am 16. Juli, starb er. Sein Leben war Mühe und Arbeit gewesen. Sein Nachfolger im Amte ward Friedrich Heinrich Martini, ein Mann von bedeutenden Fähigkeiten, aber von schwachem Charakter. Er war der Sohn eines Predigers, am 16. August 1727 zu Marnitz geboren. Als Student hatte er sich in Rostock als Orthodoxer hervorgethan, war dann in das Lager der Pietisten übergegangen und wegen seines Eifers 1756 Hofdiakonus und 1758 Hofprediger in Schwerin geworden. Obwohl das glatte Wesen des Mannes dem Herzog wenig gefiel, war er doch nicht ohne mächtigen Einfluß, da er, wo der gerade Weg verschlossen war, auch Umwege und krumme Wege zu gehen sich nicht scheute und bei Allen, die in der Umgebung des Herzogs waren oder sonst bei Hof etwas galten, sich einzuschmeicheln verstand. Der Herzog durchschaute auch das Wesen des Mannes und wollte ihn deshalb nach Menckels Tode nicht zum Superintendenten machen, sondern wandte sich an den Consistorialrath Struensee in Rendsburg mit der Bitte, ihm einen tüchtigen und bewährten Mann zu empfehlen. Indessen Martini wußte diesen Plan zu vereiteln; seine guten Freunde stellten es als eine "unverdiente Kränkung des verdienten Mannes" dar, und so wurde denn Martini am 18. September 1776 zum Superintendenten ernannt. Im Jahre 1782 wünschte er Zachariäs Nachfolger mit dem Wohnsitz


|
Seite 232 |




|
in Ludwigslust zu werden; aber der Herzog ließ sich nicht darauf ein, wenngleich er die abschlägige Antwort dem Hochstrebenden durch den Titel eines Consistorialraths versüßte.
Ich bin weit entfernt, Martini einen Heuchler zu nennen, wenn auch seine abermalige rasche Schwenkung zum Rationalismus noch bei Lebzeiten des Herzogs Friedrich diesen Verdacht bestärken könnte; aber er gehört zu jenen Strebern, deren nimmer befriedigter Ehrgeiz vor der Welt den wahren innern Kern so leicht verbirgt. Und das muß auch der Neid Martini lassen, daß er bei seiner Bewerbung um die Superintendentur nicht nach einem Amte gestrebt hatte das er nicht völlig zu bekleiden fähig gewesen wäre. In allen Geschäften erwies er sich als brauchbar, und sein kluger Geist bewahrte ihn vor Mißgriffen. Nur das tadele ich, daß er oft nicht den Muth hatte, wo es sein Amt forderte, gerade vorzugehen; was Zachariäs größte Stärke war, war Martinis größte Schwäche: er war kein fester Charakter.
In Güstrow war 1756 Bernhard Heinrich Rönnberg Superintendent. Bei der feindlichen Stellung, welche das dortige geistliche Ministerium stets den Pietisten gegenüber einnahm, mußte dem Herzog daran liegen, nach Rönnbergs Tode einen ganz energischen Mann an seine Stelle zu setzen. So wurde 1763 Johann Christian Keßler berufen. Er war am 15. October 1728 zu Freiburg in Thüringen geboren und hatte als Prediger in Magdeburg dem Kreise der gemäßigten Pietisten angehörte. In den ersten Jahren seines Wirkens in Güstrow hatte Keßler viel von den Orthodoxen zu leiden und erfreute sich auch bei den Predigern wegen der Hervorkehrung des Pietismus und Begünstigung der "Bekehrten" keiner besonderen Liebe. Aber seine Treue im Amte und die Reinheit seines Herzens gewannen ihm allmählich die allgemeine Achtung, und seit 1773, wo er die meklenburgische Geistlichkeit gegen Fidler so brav vertheidigt hatte, besaß er die größte Verehrung. Nach gesegnetem Wirken starb er im Jahre 1785.
Von dem wahren Ausbund der Verlogenheit und Tücke Ferdinand Ambrosius Fidler ist oben ausführlich gehandelt worden. Die ihm 1774 verliehene Superintendentur umfaßte die Präposituren: Doberan, Neubukow, Lübow, Meklenburg, Gnoien, Ribnitz, Schwan. Als Fidlers Nachfolger wurde 1778 der Präpositus Glöckler aus Boizenburg berufen, der sich dem Herzog besonders durch eine Schrift über die Synoden in Würtemberg und ihre Geschichte empfohlen hatte. Leider starb der treffliche Mann bereits im nächsten Jahre am Herzschlag. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt.


|
Seite 233 |




|
Zuletzt haben wir noch von dem Sternberger Superintendenten Johann Gottlieb Friederich zu handeln. Er war 1770 von Parchim als zweiter Hofprediger mit der Anwartschaft auf die nächst=erledigte Superintendentur nach Ludwigslust berufen worden. Indessen seine am Sonntag Sexagesimä gehaltene Antrittspredigt, in welcher er sich als pietistischer Heißsporn bewies, zeigte, daß er als Hofprediger nicht zu gebrauchen war; hatte er es doch gewagt, über eine Cabale am Hofe wider ihn und seine pietistischen Glaubensgenossen - von der Kanzel herab seine Bemerkungen zu machen! So wurde ihm am 8. April 1774, bevor noch Menckel gestorben war, die Meklenburgische Superintendentur mit dem Wohnsitz in dem Landstädtchen Sternberg angewiesen, was einer Verbannung gleichbedeutend war. Auch in Sternberg gab seine Amtsführung zu mancherlei Klagen Anlaß; namentlich wich er oft von dem hergebrachten Cultus ab und beschwerte unnütz die Gewissen seiner Gemeinde. Es fehlt mir indessen das nöthige Actenmaterial, um zu einem abschließenden Urtheil mich berechtigt zu halten; für ganz unverdächtig kann ich ihn aber nicht halten, da er Fidlers bester Freund war, und dessen hinterlassene Papiere ergaben, daß er aus dem Fortgang des Processes schwerlich ganz gereinigt herausgekommen wäre. Doch dies nur nebenbei!
Die Amtsführung der Superintendenten war bei der Strenge des Herzogs nichts weniger als leicht; denn derselbe forderte, daß "seine Superintendenten" in der Treue der Arbeit gesegnete Vorbilder der gesammten ihnen untergebenen Geistlichkeit seien, und genug konnte ihm darin nicht leicht einer thun, vielmehr spornte er zu immer größerem Eifer im Amte an. Die Klagen wegen zu vieler Geschäfte nahmen daher kein Ende; bei dem besten Willen und dem größten Eifer mußte Vieles unerledigt bleiben. Bei dem Herzog fanden die Vorstellungen aber so wenig Ohr, daß er, wie wir sahen, im Jahre 1767 drei Männern zu verwalten übertrug, was fünf nicht hatten verwalten können. Drei Superintendenten für das ganze Land, und dabei schien es bleiben zu sollen! Aber dem ehrgeizigen Fidler, der 1774 mit der Verwaltung der kleinen Doberaner Superintendentur ad interim betraut wurde, war auch die geringe neue Arbeit eine Last die er nicht tragen wollte. Schlau, wie er war, hatte er bald das Richtige herausgefunden. Er stellte dem Herzog vor: es sei nöthig, um den Landes=Superintendenten die unerträgliche Last zu erleichtern, ihnen Gehilfen zu geben; solche Seniores oder Inspectores seien auch in der Präpositur=Ordnung zu finden. Er wußte dies dem Herzog so verlockend darzustellen, daß dieser den Gedanken begierig ergriff und sofort Dö=


|
Seite 234 |




|
derlein zum Bericht aufforderte, ob Bedenken entgegenstünden. Das Pro memoria Döderleins ist zu interessant, um übergangen zu werden. Datirt ist es vom 2. April 1774.
1) Da die kirchenordnungsmäßige Aufsicht über die Geistlichen und Gemeinden wegen der Weitläufigkeit der Diöcesen von den Superintendenten nicht gehörig besorgt werden kann, so vernothwendigt sich die Einsetzung von Special=Superintendenten, welche unter dem Consistorium und den Landes=Superintendenten stehen.
2) Ihr Amt ist: die lebendige Erkenntniß Jesu Christi und das wahre, thätige Christenthum zu fördern und Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten, weswegen sie besonders Acht zu geben haben, ob die Schulen in gehöriger Ordnung sind, die Gemeinden das Katechismus=Examen fleißig besuchen, die Hausväter den Hausgottesdienst treu versehen, ob Laster im Schwange sind, und ob die Candidaten ein ordentliches Leben führen. Zu dem Zwecke haben sie die Prediger dazu anzutreiben, daß sie allmonatlich mit den Juraten und Honoratioren ihrer Gemeinde einen Convent abhalten, in welchem alles Wichtige besprochen wird. Besonders haben sie auch darauf zu sehen, daß die Prediger sich sorgfältig auf die Predigt vorbereiten und faßlich und eindringlich, lauter und rein lehren, die Kanzel nicht zu Allotriis, noch weniger zu Sticheleien auf Personen oder Seelen mißbrauchen. Es ist ferner ihre Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Prediger die Beichte ordnungsmäßig abhalten, das Katechismus=Examen zur Stärkung der Gemeinde nachdrücklich anwenden, die Schulen wöchentlich besuchen, die Kranken gewissenhaft besorgen, die Sünden und Laster privatim strafen und in keiner Willkür von der Gottesdienst=Ordnung abweichen. Endlich sind sie auch für die sorgfältige Führung der Kirchenbücher verantwortlich. Sie sollen aber auch das Privatleben der Geistlichen und ihrer Familie nicht außer Acht lassen; denn ein Geistlicher soll auch in seinem häuslichen Leben das Vorbild der Gemeinde sein.
3) Jeder Geistliche ist verpflichtet, dem Special=Superintendenten wahrheitsgetreu alle Uebelstände in seiner Gemeinde zu berichten, auch alles Anstößige aus seinen Nachbargemeinden zu melden; der Special=Superintendent aber soll, wenn ihm irgendwo etwas Verdächtiges angezeigt wird, sofort und unvermuthet die Gemeinde aufsuchen und in den Häusern nachforschen.
4) Zum Behuf genauer Nachrichten von dem Zustand der Gemeinden ist jährlich ein Frage=Plan an jeden Geistlichen zu senden, den dieser gewissenhaft zu beantworten und dann an den Special=Superintendenten einzuschicken hat. Die Punkte aber,


|
Seite 235 |




|
worüber Prediger, Küster und Gemeinde sollen examinirt werden, sind öffentlich von der Kanzel vorzulesen. Der Vortheil davon ist: 1) daß der Prediger dadurch ausdrücklich an seine Pflicht erinnert, und wenn er davon abweicht, beschämt wird; 2) daß redlich gesinnte Gemeinde=Mitglieder dadurch Muth bekommen, die Vergehungen ihrer Prediger höheren Orts zu melden; 3) daß rechtschaffene Prediger dadurch unterstützt werden, mit dem Hinweis auf die klare landesherrliche Verordnung den in den Gemeinden umgehenden Sünden und Lastern entgegenzutreten, da dann die ganze Gemeinde siehet und höret, daß der Prediger solches alles thun muß, wofern er nicht selber in Verantwortung und Strafe fallen will. -
Soviel von diesem ohne Bedenken wenigstens als unpraktisch zu bezeichnenden Vorschlage Döderleins. Von dem zweiten Theile desselben, dem Verhältniß der Synoden zu den Special=Superintendenten, werden wir später sprechen.
Dem Eifer des Herzogs gefiel der Vorschlag Döderleins ganz ausnehmend; um so mehr war er verwundert, von Zachariä, dem er denselben zur Begutachtung übersandt hatte ein ganz abfälliges Urtheil zu hören. Denn dessen redlicher Sinn lehnte sich gegen ein solches Spionirsystem auf, "bei dem nur die Bösen gewinnen könnten, der Friede der Gemeinden aber untergraben würde"; er erklärte daher rundweg, daß er abgehen werde, sobald der Herzog diesen Plan genehmige, da er alsdann als Superintendent überflüssig sei, wenigstens nicht mehr mit Segen in seinem Amte wirken könne. Der Herzog nahm diese kurze Abweisung einer, wie es ihm schien, so heilsamen Sache Anfangs Zachariä sehr übel, verzichtete aber auf die Verfolgung des Plans, und so hatte unser Land dem Muthe Zachariäs zu danken, daß, was der Herzog beabsichtigte, auch nicht gerüchtweise ins Publicum kam. Wie viel böses Gerede wäre damals, wo eben der Hermes'sche Proceß im Gange war, daraus entstanden! Und was schlimmer gewesen, mit der gesegneten Amtsführung unserer Superintendenten wäre es zu Ende gewesen; die Special=Superintendenten hätten bald die Superintendenten verdrängt!
Aber, wird man hier verwundert fragen, wie vereinigt sich dieser Vorschlag Döderleins mit dessen Rechtschaffenheit? Sah nur sein blinder Eifer nicht die Folgen? Oder wollte er etwa die Superintendenten beseitigen? - Ich bin nicht ganz abgeneigt, dies zu glauben. Denn so treu dieselben nach ihren Kräften ihres Amts walteten, so waren sie doch weit entfernt, einen Druck auf die Prediger auszuüben, durch den ihre Gewissen beschwert und ein


|
Seite 236 |




|
Streit hervorgerufen worden wäre, welcher weder dem Frieden der Kirche noch dem Wohl des Staats gefrommt hätte. Alle waren darin einig, mit Liebe sich Liebe zu erwerben, und selbst der eifrigste, der Güstrower Superintendent Keßler, beklagte wohl, daß so wenige Prediger sich bekehrten, aber niemals wollte er zur gewaltsamen Bekehrung seine Hand bieten. Das war aber nicht nach Döderleins Sinn. Dazu trat, daß die Superintendenten eine Selbständigkeit besaßen, welche dem Consistorium wenig nachgab. Wie, wenn es gelang, denselben ihren Einfluß zu nehmen, indem sie zu dem höheren Regiment im Consistorium zugezogen würden? Mit den Special=Superintendenten durfte Döderlein hoffen fertig zu werden und sie zu gefügigeren Werkzeugen zu machen. Doch lassen wir die Frage vorläufig noch offen: sie wird bald ihre Erledigung finden.
Bei dem energischen Widerspruch Zachariäs, der in dem ganzen Plane richtig einen neuen ruchlosen Anschlag des leider zum Schaden der Kirche bei Döderlein zu viel geltenden Fidler sah, ließ der Herzog das Project fallen und stellte auch bald die fünfte Superintendentur wieder her (1774).
IV. Die Präpositi und die Synoden.
Die Präpositi, oder wie sie früher vor 1671, resp. 1707 hießen, die Seniores, hatten beim Regierungsantritt des Herzogs Friedrich keine festumschriebene Amtsthätigkeit; denn da die in den ältesten mekl. Kirchen=Gesetzen vorgeschriebenen "Synoden zwecks Verbesserung des Kirchen= und Schulwesens, überhaupt alles dessen, was zur Beförderung und Ausbreitung der reinen evangelischen Lehre und zur Vorbeugung irriger Lehren und Unordnungen der Prediger und Gemeinden gereichen kann", seit Langem aufgehört hatten anders als gelegentlich zu besondern Zwecken berufen zu werden, so war auch damit die Hauptsorge der Präpositi oder Synodal=Vorstände gefallen, und es war ihnen nichts geblieben als die Durchführung des von den Superintendenten Angeordneten in ihren Cirkeln, und in sehr beschränktem Maße die Vertretung des etwa behinderten Superintendenten. Diesem Uebelstande mußte abgeholfen werden, wenn eine straffere Zucht der Prediger zurückkehren sollte. Alle wiederholt von den Predigern eingeforderten Berichte über das äußere und innere Leben der Gemeinden lauteten darin mehr oder minder überein, daß gegenüber der Rohheit der Sitten und dem finstersten Aberglauben, welche besonders bei dem


|
Seite 237 |




|
Landvolke herrschten, auch der beste Prediger machtlos sei. Der Herzog meinte aber, daß die Schuld allein an dem Mangel kirchlichen Lebens läge; er hatte selbst erfahren, mit wie großem Segen die "fremden Prediger" in ihren Gemeinden gewirkt, wie sie nicht müde geworden waren, überall Leben zu schaffen, wo keines war; der mangelnde Eifer der Pastoren, die schlechte Hirten seien, müßte also an Allem schuld sein. So lange der Krieg auf dem Lande lastete, war an ein energisches Durchgreifen nicht zu denken, denn die armen Prediger litten selbst am meisten unter dem Jammer. Aber kaum hatte das Land sich etwas erholt, als der Herzog begann, die Prediger sein Mißfallen fühlen zu lassen. Nicht allein, daß er die besseren Stellen des Landes an Fremde gab, die ihm aus dem pietistischen Kreise empfohlen wurden; er forderte auch die Superintendenten auf, daß sie die Prediger besonders auf dem Lande unter die schärfste Aufsicht nähmen und dieselben für das geistige Leben der Gemeinden verantwortlich machten; sie sollten unvermuthet Zuhörer der Predigten werden, ohne Wissen des Predigers in der Gemeinde Umfrage nach dessen Lehre und Wandel halten, auch Examina aufstellen und die daraus sich ergebenden Conduitenlisten jährlich an ihn einsenden, damit die Säumigen dem Consistorium zur Bestrafung angezeigt würden (1767). Aber keiner der Superintendenten kam dem Befehle nach. Keßler schickte zwar im ersten Jahre einen allgemeinen Bericht über seine Diöcese ein; aber er machte doch keinen einzigen Pastor so namhaft, daß er hätte bestraft werden können; vielmehr rühmte er, bei aller Klage, daß die "wahre Bekehrung" den Predigern schon von fern als Greuel erschiene, den lobenswerthen Eifer der ihm unterstellten Geistlichkeit. "Und wie die Lage des Landes nach den schweren Leiden des Krieges sei, müßten ja die Prediger zufrieden sein, wenn sie als gute Berather des armen, hilflosen Landvolks der Verzweiflung und den gröbsten Ausbrüchen des Lasters wehrten; es fehle noch viel daran, daß der Boden bereitet sei, gute, von allem Unkraut reine Saaten hervorzubringen." Menckel entschuldigte sich wiederholt, daß es ihm nicht möglich sei, dem Herzoglichen Befehl nachzukommen, und schickte zuletzt auf vieles Drängen nichtssagende Angaben. Zachariä endlich weigerte sich geradezu, "da er fürchten müsse, die Ehre seiner Prediger zu beleidigen und ein böses Denunciantenwesen zu wecken."
Da griff der Herzog im Februar 1769 auf die alte Kirchenordnungs=Bestimmung zurück und befahl: daß hinfort in allen Präposituren des Landes jährlich einmal eine Synode aller Prediger stattfinden solle. Zu diesem Zweck sollten die Präpositi als die


|
Seite 238 |




|
berufenen Vorsitzenden den Predigern aufgeben: 1) die sorgfältigste Ausarbeitung eines von den Superintendenten gestellten wissenschaftlichen Themas aus der praktischen Theologie und 2) einen gewissenhaften Bericht über den Stand und Fortschritt des Schulwesens in ihren Gemeinden. Die spätestens vier Wochen vor der Synode eingelieferten Arbeiten seiner Prediger sollte der Präpositus genau prüfen und darnach dasjenige, was ihm daraus geeignet erschienen, auf der Synode zur allgemeinen Besprechung bringen. Nach Beendigung der Synode sollten dann die vom Präpositus gewissenhaft beurtheilten Arbeiten nebst klarer Angabe, wie dieselben zu dem Leben und der Lehre der Verfasser sich verhielten, zur weiteren Prüfung an die Superintendenten gehen und zuletzt, nachdem auch diese ihr Gutachten hinzugefügt hätten, an den Herzog eingesandt werden. - Es ist begreiflich, daß die Präpositi durch diesen Befehl in nicht geringe Verlegenheit geriethen; es schien ihnen bei der noch nicht erstickten Gährung in Folge des Pietistenstreits die Saat der verderblichsten Zwietracht. Da sie dem Auftrage sich nicht entziehen konnten, verfielen die einen auf denselben Ausweg wie die Superintendenten, nämlich alle Personalien in ihren Berichten zu vermeiden und nur die besten und die schwächsten Arbeiten namhaft zu machen. Andere aber unter denselben, welche in der neuen Einrichtung eine unleidliche Bedrückung ihres Gewissens erblickten, suchten auf allerlei Weise um den Befehl überhaupt wegzukommen. Von den Predigern widersetzten sich besonders die ritterschaftlichen; denn von ihnen einen jährlichen Bericht über das Schulwesen in ihren Gemeinden zu verlangen, hieße nichts Anderes, als sie mit ihren Patronen verfeinden. Eben dieses war auch der Anlaß, weshalb der Engere Ausschuß, als er des Herzogs ernste, auf eine Reform des ganzen Kirchen= und Schulwesens gerichtete Absicht erkannte, 1773 beim Herzog vorstellig wurde und unterthänigst um eine Proposition in einer so wichtigen Landessache bat. Denn wenn es der Herzogl. Regierung gelang, durch die Synoden alles geistige Wesen im Lande unter sich zu bekommen, so war es mit der vielfach noch herrschenden Willkür der Patrone vorbei. Der Herzog ließ sich aber auf keine Verhandlung über diese zum Heile der Kirche erneuerte Einrichtung herbei; denn überzeugt, das Ritter= und Landschaft in der Opposition einmüthig zusammenständen, war er sich der Rückwirkung eines auf dem Landtage gefaßten förmlichen Protestes auf die ohnehin schon widerwillige Geistlichkeit völlig bewußt. Er antwortete daher, daß zu einer Vorlage auf dem Landtage gar kein Grund vorläge, da die Synoden kirchenordnungsmäßig wären und auf ihnen auch nichts


|
Seite 239 |




|
Anderes verhandelt würde, als was kirchenordnungsmäßig vorgeschrieben wäre. Dennoch: der Herzog wollte mehr; sein Wunsch war unzweifelhaft, durch die Synoden die ganze Geistlichkeit unter sich und seinen Willen zu bekommen. Aber das konnte nur gelingen, wenn die Präpositi mithalfen. Diese indessen folgten dem Beispiele ihrer Superintendenten, welche für die Sache nur so weit zu gewinnen waren, als der Friede der Kirche dadurch nicht gefährdet wurde. Was waren aber die von den Präpositis geforderten Berichte über Leben und Lehre der einzelnen Prediger Anderes als Conduitenlisten? Durch diesen Widerstand der Präpositi wurde der Herzog aufs Höchste gereizt; aber ohne die Superintendenten konnte er nach der bestehenden Ordnung denselben nicht beikommen. Die Macht der Superintendenten mußte also gebrochen werden. In diesem Zusammenhang möchte es daher als mehr denn eine bloße Meinung von mir erscheinen, daß der Herzog durch die eben damals geplante Einsetzung von Special=Superintendenten den Einfluß der Superintendenten und Präpositi zu brechen beabsichtigte. Denn hören wir, was Döderlein vorschlug:
1) Der Special=Superintendent giebt sechs Wochen vor der Synode den biblischen Text auf, über welchen jeder Prediger schriftlich sich auszulassen hat, und bestimmt zugleich die Artikel aus der Theologie, worüber das Colloquium in pleno stattfinden soll. Beide Aufgaben müssen das Wesentliche des Christenthums betreffen und sich auf die mancherlei theoretischen oder praktischen Irrthümer, welche im Schwange sind, beziehen.
2) Vier Wochen vor der Synode haben die Prediger ihre Arbeiten an den Präpositus, und dieser dieselben mit einer sorgfältigen Kritik 14 Tage vor der Synode an den Special=Superintendenten zu übersenden.
3) Die Synode beginnt um 9 Uhr Morgens; kein Prediger darf ohne genügende Entschuldigung dieselbe versäumen.
4) Die Synode wird mit einem kurzen Gebet eröffnet.
5) Der Vorsitzende ist der Special=Superintendent oder der von diesem mit seiner Vertretung betraute Präpositus.
6) Ueber Alles, was verhandelt wird, ist ein genaues Protocoll aufzunehmen.
7) Die einzelnen Predigten werden, ohne Nennung der Verfasser, censirt, die bedenklichen Irrthümer berichtigt; wenn eine Disputation entsteht, so werden die verschiedenen Ansichten genau zu Protocoll genommen.


|
Seite 240 |




|
8) Bei dem zweiten Theil der Synode, dem Colloquium über den Artikel aus der Theologie, muß jeder Prediger zu Worte kommen, und das Protocoll deutlich seine Meinung aufweisen.
9) Der dritte Theil der Synoden beschäftigt sich besonders mit der Besprechung der Gemeinde=Angelegenheiten und dem Schulwesen.
10) Die Synode wird mit einem kurzen Gebet geschlossen.
Nach gehaltener Synode schickt der Special=Superintendent ohne Verzug alle Acten nebst Beilagen zur Kenntnißnahme an seinen Landes=Superintendenten, der sie dann an das Consistorium weiter befördert. Das Consistorium wird dann aber Serenissimo vollständigen Bericht daraus erstatten und darum bitten, daß die verdienten Prediger auch durch die Verleihung der besten Pfarren belohnt werden. -
Ich trage kein Bedenken, das Scheitern dieses Plans ein großes Glück für die meklenburgische Landeskirche zu nennen. Denn davon abgesehen, daß die Synoden dadurch ihren höchst heilsamen Zweck verfehlt und zu nichts als gefährlichen Reibungen geführt hätten, wäre durch dieselben jede freie Bewegung der Kirche unterdrückt worden. Welcher Prediger hätte unter solcher Polizei noch gewagt, freimüthig seine Meinung zu äußern, oder Fragen, welche sein Gewissen berührten, zur Discussion zu bringen, wenn ihm als Folge davon drohende Processe oder leibliches Elend vor Augen standen? Die besten hätten geschwiegen und Gott um Hilfe in der Noth gebeten, und die Streber wären zu den besten Pfarren gelangt. Gerade was für die Kirche das Wünschenswertheste ist, der wissenschaftliche Eifer der Prediger, wäre dadurch gelähmt worden. Daß dies verhütet wurde, verdankt unsere Kirche dem Muthe der Geistlichkeit überhaupt und insbesondere dem Einspruche des Superintendenten Zachariä zu Parchim, eines Mannes, der dem Herzog doch zu nahe stand, und dessen ehrlicher Eifer im Dienst doch zu bekannt war, als daß er hätte beseitigt werden können. Obwohl der Herzog ihm deswegen zürnte und auch seinen landesfürstlichen Unwillen ihn fühlen ließ, durfte der redliche Mann sich doch mit seiner gerechten Sache trösten und hoffen, wie es auch geschah, das die Gnade seines Herrn ihm bald wieder leuchten würde. Daß aber Zachariä es war, an dessen Widerspruch der Plan scheiterte, geht mir außer vielem Anderen besonders daraus hervor, das der Herzog kurz nach dessen Tode, am 4. April 1783 den Superintendenten befahl:


|
Seite 241 |




|
"Wenn Wir zur Einführung und Beobachtung einer allgemeinen Gleichförmigkeit in den angeordneten Synodal - Versammlungen eine regelmäßigere Ordnung durchgängig zum Grunde gelegt wissen wollen: So verordnen Wir hiemit gnädigst, daß, so wie es
Erstlich in einigen Synoden schon eingeführt ist, daß jeder Prediger über die Aufgabe, welche zur Abhandlung bei der Zusammenkunft gewählt worden, seine Erklärung schriftlich mitbringen und zur Beilegung zum Protocoll abgeben, oder dagegen bei der Versammlung die mündliche Erklärung eines jeden Mitglieds zu Protocoll genommen werden muß, also
Zweitens jeder Prediger zugleich eine schriftliche Anzeige zu machen hat,
- wie es mit der thätigen Gottesfurcht in seiner Gemeinde beschaffen sei,
- ob die Schulen in gutem Gange und Stande sind, und besonders die Sommerschulen richtig gehalten werden,
- ob und was etwa sonst überhaupt bei seiner Pfarre im Kirchen= und Schulwesen, auch in der Kirchenökonomie fehle oder eine Verbesserung nöthig habe.
Drittens: damit weder die Unbequemlichkeit der Jahreszeit noch die Beschaffenheit der Wege oder die Unentbehrlichkeit der Fuhren u. s. w. einen Vorwand zur Erschwerung, Verzögerung oder gar gänzlichen Unterbleibung dieser nach Unseren Absichten so heilsamen Anstalten abgeben möge, wollen Wir so gnädigst als ernstlich, das die sämmtlichen Synodal=Zusammenkünfte in Unsern Herzog=, Fürstenthümern und Landen auf eine bestimmte Zeit in jedem Jahre, und zwar im Sommer sogleich nach vollendeter Saatzeit, vor Eintritt der Heuernte, solchergestalt angestellt werden sollen, daß spätestens allemal vor Michaelis alle dabei gehaltenen Protocolle vermittels eures Berichts in Unsern Händen sich befinden müssen; auch soll davon Aussetzung oder Verschließung keineswegs von der Willkür des Ehren=Präpositus abhängen, sondern dieser im erweislichen Nothfall darüber Unsere General=Concession nachsuchen und nach Befinden Verordnung gewärtigen.
Viertens wird jedem Präpositus hierdurch zur Pflicht gemacht, bei Einreichung des Synodal=Protocolls gewissenhaft und ausdrücklich zu berichten, ob ein oder etliche Prediger in seinem Cirkel auch etwa


|
Seite 242 |




|
eine irrige Lehre vortragen, ihr Amt im Studiren, Predigen oder sonstigen Verrichtungen vernachlässigen und keinen guten exemplarischen Wandel führen?
Würde der Präpositus diese pflichtgemäße Anzeige unterlassen, so soll er deshalb mit dem Schuldigen in gleiche, nach Befinden schwerere Strafe verfallen, und seine etwaige Entschuldigung der Unwissenheit von ihm angenommen werden, indem ihm als bestelltem Aufseher in seinem Cirkel oblieget und hiedurch zum Ueberfluß nochmals anbefohlen wird, nach der Amtsführung und dem Lebenswandel eines jeden ihm angewiesenen Lehrers fleißig und genau sich zu erkundigen.
Diese Unsere erneute höchste Willensmeinung habt ihr durch alle Cirkel Unserer euch anvertrauten Superintendentur gewöhnlichermaßen bekannt zu machen; und wie Wir uns dessen gnädig versehen, Unsere Superintendenten werden nach der Wichtigkeit des ihnen übertragenen Amtes an der nothwendigen Wachsamkeit und dem thätigsten Fleiße zur Ausbreitung des Reiches Gottes in seinem Stücke es ermangeln lassen: so habt ihr auch insbesondere auf die genaueste Befolgung dieser Unserer Vorschrift bei Vermeidung eigner schwerer Verantwortung sorgfältig zu halten. An dem - und Wir verbleiben -"
An die Ehren=Superintendenten.
Also: bis zum Jahre 1783 waren zwar die Synoden fast allgemein eingeführt, aber es gab doch noch Präpositi, die unter allerhand Vorwänden die regelmäßige Abhaltung derselben unterließen, andere, die die Personalien vernachlässigten, endlich andere, die in den Objecten der Synode willkürlich verfuhren. Dieser Schluß ward auch durch die in großer Menge noch vorliegenden Synodalberichte bestätigt: in den meisten Cirkeln verfuhren die Präpositi nach der Vorschrift, anderwärts aber, wie es ihnen gut dünkte. Nur sehr wenige ließen sich auf Klagen gegen die ihnen unterstellten Prediger ein, diese selbst hüteten sich, heterodoxe Meinungen vorzutragen, woraus ihnen Processe entstehen konnten, und wenn es mit oder ohne ihren Willen geschah, so gaben sie nach. Ich bin kein competenter Beurtheiler dieser theologischen Arbeiten, habe mir aber doch die Mühe gemacht, viele derselben durchzulesen und darauf anzusehen, in welchem Geiste dieselben geschrieben sind. Bei weitem die größere Menge würde den heutigen Ansprüchen nicht genügen; ohne auf die Kernfrage einzugehen, sucht sie gut oder schlecht das Thema in der Form einer Predigt mit der obligaten Dreitheilung zu behandeln; man merkt auch vielen die saure


|
Seite 243 |




|
Arbeit an, die an solche wissenschaftliche Lösung von Principien=Fragen entweder nicht mehr gewöhnt oder niemals derselben gewachsen gewesen ist. Manche sind aber auch darunter, die recht tüchtig sind, und namentlich kann man hier an den jüngeren Kräften die neue Schulung wahrnehmen. Die Zeit, wo das Studiren Nebensache war und das Predigen Hauptsache, war Dank dem Einfluß Döderleins vorüber; es wurde Keiner mehr zum Examen zugelassen, der nicht wenigstens sein Triennium absolvirt hatte und ein Attest über seinen Fleiß und seine Qualification von der Universität beibrachte; an ein unverdientes Durchschlüpfen war unter den damaligen Superintendenten nicht zu denken. Was mir aber besonders aufgefallen ist: die Zahl der pietistischen Hauch verrathenden Predigten ist zwar nicht gering, aber es ist der Pietismus, der ins orthodoxe Lager übergegangen ist; die Kunstausdrücke finden sich wohl noch, auch wohl noch der eigenartige Stil, aber von den bösen Auswüchsen bemerkt man nur selten mehr Etwas. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, darauf zu achten, wenn der Nicht=Meklenburger in der Sprache sich verrieth, und habe zu meinem Verwundern die Zahl nur gering gefunden, so daß bis auf weitern glaubwürdigen Beweis die Zahl der von auswärts berufenen Prediger mir durch den Haß der Nachzeit um Vieles vergrößert erscheint. Es ist mir bekannt, daß der Herzog in verantwortungsvolle Stellen, besonders auch in die Präposituren, gern Sachsen aus der Haller Schule einsetzte; so weit ich aber sehe, fanden seit etwa dem Jahre 1770 nur in seltenen Fällen mehr Berufungen von auswärts statt. Und ist das nicht erklärlich? Seitdem die zukünftigen meklenburgischen Theologen sich gebunden sahen, Döderleins Schüler in Bützow zu sein, drang der vom Herzog begünstigte Geist der pietistischen Orthodoxie auch in Meklenburg durch, und das Suchen auswärtiger Kräfte hörte nach und nach ganz auf.
Der Gesammteindruck aber, den die Predigten machen, ist der einer stillen Zeit, welcher jede Kampfeslust gegen das persönliche Kirchenregiment des Herzogs abging. Darum war aber dieser Friede kein ehrlicher, im Gegentheil, wir stoßen überall bei der gesammten meklenburgischen Geistlichkeit auf eine passive Opposition, und von einem Siege des Pietismus, von dem man so bedingungslos zu sprechen pflegt, kann erst recht keine Rede sein. "Wir müssen froh sein", schreibt einmal Keßler in seinem Berichte, "wenn wir wissenschaftlichen Sinn und ehrbares Leben bei allen Predigern finden; von der Bekehrung (er meint die pietistische) wollen sie nichts wissen." So bedauert auch Zachariä, daß die Prediger in


|
Seite 244 |




|
seinem Sprengel einen wahren Abschrecken vor dem Pietismus haben und darin von ihren Präpositis bestärkt werden. Es sei nichts auszurichten. Der Herzog aber strebte bis an sein Lebensende darnach, diese Opposition zu unterdrücken. Noch am 26. Februar 1784 befahl er den Superintendenten, alle Quartale über jeden Prediger an ihn persönlich zu berichten; und als dieselben aufs Neue das rein Unmögliche der Forderung geltend machten, verordnete er: das Consistorium habe hinfort alle Quartale von jedem Superintendenten über die Prediger seines Sprengels Bericht einzufordern und denselben immediate originaliter einzusenden. "Denn es kann Uns bei Unserm Oberbischöflichen Amt und Würde nicht gleich viel sein, unbekannt mit den sämmtlichen Lehrern Unsres Landes zu sein, indem Wir dereinst Rechenschaft geben sollen, wie Wir hienieden auf Erden die Kirche Christi gebaut haben." Dem Befehl des Consistoriums gehorchten zwar die Superintendenten; aber die von ihnen eingesandten Berichte enthielten, abgesehen von einzelnen Klagen über den anstößigen Lebenswandel einzelner Geistlichen, nur die kurze Angabe, "daß Besonderes nicht zu melden sei." Auf den theologischen Standpunkt der Prediger ging keiner ein.
Wir müssen also sagen: der Versuch des Herzogs, durch die Synoden einen besonderen Druck auf die Präpositi, und durch diese wiederum auf die Geistlichen auszuüben, war ebenso gescheitert wie der frühere, die Superintendenten für ein gewaltsames Vorgehen zu gewinnen. Aber dennoch gereichte die Wiederbelebung der Synoden dem Lande zu großem Segen, nicht so sehr durch die Nöthigung der Prediger, ihrem Berufe allseitig zu genügen, als durch die Herbeiführung eines engeren Bandes unter den Geistlichen: sie hatten Gelegenheit sich persönlich kennen zu lernen und über alle wichtigen, die Zeit bewegenden Fragen sich auszusprechen. Daß zugleich aber durch diese Synoden die Widerstandskraft der vereinigten Geistlichkeit gegen alle Versuche, wider ihr Gewissen sie zu zwingen, gestärkt wurde, wer wollte das verkennen oder leugnen?
Nun liegt uns aber am Schluß dieses Capitels die Beantwortung einer Frage ob, auf welche viel ankommt. Was wollte der Herzog, was wollte sein Vertrauter Rath Döderlein? Die Prediger zwingen, daß sie zum Halleschen Pietismus sich bekehrten? Das wäre unverständig gewesen und ungerecht, und beide waren davon auch weit entfernt. Oder dieselben sonst von der Orthodoxie abbringen? Auch das nicht; sagte doch Döderlein selbst einmal, das er sich bewußt wäre, in keinem einzigen Punkte von der Orthodoxie abzuweichen, und der Herzog forderte als Erstes von


|
Seite 245 |




|
seinen Predigern die unbedingte Anerkennung des in den symbolischen Büchern aufgestellten Lehrsystems. Nicht in diesem Dogmatischen lag der Schwerpunkt, sondern in der verschiedenen Auffassung der s. g. Mitteldinge. Denn mochte die Orthodoxie das Bekenntniß aus der reinen Lehre, also das Polemische, als das Erste betonen, der Hallesche Pietismus dagegen das christlich=kirchliche Leben voranstellen, so waren doch beide in dem einen Endzweck, die Sünder zur Buße zu reizen, einig. Aber eben in der Methode unterschieden sich beide; jene suchten das Heil in der Weltflucht, in einem seligen Schwelgen in Gottes Liebe, das seines Gnadenstandes durch die einmal erfolgte Bekehrung sich gewiß ist, diese in einer die weltliche Luft täglich überwindenden und täglich sich erneuernden Gnadenwirkung des Heiligen Geistes: dort ein Finden und Gefundenhaben, hier ein Suchen und Sichfindenlassen. In diesen den ganzen Christenstand verschieden auffassenden Gegensätzen bewegte sich der Streit hüben und drüben: während die Orthodoxen den Pietisten vorwarfen, daß sie durch ihre Lehre den Christen zur Täuschung über seinen Gnadenstand verführten, schalten die Pietisten auf die Orthodoxen als unfertige, unbekehrte Christen, die des Muthes zum rechten Gottesdienste entbehrten und lieber über das Wort Gottes zankten, als in dem Worte Gottes lebten. Der Herzog stand in diesem Streit entschieden auf der Seite der Pietisten, das Volk dagegen auf der Seite der Orthodoxen, nicht um ihrer Orthodoxie willen, sondern weil sie Meklenburger waren, während die "Pietisten" meist Fremde waren.
V. Die Prediger und die Gemeinden.
Der erbitterte Kampf der Ritterschaft Meklenburgs gegen den Absolutismus des Herzogs Karl Leopold hatte mit der Niederlage des Fürsten geendigt; der Adel war im Besitz all seiner Vorzüge und Privilegien geblieben. Wie sein Vater Christian Ludwig, so hütete sich auch der Herzog Friedrich, obgleich die ständische Beschränkung ihm persönlich verhaßt war, die leidenschaftliche Eifersucht der Ritterschaft zu verletzen, und verzichtete lieber, wo er durch gütliche Verhandlungen auf dem Boden des bestehenden Rechts oder der Gewohnheiten nicht durchdringen konnte, auf die Erreichung der Wünsche, als daß er es auf Processe vor Kaiser und Reich ankommen ließ. Durch diese scheinbare Nachgiebigkeit, die im Unterhandeln nicht müde wurde, erreichte der Herzog in den meisten Fällen wenigstens den besten Theil seines Wünschens.


|
Seite 246 |




|
Es fehlte allerdings nicht an Conflicten, in denen der Engere Ausschuß der Ritter= und Landschaft dem Herzog das Recht dieser oder jener eigenmächtigen Neuerung in Kirchensachen bestritt, unter Anziehung des L. G. G. E. V. von 1755, daß die Stände in allen die Wohlfahrt des Landes betreffenden Kirchensachen gehört werden sollten; aber es waren doch fast immer nur Bitten und Vorstellungen, in denen jede Antastung des oberbischöflichen Rechtes des Landesherrn ängstlich vermieden wurde. Denn darin ließ der Herzog sich seinen Buchstaben streichen, und selbst auf Vorstellungen derart unterließ er nie mit einer gewissen Härte zu antworten. So blieb zwischen dem Fürsten und seiner Ritterschaft ein dauernd gutes Verhältniß bestehen; jener tastete nicht an die Patronatsrechte des Adels, ohne deshalb zu dulden, daß die Rechte der Geistlichen oder der Unterthanen gekränkt wurden, diese willfahrte, wenn auch nach der Gewohnheit widerstrebend, den gerechten Wünschen des Fürsten, ohne zu unterlassen, dem Herzog von Zeit zu Zeit ins Gedächtniß zu rufen, daß jeder Zwang vor Ordnung der Sache mit dem Landtag gegen den Erbvergleich sei. Als die Strelitzsche Regierung den Herrn v. Arenstorf wegen Vernachlässigung der Kirche zu Krümmel verklagte, genügte die Drohung des Herzogs, einen Prediger seiner Wahl dorthin setzen und das Patronatsrecht selbst ausüben zu wollen; als der Herzog im Jahre 1783 die Ritterschaft zwingen wollte, das neue Gesangbuch anzunehmen, wich er doch "vor dem trotzigen Hochmuth" der Ständeherren zurück. -
Im Allgemeinen waren die ritterschaftlichen Pfarren die wenigst gesuchten; denn wenn die Geistlichen auch rechtlich von dem Patron unabhängig, weder civiliter noch in delictis unter der Gerichtsbarkeit des Gutsherrn standen, so gab es doch unzählige Mittel, ihnen, wenn sie obstinat waren und anders handelten, als der Patron wünschte, das Leben sauer zu machen und die Freude des Amts zu verderben. Welche Verwirrung und Willkür damals noch herrschte, möge dies Eine beweisen: Als der Herzog im Jahre 1784 auch die ritterschaftlichen Prediger aufforderte, über ihr Einkommen möglichst genaue Angaben zu machen, waren mehrere darunter, welche nicht zu sagen wußten, was Hof= und was Pfarracker wäre, andere klagten, daß ihnen der Patron eigenmächtig um einen von ihm geliebten Preis den Acker weggenommen hätte; andere endlich erklärten geradezu, das sie ganz von der Gnade lebten, nachdem sie vergebens versucht hätten, in Processen ihr Recht zu beweisen. Die Zahl der ritterschaftlichen Pfarren war aber keine unbedeutende: in der Bukower Präpositur waren es 5,


|
Seite 247 |




|
in der Doberaner 0, in der Grevesmühlener 7, in der Lübower 2, in der Meklenburger 4, in der Rehnaer 5, in der Sternberger 6, in der Parchimer 0, in der Crivitzer 7, in der Grabower 2, in der Hagenower 3, in der Lübzer 3, in der Neustädter 1, in der Warener 2, in der Wittenburger 6, in der Güstrower 0, in der Goldberger 1, in der Lüssower 3, in der Malchiner 24, in der Penzliner 11, in der Plauer 7, in der Röbeler 11, in der Teterower 5, in der Boizenburger 1, in der Darguner 2, in der Gnoiener 8, in der Ribnitzer 3, in der Schwaner 0, im Schweriner Cirkel 0, in dem Bützower 1, im Ganzen: 130.
Die Lage der Bauern in der Ritterschaft war die Leibeigener; zu Grund und Boden gehörig, seufzten sie unter schwerer Arbeit und dankten Gott, wenn er ihnen einen gnädigen Herrn gegeben hatte. Rohheit der Sitten und tiefste Finsterniß des Unglaubens und Aberglaubens waren die natürliche Folge des traurigen Looses. War auch der Kirchenbesuch durchweg gut zu nennen, so täuschte sich doch sein Prediger über das Vergebliche seiner Arbeit an diesen Seelen. "Der Bauer hat seine eigne Religion", klagt einmal ein Prediger, "er nickt zu Allem, was wir ihm sagen, mit dem Kopfe, aber im Herzen lacht der Teufel." Und ein anderer: "Alles Locken und Rufen zu wahrer Ergötzung ist hier umsonst; das Fressen und Saufen, Spielen und Tanzen ist des Bauern einzige Lust." Dennoch arbeitete der Herzog unermüdlich darauf hin, auch in der Ritterschaft "dem armen Manne" zu helfen, indem er nicht allein die Prediger antrieb, ohne Unterlaß "durch Liebe und eindringliche Ermahnung" auf die Herzen einzuwirken, sondern auch die, wir müssen es leider bekennen, widerstrebende Ritterschaft ermahnte, dafür zu sorgen, daß die greulichen Unsitten und Laster aufhörten, vornehmlich aber, daß die Sonntagsarbeit der Bauern nicht geduldet würde; denn der Bauer müßte auch einen Tag haben, den er frei von Sorge und Arbeit Gott heiligen könnte. Wie geringes Verständniß aber die Ritterschaft für diese Bestrebungen ihres Landesfürsten hatte, zeigt die Abweisung des letzteren Wunsches: das Bestellen seines Ackers am Sonntag Nachmittag nach geendigtem Gottesdienst sei dem Arbeitsmann dienlicher als das Umherlungern, welches niemand ihm verbieten könnte. Da der Herzog bei seinem Willen beharrte, kam sie endlich so weit entgegen, daß Sonntags nur Noth= und Liebeswerke erlaubt, dem Tagelöhner und Einlieger aber nach der Predigt auch das häusliche Arbeiten nicht verwehrt sein sollte.
Obgleich das äußere Resultat der allerh. Bemühungen, durch gesetzliche Bestimmungen Ordnung und Wandlung zu schaffen, der


|
Seite 248 |




|
Ritterschaft gegenüber ein sehr geringes war, so dürfen wir doch den Segen im Stillen gewiß hoch anschlagen; denn dazu sind ja von Gott die Throne errichtet, daß der Geist der Wahrheit und Liebe von ihnen über das ganze Volk Ströme des Segens verbreite, und immer hat sich noch das gute Beispiel mächtiger erwiesen als des Gesetzes Strenge.
Landschaftliche Pfarren 1 ), d. h. Pfarren städtischen Patronats, waren nur noch die zu Rostock und Güstrow. Von Rostock besetzt wurde außerdem die Pfarrei zu Rövershagen, von Parchim die zu Gischow. Die Domkirche in Güstrow war herzoglich. Die übrigen Städte des Landes hatten auf das Patronat zu Gunsten der Herzoge verzichtet.
Auch in den Städten war das geistige Leben der Bürger nicht so, wie der Herzog es wünschte. Die Industrie lag überall gänzlich darnieder, und alle Versuche ihr aufzuhelfen waren vergeblich. Die Handwerker in den kleinen Oertern waren meist zugleich Ackerbauer, und in dieser unglücklichen Verbindung zweier Geschäfte kam keines zu seinem Rechte. Die Klage über die Vergnügungssucht und den zu der Einnahme in keinem Verhältniß stehenden Luxus der Kleinbürger war allgemein. Der Herzog hätte gern diese alten üblen Gewohnheiten beseitigt, aber die Bürger "raisonnirten gegen alle wohlgemeinten Vorschläge der Regierung"; so erschien ihnen auch die Aufhebung der Theater und das Verbot aller belustigenden Schaustellungen, "als durch welche die Bürger in ihrem Müssiggang nur bestärkt und zu unnützen Ausgaben veranlaßt würden", als eine unerträgliche Bevormundung. Der Kirchenbesuch war ziemlich regelmäßig, und das Verhältniß der Gemeinden zu den Predigern durchweg gut; aber das war nur so, weil es von Alters her so gewesen war: ein wirklich thätig=christliches Leben, wie es der Herzog wünschte, war nur in wenigen Gemeinden zu finden. Und daran vermochten auch die Geistlichen wenig zu ändern; sie waren froh, wenn der kleine Kreis der Frommen zu des Herrn Freude wuchs, und die große Menge ein ehrbares, zur Einkehr vorbereitendes Leben führte.
Anders aber stand es mit der großen Masse der ländlichen Bevölkerung in dem herzoglichen Domanium, den Aemtern und incamecirten Gütern. Hier herrschte der Fürst nach seiner Willkür. Die brennende Frage jener Zeit war die Berechtigung der Leibeigenschaft. Schon Karl Leopold, und wir wollen ihm das nicht


|
Seite 249 |




|
vergessen, hatte im Jahre 1715 erklärt: die Leibeigenschaft sei der Fluch des Landes, und er wolle dieselbe aufheben, auch alle vermögenden und geschickten Bauern zur Erbpacht einladen, um ihnen statt des beschwerlichen Frohndienstes die Freiheit zu geben. Indessen bei dem guten Willen war es geblieben, und Dank hatte der Fürst damit nicht geerntet. So war der Bauer Leibeigener geblieben und blieb es noch lange, obwohl viele Einsichtige dagegen ihre Stimme erhoben. Die Folge davon war, daß die Landwirtschaft sich nicht heben wollte, viele Felder wüst lagen und das reiche Futter auf den Wiesen verdarb. Denn es fehlte an Arbeitern überhaupt, und die Arbeiter, welche da waren, lebten stumpf und dumm dahin, nur dem Zwange gehorchend. Sie hätten es besser haben können, wenn sie ihr Interesse verstanden hätten; denn das ihnen angewiesene Bauernfeld war groß genug, um alle vor Hunger und Elend zu schützen. Aber mit großer Hartnäckigkeit hielten sie fest an der verderblichen Communion, innerhalb deren der eine durch den andern gebunden war; mochte der Acker naß sein, er mußte bestellt werden, wenn der Nachbar den seinigen bestellte; wenn der Nachbar die Saat zu schneiden begann, so mußte sein Nachbar auch schneiden, mochte die Saat reif oder unreif sein. Niemand gönnte dem andern, sein Vieh zuerst hinauszutreiben, obgleich die Wiesen dadurch gänzlich verdorben wurden. So waren die Bauern an ihrem Elend zum großen Theile selbst schuld. Indessen die Verdienste des Herzogs um die Beseitigung dieses Uebelstandes gehören nicht hierher.
Innerhalb der Dorfcommunion aber lag der Priesteracker, und seine Bestellung war Sache des Predigers. Es ist mir unbegreiflich, warum die Regierung den vielen Vorstellungen der Pastoren, daß alle Arbeit verloren sei, so lange jene Communion bestände, kein Ohr lieh und lieber dem unverständigen Verlangen der Prediger nach Abgabe des ganzen Ackers willfahrte. Es gab doch einsichtige Leute genug, welche die große Gefahr der Vererbpachtung des Pfarrlandes auf ewige Zeiten erkannten und voraussagten, es würden "die Prediger bald seufzen und den Landesherrn um Brot bitten." Die Klage der Prediger, die Bestellung ihres Ackers bringe kaum die Kosten des damit verbundenen großen Haushalts auf, durfte meines Erachtens keinen Grund abgeben, die Pfarrländereien für ewige Zeiten den Kirchen abzunehmen; mochte dies auch für die Gegenwart als eine Wohlthat erscheinen, so mußte doch die Regierung einsichtig genug sein, auf den Unverstand der Prediger nicht einzugehen. Den Kirchen


|
Seite 250 |




|
in Meklenburg ist damit ein unberechenbares Vermögen entzogen worden.
Zu dem, was der Prediger aus der Bestellung seines Ackers oder der Pacht an Einkommen hatte, kamen noch hinzu die nicht geringen Hebungen an baarem Gelde, die gelieferten Hammel, Schweine, Korn, Heu, Holz, Hühner Eier, Würste, Käse u. s. w., nebst den Accidentien für geistliche Handlungen bei Taufen, Kirchgang, Confirmation, Beichte, Hochzeit, Leichen u. a. m., und diese Nebeneinnahmen waren oft so bedeutend, daß manche Prediger, die schlechte Landwirthe waren, davon mehr oder minder leben mußten.
Als der Herzog Friedrich die Regierung antrat, war die leibliche Noth, in welche die Geistlichkeit während der Wirren unter Karl Leopold gerathen war, noch sehr groß; der neue, sieben schreckliche Jahre dauernde Krieg brachte sie dem Verhungern nahe. Nur ein Beispiel statt vieler. Im Jahre 1759 sah sich der Herzog gezwungen, dem Lande eine neue Steuer aufzuerlegen. Da erklärten die Prediger der Hagenower Präpositur auf ihr Gewissen, "daß es ihnen ganz unmöglich wäre, die neue Steuer zu erschwingen; denn durch die Verschlechterung des Geldes verlören sie an jedem Thaler 10 Schillinge, ihre Wirthschaft trüge garnichts ein, ihr Vieh sei an der Pest gestorben, ihre Häuser würden von den preußischen Truppen mit Vorliebe belegt, die Gemeinden seien verarmt und in Folge davon die Accidentien sehr verringert; sie hätten kaum das trockene Brot, woher sie noch den zehnten Pfennig mehr Steuer nehmen sollten? Sie bäten daher flehentlich, da sie ja nicht unter einem barbarischen Scepter, sondern unter einem echten Freunde Gottes lebten, das ihnen diese Steuer erlassen würde." Der Herzog antwortete: er wisse Alles und kenne auch die Noth seiner Prediger, aber, "ob ihm auch das Herz blute", so könne er doch vor dem Lande, in welchem Alles litte, die Prediger nicht davon erlösen, mitzuleiden. Er werde, so bald der Krieg vorbei sei, ihrer Noth abhelfen.
Und er hielt sein fürstliches Wort; die Prediger hatten sich nicht zu beklagen. Sobald es die Lage der Cassen erlaubte, ersetzte er den einzelnen den erlittenen Schaden, schoß vor, wo kein Geld war, gab Korn zur Einsaat, lieferte Holz zu Neubauten oder Reparaturen, kurz, sorgte für jeden so, "daß er an seinem Landesherrn einen milden Vater zu haben verspürte." Als im Jahre 1784 jedem Prediger aufgegeben wurde, sein Einkommen genau zu fixiren, fanden sich nur wenige, die zu klagen gerechte Ursache hatten. Die meisten waren zufrieden, obgleich sie, wie die Kammer


|
Seite 251 |




|
urtheilte, durchgängig ihr Einkommen viel zu niedrig geschätzt hatten. Wenn daher die meklenburgische Geistlichkeit mit Vorliebe den Herzog "ihren Friedrich" nannte, so hatte sie dazu volle Berechtigung. Aber trotz aller äußersten Sparsamkeit, die von der Noth der Lage geboten war, betrug doch im Jahre 1783 das durch die Kriege, durch die Bauten von Kirchen und Pfarrhäusern hervorgerufene ungedeckte Schulddeficit der Kirche nach der Angabe der Prediger noch 13,000 Thlr., nach der genaueren Feststellung durch die Renterei aber mehr als 60,000 Thlr. Der Herzog wollte diese Schuld in der Weise tilgen, daß die reichen Kirchen den armen von ihrem Vermögen abgäben. Die Renterei aber schlug vor, die Licentgelder um den fünften Pfennig zu erhöhen, wodurch etwa 3000 Thlr. jährlich aufkommen würden. Diesen Vorschlag genehmigte der Herzog mit der Einschränkung, daß von dem einkommenden Gelde nur eine gewisse Quote an die armen Kirchen fließen, aus dem größeren Reste aber ein Fonds gesammelt werden sollte, der auch in der Zukunft den armen Patronatskirchen, welche unvermögend seien ihre Kirchen und Schulen zu erhalten, zu Gute kommen könnte. Er verbot aber, aus diesem Fonds Gelder zur Aufbesserung der Prediger=Salarien zu nehmen.
Indem der Herzog so der Noth der Kirchen und seiner Prediger im Domanium abhalf, meinte er dafür aber auch fordern zu dürfen, daß die Diener der Kirche ihre ganze Schuldigkeit in dem Aufbau des Reiches Gottes thäten. Ein Prediger, welcher sich mehr um seinen Leib als um die Seelen der Eingepfarrten kümmerte, dem an Streit und Zank mehr lag als an dem Werk der Liebe, durfte sich vom Herzog nichts Gutes versehen, er durfte gewiß sein, daß seine, auch gerechten Bitten keine Erhörung fanden. Bei allen Bittgesuchen der Prediger ließ der Herzog sich zunächst über das kirchliche Leben der Gemeinde von den Superintendenten berichten, und nach den Früchten richtete sich das Maß seiner Gnade.
Verfolgen wir nun aber im Einzelnen die herzoglichen Verordnungen!
Gleich beim Beginn seiner Regierung, am 6. August 1756, verwies er mit aller Schärfe den Predigern alles ungebührliche Schelten auf den Kanzeln, da ihr Amt allerdings die Bestrafung der Sünden von ihnen fordere, aber nicht mit beleidigender Bloßstellung des Sünders: in der Stille sollten sie den Verbrechern ihre Vergehen vorhalten, selbigen das Gewissen aufs Aeußerste schärfen, an ihrer Lebensbesserung unermüdlich arbeiten und, dafern diese nicht erfolgen sollte, sich Raths bei ihren Superintendenten erholen oder auch nach Befinden das böse Leben und Wandel dem


|
Seite 252 |




|
Fiscal zur weiteren Verfolgung anzeigen. Als ein Bauer sich beklagt hatte, daß sein Prediger ihn nicht zum Abendmahl zulassen wollte, schrieb der Herzog mit eigner Hand an den Rand des Consistorial=Berichts: "das Abendmahl vorenthalten bessert nicht, sondern verbittert; der Prediger soll durch eindringliche Mahnungen die Seelen wecken."
Am 22. October 1756 verbot der Herzog seinen Leibeigenen alles laute Lärmen bei Hochzeiten, Kindtaufen und andern Festen; selbst das Erntefest wurde beseitigt und den Leuten durch baares Geld ersetzt. Alle Spielleute wurden verbannt, und jede Ausübung dieser Kunst, womit "dem Reigen= und Tanz=Teufel gedient würde", mit der schwersten Strafe belegt. Im Jahre 1762 wurde das Hazardspielen allen Landeseinwohnern ohne Unterschied des Standes und Wesens verboten und dieses Verbot 1766 noch verschärft; indessen Frucht scheint es bei der damaligen Spielwuth wenig gehabt zu haben. Im Jahre 1769 beauftragte der Herzog das Consistorium, von den Predigern gewissenhafte Berichte einzufordern, wie weit sich das Leben besonders in den Domanialbezirken gebessert habe? Die Antwort lautete wenig erfreulich; die Meisten dienten nach wie vor den Werken des Fleisches, und vor Allem verhindere die Spiel= und Tanzwuth trotz der größten äußeren Noth die Umkehr. Einer schlägt sogar vor, man sollte, um endlich den Spielleuten das Handwerk zu legen, sie von der Kirche und dem ehrlichen Begräbniß ausschließen. Doch waren es nicht diese Sünden allein, welche den Predigern die Arbeit erschwerten; ich bin ganz außer Stande, alle den greulichen Aberglauben des blinden Heidenthums und Türkenglauben zu schildern, oder von den Unsitten auch nur ein annähernd treffendes Bild zu geben. Da saßen an den Sonntagen während des Gottesdienstes die Bauern in den Schenken und machten heillosen Lärm bei ihrem Fressen und Saufen; andere arbeiteten und wirthschafteten am Sonntag als schlimme Sabbathschänder; die Sonntage dienten besonders dazu, Hochzeiten. Taufen u. s. w. zu feiern. Hören wir den Bericht eines Predigers über den Kirchgang der Sechswöchnerinnen und jungen Frauen! "Am Sonntagmorgen finden sich oft 40 bis 50 Personen im Hause der Kirchgangsfrau ein und erhalten Frühstück, wobei sie sich rund und voll saufen. Auf dem Wege zur Kirche ist dann ein Geschrei und Gejuche, nicht anders als wenn ein Corps unbändiger Rekruten daher käme. Unter dem Hauptgesang kommen sie dann eine nach der andern in die Kirche und wählen zum Eingang die Thüre, die von dem Stuhl am weitesten entfernt ist, damit der Zug auch ja durch die Kirche


|
Seite 253 |




|
paradire. Nach geschlossener Predigt geht die Kirchgangsfrau aus ihrem Stuhl um den Altar herum, ihr folgen ihre Begleiterinnen, und die Priesterin und die Küsterin müssen diesen Gang mitmachen. Alle Umgehenden legen dann etwas Geld auf den Altar, das dem Priester zufließt, die Kirchfrau aber giebt dem Küster etwas. Während dessen lachen und sprechen die Leute und machen den Gottesdienst unmöglich. Alles dies ist aber eine günstige Gelegenheit für den Teufel, das Wort, das etwa in die Herzen der Zuhörer gefallen ist, mit leichter Mühe wieder wegzunehmen. 1 )
Dieses traurige Ergebniß der Umfrage veranlaßte die Patent=Verordnung vom 30. December 1769, in welcher allen Domanial=Unterthanen und Hauswirthen verboten wird,
1) Verlöbnisse durch eine Mahlzeit zu feiern;
2) zu Hochzeiten mehr als 14 Personen einzuladen, dieselben über einen Tag hinauszudehnen, mehr als 3 Gerichte und 1 Tonne Bier vorzusetzen;
3) zu den Kindtaufen Andere als die Gevattern und leiblichen Geschwister einzuladen;
4) bei Begräbnissen zu essen zu geben und mehr als höchstens 1/2 Tonne Bier aufzulegen;
5) Spielleute, sei es unter welchem Vorwande immer, herbeizuholen;
6) Pfingst=, Fastnachts= oder andere Gilden zu halten,
7) Wettel=Bier aufzulegen,
8) Ernte=Bier zu reichen.
9) Aber auch allen im Domanium wohnenden freien Leuten soll bei 10 Gulden Strafe untersagt sein, bei irgend welchen fröhlichen Zusammenkünften Musik zu nehmen oder Musikanten herbeizuholen.
Diese Verfügung sollte fortan jährlich an dem kurz vor der Ernte einfallenden Buß= und Bettage von den Kanzeln verlesen und die Gemeinde mit allem Ernst gemahnt werden, daß es Serenissimi Wille sei, dem lästerlichen Leben und der Schwärmerei ein Ende zu machen.
Nicht alle Prediger waren mit dieser Strenge einverstanden; sie meinten, daß das plötzliche Eingreifen in alte Gewohnheiten


|
Seite 254 |




|
mißlich wäre und die Gemeinden gegen den Prediger aufbrächte; es stecke hinter dem Bösen doch oft ein guter Kern, den man erhalten müsse.
Im Ganzen wirkte auch diese Verordnung wohl nicht allzu viel. Denn im Jahre 1780 mußte der Herzog von Neuem einschreiten und das Saufen, Tanzen, Spielen und Musikmachen, sowie die Hochzeits= und Kindtaufsgastereien verbieten und mit dem strengen Eingreifen der Obrigkeit drohen.
Dem Uebel mußte auf andere Weise gesteuert werden. Denn was half es, die Sonntagsheiligung äußerlich zu erzwingen, wenn das Leben selbst nicht geheiligt war? Was nützte es, Verbote zu erlassen, deren Geist dem Herkommen und den Gewohnheiten des Volkes widersprachen, so lange die Hoffnung nicht da war, daß an dem Gebot die Sünde sich erkannte? Wird doch jegliches Gesetz erst durch den Geist lebendig! Dies erkannte auch der Herzog gar wohl und ließ es sich darum vor Allem angelegen sein, die Erziehung und den fleißigen Unterricht der Jugend in dem Wort Gottes zu fördern; wir müssen diesem, vielleicht dem größten Verdienst desselben, ein eignes Capitel widmen. Mit dem Schulunterricht in enger Verbindung stand die 1759 befohlene allgemeine Wiedereinführung der beinahe überall außer Brauch gekommenen öffentlichen Confirmation und die Verordnung, daß dem Landvolk alle Sonntag=Nachmittage statt der Predigt der Catechismus ausgelegt und die Jugend im ersten Jahre nach der Gonfirmation noch gezwungen werden sollte, an dieser Katechese theilzunehmen. Aber auch in den regelmäßigen Gottesdienst waren viele Mißbräuche eingedrungen, die der Wirkung des H. Geistes schadeten; besonders waren es die langen ermüdenden Predigten und das endlose Singen aus dem Gesangbuch. Darum bestimmte der Herzog 1780, daß die Predigt während des Winters nicht länger als 3/4 Stunden dauern solle. Bei der Frühpredigt sei es genug, ein Morgenlied und ein Hauptlied zu singen; im Hauptgottesdienst solle nicht mehr gesungen werden als zu Anfang "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", in der Mitte das Hauptlied und der Glaube, und am Schluß einige Verse. Beim Nachmittagsdienst solle nur zweimal, am Anfang und am Schluß, gesungen werden. Statt der langen Kirchenmusiken, die ohnehin dem mehrsten Theil der Zuhörer unverständlich seien, möge allenfalls bloß das Hauptlied musikalisch angestimmt werden. - Ferner: Das Evangelium solle künftig nicht doppelt, wie bisher, einmal vor dem Altar und das zweite Mal von der Kanzel, sondern bloß von der Kanzel, wenn nämlich über das Evangelium gepredigt


|
Seite 255 |




|
wird, sonst aber bloß vom Altar verlesen werden. Auch sollte hinfort nicht stets über die Evangelien und Episteln, sondern auf dem Lande wechselsweise ein Jahr über das Evangelium und das andere Jahr über die Episteln, in den Städten aber, besonders den größeren, abwechselnd auch über ganze biblische Bücher des Neuen Testaments ein Jahr lang gepredigt werden, ausgenommen an den hohen Festen, an welchen der Prediger solche Texte wählen könne und möge, die sich zu dem Feste, das gefeiert wird, vorzüglich schickten."
Wie viel aber dem Herzog auch an der Beförderung des kirchlichen Lebens in den Gemeinden gelegen war, und obschon alle Anstalten, die er traf, darauf gerichtet waren, die Hindernisse der Bekehrung zu beseitigen, so übersah er doch nicht, daß das Beten erst in der Arbeit seinen vollen Segen zeigt. Wenn er selbst das unablässige Gebet als eine Kraft ansah, die Berge versetzte, so blieb ihm doch das Gebet immer auch die Quelle, aus welcher reicher Segen für alle Arbeit erwüchse: seiner thätigen Natur war nichts mehr zuwider als Müssiggang, und für Alles, was mönchisch war oder scheinen wollte, hatte er nur ein Wort der Verachtung. Für die praktische Denkweise des Herzogs legt ein schönes Zeugniß die Motivirung seiner VO. ab, durch welche die Aposteltage, die dritten Feiertage zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das Fest der drei Könige, die Marienfeste, die Johannis= und Michaelistage als kirchliche Festtage beseitigt wurden (25. Juni 1774): "In Anbetracht, das an vielen Feiertagen die Gotteshäuser fast von niemandem besucht, hingegen allerhand Unordnungen und Müssiggang in den Wirthshäusern betrieben werden, wollen Wir u. s. w. und befehlen sämmtlichen Amts=, Guts= und Stadtobrigkeiten, mit Nachdruck darauf zu halten, daß die Tage, deren Feier nun eingehet, nicht zum Müssiggang angewandt werden." Und in den Verhandlungen mit dem Landtage wegen der Beseitigung dieser ganz unnützen Festtage hatte er sich auf Luthers Wort berufen, "daß es genug sei, den siebenten Tag zu heiligen, sintemalen der Wohlstand und das Gedeihen des Landes den Fleiß der Unterthanen erforderten." So könnte ich noch eine Reihe von segensvollen Anordnungen des Herzogs Friedrich in Kirchen=Sachen aufzählen; aber die genannten reichen aus für den Beweis, daß dem Fürsten mit Kopfhängern garnicht gedient war. (Vgl. übrigens Siggelkow's Handbuch, bes. §§. 190 bis 201.)
So war der Herzog mit allem Eifer darauf bedacht, durch bessere Prediger und Abstellung der vielen Uebelstände den kirchlichen Gottesdienst wieder zu Ehren zu bringen. Und wenn man


|
Seite 256 |




|
liest, wie im Beginn der Regierungszeit des Herzogs die Kanzeln in schimpflichster Weise nicht allein zu leidenschaftlichen Wuthausbrüchen, sondern auch zu weltlichen Dingen, besonders öffentlichen Verkündigungen, wie Auctionen u. dgl., mißbraucht wurden, wie nur die Geduld und liebe Gewohnheit die langen Predigten und das endlose Singen ertrug; und wiederum, wie Alles bei der neuen, in 30 Jahren herangewachsenen Generation anders war: gebildete, friedfertige Prediger, geordneter Gottesdienst, in Gottes Wort wohlunterrichtete Gemeinden, - so möchte dieser Hinweis allein genügen, das Andenken an den trefflichen Fürsten, den frommen Herzog Friedrich, zu segnen. Ohne diesen der Kirche und ihrer Wirksamkeit gegebenen festen Grund würde, dessen bin ich trotz aller Widerrede überzeugt, die nachfolgende Zeit der Feindschaft den vollen Sieg davongetragen haben; es würde nicht möglich gewesen sein, unsere Landeskirche so rasch zu ihrer jetzigen festen Organisation zurückzuführen.
VI. DasVerhalten des Herzogs Friedrich gegen Andersgläubige.
A. Die Reformirten.
Die reformirte Gemeinde in Meklenburg verdankt ihren Ursprung den aus Frankreich vertriebenen Protestanten, welche im Jahre 1698 vom Herzog Friedrich Wilhelm die Erlaubniß erhalten hatten, in der durch Krieg und Feuer verödeten Stadt Bützow sich niederzulassen und eine besondere Gemeinde unter dem Schutz des Herzogs zu bilden. Die Zahl derselben war gering, nur nahezu 100 Seelen; aber ihre Kunst in der neuen französischen Manufactur schien dem verarmten Lande eine Quelle des Reichthums zu verheißen. Diese Hoffnung schlug nun allerdings gänzlich fehl, denn trotz der energischen landesherrlichen Hülfe und Unterstützung wollte die Manufactur nicht zur Blüthe gelangen; die verheerende Feuersbrunst von 1713 zerstörte die letzten Aussichten. Obgleich so das arme Land nur um eine arme Gemeinde bereichert war, genoß dieselbe doch die unveränderte Gunst des Hofes, und zumal der reformirten Herzogin Sophie Charlotte (von Hessen=Cassel); denn es waren fleißige Leute, die niemand zur Last fielen. Nach dem Tode ihres Gemahls nahm die Herzogin=Wittwe sogar ihren Wohnsitz unter ihnen und förderte das Wohl derselben nach ihren Kräften. Dennoch war diese Uebersiedelung der Herzogin kein Glück für die Gemeinde; denn da sie ihren


|
Seite 257 |




|
eignen Prediger mitbrachte, so zerspaltete sich die kleine Zahl bald in zwei getrennte Gemeinden, die französische und die deutsche, die nicht ohne Neid einander gegenüberstanden.
Bei den vielen Besuchen, welche der Erbprinz Friedrich der geliebten Tante in Bützow abstattete, hatte derselbe wohl Veranlassung genommen, das Leben der kleinen Colonie genauer kennen zu lernen; und es war daher natürlich, daß derselbe, zur Regierung berufen, die innige Zuneigung, welche er seiner 1749 verstorbenen Tante bewahrte, auf die reformirte Gemeinde übertrug. Ich führe des Herzogs besonderes Interesse für Bützow, welches er 1760 zum Musensitz erhob, auch auf dieses Verhältniß zu seiner Tante zurück. Als im Jahre 1760 die bisher von den Reformirten benutzte Schloßkirche in Bützow für das neubegründete Pädagogium nicht zu entbehren war, wies der Herzog als vorläufigen Ersatz einen Saal an und erlaubte daneben nicht allein den Bau einer neuen Kirche, sondern förderte denselben auch durch einen namhaften Beitrag zu der von dem Prediger der deutschen Gemeinde, Finmann, ins Werk gesetzten Collecte. 1 ) Auch die Prinzessin Amalie, die jüngste Schwester des Herzogs, begünstigte, soviel sie konnte, die Reformirten; so ließ sie alle Monat einmal Finmann von Bützow nach Schwerin kommen, um für die wenigen reformirten Familien daselbst Gottesdienst zu halten. Die größte Wohlthat aber war die im Jahre 1778 vollzogene Verschmelzung der französischen und der deutschen Gemeinde. Denn als das Ableben des französischen Predigers, Jean de Convenant, der übrigens ein streitsüchtiger Mann war, höchsten Orts gemeldet worden, ließ der Herzog feststellen, wie viele Seelen in ganz Meklenburg noch zu dessen Gemeinde zu zählen seien; und da fand sich, daß nicht Einer mehr der deutschen Sprache "ohnmächtig" war. In Folge dessen wurde der Wittwe des Verstorbenen ein Gnadengeld von 100 Thlrn. auf Lebenszeit bewilligt, der Rest des Gehalts aber dem andern Prediger zugelegt. Seitdem gab es, wie auch heute noch, nur eine reformirte Gemeinde in Meklenburg mehr.
Indessen dieses Wohlwollen des Herzogs Friedrich gegen die Reformirten bezog sich nicht auf ihre Lehre, die er nur geduldet wissen wollte. Mit Eifer wachte er darüber, daß mit derselben keine Propaganda auf Kosten der Landeskirche getrieben würde. Solche Versuche kamen allerdings vereinzelt vor, aber im Ganzen waren die Reformirten sehr friedfertig und gaben dem


|
Seite 258 |




|
Herzog, dessen Gnade sie so viel verdankten, zu ernsterem Einschreiten niemals Veranlassung. Der Prediger Finmann stand sogar bei Hofe in nicht gewöhnlicher Gunst; der Herzog unterhielt sich gern mit dem wissenschaftlich ebenso hochgebildeten, als weltklugen Manne. Die niederträchtige Anklage, daß er von den Collectengeldern etwas unterschlagen habe, endete mit der Blame seiner Gegner, die ihn gern entfernt hätten. -
B. Die Katholiken.
Wie die Reformirten, so bildeten auch die Katholiken in Meklenburg nur eine kleine geduldete Gemeinde, deren Gottesdienst auf die Stadt Schwerin beschränkt war. Ihren Anfang hatte dieselbe genommen im Jahre 1663, als der zum Katholicismus sich bekennende Herzog Christian Louis die Abhaltung einer regelmäßigen Messe in der Schweriner Schloßkirche anordnete. Sechs Wochen nach seinem Absterben, im Jahre 1692, hörte diese Messe seiner letztwilligen Bestimmung gemäß wieder auf: aber die bei Hofe viel geltende Ober=Hofmeisterin von Bibow, welche eine geborene Französin [Mlle. de Beau] und mit der katholischen Herzogin Isabelle Angélique ins Land gekommen war, erwirkte vom Herzog Friedrich Wilhelm die Erlaubniß, daß sie mit den andern Katholiken, so lange sie lebte, in einem über ihrem Pferdestall belegenen Saale den Gottesdienst fortsetzen durfte. Als sie 1725 starb, war die Gemeinde bereits so gewachsen, daß sie es nicht mehr nöthig erachtete, aufs Neue um Erlaubniß zu bitten. Bei dem Herzog Karl Leopold stand sie sogar in besonderer Gunst, wenn sie auch zeitweise von seinen Launen zu leiden hatte. Anders bei Herzog Friedrich. Er war ein zu gut lutherischer Christ, um den Katholiken weiter, als es seine landesherrliche Pflicht erforderte, wohlzuwollen. Dennoch, meine ich, hatten sich jene nicht zu beklagen: der gerechte Sinn des Fürsten erlaubte ihm keine ungerechte Bedrückung, und sein frommes Herz freute sich, so oft es, und wenn's auch in fremdem Glauben geschah, wahre Gottesfurcht spürte. So wuchs auch unter seinem Regiment die Zahl der Katholiken verhältnißmäßig rasch, im Jahre 1775 wurden 500 Seelen gezählt; aus dem elenden Futterboden war eine kleine Kirche mit Altar, Kanzel und Orgel geworden; selbst eine kleine Glocke fehlte nicht. Aber die wiederholt nachgesuchte Erlaubniß einen Thurm mit rechten Glocken bauen zu dürfen, wurde nicht gegeben. Als Priester fungirten zwei Jesuiten=Patres, Frings und Dechêne, die


|
Seite 259 |




|
auch eine Schule von etwa 12 Zöglingen unterhielten. Im Ganzen war aber die Gemeinde arm.
Es ist ganz bezeichnend für des Herzogs kirchlichen Standpunkt, daß, während er die Sektirer und Neuerer in seinem Lande nicht dulden wollte, weil ihre offenen oder versteckten Angriffe auf die heiligsten Güter der Christenheit ihm unleidlich erschienen, er dagegen den Gottesdienst der Katholiken persönlich gern im ganzen Lande freigegeben hätte, wenn es die Verhältnisse erlaubt hätten. Denn er urtheilte, daß nur die menschliche Schwäche oder Sünde an dem Mangel der reinen Erkenntniß schuld sei und die Vereinigung Aller zu einer Kirche verhindere; wer nur die eine Wahrheit in Christo mit ihm suchte, war ihm als Christ willkommen, vorausgesetzt daß dabei die landeskirchlichen Rechte ungeschmälert blieben. An dem Herzog lag es daher nicht, daß im Jahre 1765 die Bitte der Katholiken um freie Religionsübung im ganzen Lande Meklenburg abgeschlagen wurde, sondern seine Räthe waren es, die aufs Entschiedenste sich dagegen erklärten, indem sie darauf hinwiesen, daß die ganze evangelische Kirche gerechten Anstoß daran nehmen würde, wenn der Herzog gegen die Tradition seines Hauses dem Katholicismus eine Freistätte in Seinem Lande bereitete; dazu würde auch unvermeidlich die ertheilte Erlaubniß eine sehr ernste Collision mit den Landständen herbeiführen, die eine so tiefgreifende einseitige Aenderung des bestehenden Rechts (s. Reversalen v. 1621) niemals zugeben könnten, um so mehr, als die dem Bischofe von Hildesheim gehorchenden Patres sich niemals als friedfertig bewiesen hätten. Dieser eindringlichen Vorstellung der Gefahr gab der Herzog nach und schlug die Bitte der katholischen Gemeinde rundweg ab.
Und allerdings - die katholischen Patres hielten sich nicht darnach, daß der Herzog großes Vertrauen zu ihrer Friedfertigkeit hätte haben können. Die Irrungen nahmen beinahe kein Ende. Um von minder wichtigen Versuchen derselben, das bestehende Recht zu ihren Gunsten zu durchbrechen, nicht zu reden, so erhoben sie 1764 den Anspruch, bei Trauungen von Katholiken und Protestanten die kirchliche Einsegnung rechtsgültig vornehmen zu können. Der Herzog entschied am 31. August: nur, wenn beide Brautleute katholisch seien, sei die katholische Eheschließung statthaft, sonst nicht. Das sei alte Ordnung, und dabei müsse es bleiben.
Noch mehr kränkte es die Katholiken, daß der Herzog im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der Regierung, welche viel durch die Finger gesehen hatten, mit aller Strenge die alte Ver=


|
Seite 260 |




|
ordnung über die Taufe und Erziehung der Kinder aus Mischehen geltend machte. Die Bestimmung, daß solche Kinder, Knaben sowohl wie Mädchen, ohne Rücksicht auf die Wünsche der Eltern zur lutherischen Kirche gehören und alle damit im Widerspruch stehenden, vor der Ehe etwa abgegebenen Gelobungen, wie sie die katholische Kirche zu fordern pflegte, nicht allein null und nichtig, sondern auch strafbar sein sollten, erschien als unerträglicher Druck.
Ein für den Bestand der katholischen Gemeinde höchst gefährlicher Proceß wurde im Jahre 1773 dadurch veranlaßt, daß die beiden Patres, ohne die pflichtschuldige Dispensation vom Herzog nachgesucht zu haben zu einer zweiten Verlobung nach eigenmächtiger Aufhebung der ersten das placet ihrer Kirche gegeben und durch mancherlei Umstände den Verdacht erregt hatten, "als Missionarii die potestas delegata von ihrem Bischof sich beilegen zu lassen." Im höchsten Grade aufgebracht, beschloß der Herzog, bei einem Proceß es nicht bewenden, sondern die Gemeinde fühlen zu lassen, daß man nicht ungestraft die höchsten fürstlichen Rechte antaste. Sein nächster Gedanke war, die beiden Priester ohne Weiteres aus dem Lande zu jagen und die fernere Ausübung des katholischen Gottesdienstes überhaupt zu verbieten; die Beweise, daß er ein historisches Recht dazu hatte, waren bereits in seinen Händen. Indessen die Rücksicht auf die mehr als 500 Seelen, welche er damit aus seinem Lande vertrieben hätte, ließ ihn von dieser harten Maßregel abstehen; er begnügte sich, der Gemeinde zu verbieten, fortan noch Jesuiten als Priester zu halten, widrigenfalls ohne Barmherzigkeit die Gnade der Toleranz aufhören sollte. Den beiden Priestern ließ er aber den Proceß machen; sie sollten nach Abbüßung ihrer Strafe das Land meiden. Die Angeklagten waren klug genug, einzusehen, daß sie vor diesem Zorn des gereizten Fürsten in Allem klein beigeben müßten. Sie wiesen also mit Entrüstung jede böse Auslegung ihres Handelns von sich und erklärten sich zu aller Genugthuung und Buße nach dem Rechte bereit; sie brachten auch das Zeugniß des Bischofs von Hildesheim bei, daß nichts ferner liege, als ein Attentat auf die Rechte eines Fürsten, der sich allzeit als der beste Freund der katholischen Gemeinde gezeigt hätte. Dadurch milder gestimmt, übergab der Herzog die Untersuchung dem Regierungsfiscal Bouchholtz und nach deren Beendigung dem Rostocker Consistorium, auf dessen Anrathen die Acten an die juristische Facultät zu Kiel eingesandt wurden. Von dieser wurden beide schuldig befunden und der P. Frings zu 100 Thlr., der P. Dechêne zu 50 Thlr. und


|
Seite 261 |




|
beide zu gleichen Theilen in die Tragung der Kosten verurtheilt. Die Buße wurde am 26. Februar 1776 bezahlt.
Indessen waren bei der Untersuchung noch viele andere Ungehörigkeiten ans Licht gekommen. So hatte der Fiscal in dem Kirchenbuche gefunden, daß die Patres die evangelischen Geistlichen immer nur praedicatii titulirten, vielfach Proclamationen unterließen, heimlich Taufen und Trauungen bei gemischten Ehen wiederholten, auch nach wie vor sich Reverse bezüglich der katholischen Kindererziehung ausstellen ließen. Wenn es nach dem Sinne des Fiscals Bouchholtz gegangen wäre, so würde ein neuer, schlimmer Proceß daraus entstanden sein. Aber der Herzog verweigerte, obwohl die Hofprediger Martini und Fidler das Feuer nach Kräften schürten, zu der Verfolgung dieser Sache seine Einwilligung und erklärte sich mit der eingeforderten, allerdings mehr als nichtssagenden, Rechtfertigung der beiden Priester zufriedengestellt; er hoffte durch das eine Exempel der Strenge genug gethan zu haben.
Aber diese Erwartung schlug gänzlich fehl; vielmehr erhielten die Patres den Herzog immer an der äußersten Grenze der Geduld. Wahrhaftig, wäre der edle Fürst nicht so tolerant gewesen, wie er es war, es wäre den Katholiken, die doch rechtlich keinen Anspruch hatten geduldet zu sein, übel ergangen. Denn was sie wagten, bewies das Jahr 1784 von Neuem. Durch eine gelegentliche Notiz in der Schwerin'schen Zeitung vom 26. Juni 1784 wurde nämlich der Regierung bekannt, das der Rostocker Rath für den Gottesdienst der Katholiken ein eignes Zimmer im Rathhaus eingeräumt hatte und gegen die feierliche Beerdigung eines Katholischen unter Glockengeläute nicht eingeschritten war, obwohl beides gegen alles Recht war. Die Sache war eine höchst verwickelte. Denn wenn der Herzog auch unangefochten das jus circa sacra besaß, so war doch der Rath der Stadt auch in Kirchensachen immer so widerspenstig und selbstherrlich gewesen, daß ohne einen langen Proceß eine Erledigung des neuen Rechtsfalls nicht zu erwarten stand. In seinen jüngeren Jahren hätte der Herzog einen so eclatanten Rechtsbruch weder vom Rathe noch von den Priestern sich gefallen lassen; aber er war des ewigen Streitens mit der Stadt Rostock müde und überließ die Erledigung der Sache seinem Nachfolger auf dem Throne. -
Fassen wir das Resultat kurz zusammen, so sehen wir die katholische Kirche unter dem Schutze des Herzogs sich langsam, aber stetig weiter entwickeln: wir bemerken, wie der Herzog persönlich dem Wunsche der katholischen Kirche nach freier Religionsübung


|
Seite 262 |




|
nahe steht, denselben aber mit Rücksicht auf das Land abschlagen muß. In dem Streite über bisher versagte Rechte stellt sich der Herzog fest auf den Boden der bestehenden Rechtsordnung und wacht eifrig darüber, daß die Propaganda der katholischen Patres der Landeskirche zu keinem Schaden gereiche. Andererseits aber schirmt und stützt er die geduldete Gemeinde, so weit es nur angeht, und leidet nicht, daß Fidler und Genossen den Frieden derselben stören. Selbst die beiden Jesuitenpatres, welche nicht aufhören zu queruliren und zu intriguiren, und dadurch gelegentlich den höchsten Zorn ihres Fürsten reizen, nimmt er immer wieder zu Gnaden an; und als der alte P. Frings stirbt, ist es seine fürstlich=christliche Huld, die ein feierliches Begräbniß desselben anordnet.
So haben auch die Katholiken alle Ursache, das Andenken des Herzogs Friedrich als das eines gerechten, gnädigen Herrn in Ehren zu halten.
C. Die Sektirer.
Der klare Geist des Herzogs Friedrich war für phantastische Schwärmereien wenig zugänglich. Nach dem Zeugniß seines eignen Mundes und aller Zeitgenossen, die ihm näherzutreten das Glück hatten, war er ein gut lutherischer Christ, der treu zu Gottes Wort und Sacrament hielt und Alles, was von diesem Troste der Christen ableitete, gründlich haßte, mochte es einen Namen haben, welchen es wollte. Vor ihm machte es keinen Unterschied, ob einer seinen Abfall von der Kirche mit seiner "wissenschaftlichen Ueberzeugung" oder mit "Visionen" oder wie immer begründete; er nannte es Hochmuth und Trotz.
Und wie ihm jede Wissenschaft verwerflich erschien, welche, anstatt zu Gott zu führen, mit ihren Zweifeln die Herzen der Gläubigen beunruhige und den Unglauben der Menge stärke, so hielt er es auch für seine erste landesväterliche Pflicht, alle diese Angriffe auf die Religion wenigstens in seinem Lande nicht zu dulden. Gefährlicher aber noch erschien ihm alle geheime Sektirerei, die eben damals üppig wucherte.
In meinen Augen waren aber die dem Herzog so nahe stehenden Darguner Pietisten auch Sektirer, und zwar von der schlimmsten Art, um so gefährlicher, als sie selber rechtgläubig im Sinne Luthers zu sein behaupteten, und dabei die Entwickelung der lutherischen Lehre verurtheilten.


|
Seite 263 |




|
Es ist ein großes Verdienst, welches sich Herr Pastor Wilhelmi durch seine durchaus objectiv gehaltene Arbeit über die Entwickelung und theologische Bedeutung des Darguner Pietismus erworben hat; denn nun kann niemand, bei williger Anerkennung des Glaubenseifers "der fremden Prediger" und ihrer segensreichen Wirksamkeit in ihren Gemeinden, mehr eine hohe Meinung von denselben haben. In ihrem ersten Auftreten waren sie nicht viel besser als die ihnen nahe verwandten Herrnhuter: und als sie darnach im Streit über den methodischen Bußkampf die Verbindung lösten und die "Pest= und Schlangenbrut" mit dem ganzen Haß ihres Fanatismus verfolgten, blieben sie doch mit Zinzendorf und seiner Gemeinde in dem pietistischen Grundsatz von der Kirche in der Kirche einig. Aber dies ist noch nicht der schlimmste Vorwurf; den sehe ich vielmehr darin, daß sie erst den Boden Meklenburgs für das Wuchern des Unkrauts der Sektirerei bereiteten. Denn nachdem ihre Führer, Zachariä voran, von dem Rottenmachen sich abgewandt und ihren Frieden mit der Landeskirche gemacht hatten, blieben die Geister, welche sie wachgerufen hatten, lebendig; und diese, nicht vermögend den rechten Weg wiederzufinden, gingen, von ihren Führern verlassen, zu der Bekenntnißlosigkeit der mährischen Brüder über. Und wohl ihnen, wenn die Innigkeit des persönlichen Verhältnisses zum Heilande der feste Boden blieb, worauf sie dem Unglauben ihrer Zeit widerstanden! Aber leider endeten die meisten da, wo auch die nicht mit vollem Herzen zur Kirche zurückgekehrten Pietisten endeten, im Rationalismus oder völligen Atheismus. Besonders aber waren es die pietistisch "erweckten und bekehrten" Lehrer, welche sich Zinzendorf zuwandten und in und durch die Schulen Propaganda für dessen Lehre machten. Der Herzog war aber nicht gewillt diesem Treiben geduldig zuzusehen. Denn so sympathisch ihm die "brennende Liebe zum Heilande" war, so widerwärtig waren ihm die Extravaganzen der Brüdergemeinde, deren der Meister nicht hatte Meister werden können oder wollen. Die Herrnhuter sollten in seinem Lande keine Freistätte finden, auch nicht, wenn sie sich äußerlich zur Augsburgischen Confession bekannten, in ihrem Innern aber fortfuhren, sich für eine besonders begnadigte Gesellschaft in Jesu Christo außerhalb der allgemeinen Kirche zu halten. Wie genau der Herzog diese Bewegung auch außerhalb des Landes verfolgte, möge folgender Brief, ein Bericht über die Gemeinde der mährischen Brüder in Schleswig=Holstein beweisen. Der Consistorialrath Struensee in Rendsburg, auch sonst vielfach vom Herzog ins Vertrauen gezogen, schrieb am 16. Febr. 1775 an den Rentmeister Kychenthal:


|
Seite 264 |




|
"Daß Seine regierende Herzogliche Durchlaucht von Meklenburg=Schwerin sich meiner gnädig erinnern, solches erkenne ich mit tiefster Devotion. Ich freue mich von Herzen, daß ich Ihro Herzogl. Durchl. vor dem Throne des Lammes in ewiger Herrlichkeit nach vollendeter Pilgrimschaft erblicken werde. Da Höchstdieselben in huldreichster Herablassung von meinem Befinden und dem Zustand des Reiches Gottes, auch den Herrnhutern in diesem Lande, benachrichtigt sein wollen, so kann ich zum Preise Gottes melden: der Herr ist meines Angesichts Hilfe und mein Gott, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr schenkt mir Kräfte des Leibes und des Gemüths, daß ich meinem schweren Amte unermüdlich vorstehen kann. Dem Ziel meines mühseligen Hierseins sehe ich täglich mit Freuden entgegen, und seit einigen Jahren sind mir die Worte des Heilandes tief in die Seele gedrückt: "Ich will zu euch kommen und euch zu mir nehmen, daß ihr sein sollt, wo ich bin." In diesen Worten finde ich Alles, was ich von meinem Abschiede von der Welt und dem Zustande meiner Seele nach dem Tode zu wissen nöthig habe. Wenn mein Freund, mein Erlöser, mein Seligmacher, bei der Scheidung Leibes und der Seele seine nahe Gegenwart meinen Geist verspüren läßt, meine Seele in seine Liebesarme aufnimmt, und ich nur immer unzertrennlich bei ihm sein kann, so begehre ich weiter nichts. Denn ich habe in ihm Alles, und das unendliche Verlangen meines unsterblichen Geistes ist in ihm gesättigt und befriedigt.
"Was den Zustand des Reiches Gottes in den hiesigen Herzogthümern anbetrifft, so wird demselben nicht allein kein Hinderniß in den Weg gelegt, sondern es werden auch alle Anstalten zur Förderung desselben getroffen, und es ist der ausdrückliche Wille meines königlichen Herrn, daß die gesammten Einwohner zu einem rechtschaffenen Wesen des Christenthums geführt werden sollen. Mein tägliches Flehen zu Gott ist nur, daß er uns treue Arbeiter senden wolle.
"Die mährischen Brüder haben zwar im Amte Hadersleben einen Wohnungsort, den sie Christiansfeld nennen, und es ist ihnen freie Religionsübung verstattet worden; jedoch mit der Beschränkung, daß sie nur geduldet sein sollen. Im vorigen Jahre war ich bei ihnen und äußerte mein Bedenken wegen ihrer Lehren und Anstalten in Liebe und mit der Wahrheit. Sie erklärten mir, daß sie seit einigen Jahren von Herzen zum Augsburgischen Bekenntniß sich hielten und nichts mit den Ausschweifungen Zinzendorfs mehr zu thun hätten. Sie seien evangelisch=lutherisch, und


|
Seite 265 |




|
das mit innerer Ueberzeugung. Ich konnte also nichts thun, als sie in ihrem Glauben zu kräftigen und vor Irrlehren zu warnen. Die Folgezeit wird lehren, wie weit ihre Erklärung mit ihrem Verhalten übereinstimmt. In liturgicis sind sie verschieden von unserer Kirche, und ihr ritus paßt nicht für unsere Kirche; die Trennung ist betrübt. Ich hasse den Indifferentismus, aber feinde fremde Religionsverwandte nicht an, sondern halte es für meine Pflicht, in meinem Verhalten gegen alle Menschen Liebe und Wahrheit zu beweisen. Der Herr, unser Gott, kennt die Seinen. Die verschiedenen Einsichten zeugen von unserer Unvollkommenheit. In Christo Jesu gilt nichts als eine neue Creatur, und wie Viele nach der regula einhergehen, über die ist Friede. In Christo ist Wahrheit. Was den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Der Herr vermehre allzeit die Zahl seiner wahren Bekenner! Diese Sehnsucht ist ein Feuer in meiner Seele, welches Tag und Nacht brennt, und das Seufzen in mir erweckt: "Ach Vater, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe!" -
Auf den Herzog Friedrich hatte der Brief keine Einwirkung; dieser blieb dabei, daß die Lehre der Herrnhuter unterdrückt werden müsse. Er befahl den Predigern, auf die Lehrer ein scharfes Auge zu haben, auf die in den Gemeinden verbreiteten Bücher zu vigiliren und Alle, die zu der Lehre Zinzendorfs und seinesgleichen sich bekennten, dem Fiscal anzuzeigen. Auch auf den Synoden wurde viel über die "böse Irrlehre" geklagt und das Vorkommen derselben in allen Sprengeln des Landes constatirt. Selbst Prediger kamen deswegen in Untersuchung, zwei wurden, weil sie sich "zum Herrnhutianismus" bekannten, abgesetzt. So wurde die neue Lehre in Meklenburg verfolgt; dennoch that sie dem kirchlichen Leben im Volke vielen Schaden.
Auch an andern "Schwärmereien" fehlte es derzeit in Meklenburg nicht, und es waren nicht Alle so thöricht, ihre Angriffe gegen die Kirche und ihre Gnadenmittel offen hervorzukehren und dadurch ihr unvermeidliches Loos über sich herbeizuziehen; sondern manche von diesen neuen Propheten und überspannten Narren waren so schlau, unter dem Deckmantel der Pietisterei sich bei diesem oder jenem Hofprediger einzuschmeicheln; selbst bis an den Thron wagten sie sich vor. Das merkwürdigste Beispiel bot wohl ein gewisser Henning in Sternberg, ein "Erzschelm", der, aus Altona ausgewiesen, in Meklenburg, ich weiß nicht wie, sich die Gunst des Herzogs erworben hatte. Schon nach Kurzem hatte er durch seine Geisterseherei unter den Spiritisten ein gewisses Ansehen gewonnen, und Sternberg erschien ihm wohl wegen der Nähe des im Pie=


|
Seite 266 |




|
tismus damals am weitesten rechts stehenden Superintendenten Friederich, der geeignetste Ort für seine Wirksamkeit. Sobald er die Erlaubniß bekommen hatte, sich hier niederzulassen, begann er die Prediger des Landes insgesammt Lügner und Werkzeuge des Teufels, Brotknechte und Judasse zu schimpfen, auch in Schriften wahrhaft gottlose Prophezeihungen von dem nahen Blutgerichte über alle Baalsknechte zu verbreiten. Vergebens beklagte sich der Pastor Kaysel in Sternberg bei seinem Superintendenten. daß die ganze Gemeinde, besonders aber das Landvolk, welches in seinem Hang zum Aberglauben den Inspirationen des dreisten Menschen Glauben schenke, ihm rebellisch werde; vergebens wies er auf die Gefahr hin, welche die lockende Irrlehre von der Gleichheit und Freiheit für die Ruhe des Bauernstandes habe: der Superintendent erklärte Henning für einen Schwachkopf, der den Leuten nur zum Spotte diene. Als aber die Bewegung lebendiger wurde und sich über das ganze Land ausbreitete, mußte das Consistorium einschreiten, und da fand sich, daß die Schriften des "Schwachkopfs" bereits überall im Lande bekannt waren. Der weiteren Verfolgung entzog sich der verruchte Schelm, nicht ohne noch das Consistorium in gemeiner Weise zu verhöhnen, durch die Flucht (1782).
Aehnliche, wenn auch nicht so schlau angelegte, bösgesinnte Versuche, die Leidenschaften aufzuwiegeln, kamen häufig vor und fanden durchweg günstigen Boden. Denn wie Luthers Predigt von der Freiheit des Christenmenschen vormals in den Bauern verkehrte Vorstellungen erweckt hatte, so hörte auch der gedrückte Bauer in Meklenburg gern jede Stimme, die seine nahe Erlösung in dem neuen Zion ihm predigte. Von all dem andern Kram der Schwarmgeister verstand der Bauer nichts; wer ihm aber von seiner Befreiung redete, den hielt er für einen Himmelsboten und glaubte gern an die Inspirationen. Es konnte nicht anders sein: wenn er die lockenden Versprechungen dieser "Zionswächter" mit der Predigt vom Gehorsam gegen die Obrigkeit verglich, so mußte ihm scheinen, daß die Kirche ihm Steine statt Brot reichte! Um so schärfer mußte daher auch das Verfahren gegen diese Verführer sein, die das arme Volk zur Empörung reizten. Der Herzog machte mit ihnen kurzen Proceß: er ließ sie mit Schimpf aus dem Lande jagen. Aber trotz der Wachsamkeit der Beamten gelang es nur selten, einen dieser schlauen Gesellen festzukriegen: nur an dem treffenden Gift merkte man die geheime Wühlerei.


|
Seite 267 |




|
D. Die Juden.
Das Land Meklenburg mit seiner vorwiegend ackerbauenden, der Industrie abgewandten Bevölkerung ist niemals ein Eldorado für die Juden gewesen; was sich hier niedergelassen, hat sich zumeist kümmerlich vom Schacher und Trödel ernähren müssen. Wem es aber von ihnen gelang, wohlhabend zu werden, der zog, wie es noch heute zu sein pflegt, nach Hamburg, wo sich mit dem Capital besser arbeiten läßt. Trotz dieser gedrückten Lage der Juden hat auch Meklenburg seine "Judenhetzen" gehabt, ja sogar Zeiträume, wo ihnen im Lande zu wohnen verboten war. Die Stadt Rostock hat erst in neuester Zeit sie aufgenommen. Von denen, welche unter Herzog Friedrich in Wort und Schrift "die Austreibung der verworfenen Rotte" (!) betrieben, "weil dieselbe der Predigt des Heils nicht anders als in der höchsten Noth ihre Ohren öffne", war der heftigste der Professor Tychsen zu Bützow, der seinen früheren Beruf eines Kallenbergschen Missionars nicht vergessen konnte. Er fand damit aber beim Herzog Friedrich schlechte Aufnahme; denn wenn dessen hoher christ=fürstlicher Sinn auch die Mission unter dem armen blinden Volke in jeder Weise förderte und für die Arbeit an irrenden Seelen immer eine offene Hand hatte, so war ihm doch alle Anwendung von Gewalt verhaßt. Wie er darüber dachte, bewies er einmal gelegentlich, als Tychsen seine von bitterm Haß erfüllte "Geschichte der Judenschaft in Meklenburg" in den vielgelesenen Schweriner Blättern zu veröffentlichen unternahm: er verbot nicht allein die Fortsetzung aufs Strengste, sondern gab der beleidigten Judenschaft auch die Genugthuung, daß er solche dem christlichen Geiste widersprechende und das Interesse des Staats gefährdende Angriffe auf die jüdische Religion überhaupt in seinem Lande nicht dulden zu wollen erklärte. Tychsen mußte sich daher begnügen, seine Arbeit in den "Bützower Nebenstunden" herauszugeben. Einen andern Beweis seiner Gnade gab der hochgesinnte Fürst im Jahre 1774, als er der Schweriner Judenschaft erlaubte eine Synagoge zu bauen; denn er hielt dafür, daß es eine grausame Bedrückung sei, "dem fremden Volke", welches sich unter seinen Schutz begeben hätte, in der Ausübung seines Gottesdienstes auch nur hinderlich zu sein. Wo aber immer die Juden durch Processionen oder auf andere Weise den Christen ein öffentliches Aergerniß gaben, da verwies er ihnen solche Anmaßung aufs Ernsteste.
Die Zahl der Schutzjuden=Familien in den meklenburgischen Städten betrug damals etwa 300; es waren meist fleißige Leute,


|
Seite 268 |




|
welche dafür angesehen wurden, daß sie viel Geld in das arme Land brächten. Es gab allerdings aber auch sehr viele unter ihnen, welche entweder als Trödler das ganze Land durchzogen und den Kaufleuten in den Städten die Kundschaft wegnahmen, oder durch Pfand= und Wuchergeschäfte auf unehrliche Weise schnellerem Reichthum nachjagten und dadurch scharfe herzogliche Edicte wider solche Plage nöthig machten.
Wollten wir die Gegensätze der Ansichten über die Juden in zwei Männern der damaligen Zeit darstellen, so müßten wir Tychsen Reinhard gegenüberstellen: während jener, noch ganz von dem finstern Geist der fanatischen Verfolgungssucht beseelt, als das Heil der Staaten die Austreibung oder gewaltsame Bekehrung der Juden ansah, sah dieser in den Juden zunächst irrende Menschen, mit deren Blindheit man Mitleid haben müsse, die man aber doch, wenn sie echte Kinder Abrahams seien, hoch achten könne. Und andererseits als Bürger wollte er sie den Christen gleichgestellt wissen und billigte darum nicht, daß sie zu einer besonderen, der s. g. Judensteuer verpflichtet würden. Denn in einem wirthschaftlich so tief heruntergekommenen Staate, wie in dem damaligen Meklenburg, wären trotz allem Schaden, den ihre Sucht nach Reichthum anstiftete, die Juden mit ihrem Unternehmungsgeist als Förderer des Handels und Verkehrs ein unersetzlicher Gewinn. Der Herzog stand zwischen beiden: er erkannte den Nutzen des jüdischen Handels an, aber die Religion der Juden schien ihm jede Concession an bürgerlichen Rechten zu verbieten.
Zweiter Theil. Das Schulwesen.
Die Bemühungen des Herzogs Friedrich um die Hebung der einer Reform sehr bedürftigen höheren Schulen seines Landes lasse ich hier unberührt; im Ganzen kümmerte er sich nicht viel um dieselben. Sein Ideal waren die damaligen Gymnasien nicht: der christliche Geist schien ihm in denselben nicht genug gepflegt, und das praktische Leben nicht genug berücksichtigt zu werden. Ich habe in meiner Arbeit über das nach dem Muster der Halle'schen und der Berliner Realschule eingerichtete herzogliche Pädagogium zu Bützow neben den Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts, wie sie dem Wunsche des Fürsten entsprachen, auch den Kampf des Realismus gegen den Nominalismus, der die damalige Zeit


|
Seite 269 |




|
nicht minder als die heutige bewegte, darzustellen gesucht. Vgl. das Programm der Bützower Realschule I. O. 1881.
Die ganze Aufmerksamkeit des Herzogs war auf die Reformation des niederen Schulwesens gerichtet; denn alle Arbeit der Kirche an den Gemeinden war verloren, wenn die Jugend nicht in Gottes Wort sorgfältig unterrichtet und zu frommer Sitte erzogen wurde. Mit dem Schulwesen sah es aber trostlos aus.
Nach der Superintendenten=Ordnung von 1570 war es den Pastoren überlassen, geeignete, vom Superintendenten geprüfte Subjecte als Küster anzunehmen, jedoch vorausgesetzt, daß "die Personen nicht dem Patrone entgegen seien." Die revidirte Kirchen=Ordnung von 1650 machte zur Aufgabe der Synoden, über das Schulwesen zu berathen und zu berichten, wie weit auch auf dem Lande die Schulen ihrer Aufgabe des Unterrichts im Katechismus, in Gebeten, im Lesen und Schreiben, resp. Nähen genügten. In der VO. von 1694, wo aufs Neue allen Schulen zur Pflicht gemacht wurde, neben den andern Gegenstünden besonders den Katechismus fleißig zu tractiren, ist vom Schreiben nicht mehr die Rede: nur Lesen, Gebete, Sprüche, Psalmen und Gesänge werden hier angeführt.
Auch in dem LGG. Erbvergleich von 1755 wurde an alle dem, was Observanz war, nichts geändert: in der Ritterschaft stellte der Patron in Uebereinstimmung mit dem Prediger den Lehrer an, in den Städten der Magistrat, "sofern er die Schulen unterhält", "jedoch dem Landesherrn an dero Ober=Inspection unschädlich", und endlich im Domanium der Herzog. Jedoch wurde 1755 hinzugefügt: daß ohne Beibringung guter Zeugnisse fortan kein Schulmeister mehr, weder im Ritterschaftlichen, noch im Landschaftlichen, noch überhaupt mehr angenommen werden solle. An dem Recht der Gutsobrigkeit, unter Zuziehung des Predigers den Dorfschulmeister unter beliebigen Bedingungen anzustellen, sowie an der Jurisdiction über denselben wurde nichts geändert. Den Predigern wurde aber von Neuem eingeschärft, daß es ihre Pflicht sei, die Schulen in ihren Gemeinden, sowohl auf dem Lande als in den Städten, fleißig zu besuchen und den Schulmeistern Anleitung zu geben, auch von Zeit zu Zeit zu examiniren, wie weit die Kinder von dem Unterrichte ihres Schulmeisters profitirten.
So fehlte es also dem Herzog Friedrich nicht an Handhaben, eine gründliche Besserung des Schulwesens herbeizuführen, und er war entschlossen, das, was die Herzogin Augusta zu großem Segen in ihrem beschränkten Kreise begonnen hatte, auf das ganze Land zu übertragen. Der 1756 eingeforderte Bericht über den Stand


|
Seite 270 |




|
des Schulwesens konnte nicht trauriger lauten: nirgends war geregelter Schulbesuch, die Kinder lungerten umher, die Schulmeister verhungerten, die Geistlichkeit kümmerte sich nicht um die Schulen u. s. w. Von den Superintendenten war der einzige, welcher den Muth hatte für eine energische Aenderung des Unwesens einzutreten, Quistorp in Rostock. Er faßte die Sache am rechten Ende: die Besserung der Noth hänge ganz von der Besserung der Lage der Lehrer ab, denen man bei der jämmerlichen Einnahme nicht zumuthen könnte das Schulhalten als ihren Beruf anzusehen. So lange nur kranke und zu sonst nichts mehr nütze Subjecte Schulmeister seien, so lange sei jede Hoffnung umsonst. Als Zweites sei erforderlich die Einführung der allgemeinen Schulpflicht für alle Kinder vom 6. Jahre an und Bestrafung der säumigen Eltern, wobei es sich empfehle, zugleich alle Klipp=, Neben= oder Candidaten=Schulen aufzuheben, weil dadurch den schlechten Eltern die Möglichkeit genommen werde, der Staatsaufsicht sich zu entziehen. Wenn die Lehrer besser gestellt wären, die Prediger sich der Schulen mit Wärme annähmen, auch statt des Nachmittags=Gottesdienstes an den Sonntagen fleißig den Katechismus übten, und die Eltern mit Strenge angehalten würden ihre Kinder zur Schule zu schicken: so könnte der reichste Segen dem Lande nicht fehlen.
Der Herzog ging sofort mit Eifer an die Ausführung dieser vortrefflichen Rathschläge. Am 13. December 1756 führte er den allgemeinen Schulzwang ein und verbot den Predigern und Beamten hinfort noch ohne allerh. Befehl einen Küster oder Schulmeister anzunehmen. Im folgenden Jahre wurde der Befehl, da er meist unbeachtet gelassen war, wiederholt und dahin erweitert, daß die Beamten unnachsichtlich mit Strafen die Eltern zwingen sollten, ihre Kinder vom 6. Jahre an nicht bloß im Winter, sondern auch im Sommer zur Schule zu schicken.
Aber dieser Maßregel widersetzte sich Alles: die Schulmeister erklärten sich außer Stande im Sommer Schule zu halten, da sie ihre Felder bestellen müßten, die Einlieger verweigerten den Gehorsam, weil ihre Kinder im Sommer Hofdienst hätten, die Hauswirthe gaben an, ihre Kinder zum Hüten gebrauchen zu müssen. Auch Superintendent Quistorp konnte nur rathen, die Sommerschulen nicht obligatorisch zu machen, dafür aber auf den regelmäßigen Winterbesuch um so strenger zu halten.
Die Art des Herzogs war aber nicht, nachzugeben, wenn er Etwas für nothwendig erkannt hatte. Nur das zunehmende Kriegsgedränge verhinderte ihn, seinen Befehlen sofort Achtung zu


|
Seite 271 |




|
verschaffen. Aber selbst in dieser Zeit der Noth unterließ er nicht, wiederholt die Beamten zu ermahnen, für Herstellung eines bessern Schulwesens zu sorgen und vor der Einsetzung untüchtiger Subjecte zu warnen. Dem Schloßschulhalter Wegener in Schwerin gab er auf, für die noch untüchtigen Subjecte, die sich zum Dienst meldeten, eine Vorbildungsschule einzurichten. Die Schulordnungen der Stadt Bützow (1760) und der Stadt Neustadt (1763) lehren, wie ernst sich der Herzog auch in dem Kriegsgedränge mit dem Schulwesen und seiner Reorganisation beschäftigte. Die Grundzüge alles dessen, was später der Herzog durchführte, liegen hier schon klar vor:
"Alle Kinder vom 5. Jahre an sind schulpflichtig und haben nicht allein im Winter von Martini bis Ostern, sondern auch so viel als möglich im Sommer die Schule zu besuchen. Der Unterricht soll täglich außer Sonnabend=Nachmittags und Sonntags in 3 Stunden Vormittags und 3 Stunden Nachmittags ertheilt werden, außerdem aber die Kinder, welche sich vorbereiten zum Tische des Herrn zu gehen, in 1 bis 2 Abendstunden besondern Unterricht empfangen. Während des Schulhaltens ist dem Lehrer bei 1 Thlr. Strafe verboten andere Arbeit zu betreiben oder gar die Kinder zu seinen Haus= und Feldgeschäften zu verwenden. Für den Unterricht empfängt der Schulmeister von jedem Kinde seinen Lohn, den die Obrigkeit für ihn einzieht. Bei Strafe von 2 Thlrn. hat der Schulmeister genaue Versäumnißlisten zu führen und dieselben quartaliter an die Obrigkeit abzuliefern, die ihrerseits für jede leichtfertig versäumte Schulwoche von den Eltern 8 ßl. Strafgeld einzieht."
Am 3. Juli 1763 wurde das meklenburgische Dankfest wegen des beendigten Krieges, der so schwere, schwere Wunden geschlagen hatte, gefeiert: da war nach sieben Jahren endlich die Zeit eines gesegneten friedlichen Regiments gekommen. Aber noch vergingen drei Jahre, bis das Land sich so weit erholt hatte, daß der Herzog glaubte, mit Nachdruck in der Herstellung eines geordneten Schulwesens vorgehen zu können. Er hatte inzwischen eingesehen, daß eine solche Reform ebensowohl große Opfer forderte, die er den Gemeinden allein nicht auferlegen konnte, als sie tief in das Leben der unteren Volksclassen eingriff und Rechte und Einrichtungen berührte, an deren Bestande die Ritterschaft ein besonderes Interesse hatte. So schlug der Herzog den alten Weg allmählichen Gewinnens ein: 1767 wurden alle Nebenschulen, welches Namens auch immer, aufgehoben. "weil sie theils den Schulmeistern ihren Lohn verringerten, theils von solchen Subjecten gehalten würden,


|
Seite 272 |




|
die den Bauern in Allem zu Willen wären." Solcher Klipp= oder Winkelschulen gab es aber eine große Menge: nicht bloß in den Städten, wo den alten Candidaten, die nichts mehr hofften, sondern allein um des Hungers Willen Unterricht ertheilten, die ganze Menge der zuchtlosen Jugend zuströmte, sondern auch auf dem Lande; selbst in den kleinsten Dörfern waren Neben=Schulhalter, welche um so größeren Zulaufs sich erfreuten, je nachsichtiger sie waren. Zu dem guten Schulmeister, der Zucht und Ordnung hielt, gingen immer nur wenige Kinder. Das wurde nun mit einem Male anders: trotz Bitten und Vorstellungen wußten alle Schulhalter, welche nicht rechtmäßig angestellt waren, ihre "Stuben" schließen und einem Gewerbe entsagen, welches sie den Dorfschaften zu Willen, aber dem Staate zum Schaden ausgeübt hatten. Es wurden aber auch alle ordnungsmäßig angestellten Lehrer, welche unfähig waren, oder gegen welche die Gemeinde sonst gerechte Klagen hatte, nach und nach entfernt und durch bessere Kräfte ersetzt.
Fast gleichzeitig mit dieser Verordnung über Beseitigung der Nebenschulen erschien eine zweite, welche das Schulgeld auf jährlich 24 ßl. für jedes Kind, und 1 bis 2 ßl. wöchentlich extra für Rechnen und Schreiben festsetzte. Wer sich widerspenstig zeige, solle durch harte Leibesstrafen zur Pflicht angehalten, die etwa säumigen Schulmeister aber ohne Gnade abgesetzt werden. Obwohl die Beamten, welchen die Ausführung dieses allerh. Befehls oblag, begriffen, daß die Zeit des Abwartens und der Lindigkeit vorüber war, vermochten sie bei bestem Willen nicht durchzugreifen. Denn die Lehrer konnten von dem Schullohn allein nicht leben, und es war von ihnen nicht zu verlangen, daß sie ihre Hauptbeschäftigung, das Handwerk, welches sie betrieben, nun als Nebensache betrachteten; dazu fehlte es noch fast überall an Schulkaten. Andererseits waren viele Eltern wirklich so arm, daß sie das Schulgeld für mehrere Kinder nicht bezahlen konnten. Die Beamten stellten daher anheim, ob es nicht möglich wäre, das Schulgeld ganz aufzuheben und die Erhaltung der Lehrer und Schulen der Renterei zu übertragen.
Dies hatte zur Folge, daß am 1. December 1768 den Aemtern befohlen wurde, die Einkünfte jedes Dorfschulmeisters genau festzustellen und Vorschläge zu machen, wie eine Verbesserung und möglichste Egalisirung aller Schulstellen herbeizuführen sei. Lange Berathungen, zu denen auch die Superintendenten herangezogen wurden, ergaben endlich als Resultat das wichtige Reglement von 18. October 1770:


|
Seite 273 |




|
Jeder Landschulmeister, Schulhalter, Organist, Küster soll mindestens haben: eine Wohnung mit Schulstube, einen Garten von 100 □ Ruthen, etwa 4 Scheffel Saatacker, eine Wiese von 2 Fudern Heu, freie Weide für 2 Kühe, 1 Kalb, 2 Schweine, 10 Schafe (ohne Weidegeld und Weidelohn), freie Feuerung, freie Mühlenfuhren. An Schullohn soll der Schulmeister erhalten bei 5 bis 20 Kindern für jedes 42 ßl., für jedes mehr 8 ßl, bei 30 bis 50 Kindern für jedes 31 1/2 ßl., für jedes über 50 8 ßl. mehr; dieser Lohn soll halb in baar, halb in Roggen, den Scheffel zu 24 ßl. (1777 zu 32 ßl.) gerechnet, vom Amte ausgezahlt werden.
Dafür hat der Schulmeister zu leisten: die Abhaltung der Winterschule von Michaelis bis Ostern in 3 Stunden Vormittags und 3 Stunden Nachmittags für alle Kinder vom 4. Jahre an (für größere Kinder vom 7. Jahre an soll im Nothfalle der Unterricht erst um Martini beginnen). Der Schulhalter hat genau und gewissenhaft, unbekümmert um den Trotz unverständiger Eltern, Versäumnißlisten zu führen und von den Strafgeldern, 1 Sechsling pro Tag, Bibeln u. a. Bücher, Rechentafeln, Papier u. a. für die armen Kinder zu kaufen. Im Sommer hat derselbe, mit Ausnahme der vier Erntewochen, wenigstens an zwei Tagen der Woche mit sämmtlichen schulpflichtigen Kindern Schule zu halten, um das Gelernte zu wiederholen und auf das öffentliche Katechismus=Examen vorzubereiten. Die Kinder, welche fertig lesen können und im Christenthum nicht ungegründet sind, sollen auch schreiben und rechnen lernen, wofür sie einen Sechsling extra die Woche bezahlen. Bei großen Classen sollen die kleinen von der Schulmeisterin oder sonst einem Verwandten des Schulmeisters, der dazu Geschick hat, gesondert unterrichtet, die großen aber nach Anleitung des Stresow'schen Handbuchs in Classen abgetheilt werden. Von dem, was durchgenommen ist, sollen Tabellen Auskunft geben, damit die Prediger bei der Inspection und Prüfung ihren Anhalt haben. Den Anweisungen und Erinnerungen der Prediger haben die Schulmeister ohne Widerrede zu folgen, wie sie denn denselben in Allem als ihren Vorgesetzten bescheiden und ehrerbietig begegnen sollen. Damit sie aber auch merken, wo es in der Religion den Kindern noch besonders fehle, sollen die Schulhalter beim Confirmations=Unterricht zugegen sein, und die Schulmeisterin während dessen Schule halten.
Die Beamten und Prediger, welche sich der Sache besonders annehmen und für die Vermehrung des Unterrichts auch in den Sommerschulen sorgen, versichert der Herzog seines landesväterlichen Höchsten Wohlwollens. -


|
Seite 274 |




|
Dieses Reglement wurde dann noch durch die Bestimmung über die Pflichten der Dorfschaft ergänzt:
Jeder Hüfner, Kossat, Büdner zahlt, er mag schulpflichtige Kinder haben oder nicht, an den Schulmeister 24 ßl. Courant und 1 Scheffel Roggen, jeder Einlieger und Hirte 36 ßl. Die Dorfschaft bestellt den Schulmeisteracker und fährt das Korn ein; was aber über 4 Scheffel Aussaat ist, soll der Schulmeister selbst bestellen. Die Schulwiese hat die Dorfschaft unentgeltlich zu werben und das Heu einzufahren. Das vom Schulzen angewiesene Brennholz wird von der Dorfschaft im Frühling geschlagen, von dem Schulmeister selbst in Faden gesetzt, aber von der Dorfschaft unentgeltlich eingefahren. Wo noch kein eignes Schulhaus, hat die Dorfschaft auf ihre Kosten eine Wohnung zu miethen, zum Neubau eines solchen werden ihr alle Materialien umsonst geliefert. Alle Leistungen, außer den Mühlenfuhren, als Lieferung von Broten, Holz, Lichtgeld, Würsten, Eiern, Geschenken u. s. w., fallen hingegen fort, und haben die Schulmeister nichts mehr zu beanspruchen.
Am 30. August 1771 trat auch dieses Reglement in Kraft. Damit war vorerst für das Domanium eine heilsame Ordnung geschaffen.
Für die Stadtschulen faßte die Regierung folgende Einrichtung ins Auge:
Das Recht, ihre Lehrer zu berufen, verbleibt den Städten; doch sollen sie, damit sie nicht unbefähigte oder unchristliche Lehrer anstellen, Serenissimum jedesmal um Confirmation unterthänigst bitten. Das Consistorium, als unmittelbare Aufsichtsbehörde eingesetzt soll jährlich berichten und die thunlichste Verbesserung der Organisation sich angelegen sein lassen. Die Obrigkeit sorgt für die Handhabung des Schulzwanges, für vollständige Trennung der deutschen und der lateinischen Schule, für Beseitigung alles Streits zwischen dem Küster, der hinfort nur die Kinder von 4 bis 9 Jahren, und dem Rector, der die Kinder vom 9. Jahre bis zur Confirmation unterrichtet. Mehr als 60 bis 80 Kinder sollen in einer Classe nicht sein; jedes Kind bezahlt vierteljährlich 16 ßl. Schulgeld. Die Hauptgegenstände des auch im Sommer fortgesetzten Unterrichts (täglich 6 Stunden) sollen sein: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen. Die Obrigkeit stellt halbjährlich unter Zuziehung der Geistlichen des Orts Examina an und berichtet über das Ergebniß an das Consistorium. Das Gehalt der Schulmeister müsse mindestens baar 80 Thlr. außer Wohnung, Feuerung, Garten und Wiese betragen, wogegen alle Natural=Hebungen weg=


|
Seite 275 |




|
fallen sollten. Die Kosten, soweit sie nicht durch das Schulgeld aufkommen, sollen durch eine Steuer (Hauscollecte) aufgebracht werden. Erwünscht sei auch, wenn die Städte dem Gedanken, für die armen Kinder besondere Freischulen einzurichten, näherträten.
Die meisten Städte verhielten sich diesen so heilsamen Plänen der Regierung gegenüber möglichst abweisend; sie thaten weder Etwas für die Aufbesserung der Schullöhne, noch für die Renovirung der meist mehr als elenden Schullocale; selbst in Bezug auf die Durchführung des Schulzwanges waren sie so lässig, daß der Herzog wiederholt eingreifen mußte. Die Folge war, daß auch der Unterricht an den städtischen Schulen bald viel schlechter war als an den Landschulen im Domanium. Klagte doch noch im Jahre 1795 eine gerechte Stimme, daß, wer von den Bürgern immer nur das Schulgeld aufbringen könne, seine Kinder lieber in die Lateinschulen schicke als in die deutschen Schulen, wo garnichts gelernt, ja sogar noch nicht für regelmäßigen Sommer=Unterricht, wie auf dem Lande, Sorge getragen würde! Indessen, es gab auch Städte, die an dem schönen Vorgang des Herzogs sich ein Beispiel nahmen und, wenn sie auch weit von den Wünschen der Regierung entfernt blieben, so doch nach Kräften für geordneten Unterricht in den niederen Schulen sorgten. Im Ganzen aber waren die städtischen Schulen nicht auf der Höhe der ländlichen, und die Schulmeister selbst zogen den herzoglichen Dienst weit vor. Beispiels halber sei nur erwähnt, daß in Neustadt im Jahre 1826 noch kein Rechenunterricht an der Stadtschule ertheilt wurde.
Auch die Ritterschaft zeigte sich den Plänen des Herzogs betr. völlige Umgestaltung des Volksschulwesens sehr wenig geneigt. Denn als die Regierung im Jahre 1772 dem Engern Ausschuß der Ritter= und Landschaft die Proposition machte, ein gemeinsames Schullehrer=Seminar für das ganze Land einzurichten, damit hinfort nur mehr tüchtig geschulten Subjecten das Seelenheil der Kinder anvertraut würde, antwortete der Engere Ausschuß: die Stände könnten sich nicht entschließen, zu ihrem Theile zu dem Seminar beizutragen, noch viel weniger aber nur auf einem Seminar Vorgebildete als ihre Lehrer anzunehmen.
Der Herzog ließ sich aber nicht abschrecken; mit dem Hinweis auf den von der Ritterschaft bisher unerfüllt gelassenen Erbvergleich, wonach nur geprüfte Lehrer angestellt werden sollten, erinnerte er den Engern Ausschuß an seine Pflicht, für eine gründliche Verbesserung des Schulwesens einzutreten; es sei ja das von ihm Begehrte keine Machtfrage, sondern nur eine heilsame, die Ausbreitung des


|
Seite 276 |




|
Christenthums und der Frömmigkeit zum Zwecke habende Neuerung. Der Engere Ausschuß lehnte aber jede weitere Verhandlung ab. Da erfolgte der allerh. Befehl, die Frage wegen des Schulwesens und der Einrichtung eines Seminars den versammelten Ständen vorzulegen. Der Engere Ausschuß protestirte gegen solchen Zwang: Die Lehrer stünden unter dem Willen ihrer Gutsherren, die schon selbst, soweit es die Umstände erlaubten, für guten Unterricht Sorge trügen. Besonders die Sommerschulen seien unnütz und nicht einführbar, weil die Kinder bis Martini hüten müßten. Die Gutsherrschaft verschaffe ihren unterthänigen Kindern freien Unterricht in der Gottesfurcht, damit die Eltern aus Armuth oder Sparsamkeit sie zur Schule zu schicken nicht abgehalten werden möchten, und nach dem Verhältniß der damit für den Schullehrer verknüpften Arbeit werde derselbe hinlänglich salarirt. Der Bauersmann frage nicht darnach, ob sein Kind auch im Schreiben und Rechnen unterrichtet werde, die Gutsherrschaft aber habe nur Schaden davon. Für die in den Gütern wohnenden freien Leute habe die Gutsherrschaft keine Verbindlichkeit und wolle auch nicht, daß um 1 ßl. Lohn ihre Lehrer gezwungen würden, 1 bis 3 Kinder im Rechnen oder Schreiben zu unterrichten, wo sie mit ihrer Arbeit viel mehr verdienen könnten; sie habe keinen Nutzen davon, ob der Sohn des Schäfers oder Holländers schreiben lerne oder nicht.
Darauf erwiderte der Herzog am 9. Juni 1774: Es sei eine Anmaßung, wo es sich um nichts als um Aufbesserung des allgemeinen Schulwesens handele, von wohl erworbenen Rechten zu reden. Nicht darauf komme es an, ob die Schulmeister noch ferner unter der Gutsobrigkeit stehen sollten, sondern nur darauf, sie besser zu besolden, damit sie ihr Amt nicht als Nebenwerk betrieben, und überhaupt tüchtige Subjecte gefunden werden könnten. Dafür zu sorgen sei seine landesherrliche Pflicht.
Der Engere Ausschuß entgegnete: In §. 199 des LGG. Erbvergleichs sei ausgemacht, daß der Ritter= und Landschaft ohne ihre Zustimmung nichts Neuerliches auferlegt werden solle; als solches müsse er aber die neuerliche VO. vom 31. December 1773 ansehen, worin der Herzog einseitig das für seine Domanialschulen erlassene Reglement vom 18. October 1770, wenn auch mit Weglassung der Gehaltsbestimmungen, als für das ganze Land bindend publicirt habe; er müsse unterthänigst um Aufhebung desselben bitten. Denn wenn der Prediger das Recht habe, einen zum Unterrichten auch im Rechnen und Schreiben befähigten Schulhalter von der Gutsobrigkeit zu fordern, so folge daraus, daß ein


|
Seite 277 |




|
anderer, sonst in der Gottesfurcht und Lehre des Heiligen Worts genugsam geübter und mit Segen lehrender Handwerksmann, der sich außerhalb der Schulzeit sehr nützlich beschäftige und sich ein bequemes Auskommen verschaffe, bloß deswegen, weil er im Schreiben und Rechnen ungeübt, oder sich vielleicht sonst nicht der Nebenabsicht des Geistlichen gemäß zu betragen wisse, seinen Platz aufgeben müsse, um ihn einem wahren Müssiggänger, den die Gutsherrschaft mit doppelten Kosten und mit ihrer so viel größeren Beschwerde unterhalten müsse, zu überlassen, nur deswegen, weil ein im Rechnen und Schreiben geübter Mann gefordert würde. Und alles dieses würde doch nur um des bald hier, bald dort sich aufhaltenden freien Mannes willen übernommen werden; denn der Unterthan dürfe nicht schreiben noch rechnen lernen, das sei gegen seine Bestimmung. -
So war demnach die Ritterschaft für die guten Absichten des Landesfürsten nicht zu gewinnen. Fortgesetzte Verhandlungen und Ermahnungen hatten aber doch den einen Erfolg, daß im Jahre 1782 die Ritterschaft einwilligte, versuchsweise für die nächsten zwanzig Jahre keine anderen als von den Superintendenten geprüfte Subjecte anzustellen; doch sollte dies ohne rückwirkende Kraft auf die bereits berufenen Schulmeister gelten und ohne allen Einfluß auf die anderen constitutionsmäßigen Rechte der Herren über ihre Schulmeister bleiben.
Wenn aber die Ritterschaft dem Herzoge gegenüber sich darauf berief, daß kein Grund zu einer Aenderung des Bestehenden vorliege, da Alles in bester Ordnung sei, so lehrten die Synodalberichte der Prediger das Gegentheil. Die Schulmeister waren meist ganz untaugliche Subjecte, entweder Guts=Handwerksleute, die sonst nichts mehr leisteten, oder altersschwache Bedienten, von denen man nichts "prätendiren" könnte, sondern froh sein müßte, wenn die Frau sich der Jugend annähme. Schulkaten gab es fast nirgends, sondern der Unterricht wurde in der Wohnstube in Gegenwart der Frau und Kinder ertheilt. An Schulzwang wurde garnicht gedacht, noch weniger an die "verwerflichen" Sommerschulen; der Unterricht begann um Martini und endigte vier Wochen vor Ostern. "Was hilft aber das Lamentiren?" heißt es in einem solchen Bericht. "Und wenn ein Engel vom Himmel käme, so blieben diese Herren doch taub, die von Bildung und Unterricht ihrer Jugend nichts wissen wollen." Und in einem andern Bericht: "Wenn alle Begüterten, welche Leibeigenen zu befehlen haben, dem preiswürdigen Beispiel unsers Landesvaters folgten, so würden wir Schulen haben, wie sie in Sachsen sind. so lange aber der mo=


|
Seite 278 |




|
ralische Charakter mancher Gutsherren, ingleichen die politische Verfassung und ökonomische Einrichtung unsers lieben Vaterlandes hin und her viele Hindernisse bieten, kann man weiter nichts thun, als die Hindernisse sich vor Augen klar zu halten. Und diese bestehen: 1) in dem Mangel an Schulhäusern, 2) an guten Schulmeistern, 3) in dem Unverstand und der Lieblosigkeit der Eltern, 4) in den schweren Hofdiensten, 5) in den Maximen der Gutsherren die Leute in Unwissenheit zu erhalten, 6) in der Gewohnheit, die Kinder hüten zu lassen, 7) in dem Mangel einer gesetzlichen Ordnung, 8) in dem Mangel der Aufsicht, da die Geistlichen keine Auctorität haben, und endlich 9) in der ganz unzulänglichen Besoldung der Schulmeister." Ohne gesetzliche Regelung mit der Ritter= und Landschaft sei nichts zu erreichen. -
Blieb nun auch der Wunsch des Herzogs, das Schulwesen des ganzen Landes einheitlich zu ordnen und zu verbessern, unerfüllt, weil die Ritter= und Landschaft, sei es aus Mißtrauen gegen die Reform, mit welcher der Fürst andere als bloß geistliche Zwecke zu verfolgen schien, sei es aus Unverstand widerstrebte, so war doch das, was der Herzog erreichte, auch allein des höchsten Lobes werth und leuchtet herrlich in dem Kranze seines unvergänglichen Ruhmes.
Seit 1763 war sein Lehrer mehr im Domanium angestellt worden, welcher sich nicht in einem Examen als tauglich zu dem Amte ausgewiesen hätte; die trägen, schlechten oder sonst unbrauchbaren waren allmählich beseitigt. Die Sorge um das tägliche Hungerbrot hatte aufgehört; ja in manchen Dörfern standen sich die Schulmeister, besonders wenn sie zugleich Küster waren, so gut, daß manche Prediger sie beneideten.
Die Rückwirkung davon war, daß die Schulmeister ihrerseits mit Eifer auf die allerh. Intentionen eingingen und ihr Amt, das sie bisher als Noth= und Nebensache angesehen hatten, mit Treue verwalteten. Bei dem großen Andrang von Bewerbern um die vielbegehrten Schulhalterstellen verschwand bald der alte Stamm der unfähigen Subjecte, und die neue Generation machte mit den erhöhten Ansprüchen erhöhte Anforderungen, kaum mit dem zufrieden, was der Herzog ihr zugebilligt hatte. Das Wort von der Gleichheit der Schulstellen erregte vielen Neid; denn was der eine mehr hatte oder zu haben schien, sei es, weil der Acker besser war, sei es, weil sonst die Stelle mehr eintrug, das wollte der andere auch haben und suchte es, wenn die Kammer nicht darauf einging, von der Dorfschaft zu bekommen; gar mancher


|
Seite 279 |




|
wußte die alten schönen Lieferungen an Wurst und Eiern als freiwillige Gaben sich zu bewahren. Denn auch die Dorfschaften verschlossen sich nicht vor der Einsicht, daß ein guter Schulmeister der Jugend ebenso großen Segen als ein schlechter Unsegen brächte; und gab es auch vielen Streit, so waren doch die neuen Schulhalter wichtige und in der Dorfschaft viel geltende Personen, die an Ansehen dem Pastor gleichzukommen sich bemühten.
Wie viel anders es seit dem Jahre 1768, wo die Reform des Schulwesens begonnen hatte, mit den Schulen im Domanium geworden war, lehren am deutlichsten die Synodalberichte aus den Jahren 1783 und 1784. Die Klage über den Widerstand und unverständigen Trotz der Dörfer ist verstummt; es fehlt zwar nicht an kleinen Leuten, welche am liebsten ihre Kinder in der alten Dummheit großgezogen hätten, aber der Geist ist anders geworden. Seitdem die Dorfschaften erkannt haben, wie großer Segen der Jugend aus dem treuen und geschickten Unterricht der neuen Schulmeister erwächst, streben sie selbst darnach, die alten unfähigen Schulhalter loszuwerden. Der Bauer gewöhnt sich langsam an neue Einrichtungen und fügt sich nur dem Zwang; aber wenn er erst zur Einsicht des eignen Vortheils dabei gekommen ist, so erwärmt er sich auch leicht für die früher gehaßte Sache und bringt freiwillige Opfer. Man darf vielleicht sagen, wenn man diesen Synodalberichten glaubt, daß der Eifer der Dorfleute größer war als der Eifer der Lehrer, die besonders den Sommer=Unterricht als eine große Last betrachteten und denselben über zwei Tage der Woche hinaus auszudehnen sich nur schwer entschlossen; aber in dieser Beschränkung war der Sommerunterricht auch beinahe im ganzen Domanium durchgeführt. Auch gab es nur sehr wenige Dörfer mehr, welche nicht einen eignen "Schulkaten" hatten; beispielsweise war in der ganzen Präpositur Hagenow, einer der am wenigsten gesegneten des Landes, nur ein einziger solcher Ort mehr da.
Das Verdienst, durch energische Einwirkung auf die Beamten binnen verhältnißmäßig so wenigen Jahren so Großes vollendet zu haben, gebührte nächst dem Herzog dem Rentmeister Kychenthal, welcher ohne Bedenken, wie viel Schwierigkeiten sich auch oft aus der Finanznoth des Landes und dem Widerspruche der Forstbeamten drohend erhoben, doch alle gerechten Ansprüche zu erfüllen immer bereit war; und was besonders hoch zu schätzen ist, er handelte so, nicht um dem Wunsch seines Landesherrn zu dienen, sondern aus eignem warmem Interesse an einer Sache,


|
Seite 280 |




|
deren unberechenbaren Segen für das ganze Land er erkannte. Bei ihm vor Allen hatten sich die Schulmeister für die Besserung ihrer Lage zu bedanken; er blieb trotz aller Anfeindungen der Sache, von denen sich auch viele Prediger nicht frei zu halten vermochten, bei seinem Grundsatze feststehen, daß nur sorgenfreie Stellung die Schulmeister zu treuer Arbeit führe und sie verantwortlich mache. Mit seinem Lieblingsgedanken, daß auch die Prediger an dem Unterricht sich betheiligen müßten, vermochte er allerdings nicht durchzubringen; und wie ich meine, nicht zum Schaden der Schulen. Denn bereits begannen die Prediger nicht mehr so sehr über die Unwissenheit der ihnen unterstellten Lehrer zu klagen, als über deren Dünkel, der sie aufblähe und des Herzens Demuth ihnen raube; sie seien ungehorsam und widerspenstig und wollten sich nichts mehr sagen lassen, obgleich sie doch hinter ihrem Hochmuth die Rohheit der Seele nur schlecht zu verbergen wüßten. Diese Aufgeblasenheit bewirke auch, daß sie gern mit den Sektirern, vor allen den Herrenhutern, gemeine Sache machten, in der Absicht, dadurch sich den Schein zu geben, als ob sie auch Etwas von der Theologie verstünden. Solche in den Synodalberichten immer allgemeiner werdenden Klagen veranlaßten den Herzog im Jahre 1784 nicht allein zu dem Befehl an die Superintendenten, hinfort nur mehr Lehrer anzunehmen, die eine wahre Sinnesänderung erfahren hätten und solches in Wandel und That bewiesen, sondern sie boten auch vornehmlich den Anlaß, mit Ernst den lang gehegten Plan der Errichtung eines Landes=Seminars in Ausführung zu bringen. Nur eine tüchtige, gesunde Schulung konnte der Ueberhebung vorbeugen. Aber man war über den Plan und das innere Leben einer solchen Anstalt damals doch noch zu wenig im Klaren, um gleich das Richtige zu treffen; die Versuche, welche gemacht wurden, scheiterten kläglich. Indessen auch das Streben, das Gute gewollt zu haben, war löblich, und der Gedanke, einmal lebendig geworden, wurde nachher zur gesegneten That. Die Anregung gegeben zu haben, bleibt ein großes Verdienst des Herzogs Friedrich.
Ich bin am Ziele meiner Betrachtungen. Da geziemt es sich denn wohl, noch einmal zurückzublicken. Wir lernten den Herzog Friedrich als einen Fürsten erkennen, dessen Leben Gott geweiht und wohlgefällig war; wir durften ihn nicht zu den Pietisten in dem Sinne rechnen, daß er den Sektirereien der Darguner gehuldigt hätte, sondern er war als Fürst ein gut lutherischer Christ, der


|
Seite 281 |




|
auch in seiner Landeskirche nicht die geringste Abweichung von dem lutherischen Bekenntniß dulden wollte; daß er im Uebrigen die Halleschen Theologen den in Rostock erzogenen vorzog, lag nicht sowohl in seiner tief wurzelnden Abneigung gegen den damaligen buchstabentodten Geist der Orthodoxie an sich, als an der in Dargun gewonnenen Ueberzeugung, daß die fremden Prediger eifriger und brennender im Dienst seien; als der Pietismus aber schlaff wurde, wandte er seine ganze Gunst den orthodoxen Leipzigern zu. Was er verlangte, war, daß die Prediger neues kräftiges Leben in die Gemeinden brächten, und seinem eignen Feuereifer im Aufbau des Reiches Gottes konnte keiner genug thun. Dem Consistorium gab er das alte Ansehen zurück und machte es zu einer mehr, als gut war, gefürchteten Disciplinar=Behörde. Als Superintendenten berief er glaubensfeste, treue Männer, die ihm nach ihrem Glauben gehorsam waren, aber auch den Muth des Widerstandes hatten, wo das Heil der Kirche ihnen von dem falschen Eifer des Fürsten gefährdet erschien. In den Synoden gab er den Präpositis das Mittel, die Gesinnungen der einzelnen Prediger genauer kennen zu lernen und dieselben mahnend und strafend auf dem rechten Wege zu erhalten. Den Predigern half er mit kräftiger Unterstützung, die Noth des langen Krieges zu überwinden; er förderte überall den Bau der Kirchen. Aber auch auf die Gemeinden übte er den möglichsten Druck aus, um sie für ein frommes Leben vorzubereiten; er hinderte Alles, was von der Einkehr abhalten konnte; er milderte die rohen Sitten, beseitigte die tiefsten Schatten des Aberglaubens und Unglaubens, und förderte neben der Sparsamkeit den Fleiß der Arbeit.
Aber nicht allein für seine Landeskirche war der Herzog ein guter Regent; ihm war jeder Glaube, der das Leben durchdrang und zu Gott führte, in seinem Lande recht, mochte das Bekenntniß sein, welches es wollte, reformirt, katholisch oder jüdisch. Nur die Sektirer und Neuerer, welche mit ihren Lehren das Volk verführten, fanden vor ihm keine Gnade; er hatte auch vor den größten Gelehrten, die freisinnig waren, keinen Respect.
Den größten Segen aber brachte die Neuordnung des Schulwesens. Zwar scheiterte sein Streben, das ganze Land für seine Pläne zu gewinnen, an dem Widerstand der Ritterschaft; doch war der glänzende Erfolg desselben im Domanium bedeutend genug, um den Herzog auch in dieser Hinsicht mit Recht den größten Wohlthäter an seinen Unterthanen zu nennen.
Bei allen Bestrebungen des frommen Fürsten insgesammt aber fanden wir, das seine Politik, wie sehr sie von subjectiven Zwecken


|
Seite 282 |




|
geleitet war, sich nimmer wider das Recht wandte. Nicht als ob seiner Seele die subjective Willkür des Pietismus fremd gewesen wäre, und er nicht Vieles in seiner Landeskirche anders gewünscht hätte! Wir sahen ja, wie leicht er sich von seinem brennenden Eifer hinreißen ließ, wie hartnäckig er z. B. die Einführung des neuen Kirchen=Gesangbuchs, "der Bibel der kleinen Leute", erzwang. Im Großen und Ganzen überwog aber den Eifer der besonnene Verstand, der lieber verzichtete auf das, was er nicht mit Recht und Willen erreichen konnte. Daher war denn auch das Werk des Fürsten an der Landeskirche mehr ein innerliches: an den äußeren Instituten hat es fast nichts geändert. Gerade diese, seine Politik in Kirchen= und Schulsachen durchdringende Gerechtigkeit ist es, welche seiner Frömmigkeit erst den hohen Werth verlieh, daß die Geschichte ihn Herzog Friedrich den Frommen genannt hat; die Gerechtigkeitsliebe ist der schönste Edelstein in seiner Krone.