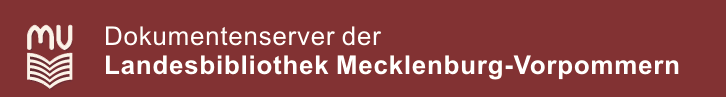|




|



|
|
|
- Mittheilung über zwei rohe Feuersteinbeile aus der Ostsee bei Warnemünde
- Das Ende der Bronzezeit in Meklenburg
- Prähistorische Untersuchungen im Großherzogthum Meklenburg-Strelitz
- Das bäuerliche Hufenwesen in Meklenburg zur Zeit des Mittelalters
- Zur Baugeschichte der Burg Stargard i. M.
- Das Bisthum Schwerin in der evangelischen Zeit (III. Theil)
- Die Politik des Herzogs Friedrich von Meklenburg-Schwerin (1756-1785) in Kirchen- und Schulsachen ( nach Urkunden dargestellt)
- Wallenstein und die Stadt Rostock : ein Beitrag zur Specialgeschichte des 30jährigen Krieges



|



|
|
:
|


|




|
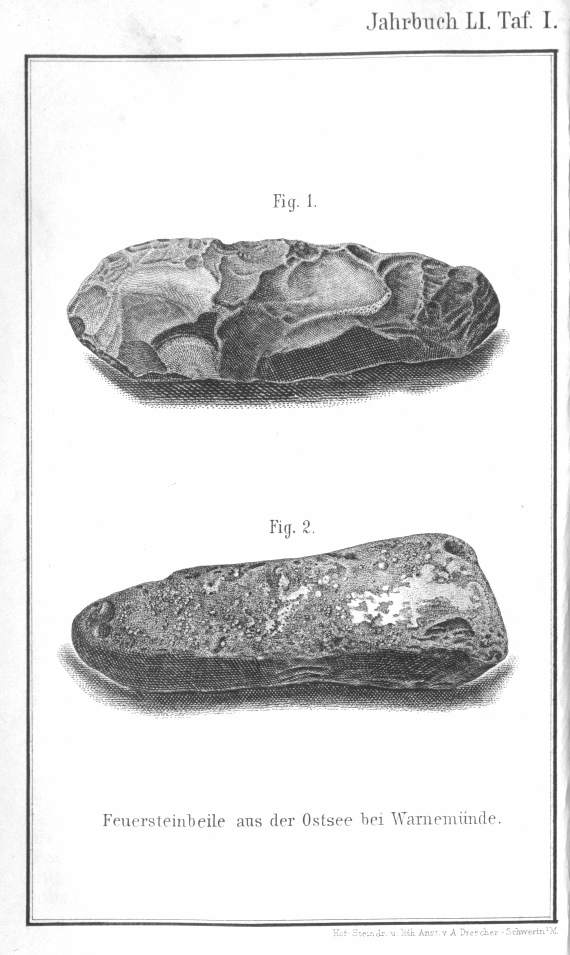


|
[ Seite 1 ] |




|
I.
Mittheilung
über
zwei rohe Feuersteinbeile
aus der Ostsee bei Warnemünde.
Von
Professor E. Geinitz
zu Rostock.
I m Sommer 1882 fand ich an dem Strande östlich von Warnemünde, bei dem als "Rosenort" bezeichneten niedrigen Abbruchsufer der Rostocker Haide ein roh gearbeitetes, vom Wasser etwas abgerolltes Feuersteinbeil. Dasselbe, auf Tafel I, Fig. 1 in halber natürlicher Größe abgebildet, besteht aus blaugrauem Feuerstein und hat eine stumpf lanzettliche Form. Es ist 15,5 cm lang, mit einer größten Breite in seinem unteren Anfang von 5,5 cm, an der Spitze sich zu 3,5 cm verjüngend; seine größte Dicke beträgt 2,5 cm. Seine Bearbeitung ist durch große unregelmäßige, flach muschlige Abspaltungsstücke auf beiden Seiten angedeutet; die (nicht abgebildete) Rückseite zeigt eine unvollkommnere Form, indem hier die ursprüngliche oder durch Zufall abgespaltene Oberfläche in unregelmäßiger flacher Krümmung vorherrscht und nur an den Rändern die kleinen muschligen Schlagflächen erscheinen. Jedenfalls hat aber das Ganze eine Form, die entschieden als Kunstproduct aufzufassen ist. Durch Abrollung im Meereswasser sind die scharfen Kanten verloren gegangen, gewissermassen abgerieben.


|
Seite 2 |




|
Das Stück, im Rostocker Universitäts=Museum aufbewahrt, bietet nach zwei Richtungen besonderes Interesse. Einmal wegen seiner primitiven Form, die an Producte der älteren Steinzeit, z. B. an die Feuersteinkeile von Amiens, erinnert. Wenn man auch annehmen kann, daß bei dem Abreiben und Abstoßen unter den Strandkieseln einige Ecken und Kanten verloren gegangen, andere Schlagflächen auch neu hinzugekommen sein mögen, so bleibt doch immer noch eine sehr primitive Gestalt des Steinbeiles bestehen.
Zweitens ist die Fundstelle von hohem Interesse. Vor dem Lande, am Strand unmittelbar an der See, in einer Gegend, der Rostocker Haide zugehörig, wo im Hinterlande (Hinrichshäger Revier) prähistorische Orte ("Hünengräber") bekannt sind, und wo eine sogen. säculare Senkung geologisch nachgewiesen ist. 1 ) Das bei größeren Fluthen beobachtete Zurückweichen des Strandes hat wohl seine Hauptursache in dem säcularen Sinken unserer Ostseeküstenländer. So wie durch dieses Phänomen die Torflager mit ihren Baumstubben jetzt vor den Strand, unter den Seespiegel gerathen sind, sind auch die Reste des prähistorischen Menschen an den Seegrund gelangt; wie die Bruchstücke der Torflager als Torfgerölle an den Strand ausgeworfen werden, so ähnlich gelangte auch unser Steinbeil wieder zur Tagesfläche, um hier durch einen glücklichen Zufall aufgefunden zu werden. -
Im Frühjahr 1885 machte Herr Dr. med. Sprengell=Lüneburg am Strande vor dem Pavillonhotel in Warnemünde einen ganz analogen Fund, den er freundlichst dem Rostocker Museum überließ. Es ist ein stark vom Wasser abgerollter und abstoßener Keil aus blaugrauem Feuerstein, in Fig. 2 zu etwa 2/3 natürlicher Größe photographisch abgebildet, 12 cm lang, hinten 4 cm breit, sich nach vorn verjüngend zu 3 cm und alsdann stumpf zugespitzt, hier 2 cm dick, hinten 3 cm, von vier fast ebenen, wenig eingebuchteten Flächen begrenzt, mit nicht ausgekerbten, aber durch das Wasser abgerundeten Kanten, hat er ungefähr die Form eines noch jetzt gebräuchlichen Hammers.
Auch dieser Fund bestätigt das oben über die säculare Landsenkung Gesagte. -


|
Seite 3 |




|
Zur Ergänzung dieser Mittheilung sei noch der Fund erwähnt, der im Sommer 1884 westlich Warnemünde gemacht wurde. In der nahe am Strande an der Grenze der Warnemünder und Diedrichshäger Fluren gelegenen, jetzt eingegangenen Kalk=Grube des Herrn Steffen zu Diedrichshagen fand man in dem Torf, der in einer Mächtigkeit von 0,5 m unter 2 m Dünensand verdeckt ist, vier Steinbeile, von denen meines Wissens zwei an das Schweriner Museum abgeliefert worden sind. Hier waren also die menschlichen Reste noch auf ursprünglicher Lagerstätte. Dasselbe Torflager, zum Grenzgebiet der weiten Breitling=Niederung gehörig, erstreckt sich in seinem nördlichen Theile bereits an den Seeboden hinaus, ganz ebenso wie die Torflager östlich von Warnemünde.
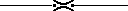


|
Seite 4 |




|



|



|
|
:
|
II.
Das Ende der Bronzezeit
in Meklenburg.
Von
Dr. Robert Beltz .
U nter den vorgeschichtlichen Funden in Meklenburg sind es besonders zwei Gruppen, welche sich aus der Fülle der Einzelerscheinungen herausnehmen und zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenschließen lassen; es sind das die Funde der reinen ("nordischen") Bronzezeit und der älteren ("römischen") Eisenzeit. Beide Perioden haben eine scharf ausgeprägte Physiognomie, und die sie charakterisirenden Merkmale unterscheiden sie bestimmend von einander und von anderen. Die Bestattungsform der reinen Bronzezeit ist ganz überwiegend die Beerdigung, die Beisetzung die in kegelförmigen Hügeln; den Bestatteten sind Waffen (Schwerter), Geräthe ("Kelte" und Messer) und Schmuckgegenstände (Ringe für Kopf, Hals, Hand, und Nadeln, bes. "Fibeln") beigegeben - alles durch Bronzeguß hergestellt; gelegentlich kommen noch Steingeräthe, ferner auch die jüngeren getriebenen Bronzen, Glas. selbst Eisen vor, der Masse der alten Bronzen gegenüber wie versprengte Einzelheiten erscheinend. Dieselbe Bestattungsform mit denselben Beigaben findet sich in Hannover, Schleswig=Holstein, den nördlichen Theilen von Sachsen und Brandenburg, dem westlichen Pommern und dem ganzen skandinavischen Norden, wenn auch überall mit wichtigen localen Verschiedenheiten, und giebt uns das Recht von einer "nordischen Bronzezeit" (um das verpönte Wort "Cultur" zu vermeiden) zu sprechen. Wir haben keinen Grund, daran zu zweifeln, daß die Träger dieser Cultur =


|
Seite 5 |




|
stufe germanische Stämme gewesen sind, und können nach ziemlich sicheren Combinationen das fünfte vorchristliche Jahrhundert etwa als Endpunkt annehmen, während der Anfang im Dunkel sich verliert. - Die andere Periode ist die "römische" Eisenzeit. Hier ist Alles anders. Die Leichen werden verbrannt, die Knochen in Urnen gesammelt, und diese in den Erdboden eingegraben. Die Beigaben bestehen überwiegend in Eisengeräth, besonders Messern und kleinen Toilettengegenständen; die Bronzegegenstände sind unzweifelhaft Erzeugnisse römischer Provincialindustrie. Urnenfelder dieser Art erstrecken sich über den ganzen Norden, sie sind unzweifelhaft germanisch und gehören den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt an. - Also an Stelle der Beerdigung tritt der Leichenbrand, an Stelle der Beisetzung in aufgeworfenen Hügeln die im Boden, an die Stelle der Bronze das Eisen. - Neben diesen Combinationen kommen nun aber auch andere vor, und zwar fehlen von den acht möglichen nur zwei in Meklenburg gänzlich: Begräbnisse und Urnenbeisetzung der Eisenzeit in Hügeln, während die vier anderen noch übrigen in der Reihenfolge sich finden, daß Beisetzung eines unverbrannten Leichnams der Bronzezeit im Boden neben Bestattungen der oben charakterisirten Art wenigstens an einer Stelle beobachtet ist (in Friedrichsruhe, s. Jahrb. XLVII, S. 276), daß sich Urnenbegräbnisse in Hügeln mit jüngeren Bronzen daran anschließen und Urnenfelder mit Bronzen, leider bisher wenig beachtet, den Uebergang zur Bestattungsform der Eisenzeit bilden. Ganz spät, am Ende der Heidenzeit, werden diese dann durch Skelettgräber abgelöst (worüber zuletzt Jahrb. XLIX, S. 21). Nach diesem Schema also sind es zwei Bestattungen, welche die Vermittelung zwischen der reinen Bronzezeit und der reinen Eisenzeit bilden, und es ist der Zeitraum von etwa 400 vor Christo bis zum Beginn unserer Zeitrechnung, den wir dafür zur Verfügung haben. Es ist ein Zeitraum von größtem geschichtlichem Interesse, da in ihm zuerst der germanische Norden in den Gesichtskreis der geschichtlichen Völker tritt, aber auch für den Archäologen von größter Bedeutung, da das spätere Culturmetall, das Eisen, damals seine Herrschaft auch im Norden antritt. Leider sind gerade die Funde dieser Zeit bei uns verhältnißmäßig spärlich und wenig imponirend; aber es ist an der Zeit, ihnen näher zu treten und den Versuch zu machen, ein zusammenhängendes Bild der heimischen Vorgeschichte in jener Periode aus den Einzelerscheinungen herzustellen und mit Hülfe der analogen Erscheinungen in den Nachbarländern zu erklären. Zu letzteren haben wir ja jetzt in dem bekannten Werke des Norwegers Ingvald Undset: "Das erste Auf=


|
Seite 6 |




|
treten des Eisens in Nordeuropa", das vortrefflichste Hülfsmittel.
Demgemäß behandeln wir die Bestattungsformen, welche in der Zeit des Uebergangs von der reinen Bronzezeit zur reinen Eisenzeit vorkommen, die Beigaben in diesen Gräbern und die Cultureinflüsse, auf welche dieselben hinweisen.
Gemeinsam ist dem ganzen zu behandelnden Abschnitte, daß die Gebeine nach dem Leichenbrande in Urnen ("Ossuarien") gesammelt und diese Urnen in Steinen verpackt beigesetzt sind; meistens sind es flache Steine, welche kistenartig die Urne einschließen. Die Beigaben liegen in den Urnen auf oder zwischen den Knochen. Solche Urnenbeisetzungen finden sich nun zunächst in Gräbern, die ganz den Kegelgräbern gleichen, aber im Allgemeinen niedriger sind; oft ist das Grab auch äußerlich durch einen Steinkranz bezeichnet, oft noch in alter Weise auf dem Urboden ein Steindamm aufgebrückt, auf welchem die kleine Steinkiste steht, von einem Steinhaufen, über dem dann der größere Erdhügel sich wölbt, geschützt. Das in anderen Ländern häufig Beobachtete, daß die Urnenbeisetzung in einem Hügel stattgefunden hat, in welchem schon eine Bestattung der alten Bronzezeit sich befand, ist hier seltener, nur für Slate. Grabow und vielleicht Bollbrücke hat es Wahrscheinlichkeit. Dieses scheint die älteste Form zu sein. Dahin gehören die Gräber von Alt=Schwerin, Moltzow (a), Borkow, Jörnsdorf. 1 ) Eine weitere Entwickelung ist dann, daß die Steinkiste, oft auch mehrere, über dem Urboden im Kerne oder Mantel des Hügels sich findet; so in Lübstorf, Goldberg, Pampow und besonders Perdöhl. Oft bilden dann die Hügel nur ganz flache, runde oder längliche Erhöhungen (Kläden, Dobbin, Kuppentin, Grabow, Lelkendorf, Rothenmoor), und schließlich wird die Urne in natürlichen Boden eingegraben und der Hügel darüber aufgeschüttet (Sukow, Vietlübbe, Liepen, Klink. [a]) Hierher gehören ferner die Gräber von Karstädt, Eikhof, Warlin, bei denen die Fundberichte zu einer bestimmteren Einfügung in die Entwickelungsreihe nicht ausreichen. - Neben diesen aus Erde oder Sand aufgetragenen Hügeln finden sich solche, deren Kern von Steinen gebildet ist; hier steht die Urne meist in der Mitte des Hügels, dessen Höhe zwischen 2 1/4 m und 1/2 m beträgt. Sie werden erwähnt bei Moltzow (b),


|
Seite 7 |




|
Gallentin, Zickhusen, Meyersdorf, Retzow, Kiekindemark, besonders schön scheint ein großes Grab von Marnitz gewesen zu sein. Mit dem Aufwerfen von flachen, runden Hügeln über den im Urboden stehenden Urnen ist schon der Uebergang gemacht zu den Begräbnissen, wo in natürlichen flachen Hügeln Urnen beigesetzt sind, diese meist in großer Menge. In Rambow fanden sich in einem 30 m langen, 15 m breiten Hügel solche Urnensetzungen, äußerlich durch Steinringe erkennbar, und Aehnliches wird von einem Funde bei Gadebusch berichtet. Ohne äußeres Merkmal waren Urnengräber von Moltzow (c) in zwei Hügeln von 60 m, resp. 36 m Länge, 30 m, resp. 18 m Breite, und von Ludwigslust (Kleinow). Findet die Beisetzung nun nicht in Hügeln, sondern im natürlichen Boden statt, so ist das Urnenfeld fertig, und wir haben die Bestattungsform der Eisenzeit erreicht. Derartiges ist aber bisher in Meklenburg für diese Periode sehr wenig beobachtet, für Klink (b) und Steinhagen wahrscheinlich, constatirt für Reutershof wo die kleine Steinkiste 70 cm tief im flachen Boden, und zwar auf einem Steinpflaster stand. - Die eben gegebene Entwickelungsreihe hat nun nicht die Bedeutung, daß sie eine Zeitfolge der einzelnen besprochenen Gräber aufstellen will; dazu wäre man nur dann berechtigt, wenn auch an den darin niedergelegten Gegenständen eine parallel laufende typologische Entwickelung zu verfolgen wäre; und wir werden unten sehen, daß das nicht der Fall ist. Sie will nur nachweisen, daß in den Formen ein allmählicher Uebergang vom Kegelgrab zum Urnenfelde stattfindet. Und damit ist schon eines erreicht: wir sind nicht mehr gezwungen, eine gewaltsame Unterbrechung am Ende der Kegelgräberperiode anzunehmen und das Auftreten einer ganz neuen Grabform etwa mit dem Auftreten einer ganz neuen Bevölkerung zu erklären, zu welcher Anschauungsweise man bekanntlich früher neigte. Wir dürfen annehmen, daß die Veränderung der Grabform sich auf eigenem Boden vollzogen hat, nicht importirt ist, zumal, um das Ergebniß einer späteren Betrachtung vorauszunehmen, die Beigaben im Wesentlichen in allen die gleichen sind und nicht, wie es in Nachbarländern in der That geschehen zu sein scheint, eine veränderte Beeinflussung durch Importgegenstände auch eine Veränderung der Grabformen herbeigeführt hat, oder doch von ihr begleitet ist. Mit dieser Auffassung stimmt überein, daß Begräbnißformen, welche in unsere Entwickelungsreihe nicht recht hineinpassen, bei uns so gut wie gar nicht vorkommen. So fehlen gänzlich die "Brandgrubengräber", d. h. die Beisetzung der verbrannten Gebeine in kesselförmigen Gruben, wie sie besonders in Bornholm in einer verwandten Periode häufig sind, und auch


|
Seite 8 |




|
die "Steinkistengräber", d. h. aus Steinplatten zusammengesetzte Behältnisse für oft sehr zahlreiche Urnen, deren classisches Land West =Preußen zu sein scheint. Allerdings werden größere Steinkisten mit mehreren Urnen auch bei uns erwähnt (Pampow, Bandow, Moltzow, Perdöhl, bes. aber Grabow und Stralendorf, wo sogar 10 Urnen zusammen standen); aber diese sind wohl nur durch Erweiterung der einfachen Urnensetzung entstanden, nicht etwa als Reminiscenz der Grabkammern der Hünengräber aufzufassen. -
Vergleichen wir nun die Vorkommnisse in den Nachbarländern (Undset, S. 321 flgd.), so ist das Bild im Wesentlichen dasselbe. Es überwiegt die Hügelbestattung je weiter nach Norden, desto mehr; sie herrscht in den Gebieten an der unteren Elbe, in Holstein, Pommern, dem nördlichen Brandenburg; westlich davon werden die Urnenfelder schon in der Bronzezeit häufiger und erhalten das Uebergewicht im Süden: Sachsen, die Lausitz, Schlesien, Posen bilden ein zusammenhängendes Gebiet ihrer Herrschaft, in dessen nördlichen Theilen sie sich mit den Hügelgräbern berühren. In Pommern scheinen diese Hügel nach Osten hin zu verschwinden, und zwar erst durch Urnenfelder, dann durch Steinkistengräber abgelöst zu werden. Ein weiteres Verfolgen dieser Verhältnisse ist für unsere Zwecke nicht nöthig; es genügt der Nachweis, daß das Verbreitungsgebiet unserer Urnenbestattungen sich mit dem Schauplatze der "nordischen" Bronzezeit im Wesentlichen deckt.
Wir gehen damit zu der Behandlung der Beigaben über.
1. Die Urnen.
Fast sämmtliche hier zu behandelnde Urnen sind Grabgefäße, d. h. mit Knochen, gelegentlich auch Asche, gefüllt. Die Sitte, dem Verstorbenen sein Hausgeräth an Töpfen u. s. w. mitzugeben, die sich besonders in den schönen und großen Urnensetzungen von Posen und der Lausitz ausspricht, hat hier nicht geherrscht. Gewöhnlich ist es auch nur eine einzelne Urne, welche in der Steinpackung sich befindet; doch sind bis auf 6 beobachtet. In der Behandlung der Urnenformen schließe ich mich an die Besprechung von Lisch (Jahrb. XI, S. 353: "die Graburnen der Kegelgräber") an.


|
Seite 9 |




|
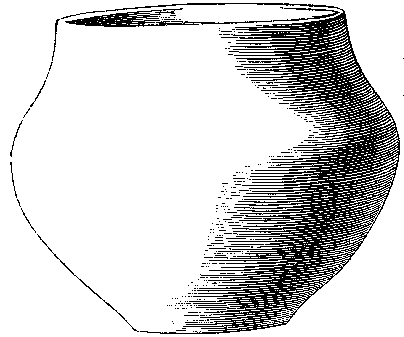
Die zuerst begegnende Form (A) sind die großen
ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, der etwa in der halben Höhe liegt, meist kurzem, etwas eingezogenem Halse und ohne Rand. Besonders typisch sind die Urnen von Liepen, Kummer, Gadebusch, Stolpe, Grabow, Perdöhl, Kleinow, Klink in der Größe von 35 - 18 cm. Aehnlich sind noch Urnen von Bollbrücke, Perdöhl (5 Ex.) und von Ludwigslust (3 Ex.). Von derselben Grundform, aber darin abweichend, daß der Halsansatz durch eine umlaufende Linie bezeichnet ist, sind Exemplare von Ludwigslust (2), Klink, Spornitz (abgeb. Frid. - Franc. V. 7), Grabow, die beiden letzteren auch noch dadurch ausgezeichnet, daß sie am Bauche durch schräge eingekerbte Rippen verziert sind. Weitere Abweichungen bestehen in einer Erhöhung des Halses (2 Ex. von Ludwigslust, Klink), einer Erhöhung des Bauchrandes (2 von Perdöhl), und ganz vereinzelt in der Umbiegung des Halsrandes (an einem schönen Exemplare von Grabow). - Diese Urnenform erstreckt sich nun weit über unser Gebiet hinweg, es ist die gewöhnliche Form der Ossuarien in schlesischen und posenschen Urnenfeldern (Undset VIII, 1), auch eine der Hauptformen der berühmten lausitzer Thongefäße, jedoch mit localem Unterschiede, indem dort der Halsansatz meist markirt ist und der gebogene Halsrand häufiger erscheint (Undset XIX, 2). Schon in die beginnende Eisenzeit hineinreichend tritt sie in Holstein (Grabhügel von Grevenkrug mit Schwert der "Hallstadt"periode, U. XXVIII, 14) und Brandenburg (Urnenfeld mit la Tène - Sachen, U. XXI, 20) auf. Fügen wir dazu gleiche Urnen aus Hügeln mit Urnensetzung in Hannover (v. Estorff, Heidnische Alterthümer von Ueltzen XV, 9) und Dänemark (Aarböger 1876, S. 146, Fig. 20), und ähnliche aus den östlichen Steinkistengräbern (U. XIII, 3), so ergiebt sich eine Gleichheit der


|
Seite 10 |




|
Urnenform für ein weites Gebiet, welche nicht zufällig sein kann und auf einen engen Culturzusammenhang dieser Gegenden in einer bestimmten Periode schließen läßt, dem wir im Folgenden näher zu kommen versuchen wollen.
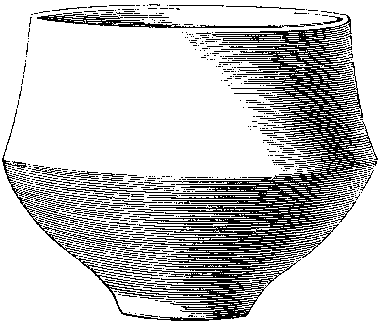
Noch charakteristischer für unser Gebiet ist aber eine zweite Form (B), deren wesentliches Merkmal der scharfe Bauchrand bildet, auch hier meist in halber Höhe der Gefäße liegend; auch bei ihnen schließt der Hals gerade ab. Wir haben sie in Gräbern von Bollbrücke (2 Ex.), Grabow (2 Ex.), Jörnsdorf, Kläden (2 Ex.), Kleinow=Ludwigslust (8 Ex.), Marnitz, Meyersdorf, Mölln, Perdöhl, Sparow, Spornitz, Vietlübbe, Wittenburg, Woserin. Abweichungen von der Grundform finden sich in der Weise, daß der Bauchrand gelegentlich etwas stumpfer ist, ferner, daß der Hals oder der untere Theil etwas eingezogen ist, so besonders bei Mölln. Eigenartig ist ein Spornitzer Exemplar, wo der Hals stark eingezogen, der untere Theil aber stark nach außen gerundet ist. Mit solchen Merkmalen ist der Uebergang zu Formen gemacht, welche weit in die Eisenzeit hineinreichen; in Eisengräbern von Müß, Häven und Pritzier sind Urnen gefunden, die der Möllner z. B. sehr ähneln. Merkwürdig ist, daß diese beiden Formen (A und B) bei uns selten neben einander sich finden: von den 40 Orten, an denen wir Grabstätten für unsere Periode in Anspruch nehmen und von denen die große Mehrzahl mehrere Urnen geliefert hat, sind es nur Bollbrücke, Grabow, Ludwigslust=Kleinow, Perdöhl, die beide Formen enthalten. Daß unser Typus B der jüngere ist, ist unzweifelhaft; daß aber alle Gräber, in denen er vorkommt, dadurch als jüngere charakterisirt werden, ist damit noch nicht gesagt. - Das Verbreitungsgebiet dieser Form ist nun ein ungleich beschränkteres als das von A. In Böhmen und Schlesien 1 ) häufig, verbreitet sie


|
Seite 11 |




|
sich durch die Lausitz (U. XVIII, 1; Jentsch, Gymnasialprogramm von Guben 1883, S. 4; Behla, Die Urnenfriedhöfe in der Lausitz, Tafel 1, 2) bis nach Brandenburg und in die Altmark, auch hier bis in die Eisenzeit hineinreichend. Dort berührt dieser Typus also unser Gebiet und erstreckt sich noch weiter Elbabwärts. Rautenberg (bei Koppmann, Aus Hamburgs Vergangenheit S. 19) bildet eine solche Urne als typisch für sein Gebiet ab, in Holstein scheint er zu fehlen und ebenso in Hannover, desgleichen ist er in unserm Osten selten. (Eine Urne gleich der Spornitzer s. bei Kühne, Baltische Studien XXXIII, Taf. 5, 31, aus Rügen, mit denselben Beigaben, von denen wir unten sprechen werden.) Es will nach diesen Fundverhältnissen fast scheinen, als ob diese Urnenform von Süden her auf dem Elbwege nach Norden gedrungen wäre, was sehr wohl mit dem Umstande stimmt, daß die darin gefundenen Beigaben sich überall gleichen. Daß sie in den südlichen Gegenden in Urnenfeldern, bei uns in Hügeln erscheint, streitet mit dieser Auffassung nicht, da der Norden an seiner traditionellen Form der Hügelbestattung sehr lange festgehalten hat.
Verwandt mit A ist eine bei uns seltene Form (C): Urnen mit wenig entwickeltem Bauchrande, die also der Cylinderform sich nähern.
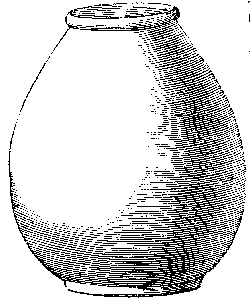
Wir haben sie aus älterer Zeit in Gräbern von Krenzlin und Rakow, aus unserer Zeit nur bei Perdöhl, Warlin, Kläden, Bollbrücke und Gallentin (3 Ex., das eine abgebildete etwas abweichend). Die Seltenheit dieser Form ist dadurch bemerkenswerth, daß sie in verwandten Gebieten gerade sehr häufig ist: so besonders im Osten, in Posen und Preußen. Es ist dieses die Form, welche vielen der bekannten Gesichtsurnen zu Grunde liegt (besonders deutlich erkennbar an dem in der Berliner Zeitschrift für Ethnologie 1877, Vhdlngn. S. 220, abgebildeten Exemplare). Ich kann auf diese wunderliche Specialität unsers Weichselgebietes hier nicht eingehen


|
Seite 12 |




|
und verweise auf die bei Undset S. 123 angeführte höchst interessante Litteratur; bis Meklenburg ist keine versprengt worden, ihre Gleichzeitigkeit mit unseren Brandgräbern ist aber durch Gleichartigkeit der Beigaben sicher gestellt.
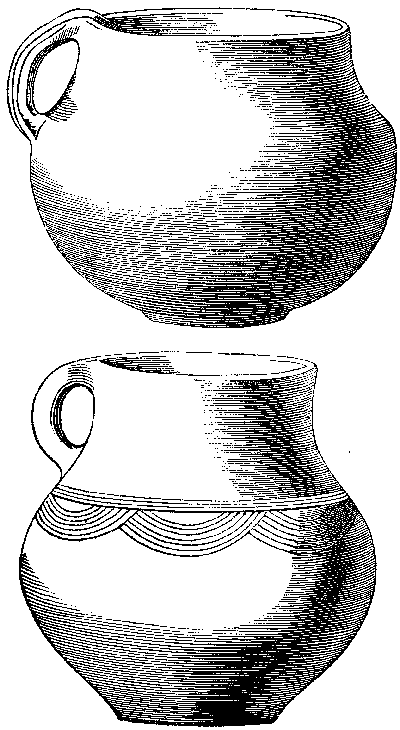
Getrennt von diesen drei Grundformen behandte ich die Henkelurnen (D), weil dieselben seltener als Ossuarien dienen und meist als Beigaben erscheinen; demgemäß sind sie im Ganzen kleiner. Die einhenkligen (Da) gehen meist, wie die abgebildeten aus Gallentin und Perdöhl, auf die Grundform A. zurück. Wir haben sie aus Göhlen, Perdöhl, Gallentin, Neu=Wendorf ,Steinbek, Rothenmoor, Spornitz, die letzteren besonders hübsch und ebenfalls mit dem oben bemerkten Einschnitte am Halse. Ihre Größe wechselt von 30 bis 16 cm; kleinere topf= oder tassenartige haben wir aus Perdöhl, Kläden, Retzow, Gallentin, Meyersdorf, Spornitz, Kiekindemark, Pampow. Interessant ist besonders das Spornitzer Gefäß; dasselbe hat Schrägeindrücke am Bauch und unten am Boden ein Grübchen; nahe liegt der Gedanke, daß wir darin eine Nachahmung der italischen


|
Seite 13 |




|
Bronzetechnik sehen, der Schalen, wie wir sie aus der Bronzezeit häufig, z. B. von Dahmen haben; derselbe gerippte Rand findet sich bei einem solchen Bronzegefäße von Weisin (Kegelgrab). 1 ) Von der erwähnten Grundform weicht ab ein Ludwigsluster Exemplar, welches einen sehr tief liegenden Bauchrand und einen hohen, flaschenartigen Hals hat, und ein Gallentiner, welches auf die Grundform A zurückgeht. - In diesem Zusammenhange mag auch ein Exemplar aus Warlin erwähnt werden, welches für uns einzig ist: dasselbe hat nämlich keinen ausgebildeten Henkel, sondern nur einen henkelartigen Ansatz, der in einen kleinen Halbmond endet. In altitalischen Terramare=Funden spielt eine ähnliche ansa lunata (s. Helbig, Italiker in der Poebene, Tafel I) eine Rolle, wohl aber ohne Zusammenhang mit unserm Gegenstande. Verwandt dagegen scheint eine Urne unsers Typus C aus einem Grabfelde von Tangermünde, welche 4 solche "platte, horizontal vorspringende, solide Knöpfe mit halbmondförmiger Ausbuchtung" zeigt (abgeb. in Zeitschr. f. Ethnol. 1883, Verhdlng. S. 374). -
Die Urnen mit zwei Henkeln (Db) zeigen einige Abweichungen. Hier haben die größten eine fast cylindrische Gestalt (zwei von Ludwigslust gleich der bei U. XI, 9 aus Posen und Jentsch, Gubener Programm 1883, 1). Solche, die auf Typus B zurückgehen, fanden sich in Mittelgröße zu Ludwigslust und Zickhusen. Gerade diese geschmackvolle Form ist häufig und weit verbreitet; sie ist eine Hauptform der lausitzischen und sächsischen Felder und der altmärkischen und niederelbischen Hügel (U. XVIII, 1, Rautenberg a. a. O. S. 19, Fig. 6) in Brandenburg reicht sie bis in die beginnende Eisenzeit hinein.
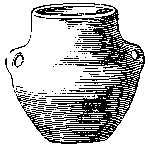
Die kleinen Gefäße mit zwei Henkeln gehen ebenso oft auf A (das hieneben abgebildete stammt aus Perdöhl), als auf B (Gallentin, Klink, Sembzin, Sukow) zurück.
Noch einige seltnere Formen sind zu erwähnen. Schalenförmige Henkelurnen (E) fanden sich in Kläden, ein elegantes Exemplar von 19 cm Höhe und 32 cm oberen Durchmessers hat einen ausgebogenen Rand und Schrägrippen am Bauche. Ein ähnliches ist in einer ganz vor Kurzem vorgenommenen Ausgrabung bei Bobzin aus der ältesten Eisenzeit ("la Tène") gefunden.


|
Seite 14 |




|
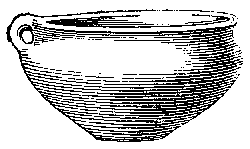
Das nebenbei abgebildete Moltzower Näpfchen hat ebenfalls die Vertiefung außen im Boden und erinnert auch in der Form an die getriebenen Bronzeschalen. Aehnliche größere flache Schalen dienen sehr oft als Deckel der Urnen (z. B. bei Klink, Ludwigslust, Perdöhl), sind aber bei den Ausgrabungen meist zerbrochen.
Eine seltsame Form haben die fast sargförmigen "Schachtelurnen" aus Sukow und Sandkrug (letztere nicht erhalten). In Holstein sollen sie häufiger sein (U. S. 302); interessant ist dort der Hügelfund von Wannbüttel, wo in der Urne eine reiche Ausstattung an Bronzekleingeräth, aber auch ein Schwert lag. Noch sonderbarer ist die Sitte, die Gebeine in Thongebilden, welche die Hausform nachahmen, beizusetzen. Die Anzahl dieser "Hausurnen" auf deutschem Boden ist eine beschränkte, ihr Verbreitungsgebiet ein begrenztes, und zwar bezeichnet das in Kiekindemark gefundene Exemplar die Nordgrenze. Auf die interessanten Folgerungen über die älteste deutsche Hausform, die man aus diesen Urnen gezogen hat, kann ich hier nicht eingehen und verweise auf die Schriften von Hennig und von Meitzen über das deutsche Haus; doch sind die ethnischen Deutungen des Letzteren mit Vorsicht aufzunehmen.
Aus dieser Uebersicht über die Urnen ergiebt sich, daß der Formenreichthum gerade kein großer ist. Und auch die Ornamentirung ist eine ziemlich einfache. Die Farbe ist ganz überwiegend die; natürliche hellbraune des Thones; nur selten sind geschwärzte Gefäße, und diese nicht annähernd von der Schönheit der späteren aus der Eisenzeit. Bemalung findet sich nie; auch plastische Verzierungen sind selten. Auf das Fehlen der "Gesichtsurnen" ist schon hingewiesen, aber auch die bei Urnen vom "lausitzer Typus" so beliebte Verzierung durch starke, herausgearbeitete oder aufgesetzte Buckel fehlt; wir haben ein einziges Exemplar, aus dem eigenartigen Grabe von Slate, auf welches schon oben hingewiesen ist. Eine Urne (C) von Bollbrücke hat am Rande einen herumlaufenden Wulst mit Einkerbungen. Sonst bestehen die vorkommenden Verzierungen in Schrägrippen (A in Spornitz, Grabow, Da in Retzow, Spornitz, D b in Retzow, Liepen, E in Kläden), oder in starken regelmäßigen Linien, die um den Hals herumlaufend in spitzen Winkeln an einander stoßen [nur Fahrenhaupt (B) und Göhlen (Da)], oder in concentrischen Bogenlinien unter dem Halsansatze (Perdöhl Da),


|
Seite 15 |




|
oder in einer etwas künstlicheren Combination von Punkt und Strichornament (Da zu Pampow, Db zu Retzow und Liepen, hier zugleich mit Schrägrippen, Gallentin), oder schließlich in ganz flüchtigen, mit einem kammartigen Instrument eingeritzten Verzierungen am unteren Theile, - so zu Grabow (A) und Rothenmoor (Scherbe). Ein recht bezeichnendes Exemplar dieser Art von unserm Typus A ist in Tangermünde zusammen mit der oben besprochenen Urne gefunden.
Das Gesammtergebniß aus dieser Betrachtung der Urnen giebt demnach kein hervorragend günstiges Bild von der Geschicklichkeit und dem Geschmack unserer Töpferei, die sich nicht entfernt messen kann z. B. mit der Lausitz, dem classischen Lande der Thongefäße in dieser Periode. Urnen von eleganter Form und feiner Arbeit kommen vor, sind aber selten und zeigen zum Theil solche Abweichungen von der Grundform, daß man bei einigen (z. B. bei solchen aus Slate, Spornitz, Liepen, Retzow) fast an einen Import denken möchte.
2. Die Bronzen.
Es ist durchgehende Sitte der letzten Bronzezeit, die Beigaben unverbrannt den Gebeinen in der Urne zuzufügen. Schon dadurch wird das Mitgeben, z. B. von Schwertern erschwert. Aber auch sonst fällt eine gewisse Aermlichkeit auf; im Verhältniß zu der Zahl der aufgedeckten Urnen sind die Beigaben recht spärlich. Man hat das oft so zu erklären gesucht, daß unsere Gräber denen mit reicher Ausstattung gleichzeitig und Grabstätten des niederen Volkes seien; dem widerspricht aber, daß die Bronzefunde derselben ganz andere Formen zeigen. Wer mit der Anschauung unserer reichen und in sich zusammenhängenden alten Bronzezeit an diese Gräber in ihrer Gesammtheit herantritt, der fühlt sich in eine ganz fremde Formenwelt versetzt, wo Alles enger, kleiner und kümmerlicher ist; und wenn man sich zu einer Sonderung dieser unscheinbaren Dinge entschließt, so findet man, daß dieselben schwer zu localisiren sind, daß sich dieselben Nadeln, Messer u. s. w. über weite Gebiete hin erstrecken, ohne daß man immer angeben könnte, wo denn gerade diese Form sich entwickelt, oder woher sie ihren Weg zu uns gefunden hätte. Erst mit dem Auftreten der ältesten mitteleuropäischen Eisenculturen bekommen wir wieder festen Boden unter die Füße und können bestimmte Exportstätten constatiren. Für unsere Zeit müssen wir meist darauf verzichten, zu bestimmen, ob der betreffende Gegenstand hier zu Lande gearbeitet ist oder nicht; einen Mittelpunkt der Metallbearbeitung hat unser Land aber auf keinen Fall


|
Seite 16 |




|
mehr gebildet. Und wenn man wirklich den Umstand, daß man jetzt dem Helden statt Schwert und Speer - Rasirmesser und Haarzange mit ins Grab giebt, nur als eine mehr zufällige Veränderung der Sitte auffassen wollte, die uns nicht berechtigt, Schlüsse auf den allgemeinen Culturzustand zu machen, so bezeichnet doch dieses Verschwinden der heimischen Industrie einen Rückgang öffentlichen Lebens, der eine Erklärung ercheischt. Das ist natürlich auf strenge wissenschaftlichem Wege nicht möglich; es läßt sich aber auch nichts dagegen sagen, wenn man sich vorstellt, daß, wie ich mich schon früher ausgedrückt habe, das Volk unserer Bronzezeit in jenen stürmischen Zeiten wilder Völkerbewegungen (sind doch Cimbern und Teutonen sicherlich nur die am meisten nach Süden getriebene Woge einer den ganzen Norden berührenden Fluthung!) den besten Theil seiner Kraft abgegeben und sich nur ganz allmählich, vielleicht durch Aufnahme neuer Stämme unterstützt, wieder zu der Blüthe erhoben habe, in der es die Funde aus dem Beginn unserer Zeitrechnung zeigen. Doch, wie gesagt, das gehört der Phantasie an. Ich begnüge mich im Folgenden das Material vorzuführen.
Nach dem Obigen ist es noch mehr das Fehlen der älteren Formen als das Erscheinen von neuen, welches unsere Periode charakterisirt. Es fehlen gänzlich die Dolche, die Schaftkelte, Diademe, Schmuckdosen. Handbergen, eine Hauptcharakterform der meklenburgischen Bronzezeit, werden an zweien unserer Fundstätten erwähnt: bei Göhlen, wo aber ein genauerer Fundbericht fehlt, und bei Kläden, wo jüngere und ältere Bestattungen sich neben einander finden; ebenso ist es mit einer Speerspitze ältester Form, die zusammen mit einem Armring in einem Hügel von Retzow ohne Urne sich fand. Auch wo Schwerter erwähnt werden, bei Sukow und Kläden, sind sie nicht aus Urnenbegräbnissen entnommen, sondern aus Hügeln älterer Form. Dagegen finden sich häufiger kleine Nachbildungen von Schwertern, die wir als "symbolische" bezeichnen. Ich will auf den eigenthümlichsten Fund der Art, den von Kummer, wo eine Schwertform nachgebildet ist 1 ), die sich selbst in Gräbern gar nicht findet, nicht eingehen, da ich das Grab von Kummer der älteren Zeit zuschreibe. Dagegen finden sich in Urnen kleine Spitzen von 6 - 10 cm Länge, die ich hierher zähle, obwohl sie meist als Pfeilspitzen bezeichnet werden, wozu sie ja unzweifelhaft auch gebraucht sein können (Abbildungen


|
Seite 17 |




|
im Frid. - Franc. XXV, 7, und bei Rygh, Antiquités norvegiennes 113), und zwar in Spornitz, Eikhof, Sukow, Jörnsdorf. Das ist aber auch Alles, was wir an Waffen in unseren Gräbern haben. Selten sind auch die Celte, das am reichlichsten gebrauchte Geräth der Bronzezeit. Wir haben nur einen Hohlcelt (aus Göhlen=Montelius, Antiquités suédoises 147) und drei Flachcelte mit starken Seitenrändern aus Göhlen und Retzow (= Montelius, A. s. 140), - beides Formen, die in Gräbern der älteren Zeit fast gar nicht vorkommen und nur aus Einzelfunden oder Moorfunden, die ich im Allgemeinen für jünger halte als die Grabfunde, bekannt sind. Als Einzelheit erscheint es auch, wenn in Sukow zwei Sicheln von der bekannten Bronzealterform (s. Frid. - Franc. XVII, 7; Montelius, A. s. 183) sich finden. Auch hierin berühren sich unsere Gräber mit den lausitzer Urnenfeldern 1 ), wo Celte und Sicheln gelegentlich vorkommen. - Durchgängig treten dagegen folgende Gruppen von Fundstücken auf:
I. Messer.
Ein durchgehender Unterschied findet sich zwischen diesen und den älteren. Letztere haben eine flache, fast halbmondförmige, nach unten gebogene Klinge; sie sind nordisch und so häufig, daß ich auf das Nähere hier nicht eingehe. Auf unserm Gebiete sind sie in Göhlen, Kläden, Sukow gefunden, - Orten, wo, wie schon oben erwähnt, ältere und jüngere Begräbnisse sich neben einander finden; die Fundberichte geben nicht an, daß sie aus Urnen stammten. Der jüngeren Zeit gehören dagegen die Messer an, deren Klinge am Ende nach oben gebogen ist oder aus einem drei= oder viereckigen Stück Bronze besteht. Auch hier bestehen bedeutende Unterschiede.
1. Als einen Importgegenstand von Südwesten her dürfen wir das schöne Messer von Vietlübbe betrachten (genau=Montelius, A. s. 193). Dasselbe hat eine starke, nach oben gebogene, 25 cm lange Klinge und Linearverzierungen im Charakter der Bronzezeit oben auf der Kante. Leider fehlt der Griff. Diese Messer gehören zu den verbreitetsten Alterthumsgegenständen. S. Müller a. a. O. S. 45 giebt die Nachweise von Ungarn bis Eng=


|
Seite 18 |




|
land, Tröltsch, Fundstatistik S. 42, für Süddeutschland, Lindenschmit A. u. h. B. II, 8, Tafel 2, eine Reihe von Abbildungen dieses Typus. Ihre Heimath scheinen die schweizer Pfahlbauten zu sein, wo sie sehr zahlreich, gefunden sind, und daneben die Gußformen für dieselben (Groß, les Protohelvètes XXVIII, 6 u. f.); daß sie aber nicht alle von dort exportirt, sondern auch anderwärts selbständig gegossen sind, beweist eine bei Müncheberg gefundene Gußform. In unsern ältern Gräbern fehlen sie gänzlich, und auch in den jüngeren ist nur dieses eine gefunden, - uns interessant als Beleg dafür, wie in dieser Periode das Gebiet der nordischen Bronzecultur von der schweizerischen berührt wurde.
2. Messer mit nach vorn gebogenem Griff. Dieselben haben eine breite, flache Klinge von viereckiger Grundform. Sie erinnern sehr an eine schon in der älteren Zeit vorkommende Form: die Messer mit Pferdekopfgriff, die bei uns gelegentlich in älteren Gräbern erscheinen (so in Friedrichsruhe, Jahrb. XLVII, S. 262) und im Norden häufig sind (s. u. a. S. Müller a. a. O. S. 41). Offenbar sind sie als Entwickelung oder vielmehr Verkümmerung dieses der "östlichen, jüngeren Richtung" der Bronzecultur (S. Müller) angehörenden Typus aufzufassen. Wir haben sie aus Dobbin (abgeb. Tafel II, 1) und Sukow, und offenbar gehört die Mehrzahl der Messer aus Bronzeblech, die nur einen Griffansatz haben, hierher. Es sind das die von Sukow (2 weitere Exemplare), Karstädt, Steinhagen, Picher, Klink, Alt=Schwerin, Retzow Perdöhl, Rehberg. Solche Klingen gehören dem ganzen nordischen Gebiete an, scheinen aber auch in dieser jüngeren Periode im Osten ungleich häufiger zu sein.
3. Messer mit zurückgebogenem Griff, die Grundform der Klinge ist viereckig oder dreieckig. Auch hier ist die Grundform in einer älteren Bronzezeit zu suchen; die bekannten Messer mit rückwärts gerollter Spirale geben das Vorbild. 1 ) Ich kann hier auf die verschiedenen Erklärungsversuche für die Ableitung dieser Grundform selbst nicht eingehen. Ich sehe mit S. Müller darin eine westliche Form und halte mit ihm eine Entstehung aus schweizer Pfahlbautypen sehr wohl für möglich. Sehr oft sind die Klingen dieser Messer mit Wellenornamenten versehen, aus denen das eigenartige Schiffsornament sich entwickelt. Wir haben diese Form in älteren Gräbern nur einmal, und zwar unverziert (in dem etwas verdächtigen Grabe von Prislich); das Schiffsorna=


|
Seite 19 |




|
ment findet sich auch nur einmal, nämlich in dem jüngeren Grabe von Meyersdorf (s. Taf. II, Fig. 2). Sonst aber kommt diese Messerform in unserer Periode ziemlich oft vor, mit einem an alten Bronzen häufigen Ornament in Spornitz (Taf. I, Fig. 3) unverziert in Steinbeck 1 ), Lübstorf, Gallentin, Göhlen 1 ). Vietlübbe, - alle diese mit viereckiger Klinge, dann in Stolpe, Jörnsdorf, Greven, Steinbeck 1 ), Sparow 1 ), Spornitz 1 ), Eikhof, Bandow, diese mit dreieckiger Klinge.
4. Durch Combination der gebogenen Klinge unserer Form 1 und des rückgebogenen Griffes von 3 ergiebt sich eine Weiterentwickelung, welche Tafel II, Fig. 4 darstellt. Dahin gehören Messer von Sukow, Lelkendorf. Dobbin (das abgebildete Exemplar), Warlow, Stralendorf, Rehberg.
5. Gelegentlich wird auch der Griff durch eine Oese gebildet. Taf. II, Fig. 5 zeigt ein aus der eben besprochenen Form hervorgegangenes Exemplar aus Kiekindemark; ähnlich ist eines aus Zepkow; auf unsere Form 3 gehen Messer aus Perdöhl, Stolpe und Sukow zurück.
Alle diese Formen sind uns nicht eigen. Wie das von Kiekindemark ist eines aus dem holsteiner Urnenfunde von Meßdorf, wie das von Perdöhl (Form 5) eines aus Hannover (Lindenschmit a. a. O. Fig. 15), Exemplare von Form 3 sind in Dänemark in einem Hügelfunde junger Bronzezeit (Aarböger 1868, S. 117, Fig. 12) auf Sylt in mehreren Hügeln mit Schwertern, Pincetten u. s. w. gefunden, aber auch in einem Urnenfelde von Pinneberg (U. XXVIII, 16), Form 4 ist in Hannover sehr häufig (Kemble, Horae feriales, und v. Estorff, Heidn. Alterth. von Ueltzen an mehreren Stellen) u. s. w. Im Allgemeinen scheinen sie westlich in eine höhere Zeit hinaufzureichen (Schalkholz i. Holstein: Form 5 mit Diadem), sind aber überall als junge Entwickelungen alter Bronzen aufzufassen.
II. Pincetten.
Diese eigenthümlichen kleinen Geräthe, deren Bestimmung noch immer nicht über allen Zweifel festgestellt ist, erscheinen schon in älterer Zeit und reichen noch in eine spätere hinein; jedoch ist es unsere Periode, aus der die große Mehrzahl stammt. Ihre Grundform (s. Tafel II, F. 6) ist immer dieselbe und erträgt nur geringe Abweichungen; ihre Größe wechselt zwischen 4 und 11 cm. Oft


|
Seite 20 |




|
sind sie ganz unverziert (s. Bastian u. Voß, Bronzeschwerter XVI, 29), so in Klink 3 Exemplare, andere in Eikhof, Lelkendorf, Retzow, Dobbin; meist aber haben sie drei erhabene Punkte (wie Montelius, A. s. 200, 201; Rygh, A. n. 121), so in Dobbin, Sukow, Spornitz, Greven. Dazu treten noch Strich= oder Linearverzierungen, so bei Rambow, Dobbin (das auf Taf. II, Fig. 6 abgebildete Exemplar) und Toddin. Manchmal fehlen auch die Punkte, und es treten Wellenlinien im Charakter des Meyersdorfer Messers dafür ein, so in Lüssow, Bandow und Stralendorf. Eigenthümlich ist, daß die Herstellung verschieden ist; die Mehrzahl ist offenbar gegossen, einige aber sind aus Bronzeblech gebogen; so erscheinen die Punkte oft massiv aufgesetzt, wie bei dem abgebildeten Exemplar, oft von innen heraus getrieben.
Sie scheinen über den ganzen Norden ziemlich gleich verbreitet und kommen meist mit den flachen Messern zusammen vor; die mit Wellenornament sind mehr dem Westen eigen, im Osten sind sie fast alle einfach. Nach Süden zu verschwinden sie gänzlich und charakterisiren sich dadurch als Product der nordischen Bronzecultur.
III. Nadeln.
Die ganze Bronzezeit ist überaus reich an Nadeln verschiedensten Gebrauches und verschiedenster Form. Wir beobachten aber hier dasselbe wie bei den Messern, daß nämlich die alten, kräftigen, originalen Formen verschwinden und fremden das Feld räumen, deren Herkunft und Entstehung sich theilweise nachweisen läßt.
1. Am meisten erinnern noch an die alten Formen einige gerade, kräftig gearbeitete Nadeln mit plattem oder kugeligem Kopfe, so die von Lelkendorf (Taf. II, Fig. 7), Hagenow, Kiekindemark (Taf. II, 8), Kläden; der Kopf verschwindet bei einer aus Alt=Schwerin. Aehnliche Formen sind in sächsischen, lausitzer und posener Urnenfeldern nicht selten und reichen dort bis in die Eisenzeit hinein.
2. Daran schließen sich gerade Nadeln mit kleinem kugeligem oder plattem Kopfe von zarter Arbeit; solche fanden sich zu Gallentin (Taf. II, Fig. 9), Stralendorf, Klink (2 Exemplare). Diese Nadeln sind nun fast überall sehr häufig, und zwar scheinen sie im Süden (Schweiz) noch häufiger vorzukommen als im Norden: ob sie darum, wie S. Müller (a. a. O. S. 118) meint, von dort importirt sind, bleibe dahingestellt, da sie sich ja auch sehr gut aus den nordischen Formen erklären lassen. Für uns interessant ist ein, soviel ich weiß, noch nicht publicirter Grabfund von Milaver


|
Seite 21 |




|
bei Domaglic im Prager Museum, wo diese Nadel neben einem Kesselwagen (ähnlich wie unser berühmter aus Peccatel) und einer Schale gleich der des Friedrichsruher Glockenbergs (s. Jahrb. XLVII, S. 273) gefunden ist.
3. Beide erwähnte Formen können nicht als Charakterformen der behandelten Zeit gelten; das sind erst die Nadeln mit Biegung. Da erscheinen zunächst die stark gearbeiteten mit gebogenem Kopfe. Taf. II, Fig. 10 giebt die Grundform (s. auch Montelius, A. s. 215). Alle haben eine oben vierseitige starke Nadel und sind gleich groß, 8 cm. Wir haben sie aus Bandow, Eikhof, Leussow, Prislich, Stolpe, Sukow (das abgeb. Exemplar). Diese Nadeln sind nun entschieden nordisch und scheinen ein sehr beschränktes Gebiet zu haben; höchst interessant ist u. a. die bei Undset, a. a. O. Fig. 46, abgebildete Nadel aus einem Urnengrabe auf Fünen. Hier wird nämlich der Kopf von einem Menschengesichte gebildet, wie es ähnlich an Messern u. ä. dieser Zeit vorkommt. Seltener sind Nadeln gleicher Arbeit mit flach segelartigem oder scheibenförmigem Kopfe, so 3 Exemplare von Sukow (s. Taf. II, Fig. 11).
4. Besonders eigenthümlich sind die Nadeln mit gebogenem Halse wie Tafel II, Fig. 12. Der Kopf wird meist von einer hohlen Schale gebildet. Solche Exemplare haben wir aus Klink, Vietlübbe, Kläden, Poltnitz (das abgeb. Exemplar), Spornitz; nur mit einfacher Biegung: von Gallentin; doppelte Biegung mit kegelförmigem oder rundem Knopfe zeigen Nadeln von Gadebusch, Borkow, Retzow, außerdem enthält die Sammlung zwei zerbrochene Exemplare von Liepen und Perdohl. Aehnliche Nadeln enthalten einige Gräber von älterem Charakter; hier ist die Biegung einfach und der Kopf sein profilirt, so bei Stolpe, Kummer und Toddin (abgeb. Frid. - Franc. XXXII, 25). Besonders interessant ist es, daß bei dem reichen Ringfund von Ludwigslust eine gleiche Nadel aus Eisen zu Tage getreten ist, über die unten zu sprechen sein wird.
Aus den nordischen Bronzen ist diese Nadel nicht zu erklären, aber auch ein schweizer Exportgegenstand scheint sie nicht zu sein; wenigstens habe ich sie in den meisten schweizer Museen unter den Pfahlbaufunden vergeblich gesucht. Dagegen sind sie in Grabfunden Süddeutschlands, besonders in Baiern, sehr häufig, allerdings nicht die mit Schale, sondern die mit massivem Kopfe (s. Tröltsch, Fundstatistik der vorrömischen Metallzeit, Fig. 76). Nach einer freundlichen mündlichen Mittheilung von Dr. Otto Tischler (Königsberg) gehen sie weit nach Frankreich hinein und


|
Seite 22 |




|
sind besonders in der Franche Comté häufig. Im nördlichen Gebiete erscheinen sie vor Allem im Osten massenhaft, merkwürdiger Weise noch nicht in Böhmen, aber sonst im ganzen rechtselbischen Gebiete, allerdings auch hier im Ganzen häufiger mit massivem Kopfe, als mit Schale (Nachweise bei Undset); in Holstein sind sie seltener, in Hannover wohl nur sporadisch. Vielfach reicht diese Nadel in die Eisenzeit hinein und ist, was wir unten noch zu besprechen haben, einer der Bronzegegenstände, der mit am frühesten in Eisen nachgebildet ist. - Verwandt mit dieser Form ist eine gerade Nadel, welche die eigenthümliche Schale als Kopf hat, so aus Sukow; sie kommt in Sachsen (U. XXII, 4), Pommern (s. Kühne a. a. O.) und Holstein vor.
Schien uns bei dieser Form der schweizer Ursprung nicht bewiesen, so ist derselbe um so unzweifelhafter bei der nächsten,
5. Nadeln mit spiralig umgebogenem Kopfe, gelegentlich mit einer Einbiegung unter demselben. In den Museen in Bern, Freiburg und Lausanne liegen sie aus benachbarten Pfahlbaufunden in größter Masse, und zwar gewöhnlich zusammen mit Messern gleich dem oben besprochenen aus Vietlübbe, aber auch mit getriebenen Bronzegefäßen. Sehr oft saß in der spiraligen Umbiegung ein Ring. Merkwürdig ist nun, daß solche Nadeln ebenso wie die getriebenen Bronzeschalen bei uns gelegentlich in Mooren gefunden werden. Damit wird eine Gleichzeitigkeit mehrerer Moorfunde mit unsern jüngeren Grabfunden constatirt, welche möglicherweise zu einer schärferen Scheidung der Moorfunde führen wird. Solche Moorfunde sind von Bützow, Roggow und Sülz eingeliefert: in Gräbern haben wir die Nadel nur bei Greven und Ludwigslust (Kleinow). - Auch diese Form ist im Norden allgemein verbreitet, besonders, wie es scheint, wiederum im Osten; in Kiel habe ich sie aus Funden notirt, welche dieselbe Zusammensetzung haben, wie die oben erwähnten schweizer Pfahlbaufunde, aber auch aus einem der ältesten Urnenfelder der Eisenzeit, dem von Ohrsen. Es mischen sich überhaupt in Holstein die Bronzefunde mit Eisenfunden viel häufiger als bei uns, wo der Uebergang nach den bisherigen Beobachtungen doch noch ein recht schroffer ist. Liegen erst die erwarteten Publicationen der holsteinischen und niederelbischen Urnenfelder vor, so dürfen wir daraus auch für das Verständniß unserer jüngsten Bronzezeit den reichsten Gewinn erhoffen.
6. Auch Nadeln mit Oehr, ganz wie unsere Nähnadeln, kommen vor; so in Alt=Schwerin, Hagonow, Perdöhl, Sukow (s. Montelius, A. s. 205). In der älteren Bronzezeit fehlen sie,


|
Seite 23 |




|
reichen aber in die Eisenzeit hinein, wie es ja bei einem so nützlichen Geräthe natürlich ist.
7. In diesem Zusammenhamge seien auch die Pfriemen erwähnt, einfache Bronzestifte, oben vierkantig, von 4 - 10 cm Länge (s. Montelius, S. 204). Sie stammen zum Theil aus älteren Gräbern in unserer Zeit, aus denen zu Ludwigslust, Bandow, Klink, Dobbin, Vietlübbe (eingeklemmt in einen Knochen).
IV. Ringe.
Diese erscheinen in Menge und in großem Reichthum der Formen.
a. Halsringe.
1. Halsringe mit schrägen Riefeln (sog. torques) von wechselnder Torsion (s. unten die Abbildung) sind eine wichtige und weit verbreitete Form. 3 Exemplare sind in Vietlübbe gefunden; sie sind verhältnißmäßig schwach (Durchmesser des Drahtes 0,5 cm) und haben sehr flache Riefeln mit vier Wendestellen. Diese Form (s. Montelius, a. a. O. 227) scheint der folgenden zu Grunde zu liegen. - S. Müller a, a. O. S. 102 giebt ihre Verbreitung an. Danach hat sich diese Ringform in Mitteldeutschland entwickelt und erscheint daher in den skandinavischen Ländern nur unter Verhältnissen, welche sie als Fremdlinge charakterisiren. Besonders wichtig ist der Fund von Ludwigslust. Hier wurden vier Ringe ähnlicher Art gefunden, die man als Weiterentwickelung dieses Typus ansehen kann. (S. Montelius, S. 229; Müller a. a. O. S. 102; Frid. - Franc. XXXII, 3). Alle vier sind gleich, offenbar in einer Form gegossen und die Rillen nachgefeilt, sie haben sieben Wendestellen und eine Dicke von 1 1/2 cm.

Ein gleicher Ring ist in einem Grabe von Krebsförden gefunden, doch ist leider kein genauerer Fundbericht vorhanden; sonst kommen sie nur in Moorfunden vor, so in Walsmühlen, Lübbersdorf, Warin, Kolbow, Reinshagen, Krusenhagen, also wiederum mit Uebereinstimmung, auf deren Wichtigkeit schon oben hingewiesen ist.


|
Seite 24 |




|
Während diese Ringe bei uns nur der Bronzezeit angehören, treten sie sonst fast überall zusammen mit Eisen auf. Wenn sie aber v. Tröltsch, Fundstatistik Fig. 49, daher direct der la Tène - Priode zuweist, so ist man dazu nach dem oben Gesagten nicht berechtigt; die Entwickelung dieser Ringe ist entschieden noch auf dem Boden einer Bronzecultur vor sich gegangen. In der Schweiz scheinen sie zu fehlen; den ganzen Rhein entlang aber erscheinen sie in Grabhügeln und Urnenfeldern.
Ein besonders wichtiger Mischfund ist der durch Virchow mehrmals besprochene von Priment in Posen (s. bes. Compte rendu du congrès international de Stockholm 1874, I, S. 522). Hier wurde nämlich in einer Kiste von getriebener Arbeit im Charakter der Hallstadtcultur ein solcher torques neben einer eisernen Axt gefunden, also die Vertreter von drei Perioden neben einander. Auch sonst findet sich bei Torques mit Hallstadtsachen zusammen (Fund aus der Ukermark, U. S. 193), während er an anderen Stellen, z. B. in Holstein, mit la Tène - Typen, ja sogar mit römischen Fibeln zusammen (Pinneberg, U. S. 317) erscheint. Auch bei uns ist er ja mit einer eisernen Nadel zusammen gefunden. Sehr bemerkenswerth ist aber, daß die oben erwähnten Moorfunde zum Theil viel ältere Formen enthalten, ein Umstand, der darauf hinzudeuten scheint, daß die Bronzezeit bei uns sich länger gehalten hat als in den anderen Ländern.
2. Halsringe mit gleichlaufender Riefelung. Bei mehreren derselben ist der Uebergang zur Linearverzierung deutlich erkennbar, so bei einem Ludwigsluster Exemplar, wo der dem Charnier sich nähernde Theil mit Zickzacklinien im Geschmack der älteren Bronzezeit versehen ist.
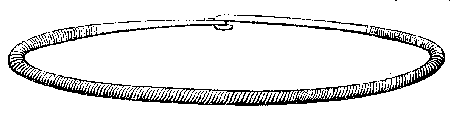
Will man diese verschiedenen Ringformen durch die Construction einer typologischen Entwickelungsreihe erklären, so muß man die geriefelten voranstellen und die Linien als Andeutung der Riefelung auffassen. Das stimmt aber mit den Funden gar nicht. Gerade der ältesten Bronzezeit sind geriefelte Bronzeringe ganz fremd, und die Verzierung ist überwiegend linear. Ich glaube demnach, daß die geriefelten Ringe von einer südlichen, jüngeren Bronzecultur eingedrungen und mit der nordischen Praxis eine Verbindung eingegangen sind, kann aber bei dem geringen nur vorliegenden Material eine Ausführung in das Einzelne nicht


|
Seite 25 |




|
wagen. Die Enden sind verschieden gestaltet; entweder sind sie gerade und spitz zulaufend, oder sie biegen sich zu einer Oese um, oder sie fassen über einander und bilden so einen Haken. Wir haben sie aus Ludwigslust (8 Exemplare mit rückgebogener Oese, drei unverziert; s. auch Jahrb. XLVIII, S. 330), Sukow, Retzow, Alt=Schwerin, Rothenmoor, Vietlübbe, Steinhagen, Spornitz (das abgeb. Stück) mit stärkerer oder geringerer Riefelung und meistens überfassenden Haken, und ein ganz unverziertes Exemplar aus Klink.
b. Handringe.
Die Handringe sind das häufigste Fundstück unserer älteren Bronzezeit und haben gerade auf meklenburgischem Boden eine sehr reiche Entwickelung durchgemacht. In unserer Periode werden sie seltener, und treten zum Theil in Formen auf, die sich aus den älteren nicht erklären lassen.
1. Aeltere einheimische Formen sind nur in dem Ludwigsluster Ringfunde und in Retzow vertreten. Und auch da ist es bezeichnend, daß in Ludwigslust die starken Ringe mit ovalem oder rautenförmigem Durchschnitt nicht vorkommen, sondern nur die nach innen ausgekehlten mit starken Verticaleinschnitten auf der Außenseite (s. Frid. - Franc. XXII, 9). Wir dürfen diese als jüngste Entwickelung der alten Form erklären, was mit ihrem Vorkommen in Gräbern von Peccatel, Slate, Holzendorf, Grabow, Friedrichsruhe, und in Moorfunden von Roggow und Marnitz, welche meist schon eine "Hinneigung zu südlichen Culturen" (in Peccatel: der getriebene Kesselwagen, zu Slate: die Buckelurnen, zu Friedrichsruhe: Thonperlen! u. s. w.) zeigen, vortrefflich paßt. Die (4) Exemplare von Retzow haben einen ovalen Querdurchschnitt und charakterisiren sich dadurch als älter, dagegen sind ebenfalls relativ jung die flachen, dünnen, ziemlich hohen Ludwigsluster Ringe (Fr. - Fr. XXII, 8), welche dem Norden fremd zu sein scheinen.
2. Aeltere, fremde Formen. Ich bezeichne damit die Ringe, die nach S. Müller einer östlichen Cultur zuzuschreiben sind und bei uns als Fremdlinge in Mooren erscheinen (s. S. Müller, a. a. O. S. 32, Fig. 30) Das hier abgeb. Exemplar
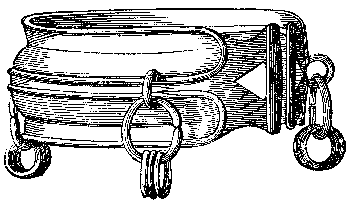


|
Seite 26 |




|
entstammt einem Moorfunde von Roga 1 ), ganz ähnliche sind aber in Gräbern von Ludwigslust (Kleinow), Alt=Schwerin, Vietlübbe und Borkow gefunden - also wiederum eine Gleichzeitigkeit von Moorfunden und unsern Gräbern!
3. Geriefelte Ringe. Für sie gilt dasselbe, was oben bei den Halsringen gesagt ist; doch sind sie nicht häufig (Kleinow, Sukow, Klink, Grabow) und sehr undedeutend.
4. Wichtiger, aber leider nur in undedeutenden Exemplaren vertreten, sind die Ringe mit einer stollenartigen Erhebung am Ende, die sich schon hierdurch von den älteren, welche sämmtlich gerade abschließen, unterscheiden. Wir haben sie aus Sukow, Alt=Schwerin, Reutershof, Kleinow, Hagenow. Ihre südliche Herkunft ist unzweifelhaft.
Eigenartig sind Ringe mit Oesen, die ich hier anhangsweise bespreche. Sie scheinen eine für Holstein specifische Form zu sein und sind dort in jüngster Zeit in Massen gefunden, meistens schon in Funden der Eisenzeit (s. J. Mestorf bei Undset S. 307). Ihre Bedeutung ist noch räthselhaft. Wir haben sie aus Karstädt und Alt=Schwerin.
c. Kleinere Ringe.
Diese wechseln zwischen 1 1/2 und 5 cm und dienten sicher verschiedenen Zwecken. In der Schweiz findet man sie häufig in der Oese der Nadel mit gebogenem Kopfe (unserm Typus 5), aber auch in solchen Massen auf einander liegend, daß der Gebrauch als Werthmetall hier wahrscheinlich wird und die Bezeichnung als "Geldring" berechtigt erscheint, zumal sie zum Theil so schwach gearbeitet sind, daß ein praktischer Gebrauch sich ausschließt. Bei uns kommen sie schon in älteren Gräbern vor, aber meist von kräftigerer Arbeit; später werden sie sehr häufig (Göhlen, Reutershof, Stolpe, Sukow, Ludwigslust, Retzow, Steinhagen, Bollbrücke, Lelkendorf, Sembzin, Kuppentin, Moltzow, Klink, Kläden u. s. w.). Einige ganz unregelmäßige darf man sicher als Geldringe ansehen, so die von Moltzow und Sukow.


|
Seite 27 |




|
Doch kommen auch künstlichere Fingerringe vor, so in Ludwigslust einer in Form einer Handberge und einer in Form eines Spiralcylinders mit umgebogener Oese; sonst auch einfachere Spiralwindungen in der Art der Goldringe, so in Ludwigslust, Spornitz und Grabow; in Spornitz auch ein massiver Ring von 1 cm Höhe, wie sie aus der älteren Bronzezeit aus Bronze oder Gold in Friedrichsruhe sich finden (s. Jahrb. XLVII, Tafel VI, 8 und 9).
V. Fibeln.
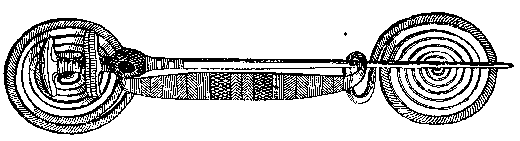
Dieses häufige Fundstück der älteren Bronzezeit verschwindet in unserer Periode allmählich. Seine Grundform ist hier dieselbe wie früher, Spiralplatten, flacher oder gewundener Bügel, am Nadelende Querbalken oder Verdickung. Ich halte die hier abgebildete Form von Retzow für die ältere, und ihr Vorkommen würde befremden, wenn nicht gerade Retzow mehrere ältere Typen bewahrt hätte und auch durch die Bauart seiner Gräber sich als relativ alt charakterisirte. Ein zweiter Fibelfund ist der von Vietlübbe; der Bügel ist massiv, aber schmal, mit Zickzacklinien verziert. Ueber das Verhältniß dieser Form, in der man früher die Grundform sah, zu der im Retzower Stück vertretenen ist schon im Jahrb. XLVIII, S. 316 gesprochen. Ein drittes Exemplar stammt von Sukow her; der Bügel ist stark, rund, mit Linien verziert, der Nadelkopf ist eine durchbrochene Scheibe (ähnliche Exemplare bei Undset, études sur l'age de bronze de la Hongrie IX, 1). Einige andere sind leider nur in Bruchstücken erhalten, so die Platte einer Nadel (?) von Klink, eine flache, massive Platte mit rundem Bügel von Kläden (s. Undset études VII, 3) und eine Nadel von Gallentin. Alle haben den Charakter der westlichen (älteren) Bronzezeit; Formen der älteren Eisenzeit (Hallstadt und la Tène) fehlen gänzlich. Es ist interessant, daß auch sonst, wo am norddeutschem Gebiete in unserer Zeit Fibeln vorkommen, es


|
Seite 28 |




|
gerade diese eben besprochenen sind, so in Brandenburg (U. XX, 6), in der Altmark (U. Fig. 15), in der Provinz Sachsen (U. S. 216).
VI. Knöpfe.
Die früher so häufigen Doppelknöpfe mit zwei flachen, oft fein verzierten Platten verschwinden. Häufig werden aber die Stachelknöpfe in verschiedenen Formen, eine dem Norden eigene Erscheinung. Solche haben wir aus Vietlübbe (vgl. Frid. - Franc. XXIV, 3; Montelius, a. a. O. 197; Rygh, A. n. 122), Dobbin (das hieneben abgeb. Exemplar), Klink, Grabow, Kläden (hübsche Uebergangsform), Sukow (2 Exemplare), Retzow (s. Rautenberg a. a. O. S. 7). - Daneben finden sich Knöpfe mit einer Oese unten; oben haben sie meistens eine Spitze und sind mit concentrischen Kreisen um dieselbe verziert; ihr Durchmesser beträgt 3 bis 5 cm. Solche sind im Museum aus Klink (2 Exemplare), Dobbin, Alt= Schwerin (3 Exemplare), Rothenmoor und aus mehreren älteren Gräbern.
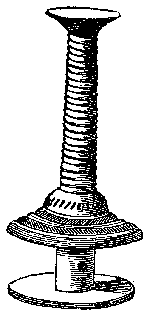
Ueberblicken wir die Resultate, welche wir aus der Betrachtung dieses Materials an Bronzen gezogen haben, so ergiebt sich: die Formen der alten Bronzezeit, in der Meklenburg zu dem westlichen Gebiete gehörte, verschwinden allmählich mit dem Ueberwiegen des Leichenbrandes; es entwickeln sich daraus einige neue, welche aber einen geringeren Grad von Geschmack und Geschicklichkeit bekunden. Formen, welche einer östlichen Bronzecultur angehören, treten gelegentlich dazu, werden aber durch Moorfunde ungleich besser vertreten als durch Grabfunde. Dagegen macht sich eine starke Beeinflussung von Süden her geltend: Charakterformen der schweizer Pfahlbauten dringen vor, und Formen, deren Entwickelung wir in Mitteldeutschland suchen müssen, treten auf und verschmelzen zum Theil mit älteren einheimischen; das archäologische Gesammtbild Meklenburgs unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem des größten Theils von Norddeutschland. Die Selbständigkeit und Originalität der früheren Zeit ist verloren. - Eine Beeinflussung durch diejenige mitteleuropäische Metallindustrie, in deren Gefolge die meisten anderen Länder zuerst das Eisen erhalten haben, die


|
Seite 29 |




|
keltische (nach Hallstadt und la Tène benannte), ist nicht nachweisbar.
3. Das Eisen.
Nach aller Analogie sollte man in unsern Gräbern ein allmähliches Eindringen des Eisens erwarten. Es liegen aber nur außerordentlich wenige Beobachtungen in dieser Richtung vor. Dabei fallen solche Vorkommnisse weg, wie bei Vietlübbe, Friedrichsruhe und neuerdings in einem noch nicht veröffentlichten Funde von Karow, wo Eisen unter Umständen, welche eine gleichzeitige Beisetzung unwahrscheinlich machen, gefunden ist. Sicher erscheint der Fund einer eisernen Sichel bei Weisin (J. XI, S. 383) aus einer Zeit, welche der unseren noch vorangeht, eines leider formlosen Eisenstückes aus einer Urne bei Borkow und einer "Hakenfibel" von Perdöhl. Besonders wichtig aber ist eine eiserne Nadel mit Einbiegung aus Ludwigslust. Denn da haben wir doch offenbar die Nachbildung einer in jener Zeit gebräuchlichen Form in dem neuen, fremden Material, dem Eisen, vor uns und damit den Beweis, daß man auf nordischem Gebiete sich die neue Technik, möge man sie bekommen haben, woher man wolle, zu einer Zeit angeeignet hat, wo man noch in der alten Formenwelt lebte. Daß diese Erscheinung keine vereinzelte ist, lehrt eine Durchmusterung des von Undset gesammelten Materials. Es sind beobachtet in Gräbern, die den unseren entsprechen, eiserne Sicheln von Bronzealterformen in Urnenfeldern der Lausitz, eiserne Messer von unserer Form 2 mit Pferdekopf in Honnover (z. B. bei Lüneburg mit einem Torques von wechselnder Torsion), eiserne Pincetten in West=Preußen, eiserne Nadeln mit schwanenhalsartiger Einbiegung in Pommern (s. Kühne, Baltische Studien XXXIII, Taf. I, Fig. 9) und in West=Preußen, Nadeln wie die Ludwigsluster, die uns zu dieser Zusammenstellung veranlaßt, in Posen in einer Gesichtsurne, welche dieselbe Nadel als Ornament auf der Oberfläche eingeritzt zeigte (s. Voß in der Berliner Ztschr. f. Ethnologie IX, S. 451, Taf. XX, 7 u. 8), in Brandenburg in Urnen mit Hallstadtgeräthen, in Braunschweig mit la Tène - Sachen, in Hannover in einer Hallstädter Kiste (also dieselbe Erscheinung wie im Funde von Priment, s. o.) und in Urnenfeldern mit Eisen, eiserne Torques in Schlesien, Posen, Hannover, Lauenburg, zusammen mit Nadeln der jüngsten Bronzezeit und mit la Tène - Fibeln. Schon diese Beispiele genügen, um zu beweisen, wie das Eisen an Stelle der Bronze verarbeitet zu werden anfängt. Höchst


|
Seite 30 |




|
sonderbar ist es allerdings, daß diese ältesten constatirten Eisenfunde schon eine Nachbildung localer Formen enthalten und nicht Erzeugnisse einer fremdartigen Eisentechnik. Wie das zu erklären ist, kann ich um so eher dahingestellt sein lassen, als gerade unser meklenburgischer Boden sich mit der Hergabe von Mischfunden bisher sehr spröde gezeigt hat. Ein Begräbniß der Hallstadt=Periode ist nur einmal beobachtet (bei Sembzin), und aus der la Tène - Periode ist erst nach Abschluß dieser Bemerkungen von dem Verfasser ein Urnenfeld untersucht (bei Bobzin). Wie und woher wir also unser erstes Eisen bekommen haben, bleibe hier ununtersucht; es genügt, dargestellt zu haben, wie das archäologische Material beschaffen gewesen ist, zu dem das Eisen hinzutrat. Das wenig Imponirende dieses Gesammtbildes erklärt am besten seinen raschen Sieg.
Suchen wir nun zum Schluß unsere Periode zeitlich zu bestimmen, oder vielmehr die zu Beginn gegebene zeitliche Bestimmung zu begründen! Chronologisch fest steht die Epoche starken römischen Einflusses. Geschichtliche Ueberlieferung und der archäologische Bestand, darunter Münzen, weisen dieselbe dem Beginne unserer Zeitrechnung zu. Nach der Analogie der Nachbarländer sollte man annehmen, daß zwischen dieser Periode und der jüngsten Bronzezeit auch bei uns eine la Tène - Periode gelegen habe, das heißt eine Zeit, in der eine für uns südliche Eisencultur (der schweizer Name will nicht sagen, daß es directe schweizer Beeinflussung gewesen sei, welche dieser Periode bei uns zu Grunde liege; als Sitze dieser la Tène - Cultur nimmt man vielmehr Thüringen und rheinische Districte an) geherrscht hat. Damit stimmt der Umstand, daß wir das Verschwinden der Bronzen eigentlich nicht beobachten können. In den Urnenfeldern der Eisenzeit sind sie eben nicht mehr da; und es ist doch anzunehmen, daß es eine Zeit gab, in der ein allmähliches Verschwinden stattgefunden hat. Auch chronologisch ist es kaum denkbar, daß erst um die Zeit von Chrtsti Geburt das Eisen bei uns herrschend geworden sein sollte, da es in Nachbarländern, deren innigen Zusammenhang die ganze obige Ausführung zeigt, schon in italischen Gefäßen gefunden wird, die nach gesicherten Ergebnissen dem vierten Jahrhundert v. Chr. angehören. Demnach glaube ich allerdings, daß wir auch in Meklenburg eine, natürlich nur kurze, la Tène - Periode gehabt haben, und einzelne Funde haben schon früher wenigstens einen Einfluß bewiesen. Jedenfalls aber würde die Zeitbestimmung von zweihundert Jahren (U. S. 344) für uns zu hoch sein. Wir werden uns bescheiden müssen zu sagen, daß die Bronzezeit im Laufe der


|
Seite 31 |




|
letzten beiden vorchristlichen Jahrhunderte aufgehört hat - Viel schwieriger ist der Anfang unserer Epoche festzustellen. Sind es doch nur allmähliche Veränderungen, welche wir wahrnehmen, und sind es doch wohl nur langsam wirkende Factoren gewesen, die ihre Physiognomie bestimmen! Wenn wir aber schon in älteren Gräbern einen starken südlichen Import (getriebene Bronzesachen und Glas) bemerken, so können wir hoffen, den terminus post quem zu finden, indem wir bestimmen, in welcher Zeit die uns ja viel besser bekannten Culturverhältnisse Norditaliens u s. w. solchen Export nach dem Norden ermöglichten. Dieser Export hat um das Jahr 400 n. Chr. aufgehört (s. Jahrb. XLVII, S. 291); Handelsbeziehungen zwischen Meklenburg und Norditalien aber viel höher hinaufzurücken, als es undedingt nöthig ist, wird kaum jemand geneigt sein. Ich glaube, wir können uns begnügen, das fünfte Jahrhundert v. Chr. als das zu bezeichnen, in dem Glas und Bronzen von Süden her zu uns gedrungen sind. Daß diese Fremdlinge an das Ende der älteren Bronzezeit gehören, beweisen die relativ jungen Typen von Bronzealterfunden, die mit ihnen zusammen vorkommen; und so dürfen wir, wenn wir überhaupt eine feste Zeitbestimmung angeben wollen, etwa mit dem Jahre 400 v. Chr. unsere Periode der jüngsten Bronzezeit beginnen.


|
Seite 32 |




|
Zu der Tafel II.
1. Messer von Dobbin (Katalog=Nr. 2136).
2.
Messer von Meyersdorf (K.=N. 519).
3.
Messer von Spornitz (K=N. L. II. . . . 34).
4. Messer von Dobbin (K.=N. 2137).
5.
Messer von Kiekindemark (K.=N. 2181).
6.
Pincette von Dobbin (K.=N. 2139).
7. Nadel
von Lelkendorf (K.=N. 44).
8. Nadel von
Kiekindemark (K.=N. 2182).
9. Nadel von
Gallentin (K.=N 291).
10. Nadel von Sukow
(K.=N. 2420).
11. Nadel von Sukow (K.=N.
2403).
12. Nadel von Poltnitz (K.=N. B. 137).
Zu den dem Texte beigegebenen Abbildungen.
1. Urne, Typus A (s. Jahrb. XI, S. 356), S.
9.
2. Urne, Typus B (s. Jahrb. XI, S. 357),
S. 10.
3. Urne von Gallentin (s. Jahrb. XI,
S. 365), S. 11.
4. Henkelurne, Typus D (s.
Jahrb. XI, S. 359), S. 12.
5. Henkelurne,
Typus D (s. Jahrb. XI, S. 360), S. 12.
6.
Kleine Henkelurne (s. Jahrb. XI, S. 362), S.
13.
7. desgl. (s. Jahrb. XI, S. 363), S.
14.
8. Torques von Ludwigslust (s. Jahrb.
XIV, S. 332), S. 23.
9. Halsring von
Spornitz (s. Jahrb. XIV, S. 322), S. 24.
10. Armring von Roga (s. Jahrb. VII B, 36), S.
25.
11. Fibel von Retzow (s. Jahrb. IX, S
331), S. 27.
12. Stachelknopf von Dobbin
(s. Jahrb, XI, S. 378), S. 28.


|




|
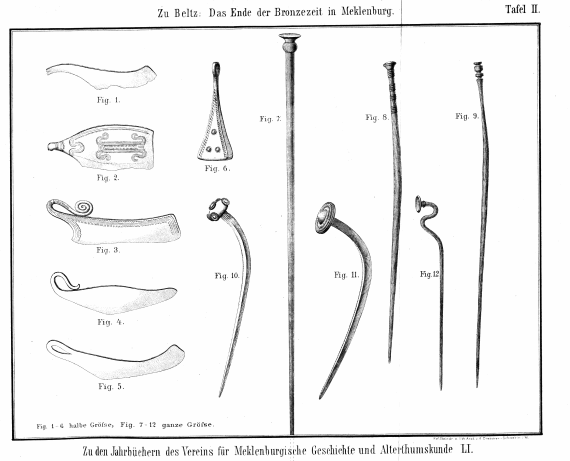


|




|


|
Seite 33 |




|
Litteraturnachweise.
|
Alt=Schwerin Jahrb. 12,
413;17, 367.
Bandow J. 29, 139. Bollbrücke J. 48, 327. Borkow J. 2B, 42. Dobbin J. 11, 377. Eikhof J. 2 B, 44. Fahrenhaupt J. 24, 281. Gadebusch (nicht publicirt). Gallentin J. 2 B, 35; 4 B, 34. Göhlen Frid. - Franc. 53, 68. Goldberg J. 24, 272. Grabow Fr. - Fr. 56, 68; J. 18, 247. Greven Fr. - Fr. 52. Jörnsdorf J. 41, 164. Karstedt J. 26, 136. Kiekindemark J. 3 B, 57; 10, 280; 11, 388. Kläden J. 16, 258; 38, 140. Kleinow s. Ludwigslust. Klink J. 3 B, 64, 66; 12, 397; 13, 374; 47, 294. Kummer Fr. - Fr. 51. Kuppentin J. 10, 292. Lelkendorf J. 2 B, 43. Levensdorf J. 13, 375. Liepen J. 10, 294; 11, 395. Lübstorf J. 4 B, 36. Ludwigslust J. 2B, 45; Fr. - Fr. 63. |
Marnitz J. 33, 135.
Meyersdorf J. 5 B, 45. Moltzow J. 6 B, 136; 7 B, 22; 16, 259. Pampow J. 2 B, 42. Perdöhl J. 5 B, 48. Poltnitz (nicht publicirt). Prislich Fr. - Fr. 67. Rambow J. 7 B, 25. Retzow Fr. - Fr. 71; J. 3 B, 64; 5 B, 64; 9, 381; 10, 278; 11, 384. Reutershof J. 47, 292. Rothenmoor J. 7 B, 24; 16, 260. Sembzin J. 10, 290; 19, 311. Slate J. 38, 129. Sparow Fr. - Fr. 61. Spornitz Pr. - Fr. 49. Steinbek Fr. - Fr. 54. Steinhagen (nicht publicirt). Stolpe J. 11, 388: Fr. - Fr. 52. Stralendorf Fr. - Fr. 58. Sukow J. 13, 367. Toddin Fr. - Fr. 54. Vietlübbe J. 9, 379; 11, 391; 13, 372. Warlin J. 5 B, 109. Neu=Wendorf J. 27, 176. Zickhusen J. 6 B, 138. |
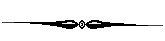


|
Seite 34 |




|



|



|
|
:
|
III.
Prähistorische Untersuchungen
im
Großherzogthum Meklenburg - Strelitz.
Von
Dr. Gustav von Buchwald.
I. Kratzeburg.
I n dem Accessionskataloge des Georgiums zu Neustrelitz findet sich zum Jahre 1861 folgende Eintragung von der Hand des Bibliothekars Gentzen: "März 1861: Der Eigenthümer eines Bauerhofes in Kratzeburg überbrachte mir 20 Bronzestücke, welche er beim Steinausbrechen auf seinem Ackerstücke gefunden hatte." (Hier folgt eine kurze Beschreibung.) "Oct. 8. Dem Anfordern des Bauern Frank=Kratzeburg, die Stelle des pag. 195 - 198 beschriebenen Bronzefundes einmal selbst anzusehen, um mich zu überzeugen, daß hier noch Vieles zu finden sein würde, wenn ich hier eine regelrechte Grabung anstellen wolle, Folge leistend, fuhr ich in Begleitung des Premierlieutenants Eggers, als das Wetter einigermaßen zu einer solchen Arbeit günstig erschien, nach Kratzeburg. Leider hatte der p. Frank seinen Acker, auf welchem er die Alterthümer gefunden hatte, am Tage vorher mit Roggen besäet, wodurch unsre Absicht, dort eine Nachsuchung zu halten, vereitelt wurde. Der Bauer Frank hatte aber bei der Besäung abermals mehrere Alterthumsgegenstände gefunden, die ihm leider von einem kleinen Knaben, der sie auf einem großen Stein, auf welchen er sie gelegt, fand, mit einem anderen Steine in Stücke geschlagen waren. Was mir davon noch zu Händen kam, waren 2 Stückchen Bronze, wovon


|
Seite 35 |




|
das dünnere einer Nadel angehört haben mag, und ein 9 - 10 Zoll langer dünner Bronzedraht, der aber auch schon aus drei Enden bestand. Was er in seiner Vollständigkeit für eine Figur gebildet hat, läßt sich nicht mehr ermitteln." - Eine genauere Untersuchung hat der alternde Gentzen nicht angestellt; der Bauer Frank konnte mir aber ungefähr die Stelle noch angeben. Mehrere große Haufen zusammengeworfener Steine bezeichneten das Fundfeld, in welchem noch "en groten Urnen" zu finden sei. "Der große Urnen" bezeichnete im Munde meines Gewährsmannes eine Steinsetzung und war auch vorhanden. Ich fand im Laufe des Sommers 1885 Gelegenheit, das ganze Feld zu untersuchen, unter Beihülfe meiner Frau, des Herrn Archivregistrators W. Müller, welcher Maße und Zeichnungen aufnahm und später die beifolgenden Taf. III - VIII zeichnete, und des Küsters und Lehrers Kühne in Kratzeburg, der sich durch rege Theilnahme ein besonderes Verdienst um das Georgium erwarb.
Das Fundfeld liegt zwischen dem Capellenberge und dem Schulzensee, dem Adamsdorfer Weg und der Langfeldschonung, die nach ihm genannt ist. Der Boden ist seit unvordenklicher Zeit Ackerland und besteht aus gelbem Sande. Daß einst die Gräbergruppen auf flachen Hügeln lagen, ist noch erkennbar; denn die Sandschichten des Urbodens steigen. Mehrere zusammengeworfene Steinhaufen zeugen davon, daß die Landwirthschaft hier zerstörend gewirkt hat. Zu Bauzwecken sind seit langer Zeit größere Steine in Wagenladungen hinweg gefahren. In der Nähe des höchstliegenden der jetzigen Steinhaufen hat Bauer Frank seine Funde gemacht und nachgegraben. Hier fanden sich nur noch Scherben von zerstörten Urnen in großer Zahl. Etwa fünfzig Schritte von diesem Haufen zeigte sich eine leichte Bodenerhöhung, "en lütten Oewer", und es ward behauptet, daß in dieser Gegend der wendische König in einem goldenen Sarge begraben sei.
Bei knapp 1/3 m Tiefe stieß der Spaten auf Steine, welche ich durch Abschürfung von oben und einen Graben an den Seiten freilegen ließ. Die Setzung war oben flach wie ein Pflaster, etwa 1 1/3 m mächtig, und bildete ein ziemlich regelmäßiges Quadrat von 4 m Seitenlänge. Das erschien mir als ein günstiger Anfangspunkt für die Untersuchung; denn von dieser regelmäßigen Figur aus ließen sich Distancen mit dem Kompaß leicht bestimmen. In dem Folgenden wird stets nach Kompaßrichtung ohne Rücksicht auf die Abweichung der Nadel berechnet; denn wer später auf dem Langfelde die Stellen aufsuchen will, wird dies auch nur mit dem Kompaß in der Hand thun.


|
Seite 36 |




|
Auch sachlich empfahl sich diese Steinsetzung, deren äußeren Rand ich stehen ließ, zum Anfangspunkt der Untersuchung. In ihrem Innern fanden sich nur eine Bronzenadel (Tafel V, Nr. 2) und ein flaches Messer, dem der rückgebogene Sförmige Griff fehlte, in 25 cm Tiefe in der Nordostecke. Nach Südwesten hin aber bedeckte eine starke schwarze Brandschicht die Steine und war tief in deren Fugen gesunken; das ganze Material hatte hier lange und anscheinend stärker geglüht als im Nordosten. Bei einer der zunächst gefundenen Urnen ganz in der Nähe dieser Setzung fanden sich kleine Stückchen des bekannten "Urnenharzes", und man möchte auf den Gedanken kommen, daß unser Steinquadrat ein Altar für Brandopfer gewesen sei. Das könnte immerhin möglich bleiben, auch wenn man das Steinquadrat als Brandherd auffaßt. Hostmann 1 ) bemerkt, daß nach seinen Versuchen ein Scheiterhaufen von 800 Cubikfuß Holz noch nicht genüge, um die organischen Bestandtheile einer Leiche zu verbrennen. Da aber die Kochherde vom "Burgwall" an der Grenze nach Pieverstorf beweisen, daß man die Wirkung des glühenden Steines kannte, so glaube ich: die Steinsetzung diente als Brandherd bei der Feuerbestattung selber. Alle die vielen Kohlentheilchen, die ich untersuchte, weisen stets das charakteristische Zellengebilde der Eiche auf, und diese konnte höchstens an den Sümpfen am Schulzensee, am Krummensee und am Käbelich in spärlicher Zahl oder auf den Höhen hinter dem Krummensee gedeihen. Das Holz mußte also weit hergeholt werden. Deswegen glaube ich, daß man mehr mit glühenden Kohlen als mit flackernder Flamme verbrannte. Für letztere wäre ein stetes, rasches Zutragen von Holz nöthig und oft nicht möglich gewesen, die Wirkung der ersteren aber mußte der glühende Stein unterstützen. Auch wenn man mit Hostmann der Ueberzeugung ist, daß die Knochenreste nach dem Zerkleinern noch einmal geglüht wurden, so war dazu eine solche Steinsetzung durchaus praktisch. Ich werde demnach diese Setzung als den ersten Brandherd bezeichnen und mit Bhd. zur Distanzmessung abkürzen. Für die Himmelsrichtungen dienen die gewöhnlichen Initialen, für die Urnen wähle ich Zahlen und Buchstaben. Die geben die Zeitfolge unserer Funde nach Zahl, großem Alphabet, kleinem und griechischem, so daß sich der Weg meiner Untersuchung genau verfolgen läßt.
Bhd.= Mitte nach O. 2,50 m ringförmige Steinsetzung von 1 m Mächtigkeit, in deren Mitte: Urne 1, völlig zerdrückt.


|
Seite 37 |




|
Bhd.=Mitte nach O. hart am Rande: Urne 2 mit Binnenurne, sehr zerdrückt.
Bhd.=Mitte nach W. am Rande: Urne 3 mit Binnenurne; 3,50 weiter nach W. Urne 4 mit leidlich erhaltener Binnenurne. Zwischen 3 und 4 in der Mitte in einem ganz stumpfen Winkel nach S. Urne 5.
Diese Urnen bestanden wie alle anderen, von denen nicht ausdrücklich Anderes bemerkt wird, aus Thon, der mit grobem Steingruß vermengt, dann mit leidlich geschlemmtem Thon inwendig und auswendig verstrichen und an offenem Feuer gebrannt war. Die Form ist freihändig gemacht, ohne Kunst, ohne scharfe Profilirung; Urne 2 auf Tafel VI bei Undset und Urne 10, Tafel VII, geben die Grundformen. Zu allen Urnen hat eine Deckelschale gehört, die stets an einem Rande ein Henk hat. Zumeist ist sie zerstört.
Bhd. 8,50 m nach O., also 6 m von 1, in gleicher Richtung Urne F.
Bhd. =NO.=Ecke 9 m ONO., NNW. von F, steht Urne A. Mit dieser beginnt eine eigene Gruppe A : B=3/4 m O.; B : D=3/4 m NO.; D : E=1 m NW.; E : C=1/2 m SW.; C : A=1/2 m SSO.
Sondirungen in der Richtung auf Urne 1 hin und auf Bhd. ergaben nichts, Sondirungslinien nach Süden hin brachten nur F zu Tage. Die Vermuthung lag nahe, es möge sich ein Kreis von Gräbern um Bhd. herum ziehen.
Eine Linie von C in nordwestlicher Richtung führte auf a, 7,50 m NO. von der Nordostecke Bhd., 1 m nordwestlich davon ergab das Doppelgrab b und b 1. Urne c etwa 4 m Nordwest von a, zu 8,50 m Nord von Mitte Bhd. über 2 hinaus. Urne d, 10,50 m W. von c zu 11,50 m NW.=Ecke Bhd., Urne e 4 m SSW. von d zu 8,50 m von Nordwestecke Bhd., Urne f in fast gleicher Richtung von e zu 8 m von Nordwestecke Bhd.
Hier hörte jedes auch nur annähernd regelmäßige Zahlenverhältniß auf, und auch die je 4 m von a : c : d : f genügen nicht, um planmäßige Beisetzung zu behaupten. Die anscheinende Regelmäßigkeit wird gestört durch eine kleinere Brandstelle zwischen b und c und eine größere zwischen d und e. Auch e macht eine Ausnahme insofern, daß sie auf Brandreste gestellt ist. Nicht unmöglich wäre es, diese Brandstellen mit flachen Steinsetzungen als Leichenmahlsherde aufzufassen, ebenso wie eine dritte bei der g - i; aber Spuren der Mahlzeit fanden sich nicht.
Die Gruppe g - k stand: Urne h, 13 m W. von der Südwestecke Bhd, h : g=1 m NW, g : k=3 m SW., k : 1=1,50 m SO., 1 : i=0,75 cm S., i : h 3,50 m NO.


|
Seite 38 |




|
Nach SSW., 91 Schritte von Bhd., stand eng an einander gedrängt die Gruppe a, ß, ?. Nur Urne 4 war mit Gruß und faustgroßen Steinen umpackt, alle anderen hatten regelmäßige Setzungen von großen Steinen. Die Bezeichnung Steinkiste ist verwirrend; denn sie erweckt das Bild eines viereckigen Hohlraumes, in dem die Urne frei steht. Das ist hier nicht der Fall. Die Steine sind stets der runden Form der Urne angepaßt, oft mit Geschick schalenartig gespalten. Besonders bei C fand sich solche Schalenartige Form aus rothem Granit. Oben war die Setzung ursprünglich wohl stets mit einem flachen Deckelstein geschlossen; doch fehlten diese zumeist. Bei k fand sich ein solcher noch, denn sie lag ein wenig tiefer als die anderen. Bei C war der Deckelstein tief in die Urne eingedrungen. Die Steinumsetzung der Urnen war manchmal aus zwei, sogar aus drei Steinreihen gemacht, so daß die Einzelgräber sich näher berührten, als man nach unseren von Mitte zu Mitte der Urne angegebenen Maßen denken möchte. Die Gruppen g - k, A - E und a - α - γ standen ohne Zweifel in innerem Connex. Zu der Urne C gehörte die Bestattung E, welche nur Brandreste und Menschenknochen ohne Urne und Beigaben enthielt; denn die Steinumsetzung von C ging bis hart an die Brandreste heran. Es machte durchaus den Eindruck, als ob die ganze Bestattung E nur eine Beigabe - etwa ein verbrannter Sklave - zu E sei.
Die Maße, welche an den Urnen aufgenommen werden konnten, sind: Urne 2: Boden 12 cm, größte Bauchweite 25 cm. Urne A. C. f: Boden 12 cm, größte Bauchweite 35 cm, obere Randweite 31 cm. Urne F: größte Bauchweite 26 cm. Urne a und d: Boden 12 cm, größte Bauchweite 32 cm, volle Höhe 31 cm; die Verengung zum Halse begann 15 cm vom Boden und ergab 19 cm als obere Randweite. Urne c hatte inclusive Deckelschale 20 cm Höhe von Boden zu Boden und 23 cm größte Bauchweite, der Urnenboden war 12 cm und der Deckelboden 11 cm weit. Urne b hatte 19 cm Höhe und 28 cm Randweite. Mit dem Maße der immer einmal gehenkelten Deckelschale von i stimmen ungefähr die A. C. f: Bodenseite 11 cm, Höhe 8 cm, Randweite 42 cm.
Doch macht Deckel i eine Ausnahme darin, daß er durch eingekratzte Striche ornamentirt ist, als wie, wenn man den noch feuchten Thon mit einem abgenutzten Reisigbesen bestrichen hätte.
Als Ornamentirungen kommen nur Fingertupfen und grade Striche bei Scherben vor, die sich auf dem Platze fanden.
Durchaus verschieden ist die Urne b 1 in der Forrn Tafel III, Figur 1. Auch sie ist freihändig gemacht und durch concave Ein-


|
Seite 39 |




|
drücke in Linienform verziert. Der Rand ist gewunden wie ein torques. Der Boden besteht aus concentrischen Hohlringen, die sich nach dem mittleren Eindruck zu erheben.
Die Binnenurnen, die über der Knochenpackung stehen, zerfallen in die vier auf Tafel III gezeichneten Hauptformen. Sie gehören zu sämmtlichen Urnen, waren aber bei der Mehrzahl so hülflos lädirt, daß es sich nicht lohnte, die Scherben alle aufzuheben; sie finden sich nur in zwei reparirten Fragmenten in β u. γ. Tafel III, Fig. 2, ist aus C entnommen und nicht die gewöhnliche Form, Fig. 2 und 3 stammen aus Urne α; sie standen neben einander. Figur 2 hat in der steilen Form Aehnlichkeit mit dem zusammengesetzten Fragment aus Urne 4. Doch ist bei diesem Fragment nicht zu erkennen, ob es auch eine Tülle hatte. Die Tüllenurne ist bis jetzt noch nicht in dieser Form im Georgium vertreten. Daselbst befinden sich zwei vasenförmige, klingend gebrannte Tüllengefäße, die mit großer Salopperie und viel Ungeschick auf der Drehscheibe gearbeitet sind, und eine nicht hellklingende freihändige Mittelform mit ganz kleiner Tülle. Die genaueren Fundorte sind undekannt, doch gehören sie nicht nach Schlesien, sondern nach Vergleichung mit meinen neuesten Funden aus Fürstensee ins Land. Eine ebenso liederlich angeknetete Tülle fand ich unter Scherben in Fürstensee (Eisen, gedrehte und freihändige Töpfe). Die tassenähnliche Form 3 ist öfter vertreten und scheint die gewöhnliche zu sein: denn zu ihr stimmen die meisten Scherben, besonders das Fragment aus Urne 2. Die Form 4 und 5, aus i und e entnommen, ist auch nicht ganz selten.
Die Beigaben sind nicht reich, wie gewöhnlich in dieser Periode. Man möchte fast mit Sophus Müller glauben, jeder Mensch habe selber für seinen Comfort im Jenseit sorgen sollen; denn der einzige kunstvollere Fund, der mit diesen Funden in Zusammenhang zu stehen scheint, ist Depotfund. Die durchgehende Spärlichkeit der Urnenfunde ist im Verhältniß zu dem Reichthum der Dépotfunde scheint mir jedoch eher mit der beginnenden Entwickelung des Erbrechts zusammenzuhängen. Es scheint, daß man hier auf einer Stufe angelangt war, wo die Furcht vor der Seele des Todten nicht mehr so stark war, daß man ihm seine volle Habe nachsandte, sondern nur, was er am Leib trug und zur Zeit seines Todes bei sich hatte. Das völlige Fehlen von Beigaben in so vielen Fällen scheint sich daraus am besten zu erklären, daß der Todte eben nichts als seine Bekleidung trug, als er starb. Auf das Nähere über die Entstehung des Erbrechts einzugehen, dessen


|
Seite 40 |




|
Entwicklung allerdings ohne prähistorische Forschung gar nicht zu begreifen ist, muß ich mir hier versagen.
Eine Beschreibung der sämmtlichen älteren Fundobjecte des Feldes zu geben, halte ich für überflüssig. Ich wähle hier nur die charakteristischen Formen aus und zähle voll nur auf, was durch meine eigene Hand aus der Urne genommen und bei den letzten Ausgrabungen gefunden ward.
Unter dem Deckel von i fand sich ganz oben auf den Knochenresten ein bronzener Fingerring. Die sämmtlichen Urnen bei Bhd und westwärts davon waren ohne Beigabe. Der bearbeitete Feuerstein (Tafel III, Fig. 8), entweder ein schlecht gearbeitetes Speerspitzenfragment oder ein Stein zum Feuerschlagen, lag in der Nähe von Urne 1, jedoch nicht in derselben. Er hatte aber wie die anderen Feuersteinwaffen mit auf dem Brandstoß gelegen.
Die steinerne Lanzenspitze, vom Feuer arg beschädigt und mitten durchgesprungen, Tafel III, Fig. 9, war mit kleinen Fragmenten von ganz dünnem Bronzedraht die einzige Beigabe von Urne C.
Die Gruppe α, β, γ, so hart aneinander gerückt, daß nur gleichzeitige Beisetzung denkbar ist, enthielt:
α. 1) die beiden Doppelknöpfe Tafel VII, 1 und 4; 2) das verbogene Armband Tafel VI, 5; 3) die Schmuckfragmente Tafel VI, 6 und 7; 4) Bronzepartikeln, die den Knochen angeschmolzen waren; 5) die Pfeilspitze aus Stein, Tafel III, 7; 6) die zerbrochene Lanzenspitze aus Stein, Tafel III, 6.
β. 1) die beiden Doppelknöpfe Tafel VII, 2 und 3; 2) das durchbrochene Scheermesserfragment Tafel IV, 1; 3) den Pfriemen Tafel IV, 7, mit den Grifffragmenten; 6) ganz dünne Drahtfragmente; 7) die tordirten Fragmente Tafel IV, 4; 8) einen Tropfen abgeschmolzener Bronze und minimale Drahtfragmente.
γ. den Spindelstein, Tafel VII, 5.
Das Messer, welches im Brandherd gefunden ward, ist dem Tafel IV, 1 abgebildeten durchaus ähnlich. Die Nadel ist Tafel V, 2 abgebildet. Die Nadel 1 ist einmal, die Nadel 3 mehrmals unter den von Frank auf derselben Stelle gefundenen vertreten. Die schmale, dünne Dolchklinge Tafel V, 4 hat mit den anderen Dolchen des Georgiums keine Aehnlichkeit, wohl aber mit Schwertern aus Dépotfunden, denen ebenfalls die erhöhte Mittelrippe fehlt (Globzow a. d. Müritz, Wendorf).
Das Messer V, 5 mit vorgebogenem, aufgerolltem Griff ist hier nicht weiter vertreten. Das Messer V, 7 ist in dieser Form


|
Seite 41 |




|
auch nur einmal vertreten; doch giebt es noch ein Grifffragment. Aehnlich so, nur mit der Schneide nach der umgekehrten Seite und ohne die Punzentupfen, nur durch Strichlagen am Griff ornamentirt, ist das, welches ich in Friedland von Herrn Kerkow für das Georgium geschenkt erhielt. (Fundort: Moor am Kavelpaß bei Friedland.)
Das Messer V, 6 mit dem herzförmigen Griffansatz findet sein Pendant in Tafel IV, 3 (Zechow, woselbst noch ein Fragment desselben Typus gefunden ist).
Wenden wir uns nun zu den flachen Messern mit Sförmigem, rückgebogenem Griff, welchen Sophus Müller in seiner "nordischen Bronzezeit und deren Periodentheilung" so viele Aufmerksamkeit schenkt.
Zur ältesten oder östlichen Form müßte eigentlich Messer 5 auf Tafel V gehören; denn der Griff neigt sich nach vorne. Ob die Formen mit einem Thierkopfe am Griffende älter sind oder die mit mehr oder minder aufgerollten Abschlüssen, darüber möchte ich keine Meinung aussprechen. Bei einigen schönen tordirten Halsringen des Georgiums zeigt sich die Gleichzeitigkeit und gleichartige Herkunft undedingt an der Arbeit; aber bei einem biegt das Schlußende in einen einfachen Haken um, bei dem zweiten hat dieser ein Paar Augen, bei dem dritten ein Paar Augen und einen deutlich markirten Schnabel. Wenn auch der Grundsatz richtig sein wird, daß eine lästige Nothwendigkeit den Anstoß zum Ornament giebt, z. B. Bindfadenornamente an Hohlcelten 1 ) als Reminiscenz aus der Zeit, wo das Bahnende des einfachen Celtes an den Schaft gebunden ward, oder Bandornamente aus gleicher Rücksicht auf den Tüllen von Lanzenspitzen, so halte ich es doch für falsch, die einzelnen Stücke nur nach dem Alter ihrer formbestimmenden Idee in jüngere oder ältere einzutheilen. Die Figur 35 bei S. Müller, S. 40, hat übrigens keinen einfachen Haken, sondern einen Thierkopf mit Augen und unentwickeltem Munde. Die Idee, welche durch die Messer 35 und 36 versinnbildlicht wird, ist offenbar dieselbe wie die Gravirung auf 37: nur stellt dort das Messer ein Schiff mit verziertem Borde und einer als Bugspriet dienenden Gallionsfigur dar, wie sie später die Drachen oder die "Wellenrosse" der Vikinger trugen.
Die jüngere oder westliche Form mit der rückwärts gerollten Spirale, resp. der Sförmigen Umbiegung weist zunächst das Schiff als Zeichnung auf der Klinge in umgekehrter Stellung auf, nämlich


|
Seite 42 |




|
mit dem Kiele nach dem Rücken des Messers. Müller zählt S. 43 derartige Messer auf: in Hannover 4, Kiel 11, Jütland 7, Fünen 3, Seeland 3. Aus dem ganzen östlicher liegenden norddeutschen Gebiet ist ihm nur 1 Exemplar mit einem roh eingeritzten Schiffe bekannt, nämlich unser Kratzeburgisches von dem Grabfeld am Capellenberge Tafel VI, 2. Hätte der Bibliothekar Gentzen die Zechow=Funde nicht so ungeschickt aufgeheftet gehabt, würde dem sorgfältigen Beobachter das Messer Tafel VI, 1 (Zechow, Ausgrabung 1845, Grab 4) wohl nicht entgangen sein. "Je weiter man nach Osten kommt, desto spärlicher werden diese Messer, desto roher diese Ornamente." Roher ist nun das Zechow=Messer auf jeden Fall nicht; aber die Schiffzeichnung ist bedeutend weniger charakteristisch. Die Uebergangsform zu dem verzierten Bordrande der Messer, deren Ganzes ein Schiff bedeuten will, zeigt Tafel IV, 2, aus dem Zechow (Gräbergruppe von 11 Plätzen ohne genaue Aufzählung, aus welcher Urne die Funde stammen).
Eine Sonderung nach geradem oder rundem Rücken zu machen halte ich für überflüssig; denn die Uebergangsformen zu geraden wie zu halbkreisförmigen Messern beweisen nichts für die Provenienz. Messer mit geradem Rücken wie VI, 3 (Kratzeburg) finden sich auch im Zechow=Funde und anderswo. Auch die Umbiegung über das S hinaus wie Tafel VI, 4 (Kratzeburg) zu Tafel VI, 1 (Zechow) beweist nichts.
Nur das dürfte als feststehend anzusehen sein, daß das Schiffsornament auf Import durch ein seebefahrenes Volk hinweist. Will man nach einer religiösen Vorstellung suchen, die dem Schiffe entspricht, so bietet sich in dem Kahne des Maui bei den Maoris, der Mondsichel, die beste Deutung. Gegen Sophus Müllers Ansicht von der westlichen Importgruppe spricht das nicht, eher im Gegentheil. Nur müßte man annehmen, daß die Fundgruppe der steinumsetzten, flachliegenden (das thun auch die auf Hügeln) - Gräber Kratzeburg, Zechow, Grammertin, Rollenhagen (1860, 1878), nebst den Dépotfunden aus Wendorf (1860), Wesenberg (Pomel, 1838, Hängebecken), Weisdin (1862, Hängebecken), kurz fast das ganze Fundgebiet des Stargader Kreises ein Sammelplatz wäre, in dem sich in eigenthümlicher Weise West =, Ost= und Süd=Import vermischten. Und das ist in der That der Fall. Es kann, geographisch betrachtet, nicht anders sein.
Charakteristisch für diese Periode ist die Ornamentirung der Pincetten. Die getriebenen Buckel fehlen nicht bei Kratzeburg, Tafel VIII, 1, 2, 3 u. 4, Zechow (1845, Grab 3), Rollenhagen


|
Seite 43 |




|
(1860). Die eingravirten Verzierungen haben mehr oder minder Aehnlichkeit mit einander. Die Punze wird seltener gebraucht als der Grabstichel.
Die Nadelformen Taf. V, 1 u. 2, sind mit Varianten im Georgium mehrfach vertreten, den breitesten Kopf hat die Nadel aus Zechow (1845, Grab II, Urne B).- Die Pfriemenform ist ungemein häufig Zechow: 8, Kratzeburg: 2, Rollenhagen 1860: 1 und auch in anderen Funden). Bei Rollenhagen (1860) fiel mir auf, daß sich da, wo die Nadel rund zu werden beginnt, ein dünner Golddraht herumwindet. Der Fund Tafel IV, Nr. 7, dessen Pendant Nr. 6 aus dem Zechow=Funde entnommen ist, erklärte mir das: es ist ein Griffende. Unter den Knochenfragmenten von Urne ß fand sich der Pfriemen 7 so, daß noch ein Stück gebogenen, papierdünnen Bronzebleches mit einem kleinen Loche an dem vierkantigen Schaftende fest saß, aber beim Herausnehmen trotz aller Vorsicht zerfiel. Am oberen Ende des vierkantigen Schaftes sitzt noch ein Stück der Füllung des Griffes. Einer dieser Pfriemen aus dem Zechow=Funde ist tordirt. Die tordirten Armring=Fragmente Tafel IV, 4 aus Urne ß finden sich in ähnlicher Weise auch in dem Zechow=Funde. Ihren Zweck mag Figur 5, unbekannten Fundorts erklären.
Das hübsch ornamentirte Armband aus dem Männergrabe a, Tafel VI, 5 nebst den Fragmenten 6 und 7 ist im Zechow=Funde nicht vorgekommen, wohl aber finden sich ähnliche Fragmente in dem Funde von Karpin (1845), auf den wir noch zurückkommen.
Die Gleichzeitigkeit der Funde aus dem sogenannten Wendenkirchof beim rothen Kruge im Zechow und der bei Kratzeburg gemachten kann wohl nicht bestritten werden, trotzdem Gentzen behauptet, zwischen den Gräbern im Zechow sei eine Differenz gewesen in den Steinsetzungen. Seine Angaben sind viel zu unpräcise, als daß sie hier Gewicht haben könnten. Die Steinwaffen, wie auch die steinerne Pfeilspitze des Fundes von Grammertin zeigen, daß wir hier noch ein reines Bronzezeitalter vor uns haben. Die beiden Funde zu Rollenhagen, welche Undset (Das erste Auftreten des Eisens in Nord=Europa S. 256) besprochen, gehören in dieselbe Kategorie. Ein Zweifel, daß diese Funde sämmtlich in die vorrömische Zeit gehören, kann nicht aufkommen.
Die Eisentheile des Karpin=Fundes, der sonst in allen Theilen mit den hier gemachten correspondirt, spricht dagegen nicht. Der Bericht des Tischlers Behrend zu Karpin (1845) lautet: "Er habe zum Bau seines Hauses die erforderlichen Feldsteine aus einem etwa 50 Fuß im Durchmesser haltenden Hügel auf der Karpiner


|
Seite 44 |




|
Feldmark rechts von dem Wege, welcher von Karpin nach Gr.=Schönfeld führt, geholt. Beim Ausbrechen derselben sei er auf eine Brandstelle getroffen, an der südöstlichen aber auf Urnen, deren Zahl wohl zwölf erreicht haben möchte. Zum Theil hätten sie in Steinkisten gestanden, welche mit einem platten Deckstein zugedeckt gewesen wären. Die meisten aber hätten im Sande gestanden 1 ) und wären von der Last der Steine 2 ) schon zerdrückt gewesen. Aus drei Urnen hätte er den Inhalt herausgefunden, ohne jedoch die Urnen unversehrt zu bergen." Aus einer Urne ergaben sich ein flaches Messer von dem Typus 3 auf Tafel VI und eine eiserne Nadel; sie scheint denen mit schalenförmigem Kopf und Umbiegung am Halse ähnlich gewesen zu sein. Aus den beiden folgenden Urnen waren zwei Bronzenadeln herausgekommen, deren eine mit V, 1 Aehnlichkeit hat, deren andere ohne Ornamente ist. Aus Urne 5 ergaben sich Bronzefragmente mit Ornamentirung wie VI, 5, in denen zwei eiserne Niete sitzen, und ein Fragment, anscheinend von einem Tüllencelt.
Daß wir mit den Funden Kratzeburg und Zechow in einer Epoche stehen, wo die altitalische Eisencultur in hoher Blüthe stand, ist mit Sichercheit anzunehmen; für Rollenhagen (1878) hat Undset es bestätigt. Ob aber der Karpin=Fund nicht schon in die römische Zeit hinein gehört, das läßt sich kaum sagen. Vielleicht enthält er das älteste nachweisbare Eisen bei uns - aber es ist auch möglich, daß sich ältere Objecte auf spätere Zeit vererbt haben. Das ornamentirte Band mit den eisernen Nieten hat entschieden stark vom Brande gelitten, das Messer aber ist sicher wenig gebraucht. Scheinbar würde die geringe Abnutzung gegen die Vererbung sprechen, in Wirklichkeit plaidirt sie gerade dafür; denn die best erhaltenen Werkzeuge, die wir jetzt haben, erbten wir aus den Moorfunden.
Es erübrigt sich nunmehr zu untersuchen, wo diese vorrömischen Germanen, deren Reliquien uns das Langfeld aufbewahrt, gesiedelt haben.
Soweit bisher die Siedlungen der Germanen gleicher Gulturhöhe bestimmt sind, ergaben sich in der ostelbischen Ebene und auch westwärts davon die folgenden Kriterien: hohe Sanddünen, resp. auch Lehmberge mit Wasser in der Nähe, leichter Boden prävalirt. Der Volksmund nennt noch heute solche Siedelungsplätze "Burgwall". Derselbe Ausdruck wird aber auch von den wendischen Befesti=


|
Seite 45 |




|
gungen im Sumpfe gebraucht, desgleichen von Schanzen, die nachweislich erst zur Zeit des 30jährigen und des nordischen Krieges entstanden sind.
Meklenburgische Prähistorie hat zuerst lange darunter gelitten, daß sie, einer Bezeichnung des Volkmundes nachgebend, spätgermanische Begräbnißplätze mit dem falschen Namen "Wendenkirchhof" belegte. Bei der heillosen Verwirrung, die in der archäologischen Terminologie eingerissen ist, erscheint eine Enthaltsamkeit in derartigen Kunstausdrücken als dringend geboten. Ohne auf die wendischen Befestigungen eingehen zu wollen, sei hier nur hervorgehoben, daß bei den germanischen "Burgwällen" dieser Epoche bei uns in der Regel weder etwas von Burg noch von Wall zu bemerken ist, während bei wendischen Burgwällen noch heute ein Schanzenbau vorkommt, der eine gewisse Aehnlichkeit mit den modernen Befestigungen hat. Unser Germane der Bronzeperiode siedelte gern auf freier Anhöhe, zu welcher ein fahrbarer Weg führte. Solide Blockhäuser baute er nicht, die charakteristischen "Klehmstaken" werden nicht gefunden, wohl aber Thonklumpen, die Brand gefühlt haben. Die größte Wahrscheinlichkeit hat es, daß er Zelte aus Fellen zur Wohnung benutzte. Wenn Wälle und Verhaue um den Berg gezogen waren, so wird das nur an schwächeren Stellen gewesen sein - südlichere Stämme der gleichen Zeit bauten sogar recht feste Wälle.
Benachbart dem Langfelde liegt der Capellenberg, der nach dem Schulzensee durch Einwirkung des Hakens und des Pfluges allerdings hier abgeflacht ist, auf seiner anderen Seite nach dem Krummen=See hin aber sein scharfes, altes Profil noch beibehalten hat. Der Weg von Kratzeburg nach Liepen und Adamsdorf führt über den Capellenberg. Der Krüger Wacholz zu Kratzeburg sagt aus, daß gerade hier Alterthümer in früherer Zeit gefunden seien. Der Spindelstein Tafel VII, Fig. 6 ist am Capellenberge gefunden.
Offensichtlich war einst der Zugang nach Kratzeburg und auch der nach Adamsdorf hin viel schmäler.
Sollte zu irgend einer Zeit eine Grenze mit Befestigung oder mit Wachtposten oder Wachtdörfern in dieser Gegend gezogen sein, so wäre es unbegreiflich, wenn der Capellenberg von Leuten, die überhaupt dazu Anhöhen benutzten, nicht gebraucht wäre. Er könnte sogar heute noch militairisch in Betracht kommen. - Eine wirklich große germanische Niederlassung lag auf dem sogenannten


|
Seite 46 |




|
"Burgwalle" 1 ) nach der Pieverstorfer Grenze zu, die größte, welche ich bis jetzt gesehen habe. Steil stürzt der Berg ab in den Dambeker See nach Westen, welcher früher sicher weiter als jetzt um den Berg herumbog; nach der nordwestlichen Seite ist eine sumpfige Niederung, das "Glockensoll", "wo die Glocken versunken sind"; von da läuft eine Schlucht, die früher tiefer war, auf die noch sehr jungen Wiesen am Lehmsee hin, so daß er fast von drei Seiten von Sumpf und Wasser umgeben war. Wie die Wege aus dem Vorland zwischen Kratzeburg und der Müritz nur am Capellenberg vorbei nach Liepen und Adamsdorf führen konnten, so mußte der Weg, welcher über die zweite Furtstelle der Havelniederung bei Dambek vorbei führte, am "Burgwall" vorüber. Faßt man auf der Generalstabscharte die Wege und die beiden Punkte Burgwall und Capellenberg ins Auge, so zeigen sich beide durch den Krummen=See mit dessen unpassirbarer sumpfiger Fortsetzung zum Lehmsee verbunden. Wer von Westen her kam, mußte entweder über Dambek oder über Kratzeburg die Wege passiren, welche diese beiden Höhen decken.
Wunder nehmen müßte es, wenn nicht beide Anlagen in irgend einem Nexus 2 ) gestanden hätten, zumal wenn sich zeigen läßt, daß sie zu gleicher Zeit besiedelt waren.
Nach den vier Himmelsrichtungen hin setzte ich den untersuchenden Spaten auf der 30,000 qm betragenden Höhenfläche des Burgwalles ein und kam nach kurzem Suchen stets auf Brandstellen. Gefäßscherben bedecken die ganze Höhe; die Formen, die Ornamentirungen durch rohe Strichlagen und Fingertupfen und die ganze Art der Mache stimmt mit den Grabfunden der Gegend vom Capellenberg überein. Die Brandstellen erwiesen sich als Feuerherde. Etwa 63 cm tief kam eine dunklere, breite, verwehte Schicht, die aus Asche und Kohlentheilchen bestand, dann folgte eine schmale kohlengeschwärzte Schicht als Rest des letzten Brandes, unter dieser lag eine unregelmäßige Steinsetzung, die völlig rußgeschwärzt war. Sie hatte als Herd gedient. Darunter lag eine Kohlenschicht bis zu 1 m Mächtigkeit und etwa 1 1/2 qm Umfang. In dieser, unter den Steinen, lagen je mehr je tiefer zahllose rußgeschwärzte Scherben. Knochen fanden sich nur an einer Stelle zahlreich, in größerer Menge aber am Abhang nach dem Dambeker


|
Seite 47 |




|
See zu. Man hatte die Abfälle, zumeist Rinderknochen, also reinlicher Weise fortgeschafft.
Neu gefunden ist auf der Oberfläche des Berges nur das Fragment einer nicht ornamentirten Zierscheibe aus Bronze. Aus einem Moderbruche nach der Pieverstorfer Seite hin ergab sich ein Dépotfund, die Schalenfibel Tafel VIII, Fig. 5, und ein tordirter Halsring.
Die Fibel, die einzige, die hier überhaupt gefunden ist, gehört in dieselbe Epoche wie der große Wendorfer Dépotfund, in dem eine ganz ähnliche vorkommt. Figur 5 zeigt den Bügel etwas nach rechts geneigt, damit die Ornamentirung voll gesehen werden kann. Im Gegensatz zu der hübschen Arbeit steht die rohe Flickstelle am Bügelende. Man hat ihn ganz ungeschickt mit überheißer Bronze angegossen, als er abgebrochen war.
Ein recht hübsches Beil aus Grünstein, mit einer begonnenen Centrumsbohrung, ist ebenfalls Moorfund von dieser Seite. Nach der Kratzeburger Seite ist ein minder geschickter Steinkeil aus ähnlichem Material ohne Bohrung gefunden. Zwei große Mahlsteine aus Granit sind am Rande des Berges selbst entdeckt und nachweislich von ihm herabgebracht.
Nach diesen Beobachtungen kann die Gleichzeitigkeit zwischen den Grabfeld= und den Burgwall=Funden und dem Wendorfer Moorfund nicht bestritten werden. Die Scherben führen allein schon den durchschlagenden Beweis. Wir kommen aber noch einen Schritt weiter mit den Funden auf dem Burgwall: er ist vor Einführung des Eisens verlassen und seit derselben nicht wieder benutzt.
Nach der Kratzeburger Seite hin fand ich andere Brandstellen. Ich führte eine Regenfurche durch einen 6 m langen und 2 m tiefen Einschnitt weiter fort. Da zeigte sich eine ca. 63 m tiefe Kohlenschicht, die vom Rande herabgefallen sein mußte. Es waren am Rande des Berges mehrere große Eichenbalken durch Feuer vernichtet und herabgestürzt. Einer derselben muß 22 cm dick gewesen sein, wie sich noch an der Faserschicht ausmessen ließ. Um auf ein festes Palissadenwerk zu schließen. dazu waren mir die schwarzen Schichten nicht fortlaufend genug.
Hierauf hin eine gewaltsame Zerstörung behaupten zu wollen, das erscheint mir viel zu gewagt; aber wo blieben die Bewohner? Wer waren ihre Nachfolger? Zwischen ihnen und den einwandernden Slaven liegt mehr als ein halbes, vielleicht ein volles Jahrtausend.


|
Seite 48 |




|
Aus der Niederung, aus Kratzeburg 1 ) selber haben wir eine leichte Speerspitze und Bolzpfeilspitzen, wie sie in die Eisenepoche gehören, deren Urnenform durch den Darzauer Typus repräsentirt wird. In einer glänzend schwarzen Urne der Rudolphi'schen Sammlung aus der Friedländer Gegend fanden sich mehrere solcher Bolzpfeilspitzen, die Moorfunde am Kavelpasse haben noch mehrere geliefert. Wir haben hier einen starken Hinweis darauf, daß der Germane mit der schwarzen Urne, der Armbrust, den Ohrringen mit der blauen, vermuthlich auf den jüngst in Thüringen entdeckten Glashütten hergestellten, Glasperle und der la Tène - Fibel mit eingedrucktem Kreuz, schon in der Niederung gewohnt hat. Es erscheint mir im höchsten Grade problematisch, daß erst der Wende die Wiesen= und Wassercultur eingeführt haben soll.
Soweit die Forschung bis jetzt ein Recht hat, sich zu äußern, haben in Kratzeburg niemals Wenden gewohnt. Selbst der älteste Name, der seit 1256 urkundlich ist (M. U.= B. 777), ist deutsch: er heißt Werder. Um zu beweisen, daß hier je Slaven gesiedelt haben, müßten specifisch slavische Funde gemacht werden. Bis diese vorhanden sind, ist es geradezu gegen alle objective historische Kritik, anzunehmen, das Dorf Kratzeburg=Werder habe einst Wustrow geheißen.
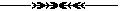


|




|
Tafel III
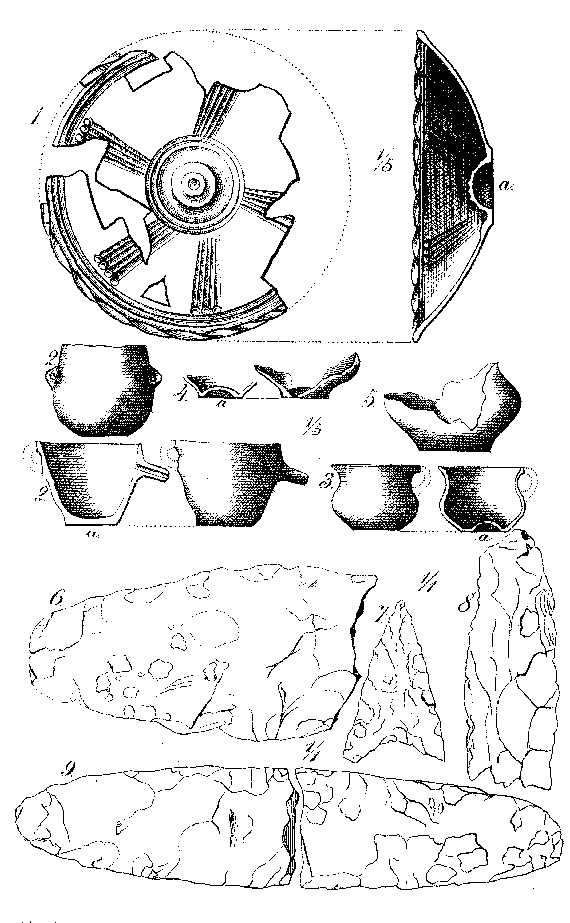


|




|


|




|
Tafel IV
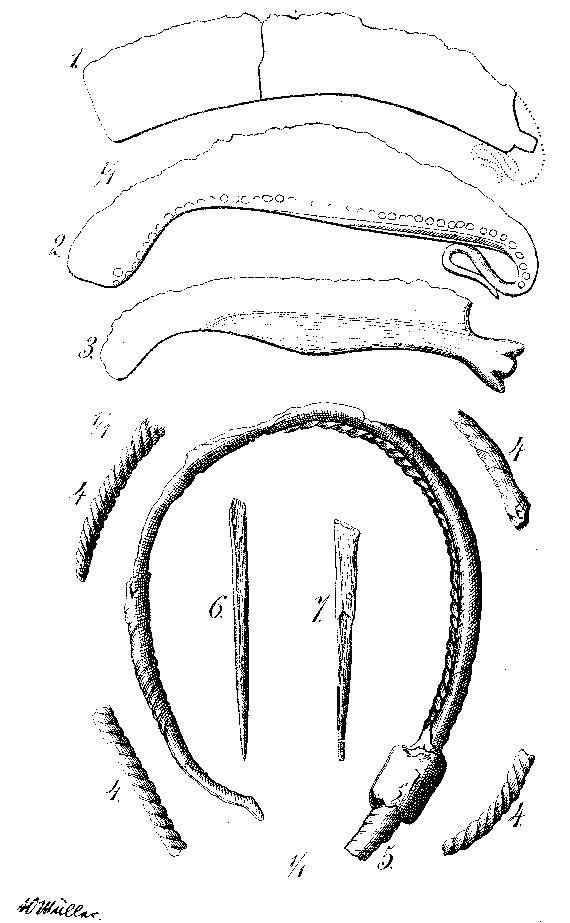


|




|


|




|
Tafel V
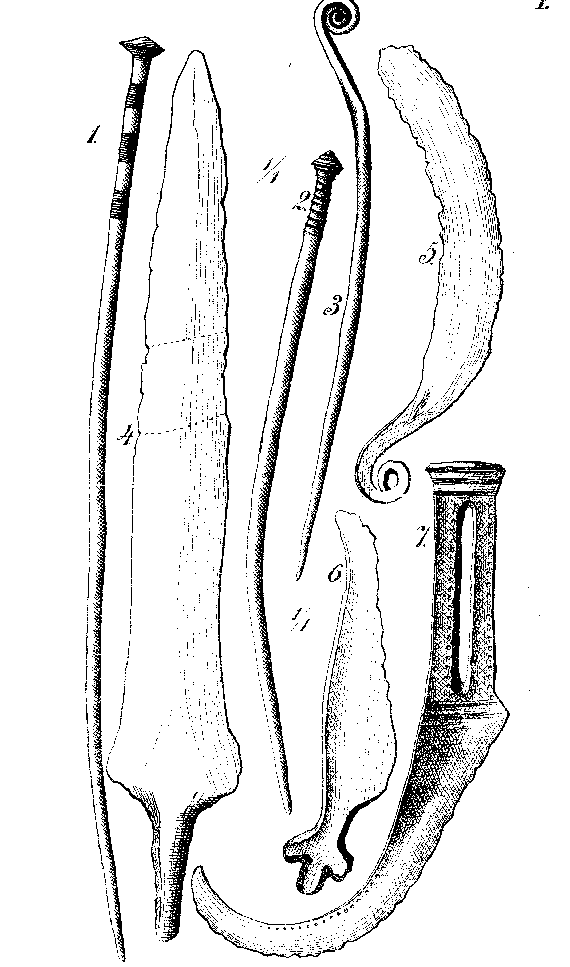


|




|


|




|
Tafel VI
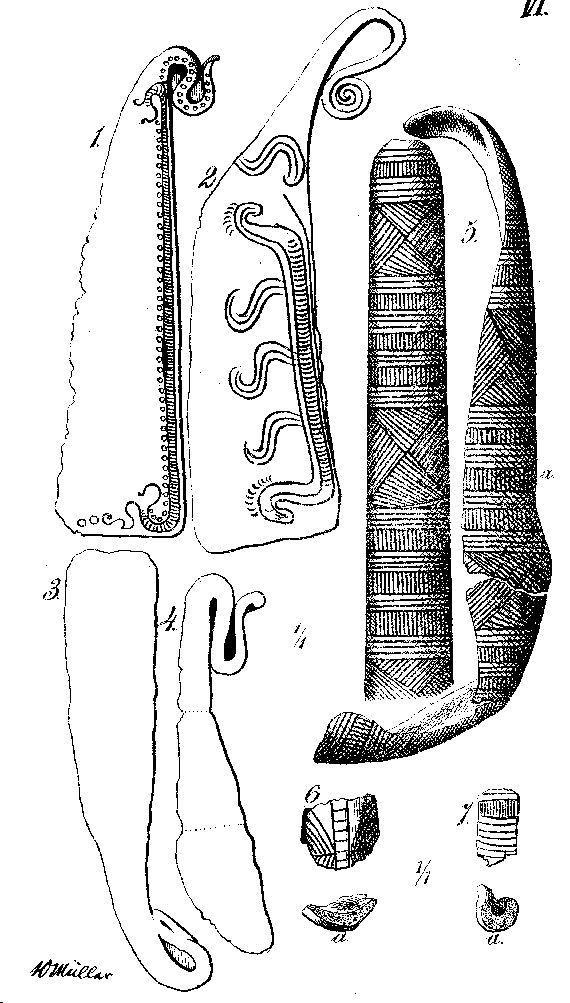


|




|


|




|
Tafel VII
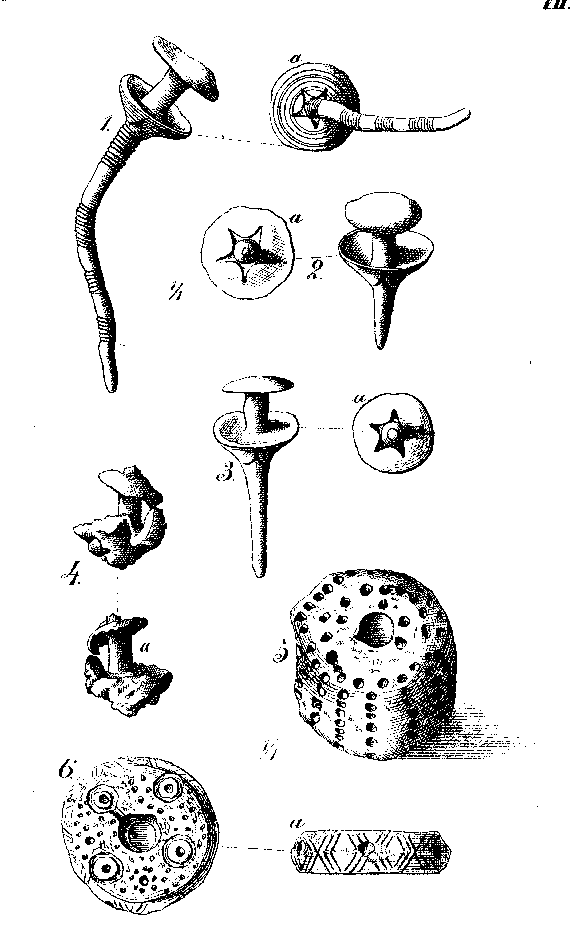


|




|


|




|
Tafel VIII
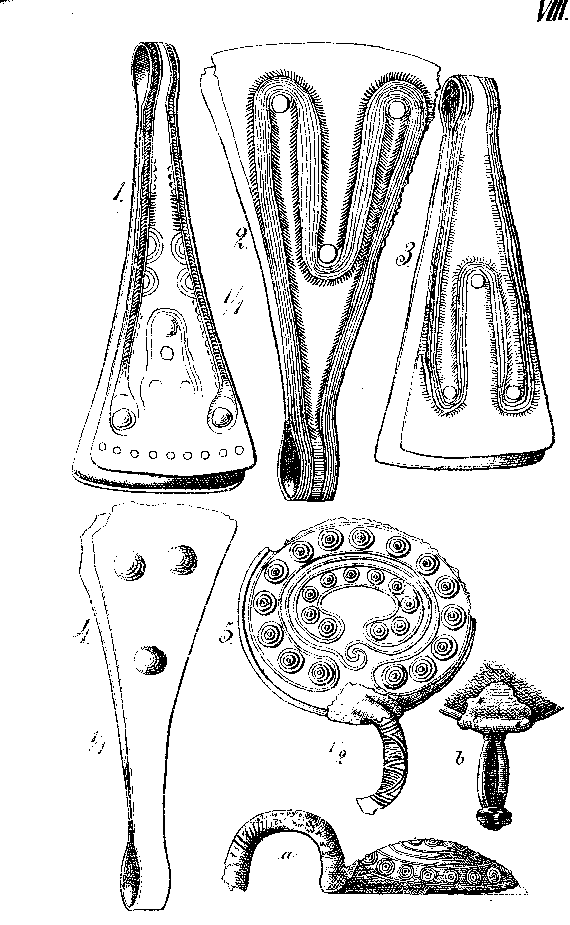


|




|


|
Seite 49 |




|



|



|
|
:
|
IV.
Das bäuerliche Hufenwesen in Meklenburg
zur Zeit des Mittelalters.
Vom
Landsyndicus Ahlers
zu Neubrandenburg.
J e weiter das Meklenburgische Urkundenbuch in der Veröffentlichung unseres Urkundenschatzes fortschreitet, um so lebhafter regt sich der Wunsch, daß das vorliegende reiche Material einer systematischen Bearbeitung unterzogen, und auf diesem Wege für die Cultur= und Rechtsgeschichte des Landes nutzbar gemacht werde. In den Urkunden bewegt sich das Verkehrsleben jener entlegenen Zeit; die Verfasser derselben, anfänglich Geistliche, später juristisch gebildete Laien, meist in amtlichen Stellungen, hatten dem Umstande Rechnung zu tragen, daß ein codificirtes Recht auf keinem Gebiete des Rechtslebens vorhanden war, und daß die gewohnheitsrechtlichen Normen, welche für die einzelnen Gesellschaftsclassen und deren Verhältnisse zur Anwendung kamen, noch den ursprünglich flüssigen und biegsamen Charakter bewahrten; daher das individuelle und mannigfache Gepräge der Urkunden, welche oft überraschende Einblicke in die zum Grunde liegenden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse und in den Wechsel derselben gestatten. Eine systematische Bearbeitung dieses Materials ist daher im Stande, die Farben zu dem allgemeinen Geschichtsbilde zu liefern, einzelne Lücken desselben auszufüllen, herkömmliche Anschauungen zu berichtigen, und diejenigen Punkte zu bezeichnen, wo unsere Kenntniß noch mangelhaft ist und wir einstweilen noch auf Vermuthungen uns angewiesen finden.


|
Seite 50 |




|
Die vortrefflichen Register, welche wir für die ersten zehn Bände des Urkundenbuches besitzen, ermöglichen erst eine solche Bearbeitung; sie sind jedoch ihrem Zwecke nach weit davon entfernt, dieselbe ersetzen zu können. Es wird die Aufgabe darin bestehen müssen, den relevanten Inhalt der Urkunden nach leitenden Gesichtspunkten, welche die Entwickelung einer Geschichtsepoche beherrschen, zu ordnen und in die zukommende Beleuchtung zu stellen; erst dann wird sich ein Bild gewinnen lassen, welches für die allgemeine Landesgeschichte verwerthet werden kann, und welches zugleich den Vorzug einer quellenmäßigen Begründung in Anspruch nehmen darf.
Es ist der Zweck der nachfolgenden Blätter, auf einem Gebiete, welches im Urkundenbuche einen besonders breiten Raum einnimmt, und welches zugleich für die Landesgeschichte bis tief in die Neuzeit hinein von hervorragendem Interesse ist - von der bäuerlichen Hufen=Verfassung und den dadurch bedingten Verhättnissen des Bauernstandes bei uns zur Zeit des Mittelalters - eine Darstellung in dem eben besprochenen Sinne zu versuchen. Es wird sich hierbei empfehlen, die Lage und Verhältnisse, wie sie um die Mitte des 14. Jahrhunderts, auf dem Höhepunkte der Entwickelung, entgegentreten, in allgemeinen Umrissen voranzustellen, um die Bedeutung des Gegenstandes und den Umfang der Aufgabe vorweg erkennen zu lassen. Die Einzelheiten, soweit sie für das Ganze von Bedeutung sind, werden durch Bezugnahme auf das Urkundenbuch und die sonst zu Gebote stehenden Hülfsmittel zu erhärten, besondere Punkte in einem speciellen Theil weiter auszuführen sein.
Jede geschichtliche Betrachtung der bäuerlichen Verhältnisse des Landes muß von der deutschen Besiedelung desselben ihren Ausgang nehmen. Eine nachhaltige und ununterbrochen fortschreitende Germanisirung beginnt für Meklenburg und Pommern erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, nach den entscheidenden Siegen Heinrichs des Löwen und seiner Sachsen über die meklenburgischen und pommerschen Fürsten. 1 ) Schon mit dem Beginn dieser Periode tritt uns die Eintheilung des gesammten für den Feldbau bestimmten Bodens in bäuerliche Hufen (mansi) entgegen, deren eine bestimmte Zahl zu einer Dorfschaft (villa) gehörte. Die territorialen Bezirke, welche die Dorfschaft mit ihren Aeckern, Weiden, Wiesen, Holzungen und Gewässern in sich begreifen, also die einzelnen Ortschaften, sind zum größten Theil aus der wen=


|
Seite 51 |




|
dischen Zeit schon überliefert. Neue Dörfer - die Hagendörfer (indagines) - entstehen auf ausgerodetem Waldland und auf wüsten, mit Rusch und Busch bedeckten Flächen; die bei weitem größte Zahl der Ortschaftsnamen läßt jedoch die wendische Herkunft der Bezeichnung, und damit die wendische Herkunft der Ortschaft in ihren früheren und späteren Grenzen erkennen.
Nachdem nun die deutsche Besiedelung sich befestigt, und auch der zahlreich zurückgebliebenen wendischen Bevölkerung ihren Stempel aufgedrückt hatte, nahmen alle privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Verhältnisse, welche den für die ländliche Bewirthschaftung bestimmten Boden betreffen, ihren Ausgangspunkt von der bäuerlichen Hufe. Fast die gesammte landwirthschaftliche Production ruhte bei uns auf den Schultern des Kleinbauern, der regelmäßig noch mit eigner Hofwehr die Hufe bestellt, oft auch Eigenthümer der Gebäude ist. Aus dem Ertrage der Hufe hat er zunächst den jährlich wiederkehrenden Anforderungen der öffentlichen Gewalt, welche als Reallast auf der Hufe ruhen, zu entsprechen; er hat an den Landesherrn die ordentliche Bede, precaria sive petitio solita, auch erbliche Bede in den späteren Urkunden genannt 1 ), in zwei Terminen, zu Martini und Walpurgis, zu entrichten; die Bede wird von den landesherrlichen Unterbeamten eingefordert und besteht zum größeren Theil in Geld, zum kleineren Theil in dem dreifachen Korn, der annona triplex. Die ordentliche Bede, welche schon in früher Zeit den Charakter eines feststehenden und bevorzugten Canons angenommen hat, erreicht ihrem Betrage nach den Werth von 30 Scheffeln Hartkorn (Roggen und Gerste) für jede Hufe, wenn - für die Mitte des 14. Jahrhunderts - der Scheffel Hartkorn zu 1 Schilling Lübisch oder 1 1/2 Schilling wendisch, und zwei Scheffel Hafer gleich einem Scheffel Hartkorn angenommen werden (U.= B.VIII, p. 177, Nr.1331); je nach Ertragsfähigkeit der Hufe kann sie darunter bleiben, aber auch in einzelnen Fällen diesen Werthbetrag übersteigen. Ihrem Rechtsgrunde nach ist sie aufzufassen als eine für die Aufgabe des unbeschränkten Herrenrechtes der wendischen Landesherren, für die Befreiung vom Kriegsdienst und für die Gewährung des Schutzes, der tuitio, gezahlte Abgabe 2 ). Die alt hergebrachten Befugnisse des wendischen Landesherrn, der Zuwachs, welchen dieselben durch die


|
Seite 52 |




|
deutsche Vogteigewalt erhielten, und die veränderte Kriegs=Verfassung, wonach der Kriegsdienst von den Lehnsleuten geleistet werden mußte, haben ohne Zweifel in ihrer Vereinigung zu einer so hohen Belastung der bäuerlichen Hufe geführt. Die ordentliche Bede kann für jene Zeit als der feststehende Beitrag des Grundbesitzes zu den ordentlichen Kosten des Landes=Regiments und zum Unterhalt des fürstlichen Hauses angesehen werden; aber nicht lange Zeit währte es, bis diese bedeutende Einnahmequelle den Händen der Landesherren mehr und mehr entschwand. Zunächst wurde aller landesherrliche und Privatbesitz, der zur Dotirung der Klöster und geistlichen Stiftungen zur Verwendung kam, regelmäßig von der ordentlichen Bede befreit; der Betrag derselben konnte alsdann der Pachtleistung der Bauern zugeschlagen werden. Sodann verleitete der rentenartige Characker derselben dazu, bei eintretenden Geldverlegenheiten, die sich in steigender Progression für die landesherrlichen Cassen wiederholten, über die Bedeleistung ganzer Ortschaften, oft ganzer Vogteien, durch Verkauf oder Verpfändung zu verfügen. So ist allmählich die alte Geldbede (precaria denariorum) wohl ganz verloren gegangen; von der Kornbede, der annona triplex, gewöhnlich 2 Scheffel Roggen, 2 Scheffel Gerste, 2 Scheffel Hafer von jeder bäuerlichen Hufe, haben sich nicht unerhebliche Reste bis auf die Gegenwart erhalten. In dem Gutachten von Wigger vom Jahre 1875, in Band 29 der baltischen Studien, ist überzeugend nachgewiesen, daß die unter dem Namen Hundekorn vielfach vorkommende Kornabgabe in Pommern, sowie die Kornabgabe von einer Anzahl ritterschaftlicher Güter in Meklenburg an den landesherrlichen Kornboden, welche bei uns den Namen Pacht angenommen hat, derjenige Theil der alten Bede ist, welchen die Fürsten zum Behufe ihrer Hofwirthschaft in dreierlei Korn erhoben.
Eine weitere feste Belastung ergab sich für die bäuerlichen Hufen aus dem Zehntrecht der Bischöfe. Herzog Heinrich von Sachsen bestimmte in der Dotationsurkunde für das Bisthum Ratzeburg, 1158, daß die Slaven im ganzen Bereiche der von ihm gestifteten Bisthümer einen Bischofszins in der Höhe von 3 Maß (kuriz) Roggen, 1 Schilling, 1 Topp Flachs und 1 Huhn von jedem Haken erlegen sollten; davon sollte der Pfarrer 2 Pfennige und 1 Maß Korn beziehen; wenn aber erst nach Austreibung der Slaven das ganze Land zehntpflichtig gemacht worden, so sollte der ganze Zehnte dem Bischof gehören, und dieser sich mit dem Grundherrn über die Dotirung der Parochialkirchen dahin vereinbaren, daß eine jede mit 4 mansi cum censu et decima ausge=


|
Seite 53 |




|
stattet werde. Der Zehntpflicht waren außer den deutschen Colonen auch diejenigen wendischen Bauern, welche zu deutschem Rechte (jure Teutonico) angesetzt wurden, unterworfen. Es wurde unterschieden zwischen dem großen Zehnten, der decima in campo, und der decima minuta, welche von dem Zuwachs des Viehs und vom ländlichen Nebenerwerb zu erlegen war. Im Anschluß an die obige Werthangabe wegen der ordentlichen Bede darf schon hier bemerkt werden, daß nach der Heberolle von Neu=Kloster (Urk.=Buch VI, S. 403, Ao. 1319) sich der durchschnittliche Werth der decima in campo cum minuta, quando redimitur, berechnete auf 25 Scheffel Hartkorn; die Mehrzahl der Hufen in den Klosterdörfern, welchen Ablösung zugestanden ist, zahlt 24 bis 28 Scheffel Hartkorn für den vollen Zehnten. Diese Angaben gestatten einen wichtigen Rückschluß auf den Bruttokörnerertrag der Hufen, wobei freilich der in einem Procentsatz schwer zu bestimmende Werth der decima minuta - eine Berechnung derselben finden wir bei Woldenhagen (a. a. O. S. 407) angegeben - allemal zurückzurechnen ist. - Der geistliche Zehnte theilte insofern das Schicksal der ordentlichen Bede, als er sehr bald in andere Hände überging, in die Hand der Landesherren und der Grundeigenthümer durch Belehnung und sonstige Vereinbarung, in die Hand der Klöster und sonstigen geistlichen Stiftungen durch die Dotationsurkunden. Er konnte sich dann mit der Bede und mit dem restirenden Pachtnutzungs=Aequivalent zu einer einheitlichen Leistung der Bauern an den Grundherrn vereinigen, die dem vollen Nutzungswerthe entsprach; nur die klösterlichen Verwaltungen hielten noch lange den Unterschied zwischen dem Zehnten und den sonstigen bäuerlichen Leistungen aufrecht.
Was nun nach Abzug der ordentlichen Bede und des Zehnten vom Ertragswerth der Hufe noch übrig blieb, bildete den Gegenstand der Behandlung und Vereinbarung mit dem Grundherrn zur Feststellung des bäuerlichen Pachtzinses, des census, Zins, auch pactus und pensio genannt. Waren ordentliche Bede und Zehnten abglöst, so konnte der census, welcher bald in Korn, bald in Geld bestimmt wurde, den gesammten Pachtnutzwerth der Hufe zum Ausdruck bringen. Aus den zum Gute gehörigen Forsten und Torfstichen mußte das nöthige Feuerungsmaterial, aus den Forsten außerdem das zu Reparaturen und Neubauten erforderliche Bauholz dem Bauern verabfolgt werden; gutsherrliche Anweisung war allemal nachzusuchen, wie in der schon angezogenen Heberolle von Neu=Kloster verschiedentlich bemerkt wird. Daß die Wiesennutzung nach Maßgabe ihres Hufenbesitzes den Dorfbewohnern zustand,


|
Seite 54 |




|
war selbstverständlich; Jagd und Fischerei (mit Ausnahme etwa der kleinen Uferfischerei) blieben dem Grundherrn vorbehalten, welcher aus der Fischereipacht oft erhebliche Einnahmen zog.
Es ist oben für die Bauerdörfer von Neu=Kloster - 30 und einige an der Zahl - der durchschnittliche Werthbetrag des Zehnten auf 25 Scheffel Hartkorn angegeben; die Zusammenstellung der Dörfer, in welchen pro censu et decima eine einheitliche Abgabe erhoben wird - wenn wir die dazu gehörigen Hagendörfer und die wenigen Dörfer, welche in Geld zahlen, nicht mit zum Ansatz bringen - ergiebt nun das überraschende Resultat; einer durchschnittlichen Leistung von 50 Scheffeln Hartkorn für jede Hufe, also das Doppelte des Zehnten; die Mehrzahl der Dörfer bewegt sich mit dem Hufenzins zwischen 45 bis 55 Scheffeln Hartkorn; in einem Falle (Warin) werden nur 24 Scheffel, in einem Falle (Klein=Schwaß bei Rostock) werden 72 Scheffel für die Hufe gegeben.
Deutlich treten in dem mehrgedachten Heberegister die Hagendörfer des Klosters - Techentinerhagen, Arnesse (Arenssee), Brunshaupten - hervor. Hier wird von der Hufe nur ein solidus, offensichtlich in signum recognitionis, pro censu gezahlt; dagegen sind sie dem Zehntzuge unterworfen; die zu Techentinerhagen gaben pro decima, quando redimitur, für jede Hufe 24 Scheffel Hartkorn. Eine Anzahl dieser Hägerbauern hat dem Kloster speciales redditus de mansis eorum - verkauft, bis zu 3 Mark 4 Schilling pro Hufe. Wir haben es hier also mit deutschen Colonisten zu thun, welche den Boden erst urbar gemacht, größtentheils wohl dem Wald abgewonnen haben; sie haben die Dörfer erbaut und mit Hofwehren besetzt; von ihnen erhebt das Kloster nur den vollen geistlichen Zehnten neben einer kleinen Recognitionsabgabe. In der Rentenzahlung, welche das Kloster von einigen derselben gekauft; hat, dürfen wir das Aequivalent einer Capitalzuwendung, welche den Pflichtigen für die Zwecke der ersten Einrichtung gemacht ist, und zugleich die Anerkennung eines dinglichen Rechtes derselben an ihren Hufen erkennen.
Zur Vervolständigung des Bildes, welches aus jener Heberolle bezüglich der klösterlichen Bauerstellen entgegentritt, ist nun noch anzuführen, daß das Kloster außer einigen 30 Bauerdörfern auch mehrere Gutshöfe - in Pinnow, Brunshaupten, Dessyn (Groß=Tessin), Knipafh (bei Warin), Warin und Neuhof - besaß, welche es mit eigenem Gesinde bewirthschaftete. Diese Höfe sind zum Theil in derselben Ortschaft, zu welcher eine Bauerschaft gehört, gelegen (Brunshaupten, Gr.=Tessin, Warin); die Bauern sind zu


|
Seite 55 |




|
diesen Höfen nicht dienstpflichtig; nur einzelnen kleinen Hausbesitzern und Käthnern liegt neben der Lieferung von Hühnern und einer Zahlung de agro adjacente auch ein biduanum servicium de qualibet domo ob. Aus dem Lohnregister des Klosters etwa vom Jahre 1320 (Urk.=Buch VI, Nr. 4242) entnehmen wir, daß auf den Gutshöfen durchschnittlich 12 bis 16 Knechte, Jungen (juvenes), Schäfer (opiliones), Hirten, und außerdem 2 bis 4 Mägde gehalten wurden; die Sommerlöhnung (pretium estivale) beträgt für dies Personal pro Hof 12 bis 20 Mark wendisch, der Lohn für die Großknechte 26 Schilling wend. Münze bis herunter zu 2 1/2 Schilling für die Pflegerin der Kälber (ancilla vitulorum). Das Speckregister des Klosters vom J. 1320 (Urk.=Buch VI, Nr. 4229) berichtet, daß beim Beginn der Erntezeit (dominica die ante festum beati Jacobi) aus den Vorräthen des Klosters an jeden dieser Höfe 5 bis 7 Seiten Speck (latera lardi) für die Leute geliefert wurden.
Der Einblick, welchen wir aus dem Vorstehenden in die ökonomische Lage des Bauernstandes, zunächst in den ausgedehnten klösterlichen Besitzungen, gewinnen, wird weiterhin zu vervollständigen sein, insbesondere durch Vergleichung mit andern Gebieten des Landes und durch eine nähere Betrachtung der bäuerlichen Hufe nach Größe und Bewirthschaftungsweise. Für die Zwecke dieser einleitenden Darstellung haben wir jetzt noch einen Blick auf die Rechtsverhältnisse des Bauernstandes und auf die Beschaffenheit seines Besitzrechtes zu werfen. Dabei scheiden wir zunächst aus die Hägerdörfer und die Bauerschaften im Bisthum Ratzeburg.
In keinem Theil des Landes wurde die deutsche Besiedelung in so kurzer Zeit und so planmäßig zur Ausführung gebracht, als im Stiftstande der Bischöfe von Ratzeburg (terra Boitin). Es fehlt zwar an näheren Angaben über den Hergang bei der Besiedelung und über die den ersten Hauswirthen (gleichfalls coloni in den Urkunden genannt) bewilligten Bedingungen; die ununterbrochene Continuität, welche für die Ratzeburger Verhältnisse bis in die Neuzeit hinein anzunehmen ist, gestattet jedoch uns hiervon ein deutliches Bild zu machen. Es gab schon im Beginne der Colonisation eine Anzahl von herrschaftlichen Höfen, zu welchen umliegende wendische Bauerschaften dienstpflichtig waren; diese Höfe mit zugehörigem Ackerwerk, 12 bis 15 an der Zahl, sind von nahezu 70 Bauerndörfern umgeben; die weitere Entfernung einzelner Bauerschaften von der curia war in damaliger Zeit kein Hinderniß, dieselben zu den Hofediensten - Spann= und Handdiensten - heranzuziehen. Durch die verheerenden Kriege, welche der nova plantatio


|
Seite 56 |




|
in diesen Gegenden voraufgegangen, war ein großer Theil der Ortschaften wüst geworden; der Rest der slavischen Bewohner wurde ohne Schwierigkeit ausgetrieben, wie dies schon in der Stiftungsurkunde des Bisthums in Aussicht genommen war. Die Neubesetzung der Dorfschaften erfolgte nun durch massenhaften Zuzug aus Westfalen und den Wesergegenden, welche schon das Kriegsgefolge Heinrichs des Löwen gestellt hatten; ohne Zweifel waren hierbei im Auftrage der Bischöfe Unternehmer thätig, welchen die Anwerbung und die Bekanntgebung der Bedingungen oblag.
Wir begegnen diesen Unternehmern - possessores, magistri genannt, wenn sie durch Landzuweisung in den von ihnen besetzten Ortschaften entschädigt wurden - vielfach in Pommern zur Zeit der dortigen Colonisation (von Bilow, Abgabenverhältnisse in Pommern, 1843, S. 29); ohne die Thätigkeit solcher Werbeagenten ist die in so kurzer Zeit erfolgte Neubesetzung der Ratzeburger Dorfschaften nicht wohl denkbar. In Westfalen und den Wesergegenden gehörte die große Masse der Bauern dem Stande der Hörigen - litones - der älteren Form der Leibeigenschaft -, an (Wiegand, Provinzialrecht von Minden, S. 1834, II., S. 111 seqq.); unausgesetzt lieferte diese in damaliger Zeit reichlich fließende Quelle das Material für die Besiedelung der Ostseeländer. Die Bedingungen, welche die Unternehmer bieten konnten, waren für besitzlose, einem unfreien Stande angehörige Leute verlockend genug: Befreiung von der Hörigkeit, welche durch Verhandlung mit den Grundeigenthümern, meistens Klöstern und sonstigen geistlichen Besitzern, leicht zu erlangen war; Uebernahme einer schon vorhandenen Bauerstelle mit einer, wenn auch beschränkten, Erblichkeit 1 ) und mit gewöhnlichen bäuerlichen Leistungen; gleichzeitige Besetzung der ganzen Dorfschaft mit Genossen derselben Gegend und Herkunft. Ihre Verpflichtungen bestanden wesentlich, außer dem Zehnten von dem, was sie auf ihren Hufen bauten und gewannen, in den Hand= und Spanndiensten zur Bewirthschaftung der bischöflichen Höfe, in sonstigen Herren= und Capitelsdiensten, endlich in verschiedenen Geldabgaben von meist nicht erheblichem Betrage, welche bei der Neuregulirung der Bauerschaften zu Anfang dieses Jahrhunderts (conf. die Versicherungsurkunde bei Masch, Gesetz=Sammlung, S. 262) als Dienst=, Pacht=, Flachs=, Spinn=, Schneidel=, Schweine=, Monats= und Fuhrgeld bezeichnet werden. - Obgleich nun der Schwerpunkt der bäuerlichen Leistungen in den Frohnden und der Dienst=


|
Seite 57 |




|
pflicht ruhte, welche anderwärts einer selbstständigen Entwickelung des Bauernstandes besonders hinderlich gewesen sind, so ist dennoch im Ratzeburgischen ein kräftiger Bauernstand sehr rasch emporgekommen; die Gleichartigkeit der Verhältnisse in 60 bis 70 Dorfschaften, welche das ganze Stiftsland bedeckten, das milde bischöfliche Regiment, die vorzügliche Bodenbeschaffenheit begünstigte nicht nur den Wohlstand der Bauern, sondern auch die Ausbildung der bäuerlichen Rechtsinstitute des Anerbenrechtes und was damit für das bäuerliche Familienleben in Verbindung steht, sowie die Ausbildung einer auf umfänglichen Gemeinschaftsbesitz gestützten Dorfverfassung. Eine erhebliche Milderung der nach den herrschaftlichen Höfen zu leistenden Frohnden wurde dadurch bewirkt, daß die einzelnen Dorfschaften in der Dienstpflicht alternirten, so daß jede Dorfschaft im zweiten oder dritten Jahre für ein ganzes Jahr dienstfrei wurde. Für das schon früh befestigte Recht der Ratzeburgischen Bauerschaften mag die Urkunde vom 2. Febr. 1320 (Urk.=B. VI, S. 508) als Beleg dienen; darnach verkaufte der Bischof Marquard seiner Dorfschaft Malzow - colonis nostris omnibus in dicta villa morantibus - eine angrenzende abgeholzte Fläche Landes für 400 Mark Lübisch, unter Auferlegung eines nicht zu erhöhenden Zinses (census) von 20 Mark jährlich und unter Befreiung dieser Fläche von Zehnten, Diensten und sonstigen Abgaben (exactiones seu tallias). Nach Masch, Geschichte des Bisthums Ratzeburg S. 222, wird die Urkunde noch jetzt wohl erhalten von der Dorfschaft Malzow aufbewahrt.
Das Gegenstück hierzu bildet die das Dorf Römnitz betreffende Urkunde vom Jahre 1285 (U.=B. III, S. 194). Der Bischof Isfried hatte sich mit dem Domcapitel durch Ueberlassung von Zehnten und ganzen Gütern im Jahre 1194 auseinandergesetzt (U.=B. I, Nr. 154; Masch a. a. O. S. 90, 97, 187); zu den dem Capitel überwiesenen Gütern gehörte Römnitz. Fast 100 Jahre später entschließt sich das Capitel zur Niederlegung des Dorfes und zur Aufrichtung einer Hofwirthschaft; den Bauern, 15 an der Zahl, wird zum Abzuge nach einem Jahr und 14 Wochen gekündigt, und sie nehmen die Kündigung an, weil sie, wenn sie auch seit langer Zeit (multo tempore) die Dorfländereien genutzt, doch kein Erbrecht an ihren Stellen hatten (in quibus hereditatem non habebant, de permissione et gratia Ratzeburgensis ecclesiae coluissent); sie bedingen nur, daß ihnen der Werth ihrer Gebäude und der Gartenbestellungsarbeiten nach einer Schätzung durch beiderseits zu erwählende Taxanten in baarem Gelde bezahlt werde; was zugestanden und nach dem vom Vogt und


|
Seite 58 |




|
Rath von Ratzeburg ausgestellten Zeugniß ausgeführt wird; die gezahlten Entschädigungen betragen zusammen 60 Mark. - Diese Urkunde ist in mehrfacher Beziehung von Bedeutung. Zunächst haben wir es nicht mit zurückgebliebenen und etwa bisher übersehenen wendischen Bauern zu thun, wenn nicht die deutschen Namen der in der Urkunde einzeln aufgeführten Bauern (villani) täuschen; sie sitzen anscheinend schon seit Beginn der Colonisation (multo tempore) auf ihren Hufen. Jedenfalls haben sie die hereditas, das erbliche Recht, nicht erworben und müssen daher auf Kündigung weichen.
So werden in dem Präbenden=Verzeichniß des Domcapitels zu Lübeck aus dem Jahre 1263 und in dem Verzeichniß der zur Domkirche zu Lübeck gehörenden Vicareien vom Jahre 1264 (Mekl. Urk.=B. II, S. 222, 239) diejenigen mansi, deren hereditas den coloni oder rustici zusteht, einzeln hervorgehoben; ebenso der Rückkauf der mansi mit hereditas in einzelnen Fällen; es geschieht dies zu dem Zwecke, damit die Vicareien=Inhaber die Befugniß erlangen, hujusmodi hereditatem locandi, cum placuerit, pro ampliori.
Die Erblichkeit des Colonatbesitzes beruhte also auf besonderem Rechtstitel; wo sie nicht zugestanden war, war der Colon einer Erhöhung des census und der Kündigung ausgesetzt. - In gleicher Lage befanden sich die Zinsbauern des Sachsenspiegels, Landrecht II, 60, §. 1, wo es heißt: "Will ein Mann seinen Zinsmann, der zu dem Gute nicht geboren ist, von dem Gute weisen, so soll er ihm kündigen zu Lichtmeß. Dasselbe soll der Mann thun, wenn er es verlassen will." Das Recht des Zinsbauern ist nach dem Sachsenspiegel sogar beschränkt auf die Lebzeit des Herrn, der ihm das Gut verliehen hat auch wenn dies auf "beschiedene Jahre" geschehen ist, "soll man es dem Erben wiedererstatten, weil er (der Erblasser) es nicht länger geweren mochte, als, so lange er lebte" (III, Art. 77 ibid.); ferner: Erbzinszahlung mag der Herr des Dorfes an dem Gute gewähren, wo die Bauern ein neues Dorf von wilder Wurzel besetzen (III, Art. 80, §. 1 ibid.).
Die zuletzt angeführte Stelle des Sachsenspiegels führt uns zu einer zweiten Classe von bäuerlichen Besitzrechten, welche eine besondere Stellung zur Zeit des Mittelalters bei uns einnahmen, zu den Hagendörfern (indagines in den Urkunden genannt) und Hagenhufen. Zur Zeit der deutschen Besiedelung gab es, wie schon bemerkt, weite Strecken Landes, die, obwohl zum Ackerbau geeignet, bisher nicht angebaut und urbar gemacht waren, die solitudines und loci horroris der Urkunden, Land, welches noch in Rusch und Busch lag; außerdem überwog in einzelnen Gegenden


|
Seite 59 |




|
der Wald derartig, daß der Boden erst stückweise durch Umwandlung in Acker nutzbar gemacht werden konnte. Die wendische Bevölkerung hatte den Anbau nur zu des Lebens Nothdurft betrieben; Jagd, Fischerei, Viehzucht waren ihr zusagender; es fehlte ihr ein Geschick und Unternehmungsgeist, vor allem aber an dem erforderlichen Vermögen, um einen noch uncultivirten Boden dem Anbau zu unterwerfen, die Wohn= und Wirthschaftsgebäude neu herzustellen und das Wirthschafts=Inventarium, die Hofwehr, aus eignen Mitteln zu beschaffen. Es war daher das Absehen der Grundbesitzer darauf gerichtet, deutsche Colonisten, welche der vorliegenden Aufgabe zu genügen im Stande waren, heranzuziehen. Selbstverständlich mußten die zu stehenden Bedingungen den von den Anziehenden zu bringenden Opfern entsprechen. Vor allem mußte dauerndes erbliches Besitzrecht, die hereditas an Grund und Boden, zugestanden werden, und Befreiung von allen Abgaben bis zu dem Zeitpunkt, wo die Höfe eingerichtet und zum Ertrage gebracht waren; die demnächst zu entrichtende Abgabe mußte erheblich geringer bemessen werden, als wie die von cultivirtem Boden und eingerichteten Wirthschaften zu erlegende. Wir haben bereits oben bei den Bauerschaften von Neu=Kloster gesehen, daß die Hagendörfer nur einen Recognitions= census von I solidus pro manso zu entrichten hatten, außer dem vollen geistlichen Zehnten; endlich war die Befreiung von bäuerlichen Diensten wesentlich und unerläßlich für ein dem Erbpachtbesitz nahekommendes Verhältniß.
Der Name Hagen, indago, gleichbedeutend mit Umzäunung, führt auf die mensura, qua metiri solent indagines, und auf die justitia, que vulgariter dicitur hagersche recht. (U.=B. III, S. 227, Ao. 1286; IV, S. 219, Ao. 1268). Es wurde die Hägerhufe mit dem Meßseil (per funiculum) in der Art zugemessen, daß zunächst die Begrenzung des dem Ackerbau zuzuführenden Bodens gesichert und festgestellt wurde, und zwar in einer zusammenhängenden Fläche. Selbstverständlich war auch der zu überweisende Flächeninhalt Gegenstand der Vereinbarung und Feststellung; dieser wurde nach Morgen (jugera) bestimmt.
Wir berühren hier ein für die mittelalterlichen Agrarverhältnisse ebenso wichtiges als schwieriges Gebiet, die Frage nach den Ackermaßen, welche man zur Anwendung brachte, und nach der Zahl der Morgen, welche einer bäuerlichen Hufe beigelegt wurde. Es mag an dieser Stelle schon bemerkt werden, daß der Morgen, dem Begriffe nach entsprechend der Arbeitsleistung eines Tages von zwei Zugthieren, in älterer Zeit kein geometrisch bestimmtes Flächenmaß bedeutete, sondern gleichbedeutend genommen


|
Seite 60 |




|
wurde mit der Fläche, welche für die Aussaat einer bestimmten Quantität Hartkorns erforderlich war. Erst in neuerer Zeit, seit die Gesetzgebung begann sich mit den agrarischen Verhältnissen zu beschäftigen, ist es zu einer Umwandlung der alten, nach Einsaat bestimmten Flächenmaße in geometrisch bestimmte Maße gekommen. Eine solche Bestimmung hätte für Meklenburg bei der großen Verschiedenheit der thatsächlich bestehenden Verhältnisse ganz besondere Schwierigkeit gehabt; es hat sich daher auch der Erbvergleich von 1755 für die Zwecke der Besteuerung der städtischen Ländereien (§. 47, sub II) auf die Bestimmung beschränkt, daß ein Morgen Ackers zu 4 Scheffeln Rostocker Maße, worunter Hartkorn zu verstehen, angenommen werden solle. - Dazu kommt, daß man schon im Mittelalter an verschiedenen Orten in Meklenburg bald nach großen, bald nach kleinen Scheffeln rechnete; die Leistungen von den Hufen derselben Ortschaft sind sogar bald nach großen, bald nach kleinen Scheffeln berechnet. (U.=B. VIII, S. 549, Ao. 1335; VI, S. 456, Ao. 1319.) Und während es in dem Verzeichniß der "zugehörigen Dinge zum Gotteshause Givetzin" vom 26. Mai 1575 - welches noch jetzt im Original dem Gevetziner Kirchenrechnungsbuche anliegt - heißt: "7 Morgen Land im großen Felde, darin fallen 14 Schepel Korn; 3 Morgen Land im Mittelfelde, darin fallen 6 Schepel Korn", wird wegen der auf der Friedländer Feldmark belegenen 996 catastrirten Morgen in dem P. M. einer dortigen Magistratsperson vom 4. October 1861 berichtet, daß diese bisher nicht vermessenen Morgen durchschnittlich von 3 Scheffeln Aussaat seien, "aber auch von 1 bis 6 Scheffel in der Größe wachsend."
Kehren wir nach dieser Abschweifung zu den Hägerhufen zurück, so ist für die Verhältnisse der Rostocker Hägerdörfer - Rövershagen, Wasmodeshagen, Porrikeshagen, das in U.=B. VII, S. 253 abgedruckte Kämmerei=Register vom Jahre 1325 von besonderem Interesse. Von den 22 Hufen in Rövershagen, 25 in Wasmodeshagen, 6 1/4 in Porrikeshagen waren zur Zeit der Landesvermessung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch 12 Hufen mit Einschluß der Schulzenhufe und der Pfarrhufe in Rövershagen (nach Ausweis der Directorial=Karte) vorhanden; an Stelle der übrigen waren längst die Pachthöfe Oberhagen, Niederhagen, Purkshof eingerichtet. Jene 12 Hufen entsprechen genau der im Kämmerei=Register gegebenen Beschreibung. In unmittelbarer Folge neben einander erstrecken sie sich von der Grenze von Purkshof in Längsstreifen versus nemus, die Rostocker Heide; sie werden auf dieser Seite begrenzt durch die Dorfstraße und die an


|
Seite 61 |




|
derselben belegenen Gehöfte, welche sich in der ganzen Ausdehnung quer vor die zugehörigen Hufen legen. Zwischen Dorf und Heide befindet sich ein mannigfaltig und unregelmäßig gestalteter Complex von Ackerfiguren, Wiesen, Brüchern, Buscagen, Brinken u. s. w., welcher seinem Flächeninhalte nach dem Hufencomplex etwa gleichkommt; es ist dies das Ueberland, der overslach des Registers, welcher den Colonen von Rövershagen zu dem sehr mäßigen Preise von 10 Mark jährlich aus dem Grunde überlassen war, weil sie die Dotation der Pfarre daselbst mit 1 1/2 Hufen aus eigenen Mitteln beschafft hatten; auch die Schulzenhufe enthielt 1 1/2 Hufen. Während nun die Aufmessung der Hufen ohne das Ueberland einen von 6700 □Ruthen bis 7300 □Ruthen wechselnden Flächeninhalt ergeben hat ist die Pfarrhufe ohne Ueberland zu 12,095 □Ruthen, die Schulzenhufe zu 10,646 □Ruthen vermessen worden. Ob bei diesen Ungleichheiten eine verschiedene Bonität der Ackerflächen bei der anfänglichen Zumessung zur Berücksichtigung gekommen, ob Gräben, Wege, Wasserlöcher abgerechnet worden, oder ob wir es nur mit den Unvollkommenheiten des Meßverfahrens zu thun haben, muß dahingestellt bleiben; jedenfalls entspricht das Bild, welches die Directorialkarte von Rövershagen gewährt, im Großen und Ganzen der im alten Rostocker Kämmerei=Register gegebenen Beschreibung der Hägerhufen. Wenn es nun in demselben weiter heißt: qui mansi longitudinem habebunt septem jugerum et dimidii versus nemus, so können wir im Beihalte der aus der Directorialkarte sich ergebenden Maße die Länge und Breite eines Morgens und den Flächeninhalt einer Hufe berechnen. Zunächst ergiebt der vermessene Gesammtflächeninhalt der fraglichen 10 Bauerhufen, 1 1/2 Pfarrhufen, 1 1/2 Schulzenhufen, zusammen also von 13 Hufen - ohne das Ueberland - 93,177 □Ruthen, wozu für kleinere, besonders vermessene Figuren innerhalb der Hufen noch ein Geringes hinzukommt. Wir können also den durchschnittlichen Flächeninhalt der Hägerhufe auf 7200 □Ruthen mit ziemlicher Genauigkeit annehmen. Die Breiten=Dimensionen der einzelnen ganzen Hufen variiren nach der Directorialkarte von 22 Ruthen bis 30 Ruthen, die Längen=Dimensionen entsprechend von 240 Ruthen bis 330 Ruthen; als mittlere Zahl nach welcher das Kämmereiregister gerechnet haben wird, ergeben sich für die Breite 24 Ruthen, für die Länge 300 Ruthen, also für jede Hufe wiederum 7200 □Ruthen. Haben daher in der Längsrichtung 7 1/2 Morgen hinter einander gelegen, so erhalten wir für den Morgen eine Länge von 40 Ruthen, eine Breite von 6 Ruthen, einen Flächeninhalt von 240 □Ruthen für den Morgen,


|
Seite 62 |




|
gleich 4 Scheffeln Rostocker Maß Aussaat, und 30 Morgen für die Hägerhufe. - Dies also scheint die mensura, qua metiri solent indagines, wenigstens für die Rostocker Hägerhufen gewesen zu sein; die Ruthe ist die 16füßige meklenburgische (virga, que vulgariter dicitur metrode, habens in longitudine XVI pedes, U.=B. VIII, S. 431). - Die per funiculum zugemessene Hägerhufe war größer als eine gewöhnliche Bauerhufe; wir werden später sehen, daß die letztere im Lande Stargard, und wohl auch in anderen Theilen unseres Landes, nur etwa zwei Drittel einer Rostocker Hägerhufe befaßte, und daß die Frage, wie viel Morgen Ackers man auf eine gewöhnliche Bauerhufe zu rechnen habe, wesentlich davon abhängt, wie man den Morgen bestimmt, also ob man, wie das Geveziner Kirchenrechnungsbuch 2 Scheffel großes Maßes, oder wie in Rostock 4 Scheffel kleines Maßes an Einsaat auf den Morgen rechnete. Eine praktische Bedeutung hat diese Frage, wie schon aus Obigem erhellt, zunächst nur für die Hägerhufen.
Die Besitzer derselben standen den übrigen bäuerlichen Besitzern insofern gleich, als sie der Gerichtsbarkeit des Grundherrn, von welchem sie ihr Recht ableiteten, unterstanden (U.=B. IV, S. 219, Ao. 1268); ferner gleich in Bezug auf die Benutzung von Wiese, Weide, Wald und Torfstich. Ihre Leistung konnte erhöht werden, wenn sie im Laufe der Zeit mehr Land für den Ackerbau oder sonstige private Nutzung in Besitz genommen hatten, als ihnen zugemessen war, was gerade bei den Hägerhufen häufig vorkommen konnte.
Wurden Hägerhufen auf geistlichem fundus errichtet, so bestand die Leistung, wie wir gesehen haben, wesentlich in der Zehntpflicht; grundbesitzende Laien, selbst der Landesherr, konnte Hägerhufen und Dörfer nach der Natur der Sache nur auf zehntfreiem Boden errichten. Daß in unseren Gegenden der Zehnte im Laufe des Mittelalters durch Infeudation und sonstigen Vertrag in die Hand der grundbesitzenden Laien zum größten Theil übergegangen war, ist schon oben bemerkt worden.
Auf zehntfreiem Boden, der nicht zugleich bedefrei gemacht worden, handelte es sich zunächst um das Aequivalent der fürstlichen Rechte, die ordentliche Bede. In dieser Beziehung sind die Urkunden vom 30. März 1320 und vom 22. Mai 1328 im U.=B. VI, S. 519; VII, S. 551, besonders lehrreich.
Die Pöler Dörfer und Hufen nebst sieben Dörfern auf dem benachbarten Festlande waren im Jahre 1318 vom Fürsten Heinrich II. von Meklenburg den Rittern von Plessen, von Preen,


|
Seite 63 |




|
von Stralendorf mit allen fürstlichen Rechten für Schuld zu vollem Eigenthum übertragen (appropriata et dimissa cum mero et vero domimo, U.=B. VI, S. 387). Im Jahre 1320 verkaufen die genannten domini an Lübische Bürger 5 Hufen in Timmendorf, worunter sich 2 Hainhufen oder Hägerhufen befanden, für 164 Mark Lübisch. Die Leistungen der Hufen werden aufgeführt und betragen für jede Hägerhufe 11 1/4 Scheffel Hartkorn und 4 1/2 Schilling Lübisch, für jede der übrigen 3 Hufen 23 3/4. Scheffel Hartkorn und 4 1/2 Schilling Lübisch. Außerdem wird den Käufern verkauft die ordentliche Bede (precaria) für 120 Mark Lübisch, "in qua precaria pro suo libito voluntatis perfruendo posse plenum habebunt, sicut hactenus nos et ante nos nobilis dominus noster Magnopolensis dinoscitur habuisse"; gegen diese Zahlung, also 24 Mark Lübisch pro Hufe, werden die Käufer und deren Colonen befreit erklärt von allen "onera serviciorum, laborum seu vectigalium, nec ad aliqua violentarum exactionum, prestationum seu precariarum gravamina in perpetuum adstringentur"; nur den Käufern gegenüber sollen den Colonen diese Verpflichtungen in Zukunft nach obliegen. - Im Jahre 1328 verkaufen dieselben Verkäufer an einen der früheren Käufer wiederum 7 Hufen in Timmendorf, worunter gleichfalls 2 Hainhufen; der Kaufpreis beträgt 270 Mark Lübisch; außerdem werden verkauft für 200 Mark Lübisch die vorgedachten fürstlichen Rechte, und wird mit den Colonen selbst ein Ablösungs=Vertrag geschlossen. Werden hierbei nun die Pachtleistungen der erstgenannten 5 Colonen zum Grunde gelegt, wie nach Inhalt der Urkunde undedenklich geschehen kann, so beträgt die jährlich von den Colonen, mit Einschluß der Hagenbauern, zu zahlende Ablösungssumme für die ordentliche Bede 30 Schilling Lübisch pro manso, dem Werthe nach gleich ebenso viel Scheffeln Hartkorn.
Wir ersehen hieraus, daß es außer den Hagendörfern auch vereinzelte Hagenhufen in anderen Dörfern gab, und daß, wenn der Landesherr der Grundbesitzer war, an die Stelle des geistlichen Zehnten in den Kloster=Dörfern die ordentliche Bede oder deren Geldwerth trat. Und wenn oben der Betrag des Zehnten für die Klosterhufen bei Neukloster auf 24 Scheffel Hartkorn angegeben worden sind, so erhellt, daß die landesherrliche ordentliche Bede diesen Werthbetrag noch überstieg und die volle Hälfte von dem Pachtwerth der Hufe für sich in Anspruch nahm. -
Bevor wir nun zu den Rechtsverhältnissen der übrigen bäuerlichen Besitzer, welche der landesherrlichen oder einer ritterschaftlichen Grundherrschaft unterworfen waren, übergehen, ist im An=


|
Seite 64 |




|
schluß an das über die Hägerhufen Beigebrachte noch einer damit verwandten Erscheinung zu gedenken.
Einzelne Bauerhofsbesitzer oder ganze Bauerschaften erwerben durch Kauf oder sonstigen onerosen Titel das erbliche Besitzrecht, die hereditas, an ihren Hufen von ihren Grundherren; sie erkaufen für sich und ihre Nachkommen die Befreiung von der Nachmessung und die Unveränderlichkeit ihrer derzeitigen Leistungen; sie schließen wegen einzelner Leistungen Fixirungs=Verträge mit ihren Grundherren, welche perpetuis temporibus gelten sollen; sie erwerben Berechtigungen in Bezug auf Holz= und Torfnutzung durch förmlichen Vertrag, in einzelnen Fällen auch die Befugniß zu Eigenthums=Dispositionen durch Verkauf; die Befugniß, den Bauerhof selbst zu verkaufen, wird in der in den Jahrbüchern VII, S. 306 abgedruckten Urkunde vom Jahre 1507 als Einräumung des Bauerkaufes im Gegensatz zu dem rechten Landkauf (U=B. XIII, S. 470) bezeichnet. In allen diesen Fällen werden die bäuerlichen Leistungen, welche unabänderlich auf der Hufe ruhen sollen, genau bestimmt.
Man kann nicht sagen, daß durch die Zugestehung des erblichen Besitzrechtes oder der Unabänderlichkeit der Leistungen die Besitzer schon das volle dingliche Recht der Hägerhufen, wie solches aus dem Rostocker Stadtbuche (U.=B. V, S. 502) entgegentritt, erworben hätten. Denn wir sehen, daß die Befugniß zu Eigenthums=Dispositionen, insbesondere zum Verkauf der Hufen oder zugehöriger Gerechtsame, besonders erworben und zugestanden sein mußte. Da die Frage ob und in welchem Umfange ein erbliches Besitzrecht der Bauern an ihren Hufen anzunehmen sei, für die Folgezeit eine bedeutende Rolle spielt, so lassen wir einzelnes hierauf Bezügliche, was theilweise schon im Obigen berührt ist, aus dem Urkundenbuche folgen.
U=B. II, S. 222. In dem Verzeichniß der Präbenden des Domcapitels zu Lübeck vom Jahre 1263 heißt es bei Johannsdorf (bei Dassow) und Fährdorf (auf Pöl): hereditas est colonorum; bei Seedorf (unweit Benkendorf): hereditas dicitur esse colonorum.
U.=B. II, S. 239. In dem Verzeichniß der Vicarien in der Domkirche zu Lübeck vom Jahre 1264: bei 2 mansi auf Pöl hereditas est rusticorum. In Fährdorf haben die vicarii die hereditas von 4 3/4 Hufen; sie haben daher die Befugniß "hujusmodi hereditatem locandi, cum placuerit, pro ampliori." In Bleese, Amts Gadebusch: "hereditas est rusticorum"; dagegen haben die vicarii auf Pöl "prope ecclesiam" (Kirchdorf) "2 mansi, quorum hereditas libera est vicariorum."


|
Seite 65 |




|
Urk.=Buch II, S. 419. Im Jahre 1271 bezeugen Abt und Convent in Dargun, daß mit den Bauern zu Polchow (cum civibus de Polchowe) dahin Vereinbarung getroffen sei, daß die Dorfschaft für alle Zeiten aus 10 zinspflichtigen und 2 zinsfreien Hufen bestehen, und die Hufen keinerlei Nachmessung unterworfen sein sollen (ipsi mansi sic sub numero tantummodo 12 mansorum ipsis [civibus] perpetuo perseverent). Der Census von jeder Hufe wird auf 48 Scheffel Hartkorn, 2 Schillinge pro porco (für die Mast) und für die decima minuta auf 1 Huhn und 1 ligatura lini bestimmt.
U.=B. III, S. 635. Die Herren von Büren zu Prebberede verkaufen im Jahre 1296 ihren civibus fidelissimis daselbst den zum Dorf gehörigen Acker mit dem Ueberschlag für 70 Mark, unter Auferlegung einer Hufen=Abgabe (pro pensione et censu) von 65 Scheffeln Hartkorns, 4 Schillingen de censu porcorum, quod vulgare suinscult dicitur, 1 top lini, von jedem Hause 1 Huhn. Ausgenommen vom Verkaufe sind die Mühle, die Fischerei, der Wald. Wer von den Verkäufern in Zukunft in Prebberede wohnen will, kann nihil mansionis ibidem obtinere, nisi quod propriis denariis emere sibi posset; wenn aber einer derselben oder deren Erben zufällig dort übernachten muß, so hat ihn der magister civium, auch burmester genannt, aufzunehmen, wogegen ihm ein Erlaß von 4 Scheffeln Roggen, 4 Scheffeln Gerste und 4 Scheffeln Hafer an dem Zins (census) zugestanden wird. - Im Jahre 1311 (U.=B. V, S. 573) erwerben die Bauern daselbst von denselben Verkäufern auch die in dem privilegio primo von 1296 noch vorbehaltenen Gegenstände durch Kauf, pro se et suis successoribus jure hereditario libere perpetuo possidendum. Doch wird die den Bauern eingeräumte Befugniß, unum juger cespitum vendere, cui volunt, besonders erwähnt.
U.=B. VI, S. 261. Das Kloster Dargun verkauft im Jahre 1317 seinen Bauern in Walkendorf den ususfructus der Walkendorfer Waldung, begiebt sich der Befugniß, zum Verkauf Holz fällen zu lassen, oder anderweitig über die Substanz zu verfügen, sichert Befreiung von der Nachmessung für alle Zeiten zu, sowie die Unveränderlichkeit der census vel pensiones; prout nunc distincti sunt agri ipsorum et mansorum distinctiones, sic eos ipsi et ipsorum posteri tempore possideant sempiterno. Der Kellermeister (cellerarius) des Klosters mit Zuziehung von vier Bauern, welche die Dorfschaft aus sich erwählt, hat die ordnungsmäßige Ausübung des ususfructus an der Waldung zu über=


|
Seite 66 |




|
wachen. Für diese Gerechtsame hat die Dorfschaft 200 Mark gewöhnlicher Münze bezahlt.
U.=B. VII, S. 232. Die Fürsten von Werle geben im Jahre 1325 der Stadt Waren das Eigenthum des Dorfes Glewest, mit der näheren Bestimmung: "wenn sie - Rathmannen und Stadtgemeinde - ausgekauft haben die Erblichkeit der Einwohner dieses Dorfes, dann mögen sie die Erblichkeit zerbrechen und gründlich zerstören, so daß das Dorf und das dabei Gelegene ewig wüst bleiben soll."
U.=B. X, S. 126. Die Herren von Gubkow verkaufen im Jahre 1347 den viris discretis universis et singulis villanis seu colonis in villa Pranghendorp commorantibus, Unterthanen des Klosters Doberan, dimidium mansum cespitum, qui vulgariter dicitur torfmur, für 38 Mark Sundisch zum Ausstechen, mit der näheren Bestimmung, daß die verkaufte Fläche 20 jugera enthalten solle, und daß die vorgenannten villani suique heredes et successores possidere et exfodere debent et debebunt ad tanti temporis duracionem, quousque dictus dimidius mansus sespitum funditus - fuerit exfossus. Wenn dies geschehen, dann soll der fundus an die Verkäufer und deren Erben zurückfallen. Auf die Zusicherung, daß der dimidus mansus sespitum 20 Morgen enthalten solle, wird später zurückzukommen sein.
Lisch, Jahrbücher VII, S. 306. Hermann von der Lühe überläßt im Jahre 1507 den Bauern Martin und Heinrich Ilow den Burgwall zu Ilow für sich, ihre Erben und Nachkommen, zu brauchen, zu besitzen und besitzen zu lassen, gegen einen jährlichen Zins und 13 Tage Dienst im ganzen Jahr, mit der Nebenbestimmung, daß die Käufer auch den "Bauerkauf davon haben sollen", und daß der Zins und die Dienste niemals erhöht werden dürfen.
U.=B. XIII, S. 9. Busse von der Dolle auf Badresch verkauft im Jahre 1351 an die Söhne des früheren Schulzen zu Badresch, Gerke und Nanne Evert und deren rechte Erbnehmer, den daselbst belegenen bomgarden nebst anstoßendem Werder, 4 Hufen enthaltend, mit Antheil an der Hölzung, und wird von Seiten des Verkäufers außer dem Vorkaufsrecht bedungen eine Recognitionszahlung (to ener urkunde) von 8 wendischen Schillingen jährlich. - Unter den Nachkommen der Käufer entstehen Streitigkeiten über ihre Antheile am Baumgarten, welche von den Nachkommen der Verkäufer im Jahre 1514 dahin geschlichtet werden, daß der eine Theil für sich und seine leiblichen Erben 2 Hufen und die Hälfte des Holzes in Besitz und Gebrauch behalten soll;


|
Seite 67 |




|
wenn sein Geschlecht ausgestorben, soll das vorbenannte Gut ungetheilt und unverkauft dem Geschlechte der Hanneken Evert zufallen.
U.=B. IX, S. 607. Bei dem Verkaufe der Dörfer Seedorf, Brandenhusen und Weitendorf und von 3 Hufen zu Wangern auf Pöl Seitens der Ritter von Stralendorf an das Heil. Geist=Hospital zu Lübek im Jahre 1344 ist mit den coloni dictarum villarum et mansorum vereinbart (bona et libera voluntate arbitrati sunt), daß sie außer ihrem gewöhnlichen census jährlich von jeder Hufe loco precarie duas marcas den. Lub. - perpetuis temporibus dare debeant expedite.
U.= B. XIII, S. 696. Im Jahre 1355 überläßt Herzog Johann von Meklenburg=Stargard an Vicke Mund ein Drittel der Bedehebungen aus dessen 29 Hufen in Beseritz; die Bede wird von 30 Schillingen Brandenburgisch auf 20 für die Hufe gemindert: die geminderten 10 Schillinge soll Vicke Mund jährlich von den Bauern, die zu den Hufen gehören, erheben, also lange, bis sie ihm oder seinen Erben diese 10 Schilling Bede abgelöst haben. - 1 Schilling Brandenb. wird für jene Zeit gleich 2 Schilling wendisch und gleich 1 Scheffel Hartkorn großen Maßes zu rechnen sein.
Diese Beispiele werden sich durch eine Nachlese aus dem Urkundenbuche leicht vermehren lassen; wir ersehen daraus, daß sich im Laufe des Mittelalters in einem weiten Umfange erbliches Recht und dingliche Berechtigungen an den Bauerhufen ausgebildet hatten, daß jedoch diese Berechtigungen nur durch Verträge mit der Grundherrschaft erworben werden konnten. -
Wir haben jetzt noch einen Blick zu werfen auf die Rechtsverhältnisse der großen Masse der übrigen bäuerlichen Besitzer, welche im Bereiche der landesherrlichen Vogteien und der ritterschaftlichen Güter angesessen waren und weder Hägerhufenrecht, noch erbliche Berechtigung erworben hatten.
Hier ist vor Allem Gewicht darauf zu legen, daß bei der deutschen Colonisation eine starke, in einzelnen Gegenden (außerhalb der Grafschaft Schwerin) wohl überwiegende wendische Bevölkerung auf dem platten Lande zurückblieb, welche, abgeschnitten von ihren Stammesgenossen und rings umgeben von deutschen Städten und deutschen Colonisten, sehr bald deutsche Sprache, Sitte und Familiennamen annahm und mit der deutschen Bevölkerung im Laufe der nächsten Jahrhunderte völlig verschmolz. Nur in den Städten machte sich der Unterschied beider Nationalitäten noch lange Zeit hindurch, bis in die Neuzeit hinein, geltend, für die ländliche Bevölkerung bestanden ähnliche Hindernisse, wie sie sie


|
Seite 68 |




|
z. B. das Zunftwesen der Städte mit sich brachte, nicht; wurden wendische Bauern zu deutschem Rechte, jure Teutonico, angesetzt, also zehnt= und zinspflichtig gemacht, so kamen sie in eine den deutschen Colonen völig gleiche Rechtslage.
Helmold in seiner Slaven=Chronik II, Cap. 14 berichtet, daß, nachdem Heinrich der Löwe seinen Frieden mit Pribislav gemacht, das ganze Slavenland bis nach Schwerin, olim insidiis horrida et pene deserta, jetzt mit Gottes Hülfe fast in eine einzige sächsische Colonie verwandelt sei: Pribislav habe die Burgen Meklenburg, Ilow und Rostock erbaut, beziehungsweise wieder aufgerichtet, und habe in deren Bereich die slavischen Völker angesiedelt (in terminis eorum collocavit). Für den den wendischen Landesherrn verbliebenen Machtbereich ist nach Wiederherstellung des Friedens an eine weitere Rückwanderung der durch langjährige Kriege schon stark gelichteten wendischen Bevölkerung nicht zu denken; deutsche Colonisten schoben sich überall ein, wo es galt, ertragsfähiges Land dem Boden abzugewinnen und urbar zu machen, oder wo die wendische Bevölkerung zur Besetzung der Dörfer nicht ausreichte und nicht hinreichend leistungsfähig sich auswies. Die letztere wurde dann oft auf einem besonderen Theil der Dorffeldmark angesiedelt, und entstanden alsdann zwei besondere Ortschaften desselben Namens neben einander, welche nach Größe oder Nationalität ihrer Bewohner unterschieden wurden. Man sieht, wie sehr hierdurch einerseits eine Verschmelzung beider Nationalitäten durch Umwandelung der wendischen Elemente gefördert wurde; andererseits ist klar, daß sich der deutschen Colonisation von Anfang an ein Element zugesellte, welches der weiteren Entwickelung deutsch=rechtlicher Institutionen im Bauernstande nicht förderlich war.
Wir geben auch hier einige Belegstücke aus dem Urkundenbuche.
Der Bischof Dietrich von Lübek, zu dessen Sprengel die Insel Pöl gehörte, beurkundet im Jahre 1210 (U.=B. I, S. 187), daß diese Insel bisher noch von Slaven bewohnt gewesen, daß aber propter penuriam et paucitatem hominum gentis illius eam (insulam Poele) excolere non valentium der Fürst Heinrich von Meklenburg (Borwin) deutsche Colonen auf derselben angesammelt habe; der Fürst habe für diese Colonen beharrlich der Unterwerfung derselben unter die Zehntpflicht sich widersetzt. In Erwägung nun, tutum non esse cum eo, qui haberet sociam multitudinem, contendere, habe sich der Bischof auf Vergleich eingelassen: ut aliqua in pace obtineremus, aliqua contemnenda putavimus. Es sei daher, nach Berathschlagung mit dem Schweriner


|
Seite 69 |




|
Bischof, dem Doberaner Abt und dem eigenen Capitel, die eine Hälfte der von den deutschen Colonen zu erhebenden Zehnten dem Fürsten zu Lehn gegeben, außerdem für 12 Hufen die Zehntpflicht duch lehnsweise Uebertragung ganz aufgegeben.
Das Dorf Brüsewitz, Amts Schwerin, ist noch im Jahre 1220 von Slaven bewohnt. Als in diesem Jahre der Graf Gunzel von Schwerin dieses Gut seiner Gemahlin Oda schenkt, verleiht er den Slaven ipsam villam inhabitantibus et postmodum inhabitare volentibus das jus Teuthonicale; 3 mansi werden jure feodali ausgethan, damit die Inhaber - als Dorfschulzen - darüber wachen, ut ipsius ville Slavi de bonis suis diligencius responderent. (U.=B. I, S. 250.)
Fürst Heinrich von Meklenburg verleiht im Jahre 1315 dem Kloster Doberan die vollen Eigenthumsrechte mit der hohen und niederen Gerichtsbarkeit über die slavischen Dörfer Stülow und Hohenfelde und bestimmt in der Verleihungs=Urkunde, quod omnis ordinatio jurisdictionis in predictis villis debet esse et fieri jure Slavicali, prout antiquitus Slavi usi fuerunt. (U.=B. VI, S. 134.)
Eine Anzahl von Slaven zu Jatzke, Kreis Stargard, nehmen gegen das Kloster Broda im Jahre 1330 die curia Jazke nomine hereditario in Anspruch. Sie werden durch Zahlung von 45 Mark wegen dieser ihrer Ansprache abgefunden (U.=B. VIII, S. 145).
Noch ist Bezug zu nehmen auf die vielbesprochene Urkunde vom 14. Novbr. 1221 (U.=B. I, S. 261 und Codex Pomeran. dipl. I, S. 310), durch welche zwischen dem Fürsten von Rügen und dem Bischof von Schwerin die Zehntpflicht von Deutschen und Wenden im Lande Tribsees und die fürstlichen Antheile am Zehnten regulirt werden; es wird dabei unterschieden zwischen den Slaven, welche den Deutschen ihre Aecker abgetreten haben und weiter zurückgewichen sind, und denjenigen, welche adhuc cum Teuthonicis resident.
Das jus Teuthonicale, welches für die deutschen Colonen galt und in welches die Slaven durch Verleihung eintraten, äußerte sich nun hauptsächlich in den nachstehenden Beziehungen:
1. in der Rechtssprechung nach deutschem Rechte und deutschem Gerichts=Verfahren durch den landesherrlichen Vogt in dem öffentlichen Landding; von der Verpflichtung, im Landding (commune terrae placitum) zu erscheinen, werden die Bauern in den geistlichen und ritterschaftlichen Besitzungen im weitesten Umfang befreit, durch Uebertragung der Gerichtsbarkeit auf die Grundherren; die niedere Gerichts=


|
Seite 70 |




|
barkeit gehört zum jus vasallicum; die höhere, das jus manus et colli, ist Gegenstand zahlreicher Special=Verleihungen. (U.=B. II, S. 553, 554, Privileg der Mannen und Geistlichen des Landes Gnoien und der Herrschaft Güstrow.) Das deutsche Compositionensystem gestaltete die Strafgerichtsbarkeit zu einer ergiebigen Einnahmequelle.
2. Hiermit im Zusammenhang steht, daß die bäuerlichen Besitzer alle unmittelbare Berührung mit der öffentlichen Gewalt verloren und Hintersassen (subditi) ihrer Grundherren wurden. Von der Grundherrschaft hat der Colon sein Besitzrecht abzuleiten, er untersteht ihrer Gerichtsbarkeit; sie bewilligt für ihn die außerordentliche Bede, welche in besonderen Fällen - zum Abtrag fürstlicher Schulden, zur Kehrung von Landesnoth, zur Aussteuer fürstlicher Töchter, endlich bei Ertheilung der Ritterwürde an einen fürstlichen Sohn - vom Landesherrn gefordert wird und ohne Bewilligung nicht erhoben werden darf. Zur Landes=Vertheidigung müssen sie sich allemal zur Verfügung stellen, wenn sie dazu aufgeboten werden, von sonstigen fürstlichen Diensten, welche auch nach der nova plantatio den bäuerlichen Besitzern noch obliegen, insbesondere von Burg= und Brückendienst, können sie durch ein besonderes Privileg entbunden werden.
3. Ihre Leistungen gegen den Grundherrn bestehen in einem festen Zins (census) und in gemessenen Diensten, wenn solche besonders vorbehalten waren, was nicht immer der Fall war. Der census wurde meistens in dem dreifachen Korn - Roggen, Gerste, Hafer - entrichtet; das Bestreben der Grundherrschaften war auf Umwandlung in Geld, wenigstens zu einem Theile, gerichtet, um die Versilberung und das Verfahren des Korns von sich abzuwälzen. Die Verpflichtung zu Diensten nimmt anfänglich, wie wir schon bei Neukloster gesehen haben, eine untergeordnete Stelle ein; sie war Gegenstand des Verkaufes und der Ablösung. So werden die dem v. Hagen zustehenden Dienste in Küssow von 4 mansi im Jahre 1322 mit Vorbehalt des Rückkaufes für 20 Mark an das St. Johannis=Kloster zu Lübeck verkauft, was nach damaligem Zinsfuß einem Werthbetrage von 8 Schillingen pro Jahr und Hufe entspricht (U.=B. VIII., S. 322). - Nebenabgaben werden entrichtet pro porcis, für Schweinemast in den Gutswaldungen, und pro dorland, terra arida, nicht umgebrochenes Land, was gewöhnlich Käthnern und sonstigen außerhalb der Hufen angesetzten Leuten zur Ausnutzung überlassen wird.
4. Ihr Besitzrecht an den Hufen kann nur als ein kündbares Nutzungsrecht, mit Zins- und Dienstpflicht, bezeichnet werden, so


|
Seite 71 |




|
lange sie nicht von der Grundherrschaft die Erbzinsgerechtigkeit, die hereditas, in irgend einer Form erworben haben. Wir beziehen uns dieserhalb auf das oben wegen Verleihung erblicher und dinglicher Rechte schon Beigebrachte, und treten daher insoweit in Widerspruch zu den früheren Darstellungen, insbesondere bei Hegel Geschichte der Meklenb. Landstände (1856), S. 45, und Balck, Domaniale Verhältnisse (1864), S. 106, wonach als ursprüngliches Besitz=Verhältniß der Bauern an ihren Hufen die erbliche Leihe angenommen wurde. Nachdem das meklenburgische Urkundenbuch und die sonstigen neueren Publicationen von Urkunden=Material einen tieferen Einblick in die bezüglichen Verhältnisse gestattet haben, ist schon von Balck, Finanz=Verhältnisse u. s. w. (1877), Band I, S. 82 bis 90 das Richtige zur Darstellung gebracht. Es ist eben in Meklenburg aus verschiedenen (theilweise schon angedeuteten) Gründen nicht zu der Entwickelung gekommen, welche andere umliegende Länder, namentlich diejenigen, aus welchen die deutsche Colonisation der Ostseeprovinzen ihren Ursprung genommen, aufweisen, nämlich zu einer Fortbildung und Befestigung der Erblichkeits=Verhältnisse, für welche das Mittelalter in weitem Umfange die Anfänge geschaffen hatte; kein gesetzgeberischer Act nach dieser Richtung ist in Meklenburg bis zu den Reversalen von 1621 sub XVI erfolgt. Durch diese wurde die dem Landesrecht entsprechende Regel der Kündbarkeit nulla vel immemorialis temporis detentione obstante aufrecht erhalten und eingeschärft, und nur der Beweis einer Erbzinsgerechtigkeit, eines jus emphyteuticum und dergleichen dem Einzelnen freigelassen.
Es ist schon von Balck a. a. O. S. 90 mit Recht bemerkt, daß es zur Zeit der Reversalen wohl nur wenigen Bauern gelungen war, aus dem Elend der vergangenen Jahrhunderte ihre Besitzes=Urkunden zu retten.
5. Auch die Anfänge einer Gemeinde= Verfassung sind durch die gemeinschaftliche Nutzung von Wiese, Weide und Wald und durch die Einsetzung des Schulzenamtes gegeben; es sind jedoch diese Anfänge nicht zu einer nachhaltigen Entwickelung gelangt. Dem Schulzen stand überall eine niedere Gerichtsbarkeit zu, welche er ohne Zuziehung von Dorfgenossen nicht ausüben konnte; nach dem Privileg für die Mannen im Lande Gnoien und in der Herrschaft Güstrow vom Jahre 1276 (U.=B. II, S. 553) soll der Hintersasse der Ritterschaft und der Geistlichkeit allemal zuächst coram domino suo, sub quo residens est, vel suo villico, belangt werden; wir sehen aber, daß die Schulzen sehr bald in die Stellung herrschaftlicher Beamten, welche nur die Erhebung des


|
Seite 72 |




|
Zinses und die Leistung der Dienste zu besorgen haben, zurücktreten. Andererseits findet sich seine Spur der dem bäuerlichen Familienrechte angehörigen Rechtsinstitute eines Anerben= und Altentheils=Rechtes, der Abfindung u. s. w., durch welche die Lebensfähigkeit des Bauernstandes bedingt wird, und welche bei den Ratzeburger Bauerschaften zur vollen Entwickelung gelangt sind.
So sehen wir denn gegen Ende des Mittelalters mit dem Eintritt der entsprechenden großen Veränderungen in den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen die Bauerschaften in dem übrigen Meklenburg mehr und mehr in die Stellung gedrängt, welche die Glosse zum Sachsenspiegel III, 45 (bei Kraut, Grundriß, 5. Ausgabe, S. 452, unter 28) den Meiern und Hofleuten anweist, welchen man ein Gut austhut; sie sind "auf dem Gute gleich als Gäste, kommen darauf und ziehen wieder davon, nach der Erbherren Willen und Geheiß." Zwar bestand neben den zahlreichen Fällen eines erblichen Besitzrechtes an den Hufen eine factische Erblichkeit im weitesten Umfange; denn der zinspflichtige Colon war regelmäßig Eigenthümer der Hofwehr und hatte Eigenthumsrecht an den von ihm hergerichteten Gebäuden; er mußte also in Kündigungsfällen entschädigt werden, es mußte eine neue Hofwehr beschafft und ein leistungsfähiger neuer Colon gewonnen werden. Aber diese Erschwerungen hinderten die Kündigung nicht, wenn es sich darum handelte, die herrschaftliche curia durch Zulegung von bäuerlichen mansi zu vergrößern und wirthschaftlich selbständig zu machen.
Wir treten damit in die Periode der Bildung des Großgrundbesitzes, zu welchem der bäuerliche Hufenbesitz das Material hergeben mußte. Mit diesem Momente trat auch eine gänzliche Veränderung in der Stellung der übrigbleibenden bäuerlichen Besitzer ein; an die Stelle der Zinspflicht trat die Dienst= und Frohnpflicht zum herrschaftlichen Hofe, wenigstens zum größeren und überwiegenden Theile. Durch die Veränderung der Kriegs =Verfassung und des Hofdienstes fanden die Lehnsleute sich darauf angewiesen, festen Wohnsitz auf ihren Gütern zu nehmen und ökonomischer Beschäftigung sich zu widmen; zu Kriegsdiensten wurden sie im 16. Jahrhundert nur selten, und hernach bald überhaupt nicht mehr aufgeboten, und im Rathe der Fürsten nahmen die Rechtsgelehrten ihren Platz ein. Es wurde jetzt auf Grundlage des Kündigungsrechtes Alles den veränderten Verhältnissen entsprechend eingerichtet; mehrere Hufen, oft 3 bis 4, wurden in eine bäuerliche Hand gelegt, um die Leistungsfähigkeit für die Hofdienste herzustellen, und daneben einen, wenn auch abgeminderten census,


|
Seite 73 |




|
zu conserviren. 1 ) Im Verlaufe dieses Processes wird allmählich etwa die Hälfte der Bauerhufen dem Hofacker beigelegt; das ist der Zustand, welchem wir zur Zeit der Landes=Vermessung auf einer großen Zahl von ritterschaftlichen Gütern begegnen.
In diese Entwickelung fällt nun ein anderes Moment, welches die letzten Reste der Selbständigkeit des Bauernstandes beseitigen mußte: die regelmäßig wiederkehrenden und steigenden steuerlichen Anforderungen der landesherrlichen und der Reichsstaatsgewalt. Ritterschaft, Klöster und Städte konnten sich in den meisten Fällen einer Bewilligung, wie sie der Landesherr forderte, nicht entziehen, da für die Reichserfordernisse und für die bereits oben bezeichneten Fälle das jus collectandi der Landesherren mehr und mehr zur Geltung kam: aber der modus der Aufbringung war durch die inzwischen eingetretenen Veränderungen in eine unheilbare Verwirrung gerathen. Die Ritterschaft machte geltend, daß der modus der alten Landbede, also die Realsteuer nach Bauerhufen und städtischen Erben, für alle Theile der allein verfassungsmäßige und gesetzliche sei; sie bezog sich auf ihre alten Privilegien, wonach für den Fall einer allgemeinen Landbede die sub cultura dominorum befindlichen Hufen steuerfrei sein sollten: sie hielt im Principe fest an dem Grundsatze der Abwälzung der Steuerlast auf die bäuerlichen Hintersassen, für welche sie die Steuer bewilligte. Aber es fehlte an einer gesetzlichen Bestimmung über das zulässige Maß der Umwandlung von Bauerhufen in Hofhufen, wie solche in andern Ländern getroffen war; der Landesherr wollte das Privileg nur für die Zahl der ursprünglich zum Rittersitz gehörigen Hufen zugestehen, welche in den meisten Fällen sich jeder sicheren Ermittelung entzog. Andererseits gerieth die Ritterschaft in Conflict mit den Städten, welche mit ihrem Erbenmodus der wachsenden Steuerlast nicht mehr genügen konnten und sich über Prägravation durch die für ritterschaftliche Hofhufen beanspruchte Steuerfreiheit zu beklagen hatten. Die von Fall zu Fall von den Städten bewilligten Consumtionssteuern riefen den Widerspruch der Ritterschaft hervor, da die Gutserzeugnisse indirect hierdurch mit ergriffen wurden. Und wenn auch von der Ritterschaft nicht bestritten werden konnte, daß von ihr ein besonderer steuerlicher Zutrag wegen der wegfallenden Kriegsdienste zu leisten sei, so hatte doch eine Feststellung der Ritterpferdgelder um so größere Schwierigkeiten, als einer beträchtlichen Zahl von ritterschaftlichen Gütern die Verpflichtung zum ser-


|
Seite 74 |




|
vitium dextrarii durch besonderen Vertrag vom Landesherrn erlassen war.
Die Darstellung dieser Streitigkeiten und der dadurch verursachten Wirren fällt außerhalb des Bereiches unserer Aufgabe und gehört der neueren Geschichte an. Zwei Jahrhunderte hindurch war man unausgesetzt bemüht, einen neuen modus für die Anlegung von Realsteuern, im Anschluß an die alte bäuerliche Hufen=Verfassung, welche in Trümmer zerfallen war, zu finden. Alle diese Versuche mißglückten. Es mag an dieser Stelle als besonders bezeichnend nur noch hervorgehoben werden, daß man schließlich dahin gelangte, auf das der alten wendischen Hakenhufe zum Grunde liegende Princip zurückzugreifen und die Realsteuern nach der Zahl der bespannten Haken, gleich gut ob Hofhaken oder Bauerhaken, anzulegen. Nach solchem Hakenmodus wurden im Stargardschen Kreise alle Landes= und Kreis=Anlagen, sowie der Zutrag zur ordentlichen Contribution bis zur Publication des neuen ritterschaftlichen Hufen=Catasters erhoben.
Ihren Abschluß fand diese Periode erst, nachdem man sich über völlig neue Grundlagen für das Steuerwesen geeinigt hatte; für die Ritterschaft im Wege einer allgemeinen Landes=Vermessung und Bonitirung, für die Städte durch Einführung einer Consumtions= und Handelssteuer, neben welcher der alte städtische Erbenmodus in eine untergeordnete Stellung zurücktrat.
Um das vorstehend gezeichnete Bild zum Abschluß zu bringen, ist nur noch hinzuzufügen, daß die Theorie von der Leibeigenschaft und der glebae adscriptio der Gutsunterthanen im engsten Zusammenhange stand mit der Bildung des Großgrundbesitzes in der Ritterschaft, der Pachthöfe in den landesherrlichen Domainen. Der Bauerstand war durch die Umwandlung der Zinspflicht in eine Dienst= und Frohnpflicht mehr und mehr in eine persönlich abhängige Stellung gerathen; er verarmte, und der Grundherr wurde Eigenthümer der Hofwehr und der Gebäude. Damit war das Band, welches den Bauern bisher an die Scholle gefesselt hatte, gelockert; es galt jetzt durch eine künstliche Interpretation seiner Eigenschaft als Gutsunterthan, subditus, ihn festzuhalten, und der Auswanderung in die Städte einen Riegel vorzuschieben. Die landesherrlichen Beamten und Pfandbesitzer in den Domainen hatten hierbei das gleiche Interesse wie die Ritterschaft. So kam die alte Hörigkeit, welche ein großer Theil der deutschen Colonen in der Heimath zurückgelassen hatte, wieder in neuer Form zur Geltung; der deutschen Colonisation fehlte von Anfang an der innere Zusammenhang und die Gemeindeorganisation, um sich dieser durch die Zeitverhältnisse


|
Seite 75 |




|
herbeigeführten Umwandlung mit Erfolg widersetzen zu können. Wir haben weiter noch hinzuzufügen, daß durch die Verwüstungen des 30jährigen Krieges, welche in einzelnen Aemtern nicht den zehnten Theil des Bauerstandes übrig ließen 1 ), der historische Zusammenhang zwischen den neu entstehenden Verhältnissen und der alten bäuerlichen Hufenverfassung vollends zerrissen wurde, bis auf wenige Trümmerreste, welche sich bis in die Neuzeit hinein gerettet haben und Zeugniß von den früheren Zuständen ablegen.
Es bleibt zum Abschluß unserer Arbeit noch übrig, die eben gedachten Beziehungen, soweit sie in der Gegenwart noch erkennbar, vorzuführen und daran einige Bemerkungen über wirthschaftliche und Größenverhältnisse der alten Hufen, sowie über die Feldmaße, nach welchen man rechnete, zu knüpfen.
Als Reste der alten bäuerlichen Hufenverfassung sind zu bezeichnen:
1. die Vorschriften der Polizeiordnung vom 2. luli 1572 im Titel "von Jagen", betreffend die Ausübung der Jagd durch mehrere Mitbesitzer, das sogenannte Vier=Hufen=Recht;
2. die Kornabgabe, welche von einer Anzahl von ritterschaftlichen Gütern in Meklenburg alljährlich an den landesherrlichen Kornboden als sogenanntes Pacht= oder Hundekorn zu erlegen ist;
3. die Meßkornabgabe der Meklenb. Kirchenordnung fol. 141 an die Pfarren von Hufen und Katen;
4. der den Pfarren zu deren Dotation nach Hufen beigelegte Landbesitz;
5. die Antheile, welche einzelne Hauptgüter oder die Großherzogliche Kammer in ritterschaftlichen Gütern besitzen.
Wir bemerken hierzu:
ad 1. Die Polizeiordnung von 1572 enthält eine Reihe von werthvollen Zeugnissen über den früheren Rechtszustand. Aus dem Titel "von Jagen" entnehmen wir zunächst, daß vor den Reversalen von 1621, Art. XIX, ein Jagdfolgerecht in Meklenburg noch nicht zur Anerkennung gelangt war, und daß zur Zeit der Polizeiordnung noch galt, was die Entscheidung des Bischofs Rudolf von Schwerin - zur Schlichtung verschiedener Streitigkeiten zwischen den Grafen von Schwerin und von Danneberg im Jahre 1262 ergangen (U.=B. II, S. 203) - bezeugt: item de venatione taliter ordinamus, quod nullus prosequetur feram iaventam


|
Seite 76 |




|
in terra propria ultra disterminationem suam in terminis alterius.
Erwägt man, daß die ältesten Spuren des Jagdfolgerechtes bis in die Zeit der Volksrechte zurückreichen (Entscheidungen des Ober =Appell.=Gerichtes zu Rostock, Band VI, S. 114), und daß der Sachsenspiegel (II, Art. 61, §. 4) dasselbe schon in weiterem Umfange (den Bannforsten gegenüber) anerkennt ats die beinahe 400 Jahre späteren Reversalen, so dürfen wir hierin ein Zeugniß für die Abgeschlossenheit unserer Rechtsbildung im Mittelalter und für den geringen Einfluß der deutschrechtlichen Anschauungen auf unser Landrecht erblicken. Sebst für das Land Stargard, welches im 13. Jahrhundert die colonisirende Thätigkeit der Markgrafen von Brandenburg im reichen Maße erfahren hatte, gilt ein Gleiches. Mit Recht bemerkt Böhlau in seinem Landrecht I, S. 259: "Mit der territorialen Entwickelung des märkischen - auf dem Sachsenspiegel beruhenden - Landrechtes hat das meklenburgische Land Stargard keinen Zusammenhang."
Von größerem Interesse für den Gegenstand unserer Untersuchung ist die auf das Vierhufenrecht bezügliche Vorschrift der Polizeiordnung in demselben Titel.
Wenn auf demselben Gute sich verschiedene domini befinden, so wird wegen der Jagdberechtigung unterschieden, ob mehrere desselben Geschlechtes ein Dorf besitzen, oder verschiedene Geschlechter fast gleiche Antheile haben, oder endlich, ob bei einer Verschiedenheit der besitzenden Geschlechter ein Unterschied in der Art hervortritt, daß einzelne nur einen oder zwei Bauern im Dorfe und weniger als 4 Hufen auf der Feldmark besitzen; in diesem letzteren Falle findet Ausschluß von der Jagdberechtigung, in den beiden ersteren Fällen gemeinschaftliche Ausübung - die Koppeljagd - statt.
Das Bild der Besitzverhältnisse an Grund und Boden, welches aus diesen Bestimmungen entgegentritt, ist bezeichnend für jene Zeit. Man kann wohl sagen, daß, mit Ausnahme des landesherrlichen, des geistlichen und des städtischen Besitzes, die Zersplitterung der Besitzrechte an Grund und Boden in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters und zu Anfang der Neuzeit die Regel bildete. Es werden unausgesetzt aus demselben Gutscomplexe einzelne Bauerhöfe mit allen herrschaftlichen Rechten verkauft, verpfändet, durch Erbtheilung erworben; es sitzen mehrere ritterschaftliche Familien auf verschiedenen Höfen in demselben Gute; jeder Besitzer hat Hufen auf der Feldmark und Bauern im Dorfe; die Zahl der in propria cultura dominorum befindlichen mansi ist noch eine ge=


|
Seite 77 |




|
ringe, 4 bis 6, so viel als zur Aufrechterhaltung eines eigenen Haushaltes erforderlich schien; auch giebt es viele domini ohne herrschaftliche curia; zu diesen gehören vielfach städtische Bürger und geistliche Herren und Stiftungen. Das Creditbedürfniß wurde durch Verkauf oder antichretische Verpfändung einzelner Bauerhufen, oder auch der davon zu erlegenden Abgaben an precaria und census befriedigt; auch die bäuerlichen Dienste wurden verkauft und verpfändet. Zweierlei Momente waren es nun, welche ein Auseinanderfallen des Gutes in einzelne Parcelen verhinderten. Zunächst richtete sich der Anspruch des Lehnsherrn auf die gebührenden Lehnsdienste, insbesondere die Stellung des Lehnspferdes, dextrarius, gegen das ganze Gut; bei Theilungen und Abverkäufen mußte dieser Punkt besonders regulirt werden. Sodann - und dies war die Hauptsache - mußte Wald, Wiese, Weide, Torfstich, überhaupt Alles, was außerhalb des Hufenschlages der Dorfschaft lag, gemeinschaftlich bleiben, die gemeinschaftliche Nutzung nach Maßgabe der Hufenzahl wird allemal reservirt und zugestanden (U.=B. XIII, S. 56); also ein eigenthümliches Gemisch von condominium pro diviso und pro indiviso.
Die Beantwortung der Frage, wie in vorkommenden Fällen noch heute die Vorschrift der Polizeiordnung zur Anwendung zu bringen sein möchte, liegt außerhalb unserer Aufgabe; über die historischen Gesichtspunkte, welche sich hierbei geltend machen, glauben wir jedoch Einiges bemerken zu dürfen.
Für die heutige Anwendung tritt die Schwierigkeit entgegen, daß die alten Bauerhufen nirgends mehr vorhanden sind; sie sind mit den wirthschaftlichen Veränderungen, welche mit dem Aufkommen des Großgrundbesitzes Hand in Hand gingen, zu Grunde gegangen, und ist nur von einer geringen Zahl von Gütern der frühere Bestand an bäuerlichen Hufen sicher bekannt. Aber auch wenn diese Zahl bekannt ist, so ist damit noch nichts über Größe und Flächeninhalt entschieden, weil die Hufe nur das Ackerland befaßte, und das Verhältniß zwischen Acker, Wiese, Wald im Laufe der Jahrhunderte hier und da große Veränderungen erlitten hat. Es fragt sich daher, ob für die alten Bauerhufen ein durchschnittliches Größenmaß anzunehmen sei, und ob hiernach Bezeichnungen wie: una quarta mansi usualis - ein Viertel Landes einer gewöhnlichen Hufe (Lisch, Urkunden des Geschlechtes von Oertzen, II, S. 158 und 162, Ao. 1455) zu deuten seien. Wir werden hierauf weiterhin zurückkommen.
In dem von einer deutschen Juristenfacultät unter dem 11. Febr. 1878 in einer meklenburgischen Proceßsache wegen Tur=


|
Seite 78 |




|
bation der Jagdgerechtigkeit abgegebenen Erkenntniß heißt es, unter Bezugnahme auf die Miscell. histor. jurid. Mecklenb. IV, 1749, pag. 86: "Daß die 4 Hufen (der Polizeiordnung von 1572) nicht als Haken= oder Bauerhufen, sondern als Ritter=Hof= oder Landhufen im Sinne der damaligen Bezeichnungen zu nehmen seien, war längst nicht mehr zweifelhaft." Die in den Miscellanea 1. c. abgedruckte Proceßschrift will den Nachweis führen, daß derjenige, welcher nicht 4 Landhufen, die Hufe zu 100 Scheffeln gerechnet, auf einer Feldmark besitzet, keine separirte Schafhütung und Hürdenschlag halten könne.
Ein Blick in jene Proceßschrift und in die dort angezogene Anlage A sub c ergiebt die völlige Werthlosigkeit derselben für die meklenburgischen Verhältnisse, wie solche zur Zeit der Polizeiordnung noch bestanden, und als Grundlage für eine gesetzliche Bestimmung in Bezug genommen werden durften; die sogenannte Landhufe zu 100 Scheffeln 1 ) gehört einer viel späteren Zeit willkürlicher administrativer Regulirungen an und hat nur für das Domanium vorübergehende Geltung gehabt. Sodann ergiebt die angezogene Anlage A sub c (Miscell. 1. c. pag. 93), daß im Jahre 1681 zu Geifswald erkannt worden, daß Kläger wohl berechtigt auf seinen - 8 wüsten Bauerhufen eine Schäferei anzulegen.
Hieraus wird gefolgert, daß in Meklenburg "8 Bauerhufen, so 4 Landhufen ausmachen", gleichfalls erfordert werden - weil die pommersche Landesgewohnheit mit der Meklenburgischen fast einerlei sei." - Es ist hierbei übersehen, daß in Pommern durch einen Act der Gesetzgebung, zur Beseitigung von Ungewißheiten bei den Steueranlagen, im Jahre 1616 bestimmt wurde, daß 15 Morgen für eine Hakenhufe, 30 Morgen für eine Landhufe, 60 Morgen für eine Hägerhufe gerechnet werden sollen (von Bilow, Abgabenverhältnisse in Pommern, 1843, S. 122), während für die Kurmark Brandenburg um die Mitte des vorigen Jahrhunderts festgesetzt wurde, daß in allen königlichen Aemtern und Domainen nur einerlei Art von Hufengröße zu 30 Morgen à 180 □Ruthen Magdeburgisch (gegen den pommerschen Morgen à 300 □Ruthen, der 16füßigen Ruthe!) angenommen werden solle. (Scholz, Provinzialrecht der Kurmark Brandenburg, 1854, Band I, S. 52. 53). Es dürfte hieraus zur Genüge erhellen, daß von den oben ge=


|
Seite 79 |




|
dachten Bestimmungen des pommerschen oder des märkischen Rechtes für Meklenburg kein Gebrauch zu machen; ein Unterschied zwischen Hakenhufen und Landhufen tritt bei uns seit der deutschen Besiedelung nirgends hervor; eine Veränderung in den Größenverhältnissen trat nicht ein, wenn Bauerhufen eingezogen wurden zur cultara propria dominorum; die Unterscheidung zwischen Hofhufen und Bauerhufen ist dader insoweit als eine fehlsame zu bezeichnen. Endlich spricht die Polizeiordnung nur von Bauern im Dorfe und von Hufen auf der Feldmark.
ad 2. Es ist schon oben bemerkt, daß ein Theil der ordentlichen Bede in Korn zu erlegen war, und daß diese Kornabgabe im Laufe des Mittelalters, sowohl in Pommern als in Meklenburg, den Namen Hundekorn, annona canina, frumentum canum, angenommen hat. 1 ) Die Untersuchung darüber, wie diese Bezeichnung, welche bei uns später wieder durch den Namen Pachtkorn verdrängt wurde, entstanden sei, darf als völlig geschlossen noch nicht angesehen werden; wir verweisen dieserhalb auf die in Separat=Abdruck erschienenen Gutachten des weiland Staatsarchivars Dr. Klempin in Stettin und des Geheimen Archivraths Dr. Wigger, sowie auf die Einleitung und den Anhang vom Appellationsgerichts=Präsidenten Dr. Kühne, 1879. Uns interessirt nur, daß diese Abgabe sich nach Hufenzahl bestimmte, und daß gewöhnlich von jeder Hufe 6 Scheffel des dreifachen Korns - 2 Roggen, 2 Gerste, 2 Hafer - zu erlegen waren. (U.=B. X, S. 104, Ao. 1347; Schröder, Pap. Meklenburg II, S. 1363, Ao. 1357.)
Dies ist der Betrag der precaria major, welche zu Martini fällig war; daneben wurde in früherer Zeit noch eine precaria minor, in dem halben Betrage der ersteren, zu Walpurgis erhoben. Im Jahre 1303 schenkt Fürst Heinrich von Meklenburg der Johannitercomturei zu Nemerow 8 Hufen zu Staven, oder vielmehr die libertas und proprietas dieser Hufen - was mit der Aufgabe der fürstlichen Rechte gleichbedeutend war -, insbesondere cum precaria majori et minori. (U.=B. V, S. 115.) Die erstere beträgt nach der Urkunde 24 solidi slav. und 6 Scheffel des dreifachen Korns, die letztere die Hälfte, also eine Gesammtabgabe von 2 Mark 4 Solidi und 9 Scheffeln Korn von jeder Hufe. Wenige Jahre später werden die redditus in proventu seu pachto von 8 mansi in Staven, pro Hufe ein brandenburgisch talentum betragend, verkauft. Da für jene Zeit (U. =B. VII, S. 29, Ao. 1322)


|
Seite 80 |




|
1 Schilling brandenburgisch gleich gerechnet wird mit 28 slav. denar., so blieben neben der precaria für Pachtnutzung noch 46 2/3 solid. slav., nahezu 3 Mark; auch hier erreichte die ordentliche Bede in ihrem ursprünglichen Betrage die volle Hälfte des Pachtwerthes.
Bei den ritterschaftlichen Gütern, welche noch heute mit dieser Abgabe belastet sind, werden wir, wenn der Betrag der precaria major für die spätere Zeit zum Grunde gelegt wird, aus der Höhe der Abgabe auf die Zahl der Hufen, welche das Gut enthielt, schließen können, mit Sicherheit jedoch nur dann, wenn das Ergebniß anderweitig durch die Meßkornabgabe und durch den nachweisbaren Bestand des Gutes an Ackerfläche controlirt werden lann.
Das Gut Sadelkow, ritterschaftl. Amts Stargard, hat alljährlich an den landesherrlichen Kornboden zu Stargard zu liefern 6 Drömt 6 Scheffel Roggen, ebenso viel Gerste und ebenso viel Hafer, im Ganzen 234 Scheffel des dreifachen Korns, jetzt Berliner Maße. Außerdem muß, laut des alten bis auf das Jahr 1691 zurückreichenden Qittungsbuches, eine Geldabgabe von 9 fl. 18 ß., also 234 Schillinge, ebenso viel Schillinge als Scheffel Korn, an das Amt Stargard gezahlt werden. Die Kornlieferung führt auf 39 Hufen; hiermit stimmt auch die Meßkornabgabe an die Pfarre zu Rühlow überein. Wir haben es hier also anscheinend mit völlig normalen Verhältnissen zu thun, und werden weiterhin sehen, daß hiermit auch der Ackerbestand zur Zeit der Directorial=Vermessung übereinstimmt. Noch im Jahre 1408 konnten die Herzoge Johann und Ulrich von Meklenburg einer Vicarei zu Friedland überweisen (Boll, Geschichte des Landes Stargard, II, S. 351): "sexaginta marcarum redditus in villa Zadelcow de precariis nostris in pecuniis et frumentis ibidem - antequam nos seu aliquis nostrorum nomine quicquam percipiet de nostris precariis ville prenarrate."
Die Kornabgabe von Leppin - 6 Drömt Roggen, ebenso viel Gerste und Hafer, führt auf 36 Hufen; als Meßkorn an die Pfarre werden 38 1/2 Scheffel Roggen entrichtet.
Die Kornabgabe von Gantzkow beträgt 3 Drömt 6 Scheffel Roggen, ebenso viel Gerste und Hafer, was auf 21 noch bedepflichtige Hufen schließen läßt. Die Meßkornabgabe von Gantzkow an die Pfarre zu Brunn beträgt dagegen 42 Scheffel Roggen. - Die an das Großh. Amt Stargard von Gantzkow zu zahlende Orbede beträgt 2 Thlr. 30 ß. - jährlich, also, wie bei Sadelkow, ebenso viel Schillinge als Scheffel Korn.


|
Seite 81 |




|
Vom Gute Möllenbeck werden alljährlich an den Kornboden zu Stargard geliefert 15 3/4 Scheffel Roggen, ebenso viel Gerste und Hafer; außerdem 47 Schillinge, der Scheffelzahl entsprechend. Hier ist also die Abgabe nur noch für 7 7/8 Hufen von Bestand geblieben.
Wir haben nur noch hinzuzufügen, daß die Kornbede erlegt wird von dem auf der Hufe gewachsenen Korn. Die annona canina wird in deutschen Urkunden bezeichnet als die "Jahrfrucht von den Hufen" (Schroeder, Papistisches Meklenb. II, S. 1363, 1366); der Pflichtige konnte nicht angehalten werden, wenn ohne sein Verschulden mangelhaftes Korn auf der Hufe gewachsen war, besseres Korn zu kaufen. Ob hierin durch den Uebergang der bäuerlichen Reallasten auf die Gutsherrschaften sich etwas geändert habe, müssen wir dahin gestellt sein lassen; zu vergleichen ist Band VI, S. 293, der Entscheidungen des Ober=Appellationsgerichts zu Rostock.
ad 3. Die Meßkornabgabe tritt uns schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts als eine regelmäßige Leistung der coloni parochiales entgegen; sie war neben dem Zehnten, welcher dem Bischof gebührte, zu erlegen; sie wird als ecclesiastica annona ad sustentationem sacerdotis bezeichnet und ergänzt die Ausstattung mit Pfarrland.
Im Jahre 1305 (U.=B. V, S. 217) wird die neu errichtete Pfarre zu Schlakendorf bei Neukalen mit 2 Pfarrhufen dotirt; die villa Karniz wird ihrem Sprengel beigelegt; von jeder Hufe sollen 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Hafer ad sustentationem sacerdotis, 1 Scheffel Hafer außerdem ad sustentationem custodis gegeben werden.
Im Jahre 1309 (U.=B. V, S. 450) wird die Capella in Brodersdorf, bisher Filial von Rökwitz, zu einer Pfarrkirche erhoben, mit 2 Pfarrhufen dotirt; ihrem Sprengel werden die villae Dargbent und Bralyn beigelegt. Pro ecclesiastica annona soll jede Hufe in Brodersdorf, sicut antea facere consueverunt, 1 Scheffel Roggen geben, die beiden eingepfarrten Ortschaften 1/2 Scheffel Roggen von jeder Hufe.
Der neu errichteten Pfarre in Kulrade werden die villae Buckhorst und Emekenhagen im Jahre 1310 (U.=B. V, S. 506) beigelegt, und hierbei wird bestimmt, daß die coloni parochiales dieser Dörfer, soweit sie bisher nur 1/2 Scheffel Korn gegeben, in Zukunft einen ganzen Scheffel, und soweit sie bisher nur 1 denarium praebendalem gegeben, in Zukunft 2 Denare geben sollen.


|
Seite 82 |




|
Es konnte daher die meklenburgische Kirchenordnung fol. 141 bestimmen, daß das "gebührliche Meßkorn, als von der Hufen einen Scheffel und von dem Katen einen halben Scheffel", überall gegeben werden solle.
Die Geltendmachung dieses Anspruches gegen die zum Hoffelde eingezogenen Hufen stieß jedoch vielfach auf Widerspruch. Ein Gleiches war in Pommern der Fall; auch dort wurde, meist mit Erfolg, behauptet, daß das Meßkorn "nur an den contribuablen, aber nicht an den Ritterhufen hafte." (Padberg, die ländliche Verfassung der Provinz Pommern, 1861, S. 223.) Wir können daher aus der Meßkornabgabe einen sicheren Rückschluß auf die Zahl der alten Bauerhufen eines Gutes nicht machen, auch wenn davon abgesehen wird, daß auch die Katen derselben unterworfen waren.
ad 4. Die von Herzog Heinrich dem Löwen im Jahre 1158 in der Stiftungsurkunde für das Bisthum Ratzeburg getroffene Anordnung: postquam autem Slavis ejectis terra decimalis facta fuerit, decima tota vacabit episcopo, qui cum domino fundi de dotibus aget ecclesiarum parochialium, scilicet ut - quatuor mansis dotentur cum censu et decima" - ist wegen der Parochial=Kirchen nicht in dem vorgeschriebenen Umfang zur Ausführung gekommen. Im Jahre 1319 wurde den sämmtlichen zur Diöcese Ratzeburg gehörigen Pfarrern und Vicarien aufgegeben, eine Taxe ihrer Pfarreinkünfte aufzustellen; aus den (im U.=B. VI, S. 453 flgd. abgedruckten) Taxen sehen wir, daß die Mehrzahl der Pfarren nur 2 bis 3 Hufen besaß und daneben auf anderweitige, mehr oder weniger feststehende Einkünfte angewiesen war. Eine Zusammenstellung der Taxen vom Jahre 1335, mit welcher der Pfarrer Petrus zu Schönberg beauftragt wurde, findet sich U.=B. VIII, S. 540 flgd. abgedruckt. Danach waren abgeschätzt:
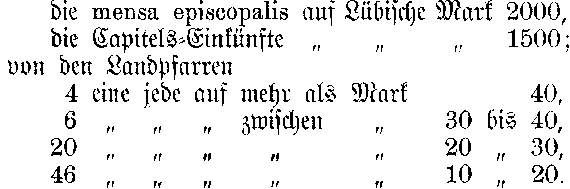
Die Hufen sollen abgeschätzt werden, prout locari possunt aliis cultoribus ad colendum; die freiwilligen Hebungen, oblaciones, secundum quod communiter obveniunt. Es sollte angenommen werden


|
Seite 83 |




|
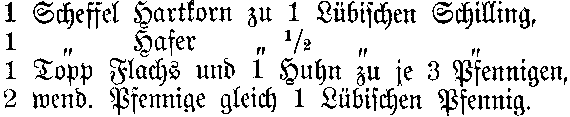
Die Kirchen=Visitations=Protocolle aus dem 16. und 17. Jahrhundert ergeben vielfach einen Besitz der Pfarren von 2 bis 4, oft bis 6 Hufen; bei großen Pfarren sind gewöhnlich Vicarienäcker der dos zugeschlagen. Ein großer Theil dieses Besitzes ist aber durch die Wirren während und nach der Reformation, mehr noch durch die Verwüstungen des 30jährigen Krieges verloren gegangen, oder doch in Streit und Ungewißheit gerathen; die Rubrik der nicht mehr nachweisbaren geistlichen Ländereien, für welche an Kirche und Pfarre seit unvordenklicher Zeit eine bestimmte jährliche Entschädigung von den Gutsherren gezahlt wird, ist in unsern Gutsbeschreibungen (§. 5 sub 2 der revidirten Hypothekenordnung für Landgüter vom 18. October 1848) noch immer ziemlich stark vertreten.
Ein Zeugniß dafür, daß die Pfarrhufen ebenso wie alle Bauerhufen an den gemeinschaftlichen Nutzungen der Dorfgenossen nach Hufenzahl participirten, findet sich noch im landesgrundgesetzlichen Erbvergleich von 1755, §. 13; es sollen bei den Pfarrhufen für jede 175 Scheffel an saatbarem Lande oder an urbaren Wiesengründen, 125 Scheffel an Außenweide, oder in Rusch und Busch gerechnet werden; mit anderen Worten: es sollen 175 Scheffel Pfarrland wegen der zuständigen Nutzungen an den außerhalb des Hufenschlages der Dorfschaft belegenen Objecten für eine volle Hufe von 300 Scheffeln gerechnet, beziehungsweise zum Abzuge gebracht werden.
ad 5. Die Antheile, welche das eine ritterschaftliche Gut in dem andern, und welche die Großherzogliche Kammer in einzelnen ritterschaftlichen Gütern besitzt, sind in vielen Fällen darauf zurückzuführen, daß einzelne bäuerliche Hufen sich in der Hand benachbarter Gutsbesitzer befanden und wegen eines besonderen Nutzens dieser Verbindung mit dem benachbarten Gute sich der allmählich fortschreitenden Consolidation des Hufenbesitzes in der Hand dessen, welcher die Lehnspflichten zu erfüllen hatte, entzogen haben. Eine wichtige Rolle bei dieser Consolidation spielt in früherer Zeit, als noch die Particularadjudicationen einzelner Gutstheile in täglicher Uebung standen, das Reluitionsrecht, worüber das Nähere bei Tornow, de feudis Meckl. 1708, p. 652, nachgesehen werden kann.


|
Seite 84 |




|
Wir kehren zu der anfänglichen Aufgabe, ein Bild der bäuerlichen Hufen=Verfassung in Meklenburg zur Zeit des Mittelalters zu geben, zurück, und vervollständigen die obige Darstellung durch einige Bemerkungen über wirthschaftliche Verhältnisse, über Größe der Hufen und über Flächenmaße, soweit wir aus den Urkunden Aufschlüsse hierüber entnehmen können.
1. Als Ausgangspunkt für die hierauf bezügliche Untersuchung ist die Frage anzusehen, ob die Hufeneintheilung, wie sie im Beginne der deutschen Besiedelung überall bei uns entgegentritt, als eine aus früherer Zeit überkommene Einrichtung aufzufassen, oder ob neue Auftheilung und Vermessung des dem Ackerbau dienenden Bodens dabei stattgefunden habe. Wir sehen hierbei natürlich ab von den Hägerhufen und Hägerdörfern, über welche schon oben gehandelt ist; die Frage kann nur für die große Masse der Dörfer und Ortschaften, welche schon zur wendischen Zeit bestanden haben, gestellt werden. Wird dieselbe im Sinne der ersteren Alternative beantwortet, so würde sich zunächst in Bezug auf die Zahl der Hufen (mansi) und der wendischen Haken (unci), welche zu einer Ortschaft gehören, eine Uebereinstimmung, also ein unveränderter Uebergang der alten in die neue Einrichtung ergeben müssen; daß sich daneben die Ackerfläche der Hufen durch Heranziehung von bisher unbebauten, zu den Haken gehörigen Flächen vergrößert haben könne, würde mit dieser Annahme vereinbarlich sein. -
Wir neigen zu der Annahme, daß die Zahl der Hufen in den einzelnen Ortschaften als eine von alter Zeit her überkommene anzusehen sei. Zunächst ist außer Zweifel, daß einem wendischen Hufen ein bestimmtes Ackermaß mit Antheil an der gemeinschaftlichen Nutzung von Wald, Wiese, Weide und Wasser entsprach. Im Jahre 1297 verkauft Fürst Witzlav von Rügen an die Unterthanen im Dorfe Patzig das Erbe des Dorfes und das Erbe von 20 1/2 Haken, die zu dem Dorfe liegen. Von jedem Haken sollen die Käufer und ihre rechten Erben jährlich entrichten 24 Schillinge gewöhnlicher Münze, 4 Hühner, 20 Eier, 1 Maß (coretz) Roggen, 1 Maß Hafer; damit sollen sie los und frei sein von aller ringen Rechtigkeit (minori justicia in der lateinischen Uebersetzung) wegen Dienste und gastynge. Diese Pacht soll niemals erhöht werden; die Haken sollen niemals beritten oder gemessen werden (predicti unci nunquam debent amplius equitari vel metiri. (Fabricius, Urkunden des Fürstenthums Rügen III, S. 129.)
Von demselben Fürsten wird im Jahre 1300 die hereditas von 16 1/2 Haken, welche zu den Dörfern Cyrosewitz und Dunecitz gehören, den villarum civibus et eorum heredibus mit allen


|
Seite 85 |




|
Nutzungen, prout habuerant ab antiquo, verkauft, mit der Befugniß zur Veräußerung. Item nupcias liberas habebunt, equos et canes dominorum non tenebunt, a vecturis et procurationibus advocatorum et subadvocatorum erunt liberi et exempti. (Das. S. 616.)
Dem Kloster Hiddensee wird im Jahre 1302 das Eigenthum des Dorfes Lehsten und eines Hakens in Rentzize geschenkt. (Das. S. 124.)
Für 8 Mark gewöhnlicher Münze wurde die hereditas von 2 Haken in Moyselkowe im Jahre 1285 erworben. (Das. S. 54.)
Wir sehen, daß im Fürstenthum Rügen auf die Haken dieselben Verkehrsformen angewandt werden, wie zu gleicher Zeit in Meklenburg auf die Hufen (mansi); die Besitzer der Haken kennzeichnen sich als Wenden, denen das jus Teuthonicum nicht verliehen ist; sie geben geringere Abgaben als die Hufenbesitzer, weil sie einen Theil ihres privaten Besitzes nur als Weide nutzen, und werden bei solcher Nutzung von ihren wendischen Landesherren belassen.
2. Für die Annahme, daß die Zahl der Hufen in den einzelnen Ortschaften eine von Alters her, aus der Zeit vor der deutschen Besiedelung überkommene sei, spricht ferner der Umstand, daß unsere Urkunden von einer neuen Auftheilung oder Vermessung der Aecker nicht die leiseste Spur enthalten. Bei der Nachmessung, welcher zahlreiche Ortschaften im ersten Jahrhundert der deutschen Besiedelung unterworfen werden, handelt es sich zunächst immer um die Ermittelung des numerus mansorum quem habebant (villae) ex antiquo (U.=B. III, S. 308, A.o. 1288); aus den überschießenden Aeckern, de excrescenti residuo et superfluo mensurationis, quod vulgo overslach dicitur, werden neue Hufen und neue Ortschaften gebildet. Im Jahre 1270 (U.=B. II, S. 390) bestätigt der Fürst Nicolaus von Werle der Johanniter=Comturei Mirow die Schenkungen, welche derselben von ihm, seinem Vater und seinen Brüdern zugewendet worden; es sei zwischen dem fürstlichen Vogt und der Comturei questio seu controversia super dicta donatione suborta, quod plures agr[i] seu mans[i] extra donationem predictam fuissent inventi; gegen Zahlung von 100 Mark Silbers verzichtet der Fürst auf das Recht der Nachmessung und bestimmt die Grenzen der Dorfschaften. - Der Corveyer Annalist bei Wigger, Meklenburg. Annalen, S. 145, erzählt, daß die Circipaner nach Corvey eine Abgabe de uniuscujusque - unci cultura, quem nostrates aratrum vocitant, entrichtet hätten;


|
Seite 86 |




|
aratrum ist aber der technische Ausdruck für das zur Hufe (mansus) gehörige Ackerland. (Waitz, Altdeutsche Hufe, 1854, S. 22.)
Der Bischof Albert von Lübeck bestimmt im Jahre 1249 nach Vereinbarung mit den Grafen von Holstein und Stormarn über Zehnten im Lande Oldenburg und Dassow (U.=B. I, S. 587), daß de sex villis Theutonicis, in quibus prius pro decima soluebantur sex modii ordei de aratro, nunc - quatuor modii siliginis de manso quolibet - exsolvantur. 1 ) - Die Königin Margarete von Dänemark schenkt im Jahre 1272 dem Nonnenkloster zum heil. Kreuz in Rostock - Schmarl villam - culturam quatuor continentem aratrorum. (M. U.=B. II, S. 430, vgl. S. 359.)
Aus allem diesem folgt freilich zunächst nur, daß uncus das zu einer slavischen Hufe, aratrum das zu einer deutschen Hufe gehörige Ackerland bedeutete; nirgends finden wir aber einen Größenunterschied angedeutet. Der Unterschied lag in der persönlichen Stellung der Besitzer und in der dadurch bedingten Verschiedenheit der Leistungen an Korn und Geld; der Wende war dem jus commune servitutis unterworfen, so lange er nicht in das deutsche Recht durch Verleihung desselben eingetreten war. (U=B. IV, B, S. 470, servitus.)
Wenn ferner die brandenburgischen Markgrafen wenige Jahre nach dem Erwerbe einer bis dahin wendischen Landschaft, des Landes Stargard, zur Gründung der Städte Neu=Brandenburg, Friedland, Lychen eine Anzahl von mansi bestimmen und überweisen, so wird dabei der Bestand der alten Ortschaften, deren Namen wir zum Theil noch kennen, an wendischen Hufen zum Grunde gelegt sein; an eine voraufgegangene Regulirung der Feldmarken und dabei erfolgte Umwandlung der Hakenhufen in mansi ist doch nicht wohl zu denken.
Endlich entspricht die Größe der Hufen im Lande Stargard, so weit sie durch Nachrechnung noch ermittelt werden kann, durchweg der altpommerschen und rügenschen Hakenhufe, welche, wie schon bemerkt, im Jahre 1616 zu 15 Morgen à 300 □Ruthen der 16füßigen Ruthe, also zu 4500 □Ruthen meklenbg. angenommen wurde; worüber weiter unten das Nähere.
3. Die Nachmessung der Hufen, das equitare vel metiri der rügianisch=pommerschen Urkunden, geschieht ea mensura, quae in vulgari hofslach dicitur (U.=B. V, S. 151, 227, 241), und be=


|
Seite 87 |




|
zieht sich zunächst auf die Abgrenzung des im privaten Besitz der Dorfbewohner befindlichen Ackerlandes, des Hufenschlages der Dorfschaft, von den der gemeinen Nutzung der Hufenbesitzer unterworfenen Gutstheilen; die Feststellung der Gutsgrenzen ist dabei Voraussetzung, und diese gehört, wo sie erforderlich wird, einem andern Verfahren an. Eine Nachmessung zu veranstalten, gehörte zu den Prärogativen des Landesherrn; von dem sich ergebenden Ueberland mußten ihm die precariae und die servitia nach Hufenzahl geleistet werden, welche er de jure et consuetudine, wie es in den Urkunden heißt von jeder Hufe in Anspruch nahm. Es wurde daher dieses Mittel zu finanziellen Zwecken vielfach in Anwendung gesetzt. Außer der Abgrenzung des privaten von dem der gemeinen Nutzung unterworfenen Lande hatte man hierbei jedoch selbstverständlich auch einen mehr oder weniger bestimmten Flächen=Inhalt der Hufen an saatbarem Lande vor Augen; auf eine solche Messung mußte recurrirt werden, wenn die Abgrenzung des Hufenlandes ein sicheres Resultat nicht ergab, oder wenn eine bestimmte Hufenzahl nicht mehr bekannt war. Die Unvollkommenheit des Meßverfahrens zeigt sich besonders in dem pommerschen equitare, bei welchem wohl an ein Abreiten des Grenzzuges der Hufen oder der Feldmark zu denken ist. - Wir führen einiges hierauf Bezügliche aus unseren Urkunden an.
Im Jahre 1309 (U.=B. V, S. 518) verkauft Fürst Nicolaus von Werle dem Kloster Doberan das Gut Niex - die villa cum proprietate et omni prorsus utilitate - für 2000 Mark wend. absque certo numero mansorum.
1342 (U=B. IX, S. 365) verkaufen die Fürsten Nicolaus und Bernhard von Werle den Johanniterrittern zu Mirow die proprietas - also nur die fürstlichen Rechte - universorum mansorum adjacentes ville Cakeldutten für 45 Mark Lübisch - sine agrorum mensura.
Dagegen verkaufen die Gebrüder Thun im Jahre 1338 (U.=B. IX, S. 133) dem Kloster Ribnitz mansos et agros, qui spectabant ad curiam Dalvitz - ita tamen, quod prius agri mensurentur, ad sciendum mansorum numerum et pecunie certam summam. Für jede aus der Messung sich ergebende Hufe sollen 150 Mark Sundisch gezahlt werden.
Die Fürsten von Werle verleihen im Jahre 1273 (U.=B. II, S. 453) der Johanniter=Comturei Mirow die Dörfer Zirtow und Lenz mit 36 und 12 Hufen, mit dem Hinzufügen: que ville si mensurarentur et tres mansi invenirentur, predictis fratribus


|
Seite 88 |




|
sunt collati, si vero super predictum numerum excresceret, de nobis emere debent fratres.
Johann, Herzog von Meklenburg=Stargard, verkauft 1355 (U.=B.XIII, S. 663) an die Johanniter=Comturei Nemerow ein Stück Wald mit Grund und Boden ("dat holt unde dy stede des sulven holtes"), angenommen zu einer Hufe, für 5 Mark und 100 wendische Pfennige; würde aber mehr gefunden, wenn man das Holz messen würde, so soll für jeglichen Morgen so viel bezahlt werden, "als er ghulde an der Huve."
4. Bevor wir nun in eine nähere Erörterung über Größe von Hufen und Morgen eintreten, ist noch die Frage zu beantworten, ob eine Gemengelage des Hufenlandes, oder ob die Lage in einem Stück, die Einzelhufe, als Regel anzunehmen.
Bekannt ist, daß schon im Beginn der Neuzeit, im 16. Jahrhundert, sich ein großer Theil der Hufen in Gemengelage in Folge der Dreifelderwirthschaft befand; wir beziehen uns einstweilen auf das Amtsbuch der Comturei zu Nemerow von 1572 in den Jahrbüchern, Band IX. S. 88 u. 89.
Wie weit dieser Zustand für den ritterschaftlichen Besitz zgurückreicht, ob er schon während des Mittelalters die Regel bildete, ob und in welchem Umfange daneben Einzelhufen in zusammenhängenden Stücken vorkommen, und wie sich hierzu die einer herrschaftlichen curia anfänglich zugelegten mansi sub cultura dominorum verhielten, muß einer näheren Erforschung vorbehalten bleiben, und steht zu hoffen, daß die folgenden Bände des Urkundenbuches das dürftige Material, welches zur Zeit für diese Frage uns vorliegt, vervollständigen werden. Jedenfalls sind die Städte auf ihrem zu Stadtrecht liegenden Gebiete schon sehr früh mit der Einführung der Drei=Felder=Wirthschaft und Flurzwang für die ganze Feldmark vorgegangen. Wir lassen Einiges, was auf Einzelhufen gedeutet werden kann, aus den Urkunden folgen.
Heinrich von Meklenburg verkauft im Jahre 1309 (U.=B. V, S. 451) der Stadt Gadebusch das Dorf Zwemin zur Stadtfeldmark zu Lübischem Rechte. Possunt etiam predicti cives quinque vel sex mansos ab eorum civitate nimium distantes, si ipsis placuerit, sub eadem proprietate et libertate locare quibusdam colonis et rusticis ad colendum -.
Von Lübbersdorf werden in den Jahren 1327 bis 1332 (U=B. VII, S. 475, 524; VIII, S. 243, 272) nach und nach eine Anzahl Hufen, anscheinend zehn, welche zu den Höfen in Lübbersdorf liegen (jacentes ad ipsorum - der Verkäufer - curias) an die Stadt Friedland verkauft und zu Stadtrecht gelegt.


|
Seite 89 |




|
Diese Hufen bilden noch heute einen deutlich erkennbaren besonderen Abschnitt der Friedländer Feldmark, welcher sich wie eine Landzunge in die angrenzende Lübbersdorfer Feldmark hinein erstreckt.
Die Johanniter=Comturei Nemerow erwirbt im Jahre 1303 (U.=B. V, S. 116) das Eigenthum von 8 Hufen in Staven, quos habent fratres - dicti de Stoven in isto latere, sicut advenitur de opido dicto Vredeland in Stoven, villam predictam. -
Die Polizeiordnung von 1572 verbietet im Titel von Roden und Verwüstung der Holzungen den Bauern "ihre Aecker mit überschwenklichen großen Zeunen zu befrieden"; dagegen soll ein jeder binnen Jahresfrist "um seine Felder und Aecker Feldsteine setzen oder Graben aufwerfen, und allenthalben nach Gelegenheit, Weiden, Mast =, Obst= und andere fruchtbare und nützliche Bäume setzen und pflanzen."
In welchem Zusammenhange die Drei=Felder=Wirthschaft mit der Bildung des Großgrundbesitzes sich befinde, wird erst durch weitere Localforschungen aufgehellt werden können. Jedenfalls war diese Bewirthschaftungsweise schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts allgemein verbreitet. Die einzelnen Schläge zerfielen gewöhnlich wieder in eine Anzahl von Ackerblöcken, in Gewanne, in welchen sowohl die Bauerhufen als die Hofhufen einzelne Stücke haben, so daß eine jede Hufe in jedem Schlage zum dritten Theil ihres Bestandes vertreten ist, in den einzelnen Gewannen aber verschieden, je nach der Größe derselben und nach ökonomischen Rücksichten.
Auf den Stadtfeldern ist die Drei=Felder=Wirthschaft wahrscheinlich schon bald nach der Gründung der Städte eingeführt. Die Neubrandenburger Feldmark hatte vor der Separation an Acker
| im Stargarder | Schlage | 311,006 | □Ruthen, |
| im Trollenhäger | Schlage | 320,367 | □Ruthen, |
| im Küssower | Schlage | 298,842 | □Ruthen, |
| ---------- | -------- | ||
| Summe der Hufen an Acker = | 930,215 | □Ruthen. | |
Nur in den beiden ersteren Schlägen war die Feldmark in Gewanne eingetheilt, und zwar, abgesehen von den sogenannten Füllungen, der Trollenhäger Schlag in 5 Gewanne von sehr ungleicher Größe, der Stargarder Schlag in 7 Gewanne; der Küssower Schlag von durchweg gleicher Bodenbeschaffenheit enthielt keine Gewanne; jeder Hufe, beziehungsweise jedem Hufenpaar war


|
Seite 90 |




|
sein Antheil in dem Küssower Schlage in einem zusammenhängenden Stücke zugewiesen.
Der Artikel 6 der zuletzt unter dem 25. April 1818 landesherrlich confirmirten Bauzunfts=Artikel für die Vorderstadt Neubranbenburg lautet: "Es soll keinem Bürger, er sei in oder außerhalb der Zunft, gestattet werden, mehr Vieh zu halten, als ihm nach Verhältniß seines Ackerwerkes unentbehrlich ist, nämlich einem jeden Baumann, so er nur eine Hufe hat, 2 Pferde und 10 Schafe; so er ein Paar Hufen, 4 Pferde, 2 Ochsen, 20 Schafe: dem, der 3 Hufen hat, 4 Pferde, 2 Ochsen, 30 Schafe: und dem, der 4 oder mehr Hufen hat, 6 Pferde, 4 Ochsen, und nicht darüber, nebst den Schafen nach voriger Proportion."
Die Feldmark der Stadt Friedland zerfällt in 3 Schläge, das Steinfeld, das Treptowsche Feld, das Burgfeld; jeder Schlag enthält ein Binnenfeld und ein Draußenfeld. Es sind im Ganzen 11 Gewanne in dem Hufenlande, in welchem jede Hufe ihr Stück hat, im Burgfeld 4, im Steinfeld 4, im Treptowschen Feld 3 Gewanne. Nach Scheffeln à 100 □Ruthen sind
| vorhanden an Acker im Ganzen | 14,200 | Scheffel; |
| davon lagen in Morgen u. Kämpen | 3100 | " |
| ----- | ------------ | ----------- |
| und in Hufen | 11,100 | Scheffel. |
Es sind 164 Hufen vorhanden, so daß auf jede Hufe etwa 64 Scheffel entfallen. Daß zu den 150 Ackerhufen, mit welchen Friedland bei seiner Gründung dotirt worden, schon im Jahre 1270 an Ueberland durch landesherrliche Verleihung 44 Hufen (U.=B. II, S. 385: Boll Gesch. des Landes Stargard I, 293), in den Jahren 1327 bis 1332 fernere 10 Hufen durch Kauf von Lübbersdorf hinzukamen, ist schon oben bemerkt.
5. Die Frage nach der durchschnittlichen Größe der alten Bauerhufen kann nur auf Grund localer Ermittlungen und Berechnungen beantwortet werden, und haben daher die Ergebnisse solcher Ermittlungen zunächst nur einen localen Werth in Anspruch zu nehmen. Es führen jedoch schon die vielfachen Nachmessungen der Hufen darauf hin, daß man für einen größeren Bereich ein bestimmtes Ackermaß vor Augen hatte; Ungleichheiten zwischen den nachgemessenen und den von der Nachmessung befreiten Hufen werden sich vielfach auch innerhalb desselben Bereiches ergeben müssen, da die letzteren das Ueberland mit dem Hufenland zu vereinigen pflegten.


|
Seite 91 |




|
Einen bestimmten Anhalt gewähren zunächst die Stadtfeldmarken, deren ursprünglicher Hufenbestand bekannt ist; Veränderungen der Ackerfläche durch veränderte Benutzungsweise, sowie durch Zuwachs oder Abgang, können jedoch auch hier eingetreten sein.
Die Neubrandenburger Feldmark hat sich, soweit die Nachrichten reichen, in ihrem ursprünglichen Bestande bis auf die Jetztzeit erhalten: sie enthielt bis zur Separation noch die ihr zugewiesene Zahl von 200 Ackerhufen
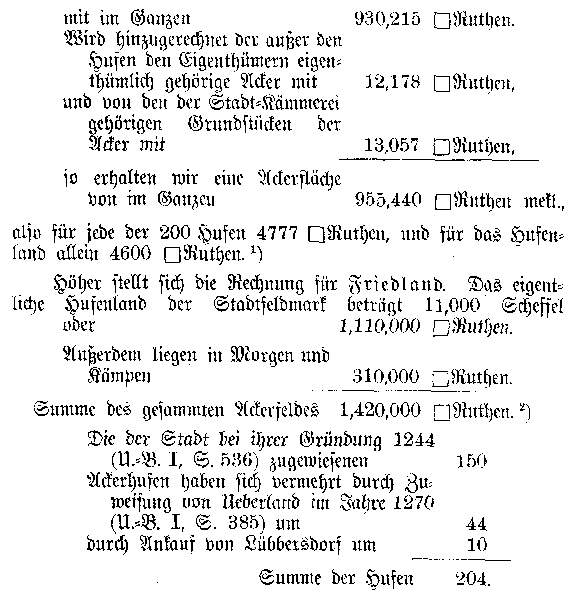
1) Nach dem vorliegenden
Hufenregister; aus dem Ende des vorigen
Jahrhunderts.
2) Aus dem P. M. vom
1.August 1862 bei den Acten des Friedländer
Magistrats, betr. Separation.


|
Seite 92 |




|
Auf die Hufe würden also entfallen von dem gesammten Ackerfelde 7000 □Ruthen, von dem in Hufen liegenden Lande 5440 □Ruthen. Es leidet jedoch keinen Zweifel, daß bei der Friedländer Feldmark weitere Veränderungen von Erheblichkeit eingetreten sind, welche eine Zurückführung der gegenwärtig vorhandenen Ackerfläche auf einen ursprünglichen Hufenstand nicht nur erschweren, sondern wohl unmöglich machen. Im Jahre 1288 (U.=B. III, S. 320) verkaufte der Markgraf Albrecht von Brandenburg an die Stadt Friedland das gesammte Uebermaß in den Dörfern Schwichtenberg. Klokow und Hagen (Sandhagen) an Acker, Wiesen, Wald: wahrscheinlich ist dieses Uebermaß, dessen Größe wir nicht kennen, im Wege einer neuen Regulirung der Stadtfeldmark, welche in großer Ausdehnung mit Sandhagen grenzt, zu jener zugeschlagen und hat zu einer Vergrößerung der Hufen geführt, sowie zu einer neuen Bestimmung der Hufenzahl, welche jetzt 164 zu etwa 6400 □Ruthen beträgt. Außerdem wird durch Umwandelung Ackerland gewonnen sein: Wald und Wiese durchsetzen noch heute die ausgedehnte Feldmark an vielen Stellen, und werden in früherer Zeit einen noch größeren Umfang gehabt haben.
Wir lassen einige ritterschaftliche Güter im Stargardschen Kreise, deren Hufenzahl oben aus dem Betrage der Kornbede und des Meßkorns ermittelt worden oder sonst bekannt ist, mit ihrem Ackerbestand zur Zeit der Landesvermessung folgen, um vergleichbare Zahlen für die Größe der Hufen zu gewinnen. Die aus Bede und Meßkorn ermittelte Hufenzahl ist allemal nur als Minimalzahl anzusehen, weil die von Alters her zur herrschaftlichen curia gehörigen Hofhufen sich diesen Abgaben vielfach entzogen haben, wie schon oben bemerkt worden. Außerdem waren die Pfarrhufen abgabenfrei.
Das Gut Sadelkow hatte zur Zeit der Landes=Vermessung unter dem Pflug 177,960 Ruthen an Hof= und Bauerländereien; für 39 oben nachgewiesene Hufen ergeben sich pro Hufe 4565 □Ruthen, also annähernd die gleiche Zahl, wie für die Neubrandenburger Hufen.
Das Gut Gantzkow hatte zur gedachten Zeit an Hof= und Baueracker 209,707 □Ruthen: für 42 Hufen, für welche Meßforn erlegt wird, ergeben sich pro Hufe 4970 □Ruthen.
Das Gut Staven, früher dem Domanium angehörig, ist nicht vermessen und bonitirt; nach gütiger Mittheilung des Herrn Gutsbesitzers Schlaeger beträgt die gesammte Ackerfläche unter dem Pflug gegenwärtig etwa


|
Seite 93 |




|
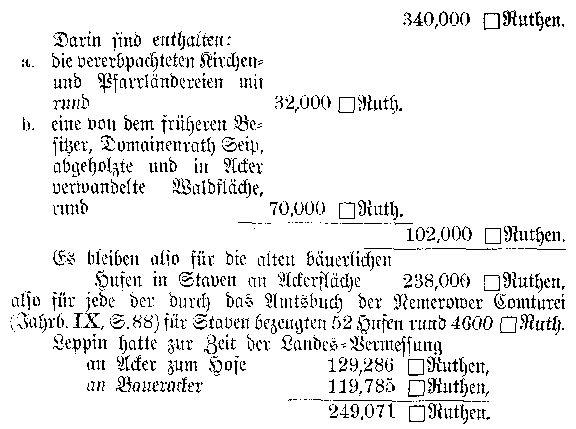
Der alte Hufenstand von Leppin konnte aus Bede und Meßkorn nicht sicher berechnet werden, erstere führte auf 36, letztere auf 38 1/2 Hufen. Unzweifelhaft hat Leppin, wie der Vergleich seines Areals mit den voraufgehend genannten Gütern, namentlich mit Staven, ergiebt, einen höheren Hufenstand gehabt, und werden hier die der Zahl nach unbekannten Hofhufen sich der Bede= und Meßkorn =Abgabe entzogen haben; für 38 Hufen würden sich 6554 □Ruthen pro Hufe ergeben.
Die geringeren Zahlen, welche sich zwischen 4500 bis 5000 □Ruthen pro Hufe bewegen, werden die richtigen Durchschnittszahlen sein; schon wegen ihrer Uebereinstimmung mit der Zahl, welche für den intact gebliebenen Bestand der Neubrandenburger Hufen gefunden ist, und, fügen wir hinzu, wegen ihrer Uebereinstimmung mit dem für die pommersche und rügensche Hakenhufe durch die pommersche Gesetzgebung im 17. Jahrhunderte angenommenen Normalmaß von 15 Morgen à 300 □Ruthen der 16füßigen Ruthe. Die sogen. Landhufe von 30 Morgen à 300 □Ruth. der 16füßigen Ruthe ist nichts weiter als zwei in eine Hand gelegte alte bäuerliche Hufen, ein Verhältniß, welches schon in der Polizei=Ordnung von 1572, Titel "von Jagen": "1 oder 2 Bauern im Dorfe und weniger denn 4 Hufen auf der Feldmark" zum Ausdruck gebracht ist. - Nach dem "wendisch=rügianer Landgebrauch" aus der ersten


|
Seite 94 |




|
Hälfte des 16. Jahrhunderts von Mathäus v. Normann (Ausgabe von Gadebusch 1777, Tit. 104 "Von den Höfen, Erben und Cathen der Bauern") wurde auf Rügen unterschieden zwischen Höfen nnd Erben; zu ersteren gehörten 2 oder 3 Hufen; das Erbe ist halb so groß und hat eine Haken=Hufe "und 2 oder 3 Haken "up das üterste"; Kotzen aber sind, die 8 Morgen, ringer oder "wenig mehr", an Acker zu bauen haben." - Die Rostocker Hägerhufe enthielt, wie oben ausgeführt ist, nach der anfänglichen Zumessung 7200 □Ruthen mekl. oder 30 Morgen à 240 □Ruthen; daß sie mit dem Ueberland, welches den Hufen später beigelegt wurde, nahezu die doppelte Größe erreichte, ist gleichfalls schon bemerkt worden.
6. Es ist jetzt noch Einiges über das alte Morgenmaß, über die jugera, denen wir so oft in den Urkunden begegnen, beizubringen.
Unzweifelhaft hat den letzteren ein bestimmtes Größen=Verhältniß der Hufe, und daß dieselbe eine bestimmte Zahl von Morgen in sich begreife, vorgeschwebt; es soll ein Stück Land nachgemessen werden, um zu erfahren, wie viel es an Hufen befasse; ein Stück Waldland wird zu einer Hufe angenommen und verkauft, mit Vorbehalt der Ausmessung; wenn sich mehr findet als eine Hufe, so soll das Uebrige nach Morgenzahl bezahlt werden. Aber nirgends wird die Verhältnißzahl von Morgen zu Hufe. oder der Flächeninhalt eines Morgens genannt; erst die späteren Urkunden aus dem Beginne der Neuzeit geben hierüber Aufschluß.
Uns scheint der Grund hiervon darin zu liegen, daß man unter Hufe und Morgen noch kein bestimmtes Flächenmaß verstand, sondern ein nach localer Gewohnheit, nach der Bodenbeschaffenheit und nach den üblichen Getreidemaßen wechselndes Maß, welches daher erst nach örtlichen Verhältnissen seine nähere Bestimmung erhielt. Daß der Morgen sich überall nach Scheffeln Aussaat bestimmte, ist bereits oben bemerkt.
Wir haben schon angeführt, daß nach dem Geveziner Kirchenrechnungsbuch 2 Scheffel großes Maßes Aussaat auf den Morgen gerechnet werden, und daß auf dem Friedländer Stadtfelde die Morgen durchschnittlich 3 Scheffel großes Maßes Aussaat enthalten, "aber auch von 1 bis 6 Scheffel in der Größe wachsend." Wir lassen noch einiges Bezügliche folgen:
Nach dem Amtsbuche der Comturei Nemerow vom Jahre 1572 (Jahrb. IX, S. 90) liegt der Acker des Dorfes Rowa in 3 Feldern, "sind nicht alle gleich groß, seyen in einen jeden Morgen gemistet Land 2 Scheffel."


|
Seite 95 |




|
Der Entwurf zu einem modus contribuendi für die Städte, welcher aus den Verhandlungen zwischen ritterschaftlichen und städtischen Bevollmächtigten am 18. September 1748 hervorging, lautete sub 2 von Ländereien: "Von einem Morgen besäeten Acker durch die Bank 4 Schilling." Der von den Städten des Stargardschen Kreises im Mai 1754 vorgelegte "Contributionsplan derer Städte Stargardschen Kreises" schlug vor:
"2. von Aeckern, Wiesen und Gärten ein Scheffel Aussat nach der Landesmessung an bonitirtem Acker, sowohl im Winter= als Sommerschlage, exclusive der Brachfelder 2 Schilling." Der hierauf von den Städten bei den Verhandlungen mit der Ritterschaft vorgelegte, von letzterer am 11. Mai 1754 genehmigte modus lautete:
"Städtischer modus contribuendi.
"II. Von Ländereien.
"Von einem Morgen Acker, der nicht in Schlägen liegt, und alle Jahre besäet werden kann, à 4 Scheffel Rostocker Maße, wenn er besäet ist, jährlich 4 Schilling." Diese Fassung ist unverändert in den landesgrundgesetzlichen Erbvergleich §. 47 übergegangen.
Man hat sich also schließlich für den Rostocker Scheffel Aussaat als Flächenmaß entschieden, nachdem dieser Scheffel als Bonitirungsmaß für die ritterschaftlichen Hufen grundleglich gemacht war. Der Rostoder Morgen beträgt darnach 240 □Ruthen mekl. oder Lübisch; wir haben oben gesehen, daß man schon bei der Abmessung der Hägerhufen dieses Maß in Anwendung brachte.
Auf die Frage, wie viel Morgen man auf die gewöhnliche Bauerhufe gerechnet habe, erhalten wir eine Antwort aus der Nr. 77 der Beilagen zur Streitschrift (von Freiherrn von Ditmar, herzoglichem Vicecanzler): "Das letzte Wort zur Behauptung der Auseinandersetzungs=Convention" (1751). Der Pastor Gutzmer zu Sternberg hat sich zum Visitations=Protocoll von 1623 beschwert, daß von den - damals wüsten - Hufen zu Schönfeld, welche der Kirchenökonomie zu Sternberg eigenthümlich gehörten, die Bauern zu Kobrow "ein gar geringes Heuergeld, nemlich von jeder Hufe 12 Schillinge, seit langen Jahren zahlten." Er bittet den Bauern aufzuerlegen, daß sie in Zukunft 4 Gulden von jeder Hufe geben; bei 12 Schillingen entfielen auf jeden Morgen nur 4 Pfennige, bei 4 Florenen auf jeden Morgen 4 Schillinge. Beide Rechnungen führen auf 24 Morgen pro Hufe, wenn berücksichtigt wird, daß damals auf den Gulden 24 ßl. und auf den Groschen 16 Pfennige, auf den Schilling also 8 Pfennige


|
Seite 96 |




|
gerechnet wurden. (Rudloff, Neuere Geschichte v. Mekl. 1821, I, S. 332.)
Wenn eine Hufe sich durch einen Zuwachs, insbesondere an Ueberland, vergrößert hatte, so enthielt sie folgeweise mehr jugera als eine gewöhnliche Hufe; dies wurde in den Urkunden zum Ausdruck gebracht, wenn dazu besondere Veranlassung vorlag, z. B. dann, wenn Zehntberechtigungen verkauft wurden, welche von Rechts wegen und ohne Weiteres auch das Ueberland ergriffen und deshalb einen höheren Werth hatten, wenn die Zahl der jugera größer war, als die gewöhnliche. In der Urkunde bei Schröder, P. M. II, S. 1590 wird von Seiten der Herren von dem Berge der Zehnte von 3 1/2 Hufen in Alten - Gamme - im Bergedorfschen - an den Bischof zu Ratzeburg verkauft, im Jahre 1389. Es sind 5 Hufenbesitzer vorhanden, welche mit ihrem Besitz genannt werden. Drei halbe Hufen sind im Besitze von ebenso viel Colonen, der vierte hat 30 Morgen, der fünfte 25 Morgen, also je 6 und 1 Morgen mehr als eine Hufe.
Wird das Wort mansus nur in der Bedeutung eines Flächenmaßes gebraucht, so kam es weniger auf diese immerhin etwas unbestimmte Bezeichnung, als auf die Zahl der jugera an, welche die in Frage stehende Fläche enthalten sollte. In der bereits oben angeführten Urkunde vom Jahre 1347 (U.=B. X, S. 126) wird ein dimidius mansus cespitum (Torf) mit der näheren Bestimmung verkauft, daß diese Fläche 20 jugera enthalten sollte. - Die vom Herzog Johann von Meklenburg=Stargard im Jahre 1355 (U.=B. XIII, S. 663) an die Johanniter=Comturei Nemerow verkaufte Holzfläche ist zu 1 mansus angenommen und bezahlt, jedoch mit Vorbehalt der Nachmessung und der Nachzahlung für jeden mehr gefundenen Morgen.
Mit den 24 Morgen pro Hufe stimmt auch ungefähr die Hufe auf dem Neubrandenburger Stadtfelde überein, welche zu 45 Scheffeln Aussaat großes Maßes, also auf etwas weniger, vor der Separation beständig angenommen wurde. Nach Haubold, Sächsisches Privatrecht (1820) §. 175, werden in Sachsen gewöhnlich 24 Aecker auf eine Hufe gerechnet, obwohl die Anzahl der Aecker nach der Verschiedenheit des Bodens und der Gegenden verschieden sei. Nach Pufendorf, Observat. II, obs. 185, pag. 422, wurden im Braunschweigischen und Lüneburgischen gewöhnlich 30 Morgen, an manchen Orten aber auch 24 und 20 Morgen auf eine Hufe gerechnet, und zwar der Morgen zu 120 □Ruthen der 16füßigen Ruthe, womit der Magdeburgische Morgen=180 □Ruthen der 12füßigen Ruthe nahezu übereinstimmt.


|
Seite 97 |




|
Wir erkennen in allem diesem den vorwiegend localen Charakter des Morgen=Maßes; der calenbergische Morgen ist nicht halb so groß als wie der pommersche von 300 □Ruthen; durch Meklenburg selbst geht die Verschiedenheit des nach großem Scheffel und nach Rostocker Scheffel bestimmten Maßes. Der Wismarsche, Güstrower und Schweriner Scheffel unterscheiden sich nur wenig von dem Rostocker. Der Grabower, Parchimsche, Warensche Scheffel stimmten ungefähr mit dem großen Scheffel der Mark Brandenburg, dem späteren Berliner Scheffel, überein (vgl. Vaterlandskunde von Raabe, Bd. II, S. 194). - Für die Eintheilung der gewöhnlichen Bauerhufe in 24 Morgen als allgemein üblich spricht übrigens noch der Umstand, daß oft nach Achtel=Hufen gerechnet wird, dimidium quartale (U.=B. VIII, S. 28, und das Register sub voce quartale), was eine durch 8 theilbare Zahl voraussetzt.
Wir schließen unsere Arbeit mit dem Wunsche, daß sie zu weiteren Ermittelungen auf diesem Gebiete und damit zur Bestätigung oder Berichtigung der von uns gefundenen Ergebnisse veranlassen möge.
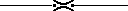


|
Seite 98 |




|



|



|
|
:
|
V.
Zur Baugeschichte der Burg Stargard i. M. 1 )
Von
Bürgermeister Dr. O. Pieper
zu Penzlin.
D
ie Slaven fanden hier eine "alte
Burg" der Germanen vor und nannten den
Platz deshalb Stargard. Da sie dem Ort einen
Namen gaben und ihn bewohnten, ist anzunehmen,
daß sie trotz der nicht durch Wasser geschützten
Lage die alte Befestigung nicht ganz unbenutzt
gelassen haben, da sie keineswegs - anders z. B.
auf Rügen - nur in Sümpfen
 . Wallburgen hatten.
. Wallburgen hatten.
Von den alten Wällen ist indessen meiner Ansicht nach nichts mehr vorhanden. Es ist meines Wissens ohne Beispiel, daß die alten Umwallungen, anstatt ein Plateau oder einen Kessel zu umschließen, um den Fuß eines Hügels geführt wären, wie jetzt in Stargard. Die alte Umwallung wird vielmehr den oberen Rand der jetzigen inneren (Haupt=) Burg umschlossen haben, und ist bei Anlegung der Hofburg im 13. Jahrhundert abgeräumt und planirt werden. Eine mittelalterliche Burg schützte sich nur durch hohe Ringmauern, Thürme und Gräben; erst als - wesentlich erst im 16. Jahrhundert - verbesserte Feuergeschütze mehr ausschließlich gebraucht wurden, kamen wieder vorgelegte Wälle mit ausgedehnteren, zum Theil ausgemauerten Gräben in Anwendung. Was hiervon bei der Burg Stargard noch erhalten ist, stammt also aus dieser Zeit.


|
Seite 99 |




|
Die im 13. Jahrhundert aufgebaute Burg mußte als "Hofburg" gleich einen größeren Umfang mit Vor= und Hauptburg haben, der im Wesentlichen dem heute bebauten Theil entsprochen hat. Der südlich der Vorburg gelegene freie umwallte Platz dürfte später, eben bei der Umwallung, etwa im 16. Jahrhundert, hinzugefügt sein. Vor dem Thorhause ging über den früher tieferen Graben jedenfalls eine Zugbrücke. Die großen Bögen in der Façade der oberen Hälfte des Thorhauses sind nur Blendbögen zur Verzierung, die später der größeren Haltbarkeit wegen ausgemauert wurden. Dieses obere Stockwerk des Thorhauses ist allem Anscheine nach später aufgesetzt. Es deutet mit seinen Spitzbogen auf eine jüngere Zeit als der untere Theil, bei welchem der vorhandene Rundbogenfries, dessen Schenkel auf kleinen Consölchen ruhen, mit Sicherheit (vgl. Otte, Gesch. d. deutschen Baukunst 1874, S. 306 u. 308) gerade auf das 13. Jahrhundert hinweist. Durch diesen späteren Aufsatz erklärt es sich auch, daß das Thorhaus keine Einrichtung für eine Zugbrücke mehr zeigt. Nach der Hauptburg hin war das Thorhaus, von welchem hier nur die Seitenwand erhalten ist, sehr wahrscheinlich durch ein Fallgitter geschlossen. 1 )
Das zweite, innere Thorhaus lag links neben dem jetzigen zweiten und zeigt hier seinen später vermauerten Thorbogen. Während das jetzige innere Thor in grader Linie hinter das äußere gelegt ist, war dies - entsprechend dem Princip bei mittelalterlichen Wehrbauten - bei dem älteren Thor nicht der Fall. Ein jetzt noch vor letzterem stehender Mauerrest wird als die vormalige Außenwand des älteren Thorbaues anzusehen sein. Neben dem Hauptthorbogen ist hier noch das seiner Zeit übliche kleinere Thor für Fußgänger zu erkennen. Vor diesem Thorbau wird sehr wahrscheinlich ein zweiter Graben mit Zugbrücke gewesen sein.
Daneben liegt die ehemalige Burgkapelle, deren jetziger Mauerabschluß an der äußeren Giebelseite einstweilen noch Räthsel aufgiebt.
Das jetzige Wohnhaus des ersten Beamten mit seinen Reihen regelmäßiger großer Fenster auch nach außen, Mangel an


|
Seite 100 |




|
Steinbänken in den Fensternischen, überhaupt bis auf die Mauerstärke ein ganz moderner Bau, ist - abgesehen vielleicht von den Kellern - etwa 17. Jahrhunderts.
Der Berchfrit gehört dagegen dem ersten Bau (des 13. Jahrhunderts) an. In diesem Jahrhundert waren - nach Cohausen, Bonner Jahrbücher XXVIII, 47 f. - die Berchfrite, wenn sie rund waren, der Ringmauer abgewendet, und Abtritt und Kamin, wie sie bei dem Stargarder Berchfrit vorhanden sind, finden sich vereinzelt schon bei Berchfriten des 12. Jahrhunderts. Der Eingang lag in Stargard, wie überall bis ins 15. Jahrhundert, über dem untersten, als Verließ dienenden Geschoß. Statt der beweglichen Leiter, die ursprünglich hinauf führte, hat man später an der äußeren Thurmwand die in ihren Spuren noch erkennbare bequemere, kurze Wendeltreppe bis dahinauf geführt und dann zuletzt zu ebener Erde den jetzigen Eingang durch das vormalige Verließ durchgebrochen. Der alte Eingang bietet insofern eine auffallende Anomalie, als er der Angriffsseite fast direkt entgegen gekehrt ist, während der Eingang zu den Berchfriten - bevor er gegen Schluß der Burgenzeit zu ebener Erde angebracht wurde - immer der Angriffsseite abgekehrt lag.
Die Angriffsmittel des Mittelalters - Untergrabung, Mauerbrecher, Steinschleudern und Armbrüste - waren in der Höhe nicht so wirksam, daß man nicht unbeschadet der Sicherheit in dem nur von oben vertheidigten Berchfrit für die höheren Stockwerke durch Verdünnung der Mauer sich vermehrten Innenraum hätte schaffen können. Demgemäß pflegt die Mauerdicke in jedem höheren Stockwerk (nach Cohausen 1. c.) um 6 bis 11 Zoll abzunehmen. In dem Stargarder Berchfrit ist diese Verjüngung eine stärkere, indem sie - von 3,95 m Mauerdicke unten bis zu 2 m oben - in jedem Stockwerk 34 bis 85 cm, also 13 bis 32 1/2 Zoll, beträgt Die Mauer besteht, wie in Norddeutschland gewöhnlich, aus einem mit Mauersteinen bekleideten Kern von großen Feldsteinen.
Die Vertheidigung des Berchfrits geschah (von einem hier nicht vorhandenen hölzernen Umgang abgesehen) nur aus den Zinnen, mit welchen die Mauer oben abschloß. Die Zinnenlücken (Fenster) zwischen den Wintbergen betragen daher etwa 75 bis 120 cm, um entweder für einen oder für zwei Schützen Raum zu geben. Die Wintbergen selbst mußten den aufrecht stehenden Schützen decken. Man sieht hieraus, welche wohl aus Unkenntniß entstandene Spielerei die jetzt den Stargarder Berchfrit bekrönende zierliche Zinnenreihe ist. Dieselbe ist 1823 (?) zugleich mit einer


|
Seite 101 |




|
Erhöhung des Thurmes aufgemauert. Die alten Zinnen sind darunter noch im äußeren Mauerwerke erkennbar.
Der neben dem Berchfrit vorhandene halb unterirdische Gang in den Wallgraben hinab ist wahrscheinlich der bequemeren Verbindung wegen zur Zeit der späteren Befestigung angelegt, wenngleich es auch bei mittelalterlichen Burgbauten nicht an Nebenpforten und geheimen unterirdischen Ausgängen fehlte.
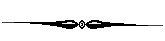
Einen vom Herrn Baumeister Koeppel gezeichneten Grundriß der jetzigen Burg Stargard geben wir auf der folgenden Seite, Tafel IX.


|
[ Seite 102 ] |




|
Tafel IX.
Burg Stargard.
~~~~~~~~~~~~~
|
a. Weg von der
Stadt.
b. Thor. c. Alter Wallgraben. d. Wirthschaftshof. e. Zweites Thor. f. Früheres zweites Thor. g. Mauerstumpf. h; Alte Kirche. |
i. Thurm.
k. Treppe in den Wallgraben. l. Wohngebäude. m. Wirthschaftsgebäude. n. Spätere Ausdehnung der Befestigung. o. Ringmauer. |
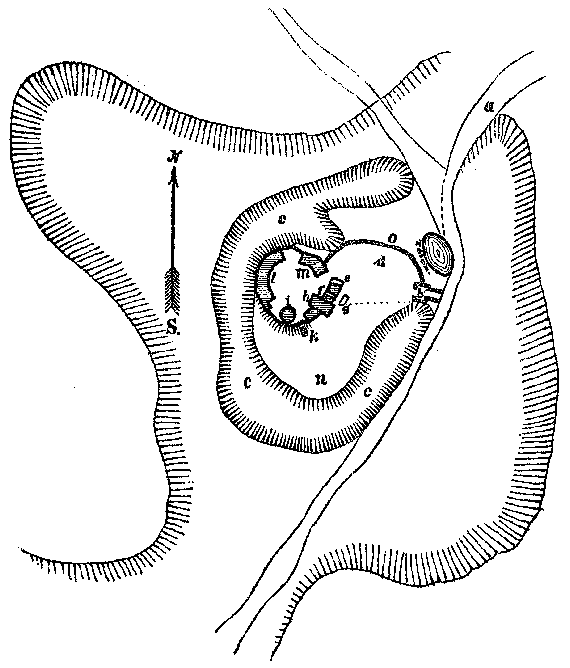


|
Seite 103 |




|



|



|
|
:
|
VI.
Das Bisthum Schwerin
in der evangelischen Zeit.
Vom
Archivar Dr. Fr. Schildt.
III. Theil.
III. Die äußere Geschichte des Bisthums.
[Fortsetzung und Schluß zu Jahrbuch XLVII, S. 146 ff., und XLIX, S. 145 ff.]
D ie äußere Geschichte des Bisthums hat vorzugsweise die Stellung dieses Landes zum Reich und seine Beziehungen zu andern Reichsländern zu behandeln. Bei der geringen Bedeutung des Ländchens kommen Beziehungen zu außerdeutschen Staaten nur ausnahmsweise vor, und zwar handelt es sich hier nur um die benachbarten Königreiche Dänemark und Schweden.
A. Das Bisthum als deutscher Reichsstand.
Moser zählt in seinem 1767 erschienenen Buche: "Von denen teutschen Reichsständen" zu denjenigen Staaten, welche zur weltlichen Fürstenbank gehörten, als 31sten das Stift Schwerin. Dasselbe nahm nach seiner Angabe dieselbe Stellung ein wie die benachbarten evangelischen Stifter Ratzeburg und Lübek; nur hatte das letztgenannte nicht seinen Sitz auf der weltlichen Fürstenbank, die ihm nicht genügte, sondern mit Osnabrück auf der Querbank, die diesen beiden nach der Reformation bewilligt wurde, als sie sich vergeblich bemüht hatten, die geistliche Bank zu behaupten.


|
Seite 104 |




|
In der Geschichte des ersten Schweriner Bischofs Berno von Wigger (Jahrb. XXVIII, S. 3 ff.) wird nachgewiesen, daß das Oberhaupt des Stifts Schwerin als ein Lehnsmann des Kaisers anzusehen ist. Denn der Kaiser allein hatte nach dem Wormser Concordat von 1122 von der Kirche das Recht erhalten, die Bischöfe im Reich durch das Scepter mit Regalien zu belehnen. Wenn nun auch der erste Schweriner Bischof Berno diese Belehnung nicht aus der Hand des Kaisers selbst empfing, so erhielt er sie doch im Auftrage desselben durch Herzog Heinrich von Sachsen, welchem zu dem Zwecke besondere Vollmacht verliehen war. Denn ausdrücklich hatte Kaiser Friedrich bestimmt, daß Herzog Heinrich in den Wendenlanden jenseits der Elbe den neu zu gründenden Kirchen Verleihungen von Reichsgütern machen könnte, und daß die von ihm eingesetzten Bischöfe allemal von der Hand des Herzogs als von der des Königs (Kaisers) zu nehmen hätten, was königlichen Rechtes sei (S. 75). Das Recht den Bischof zu wählen nahmen die Wendenfürsten zwar noch bis 1195 in Anspruch, im übrigen war aber der Schweriner Bischof von ihnen wie von den Grafen von Schwerin völlig unabhängig, da er sein Bisthum als dos ecclesiae erhielt und mit dem "Reichsgut" cum omni integritate et utilitate nunc et in postmodum profutura sine aliqua exceptione investirt wurde.
Wenn nun dies alles der Ordnung und dem Gebrauch gemäß war, und wenn auch die übrigen Bischöfe des Reichs als von der benachbarten Landeshoheit unabhängige Reichsfürsten in ihren Stiftern regierten, ohne daß ihnen dies ihr Recht angefochten wurde, und wenn selbstverständlich die staatsrechtliche Stellung des Bischofs sich in den säcularisirten Stiftern, wie Ratzeburg und Lübek, ohne Widerspruch auf die protestantischen Administratoren als deren Nachfolger vererbte: so sollte man denken, daß man auch dem Administrator des Stifts Schwerin seine Reichsstandschaft nicht hätte bestreiten können. Thatsächlich ist es aber doch geschehen. Und gerade der erste Administrator, Herzog Ulrich von Meklenburg, verfocht während der ganzen Zeit seiner langen Regierung mit großem Eifer und großer Ausdauer die Behauptung, daß das Stift Schwerin nicht reichsunmittelbar sei. Seine Gegner waren in diesem Streite außer dem Reichsfiscal besonders die Stiftsstände und unter diesen wiederum vor allen die Capitularen. Aber auch nach dem Tode Ulrichs von Meklenburg war diese Streitfrage eine offene, indem die nachfolgenden Herzoge von Meklenburg gleich wie er die Abhängigkeit des Stifts von ihren Herzogthümern zu behaupten suchten.


|
Seite 105 |




|
Unbedingt ist der Streit um die Stellung des Stifts zum Reich und zu Meklenburg mit der anziehendste und wichtigste Theil der Stiftsgeschichte, und gerade dieser Zeit ist schon längst in ausführlicher Weise behandelt in der 1741 anonym erschienenen Schrift: "Historische Nachricht von der Verfassung des Fürstenthums Schwerin besonders in Politicis", und in Rudloff's d. ä. "Verhältniß zwischen dem Herzogthum Meklenburg und dem Bisthum Schwerin" (1774). Erfreulich ist es nun zwar für den Verfasser der Geschichte des evangelischen Stifts Schwerin nicht, bekennen zu müssen, daß er die bedeutendste Frage dieser Zeit schon gelöst vorgefunden hat; aber darum darf er doch das ganze Capitel nicht übergehen und auf die Vorarbeiten verweisen. Die Vollständigkeit der Darstellung schon erlaubt das sicher nicht. Nun ist aber auch in beiden genannten Schriften das ganze vorhandene Actenmaterial nicht benutzt, und außerdem kommt es deren Verfassern nicht so sehr auf die historische Entwicklung dieses Streites, die gerade unser Interesse vorwiegend in Anspruch nimmt, als auf die rechtliche Widerlegung der Behauptung an, daß das Stift von Meklenburg abhängig sei. Wir gehen also neben ihnen unsern eigenen Weg, freilich in dem Bewußtsein, daß wir mit ihnen ungefähr zu demselben Ziele gelangen werden.
Vorerst noch darzuthun, welche staatsrechtliche Stellung das Stiftsoberhaupt während der 400 Jahre des Katholicismus einnahm, würde nicht nur zu umständlich und weitläufig für unsre Zwecke sein, sondern scheint uns bis auf wenige orientirende Daten auch völlig überflüssig. Wir beschränken uns daher auf das Nothwendigste.
Soviel muß man einräumen, daß die Bischöfe von Schwerin, obwohl sie officielle Einladungen zum Reichstage bekamen, nachweislich - wenigstens ist es bis jetzt nicht nachgewiesen - niemals thatsächlich einen Sitz auf der Fürstenbank des Reichs eingenommen und also niemals ihr votum virile ausgeübt haben. Aber das thaten auch viele andere Reichsfürsten nie, und trotzdem behielten sie diese Rechte. Dagegen steht aber ganz fest, daß das Stift Schwerin ebenso wie die übrigen reichsunmittelbaren Staaten in den Matrikeln des Reichs und des Kreises nicht überschlagen wurde. 1 ) Beispielsweise wurde das Stift in der Matrikel von 1464 und 1467 (Archivacten über Reichsanlagen und=Steuern; Lünig, Reichsarchiv II, S. 83) zu 10 Mann zu Roß und 24 Mann zu Fuß veranschlagt, 1471 dieser Anschlag auf 5 zu Roß


|
Seite 106 |




|
und 7 zu Fuß ermäßigt (L. II, 100), dann 1480 wieder auf 8 zu Roß und 10 zu Fuß (L. II, 116), und nochmals 1481, als das ganze Reich 20,000 Mann stellen sollte, auf 10 zu Roß und 10 zu Fuß erhöht. (Archivacten.) 1 ) Auf dem berühmten Reichstage zu Worms 1521 lautete der Anschlag für Schwerin auf 12 zu Roß und 19 zu Fuß, 1 ) . später (1545) wieder auf 10 zu Roß und 10 zu Fuß. 2 ) Zum Vergleich mag hier angeführt werden, daß die Stifter Lübek seit 1545 5 zu Roß und 0 zu Fuß und Ratzeburg 5 zu Roß und 15 zu Fuß stellten. (L. IV, 448 und Archivacten.)
Daß die Bischöfe sich als Reichsfürsten ansahen und von anderen dafür gehalten wurden, beweisen mehrere Verträge, welche sie mit Landesherren schlossen, z. B. 1319 mit König Erich von Dänemark und Herzog Heinrich von Meklenburg, 1397 mit Herzog Albrecht (König von Schweden) und Herzog Johann von Meklenburg. Nun findet sich aber im hiesigen Hauptarchiv in einer gleichzeitigen Abschrift eine Urkunde Herzog Heinrichs von Meklenburg vom Jahre 1468 (13. Septbr.), welche wohl geeignet ist, den Glauben zu erwecken, daß die Bischöfe bereits in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihre Selbständigkeit wenigstens theilweise verloren hatten. Es handelte sich damals um eine Hülfe, welche der Bischof Werner dem Herzog in seiner Fehde mit Pommern=Stettin leisten sollte. Der Bischof sah durch die Heeresfolge seine Einnahmen aus Pommern gefährdet und hatte deshalb um Erlaß dieser Verpflichtung gebeten, welcher ihm auch gewährt wurde. Die darüber ausgestellte Urkunde enthält den Satz: alse vns denne de erwerdighen heren vnde vedere biscope tor tiid wesende vnser kerken Swerin mit mandenste vorplichtet sint, vns natoridende vnde volghende, wanner vns dat van noeden is, - - darvmme hebben wii deme gnanten heren Wernere vnde den sinen de tiid sines leuendes sodanes denstes vmme sundergher gunst vnde gnade vnde andere denste vnde welker ghifte vnde schenke willen - - - degher vnde all vordreghen vnde vorlaten vnde ene vnde de sinen gnedichliken mede ouergesehn. 3 ) Das sind nicht Worte, wie sie in Verträgen zwischen einander nebengeordneten Reichsfürsten üblich


|
Seite 107 |




|
sind, das ist vielmehr die Sprache eines Lehnsherrn seinem Vasallen gegenüber. Es kann uns daher auch nicht mehr wundern, wenn 1494 die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg von der Stadt Bützow einen Beitrag zur Kaiserbede forderten. 1 ) Daß sie ihn aber erhalten haben, ist mindestens zweifelhaft, da Bischof Petrus entschiedene Einsprache erhob. Nicht mehr so ganz sicher fühlte sich derselbe Bischof, als die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg 1510 und die folgenden Jahre gleichfalls Kaiserbede und Fräuleinsteuer aus dem Stift verlangten. Er behauptete nur, daß er von einer solchen Verpflichtung seines Bisthums nichts wisse, sich aber darnach erkundigen wolle. Die Herzoge bedrängten nun den Bischof mehr und mehr, und derselbe ließ sich endlich, obgleich er noch bestritt, daß das Stift früher Landbede an Meklenburg gezahlt habe, zu dem am Tage Silvestri Papae (31. Dec.) 1514 zu Schwerin geschlossenen Vertrage 2 ) herbei, nach welchem, vorbehältlich beiderseitiger Rechte,
1) das Stift jedesmal zur meklenburgischen Landsteuer 500 Mark Lüb. als Schutzgeld zahlen soll,
2) Meklenburg dafür alle Verpflichtungen des Stifts dem Reich gegenüber auf sich nimmt.
Nun ging es schrittweise weiter. 1526 lud Herzog Albrecht die Stadt Bützow zum meklenburgischen Landtage auf der Sagsdorfer Brücke ein. Das Stift ließ dem Herzog durch Professor Conrad Pegel entgegnen, das sei wider alle Gewohnheit; wohl habe der Bischof aber dessen Stellvertreter an der meklenburgischen Ständeversammlung auf der Sagsdorfer Brücke wegen des Stifts Theil genommen, aber die Stiftsstände seien nie dazu gefordert. Wie man den Streit löste, ist aus den Acten nicht zu ersehen; doch darf man nach den späteren Vorgängen annehmen, daß Bützow der Aufforderung nicht Folge leistete.
Das Verhältniß des Stifts zum Reich und zu Meklenburg immer unklarer erscheinen zu lassen, war nun die Regierung des Bischofs Magnus (postulirt 1516, Bischof 1532 - 1550), der ein Sohn des meklenburgischen Herzogs Heinrich des Friedfertigen war, vor allem schuld. Schon als meklenburgischer Prinz kümmerte Magnus sich weniger um das Ansehen des kleinen Ländchens, als um die Macht seines eigenen Heimathslandes. Und da während


|
Seite 108 |




|
seiner Minderjährigkeit sein Vater als Vormund auch im Stift die Regierung führte, und während dieser Zeit alle Gefälle und Einkünfte aus dem Stift ebenso wie aus dem Herzogthum Meklenburg in die fürstliche Kammer Heinrichs flossen 1 ) ,so daß Meklenburg damals völlig, um in der Sprache jener Zeit zu reden, der "ausziehende", das Stift aber der "ausgezogene" Stand wurde: da verwirrten sich die Meinungen auch fachkundiger Leute so sehr, daß später eine große Zahl ehrenhafter Zeugen behaupten konnte, das Stift sei dem Reich gegenüber immer von Meklenburg vertreten und gelte nicht für einen reichsunmittelbaren Stand. Aehnlich war die Ansicht des Bischofs Magnus selbst. Er glaubte, daß durch die von Meklenburg gezahlten Reichsabgaben den Anforderungen des Reichs an das Stift genügt sei, und wollte weiter nichts leisten. Natürlich gerieth er darum aber mit dem Reichsfiscal in Conflict, der ihn bis an sein Ende mit Strafanträgen und Processen verfolgte.
1. Die Regierungszeit Ulrichs I.
Nach solchen Vorgängen trat der entschlossene, thatkräftige Herzog Ulrich von Meklenburg 1550 die Stiftsregierung an. Auch er hielt das Stift für ein Meklenburg incorporirtes Land und setzte darum den von Herzog Magnus ererbten Proceß mit dem Reichsfiscal beim kaiserlichen Kammergericht fort. 2 )
Vorhanden ist eine Quittung aus dem Jahre 1545 über die Leistung der Reichsabgaben von den meklenburgischen Herzogen und im Besonderen auch vom Bischof Herzog Magnus wegen des Stifts Schwerin. Es war also 1545 vom Stift die Reichsanlage gezahlt; aber seitdem wurde von Seiten des Bischofs wieder die Exemtion des Stifts vorgewandt, um die Zahlung zu verweigern. Deshalb brachte denn der Reichsfiscal auf dem Reichstage zu Augsburg 1548 seine Beschwerde wider Magnus vor und erwirkte


|
Seite 109 |




|
dadurch eine Ladung desselben "als vermeintlich unbilligen eximirten Principalen" und wider den Herzog Heinrich von Meklenburg "als vermeintlichen Eximenten" des Bischofs. Der auf demselben Reichstag gefaßte Beschluß der Reichsstände, "daß auch zu völliger Leistung der bewilligten Reichshülfe die Stände, so durch andere ausgezogen, ein jeder seine gebührende Anlage dies Mal selbst zu erlegen oder aber von ihretwegen die ausziehenden Stände dieselbe zu erstatten schuldig sein sollten", ließ den Meklenburgern wenig Hoffnung, daß sie mit ihrem Einspruch durchdringen würden. Jedenfalls aber konnte man eines erreichen, was bei der bedrängten Finanzlage den Angeklagten höchst wichtig war, man konnte Zeit gewinnen. Es scheint auch, als ob der Anwalt Meklenburgs und des Stifts, der Dr. juris Michael (von) Kaden, es sich besonders angelegen sein ließ, die Streitfrage hinzuhalten. Es wurde eine Menge Streitschriften gewechselt. Auf die Ladung folgte die Vollmacht des Anwalts, darauf die petitio articulata des Fiscals, weiter die responsiones cum annexis articulis defensionalibus seu elisivis Herzog Heinrichs, übergeben zu Speier 16. Nov. 1549, die Probationsschrift des Fiscals, die articuli additionales cum petitione der Herzoge, die exceptiones contra praetensos additionales articulos et in eventum responsiones Fiscalis und die dicta testium.
Das alles erlebte freilich Bischof Magnus nicht mehr, und auch Kaden, der auf vielfaches Ermahnen endlich im Jahre 1556 auch die Vollmacht Ulrichs I. beibrachte, gab wie andere Processe auch diesen auf und verlebte (am 13. Juni 1561 erscheint er zuletzt als Anwalt Ulrichs) seine letzten Jahre in Ruhe. Für ihn trat, zuerst 11. Oct. 1561, wieder der Dr. Heinrich Burckhardt als Anwalt der Meklenburger auf.
Auf dem Kreistag zu Halberstadt 1551 brachte als Vertreter Meklenburgs und des Stifts Dr. Hoffmann die Beschwerden seiner Mandanten über die zu hohen Ansätze der Reichsanlagen vor. Dem Stift war 1545, wie schon angegeben, seine Leistung zu der Vertheidigung der Reichsgrenzen auf 10 Mann zu Roß und 10 zu Fuß ermäßigt, aber auch dieser Anforderung zu genügen hielt Ulrich sich nicht verpflichtet. Hoffmann erklärte den Kreisständen, daß das Stift immer als von Meklenburg incorporirt betrachtet sei, daß dasselbe ohne Zweifel für ein "exemt Gliedmaß" gehalten werden müsse, und daß Herzog Ulrich "diesfalls in quasi possessione libera" sich befinde. Zwar würde dies durch den Reichsfiscal bestritten, aber man führe eben deshalb noch den Proceß, und der Herzog hoffe Recht zu behalten. Ohnehin


|
Seite 110 |




|
sei der Anschlag zu groß, da das Stift nur ein armes Land sei "ohne Bergwerk, Weinwachs oder Salzwerk". Die Stifter Brandenburg, Ratzeburg und Schleswig seien geringer angeschlagen als Schwerin, obgleich sie sicher nicht ärmer wären. Andere Stifter hätten nur einen Anschlag auf 5 zu Roß (er meinte damit Lübek, das in der That so niedrig angeschlagen war); daher könne man auf keinen Fall von Schwerin 10 zu Roß und 10 zu Fuß fordern.
Zunächst zahlte man nun diese Abgabe nicht, und bald war man denn auch große Summen schuldig. 1557 betrugen die Rückstände des Stifts Schwerin nach der Rechnung des Kreislegekastens zu Lübek 640 Meißnische Gulden oder 560 Thaler. Im nächsten Jahre erging deshalb eine Mahnung an das Capitel; zugleich forderte man auch das "aufgegebene Geschütz und Munition zu stellen", widrigen Falls man mit einer Klage beim Kaiser und Kammergericht vorgehen werde. Außer diesem Anschlag forderte aber das Reich noch andere Abgaben. Auf dem Reichstage zu Worms 1551 legte man dem Stift auf 4 Jahre eine jährliche Steuer von 37 1/2 Gulden Kammerzieler auf, die in 2 Raten das Jahr, jedes Mal mit 18 Gulden 3 Ort, zu zahlen war. Diese 8 Kammerzieler waren selbst 1561 noch nicht entrichtet, obgleich bis dahin bereits wieder 13 neue Zieler verfallen waren. Die Summe aller fälligen Zieler seit 1548 betrug 608 Gulden. Durch vielfaches Vertrösten auf Zahlungen nur hatte sich der Reichfiscal so lange hinhalten lassen; aber am 20. Oct 1561 erwirkte er doch endlich ein gerichtliches Erkenntniß, daß Herzog Ulrich ungeachtet der vorgebrachten "articulirten Exception Parition thun" solle. Trotzdem wurde nicht gezahlt, ja es restirte selbst schon die 29. Rate: da erst beschloß der Fiscal mit Verkündigung der Execution vorzugehen, damit er die Kammerzieler in der Höhe von 750 Gulden und dazu die "Legationskosten in Frankreich" von 82 Gulden 30 Kreuzern aus dem Stift erhalte.
Da die vielen Beschwerden wegen der Reichsanschläge den Abgeordneten der Reichstage zu lästig wurden, so hatte man schon 1548 beschlossen, daß die Reichsstände ihre Einreden auf den Kreistagen vorbringen sollten. Von hier aus sollten dann die Verhältnisse durch Commissare untersucht und deren Ermittelungen einer Moderations=Commission des Reichs vorgelegt werden. Der Weg bis dahin war aber ein sehr langer und mühsamer; und kam man endlich mit seinen Acten zur Stelle, so fand man die Thür verschlossen, wie wir später sehen werden.


|
Seite 111 |




|
Zu den Kreistagen, die vom Erzstift Magdeburg und dem Herzogthum Braunschweig=Lüneburg als Kreisdirectoren im niedersächsischen Kreise berufen wurden, gingen die Einladungen zur Zeit Ulrichs I. nicht an den Stiftsregenten, sondern an das Schweriner Domcapitel mit der Aufforderung, "die Seinigen, mit genugsamer Instruction versehen, zu schicken." Das Capitel schickte aber niemand; es bat Herzog Ulrich, der doch schon als Herzog von Meklenburg seine Abgeordneten sandte, um Vertretung: "Dieweil denn E. F. G. diesfalls derselben Domcapitel pflegen in Gnaden zu vertreten, als zweifeln wir nicht, E. F. G. werden dasjenige, was sich derselben Stifts und Capitels halben hierin zu beschaffen gebührt, auch anzuordnen wissen." Das Capitel wurde also im 16. Jahrhundert als ein Kreisstand geachtet; es hieß darum auch ausdrücklich in dem Kreisausschreiben: Euch und die andern Stände dieses löblichen niedersächsischen Kreises." 1589 meinte Herzog Ulrich sogar, daß das Capitel den letzten Kreistag selbst beschickt habe, aber seine Ansicht war doch wohl irrig.
Die Lage des Stifts bei der Menge der sich noch jährlich mehrenden Reichsschulden war freilich keineswegs beneidenswerth; es ist daher auch begreiflich genug, daß Herzog Ulrich es sich angelegen sein ließ, ein Erkenntniß des Reichskammergerichts zu erhalten, welches das Stift für incorporirt erklärte und ihn von allen Zahlungen befreite. Die übrigen Herzoge von Meklenburg unterstützten ihn, zwar aus andern Gründen, thatkräftig genug. 1557 hatte man in dieser Angelegenheit im Hause des meklenburgischen Kanzlers Johann von Lucka auf Befehl Herzog Johann Albrechts wider das Vorgehen des Reichsfiscals das Instrumentum appellationis an das Kammergericht verfertigen lassen und dieses mit 61 Rthlrn. an Dr. von Kaden nach Speier geschickt. Es kam auch wirklich nicht gar lange darauf die Einladung zum Termin. Unterm 15. April 1561 wurde Herzog Ulrich ad mandatum imperatoris auf den 1. Juli desselben Jahres nach Speier citirt. Das Urtheil wurde am 21. October 1561 publicirt, es war in possessorio erkannt und lautete 1 ): "In Sachen kais. Fiscals, Klägers, wider Herrn Heinrich und Herrn Johann Albrecht, Herzoge zu Meklenburg, exemtionis, ist allem Vorbringen nach zu Recht erkannt, daß die Beklagte das Stift und Bisthum Schwerin als einen sonderbaren Stand des Heil. Reichs bis zu Erörterung des petitorii an allen specificirten, seit der Zeit der Rechtfertigung bis hieher rückständigen Zielen und Reichsanschlägen, auch künf=


|
Seite 112 |




|
tigen Reichshülfen, zu vertreten und zu bezahlen schuldig seien bei Pön" u. s. w. Ulrich protestirte zwar 1562 durch seinen Anwalt gegen dies Erkenntniß, im Besondern dagegen, daß das Stift bis zur Erörterung des noch streitigen petitorii als ein sonderbarer Stand des Reichs gelten solle; doch hatte er anscheinend selbst wenig Hoffnung, mit seinem Protest etwas zu erreichen, da er von jetzt an das Stift durch Einberufung der Stiftsstände nach Bützow und durch gesondertes Einsammeln der Contribution als ein setbständiges Reichsland behandelte. 1 ) Sofort suchte Herzog Ulrich auch den meklenburgischen Amtleuten das Erheben von Steuern im Stift zu verwehren. 1562 schon erklärte er den Beamten zu Bukow: Früher hätten zwar die Stiftsleute an Meklenburg gesteuert, da man das Stift für incorporirt gehalten; im vorigen Sommer sei aber dasselbe durch Urtheil des Kammergerichts ein "sonderbarer Reichsstand" geworden, der selbst seine Steuern zu zahlen habe. Es habe nun aber Herzog Johann Albrecht zugesagt, er wolle auf dem jetzigen Reichstag zu Frankfurt, wohin er selbst gereist sei, dafür wirken, daß das Stift als incorporirt anerkannt werde; bis zur Wiederkehr des Herzogs möchten sie daher gegen die Stiftsunterthanen nichts unternehmen.
Am 4. Juli 1562 eröffnete Ulrich zu Bützow seinen ersten Stiftstag. Er machte die Stände mit dem Urtheil des Kammergerichts bekannt, das in possessorio ergangen sei, weil das Reich glaube wegen der Hebungen aus dem Stift "im Besitz und Posseß" zu sein, da dasselbe vor 14 Jahren (1548) als ein "sonderbarer Stand" Reichsanlagen gegeben habe. Die ganze Summe der Forderungen, der alten und der neuen, betrug 2430 Gulden schwerer Münze (1 G.=16 Batzen). Die Stände gingen natürlich ungern auf diese hohe Forderung ein; sie fanden sich aber endlich bereit, obwohl sie meinten, daß die Reichssteuer von des Bischofs Tafelgeldern gezahlt werden müsse, auf Martini für die Hufe 2 Mark Lüb. und für das städtische Haus 1 Gulden zu zahlen, wenn Ulrich ihnen einen Revers ausstellen wolle, daß sie künftig mit diesen Abgaben verschont blieben. Ulrich nahm das Anerbieten an und stellte am 13. Februar 1563 den Revers aus.
Um die Beschwerden des Stifts besser beurtheilen zu können, beschloß man eine Commission zu erwählen, welche durch ein umfängliches Zeugenverhör und durch Inspection schriftlicher Urkunden die Wahrheit ermittetn sollte. Der meklenburgische und Stiftsanwalt Dr. Burckhardt schlug als Reichscommissare das Dom=


|
Seite 113 |




|
capitel zu Havelberg und den Magistrat zu Stralsund vor, das Kammergericht nahm beide an und ernannte seinerseits noch den Dr. jur. Langenbeck zu Hamburg, welcher ex officio ad instantiam fiscalis den Commissaren beigeordnet wurde. Nun beeilten sich beide Parteien, ihre Beweisstücke und Frageartikel der Commission zu übermitteln. Der Fiscal des Kammergerichts Dr. Vollandt suchte darzuthun, daß die Bischöfe von Schwerin in früherer Zeit immer als Reichsfürsten gegolten, daß sie sich erst später in den besonderen Schutz der Herzoge von Meklenburg begeben, und daß dann diese allmählich sich Hoheitsrechte über das Stift angemaßt hätten. Als Anwalt Meklenburgs und des Stifts war Dr. Bouke thätig. Er sollte selbst nach Stralsund reisen, um vor dem dortigen Magistrat seine Mandanten zu vertreten; da ihn aber "Leibesschwachheit" daran hinderte, so schickte er seine Beweisstücke mit einem langen Schreiben nach Stralsund ab.
Nun luden die Commissare die Zeugen zum Verhör ein, welches am 10. Mai 1563 auf dem Rathhause zu Güstrow stattfand. Der Dr. Vollandt hatte als Vertreter des Reichs den Notar und Rechenmeister Magister Thomas Fischer zu Rostock deputirt mit der Befugniß, nöthigenfalls einen andern für sich schicken zu dürfen. Fischer machte von dieser Befugniß Gebrauch und substituirte den Notar Christoph Lewenstein. Der Vertreter der Herzoge, Dr. Bouke, nahm aber den Notar Lewenstein nicht an, "da der substituens Fischer eine anrüchige Person sei, und auch Lewenstein früher als herzoglich meklenburgischer Einspänniger wegen verdächtiger Sachen aus seinem Dienste hätte entlassen werden müssen. Die Commission wählte endlich, um vorwärts zu kommen, den Stadtschreiber Martin Probst zu Güstrow. Die Namen der Commissare hat Verfasser nicht vollständig ermitteln können; ob aus Havelberg ein Domherr kam, ist ungewiß. aus Stralsund sollte der Bürgermeister Dr. Nic. Gentzkow geschickt werden, und wahrscheinlich wird er gekommen sein. Als Notar fungirte der Stralsunder "Mitrathsfreund und Secretär" Bartholomäus Zastrow.
Die geladenen Zeugen waren alle bis auf zwei erschienen und wurden in folgender Reihenfolge verhört: 1) Kurd von der Lühe (70 Jahre alt), 2) Hartwig von Bülow auf Pokrent (70 J.), 3) Hans Sperling auf Rüting (63 od. 64 J.), 4) Professor Mag. Konrad Pegel zu Rostock (70 J.), 5) Gregor Dethlef, früher Präceptor zu Tönnieshof (Tempzin), jetzt (verheirathet) zu Rostock (69 J.), 6) Heinrich Gültzow, Wandschneider, früher Bürgermeister zu Rostock (74 J.), 7) Tönnies Preen, Edelmann zu Wismar


|
Seite 114 |




|
(60 J.), 8) Brauer Peter Zander zu Schwerin (67 J.), 9) Bürgermeister Eitel Schencke zu Neubrandenburg (55 J. alt, "98,000 Fl. reich"), 10) Bürger Heinr. Aelkopf zu Wismar, früher Herzog Albrechts Küchenmeister (60 J.), 11) Bürger Urban Lamprecht zu Wismar, zu Herzog Heinrichs Zeit in der Kanzlei angestellt (55 J.), 12) Bürger Jacob Eger zu Schwerin (50 J.). Die beiden nicht erschienenen Zeugen 13) Lütke von Quitzow zu Perleberg (80 J.) und 14) Heinrich von Hahn zu Pleez (80 J.) wurden in ihren Wohnungen verhört.
Die Aussagen der Zeugen erstrecken sich nur über das, was sie selbst erlebt haben konnten, und alle meinen, daß das Stift seit ihrer Lebenszeit ein von Meklenburg abhängiges Land gewesen sei: Die Jurisdiction sei zwar im Stift von den Bischöfen selbst exercirt, aber die Steuer habe Meklenburg erhoben und an das Reich gezahlt. Die Bischöfe wären früher Prälaten Meklenburgs gewesen. Dethlef will die Bischöfe Conrad Loste, Johannes Thun und Petrus Wolckow perpönlich gekannt haben, sie seien immer "gnädige Herren", nie "Fürsten" genannt worden. Pegel weiß, daß Bischof Petrus Wolckow den Freiwerber Herzog Heinrichs bei der Pfalzgräfin gemacht habe.
Der von den Commissaren (auch vom Havelberger Capitel) unterschriebene und untersiegelte rotulus testium wurde am 11. März 1564 verschlossen von Dr. Burckhardt zu Speier übergeben. Ob er aber auch daselbst gelesen worden? Zweifelhaft ist es mindestens. Wir wissen nur, daß der Fiscal noch im Jahre 1564 die Siegel des Rotulus auf ihre Echtheit prüfte. Dann haben wir erst wieder Nachricht aus dem Jahre 1571, wo der Piscal, jedenfalls als Gegenbeweis wider die Zeugenaussagen, die Reichslehnbücher zu Speier vorlegte, um seine Behauptung zu rechtfertigen, daß das Stift Schwerin als reichsunmittelbares Land gelten müsse. Vielleicht kümmerte das hohe Gericht sich auch nicht weiter um diese Beweisstücke; doch versprach dasselbe 1573, diese Bücher auf des Piscals Verlangen wieder zurückzugeben, wenn es statt derer beglaubigte Abschriften bekomme.
Daß neben Herzog Ulrich auch dessen Bruder Johann Albrecht bemüht war, noch nach dem Erkenntniß des Kammergerichts die Oberherrschaft Meklenburgs über das Stift zu beweisen und zur Anerkennung zu bringen, ist actenmäßig erwiesen. 1565 handelte Dr. Jacob Thomingk zu Leipzig, damals einer Reichslegestadt, d. h. einem Ort, an welchem Reichssteuern eingezahlt wurden, im Auftrage des Herzogs Johann Albrecht. Er war damals mit


|
Seite 115 |




|
der Abfassung eines Berichtes "in puncto reductionis" (der Reichsabgaben) "et episcopatus Suerinensis" beschäftigt.
Da man aber endlich einsehen mußte, daß alle Anstrengungen, die Anerkennung der Abhängigkeit des Stifts von Meklenburg und in Folge dessen Abgabenfreiheit dieses Landes zu erlangen, sicher noch auf lange Zeit vergeblich sein würden, so versuchte man auf einem andern Wege wenigstens einen Theil der drückenden Reichsabgaben los zu werden. Man bewarb sich um so eifriger um Moderation. Um Steuerermäßigung zu erhalten, durften die Reichsstaaten sich nach dem Beschluß des Reichstages von 1548, welcher Beschluß im Jahre 1566 erneuert wurde, nicht mehr an diese hohe Versammlung selbst, sondern nur an die Kreistage wenden, welche die Verhältnisse prüfen und dann das gewonnene Material einer eigens dazu eingesetzten Moderations=Commission des Reichs zur Beurtheilung einsenden sollten. Trotzdem versuchte Ulrich noch 1566 auf dem Reichstage zu Augsburg Abminderung seiner Reichsschulden, die auf 3840 Gulden angewachsen waren, zu erlangen. so hoch, hielt er der Versammlung vor, sei kein Reichsstand belegt, daß er mehr als ein ganzes Jahreseinkommen zahlen müßte. Wie erklärlich, war aber seine Mühe hier vergebens, und er zahlte darum zu Leipzig, wenn auch mit Protest.
Nach diesem vergeblichen Bemühen wandte man sich dann an die Kreisvertretung. Auf dem Kreistage zu Halberstadt überreichten die Vertreter Ulrichs: Joachim von Holstein und Dr. Joh. Bouke, am 3. Nov. 1566 die gravamina des Stifts Schwerin, in welchen bewiesen wurde, daß dies Ländchen die hohen Reichsabgaben nicht zu zahlen vermöchte, da dessen große Einnahme aus den Wallfahrten nach dem heiligen Blut in Schwerin ("jährlich etliche viel tausend Gulden") aufgehört habe, da viele neue Kirchendiener angestellt, ein ganzes Consistorium eingesetzt wäre, und die Domschule mehr Lehrer erfordere als früher, da seit 13 oder 14 Jahren die Einkünfte aus Pommern und ebenso aus Meklenburg fast alle ausblieben, und da endlich das Stift auch Meklenburg gegenüber Verpflichtungen erfüllen müßte. Unter diesen Verpflichtungen verstand man die von einigen Stiftsunterthanen geforderten Dienste, meklenburgische Steuern und Landbede, welche man "als ein Mitgliedmaß" zahlen müsse, und die Kostenbeiträge zu den meklenburgischen Gerichtstagen. Die Einnahme im Stift sei so gering, daß Herzog Ulrich jährlich aus seinen Einkünften in Meklenburg zuschießen müsse. Administrator und Capitel bäten daher um eine Entfreiung vom Reichsanschlag auf 15 oder 20 Jahre. Sollte aber unterdeß in dem schwebenden Proceß das Stift für reichs=


|
Seite 116 |




|
unmittelbar endgüttig erklärt werden, so bitte man um eine Herabsetzung des Anschlages bis auf 1/3, denn mehr zu leisten sei das Stift außer Stande.
Damit nun dieser Antrag des Stifts nicht ganz in Vergessenheit gerathe, was derzeit leicht möglich war, brachten die Bevollmächtigten Ulrichs auf dem Kreistage zu Lüneburg 1567 - es waren dieselben wie 1566 - wiederum eine Petition um Moderation ein. Die Begründung derselben war der vom vorigen Jahre gleich; nur behauptete man noch in einem Subscript, daß man einen namhaften Ausfall der Einkünfte habe, seitdem die Wallfahrt nach Sternberg aufgehört habe, denn dahin sei "eine viel größere Wallfahrt und Zulauf gewesen" als nach Schwerin. Die Forderungen waren etwas herabgesetzt: es wurde gebeten, man wolle das Stift auf 15 oder 20 Jahre oder bis zur Entscheidung der Frage über die Reichsunmittelbarkeit nur zu 1/3 des bisherigen Anschlages verpflichten.
Der Kreistag ging dies Mal in der That auf den Antrag ein; denn er bestimmte, daß Ulrich am nächsten Montag nach Judica zu Lüneburg den Beweis seiner Behauptungen führen sollte. Diese Frist aber erschien dem Herzog zu kurz, und er bat deshalb um einen späteren Termin, der auch bewilligt wurde. Nun wurde Lübek beauftragt, durch Subdelegirte am Mittwoch nach Palmsonntag zu Wismar ein Zeugenverhör zu halten und urkundliche Beweise entgegenzunehmen. Zur Ueberlieferung der brieflichen Beweisstücke und zur Vertretung des Stifts überhaupt deputirte Herzog Ulrich den Dr. Georg Kummer und den Rentmeister Gabriel Bruckmann. Das Verhör begann unter dem Vorsitz des Lübischen Rathsverwandten Dr. juris Penningbuttel am Nachmittage des 26. März 1567 auf dem Rathhause zu Wismar. Die beiden genannten Vertreter des Stifts wurden vor Beginn der Verhandlungen von dem Vorsitzenden vereidigt. Als Zeugen wurden verhört: der Kirchenstructuar Burchard Schmidt, die Vicare Johann Dieckmann und Christian Vidimer, der Schelfvogt Hans Schmidt, der Superintendent Dr. Wolfgang Peristerus, der Rector der Domschule Mag. Heinrich Timannus, alle zu Schwerin, der Küchenmeister Grammerius zu Bützow, der Stiftsmonitor Jacob Rigemann ebendaselbst und 7 Bauern. Ihre Aussagen waren für Ulrich entschieden günstig, denn alle Zeugen waren von der Zahlungsunfähigkeit des Stifts überzeugt, das mit Abgaben übermäßig belastet sei. 1 )


|
Seite 117 |




|
Ehe aber noch von einer Berücksichtigung der Stiftsbeschwerden und der eben eingeholten Beweise für dieselben die Rede sein konnte, kam dies arme Land in große Verlegenheit, da der Reichsfiscal wieder hartnäckig Zahlung verlangte. Herzog Ulrich sah sich deshalb genötigt d. d. Güstrow, 5. August 1567, schriftlich Protest einzulegen. Aber schon unterm 21. Octbr. desselben Jahres erhielt er aus Speier die Mittheilung, daß wegen der rückständigen 1920 Gulden Reichsschulden, wegen welcher er nach Reichstagsbeschluß schon in die Pön der Acht oder statt deren der Privation gefallen sei, am 39. Tage nach Empfang des Schreibens er selbst oder ein Bevollmächtigter vor dem Kammergericht erscheinen solle, um begründete Einreden vorzubringen oder "um aller Regalien, Privilegien, Freiheiten, Gnaden, Rechte und Gerechtigkeiten, die er vom römischen Reiche habe, privirt zu werden." Noch bevor Ulrich diese Ladung in Händen haben konnte, am 25. Octbr., ließ er unter Leitung des Hofraths Welß durch den Notar Reimann zu Wismar ein Appellations=Instrument an das Reichskammergericht verfertigen, in welchem er sich über das Urtheil des Moderationstages zu Worms, das ihm wieder den alten Anschlag, 10 zu Roß und 10 zu Fuß, auferlegte, auf das Aeußerste beschwerte. Aber Alles war umsonst. Der Abschied des Kammergerichts vom 17. October 1568 verkündete dem Stiftsanwalt Dr. Kirrwangen, daß er innerhalb der erbetenen Frist, die nicht näher bekannt ist, Anzeige der geschehenen Zahlung zu machen habe, widrigenfalls auf ferneres Anrufen des Fiscals ergehen solle, was Rechtes sei. Nun wurden von Stifts wegen 1631 Thlr. gezahlt, aber nicht auf einmal, da Ulrich noch in demselben Jahre gemahnt wurde, den Rest von 640 Gulden zu erlegen.
Als im folgenden Jahre wieder die Reichsanschläge nicht entrichtet waren, verlor der Procurator Dr. Kirrwangen den Muth noch ferner dem Stifte helfen zu können, und Herzog Ulrich mußte den gelehrten Dr. juris Teuber in Wittenberg ersuchen, er möge Kirrwangen Rath ertheilen.


|
Seite 118 |




|
Nicht lange darauf, 1571, war das Stift wieder 9 Römermonate schuldig. Da der Fiscal drängte, suchte man wieder Hülfe beim Kreistage. Deshalb überreichte der bischöfliche Anwalt Joh. von Hagen am 8. Mai zu Lüneburg eine Petition um Moderation. Die subdelegirten Inquisitoren (bischöflich Bremische, lüneburgische und Lübische Abgeordnete) wiesen ihn an, er solle die gravamina und die schriftliche Begründung derselben bald bereit halten, damit sie sogleich nach dem Abschied des Kreistages zu Braunschweig an den Erzbischof von Magdeburg, den ersten Kreisdirector, geschickt werden könnten. v. Hagen reiste daher sofort zu Joach. Wopersnow, um sich von demselben Rath zu holen. Er erhielt die Zusicherung, daß die Briefe und Urkunden bis Ende Mai abgeschrieben sein könnten. Auch ein Zeugenverhör sollte wieder stattfinden, und zwar wieder wie 1566 unter der Leitung Lübeks, das zu dem Zwecke die Zeugen zu ascensionis domini nach Warin forderte. Wismar hatte man auf Wunsch Ulrichs nicht wieder gewählt, weil die Versammlung dort zu theuer geworden war.
Das Verhör begann unter Leitung der beiden Lübischen Rathsherren Franz und Heinrich von Stiten am Freitag, 25. Mai 1571, Morgens 9 Uhr, in der "Sommerstube" der Burg zu Warin. Als Notar fungirte Simon Hennings, und als Bevollmächtigte Ulrichs erschienen der Dekan Joachim Wopersnow, der Domherr Otto Wackerbarth und der Rentmeister Gabriel Bruckmann, Nachmittags kam noch Johann Grammerius hinzu. Zu Zeugen waren berufen: der Vicar Christian Vidimer, der Domherr Georg Hübner, der Superintendent Dr. Peristerus, der Rector Mag. Timann, der Vicar und Domstructuar Schmidt, alle zu Schwerin, der Küchenmeister Hans Möller zu Warin u. a. Das Verhör war am 26. Mai Mittags beendet, und es begann nun die Prüfung der schriftlichen Beweisstücke. Alle Copien wurden mit den vom Secretär Joh. von Hagen vorgelegten Originalien verglichen. Am nächsten Montag mußte der Notar Hennings noch den Vicar Schmidt zu Schwerin verhören, da dieser zu Warin nicht erschienen war.
Der Moderationstag des Reiches war auf Ende Juli zu Frankfurt a. M. bestimmt. Aus jedem Kreise waren 2 Moderatoren erwählt, aus dem niedersächsischen Rath Uden für Magdeburg und Syndicus Lüder für Nordhausen. Im Auftrage des Stifts reiste Dr. Bouke nach Frankfurt. Er war mit Vollmacht und Instruction hinlänglich versehen; aber er konnte doch nichts ausrichten, da unter den vielen Anträgen (41) der des Stifts Schwerin gar nicht vorgenommen, sondern an den am 1. August zu Frankfurt statt=


|
Seite 119 |




|
findenden Deputationstag verwiesen wurde. Hier überreichte nun Bouke eine Petition, in welcher er hervorhob, daß die Moderation mit der fraglichen Exemption nichts zu thun habe. Aber auch der Deputationstag ließ die Stiftssache unerörtert in der Mainzischen Kanzlei liegen.
Auf dem Stiftstage zu Bützow 1576 klagte die Stiftsregierung, daß die Contribution für die vielen Ausgaben nicht mehr ausreiche; in letzter Zeit sei sehr viel Geld vom Reich gefordert: "Kammergerichts=Unterhaltung, Bau=, Wartgeld, behörliche Gegenstände, Hülfe, Expeditionen, Reichs=, Kreistage, Legationen." Dazu habe der Administrator die Kosten der Bewerbung um Moderation allein tragen müssen. Daß aber aus dem Stift mehr aufkommen würde als bisher, war mindestens zweifelhaft, da schon jetzt nicht alle Steuern mehr eingingen. Es blieb also wohl nichts weiter übrig, als noch einmal dem Kreistage mit dem Antrag auf Moderation zu kommen. Und schon im Frühling 1577 sehen wir die Kreisinquisitoren zu Lüneburg wieder mit der Stiftsangelegenheit beschäftigt. Sie versprachen unterm 1. Mai das Actenmaterial zum bevorstehenden Moderationstag (1. Aug.) nach Frankfurt a. M. zu schicken. Neues Material bekamen sie indessen nicht, da Ulrich es verweigerte, fernere Probationen zu geben. Nach Frankfurt sollte wieder Bouke reisen, aber er wollte nicht, da er sich nicht wohl befand. Auch Andere lehnten die Reise ab, wie der Propst Heinrich von der Lühe (auf Thelkow) und der Domherr Otto Wackerbarth. Endlich fand sich Dr. Esaias Hoffmann bereit und reiste ab. Er war in Frankfurt anscheinend sehr thätig; denn überall, wo er Zutritt fand, hielt er um Beschleunigung der Verhandlungen an, ohne indessen dafür mehr als "gute Vertröstungen" zu bekommen. Er meinte daher, "daß dieses ein langsam Werk werden wolle"; er hätte auch ebenso gut behaupten können, daß es vergebliches Bemühen wäre. Denn die Zahl der Anträge war außerordentlich groß, 136 Stände baten um Moderation, und die zum 1. August berufenen Moderatoren waren am 10. August noch nicht einmal vollständig erschienen. so wurde aus der Moderation des Stifts wieder nichts.
Die Forderungen des Reichs wurden aber nicht geringer. Nach der 1576 bewilligten 6jährigen Türkensteuer betrug die Stiftsabgabe jährlich 1600 Gulden, also in 6 Jahren fast 10,000 Gulden. Die ganze Einnahme des Stifts belief sich dagegen nach Angabe der Regierung nur auf 2514 Thlr. 23 ßl. 7 1/2 Pfennig jährlich. Ohne Anleihen ging es lange nicht mehr; aber auch dies Mittel die Schuld zu tilgen konnte keine dauernde Rettung bringen,


|
Seite 120 |




|
sondern endlich nur größere Verlegenheiten bereiten. 1583, als das Stift schon 4000 Gulden schuldig, und vom Reich mit der Acht und poena dupli beim Ausbleiben der Steuern bedroht war, wollte es darum auch nicht anders mehr gehen, als daß man wieder durch Bitte um Moderation (wie gewöhnlich auf 3 zu Roß und 3 zu Fuß) wo möglich, wenn nicht Ermäßigung, so doch Aufschub zu erlangen suchte. Wiederum wurde die alte Klage auf dem Kreistage zu Halberstadt 1583 vorgetragen, wiederum nahm sich diese Versammlung des Stiftes an und bestimmte Bremen, Braunschweig=Lüneburg und Lübek zu Inquisitoren. Diese schrieben auf Antrag des Dr. Heinr. Husanus einen Termin zum Zeugenverhör nach Sternberg aus, zuerst auf den 30. April, an welchem Tage das Verhör wegen des Ausbleibens Vieler unterbleiben mußte, und dann auf den 14. Juni. An diesem Tage erschienen vor den Subdelegirten des Kreises als Zeugen 4 Ratzeburger Domherren (wegen des Vergleichs mit dem Stift daselbst), 11 pommersche Unterthanen (wegen der Einkünfte aus Pommern), ferner Stiftshauptmann Jürgen Wackerbarth, Jürgen von Bülow auf Zibühl, Bürgermeister Peter Rittorff zu Bützow, Secretär Joh. von Hagen zu Bützow und Vicar Christian Videmeier (Vidimer) zu Schwerin. Ihre Aussagen bewiesen, daß das Stift Schwerin seit der Reformation nur geringe Einkünfte hatte, und daß im Besondern Ratzeburg viel besser gestellt sei. Wackerbarth erklärte, daß anderswo die Unterthanen von der Hufe nur 4 Schillinge zahlten, im Stift Schwerin aber 2 Gulden von jeder Hufe gegeben werden müßten; das wäre viel zu hart für die Stiftsbewohner, und doch reichten die Einnahmen dieses Ländchens lange nicht. 1 )
Auch die dies Mal erwachsenen Acten wurden an die Moderations=Commission des Reichs geschickt, natürlich ohne Erfolg; aber durch den Fiscal=Procurator wurde die Stiftsschuld 1584 wenigstens bis auf 1110 Guld. 15 Gr. erlassen. Dies Geld wurde zwar gezahlt; aber damit war nichts gewonnen, denn nun forderte das Reich wieder die ganze rückständige Summe! Die Moderations=Acten von 1583 wurden wiederholt dem Reichstage vor=


|
Seite 121 |




|
gelegt; 1590 waren sie von den Moderatoren noch nicht geöffnet. Unterdessen war die Stiftsschuld wieder auf 8640 Gulden angewachsen. Als nun Herzog Ulrich deshalb von des Kreises wegen gemahnt wurde, erklärte er, es wäre die Frage der Exemption des Stifts noch nicht entschieden, auch habe er keine Antwort auf seine Bitte um Moderation; daher sei er zunächst mit einer Mahnung billig zu verschonen. Aber auf die Mahnung von 1593 konnte er antworten, daß es derselben nicht bedurft habe, da er bereits vor 2 Monaten sein "Gebürniß" wegen des Stiftes Schwerin erlegen lassen, wie die Quittung der Einnahmen ausweise. Ebenso zahlte Ulrich in den nächsten Jahren, jedoch immer cum solita protestatione, wie es in den Contributions=Acten heißt. 1598 und 99 wurden sogar 4690 Thlr. in die Legestädte abgeführt, zu welchem Zwecke man sich freilich 4000 Thlr. (von Andreas Meyer zu Hamburg) leihen mußte. Und immer noch mehrten sich die Anforderungen des Reichs. 1601 verlangte man "eilends" 14 Römermonate in 2 Raten, von denen jeder dem Stifte 70 Thlr. oder 160 Guld. rhein. kostete, und 1603 bewilligte der Reichstag wegen der Türkennoth sogar 86 Monate, in 4 Jahren zu zahlen. Beim Ausbleiben der Zahlung sollte der Fiscal sofort beim Kammergericht auf die Pön der Acht oder auf Privation anhalten, und gegen Herzog Ulrich I. geschah dies auch wieder. Als aber der Befehl zur Verantwortung, datirt vom 23. September 1603, in Meklenburg eintraf, war der mit Zahlungsbefehlen viel verfolgte Stiftsregent bereits zur ewigen Ruhe eingegangen.
53 Jahre hatte Ulrich das Stift beherrscht, und fast während dieser ganzen Zeit hatte er mit dem Reichsfiscal den Prozeß wegen der Exemption des Stifts geführt und mit dem Reichstag, dem Kreistag und der Moderations=Commission sich um die Höhe der Stiftsbeiträge zu den Reichsanlagen gestritten; aber weder der Proceß noch die Moderationsfrage war vor seinem Tode beendet worden. Das waren die herrlichen Zeiten des heiligen römischen Reiches!
2. Die Regierungszeit Ulrichs II. bis zum 30jährigen Kriege.
Mit dem Antritt der Regierung des Administrators Ulrich II., des dänischen Prinzen, änderte sich die Sachlage von Grund auf. Während Ulrich I. mit größter Ausdauer sich für die Anerkennung der Abhängigkeit des Stifts von Meklenburg bemühte, verfocht Ulrich II. von vorne herein mit allem Eifer die Unabhängigkeit


|
Seite 122 |




|
seines neu erworbenen Landes. Der Proceß mit dem Reichsfiscal um die Exemption des Stifts war also nun selbstredend zu Ende, soweit die Herzoge von Meklenburg ihn ruhen ließen; denn zwischen dem Stift und dem Reiche bestand über diese Frage keine Meinungsverschiedenheit mehr. Meklenburg blieb nun zwar nicht ganz unthätig, aber es kümmerte sich auch nicht direct um diese Angelegenheit, sondern suchte nur seine Oberherrschaft über das Stift bei dem Streit um die Abhängigkeit desselben vom meklenburgischen Landgericht zu verfechten, wie wir später sehen werden. Doch der Kampf um die Zahlungen ans Reich wurde von Ulrich II. mit dem Fiscal fortgesetzt.
Ehe wir aber dieses unerquickliche Thema wieder berühren, wollen wir zunächst sehen, wie der neue Stiftsregent sich als deutschen Fürsten einführte.
Unter d. 28. Febr. 1604 erließen die Kreisdirectoren die Einladungen zum Kreistage; für das Stift Schwerin war das Einladungsschreiben nicht mehr, wie nachweisbar noch 1602, an das Domcapitel, sondern an den Administrator gerichtet. Ulrich II. war, als es zu Bützow eintraf, in Dresden, daher nahm es sein Kanzler Erasmus Reutze in Empfang. Reutze schrieb nun sogleich an Ulrich II.: So lange Ulrich I. zugleich Meklenburg und das Stift Schwerin regiert habe, seien an den Stiftsregenten niemals besondere Reichs= und Kreisausschreiben ergangen, "dasselbe habe auch keine Session und Stimme gehalten und gegeben, sondern, was von wegen des Fürstenthums Meklenburg gewilligt und beschlossen sei, das habe auch im Stift müssen gelten und angenommen werden." Jetzt sei es anders. Da dies nun während der Regierung Ulrichs II. der erste Kreistag sei, so möge der Herzog auch Session und Stimme halten und einnehmen als ein besonderer Stand des Reichs und also durch diese Gelegenheit das Stift in "seine uralte Dignität und Hoheit und in die Possession der Frei= und Gerechtigkeit der andern Reichs= und Kreisstände" wieder setzen. Was die Personenfrage beträfe, so würden gewöhnlich Rechtsgelehrte zu Abgeordneten genommen, er (Reutze) wäre aber bis jetzt noch der einzige Rechtsgelehrte im Rathe Ulrichs. Solle er den Kreistag besuchen, so wäre zu erwägen, ob auch einer aus dem Domcapitel mit ihm kommen müsse. Beim ersten Male wäre das wohl wünschenswerth, weil ein Domherr ihn bei der Vertheidigung der Stiftsstimme, wenn diese etwa sollte streitig gemacht werden, bei dessen Sachkenntniß gut unterstützen könnte. Herzog Ulrich möge nun vorläufig zur Instruction mit dem Kurfürsten von Sachsen wegen der Vorlagen correspondiren.


|
Seite 123 |




|
Zugleich richtete Reutze ein Schreiben an das Magdeburger Domcapitel, um dasselbe zu bitten, daß es sich des Stiftsabgeordneten annehme, da dieser zum ersten Male auf dem Kreistage erscheinen würde. Wenn er keine Aussicht habe, von den Kreisständen als Mitglied angenommen zu werden, so solle er lieber vor Eröffnung der Versammlung zurückkehren.
Dem Administrator übersandte er zur Unterschrift 4 Schriftstücke: eine Vollmacht für den Abgeordneten, zwei Briefe an die kreisausschreibenden Stände Magdeburg und Braunschweig und ein Schreiben an Meklenburg, um dessen Zustimmung zu dem Vorhaben zu gewinnen. Ulrich schickte diese Acten unterschrieben zurück, indem er einen ganz kurzen Brief vom 13. April an seinen Kanzler beifügte, um demselben mitzutheilen, daß er damit einverstanden sei, wenn Reutze und der Dekan Heinrich von Bülow zum Kreistag reisten. Das war allerdings in dieser wichtigen Angelegenheit auffallend wenig.
Reutze traf am 6. Mai zum Kreistage in Halberstadt ein und überreichte noch Abends die Briefe an Magdeburg und Braunschweig. Auf den andern Morgen wurde er zur Entgegennahme der Antwort auf das Rathhaus bestellt. Dort erwiderten die Kreisdirectoren, man wolle die Stiftssache allen Kreisständen vortragen, Reutze möchte sich auf eine Stunde gedulden. Nachmittags 2 Uhr erhielt der Stiftskanzler von Magdeburg die Antwort, Meklenburg hätte ein besonderes Recht auf das Stift beansprucht und behaupte, es sei in possessione wegen Ratzeburgs vor dem Stift Schwerin zu sitzen. Aber nach der Kreismatrikel und nach alten Kreisabschieden sei beschlossen, daß das Stift Schwerin nach Lübek und vor Ratzeburg Sitz haben solle, "doch jedem in seinem Rechte ohne Schaden." Reutze nahm den Sitz an mit dem Bemerken, daß er Meklenburg in Bezug auf das Stift Schwerin nichts geständig sei.
Darauf traten die Stände zusammen; Reutze setzte sich nächst Sachsen=Lauenburg. Nach der Eröffnung der Sitzung wiederholte der Magdeburgische Kanzler zuerst den Vergleich der Stände wegen der Session Schwerins, und ebenso wiederholte Reutz seine Protestation.
Somit war also das Stift Schwerin wieder in seine alte Würde als unmittelbarer Reichsstand aufgenommen und eingetreten.
Von den Verhandlungen auf dem Kreistage, der vom 7. bis 13. Mai dauerte, beansprucht unsere Theilnahme am meisten der Antrag Reutzes auf Moderation für das Stift. Er begründete


|
Seite 124 |




|
seinen Antrag damit, daß er erklärte, der Anschlag des Stifts sei so hoch, daß dabei die Stiftsunterthanen zu Grunde gehen müßten. Man möge eifrig betreiben, daß die schon so lange schwebende Angelegenheit endlich beim Reiche entschieden werde. Noch beim Abschied übergab Reutze an die Stände ein Promemoria, welches die Bitte um Hülfe ausspricht, damit die Mainzische Kanzlei endlich (nach etwa 50 Jahren!) die Stifts=Moderation erledige. Bei der Umfrage nach Restanten erklärte Reutze, daß auf Erkundigung bei der meklenburgischen Renterei ihm die Antwort geworden, das Stift Schwerin sei nichts schuldig.
Da Ulrich I. als Herzog von Meklenburg Kreisoberster gewesen war, so mußte nun nach seinem Tode ein Nachfolger in diesem Amte gewählt werden. Vorgeschlagen waren Herzog Heinrich Julius von Braunschweig=Lüneburg, bisher Stellvertreter des Obersten, und Herzog Karl von Meklenburg. Reutze wählte Heinrich Julius, der die Majorität der Stimmen erhielt, Karl wurde dessen Stellvertreter.
Unter den Unterschriften des Kreisabschiedes steht an 10. Stelle, nach Lübek und vor Ratzeburg: "Stift Schwerin, Dr. Erasmus Reutze."
Noch ein paar Male treffen wir den Kanzler Reutze als Vertreter des Stifts auf den Kreistagen, 1615 wurde aber sein Nachfolger, Kanzler und Rath Heinrich Stallmeister, dahin abgeordnet 1 ), 1619 vertrat das Stift Schwerin der lüneburgische Kanzler Erich Heidemann mit, und später, selbst noch zur Zeit Ulrichs III., wurde der stiftische Rath Dr. Theodor Bussius geschickt. Da unter Ulrich III. der König von Dänemark mehr als der Administrator im Stift regierte, so richtete man sich gewöhnlich so ein, daß die von Dänemark bestimmten holsteinischen Gesandten zugleich das Stift Schwerin mit vertraten. Die Unterschrift Schwerins stand stets zwischen den Stiftern Lübek und Ratzeburg.
Mit den Reichsabgaben verhielt es sich aber doch nicht so, wie Reutze auf dem Kreistage 1604 in Folge seiner Erkundigung bei der meklenburgischen Renterei gemeint hatte. Wir haben früher gesehen, daß bald nach dem Tode Ulrichs I. eine gerichtliche Mahnung eintraf, welche noch an den verstorbenen Stiftsregenten gerichtet war. Der Kammerbote brachte die Meldung von dem Ableben Ulrichs I. nach Speier, und dort wurde deshalb sofort das


|
Seite 125 |




|
Schreiben an Ulrich II. adressirt. Es waren nämlich zwei Termine, Jacobi und Weihnacht 1603, nicht gezahlt. Auch vom Kaiser erhielt Ulrich II. ein Schreiben, er möchte die Schuld baldigst, spätestens bis Ostern 1604 abtragen. Jedenfalls geschah dies aber nicht, denn Ulrich wurde bald darauf wegen seiner Reichsschulden zum 30. Juli vor das Kammergericht gefordert, woselbst er sich durch den Advocaten Sigismund Haffner vertreten ließ. Uebrigens zahlte er vorher zu Leipzig 3360 Gulden, wie sein Großvater, mit Protest.
Das Moderationswerk ruhte noch immer; die vom Stift vor bald 40 Jahren eingereichten Beweisstücke lagen noch 1604 uneröffnet zu Speier. Unter d. 16. März 1605 übergab der Fiscal Karl Seiblin an das Kammergericht eine Exceptionsschrift, in welcher er behauptete, daß er eine von Ulrich II. erwähnte Moderation nie gesehen; habe das Stift wirklich einmal Ermäßigung erhalten, so sei das jedenfalls längst wieder geändert, und er müsse daher bis zur gerichtlichen Entscheidung nach dem gewohnten Anschlag die Beiträge fordern.
Als Ulrich II. im Jahre 1605 in Ungarn war und sich bei dieser Gelegenheit persönlich beim Kaiser für das Stift verwandte, schrieb Dr. Ernst Cothmann (unterm 11. Aug.) in dieser Angelegenheit an den Administrator. Er offenbart uns wunderliche Dinge von den Zuständen im Reiche. Bei der Bewerbung des Stifts um Moderation seien zwei Anwälte, Kirrwangen und Niebuhr, eher gestorben, als sie die Attestationen hätten anbringen können. 1595 wußte man gar nicht, wo die Schriften geblieben. Nun wurde Cothmann nach Speier geschickt, um sie zu suchen, und er fand sie endlich bei den Erben Kirrwangens. Aber sie an die rechte Behörde zu bringen, war ihm unmöglich. Er übergab sie daher dem Dr. Kremer zu Speier. Auch Kremer wurde von den Reichsdeputirten abgewiesen, die nach der Behauptung Cothmanns nicht eine einzige Moderationssache erledigten. Cothmann rieth endlich, Ulrich möge sich direct an den Kaiser wenden und sich mit diesem zu vergleichen suchen.
Diesen Rath befolgte der Herzog. Der Kaiser ließ auch wirklich beim Fiscal Erkundigungen einziehen; aber dabei wird es wohl geblieben sein, jedenfalls fand Ulrich II. sich veranlaßt, am 25. April 1606 seinen Antrag beim Kaiser zu wiederholen, indem er zugleich erklärte, er wolle bis zu ausgemachter Sache den halben Anschlag (5 zu R. und 5 zu F.) zahlen. In den nächsten Jahren zahlte er in der That die Hälfte; aber das half ihm wenig, denn das Reich war damit nicht zufrieden, und die Schuld des


|
Seite 126 |




|
Stifts wuchs also ungeheuer an. Im Jahre 1605 z. B., wo 14 Monate, 7 zu Johannis und 7 zu Michaelis, die für das Stift 2 Mal 980 Thlr.=1960 Thlr. betrugen, bewilligt waren, blieb Ulrich von dieser Forderung in einem Jahr schon 980 Thlr. schuldig. So ging es weiter, bis der Fiscal wieder ernster drohte, und man nicht umhin konnte, durch Anleihen die Schuld zu decken. 1611 schrieb Ulrich an den postulirten Erzbischof von Magdeburg, er sei außer Stande, die vom Kaiser geforderten Beiträge zu zahlen, da das Stift wegen der früheren Reichs= und Kreisauflagen so hoch verschuldet und verarmt sei, daß die Stiftsstände erklärt hätten, sie wüßten im Geringsten keinen Rath mehr zu finden. Er erhielt die Antwort, die Beschlüsse seien per majora gefaßt, und Keiner würde sich deshalb weigern dürfen zu zahlen, 1615 wurde auf dem niedersächsischen Kreistag beschlossen, daß jeder Stand sein Contingent selbst stellen sollte, von dem ganzen Kreise wurden 500 zu Roß und 3000 zu Fuß gefordert. Das war wohl eine Abwechselung, eine Erleichterung keineswegs. So wurde die Noth immer größer und das Drängen des Fiscal immer härter. Wir dürfen es wohl unterlassen, diese Zustände noch für die späteren Jahre näher zu beleuchten. Nur möchten wir noch mittheilen, daß selbst 1623 die aus der Zeit Ulrichs I. herstammende Reichsschuld noch nicht gezahlt war, und daß, wie es sich aber von selbst versteht, das Stift niemals Moderation erhielt.
Als Ulrich II. gestorben war, gingen die Einladungen zu den Kreistagen wieder an das Domcapitel, vielleicht weil man nicht recht wußte, wer im Stifte regierte.
Was die Stellung des Stifts zu den Reichstagen betrifft, so müssen wir bekennen, daß wir hierüber wenig Nachricht haben. Als Ulrich I. regierte, bekam das Stift wohl kaum eine besondere Einladung zu denselben. Ulrich II. wurde zuerst zu dem auf den 24. April 1613 anberaumten Reichstag "als ein Fürst und Stand des Reichs ordentlich mit beschrieben." Er deputirte für sein Stift den braunschweig=lüneburgischen Abgeordneten Dr. Erich Heidemann; dieser wurde aber wie alle Gesandten aus protestantischen geistlichen Stiftern von den katholischen Reichsständen nicht angenommen. (Rudloff, Verhältniß des Stifts zu Meklenburg S. 94.) In den Archivacten haben wir außerdem noch eine Mittheilung, sie findet sich unter den Reichstagsacten, die Meklenburg betreffen. Nach derselben lief 1614 ein kaiserliches Einladungsschreiben zum Reichstag, der am 1. Febr. 1615 eröffnet werden sollte, zu Bützow ein mit der Adresse: "Dem Ehrwürdigen Unsern lieben Andächtigen N. Bischof zu Schwerin." Man wußte also in der kaiserlichen Kanzlei


|
Seite 127 |




|
nicht einmal den Namen des Stiftsregenten, nachdem derselbe schon 11 Jahre in diesem Lande geherrscht hatte. Ulrich II. gab auf diese Einladung wiederum dem Dr. Heidemann Vollmacht und Instruction; dies Mal ganz vergebens, denn der ausgeschriebene Reichstag fand überhaupt nicht statt.
3. Die Zeit des 30jährigen Krieges.
Als der Aufstand in Böhmen vom Jahre 1618 größere Kreise des deutschen Reiches und sogar zum Theil das Ausland mit auf den Kampfplatz rief, begann man auch im niedersächsischen Kreise sich zu rüsten, um etwaigen feindlichen Einfällen Widerstand leisten zu können. Der Kreisoberste in Niedersachsen war damals Herzog Christian von Braunschweig=Lüneburg. Von diesem erhielt der Administrator des Stifts Schwerin unter d. 17. März 1619 die zweite Aufforderung, sich zum Kampfe bereit zu halten. Herzog Ulrich solle "sich bei der gefährlichen Zeit mit der im Kreise bewilligten Tripelhülfe an gutem geworbenen Kriegsvolk zu Roß und zu Fuß, auch allem, was an Artillerie und sonst dazu gehörig, gefaßt machen und halten", damit bald nach Ostern eine Generalmusterung stattfinden könne. Die Pässe des eigenen Landes solle er mit dem Landvolk wohl besetzen. Er solle stets auf der Hut sein und alle Nachrichten über kriegerische Ereignisse sofort dem Kreisobersten mittheilen. Antwort wurde sofort durch den Ueberbringer des Schreibens erbeten, und Herzog Ulrich gab dieselbe unterm 7. April dahin ab, daß er jeder Zeit mit seinem Volke bereit sein wolle, wie es sich gebühre. Am 21. Mai setzte er nun seinen Lehnsmann Otto v. Flotow (aus Stuer) zum Kriegshauptmann ein; aber das Heer, welches derselbe im Namen Ulrichs commandiren sollte, war noch nicht vorhanden, v. Flotow sollte es erst selbst anwerben. An Sold wurden ihm für den Monat 10 Speciesthaler versprochen. Als der Kanzler Stallmeister am 7. Juni 1619 den nur in Veranlassung der Rüstung berufenen Stiftstag zu Bützow eröffnete, machte er die versammelten Stände damit bekannt, daß in Niedersachsen eine Tripelhülfe 1 ) gefordert würde, deren Musterung schon am 8. Juni, also am nächsten Tage, geschehen solle. Das Stift hätte 15 Pferde geworben und für jedes 10 Speciesthaler gegeben. Der Kreis bewillige als Monatssold für den Reiter 16 Gulden, für den Commandeur 160 Gulden.


|
Seite 128 |




|
Die Stände antworteten durch den Stiftsmarschall v. Vieregge, die für die Pferde ausgelegten 150 Thaler sollten auf den Herbst wieder erstattet werden. Die nächsten Monatszahlungen möge der Herzog nur auslegen. Uebrigens sei die Rüstung nicht so eilig, da man sehe, daß in Meklenburg noch garnichts gethan werde. Der Stiftstag war damit wieder zu Ende und konnte noch am 7. Juni geschlossen werden.
Ueber die Rüstung erfahren wir weiter nichts; auf den Stiftstagen der nächsten Jahre wird nur mitgetheilt, daß wegen der kriegerischen Ereignisse höhere Contribution nöthig sei.
Auf dem Kreistage zu Braunschweig, der am 26. Jan. 1623 eröffnet wurde, bildete die Hauptvorlage die Berathung über die Vertheidigung des Kreises "gegen das andringende Kriegsvolk". Der Schwerinsche Gesandte Bussius hatte die Weisung erhalten, in dieser Angelegenheit "sich auf die Stimme des Vorsitzenden und insonderheit darauf zu achten, wie die dänisch=holsteinischen Gesandten sich resolviren" würden. Es wurde eine triplicirte Tripelhülfe (triplum in triplo) bewilligt, die für das Stift Schwerin 72 Reiter oder, wenn man nicht so viele Pferde stellen konnte, 54 Reiter und 54 Fußknechte betrug 1 ), denn für 1 Reiter zählte man 3 Mann zu Fuß. Bussius, der diese Forderung am 10. Februar dem Administrator schriftlich mittheilte, meinte, es würde in Betreff der Kosten gleich sein, ob das Stift lauter Reiter oder Reiter und Fußknechte stellte. Das Monatsgeld wäre in beiden Fällen ganz gleich, bei der Reiterei käme aber der Anritt in Betracht, der im 1. Falle 720 Thlr., im 2. Falle 540 Thlr. koste. Nun müßten aber auch wieder den Fußsoldaten Gewehr, Kraut und Loth geliefert werden, welche Gegenstände die Reiter sich selbst anschafften; daher würden auch selbst beim Anritt beide Arten von Rüstung gleich theuer werden. Die Lüneburg=Zelleschen Kreistagsgesandten hatten noch den besonderen Auftrag, Herzog Ulrich von Schwerin das Commando über 1000 Pferde anzubieten; wir wissen aus den späteren Vorgängen, daß Ulrich dies Commando nicht annahm.
Mit bemerkenswerther Eile berief der Herzog Ulrich die Stiftsstände auf den 10. März 1623 nach Bützow; aber die meisten derselben blieben ohne Entschuldigung aus, als ob sie nichts Gutes ahnten, und die Sitzung mußte bis auf den 7. April vertagt werden. Da erst konnte der Regierungs=Commissar den


|
Seite 129 |




|
Ständen die Mittheilung von den außerordentlichen Forderungen des Kreises machen. Zunächst seien die Kosten zu tragen für das triplum triplicatum, das für den Anritt 72 X 10=720 Thlr. und an Monatsgeld 72 X 12=864 Thlr. betrüge. Außer diesem triplum in triplo sollte aber noch halb so viel Mannschaft als Nachschub bereit gehalten werden, und wenn auch das nicht genügte, sollte der zehnte, ja selbst der fünfte Mann zur Vertheidigung des Vaterlandes gebraucht werden; deshalb habe sich Jeder stets bereit zu halten. Mit Angst und Zagen hörten die Stände diese Verkündigung. Woher sollte das verarmte Land die Mittel nehmen? In etwas beruhigte allerdings der patriotische Beschluß des Kreistages, der ebenfalls mitgetheilt wurde, daß nämlich, "damit die Armen nicht den größten Theil der Last tragen müßten, Alle, Geistliche und Weltliche, selbst die Kreisfürsten von allen Gütern, Kleidern, Kleinodien u. s. w. den 50sten Theil zahlen sollten, und dabei wolle man des Adels und der reisigen Knechte Pferde, Geschütze, Harnische, Pulver u. a. nicht rechnen. Und zur Ehre des Stifts sei es gesagt, daß weder Fürst noch Stände dieses kleinen Landes an patriotischem Eifer hinter den hochherzigen Entschlüssen des Kreises zurückblieben. Ulrich hatte bereits auf eigene Gefahr hin 7000 Gulden für die ersten Bedürfnisse aufgeliehen, die Stände übernahmen diese Anleihe willig als Landeschuld und stellten am 10. April die Obligation aus, auch bewilligten sie außerdem eine Anleihe von 2000 Gulden. Zur allmählichen Tilgung der Schuld sollte von jetzt an die Contribution vierfach gezahlt werden, das machte für den Roßdienst 30 Thlr., für 1 Hufe 2 Thlr. Dagegen baten die Stände, der Herzog möge die Reserve, das 1/2 triplum in triplo, zunächst noch nicht ausrüsten, und diese Bitte wurde unter der Bedingung gewährt, daß man sich wolle "männiglich in Bereitschaft halten, mit Gut und Blut und allem Vermögen zu fürstoßenden Ungelegenheiten zu treten." Die ganze Verhandlung ging in Folge des willigen Zugeständnisses der Stände so rasch von Statten, daß der Abschied des Stiftstages noch an demselben Tage, 7. April, erfolgte.
Aber der gute Wille allein konnte doch nicht genügen, und die Kräfte fehlten. Die bewilligte hohe Contribution ging nur theilweise ein, die Anleihe reichte nicht aus, und an dem Contingent, das schon im Frühling gemustert werden sollte, fehlten immer noch 32 Reiter; 40 hatte man also zusammengebracht. Daher wurden die Stände zum 6. October wieder nach Bützow berufen, wo sie beschlossen, daß die Contribution sofort gezahlt und, wenn das nicht geschähe, unverweilt Execution verhängt werden sollte.


|
Seite 130 |




|
Das war allerdings leicht gesagt, aber es fragte sich doch sehr, ob die Excecution überall von Wirkung sein würde. Sie war es nicht, wie wir bald sehen werden.
In der äußersten Verlegenheit, in welche die Schulden das Stift gebracht hatten, segnete der Administrator Ulrich II. das Zeitliche, 27. März 1624. sein Tod wurde wohl von Vielen, und zwar aufrichtig bedauert, denn er war ein milder und wohlthätiger Regent; aber wie für ihn selbst, brachte er auch für das Stift eine Erlösung aus großer Noth. Denn bei den unmündigen Jahren des nachfolgenden Administrators Ulrich III. übernahm dessen Vater, König Christian IV. von Dänemark, zunächst das Regiment, und der König hatte wenigstens Mittel zu helfen. Da nun Christian IV., jetzt Kreisoberster in Niederdeutschland, nicht wenig Lust zeigte, im Reiche immer mehr festen Fuß zu gewinnen, so konnte es ihm nicht schwer werden, für das Stift einige Mittel zu wagen; denn mit seiner Hülfe wuchsen billiger Weise seine Ansprüche. In der Hoffnung, dies Ländchen einmal dauernd für sein Haus zu gewinnen, hatte er sicher auch am 15. April 1624 für das Stift den Schutzbrief ausgestellt, und in derselben Hoffnung erbot er sich gleich nach Uebernahme der Regierung zur Deckung der Stiftsschulden große Summen vorzustrecken. Am 20. December 1624 ließ er den zu Bützow versammelten Stiftsständen eröffnen, daß er gegen eine ständische Schuldverschreibung zur Bezahlung der Stiftsschuld, welche damals schon 21,000 Gulden betrug, diese Summe auf ein Jahr leihen wolle. Das Anerbieten schien aber den Rittern, natürlich wegen der ungewöhnlichen Höhe der Anleihe, doch zu bedenklich, und sie weigerten deshalb ihre Unterschrift unter die geforderte Obligation zu setzen, indem sie zugleich behaupteten, daß Capitel und Städte hinlänglich Sicherheit gewähren könnten. Wie es endlich mit der Schuldverschreibung wurde, ist nicht bekannt; doch steht fest, daß der König Geld schickte.
So erfreulich es nun sein mochte, daß durch die Zahlung Dänemarks die erste Noth wieder gekehrt wurde, so unbequem war eine andere Sendung aus demselben Lande, die zu Anfang 1625 eintraf, nämlich 400 Mann dänische Einquartierung. König Christian wollte, daß die Truppen auf das ganze Stift vertheilt würden, aber die Regierung sah die Noth der Bauern und beschloß diese zu verschonen; die 3 Städte sollten die Soldaten allein aufnehmen: Bützow 200, Warin und die Schelfstadt je 100 Mann. Aber die beiden kleinen Städte baten so inständig um Verschonung, daß man schließlich Bützow die ganze Last allein auferlegte, freilich


|
Seite 131 |




|
in der Hoffnung, daß die fremden Völker bald wieder abziehen würden. Das geschah indessen nicht, im Gegentheil meldete König Christian noch eine Compagnie Reiter dazu an. Da berief die Regierung in ihrer Verlegenheit wieder den Stiftstag, der am 11. April zu Bützow eröffnet wurde. Die Stände erklärten hier, daß der königliche Major (Vorbrandt) die Zehrungskosten für dite Bützower Einquartierung zahlen müßte, Adel und Bauern würden ohnehin täglich von durchstreifenden Rotten gebrandschatzt; übrigens wäre es auch im niedersächsischen Kreise nicht gebräuchlich, daß die vom Adel und ihre Bauern mit Einquartierungskosten beschwert würden. Endlich kam man zu dem Beschluß, die Stände sollten für die Einquartierung contribuiren; dem Rittmeister der angemeldeten Reiter wollte man 300 Gulden verehren, damit er vorbeiziehe. Sicher ist aber, daß die Reiter im Stifte blieben. So wurde für die Einquartierung wieder alles durch Contributionen zusammengebrachte Geld verbraucht, und die regelmäßigen Forderungen des Reiches wurden nicht bezahlt.
Als der Kanzler am 23. Febr. 1626 wieder den Stiftstag eröffnete, forderte er: 1) man solle sich zum Roßdienst bereit halten, 2) die Contribution müsse verdoppelt werden, 3) gegen die Säumigen solle sofort mit Execution vorgegangen werden. Die Ritter antworteten auf die erste Proposition, sie wollten mehr thun, als wozu sie verpflichtet wären, und für 1/2 Pferd 2 Pferde bereit halten, dann sollten aber auch die Städte den dritten Mann stellen. Doppelte Steuer bewilligten die Stände nicht, sie schlugen wieder eine Anleihe vor. Schließlich beklagte man sich allgemein über die Saumseligkeit des Capitels, "man möchte wohl dessen gründliche Ursache wissen."
Die Einberufung der Stände geschah jetzt sehr häufig 1626 z. B. fünf Mal, im Februar, im April, zwei Mal im September und ein Mal im December. 1 ) Auf dem ersten Stiftstage im


|
Seite 132 |




|
September wurde die Mittheilung von der Niederlage König Chistians bei Lutter am Barenberge (27. Aug) gemacht, aber auch die andere, daß der Kreis nun noch größere Truppenmassen ausrüsten wollte und deshalb bis zu Ende des Krieges ein triplum in triplo forderte. Außerdem wolle jetzt König Christian das dem Stift geliehene Geld, welches sich auf 9000 Thlr. beliefe, wieder haben. Das hatte der Heereszug Christians dem kleinen Stiftslande eingebracht; freilich war dasselbe auch bei dieser Gelegenheit die Einquartierung, welche mit in den Kampf zog, los geworden, wenn auch nur auf kurze Zeit.
Keiner wußte zu rathen, wie man die geforderten hohen Summen aufbringen könnte; die Contribution zu erhöhen schien unmöglich, und neue Anleihen waren sehr bedenklich, da das Stift außer der dänischen Schuld schon 19,000 Gulden geliehen hatte. Die Stände gingen daher auseinander, um nach nochmaliger Ueberlegung wieder zusammenzutreten und dann Rath zu geben. Es wurde endlich eine hohe Contribution zu Michaelis gefordert, von welcher aber am 8. December noch nichts eingegangen war.
Unterdessen waren auch schon längst die Dänen wieder da. Anfangs October kam der Capitain Schweinitz mit 200 Mann, welche man in den Bützower Amtsdörfern einquartierte, und am 20. November vertheilte man die neu angemeldeten unter Capitain Helmers stehenden 300 Dänen auf Bützow (60 M.), Warin (30), die Schelfe (30), das Domcapitel (30), die bischöflichen Bauern (70) und auf die Ritterschaft (80). Die Schweinitzischen sollten, so hieß es, jetzt wieder abziehen.
Als diese Einquartierung kam, verließen die Domherren das Land und suchten sich größtentheils Wohnungen in Lübek. Von dort aus beklagten sie sich bitter über die Verwüstungen der Dänen in ihren Stiftsgütern, indem sie bei Herzog Adolf Friedrich von Meklenburg Schutz suchten. Ihre Klagen betreffen ausschließlich das willkürliche, rücksichtslose Betragen der Soldaten, das in damaliger Zeit, wie hinlänglich bekannt, gang und gäbe war. Naiv klingt die Beschwerde der Capitularen, daß die fremden Völker "uns unersuchet sich einquartiert" und sogar die Domhöfe belegt hätten. Am 27. April 1627 schrieb Adolf Friedrich den Capitularen, daß "berührtes Kriegsvolk mehrentheils abgeführet und ihren Weg nach der Mark Brandenburg genommen."


|
Seite 133 |




|
Es hatte guten Grund, daß die Dänen Meklenburg räumten; denn sie fürchteten von den anrückenden kaiserlichen Heeren abgeschnitten zu werden. Im Sommer 1627 erschienen schon die Kaiserlichen in Meklenburg, und im Herbst desselben Jahres hatte der kaiserliche Oberst Hans Jürgen von Arnim Bützow besetzt. Die Capitularen baten nun wieder von Lübek aus (6. Oct), Herzog Adolf Friedrich möge doch bei v. Arnim auswirken, daß das Stift wieder frei werde, da es ja nie vom Kaiser abgefallen sei. Sie hatten insofern Recht, als das Stift weiter nichts gethan hatte, als wozu es Mächtigere zwangen; aber es hatte in zu naher Beziehung zu dem Könige von Dänemark gestanden, und das war für den Kaiser ein hinreichender Grund zur Verurtheilung. Nachdem durch die Urkunde vom 9. Januar 1 ) 1628 der Kaiser Ferdinand dem Grafen Wallenstein die Herzogthümer Meklenburg als ein Unterpfand für dessen Forderungen überwiesen hatte, lieferte er ihm unterm 16 Jan. auch das Bisthum Schwerin wie die andern geistlichen Stifter des Landes aus. 2 ) Unter d 1. Juli, nachdem Wallenstein Meklenburg schon in Besitz genommen hatte, gab er seinem Commissarius Heinrich Niemann, der auch bei der Pfandhuldigung der meklenburgischen Stände zugegen gewesen war, Instruction und Vollmacht zur Besitzergreifung im Stift. Er sollte sofort nach Bützow reisen und
1) den Stiftshauptmann Heinrich v. Hagen abdanken und alle übrigen Diener und Unterthanen der Stiftsämter ihrer bisherigen Eidespflichten entbinden, an Stelle v. Hagens aber den Ulrich v. Pentz wieder als Stiftshauptmann einsetzen,
2) die Unterthanen Wallenstein huldigen und schwören lassen und dem neuen Stiftshauptmann anweisen,
3) alle Stiftsintraden und alle vorhandenen Vorräthe einziehen,
4) die Aemter mit den nöthigen Dienern bis auf Wallensteins weitere Anweisung und Ratification besetzen,
5) allen Vorrath inventarisiren lassen. Darnach sollte Niemann sich sofort nach Schwerin begeben und daselbst
6) der Capitularen Hofe, Häuser und Ackerwerke, besonders auf der Schelfe, zu Rampe, Medewege und Warkstorf einziehen und es dort mit der Bestellung der Diener wie zu Bützow halten,


|
Seite 134 |




|
7) das Capitelshaus versiegeln, es wieder eröffnen, die Sachen darin inventarisiren und von da auf das Haus Schwerin transferiren und dort verwahren,
8) an allen Stifts= und Capitelsbesitzungen (Aemtern, Höfen und Häusern) das friedländische Wappen anbringen.
Niemann wird seine Aufträge schon am 2. und 3. Juli in Bützow ausgeführt haben, denn am 4. und 5. kam er nachweislich dem Befehl in Schwerin nach.
Gegen diesen Gewaltact erhob sich kaum Widerspruch. Der Administrator Ulrich III. war wohl vor dem Einmarsche der Kaiserlichen aus dem Stifte gewichen. Seine letzte Regentenhandlung, die nachsweisbar ist, war die schleunige Einberufung des Stiftstages vom 29. Nov. auf den 1. Dec. 1626. In den Lübeker Friedensverhandlungen versuchte wohl Dänemark für alle Fürsten des niedersächsischen Kreises eine "General =Amnestie" zu erwirken, aber der Kaiser wollte davon nichts wissen. Er forderte vielmehr, daß der König von Dänemark alle Rechte, die er oder seine Söhne in Niedersachsen (außer Holstein) und andern Kreisen beanspruchen möchten, aufgebe, und der König willigte endlich in die Bedingung des Friedensschlusses vom 27. Mai (6. Juni 1629), "daß er sich des heil. römischen Reichs Sachen anderer Gestalt nicht, als deroselben wie einem Fürsten und Stand des Reichs wegen des Herzogthums Holstein gebührt, auch der Erz= und Stifter für sich und dero geliebten Herren Söhne, unter was Prätext und Schein ein solches auch sein und geschehen möchte, ferner nicht anmaßen" werde. Nur die Capitularen richteten unterm 11. Juli 1629 eine Vorstellung und Bitte an Wallenstein, worin sie ausführten, daß ihre Curien und Landgüter sequestrirt worden, ohne daß sie als die rechtmäßigen Besitzer zur Vertheidigung citirt seien, daß sie nichts verschuldet, selbst sich zu keiner Consultation gebrauchen lassen, und daß das Stift schon 12 Jahre vor dem Passauer Vertrage reformirt und seitdem von vielen Kaisern bestätigt worden. (Die Behauptung von der kaiserlichen Bestätigung war übrigens nicht wahr.) Wallenstein hätte darum auch wohl nur die jura episcopalia occupiren wollen; er wäre ja selbst Reichsfürst und würde als solcher gewiß die Reichsverfassung respectiren wollen. Mit den übrigen reformirten Stiftern sei so hart nicht verfahren. Daher möge er die Sequestration ihrer Privathöfe und=Curien wieder cassiren, er solle dann bald Ursache haben, sie noch mit mehr Gnade zu favorisiren.
Das Schreiben der Domherren wurde am 13. Juli der Wallensteinschen Regierung vorgelegt, worauf unterm 16. Juli die


|
Seite 135 |




|
Antwort erfolgte: "Nachdem die Sequestration der Domherren Güter und Curien des Stifts Schwerin specialiter et directo ab illustrissimo unserm gn. Fürsten und Herrn anbefohlen sein soll, davon uns das Geringste nicht zukommen, wir auch keine Ursache wissen mögen, warum S. f. g. die sequestration verordnet, als ist uns nicht thunlich, hierin etwas zu unserm Bedenken zu eröffnen, sondern haltens dafür, daß S. f. g. zu dero glücklicher Anheimkunft des Capitels Suchen und Bitten selbst unterthänig müsse fürgebracht werden." Es unterzeichneten die Räthe Dr. Oberbergk, Meier und Dr. Eggebrecht.
Ferner ist ein von Gebhard v. Moltke, dem Rathe Wallensteins, unterschriebenes Memorial vom 30. Juli vorhanden, auf welchem unter andern Angelegenheiten auch der Antrag der Domherren wegen ihrer Güter verzeichnet steht. Dieser Antrag enthält die Randbemerkung: "Abgeschlagen". Ob nun dieser Beschluß des Fürsten dem auf Antwort wartenden Capitels=Syndicus nicht mitgetheilt wurde, oder ob die Capitularen eine etwaige mündliche Mittheilung nicht für eine genügende Antwort hielten, ist aus den Acten nicht ersichtlich; so viel steht aber fest, daß das Capitel unterm 1. Oct. seine Bitte wiederholte, da es bisher von Wallenstein keine Antwort bekommen habe. Die Domherren forderten noch einmal "Restitution ihrer Privatgüter", weil sie, wo nicht ihres Privatvortheils, so doch in Anbetracht ihres dem Stift zu leisteten Eides nicht umhin könnten, "sich dieser Sachen angelegen sein zu lassen."
Den größten Gegner fand das Capitel in der Wallensteinschen Kammer. Als die Capitularen am Dom zu Schwerin ein kaiserliches mandatum avocatorium, von dem weiter nichts berichtet wird, anheften ließen und auch vom Stiftshauptmann v. Pentz verlangten, daß er zu Bützow dasselbe thue, rieth die Kammer, man müsse das mandatum abreißen und dafür das kaiserliche Edict über Wallensteins Belehnung anschlagen. Die Capitularen suchten doch nur sich allmählich wieder einzuschleichen. Es wäre noch ein Capitels=Syndicus und ein Stiftssuperintendent in Schwerin, diese müßten cassirt werden; denn da kein Capitel mehr vorhanden sei, so bedürfe es auch keiner Capitelsbeamten mehr.
Wie Wallenstein selbst über das Verhältniß des Stifts zum Reiche und zu Meklenburg dachte, ist aus den vorhandenen Acten mit Sicherheit nicht zu ersehen, anscheinend hielt er das Land für reichsunmittelbar. Als der Herzog seinen Rath Gebhard v. Moltke 1628 mit den früher im Besitz der Familie von Moltke befindlichen Stiftsdörfern Passin, Bahlen, Parkow und halb Penzin


|
Seite 136 |




|
(s. Beschreibung des Stifts) belehnen wollte, fragte er bei seiner Regierung, seiner Kammer und seinem Hofgericht zu Güstrow an, warum das Stift früher für incorporirt gehalten sei. Die Antwort fiel dahin aus, daß wegen des Vertrages von 1514, nach welchem das Stift zu allen meklenburgischen Contributionen 500 Mark Lüb. beitragen müsse, wegen des vom Herzog Heinrich ausgestellten Schutzbriefes (Hist. Nachricht, Anlage O) das Land für incorporirt zu halten sei, auch gelte im Stifte meklenburgisches Lehnsrecht.
Trotzdem wurden die Stiftslehnsleute und=Stände, das Capitel eingeschlossen, d. d. Güstrow, 18. März 1629 ad mandatum proprium suae celsitudinis auf den 25. April nach Güstrow zu einer Art von Stiftstag berufen. Sie sollten sich Abends zuvor auf der herzoglichen Kanzlei melden und bei Strafe von 30 Thlrn. nicht ausbleiben. Der Zweck des Stiftstages war die Bezahlung der Stistsschuld von 20,000 Gulden, welche das Land aufbringen sollte (Domcapitel 780 G., Amt Bützow 2600, Zibühl 780, Amt Rühn mit Hermannshagen 1296, Amt Warin mit Gallentin 2100, Stadt Bützow 4380, St. Warin 900, die Schelfe 1020, Katelbogen und Moisall 690 Gulden u. s. w.).
Die herzogliche Kammer machte vor Eröffnung der Sitzung darauf aufmerksam, daß die Einladung des "gewesenen" Domcapitels Wallenstein höchst präjudicirlich sei. Dasselbe dürfe nicht als Capitel und die Capitularen ("diese Subjecte") nicht als "Stiftsmembra" anerkannt werden, da sie seit der Occupation schon aus dem Stifte gewichen seien. Nun würden sie um so steifer auf die Restitution ihrer Güter dringen. Das Stift wäre überhaupt von Wallenstein incorporirt nnd ein Gliedmaß Meklenburgs. Ferner könnten sie, die Kammer, nur auf ausdrücklichen Befehl Wallensteins es zulassen, daß auch die Kammergüter (die Domanialämter) mit besteuert würden. Endlich wollte man, daß auch der Rath G. v. Moltke, dem seines Vetters Güter im Stift restituirt wären, mit zum Stiftstage eingeladen würde.
Wie es auf der Versammlung der Stände herging, ist nicht bekannt; nur wird mitgetheilt, daß das Capitel von Lübek aus seinen Syndicus Dr. Wedemann zum Stiftstage schickte, und daß man in die Bezahlung der Schuld willigte.
Bald darauf aber, 6. Juni 1629, wurde Wallenstein statt der Pfandbelehnung das Herzogthum Meklenburg mit den zugehörigen Ländern als erbliches Fürstenthum vom Kaiser verliehen. Das Bisthum Schwerin war von König Christian IV. von Dänemark im Lübeker Frieden vom 12. (22.) Mai desselben Jahres an Meklenburg, d. h.


|
Seite 137 |




|
an Wallenstein, abgetreten. (Raabe, Vaterlandskunde, S. 935.) Seitdem ist von der Selbständigkeit des Stiftes unter Wallensteins Regierung nicht mehr die Rede. Als die meklenburgischen Stände im Januar 1630 nach Güstrow zur Leistung der Erbhuldigung gerufen waren, erhielten auch die Ritterschaft und Städte des Stifts eine Einladung, die Capitularen wurden dieser Ehre aber nicht mehr gewürdigt. Die Stiftsstände fanden es zwar befremdend, daß in der Ladung ihres Landes nicht besonders gedacht, sondern dasselbe nur als Anhängsel von Meklenburg betrachtet war; doch auf die Erklärung des Wallensteinschen Kanzlers, daß sie als Mitglieder der meklenburgischen Stände angesehen werden sollten, weigerten sie sich nicht lange mehr zu erscheinen. Sie versuchten nur noch in Güstrow selbst ihre alten Privilegien zu sichern und baten um Ausschreibung einer Contribution, damit sie von der Bürgschaft für die Stiftsschuld, welche ohne Zinsen auf 12,000 Gulden angewachsen war, befreit würden.
Zur Deputation, die von den Ständen zur Berathschlagung der Huldigungs=Angelegenheit gewählt war, gehörten aus dem Stifte Schwerin die beiden Ritter Jürgen Wackerbarth auf Katelbogen und Moisall und Berthold Parkentin auf Tieplitz. Sicher schwuren auch die Stiftsstände, wie die meklenburgischen Stände, am 22. Jan. 1630 "bei versperrten Thoren mit Soldaten umgeben" (Frank IX, 94) den Erbhuldigungseid für Wallenstein.
Unterdessen war Wallenstein selbst schon aus Meklenburg abgereist, um nie wieder zurückzukehren, und seine Herrschaft war ihrem Ende nahe.
Schon im September 1630 rückte der König Gustav Adolf von Schweden in Meklenburg ein, um dies Land und mit ihm auch das Stift Schwerin von dem Usurpator Wallenstein zu befreien, was ihm mit Hülfe der angestammten meklenburgischen Herzoge im nächsten Jahre größtentheils gelang. Wallenstein befahl zwar noch von Böhmen aus 1631 die Ausführung der Bestimmungen des Lübeker Friedens im Stift, indem er seinem Statthalter Obersten Wingiersky den Auftrag gab, die Stiftsgüter Zibühl und Gallentin dem Könige von Dänemark oder dessen Commissar Daniel Troje einzuräumen und seinem Oberhofmeister Grafen zu Liechtenstein, der von dem Friedländer Zibühl zum Geschenk bekommen hatte, auf andere Weise zu entschädigen; aber abgesehen davon, daß die eignen Beamten des Herzogs diesen Befehl nur mangelhaft und unvollständig ausführten, so daß Troje sich deshalb zweimal beklagte, hatten diese Maßregeln nur eine kurze Dauer. Unterm 16. September 1631 berichtete Troje, daß


|
Seite 138 |




|
die Schweden am 21. Juni 1631 zuerst in Bützow eingerückt seien und seitdem das Stift, besonders die Städte Bützow und Warin, furchtbar verwüsteten. Das war das Ende einer und der Anfang einer andern Fremdherrschaft in diesem Lande.
Die Schweden waren also seit dem 21. Juni in der That in Besitz des Bisthums; aber als rechtmäßigen Regenten sah sich noch immer, wie in der zweiten Abtheilung (der innern Geschichte) mitgetheilt ist, der in der Fremde weilende dänische Prinz Administrator Ulrich III. an, und auch Herzog Adolf Friedrich von Meklenburg suchte jetzt ein Recht an dieses Land geltend zu machen, auf welches er vermöge der Capitulation von 1625, für seinen Sohn Christian ausgestellt, wohl einige Ansprüche machen konnte. Unterm 5. Septbr. 1631 schrieb er an den Domherrn Vollrath v. Plessen, die Capitularen hätten versprochen, ihm 1000 Thlr. zu contribuiren (wohl unter der Voraussicht, daß Adolf Friedrich ihnen ihre Stiftsgüter wieder verschaffe), jetzt brauche er Geld, sie möchten also zahlen; sonst würde er die Capitelsgüter einziehen, die ihm ohnehin jure belli gehörten. Diese Drohung hatte freilich Angesichts der erfolgten Besitzergreifung des Landes durch die Schweden nicht sonderlich viel zu bedeuten, und sicher können wir voraussetzen, daß die vorsichtigen Capitularen nicht zahlten. Aber noch öfter versuchte Herzog Adolf Friedrich als Stiftsregent aufzutreten.
Die Schweden setzten sich indessen im Bewußtsein ihrer Uebermacht schleunigst überall im Stift als die Herren fest und suchten zunächst im wahren Sinne des Worts aus diesem Besitz Capital zu schlagen. Der Feldmarschall Achatius Tott brandschatzte das Stift mit Contributionen auf das Härteste. Von Buxtehude aus erließ er unterm 6. Mai 1632 den Befehl, zur Aufbringung von 1800 Thlrn. Werbungsgelder, da er 3 neue Compagnien aufrichten wollte, welchen vom Stift Löhnung und Quartier gegeben werden sollte. Alle Zahlungen mußten an den Commandanten von Wismar geschehen. Damit aber die erpreßten Gelder ja den richtigen Weg fänden, wurde Heinrich Janeke, ein Meklenburger, unterm 9. Mai 1632 mit einem Gehalt von 30 Thlrn. monatlich zum Inspector des Stifts bestellt. 1 ) Ihm lag speciell die Ueberwachung


|
Seite 139 |




|
der Stiftsintraden und die Ueberführung derselben nach Wismar ob. Nach einem Briefe Jürgen Wackerbarths an Herzog Adolf Friedrich d. d. Rühn 1 ), 18. Mai 1632 wurde Janeke am 14. Mai von dem schwedischen Reichskanzler und General=Kriegscommissar Erich Anderßen mit Vollmacht und Instruction ins Stift geschickt.
Aus eben diesem Schreiben Wackerbarths geht hervor, daß der Herzog Adolf Friedrich glaubte, er würde die Stiftssteuer in Empfang nehmen sollen, wie er auch sonst behauptete, daß er "Ordinanz in Händen" habe, die Steuer im Stift zu dirigiren. Deshalb intervenirte er fortwährend für das Capitel, von dessen Curien in Schwerin die Schweden wider früheren Gebrauch ebenfalls Steuern forderten. Selbstverständlich wollte hierdurch zugleich der meklenburgische Herzog, welcher keine Mühe sparte das Stift zu gewinnen, zu diesem seinem Vorhaben die Capitularen geneigt machen.
Den Bestrebungen Adolf Friedrichs für das Capitel trat aber der Stiftsinspector Janeke mit allem Eifer entgegen. Am 5. Juli 1632 beauftragte er den Pächter von Medewege, Amtmann Caspar Eßlinger, mit dem Einsammeln der Steuern in den Capitelsdörfern und=Häusern und befahl ihm zugleich, dem Syndicus Wedemann, welcher den Besitz der Capitularen vertheidigte, "keine Possession zu gestatten", nöthigen Falls solle er bewaffnete Hülfe zur Abwehr bekommen. Eßlinger schickte denn auch noch im Herbste 1632 dem Syndicus 8 Musquetiere ins Haus.
Das Schicksal des Bisthums lag, wie das anderer Länder Norddeutschlands, damals zumeist in den Händen des schwedischen Geheimen und Kriegsraths Salvius, den der König Gustav Adolf zum General=Commissar in Niedersachsen eingesetzt hatte. Die Herzoge von Meklenburg waren durch den Vertrag mit Gustav Adolf vom 19. (29.) Febr. 1632 vollständig von Schweden abhängig geworden. Bei dieser Sachlage blieb Herzog Adolf Friedrich nichts Anderes übrig, wollte er nicht auf das Stift verzichten, als dem schwedischen Gewalthaber Salvius gute Worte zu geben. Und daran ließ der Herzog es denn auch nicht fehlen. Am 6. Mai 1632 schrieb er an Salvius, es wäre selbst für Schweden besser,


|
Seite 140 |




|
daß das Stift einen gewissen Administrator habe. In der Alliance der Herzoge von Meklenburg mit König Gustav Adolf wäre des Stiftes nicht gedacht, also Verträge hinderten nicht, das Land "um ein Billiges" ihm oder seinen Söhnen zu gönnen. Darauf schickte er seinen Archivar und Lehnssecretär Simon Gabriel zur Nedden mit einem Brief vom 9. Mai an Salvius, um u. a. denselben zu bitten, daß er die Zustimmung des Königs und dessen Kanzlers Oxenstierna zur Ueberlassung des Stifts an des Herzogs ältesten Sohn Christian erwirke. Auch die Capitularen wünschten, daß Prinz Christian Administrator würde. Die Leistungen des Landes für Schweden könnten durch einen Vertrag fest bestimmt werden. Auf diese Weise würden die ewigen Brandschatzungen aufhören, die das Ländchen völlig zu Grunde richteten. Salvius gab zur Nedden schon einige Zusicherungen, und unterm 6. September 1632 vcrkündigte er von Hamburg aus, daß er zwar ohne speciellen Auftrag, aber doch im Namen des Königs von Schweden dem Herzog Adolf Friedrich die Oberinspection des Stifts übertragen habe, damit er dasselbe "der königlichen Kriegskasse und den armen Unterthanen zum Besten" administriren lasse.
Wie es scheint, befriedigte dies Resultat seiner Bemühungen Adolf Friedrich nicht; es war in der That auch peinlich genug für ihn, daß er, der Herzog von Meklenburg, sich von einem schwedischen Beamten zum Oberinspector sollte ernennen lassen und sich somit unter diesen stellen. Der Geh. Rath Hartwig v. Plessen auf Zehna widerrieth dem Herzoge gradezu, diese Art der Administration zu übernehmen. "Denn obwohl", sagte er, "die possessio semper est aurea, so ist doch die ganze Uebertragung nicht legal, und das wird Schaden bringen. Vor allem müssen erst der König von Schweden und die Capitularen zu dem Vorschlag ihre Zustimmung gegeben haben." Adolf Friedrich theilte die Bedenken v. Passow's sofort Salvius mit und fügte hinzu, er wollte lieber, daß anstatt seiner dem Domherrn und herzoglichen Rath Vollrath v. Plessen oder Hartwig v. Passow provisorisch die Administration übertragen werde. Der Rath der Capitularen, welcher in dieser Sache von Adolf Friedrich eingeholt wurde, fiel unbestimmt aus. Die Herren antworteten mit vielen Klagen über die schlechte Wirthschaft im Stift, baten um die Zurückgabe ihrer Landgüter und meinten endlich es wäre erklärlich, daß Adolf Friedrich sich wegen der Postulation seines Sohnes mehr um das Stift kümmern wolle.
Indessen nahm Adolf Friedrich doch zunächst an, was ihm geboten war; unterm 15. October 1632 theilte er dem bisherigen


|
Seite 141 |




|
Stiftsinspector Janeke mit, daß Salvius ihm die Inspection übertragen, wonach Janeke sich zu richten habe. Janeke antwortete, er müsse gröblich bei Salvius verleumdet sein; er wolle aber gern Adolf Friedrich gehorchen.
So standen die Sachen im Stift, als die Nachricht eintraf, daß der Schwedenkönig am 6./16. November 1632 gefallen sei. Der Reichskanzler Oxenstierna übernahm nun, wie bekannt, im Namen der Krone Schwedens die Leitung der schwedischen Angelegenheiten in Deutschland, an ihn mußte sich nun also Adolf Friedrich wenden, um seine Wünsche in Betreff des Stifts erfüllt zu sehen. Er schickte deshalb bald nach Gustavs Adolfs Tode v. Passow an Oxenstierna, damit er um die Bestätigung der Stiftsinspection und um Verhaltungsmaßregeln bitte. Mit Salvius knüpfte er im nächsten Sommer (1633) Unterhandlungen an wegen Ueberlassung des Stiftes gegen eine jährliche Pacht; aber noch ehe diese Verhandlungen zu Stande kamen, erhielt der Herzog (durch den General=Major Lohausen; die Nachricht von dem Tode des rechtmäßigen Stiftsregenten, Administrators Ulrich III. (Vgl. 2. Theil, Administratoren.) Das änderte wieder die ganze Sachlage.
Rechtlich war jetzt in Folge der Capitulation von 1625 der meklenburgische Prinz Christian Administrator im Stift, und für ihn durfte mit ebenso gutem Recht sein Vater Herzog Adolf Friedrich die Regierung antreten. Aber die Schweden befanden sich im Besitz dieses Landes, das ihnen nach ihrer Ansicht jure belli gehörte. Das deutsche Reich war nicht in der Lage, zeigte auch keine Neigung, sich um diese Angelegenheit zu kümmern, und Adolf Friedrich konnte darum nur auf dem Wege gütlicher Verhandlungen mit Schweden zu seinem rechtmäßigen Besitz gelangen, d. h. bittend auf dem Gnadenwege das erhalten, was er von Rechts wegen zu fordern hatte. Der Herzog betrat diesen ihm allein übrig gebliebenen Weg.
Die Hauptentscheidung über das Schicksal des Stiftslandes lag jetzt in den Händen des schwedischen Kanzlers Oxenstierna, und ihn suchte daher auch Adolf Friedrich mit Aufbieten vieler Mühe für sich zu gewinnen. Daß er sich (12. Sept.) an die schwedischen Reichsräthe in Stockholm wandte und um Uebergabe des Bisthums bat, "das die Krone Dänemark zwar nach Tractaten mit dem Kaiser aufgegeben und jetzt die Schweden in Besitz genommen, das diese aber trotzdem aus Rücksicht auf den jungen Herzog Ulrich (den Administrator), welcher für das Evangelium kämpfte, niemals von Dänemark verlangt hätten", erscheint als eine bloße


|
Seite 142 |




|
Formsache gegenüber den Anstrengungen, mit welchen der Herzog sich die Zustimmung des Kanzlers verschaffen mußte. Ebenso war die Begrüßung der Königin von Schweden um das Stift wohl nur eine Höflichkeitsform, die wenigstens nicht schaden konnte.
Zunächst hoffte Adolf Friedrich durch Fremde den gewaltigen Kanzler günstig stimmen zu können; deshalb mußten der Erzbischof Friedrich von Bremen, ein dänischer Prinz und Bruder des verstorbenen Admimstrators Ulrich III., sowie der schwedische Legat Salvius sich für ihn bei demselben verwenden. Beide zeigten sich willfährig genug, aber das Werk ging trotzdem nicht von Statten. Endlich erklärte der Bremer Erzbischof, Oxenstierna habe es übel genommen, daß der Herzog nicht eigne Gesandte an ihn geschickt, und deshalb das Bisthum dem königlichen Stallmeister von der Schulenburg und dessen Erben versprochen, doch nur unter der Bedingung, daß das Land "für ein Stück Geld" wieder an Adolf Friedrich solle abgetreten werden, wenn es verlangt würde. Schulenburg sei indessen schon "ableibig" geworden (gestorben). Dieselbe Nachricht kam bald darauf auch von Chr. Hans v. Bülow, dem Gesandten des Bremer Erzbischofs, aus Lübek, mit dem Zusatz, daß Oxenstierna nach v. d. Schulenburgs Tode den Lehnbrief über das Stift wieder an sich genommen habe. Nun beeilte sich Herzog Adolf Friedrich, Abgeordnete aus Meklenburg an den Kanzler zu senden. Er wählte dazu den Geh. Rath v. Passow auf Zehna und den Kanzler Dietrich Reinking, welche, mit ausführlicher Anweisung wohl versehen, noch im Januar 1634 abreisten. Gern wäre der Herzog selbst mit ihnen gegangen, wie er Salvius schrieb, aber die Herzogin Anna Marie, seine Gemahlin, sowie die junge Prinzessin Juliane waren so bedenklich erkrankt (sie starben beide Anfangs Februar), daß er es nicht wagen durfte, seine Familie zu verlassen.
Aus der Instruction für die Gesandten v. Passow und Reinking, die auch die Art der Anmeldung, Begrüßung, Entschuldigung des späten Eintreffens ausführlich vorschrieb, interessirt uns besonders die Mittheilung, daß der König Gustav Adolf dem Herzoge zu Frankfurt a. M. mündlich Hoffnung auf das Stift gemacht, wie es Oxenstierna selbst gehört habe. Eine "Geheime Post=Instruction" bestimmte:
1) Die Gesandten möchten zunächst zusehen, daß der Herzog das Stift umsonst erhalte, da Meklenburg im Kriege so viel gelitten.
2) Fordere Schweden eine Entschädigung, so sollte ein Regiment zu Fuß, mit dem Mustermonat versehen, angeboten werden;


|
Seite 143 |




|
würde aber Geld verlangt, so solle man aufs Aeußerste handeln und bis 20,000 Thlr. bieten.
3) Müsse man mit Schulenburgs Erben verhandeln, so solle man diesen höchstens ebenso viel bieten; wenn sie darauf aber nicht eingehen wollten, an Adolf Friedrich referiren.
4) Verlange man eine eigne Capitulation, so solle dies ebenfalls ad referendum angenommen werden.
5) Zu Geschenken für die vornehmsten Diener (Secretär und Schreiber) Oxenstiernas seien 3000 Thlr. bestimmt.
6) Wolle man das Stift nur als schwedisches Lehn anbieten, so müßten die Gesandten sofort mit der Post abreisen.
Die erste Nachricht über die Gesandtschaft des Herzogs brachte ein Brief v. Passows d. d. Magdeburg, d. 25. Jan. Man erfuhr, daß Oxenstierna ganz gnädig gewesen, und so nebenbei, daß der Hof Wolken (an den schwedischen Residenten Alexander v. Eßken in Erfurt) verschenkt sei. Am 30. Jan. berichtete v. Passow wieder, daß er dem Marschall Banér ein gutes Pferd versprochen habe, was der Herzog billigte, obgleich er Banér "schon mit Zollbefreiung einer großen Anzahl seines eigenen Korns, so die Elbe hinunter passiret, gratificiret." Am 1. Febr. schrieben v. Passow und Reinking, sie hätten gestern Oxenstierna in Magdeburg gesprochen, derselbe habe sich gegen Adolf Friedrich günstig gezeigt. Heute reise der schwedische Kanzler nach Halberstadt ab, wohin sie ihm folgen würden, denn dort wolle er Resolution geben. Am 9. Febr. würde Oxenstierna mit dem Kurfürsten von Brandenburg in Stendal zusammentreffen, ob der Herzog nicht auch dahin reisen möchte. 1 ) Am 10. Febr. hatte v. Passow wieder eine Unterredung mit Oxenstierna, in welcher das Stift durante hoc bello als Recognition von Schweden angeboten wurde, wie die Stifter Fulda und Hersfeld dem Landgrafen Wilhelm von Hessen gegeben seien. Mehr wollte man nicht bewilligen, damit kein Präjudiz geschaffen würde. v. Passow wies auf das jus quaesitum Meklenburgs hin, dessen sich der Landgraf und Andere nicht rühmen könnten. Auch am nächsten Tage führte die Verhandlung zu keinem Resultat. Am


|
Seite 144 |




|
14. Febr., als v. Passow grade mit dem Schreiben eines Briefes beschäftigt war, der wenig Hoffnung für den Herzog enthielt, kam Salvius persönlich zu dem meklenburgischen Gesandten, um mitzutheilen, daß Oxenstierna jetzt wohl von seinen harten Bedingungen abstehen werde. Vielleicht war dieser Umschlag in Folge einer Unterredung mit dem Kurfürsten von Brandenburg geschehen, denn am 12. oder 13. Febr. reiste Oxenstierna nach v. Passows Bericht nach Stendal, vielleicht auch hatte ihn Salvius bewirkt. Ebenfalls am 14. Febr. schrieb endlich auch der schwedische Kanzler selbst an den Herzog von Meklenburg. Zwar theilte er nichts Genaues mit; doch sagte er, daß er sich gegen die meklenburgischen Gesandten so erklärt habe, daß Adolf Friedrich "darob verhoffentlich ein gutes Contentement haben werde." Der Herzog schöpfte viel Hoffnung aus diesem Brief und antwortete sehr verbindlich. Und wirklich ging es von jetzt an rascher, als man erwarten durfte. Oxenstierna hatte in der That jetzt die Absicht, das Stift außer den schon von Schweden verschenkten Gütern unter annehmbaren Bedingungen dem Herzog zu überlassen; er glaubte zwar zuerst noch, vorher die Zustimmung aus Schweden einholen zu müssen, doch entschloß er sich bald wieder als bevollmächtigter Generalagent selbständig seine Absicht auszuführen. Am 15. Febr. 1634 ertheilte er Salvius die Vollmacht, den Herzog Adolf Friedrich in das Stift einzuweisen. Daß dies am 24. März geschah, ist bereits im 2. Teil dieser Geschichte unter der Administration Adolf Friedrichs mitgetheilt.
Was die von Schweden verschenkten Stiftsgüter betrifft, so sind damit gemeint: 1) der Hof Hermannshagen mit den dienstpflichtigen Dörfern Jürgenshagen, Göllin, Glambek und Qualitz, welche der König Gustav Adolf im September 1632 an Adam Heinrich v. Pentz gab (s. I. Theil unter Hermannshagen); 2) der Hof Wolken mit dem zugehörigen Dorfe Zepelin und die Officialei zu Rostock c. p., welche am 9. Jan. 1634 der schwedische Resident Eßken zu Erfurt für sich und seine Erben als Geschenk erhielt. Da aber Adolf Friedrich großen Werth grade auf diese beiden Besitzungen legte, "da Wolken dem Hause Bützow Feuerung und Küchennothdurft liefern müsse, und da mit der Officialei die geistliche Jurisdiction und das jus patronatus über die Rostocker Universität zusammenhinge". so beredete Oxenstierna selbst den Residenten Eßken, er möge gegen die Erfüllung anderer Wünsche diese Geschenke wieder abtreten, was denn auch bald darauf geschah. 3) Gr.=Medewege c. p., seit 1631 im Besitz des Vice =Admirals Ryning, 4) Rampe, im Besitz des Obersten v. Salzburger, 5) Zibühl, zwar


|
Seite 145 |




|
noch im Besitz des dänischen Königs und von Troje 1 ) verwaltet, doch trotzdem von der Krone Schweden an den Obersten Wrangel verschenkt. Die Capitelsgüter waren völlig für ihre früheren Besitzer verloren, vom Domanium und Kloster Rühn waren nicht unbedeutende Stücke losgetrennt; nur die Lehngüter, freilich grausam verwüstet, hatte man bis auf Zibühl nicht angetastet.
Die Steuerkraft des Landes war gänzlich erschöpft, und was unter harten Drohungen und Executionen noch aufkam, mußte nach Adolf Friedrichs eigenem Bericht (vom 24. Aug. 1634) dem schwedischen General Redwein (oder Ritwein) gegeben werden, da derselbe eine Assignation auf die Stiftscontribution in der Höhe bis monatlich 500 Thlr. hatte. Der Besitz des Landes war also wahrlich nicht begehrenswerth, wenn es nicht bald anders wurde.
Wegen der Art der Verleihung von Schweden und wegen des Anspruchs Redweins auf die Contribution war das Stift noch immer für das Reich oder richtiger für den niederdeutschen Kreis - denn die Macht des Reiches erstreckte sich augenblicklich überhaupt nicht so weit - so gut wie verloren. Doch versuchte der Kreistag wenigstens jetzt wieder wie in früherer Zeit seine Forderungen an das Stift zu stellen (seit einigen Jahren war auch das unmöglich gewesen), wenn es auch zunächst noch nicht viel Erfolg hatte.
Am schlimmsten waren augenscheinlich die Capitularen behandelt, da ihnen alle ihre Landgüter genommen waren, so daß als Capitetsbesitz nur die ziemlich werthlosen, verfallenen Domhöfe in Schwerin übrig blieben; und diese Höfe wurden mit Contribution hart belegt, die fortwährend durch schwedische Execution beigetrieben wurde.
Bei dem überall herrschenden Elend ging der Wunsch, geordnete Verhältnisse wieder im Stifte anzubahnen, bald genug von den unter der schwedischen Steuer schwer leidenden Ständen aus. Nachdem vereinzelte Klagen wegen der Executionen längst dem Herzog Adolf Friedrich die große Noth der Stiftsunterthanen geschildert hatten, wandten sich Ritterschaft und Städte unterm 10. September 1634 an ihren neuen Regenten mit der Bitte um Ansetzung eines Stiftstages, damit die Steuern wenigstens gerechter vertheilt werden möchten. Adolf Friedrich berief die Stände zum 8. Januar 1635 nach Bützow, wo neben den alten Vertretern des Landes auch die von den Dänen und Schweden neu eingewiesenen


|
Seite 146 |




|
Gutsbesitzer, wie Troje auf Zibühl und Gallentin, der Admiral Ryning auf Gr.=Medewege und der Oberst v. Saltzburger auf Rampe, sowie der Schelfvogt zu Schwerin erscheinen sollten. Troje weigerte sich aber zu kommen, da er nach seiner Meinung von dem meklenburgischen Herzog gar nicht abhängig sei.
Auf diesem Stiftstage wurde mitgetheilt, daß auf dem vorigjährigen Kreistage zu Halberstadt beschlossen sei, das Stift Schwerin solle bezahlen: für Munition 1020 Thlr., für einen einfachen Römerzug 66 Thlr. 16 ggr, für Proviant 1700 Thlr, als Kreishülfe (8 Monate, 1. Mai bis 31. Dec.) 6400 Thlr. und noch einmal für Proviant 2400 Thlr., zusammen 11,586 Thlr. 16 ggr. Davon dürfte abgerechnet werden die an Redwein gezahlte Steuer von 1275 Thlr. 44; es blieben also zu zahlen 10,310 Thlr. 36 ßl. Das Stift Schwerin wurde noch immer vom Kreistag sehr hoch besteuert, da es einen Anschlag von 8 zu Roß hatte, während man vom Stift Lübek nur 3 zu Roß und von Ratzeburg nur 1 zu Roß und 3 zu Fuß verlangte.
Die Stände zeigten sich willig die Contribution zu zahlen; doch machten sie zur Bedingung, daß auch von den Stiftsgütern, die in fremdem Besitz waren, und von dem Domanium, das seit 9 Jahren frei ausgegangen sei gesteuert würde. Ferner verlangte man zum Stiftskasten 4 Schlösser, für den Stiftshauptmann, das Copitel, die Ritterschaft und die Stadt Bützow je eins. Einige Ritter beklagten sich über ungleiche Vertheilung des Roßdienstes, u. a. v. Warnstedt auf Vogelsang, der unter Wallensteins Herrschaft auf der Proscriptionsliste gestanden hatte. Sehr traurig klangen die Klagen der Städte über die Einquartierung. Der Oberstlieutenant Osterling hatte vom September 1634 her bis jetzt mit einer Compagnie Dragoner in Warin gelegen und die Stadt hatte deshalb 2096 G. 8 ßl. verausgaben müssen. Warin hatte große Schulden, ein Haus nach dem andern wurde verlassen und blieb wüst, "daß solches einen Stein in der Erde erbarmen möchte." Bützow hatte 9000 G. Schulden, und der dritte Theil der Häuser war zerstört.
In dem Stiftsabschied vom 10. Januar wurde versprochen, es sollten alle rückständigen Steuern im Domanium, in den Capitelsgütern und in Zibühl und Gallentin eingefordert werden, den Stiftskasten wollte man revidiren, die Beschwerden wegen des Roßdienstes untersuchen lassen, die Ausgaben für Einquartierung sollten von der Kreissteuer abgerechnet werden, und endlich wollte man versuchen, Warin von der Einquartierung zu befreien.


|
Seite 147 |




|
Das klang wenigstens tröstlich und war sicher gut gemeint; aber wie sollten alle diese guten Absichten zur Ausführung kommen? Bei der Einhebung der Contribution stieß man sofort auf Widerstand. Als nach Zibühl und Gallentin, sowie nach Rampe und Medewege Execution gelegt wurde, gingen die Beschwerden deshalb an den König von Dänemark und an die schwedische Commandantur zu Wismar. König Christian schrieb sogar in dieser Angelegenheit an Adolf Friedrich, und aus Wismar erhielt der Stiftshauptmann v. Grävenitz die Drohung, man wolle es ihm gedenken, man habe auch Soldaten, und es käme darauf an, wer den Platz behaupte.
In demselben Jahre, 1635, wurde noch ein Ausschuß der ständischen Mitglieder nach Bützow gerufen; es ist dies das einzige Mal, daß wir während der 100 Jahre der Administration von einer solchen Versammlung hören. Eingeladen waren: das Capitel, der Stiftsmarschall Friedr. Vieregge zu Gischow, Barthold v. Parkentin zu Bolz (und Tieplitz), Hauptmann Heinr. v. Hagen zu Rühn, Stiftshauptmann v. Grävenitz zu Bützow, Bürgermeister Peter Strauß zu Bützow, Bürgermeister Daniel Pfeil zu Warin und Schelfvogt Arnd Fentzahn von der Schelfe. Vom Capitel erschien der Domherr V. v. Plessen, v. Parkentin ließ sich durch den Stiftsmarschall vertreten; die Städte Warin und die Schelfe sandten keinen Abgeordneten, auch von einer Vertretung derselben ist keine Rede. Die Versammlung tagte vom 12. bis 16. März, um wegen des Steuermodus, welcher auf dem letzten Stiftstage verabredet war, Berathungen zu pflegen, weil die Steuern nicht eingingen. Selbstverständlich konnte auch der Ausschuß nicht helfen. Die Zahlungen blieben nach wie vor größtentheils aus: Viele schickten statt Geldes Abrechnungen für Einquartierung. Da riß dem Kreisobersten die Geduld, er beorderte den Kreiscassier, in militärischer Begleitung die Stiftscontribution selbst einzutreiben, und drohte, ein ganzes Regiment Soldaten schicken zu wollen, wenn nicht Zahlung erfolgte. Adolf Friedrich wollte nun dasselbe beim Kreise versuchen, was die Stiftsunterthanen beim Stiftskasten gethan hatten, d. h. er ließ durch den Domherrn v. Plessen Rechnungen über die Kosten der Einquartierung der Redweinschen und Osterlingschen Völker aufsetzen, und diese sollten in den Kreiskasten als Zahlung geschickt werden. Wir wissen nicht, welchen Erfolg dieses Unternehmen hatte. Das ist aber sicher, daß das Stift den geforderten Anschlag nicht zusammenbrachte; denn im Sommer 1635 verfügte man erst über 2640 G., während man 19,027 G. zahlen sollte; und ebenso stellt fest, daß Administrator und Stände im


|
Seite 148 |




|
Jahre 1635 eine Anleihe von 6000 Thlrn. bei dem Hamburger Kaufmann Block machten.
Im Herbst 1635 theilte Adolf Friedrich den Stiftsständen schriftlich mit, daß der letzte Kreistag zu Lüneburg beschlossen habe, es sollten alle festen Orte und alle Städte mit Kreisvolk belegt werden. Nach Bützow würden deshalb ungefähr 300 Mann geschickt werden. Der Herzog beabsichtigte "wegen der gefährlichen Zustände" nicht, die Stände zusammenzurufen; es sollten die nöthigen Gelder für die Verpflegung der Kreistruppen ohne vorhergehende Berathung auf dem Stiftstage, aber sine praejudicio gezahlt werden. Doch da es nicht ging, mußten die Stände am 8. October nach Bützow kommen. Die Soldaten waren damals schon in Bützow eingerückt, anscheinend für die entvölkerte und verarmte Stadt in sehr erheblicher Anzahl; denn die Stände baten, man möchte doch die Stadt bis auf 2 Compagnien befreien, was auch in dem Abschied des Stiftstages verheißen und später wirklich ausgeführt wurde. Bützow beherbergte später mehrere Jahre lang 2 Compagnien Musquetiere, zusammen gegen 300 Mann stark. Für die Verpflegung derselben sollte das platte Land der Stadt zur Hülfe kommen; aber die Ritterschaft wehrte sich gegen diesen Beschluß, da sie ohnehin an den schwedischen Commandanten von Wismar zahlen müsse, obwohl dieser vom Domanium und von den Städten ebenso gut seinen Tribut forderte. Als nun im nächsten Frühjahr, 1636, wieder der Stiftstag tagen sollte, fanden sich so wenig Mitglieder ein, daß man, zumal da Keiner vom Capitel geschickt war, beschloß, unverrichteter Sache wieder abzureisen. Schon waren die meisten aus der Stadt fort, da traf noch der Domherr v. Plessen ein; die Versammlung kam aber nicht mehr zu Stande.
So ging es in den nächsten Jahren weiter; man mühte sich vergebens ab, die alten Schulden zu bezahlen und den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Dem Kreis gegenüber hielt man sich zu Zahlungen verpflichtet; und wenn die Möglichkeit vorhanden gewesen wäre, so hätte man diese Last garnicht so ungern getragen. Aber es fehlten beständig die Mittel, und das Stift stürzte sich in unerschwingliche Schulden. Von der Blockschen Schuld waren erst 2000 Thlr. abgetragen und lange keine Zinsen mehr gezahlt. Da nun dieser Gläubiger häufig mahnte, u. a. auch durch den Cand. jur. Abraham Kayser, welcher später im Auftrag Adolf Friedrichs den Osnabrücker Friedensverhandlungen beiwohnte, so mußten die Stände am 31. Juli 1638 zum Stiftstage nach Bützow kommen, um Rath zu suchen. Aber sie fanden ihn nicht, und noch lange nach dem westfälischen Frieden klagten die Blockschen Erben


|
Seite 149 |




|
wegen dieser Schuld. Bei dieser Sachlage erscheint es als eine Unverschämtheit, wenn die "befreundeten" Schweden, die unter dem Versprechen zu helfen gekommen waren, fortwährend bis zu Ende des Krieges durch den Commandanten zu Wismar Contributionen in dem armen Stiftslande ausschreiben und durch Execution beitreiben ließen. Zweimal erreichte die Noth der viel gequälten Stiftsunterthanen noch den Gipfelpunkt; es war das 1637 und 1638 während des Banérschen Zuges nach dem Norden, dem die Kaiserlichen und die Sachsen folgten, und 1643 - 45 während der massenhaften schwedischen Durchzüge unter Torstenson und Wrangel, denen ebenfalls die Kaiserlichen nachrückten. Die gesetzliche und gewohnheitsmäßige Ordnung wurde durch diese Ereignisse im Kleinen, in Stadt und Dorf und in der Familie, allerdings völlig untergraben; doch hielt man sie im Staatsregiment im Ganzen aufrecht. Denn selbst zu den Zeiten der greulichsten kriegerischen Verwüstungen wurden die Stiftstage einberufen und beschickt 1 ), und man verhandelte dort nach Aussage der Protocolle immer noch mit einer Ruhe, die mit Recht Bewunderung verdient.
Wie schwer Bürger und Bauern im 30jährigen Kriege litten, geht zur Genüge aus den Beschreibungen im ersten Theil dieser Arbeit hervor und ist außerdem aus den Berichten über andere Länder hinlänglich bekannt; wir dürfen es uns daher ersparen, die schauerliche Noth zusammenfassend darzustellen. Nur möchten wir auf Grund der im 2. Theil bekannt gemachten kirchlichen Visitations=Protocolle eine Berechnung anstellen über die Anzahl der Personen, welche den Frieden in der Heimath erlebten. Die erwähnten Protocolle geben zum Jahre 1642 die Seelenzahl von 6 Stiftsgemeinden an. Diese Zahl erreicht nur 1/7 bis 1/8 (genauer 10/76) der jetzigen Bevölkerung. Ist die Verwüstung des Krieges im ganzen Stift, was mehr als wahrscheinlich, ebenso groß gewesen, so wohnten 1642 auf demselben Raume, den jetzt etwa 30,000 Einwohner bevölkern, nicht ganz 4000 Menschen. 2 )
Ganz verschwunden ist übrigens im Stift Schwerin während des 30jährigen Krieges kein Ort. In Nisbill wohnte zwar 1639 nur noch ein Kossat, und die Häuser des Dorfes waren ebenfalls


|
Seite 150 |




|
bis auf eines eingeäschert; aber es wurde dort doch bald wieder von Neuem gebaut. Tieplitz war während der Vormundschaft für den jungen v. Parkentin um 1641 eine Zeit lang von Menschen ganz verlassen, und das Feld lag unbebaut. Ebenso stand es höchst wahrscheinlich gegen Ende des Krieges um Schependorf, und nicht viel besser um Lübzin, da um 1643 die Besitzer, die v. Preenschen und v. Maltzanschen Erben, dies Gut mit seinen beiden Rittersitzen wegen Schulden aufgaben. Aber alle Orte aus jener Zeit, mit Ausnahme der drei im 18. Jahrhundert untergegangenen Dörfer Bahlen und Trepzow bei Bützow und Hilgendorf bei Schwerin, sind noch heute vorhanden. In dieser Hinsicht mag das Stift Schwerin vor manchen andern deutschen Staaten einen Vorzug haben, im Uebrigen darf es sich dessen gewiß nicht rühmen. Auch hier lernte man ebenso gut wie anderswo das maßlose Elend und den ganzen Jammer des schrecklichsten Krieges kennen, und auch hier flehten schon lange Alle, welche noch nicht völlig abgestumpft oder gar verwildert waren, inbrünstig um Frieden.
4. Der westfälische Frieden.
Endlich nach langem, langem Sehnen kam die Botschaft aus dem Westen, daß die Herrscher der Völker, des Streitens müde, beschlossen hätten, durch friedliche Unterhandlungen sich zu einigen, und daß zu dem Zwecke ihre Bevollmächtigten in den beiden westfälischen Städten Münster und Osnabrück die Friedensbedingungen erörterten. Das war im Herbste 1643. Es ist allgemein bekannt, wie bitter diejenigen getäuscht wurden, welche voreilig jetzt in kurzer Zeit den Frieden erwarteten. Die langen Kriegsjahre hatten die Verhältnisse dermaßen verwirrt, daß die Lösung des Knotens schwer wurde und viele Jahre erforderte. Wir brauchen indessen den langwierigen Verhandlungen in Westfalen nicht Schritt für Schritt zu folgen, wir suchen nur die paar Stunden heraus, in welchen man sich um das künftige Schicksal unsres Stiftes stritt, und werden darum bald zum Ziele gelangen.
Als Bevollmächtigter des Stifts Schwerin wurde von Herzog Adolf Friedrich der Geh. Rath Dr. Abraham Kayser, welcher auch das Herzogthum Meklenburg=Schwerin vertrat, nach Osnabrück geschickt. Kayser reiste im December 1644 zu dem Congresse ab. Als er aber dort für das Stift sein Votum abgeben wollte, erhob sich lebhafter Widerspruch, da im Prager Friedensschluß von 1635 den protestantischen Stiftern das Stimmrecht auf 40 Jahre ge=


|
Seite 151 |




|
nommen war. Kayser gab daher unter Protest bie Stiftsstimme auf. Er versuchte aber als meklenburgischer Abgeordneter mit anerkennenswerther Ausdauer und mit vielem Geschick die großen Opfer, welche Schweden als Entschädigung von Meklenburg forderte, abzumindern. Doch es war ihm unmöglich, den Gewaltigen gegenüber auch nur etwas zu erreichen, so sehr er auch durch die patriotischen, bestimmten Erklärungen seines Herzogs, der bekannte, lieber sterben zu wollen als das beste Kleinod seines Landes (Wismar) dahin zu geben, unterstützt wurde.
1647 wurde als Entschädigung für die an Schweden abzutretenden Gebiete Wismar, Röl und Amt Neukloster Meklenburg= Schwerin zuerst das Stift Schwerin (neben dem Stift Ratzeburg) angeboten, und zwar in der Weise, daß der Herzog Adolf Friedrich die Hälfte der Canonicate sollte zu seinem Kammergute legen können. Adolf Friedrich lehnte dies Anerbieten ab. Denn was waren diese beiden Länder für ein Ersatz, da er das eine längst als sein Eigenthum ansah, und das andere seinem Neffen, dem jungen Herzog Gustav Adolf von Meklenburg=Güstrow, gehörte? Adolf Friedrich war überhaupt noch nicht geneigt, Entschädigungen für Wismar anzunehmen, da er diese Stadt noch immer zu behalten hoffte. Da kamen die Schweden mit der Erklärung, daß sie Wismar als Reichslehn vom Kaiser annehmen würden. Das änderte die ganze Sachlage; denn nun waren die kaiserlichen Abgeordneten diesem Begehren nicht mehr abgeneigt, und die beste Stütze Meklenburgs fehlte. Die KaiserIichen, ja Abraham Kayser selbst, riethen nun dem Herzog, für Wismar anzunehmen, was er erhalten könne. Zwar ging Adolf Friedrich auch jetzt noch nicht auf diesen Rath ein, er versuchte erst das Letzte, durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem schwedischen Königshause die Königin selbst zur Nachgiebigkeit zu bewegen, indem er seinen Sohn, den Prinzen Karl, nach Schweden schickte; als dieser aber, mit einem Geldgeschenk freundlich von der Königin entlassen, unverrichteter Sache wieder zurückkehrte, da reiste Dr. Kayser nach Osnabrück, um in die Abtretung Wismars zu willigen, wenn es unter der Bedingung,wie seiner Zeit Emden an Holland gekommen, an Schweden gegeben würde. Doch jetzt war alles zu spät, die Abtretung Wismars als Reichslehn war bereits in das Friedensinstrument aufgenommen. Selbst als Entschädigung war nichts mehr zu Vergeben übrig als die beiden Stifter Schwerin und Ratzeburg. Wohl oder übel mußte darum Dr. Kayser in die endgültige Bestimmung des Westfälischen Friedens willigen, die nach §. 12 des Friedensinstruments im deutschen Texte lautet:


|
Seite 152 |




|
"Für dasjenige aber, so dem Herzog von Meklenburg zu Schwerin, Herrn Adolf Friedrich, in Veränderung der Stadt und Hafens Wismars abgehet, soll ihm und seinen männlichen Leibeserben zukommen das Bisthum Schwerin und Ratzeburg als ein immerwährendes unmittelbares Lehn [jedoch vorbehältlich der zuständigen Rechte des Hauses Sachsen=Lauenburg und anderer benachbarten, wie auch besagter Diöces 1 )] sammt allen Gerechtigkeiten, schriftlichen Urkunden, Archiv, Registern und andern Zugehörungen, mit der Freiheit, an beiden Orten nach Abgang der jetziger Zeit residirenden Canoniker die Canonicate abzutilgen und alle Renten der fürstlichen Tafel zu appliciren, und soll auch bei den Reichs= und des niedersächsischen Kreises Conventen seine Session, auch zwiefachen fürstlichen Titel und Stimme haben." Das ganze instrumentum pacis wurde von den Bevollmächtigten am 14. (24.) October 1648 in öffentlicher Versammlung unterschrieben und besiegelt und am folgenden Tage feierlich bekannt gegeben. Die Unterschrift Kaysers, welcher "wegen Meklenburg=Schwerins für sich und in Vormundschaft von Meklenburg=Güstrow" zeichnete, steht an 20. Stelle.
Die amtliche Mittheilung von dem Friedensschluß an das Stift Schwerin geschah auf dem Stiftstage zu Bützow am 11. Nov. 1648 gleich nach Eröffnung besselben durch Dr. Hein Morgens 10 Uhr. Leider folgte auf diese erfreuliche Kunde sofort die Erklärung, daß die Stände, zu denen man diesmal auch die Domina und die Provisoren des Klosters Rühn rechnete, den hohen Beitrag von 12,816 Reichsgulden oder 8514 Thlr. zur Entschädigung an Schweden, das nach §. 16 des Friedens 5 Mill. Thlr. "zur Abdankung der Truppen" aus sieben Kreisen des Reiches erhielt, bewilligen sollten. Die Stände begehrten Abtritt bis zum Montag den 13. Nov. Als sie wieder zusammentrafen, willigten sie ein, daß das Entschädigungsgeld im Stifte als Gontribution aufgebracht würde; aber ohne Execution möchte es wohl nicht möglich sein, meinten sie, und besorgt fragten sie, ob denn der schwedische Major Königsmark, welcher mit seinen Soldaten in Bützow lag, die Executionsmannschaft stellen sollte. Adolf Friedrich war aber der Ansicht, daß man jetzt nicht mehr Fremde gebrauchen müsse.
Es handelte sich nun vor allem um den Steuermodus, nach welchem gezahlt werden sollte. Darüber war man sich sofort einig, daß Alle herangezogen werden müßten, und damit dies geschähe, bestimmte man, daß ein Kopfgeld von allen Personen über 10


|
Seite 153 |




|
Jahre, mit Ausnahme der Geistlichen und der Schuldiener und deren Familien, und eine Hufen =, Vieh= und Einkommensteuer zu entrichten sei. Für das Kopfgeld theilte man die Bevölkerung in 4 Klassen, in der letzten (niedrigsten) Klasse sollte der Mann 1/2 Thlr., die Frau 16 ßl. und das Kind 8 ßl. geben; es war dies ganz der Modus, wie er in Meklenburg verordnet wurde. Zur bessern Sicherung der Stiftskasse wurden die Einnehmer am 16. Nov. vereidigt.
Das Steueredict, datirt vom 14. Nov., wurde gedruckt, von allen Kanzeln verlesen und darauf an die Kirchthüren, Schulzengerichte und Krüge geheftet. Kennen lernte es also Jeder; aber doch zahlten Viele nicht, weil es Vielen unmöglich war. Endlich am 16. Sept. 1649 theilte der Herzog dem Gouverneur von Wismar mit, daß er die erste Rate von 4960 Thlrn. (3 Raten waren zu Osnabrück vereinbart) in Empfang nehmen und den Friedensbedingungen gemäß jetzt die fremden Truppen aus dem Lande schicken möge. Erst, als dies geschehen, war der Herzog als "Fürst von Schwerin" im alleinigen, ungestörten Besitz des Landes.
Die Aufbringung des Restes von der schwedischen Kriegsentschädigung war freilich auch noch nicht leicht, aber die Summe wurde doch endlich gezahlt.
Von außen her war der neue Fürst von Schwerin von jetzt an völlig unbehelligt; nur in dem eignen kleinen Lande erhob sich Widerspruch gegen die von ihm geplante Vollziehung der Osnabrücker Beschlüsse, und zwar von Seiten der noch übrig gebliebenen Domherren. Wie wir eingesehen haben, bestimmte §. 12 des Friedensinstruments, daß der Herzog befugt sei, in beiden ihm als Fürstenthümer überwiesenen Stiftern Schwerin und Ratzeburg "nach Abgang der jetziger Zeit residirenden Canoniker die Canonicate abzutilgen und alle Renten der fürstlichen Tafel zu appliciren." Die Canonicate hatten früher bestanden in den Domherrenhöfen zu Schwerin, in einer größeren Anzahl fruchtbarer Landgüter und in einzelnen Hebungen aus verschiedenen Dörfern. Die Landgüter wurden von den Capitularen selbst größtentheils veräußert, nach 1622 besaßen sie nur Medewege. c. p., Rampe c. p., Warkstorf und den Schelfbauhof. 1627 hatten diese Güter Fremde in Besitz genommen, während die früheren Inhaber geflohen waren, und 1648 wirthschafteten auf den drei zuerst genannten Höfen die Schweden; nur den Schelfbauhof hatte ein Capitular, der Dekan v. Wackerbarth, inne.


|
Seite 154 |




|
Während des Krieges verfielen die altersschwachen, schon längst schlecht erhaltenen Curien, und die Hebungen wurden wohl kaum gefordert, sicher nicht gegeben. Auf die ziemlich werthlosen Curien und auf die sehr unzuverlässigen Hebungen machte Adolf Friedrich keinen Anspruch; dahingegen glaubte er die Landgüter jetzt als sein Eigenthum ansehen zu dürfen. Die Capitularen behaupteten aber, daß ihnen diese Besitzungen vermöge der Capitulation von 1634 müßten ausgeliefert werden; und daher entbrannte der Streit, der denn gelegentlich auch die Aufsicht über den Dom und über das Kloster Rühn berührte. Der Herzog eignete sich nämlich das Patronat über den Dom und das Ober=Provisorat über Rühn an, und die Domherren versuchten eine Zeit lang, ihm diese Rechte streitig zu machen.
Unterm 13. Febr. 1649 erinnerte das Capitel, welches jetzt seinen Wohnsitz wieder von Lübek nach Schwerin verlegt hatte, den Herzog zuerst an die verheißene Restitution der Landgüter. Adolf Friedrich antwortete damit, daß er am 27. Febr. Befehl gab, Medewege, Rampe und Warkstorf zu inventarisiren, "weil er diese Güter in Possession nehmen" wolle.
Die Bitte um Rückgabe der Güter wurde von den Domherren am 5. April wiederholt, und bei dieser Gelegenheit dem Herzog vorgeworfen, daß er widerrechtlich die Pfarre zu Baumgarten mit dem Bützower Rector besetzt habe; denn das Patronat zu Baumgarten gebühre dem Kloster Rühn und folglich ihnen als den gesetzlichen Provisoren desselben. Da seine Antwort erfolgte, so schrieben die Capitularen abermals am 25. Mai und forderten nun auch das Patronat über den Dom, an dem der Herzog eigenmächtig und widerrechtlich bauen lasse. Auf die Klage vom 30. Juli erhielten sie endlich die Weisung, sie sollten in der Unterschrift die Bezeichnungen Dekan, Senior und Capitularen weglassen und nur ihre Namen unterschreiben, dann würden sie schon Antwort bekommen.
Wie diese Antwort aber ausfallen würde, konnten die Domherren aus des Horzogs Befehl vom 28. August schließen, der den Stiftshauptmann Rabensteiner und den Küchenmeister Nortmann zu Bützow anwies, "alsofort das Kloster Rühn und die zu der Stifts= und Domkirche gehörigen Gefälle und Intraden, wie dieselben Namen haben, und wo sie auch anzutreffen sein mögen, in wirkliche Possession und Besitz zu nehmen." Noch deutlicher war der den Notaren Rachel und Reppenhagen vom Herzog gegebene Befehl (31. Oct.), daß sie sich zu Ulrich v. Wackerbarth und Dr. Wedemann begeben sollten und von diesen fordern: das Capitels=


|
Seite 155 |




|
Archiv mit den Acten, Original=Obligationen, Urkunden, Registern, Kirchenbüchern und Rechnungen, die Capitulationen Meklenburgs mit dem Capitel und die Reverse Meklenburgs, ferner alle Siegel und alle Schlüssel. Sie sollten alle diese Sachen zu den übrigen ihnen anvertrauten Stiftssachen legen und demnächst, daß es geschehen, berichten.
Nach einer Beschwerde des Dekans v. Wackerbarth vom 4. Nov. 1649, daß nämlich der Herzog seinen Viehfutterer von seinem (des Dekans) Bauhof zur Schelfe habe vertreiben lassen, dürfen wir wohl annehmen, daß Adolf Friedrich nunmehr auch Besitz vom Bauhof ergriff.
Zu Anfang des folgenden Jahres, d. d. 9. Febr. 1650, erhielt der Herzog wieder eine Petition der Domherren Ulrich v. Wackerbarth, Georg v. Behr, Hartwig v. Wackerbarth. Matthias v. Behr, Henning Matthias v. Lützow (Balthasar v. Bothmer, der sich hatte abfinden lassen, verweigerte die Unterschrift), in welcher um die Rückgabe der Landgüter gebeten und über Adolf Friedrichs Eingriffe in die Rechte des Capitels bezüglich des Klosters Rühn und des Schweriner Doms Beschwerde geführt wurde. Jetzt beachtete der Herzog die wiederholten Klagen wenigstens so weit, daß er von seinen Räthen Dr. Albrecht Hein, Dr. Meier, Dr. Kayser und Dr. Daniel Nicolai ein Gutachten über dieselben forderte. Diese Räthe gaben darauf ihr Urtheil unterm 27. Aug. 1650 schriftlich dahin ab, daß Adolf Friedrich Anfangs wohl hätte milder verfahren können, und daß er weiter gekommen wäre, wenn er dem einen oder dem andern der Capitularen, und nicht grade dem Bestverdienten, etwas mehr hätte zufließen lassen, um das Capitel zu spalten. Dadurch würde man jetzt drohende Weitläufigkeiten, welche bei dem Zustande des Fürstenthums, der schwedischen Krone Compartement und dem bekannten unruhigen "Schwindelhirn" des Georg v. Behr nicht gering zu achten seien, leicht vermieden haben. Vor allem rieth man, das Vorgehen gegen Rühn zu ändern. Dem Kloster müßten seine Gerechtsame als einem Stand des Fürstenthums gewahrt werden; es dürfe daher nicht dem herzoglichen Beamten unterstellt werden. Adolf Friedrich möge wieder einen tüchtigen Propst bestellen, der auf Landtagen das Kloster vertrete. Da man höre, daß das Kloster eingehen solle, beabsichtige sogar der König von Dänemark, "dessen Aeltermutter dasselbe mit Intraden augmentirt sind gleichsam wieder aufgerichtet habe, dagegen einzuschreiten. Auch eine Antwort an die Capitularen wurde aufgesetzt, aber wohl nicht abgeschickt; jedenfalls kam sie nicht in die Hände der Adressaten. In dieser Antwort behauptete der Herzog, daß die Domherren sich


|
Seite 156 |




|
auf die Capitulation von 1634 nicht mehr berufen dürften, da diese durch das instrumentum pacis aufgehoben sei. Georg v. Behr und Hartwig v. Wackerbarth hätten nichts zu fordern, denn sie wären nie Domherren gewesen und hätten auch in wohl 10 Jahren keinen Psalm in der Domkirche gesungen. Ulrich v. Wackerbarth solle Rampe haben; aber erst müsse er die Structurgelder der Domkirche herausgeben. Den Titel eines Dekans könne er nicht bekommen, weil kein Collegium mehr vorhanden: wolle er Capitular genannt werden, so möge das geschehen.
Die Wünsche Ulrich v. Wackerbarths wollte man also bis zu einem gewissen Grade erfüllen, denn der war ein alter Mann und konnte Rampe nicht lange mehr besitzen; übrigens hoffte man auch, ihn dadurch von den übrigen Domherren zu trennen. Als aber die Unterhandlungen mit ihm begannen, erhob Matthias v. Behr Einspruch, da er der Ansicht war, das zu allen Verfügungen über Capitelsgüter sämmtliche Capitularen ihre Zustimmung geben müßten.
Auf eine nochmalige Mahnung des Capitels vom 18. Mai 1601 ordnete Adolf Friedrich endlich eine Conferenz an, welche am 12. und 13. August zu Schwerin stattfand und von Seiten des Herzogs durch die Doctoren Meier und Nicolai, von Seiten des Capitels durch die beiden v. Wackerbarth, Matthias v. Behr, v. Lützow und Syndicus Wedemann besucht wurde. Von allen Vorschlägen der Herzoglichen nahmen aber die Capitularen nur einen an, den nämlich, daß die Rückstände von den ihnen jährlich versprochenen 600 Thlrn. Entschädigungsgelder gezahlt werden sollten. Dahingegen widersprachen sie entschieden den Erklärungen:
1) daß kein Propst vorhanden sei und darum das Propsteilehn Medewege dem Herzog gehöre,
2) daß der Herzog das Dekanatsgut Rampe auf dem Wege des Vertrages mit Ulrich v. Wackerbarth, dem er dafür jährlich 200 Thlr. geboten habe, erwerben wolle,
3) daß der Herzog Warkstorf mit Recht besitze, da der Senior v. Bothmer es ihm gegen eine goldene Kette mit Brustbild und eine jährliche Rente von 300 Thlrn. abgetreten habe.
4) daß die Klagen wegen des Klosters Rühn, wenn sie von der Domina specificirt eingereicht würden, untersucht werden sollten.
Die Capitularen behaupteten, der Dekan Ulrich v. Wackerbarth sei zum Propst erwählt und die übrigen Domherren in Folge dessen der Reihe nach aufgerückt, es seien also wieder ein Propst, Dekan, Senior und Subsenior vorhanden, und diesen gebühreten die


|
Seite 157 |




|
4 Capitelsgüter, für deren Besitz sie an das eine sonst nicht dotirte Canonicat jährlich etwas abgeben müßten. Ihre Gravamina bezüglich des Klosters Rühn gaben sie schriftlich ab. Damit wurde die Conferenz geschlossen.
Die Domherren erhielten die Güter nicht. Mit unermüdlicher Ausdauer setzten sie aber ihre Petitionen fort, die allmählich in Drohungen mit dem Kammergericht übergingen, und endlich schickten sie wirklich eine umfassende Klageschrift an das Reich ab. Darauf erhielt Adolf Friedrich einen Befehl des Kaisers aus Regensburg vom 23. Sept. 1653, daß er die Capitularen gemäß des westfälischen Friedens "alsobald" befriedigen solle. Um den kaiserlichen Brief wurde ein Umschlag gelegt, auf welchem geschrieben steht:
"Dieses hat Herr Dr. Hein beantworten sollen, ist aber wegen anderer J. F. G. Geschäfte davon behindert, auch endlich darüber gar zum Deputationstage nach Speier verreisen müssen."
Das letzte vorhandene Schriftstück in dieser Angelegenheit ist ein Brief der Domherren an den Herzog (Schwerin, 21. Jan. 1654), in welchem sie um eine Conferenz bitten, damit über die Restitution der Capitelsgüter verhandelt werden könne. Diese Conferenz wurde ihnen jedenfalls nicht mehr bewilligt, und die ganze Streitfrage wird so allmählich still begraben worden sein. Selbstverständlich war sie aber endgültig erledigt durch das Absterben der letzten Capitularen, das in nicht allzu ferner Zeit erfolgt sein muß.
Wie die Ansprüche auf die Landgüter, erloschen mit dem Tode der Domherren auch ihre Forderungen in Hinsicht des Klosters Rühn und des Schweriner Doms, und Adolf Friedrich sah endlich alle Versprechungen, welche ihm der westfälische Friede machte, im frühern Stifte Schwerin erfüllt. Da war er auch ohne Widerspruch im Innern dieses Landes im Besitz aller ihm zugesicherten Rechte eines Fürsten von Schwerin.
B. Der Streit mit Meklenburg um die Jurisdiction im Stift.
Wäre die Reichsunmittelbarkeit des Stifts zu keiner Zeit angefochten worden, so würde die Jurisdiction unzweifelhaft in den zweiten Abschnitt der Stiftsgeschichte, welcher die inneren Verhältnisse behandelt, gehören. Da aber die Herzoge von Meklenburg seit der Reformation die Unabhängigkeit dieses Landes nicht anerkannten, im Gegentheil auf das Nachdrücklichste die Oberhoheit Meklenburgs suchten geltend zu machen, so wurde die interne Angelegenheit der Rechtspflege eine Streitfrage zwischen dem Stift


|
Seite 158 |




|
und Meklenburg und bedarf daher der Behandlung in der äußern Geschichte des Bisthums. Um nun die Darstellung der Jurisdictions=Verhältnisse nicht durch eine Trennung der Materie zu erschweren, behandeln wir die ganze Angelegenheit hier an dieser Stelle, obwohl wir wissen, daß unsre Erörterungen zum Theil nicht hierher gehören.
Dieselbe Frage, welche wir hiermit zu behandeln unternehmen, ist ebenfalls schon, wie die Frage der Reichsunmittelbarkeit des Stifts überhaupt, anonym in der Schrift: "Historische Nachrichten von der Verfassung des Fürstenthums Schwerin" (1741) und von Rudloff in seinem Verhältniß zwischen dem Herzogthum Meklenburg und dem Bisthum Schwerin (1774) ausführlich besprochen. Wir werden darum uns auf diese beiden Schriften gelegentlich beziehen können, im Uebrigen halten wir es für unsre Aufgabe ohne Rücksicht auf dieselben bloß nach den Acten des Geh. und Hauptarchivs Aufschluß über diese sehr verwickelte Angelegenheit zu geben.
Einen Einblick in die Rechtspflege während der letzten katholischen Zeit gewährt das Privilegium, welches der Bischof Petrus 1508 der Stadt Bützow ertheilte (Hist. Nachr. Anlage R.). Darnach sollten in der Stadt für Rechtsprechung 3 Instanzen sein:
1) der Stapel, 2) der Rath der Stadt, 3) der Bischof. Der Bischof will das Endurtheil, von dem keine Appellation gestattet sein soll, auf der Brücke vor der Burg zu Bützow fällen. Nach Ansicht des Stiftsoberhauptes konnte hiernach von einem Recht Meklenburgs auf die Rechtspflege im Bisthum keine Rede sein. Die Jurisdiction in der ersten evangelischen Zeit illustriren 3 Fälle, welche actenmäßig bezeugt sind.
1) Klaus Johannsen tritt ein Erbe in Dalberg gegen Entschädigung an Jochim Rehmann zu Dalberg ab. Die Entschädigung wurde nicht völlig entrichtet; deshalb klagt Johannsen, jetzt Bürger zu Lübek, auf Herausgabe des Erbes. "Up Klage und Antwort ist die Burschap in die Vindinge gewiesen, und darnach durch den Vindesman vor Schwerinsch Recht affgespraken", daß Rehmann den Rest der Schuld bezahlen und das Erbe behalten soll. Das Urtheil, d. d. "Donnerstag nach nativitatis Mariae" 1551, ist vom Capitel, zu dessen Besitz Dalberg gehörte, untersiegelt.
Johannsen appellirt "vor die Brugge tho Butzow." 1503, Donnerstag nach Gallen, findet unter Leitung des Stiftshauptmanns Jürgen Wackerbarth der Gerichtstag vor der Schloßbrücke zu Bützow statt. Der Kläger erscheint nicht, aber der Stadtvogt


|
Seite 159 |




|
von Bützow gieb eine Erklärung, warum derselbe ausgeblieben. Nun wird "die Burschap in die Vindinge gewiset", und der "Vindesman" bestätigt das 1. Urtheil. Wackerbarth steht dem Beklagten hierüber ein Attest aus.
2) Ludwig Krüger, Bürger zu Schwerin, Kläger, wider das Domcapitel daselbst Beklagten, wegen eines Kampes Acker. Der Stiftshauptmann ladet unterm 7. Oct. 1579 Dr. Martin Bollfraß, Dr. Es. Hoffmann und Amtmann v. Leisten zum Versuch eines gütlichen Vergleichs nach Bützow. Sollte der Vergleich nicht zu Stande kommen, so sollen die Parteien Klage und Antwort, jede doppelt ausgefertigt, innerhalb je 8 Wochen schriftlich einreichen zum Gutachten einer juristischen Facultät. Als Notar wird der Stadtschreiber zu Bützow bestellt. Der 1. Termin findet am 23. Oct. 1579 statt; am 5. Juni 1081 wird im Namen des Herzogs Ulrich das Urtheil gefällt, daß das Capitel den Acker abtreten, Krüger dagegen diesem die versprochenen 2 Mark zahlen soll.
Das Capitel, welches von vorne herein exceptio fori eingewandt hat, appellirt an Ulrich als Bischof, und falls dieser die Appellation nicht annehmen will, an den Kaiser. Ulrich läßt die Berufung zu. Nun werden die Acten an die Facultät zu Frankfurt geschickt, welche in dem Urtheil vom 4. Oct. 1583 dem Capitel den Acker zuspricht. Dies Urtheil wird als Rechtsspruch am 19. Nov. 1583 in der Rathsstube zu Güstrow in Gegenwart Krügers und des Capitelssyndicus Lorenz Niebuhr von Bollfraß und Hoffmann verkündet.
3) Das Schusteramt zu Sternberg klagt gegen das Schusteramt zu Bützow, welches ihm den Einkauf von Haut und Lohe auf dem Bützower Jahrmarkt nicht gestatten will. Die juristische Facultät zu Rostock spricht in einem Gutachten vom 29. Juni 1594 den Sternbergern das Recht des Einkaufs zu. Dies Gutachten wird als Urtheil am 3. Aug. 1594 zu Güstrow den Parteien bekannt gemacht. Die Bützower wenden exceptio fori ein und appelliren an Herzog Ulrich als Bischof. Ulrich bestätigt nach dem Erkenntniß der juristischen Facultät zu Frankfurt das Urtheil erster Instanz unterm 18. Febr. 1596.
Aus dem bischöflichen Privileg für Bützow und aus den 3 überlieferten Fällen der Rechtspflege geht hervor, daß Ulrich bei seinem Regierungsantritt im Stift in Civilsachen einen dreifachen Instanzenweg vorfand: 1) ein Schöffengericht, in Bützow der Stapel genannt, unter Leitung der Ortsobrigkeit, 2) ein Appellationsgericht in Bützow unter der Leitung des Raths, in den


|
Seite 160 |




|
übrigen Landestheilen, wahrscheinlich auch in der Ritterschaft, nachweislich auf dem Capitelgebiet und sicher in Warin, das amtssässig, und auf der Schelfe, die größtentheils in erster Instanz unter der Jurisdiction des Capitels stand, in zweiter Instanz also ein Appellationsgericht unter Leitung des Stiftshauptmanns, der sich wohl einige Rechtsgelehrte zur Hülfe nahm, 3) ein Oberappellationsgericht in der endgültigen Entscheidung des Bischofs selbst. Eine Abhängigkeit von Meklenburg ist hier nicht einmal angedeutet; und wenn auch in den beiden zuletzt genannten Fällen die Parteien in die meklenburgische Stadt Güstrow, die Residenz des Herzogs Ulrich, gefordert wurden, so ist das zwar nicht in der Ordnung, doch ist weiter nichts von einem Anspruch Meklenburgs auf die Rechtspflege im Stift zu erkennen.
Daß in geistlichen Sachen der Bischof zur katholischen Zeit nicht bloß im eigenen Stiftslande, sondern in seiner ganzen Diöcese richterliche Gewalt hatte, ist setbstverständlich. Nach Einführung der Reformation verlor er, nunmehr in der Regel bloß Administrator genannt, zwar das Richteramt außerhalb der Stiftsgrenzen; aber in seinem Bisthum selbst war er natürlich ebenso gut wie jeder protestantische Fürst wirklicher Bischof. Thatsächlich ließ allerdings der erste Administrator Ulrich in den ersten Jahren seiner Stiftsregierung vielfach seine bischöflichen Rechte und Pflichten durch seine meklenburgischen Geistlichen ausüben, wir meinen, ohne daß darum das Stift von seinen Rechten etwas verlieren konnte; doch sah er bald genug ein, daß auf diese Weise Kirche und Sitte nicht genügend gepflegt werden konnte, und setzte deshalb nicht bloß 1561 einen eignen Stiftssuperintendenten, sondern auch 1567 ein eignes Stifts=Consistorium ein. (S. 1. Theil, S. 254 und 256.) Daß diese seine Beschlüsse indessen durch das Drängen der Stände, besonders des Capitels, rascher gezeitigt wurden, wollen wir keineswegs verhehlen, aber das ändert sicher nichts an der Thatsache.
Die Ausübung der Polizeigewalt gebührte in allen niedern Sachen der Ortsobrigkeit, also außerhalb des Domaniums, wo die bischöflichen Beamten im Auftrage des Administrators die Ordnung aufrecht erhielten, dem Capitel, den Magistraten und der Ritterschaft in ihren Gebieten. Oberster Polizeiherr sollte natürlich überall der Administrator sein; aber Ulrich I. pflegte die höchste Polizeigewalt im Stift als Herzog von Meklenburg zu üben; in dieser Hinsicht erkannte er wohl niemals die Selbständigkeit des Bisthums an. So ließ er 1572 (2. Th., S. 162) die meklenburgische Polizei= und Landordnung auch im Stift im Namen der


|
Seite 161 |




|
meklenburgischen Herzoge verkünden, und diese Veröffentlichung wurde selbst auf wiederholtes Ersuchen der Stiftsstände nicht durch eine andre im Namen des Bischofs ersetzt.
Wie nun Ulrich I. in Polizei=Angelegenheiten das Stift seinem Herzogthum Meklenburg unterordnete, so versuchte er auch auf andern Gebieten die Oberhoheit des größeren Landes über das kleinere geltend zu machen. Zu Hülfe kam ihm hierbei die Unklarheit der Verhältnisse, die in dem gemeinschaftlichen Oberhaupte beider Staaten begründet war, und die selbst durch die höchste Instanz im deutschen Reiche nicht gehoben werden konnte. So ereignete es sich, daß die Parteien in reinen Stiftsangelegenheiten sich an meklenburgische Gerichte wandten, um sich Recht zu holen, und die meklenburgischen Gerichte verweigerten diesen Parteien ihr Urtheil nicht. Das sahen die Stiftsstände freilich nur eine Zeit lang ruhig an; denn bald, jedenfalls seitdem sie in ihrer Ansicht von der Selbständigkeit des Stiftes durch das Kammergerichtsurtheil von 1561 bestärkt waren, erhoben sie lauten Widerspruch gegen diese Art der Rechtspflege auf den Stiftstagen und bei andern Gelegenheiten, und endlich wurde die Lösung dieser viel erörterten Frage, wie die über die Reichsunmittelbarkeit überhaupt, ebenfalls dem höchsten Reichsgericht anheimgegeben, natürlich ebenfalls ohne Erfolg.
Am bedenklichsten war für das Stift und die Vertreter seiner Rechte der Umstand, daß die alte mittelalterliche Gerichtsorganisation nicht mehr genügte, und zumal seitdem in den Nachbarländern, wie in Meklenburg, an Stelle der abgebrauchten Institute neue, angemessenere Gerichtshöfe entstanden waren. Dies gilt in allen Civilsachen seit der neuen meklenburgischen Hof= und Landgerichts=Ordnung von 1568. Die Stiftsstände sahen das wohl ein; denn daher mehrten sich seitdem ihre Bitten um Errichtung eigner Stiftsgerichte in den 70er Jahren. Allen voran ging aber das Capitel. Unterm 30. Dec. 1570 übergaben die Capitularen an Ulrich einen schriftlichen Vortrag mit der Bitte, der Administrator möchte, da kein ordentliches Gericht im Lande vorhanden, und die Stiftsbewohner also gezwungen seien fremde Gerichtshöfe anzusprechen, baldigst ein eignes Stiftsgericht anordnen. Ulrich gab keine bestimmt ablehnende Antwort, aber auch keine volle Zusage. Wenn er künftig, erwiderte er, von Stiftsverwandten deshalb gebeten werde, so wolle er sich auch "der gnädigen Gebühr zu verhalten wissen." So sehr nöthig seien eigne Stiftsgerichte nicht, da die meisten Stiftsstände auch in Meklenburg angesessen wären und also dort ihren Gerichtshof haben könnten. Das Capitel ent=


|
Seite 162 |




|
gegnete, das Stift würde seine Selbständigkeit verlieren, wenn es keine eigne Jurisdiction habe. Daß auch Stiftsstände in Meklenburg ansässig wären, könne auf sein Urtheil in dieser Sache keinen Einfluß haben. Es müsse seiner Pflicht nach wiederholt um eigne Jurisdiction bitten. Ulrich meinte aber, seine Vorgänger hätten kein eignes Stiftsgericht gehalten, so brauche er es auch nicht, zumal da sein Bedürfniß dafür vorhanden sei.
Als man auf dem Stiftstage 1576 die Regierung wegen der Polizeiordnung interpellirte, ließ der Herzog Ulrich den Ständen antworten, das Stift läge mitten im Herzogthum Meklenburg und bedürfe dessen Schutz, man könne sich darum nicht ganz von Meklenburg lossagen. Die Polizeiordnung wäre publicirt, und das genüge; es sei gleich, wie es geschehen. Sie würde darum im Stift ebenso nützlich sein wie im Herzogthum. Die Stände erwiderten, den Nutzen bestreite man nicht, darum handle es sich auch nicht. Die Polizeiordnung sei im Namen Meklenburgs publicirt, und das könne dem Stifte präjudicirlich werden. Sie wären erbötig, mit dem Administrator eine eigne Polizeiordnung zu berathen. so gingen die Verhandlungen mehrere Jahre fort, bis die Stände sich ruhig gefallen ließen, was sie nicht ändern konnten.
Man verstand es in früherer Zeit meisterhaft durch Streiten über Nebendinge eine Sache hinzuhalten; ja es war diese Kunst so sehr geübt worden, daß sie völlig zur Gewohnheit wurde. Dies erklärt auch, wie es nur möglich sein konnte, daß man eine im Ganzen einfache Frage mehrere Jahrzehnte erörterte, ohne zu Ende zu kommen. Nach eben dieser Gewohnheit wurde die Frage über die Stiftsjurisdiction behandelt. Für den Geschichtsschreiber ist es in der That ein Glück, daß diese umständlichen Verhandlungen nur zum kleinen Theil überliefert sind. Wir werden aber in Rücksicht auf den Leser selbst von den vorhandenen Berichten nur die Hauptmomente auswählen.
Am 15. Juli 1583 machte Herzog Ulrich den Ständen das Anerbieten eines besondern Judiciums und einer besondern Polizeiordnung für das Stift. Er meinte damit aber nur ein Gericht erster Instanz, und dies wollte er auch nur in Rücksicht auf die nicht in Meklenburg ansässigen Stiftsstände einrichten. Nach des Herzogs Bestimmung vom 20. Jan. 1588 sollten die Kosten von Regierung und Ständen gemeinschaftlich getragen werden. Die Appellationen sollten nach wie vor an das meklenburgische Hofgericht gehen. Das wäre nicht mehr als billig, meinte der Administrator, denn das Capitel wisse recht gut, daß das Hofgericht immer mit für das Stift Recht gesprochen habe, deshalb hätten


|
Seite 163 |




|
die früheren Bischöfe und Administratoren selbst mit im Hofgericht gesessen, und noch jetzt schicke das Capitel einen Assessor in dasselbe. Die Domherren glaubten mehr beanspruchen zu können und nahmen das Anerbieten des Administrators in dieser Beschränkung nicht an. Sie forderten auch ein Gericht zweiter Instanz und verlangten, daß die Regierung die Kosten für die Jurisdiction allein trage, da sie allein die Gerichtsgefälle bekomme.
Unterm 18. März 1588 erklärten die Capitularen, früher sei allerdings weder im Stift, noch in den benachbarten Fürstenthümern ein ordentliches Obergericht vorhanden gewesen; jetzt seien aber in den Nachbarländern Obergerichte eingesetzt, und was andern Unterthanen zu Theil werde, habe Ulrich auch dem Stift versprochen. Die Appellationen ans meklenburgische Hofgericht dürfe man nicht zulassen, da man beweisen könne, daß die Bischöfe immer die oberste Gerichtsgewalt im Stift geübt hätten. Die Appellationen wären sonst immer ad episcopum Suerinensem gegangen. Daß man auf Ulrichs Begehren seit einigen Jahren einen Capitular als Assessor zum Hofgericht schicke, könne kein Grund sein dem Stift die Obergerichtsgewalt zu nehmen.
Da die Forderungen der Domherren nicht aufhörten, gab Herzog Ulrich 1591 seinen Räthen Dr. Jac. Bording und Dr. E. Cothmann den Auftrag, die gravamina des Capitels entgegenzunehmen und über dieselben zu berichten. Das Capitel übergab nun (28. Sept.) diesen Räthen seine Vorschläge, welche in Kürze darauf hinausliefen, daß Ulrich verpflichtet sei, dem Stift die Obergerichtsgewalt zu lassen, zumal da er dies selbst verschiedentlich eingeräumt habe. Die Appellationen in zweiter und dritter Instanz dürften nicht aus dem Stift gehen. Wegen der Kosten hoffe man sich zu vergleichen; die übrigen Stiftsstände würden auch wohl einen Theil derselben auf sich nehmen, denn sie allein zu tragen sei das Capitel keineswegs verpflichtet.
Am 1. Mai 1593 wurden der Propst Otto v. Wackerbarth und der Canonicus Joachim v. Bassewitz zu einer persönlichen Vorstellung an Ulrich geschickt. Sie wiesen besonders darauf hin, daß die Lehnsleute Hardenack und Otto v. Wackerbarth, welche nur im Stifte ansässig seien, wider ihren Willen vor das Hofgericht gezogen wären; das sei ein Nothstand, der abgestellt werden müsse. Ulrich erwiderte dem Capitel am 4. Mai schriftlich, "wenn die Stiftsstände die Unkosten darauf wenden wollten", so könne ein besonderes Stiftsgericht eingesetzt werden. Dann sollten aber hinfort die Stiftsstände, welche nicht in Meklenburg ansässig wären, nur an den Bischof appelliren und weiter nicht. Das gefiel wieder


|
Seite 164 |




|
den Capitularen nicht, sie glaubten, daß die Stände die Kosten nicht allein zu tragen brauchten, und wollten außerdem auch die Appellationen an das Reich frei gelassen haben. Da schrieb Ulrich unterm 19. Nov. 1593, da das Capitel sein Anerbieten nicht angenommen habe, so sehe er sich veranlaßt dasselbe zurückzuziehen. Dadurch war die ganze Streitfrage wieder an ihren Ausgangspunkt zurückversetzt. Daß das Capitel nun noch Erklärungen abgab und Resolutionen faßte, konnte so gut wie garnichts nutzen. Wir übergehen darum dieselben mit Stillschweigen und dürfen das um so eher, als nun die Angelegenheit in ein anderes, ernsteres Stadium trat.
Der Fall, welcher eine Wendung der Dinge hervorbrachte, ist folgender. Der Rath zu Bützow wurde von Catharina Schröder puncto injuriarum beim Land= und Hofgericht zu Güstrow verklagt. Beklagter wandte exceptio fori ein; aber am 22. Januar 1594 erschien zu Güstrow das Urtheil, das der Rath sich in dieser Sache vor dem Hofgericht einzufinden habe.
Nachdem der Bützower Magistrat nun noch vergeblich versucht hatte, durch eine Vorstellung bei Herzog Ulrich sich von dem fremden Gerichtshof zu befreien, wandte er sich mit einer Bitte um Unterstützung an das Domcapitel, um mit diesem vereint an das Reichskammergericht appelliren zu können. Das Capitel versagte natürlich seine Hülfe nicht. Aber so rasch, wie der Magistrat es wünschte, war die schwerfällige Corporation nicht vorwärts zu bringen, nur ein einziger Capitular, der Dompropst v. Wackerbarth, entwickelte einen großen Eifer. Er reiste im April nach Bützow und nahm dort am 18. aus der Hand des Notars Giesenhagen ein "documentum protestationis urbis Bucensis" entgegen, in welchem erklärt wurde, die Stadt Bützow wolle vor Gott, dem Bischof, dem Stifte und der Posterität entschuldigt sein, wenn der Bischof und das Capitel sich dieser gerechten Sache nicht annähmen. v. Wackerbarth übergab, aber nur für seine eigne Person, nicht im Namen des Capitels, eine Gegenprotestation, in welcher er behauptete, das Capitel habe die Appellation der Stadt an das Kammergericht wohl unterstützen wollen, habe aber erklären müssen, daß die Angelegenheit erst in einer Capitelssitzung zu berathen und demnächst darüber an den Administrator zu berichten sei. Das sei jetzt alles geschehen, ja man habe auch dem Rathe zu Bützow mitgetheilt, was man an Herzog Ulrich berichtet. Die Antwort desselben werde der Rath ebenfalls erfahren. Uebrigens wolle das Capitel auch jetzt schon Hülfe leisten, man möge nur bestimmen, ob es durch Rathschläge oder durch Geldmittel geschehen solle.


|
Seite 165 |




|
Die Bereitwilligkeit des Capitels, sogar Geld zur Verfügung zu stellen, war vielleicht mehr durch einen andern Fall veranlaßt, der für die Domherren noch bedenklicher sein durfte als das Urtheil gegen Bützow. In der Klagesache Caspar Rapps gegen Jürgen v. Wopersnow pto. debiti, jetzt executionis, ergingen nämlich unterm 22. Jan. 1594 aus dem Hofgericht zu Güstrow executoriales an den Amtmann zu Bützow auf des Beklagten Gut Dämelow und seinen Antheil an der Mühle zu Rubow, d. h. auf Güter, welche im Stifte lagen. Das Capitel protestirte auf eignen Antrieb gegen dies Verfahren und suchte umständlich nachzuweisen, daß Stift als reichsunmittelbares Land nicht von einem fremden Gericht abhängig sein könne.
Endlich waren denn auch im Capitel die Vorbereitungen so weit erledigt, das ein gemeinsames Vorgehen mit Bützow möglich war. Auf dem Stiftstage im October 1594 überreichten Capitel und Städte - es hatte sich also auch Warin angeschlossen - ein Schreiben an Herzog Ulrich, um ihre schon früher ausgesprochene Bitte um ein eignes Appellationsgericht zu wiederholen, "weil das Stift ein sonderbarer Stand des Reichs allwege gewesen, wie auch durch gegenwärtigen Stiftstag bezeugt würde, und weil das Stift immer seine sonderliche hohe Jurisdiction gehabt habe und noch habe." Der Herzog habe sich auf fast allen Stiftstagen erboten ein eignes Gericht im Stift zu bestellen, er möge daher jetzt bündige Zusage geben; andern Falls müsse man an das Reichskammergericht appelliren.
Von bedeutender Wirkung war dies Schreiben allerdings nicht; aber es wurde doch auch nicht ganz unbeachtet bei Seite gelegt, denn Herzog Ulrich forderte bald darauf, um sich genau zu informiren, von dem Gelehrten Dr. E. Cothmann einen Bericht über das Verhältniß des Stifts zu Meklenburg, besonders in Bezug auf die Jurisdiction. Dieser Bericht, abgefaßt unterm 8. Jan. 1595, hatte fast ausschließlich das Protocoll des Zeugenverhörs zu Güstrow 1563, bei welchem es sich um die Frage der Reichsunmittelbarkeit des Stifts handelte (S. 113), zur Grundlage. Wie nun dort die Zeugen größtentheils von der Abhängigkeit des Stifts von Meklenburg überzeugt gewesen waren, so behauptet auch Cothmann mit denselben Beweisen wie jene, daß Meklenburg Hoheitsrechte im Stifte besitze. Indessen, meinte er, sei doch erwiesen, daß die Bischöfe immer das "exercitium jurisdictionis" in bürgerlichen und peinlichen Sachen gehabt und noch hätten, doch wollte er darunter nur die Jurisdiction erster Instanz verstehen.


|
Seite 166 |




|
Auf Anrathen Cothmanns wurde dann am 20. Jan. 1595 zu Güstrow ein "consilium principis" gehalten, welchem 3 Landräthe: Joh. v. Cramon, Jürgen v. Raben und Dietrich v. Bevernest, und 3 Gelehrte: Dr. Albinus, Dr. E. Cothmann und Dr. Möller, beiwohnten. Das Resultat dieser Berathung war die Erklärung, daß es sich hinlänglich beweisen ließe, wie die Stiftsunterthanen immer vor dem Güstrower Hofgericht Recht gesucht; Meklenburg sei also in dieser Hinsicht in possessione. Wollten die Capitularen den meklenburgischen Herzogen das Recht der Jurisdiction im Stift streitig machen, so müßten sie noch bessere Gründe vorbringen als bisher; vor allem müßten sie die alten Verträge zwischen den Herzogen und den Bischöfen, von denen sie sprächen, bekannt geben, und wenn das geschehen sei, so sollte ihnen darauf von Cothmann geantwortet werden. In diesem Sinne wurde endlich nach abermaliger Petition des Capitels unterm 20. März 1595 die Antwort erlassen.
Ulrich hatte aber unterdessen am 21. Jan. 1595 sowohl das Domcapitel wie den Magistrat zu Bützow wegen Ungehorsams gegen das meklenburgische Hofgericht 1 ) in je 100 Mark Strafe verurtheilt, und dies wurde die Veranlassung, daß beide, Capitel und Magistrat, unterm 30. Jan. an das Reichskammergericht appellirten. Zum Anwalt bestellten die Appellanten den Dr. Marsilius Bergner. In der Anklageschrift behaupteten sie, daß der Herzog erst seit 20 Jahren versucht habe, die Stiftsleute vor das Güstrower Landgericht zu ziehen, früher sei das unerhört gewesen. Das meklenburgische Gericht sei aber für Bewohner des reichsunmittelbaren Stiftes incompetent; die Stiftsstände hätten ein Recht, eigne Gerichte zu fordern, und Ulrich selbst hätte noch auf dem Stiftstage 1563 in Folge Bewilligung der Reichsanlagen von Seiten der Stände ihnen durch einen Revers alle ihre Rechte gesichert.
Eins muß hier auffallen, nämlich daß die Ritterschaft, die auf den Stiftstagen in den 70er Jahren, zu welcher Zeit nach Aussage der genannten Appellanten die Ladungen der Stiftsleute vor das meklenburgische Hofgericht zuerst stattfanden, so eifrig die Selbständigkeit der Stiftsjurisdiction vertrat, jetzt ihre früheren Genossen ganz im Stiche ließ. Warum das geschah, erklärten die Stiftsritter selbst: sie scheuten die Kosten, und ihnen war es jetzt ebenso


|
Seite 167 |




|
lieb, vor den Herzogen von Meklenburg wie vor dem Administrator Recht zu geben und zu nehmen, weil sie doch größtentheils auch in Meklenburg ansässig waren.
Aller Gewohnheit zuwider forderte das Kammergericht auf die Anklage sehr bald von Herzog Ulrich die Einsendung der Acten über die beiden Gerichtsfälle: Cath. Schröder wider den Magistrat zu Bützow und Caspar Rapp wider Jürgen v. Wopersnow, und ebenso ungewöhnlich rasch, schon unterm 10. Mai 1595, wurde der Herzog auf den 24. Juli nach Speier zu Gericht geladen. Der Fortgang des Processes war aber wieder in alter Weise langsam, sehr langsam, und das ganze Ergebniß der vielen Schreibereien von beiden Seiten so gering, daß es der Mittheilung schwerlich werth ist.
Meklenburgischer Anwalt in diesem Proceß war Dr. Joh. Jac. Kremer, der zuerst 1595 von Herzog Ulrich, dann 1604 von Herzog Karl und endlich 1611 von den beiden Herzogen Adolf Friedrich und Johann Albrecht Vollmachten erhielt. Kremer, der sich häufig vom Professor E. Cothmann Rath holte, verlangte vorerst von der Gegenpartei die Ablegung des Appellationseides vor dem Forum, von welchem appellirt wurde, d. h. vor dem Güstrower Hofgericht. Diese Forderung schien aber dem Capitel unerhört, da es noch niemals die Competenz dieses Gerichts anerkannt habe. Wenn es überhaupt den Eid schwören werde, so könne es nur mit Protest geschehen. Das wird man denn wohl gethan haben; jedenfalls übergab Dr. Bergner 1601 das documentum paritionis in Betreff des Appellationseides. Es ist erklärlich, daß der ganze Proceß bis in die Unendlichkeit dauern mußte, wenn die Erfüllung einer einzigen Förmlichkeit ihn viele Jahre aufhalten konnte. Es nimmt daher nicht Wunder, daß Herzog Ulrich II. noch 1613 von diesem 1595 begonnenen Proceß sagen konnte, "er schwebe zu Speier noch in unerörterten Rechten."
Uebrigens gesellten sich zu diesem ersten Proceß bald andere; denn Herzog Ulrich I. forderte trotz der Klage beim Kammergericht nach wie vor die Stiftsleute vor das meklenburgische Hofgericht, und die Capitularen unterließen es nicht, auch wegen dieser neuen Beeinträchtigungen der von ihnen beanspruchten Rechte Beschwerden nach Speier zu senden. In einer dieser nachträglich angebrachten Klagen erhielt das Capitel ein sehr günstiges Urtheil von dem Kammergericht. Dasselbe erklärte nämlich am 24. März 1598 "in Sachen des Capitels wider Herzog Ulrich pto. primae appellationis in specie Simon Gerdes Wittwe", daß diese Gerdes nicht


|
Seite 168 |




|
verpflichtet sei, vor dem Güstrower Hofgericht sich zugestellen, wie ihr von Herzog Ulrich befohlen, und daß ihr die in dieser Streitfrage erwachsenen Gerichtskosten zu ersetzen seien.
Die letzte Nachricht über die Verhandlungen zu Speier findet sich in einem Actenverzeichniß, welches die einfache Notiz enthält: "Completum (d. h. das Actenmaterial) 21. Nov. 1613." Ein die ganze Frage entscheidendes Urtheil ist nicht gefällt worden.
Mehr Mittheilungen als über den Proceß enthalten die Acten über die gleichzeitig geführten, gütlichen Ausgleichsverhandlungen in dieser Streitsache. Anscheinend regte das Capitel zuerst diesen Ausgleichsversuch an, da es unterm 13. Oct. 1595 an Herzog Ulrich ein "articulirtes Libell" sandte, mit der Bitte, der Herzog möchte dagegen seine Bedenken mittheilen, damit man gütlich verhandeln könne. Ob auf dies Libell eine directe Antwort erfolgte, wissen wir nicht, dahingegen ist bekannt, daß Ulrich auf Bitten der Königin Sophie von Dänemark, an welche sich das Capitel auf Grund der Postulation des jungen dänischen Prinzen zum Coadjutor des Stifts gewandt hatte, unterm 4. Nov. 1595 eine "Tagefahrt" auf den 9. Dec. zu Güstrow anordnete, zu welcher er seine Räthe Joh. v. Cramon auf Woserin, Jürgen v. Raben d. ä. auf Stük, Dietrich v. Bevernest auf Lüsewitz, Dietrich v. Maltzan auf Ulrichshusen, Dr. Joh. Albinus, der sich wegen Krankheit entschuldigte, Dr. Barth. Clinge, Claus v. Below auf Weisin, Dr. E. Cothmann, Dr. Hajo v. Nessen und nachträglich noch Amtmann Christoph v. Rohr zu Stavenhagen, "weil er zuvor das Amt Bützow eingehabt", einlud, und zugleich das Capitel aufforderte, zwei oder drei Deputirte zu schicken. Später wurde für Güstrow als Versammlungsort Bützow bestimmt, weil Ulrich dann dort grade anwesend sei.
Das Capitel wählte zu seinen Vertretern auf der Conferenz den Propst O. v. Wackerbarth, den Dekan Ludolf v. Schack und den Senior Joach. v. Bassewitz. Aus Vorsicht wünschten die Capitularen sich vor den Verhandlungen mit den übrigen Stiftsständen, Ritterschaft und Städten, zu verständigen und luden diese darum zu einer Besprechung am Tage vorher ein, was Herzog Ulrich für ganz Verfassungswidrig hielt und scharf tadelte. Daß unter diesen Umständen die Ritterschaft sich zur Berathung einstellte, ist unwahrscheinlich, vielleicht fand sich aber der Magistrat zu Bützow dazu geneigt. Weil ferner die Capitularen wohl einsahen, daß sie dem herzoglichen Gesandten gegenüber, da diesem die Leitung der Verhandlungen zukam, allein einen schweren Stand haben möchten, so sahen sie sich nach starken Bundesgenossen um,


|
Seite 169 |




|
und diese glaubten sie in Dänemark finden zu können. Denn die dänische Königsfamilie hatte wegen der oben erwähnten Postulation des Prinzen Ulrich wohl ein Interesse daran, daß dem Stift auch in der Jurisdiction seine Selbständigkeit gewahrt blieb. Das Capitel bat also wiederum die Königin Sophie, und diese schickte darauf zu der Versammlung drei ihrer Räthe: Hans Blume auf Seedorf und Neverstorf (Domdekan zu Lübek und Hofmeister des Prinzen Ulrich), Dr. Ludwig Pintzier und Apitz von Grünenberg nach Bützow. Es handelte sich nun aber darum, mit welchem Recht diese dänischen Gesandten Zutritt zur Versammlung begehren konnten, und wie sie dort auftreten sollten. Das Capitel meinte, sie müßten als die Abgesandten des erwählten Nachfolgers von Herzog Ulrich als Substitute des Administrators fungiren; ja sie wünschten sogar, daß den Gesandten des Successors Ulrichs das Directorium auf der Conferenz übertragen würde; aber Ulrich erklärte, er brauche keine Substitute. Die dänischen Räthe werden darum wohl von der Theilnahme an den officiellen Verhandlungen ausgeschlossen worden sein; jedenfalls wird nicht mitgetheilt, daß sie etwas Erhebliches ausgerichtet haben; doch durften sie dem Herzog Ulrich am 8. Dec. ihre Creditive überreichen.
Da die Capitularen am 9. Dec. eine "Supplication" an Herzog Ulrich einreichten, so wurde die Conferenz sofort bis zum 11. ausgesetzt. Nach Eröffnung derselben wurden die Domherren aufgefordert, ihre Beschwerden vorzutragen. Sie erklärten, die Jurisdictionsfrage sei nun seit 25 Jahren auf allen Stiftstagen tractirt. Bisher hätten sie die Sache nicht so sehr ernst genommen, weil das meklenburgische Hofgericht bisher nicht auf den Gerichtszwang bestanden hätte, wie jetzt. Daß aber, wie von Seiten Meklenburgs behauptet wurde, durch die Beschickung des Hofgerichts mit einem Domherrn als Assessor Zugeständnisse der meklenburgischen Obergerichtsgewalt gemacht seien, könne man nicht gelten lassen, denn dieser Domherr würde wegen der überall gültigen "dignitas ecclesiastica" gefordert und wegen der nahen Verwandtschaft mit Meklenburg vom Stifte gegeben.
Nach längeren Debatten schlugen die fürstlichen Räthe vor, es solle im Stift ein Gericht I. Instanz bestehen, die Appellationen an das meklenburgische Hofgericht gehen, aber die Execution des Berufungsurtheils dem Richter erster Instanz verbleiben, oder es sollten Rechtsgutachten von 2 oder 3 Juristenfacultäten eingeholt werden. Beide Vorschläge fanden die Billigung der Domherren nicht, lieber wollten sie, wie sie sagten, den Proceß beim Kammergericht weiter gehen lassen. Die fürstlichen Räthe waren mit der Fortsetzung des Pro=


|
Seite 170 |




|
cesses einverstanden, behaupteten aber, daß während desselben das Hofgericht in possessione jurisdictionis bliebe. Der Bericht über die Conferenz schließt: "Und weil man befunden, daß ungeachtet vielfältiger eingewandter Mühe und Fleißes die Sache auf seinen andern Weg hat beigelegt werden können, so habens die Unterhändler auch dabei müssen beruhen lassen und der Handlung abdanken." 1 )
Am 14. Dec. 1595 erfolgte der Bescheid Ulrichs:
1) Es sei erwiesen, daß Stiftsunterthanen und = Stände, die nicht in Meklenburg begütert, sich dem meklenburgischen Landgericht gestellt hätten.
2) 1523 hätten die Stiftsstände bei den Verträgen und der Conföderation Meklenburgs mit seinen Ständen den meklenburgischen Herzogen willigen Gehorsam geleistet.
3) Nach den 1564 beim Kammergericht publicirten Kundschaften über die Exemption des Stifts 2 ) sei das Stift Meklenburg incorporirt.
4) Die Bestätigung der meklenburgischen Land= und Hofgerichtsordnung durch den Kaiser beweise, daß Einer aus dem Stift ats Stand des Herzogthums dem Land= und Hofgericht verwandt gemacht werden solle. Otto v. Wackerbarth selbst habe oft als Stiftsstand dem Landgericht beigewohnt.
5) Stiftsunterthanen hätten vor dem meklenburgischen Consistorium Recht genommen, auch noch nach 1586, obwohl damals auf Wunsch Wackerbarths die Consistoriales Befehl bekommen, Stiftseingesessene nicht zu richten.
6) Sogar als Partei habe der jetzige Propst zweimal vor dem meklenburgischen Landgericht gestanden.


|
Seite 171 |




|
7) In der Klagesache gegen den kaiserlichen Fiscal pto. exemptionis habe 1583 zu Sternberg (s. S. 120) O. v. Wackerbarth, damals Dekan, selbst mit Joach. v. Bassewitz u. a. die vom Administrator und Capitel aufgesetzten articuli probatorii dem kais. Subdelegirten übergeben.
8) Daß das Stift in criminalibus et civilibus peculiaris jurisdictio habe, nehme man nicht in Abrede. Es wäre der Administrator auch geneigt, auf gewisse Zeit im Jahr Stiftsstände und Räthe nach Bützow zu entbieten, damit sie dort "vorfallende Sachen in seinem Namen verabschieden."
9) Obwohl bisher die Stiftsleute nach eignem Bekenntniß des Capitels in prima instantia am meklenburgischen Landgericht mit Recht belangt worden, so wolle Ulrich doch sich dahin erklären, daß Stiftsbewohner sich künftig nur ad secundam instantiam an dies Gericht wenden sollen.
Als Beweis für die Behauptung in Nr. 1 wurde eine Anzahl von Processen aufgeführt, in welchen Stiftsleute das Urtheil des Güstrower Gerichts eingeholt haben.
Die Capitularen erwiderten darauf schriftlich am 16. December 1595:
1) Die von der Gegenpartei angezogenen Beispiele von Gerichtsverhandlungen zu Güstrow seien schon früher genügend widerlegt. Bisher gäbe es kein Exempel wider die Stiftsstände, dem nicht widersprochen, und das nicht von der Obrigkeit inhibirt sei. Sie suchen darauf einzelne Fälle als nicht zutreffend darzustellen.
2) Das Capitel habe immer beim Administrator darum angehalten, daß die Stiftslehnsleute actione personali und ihrer Stiftsgüter halber ratione domicilii nirgends anders als im Stift gerichtlich belangt werden könnten.
3) Der Administrator habe nur gefordert, daß auch in Meklenburg ansässige Stiftslehnsleute vor dem meklenburgischen Gericht Recht nehmen und geben sollten.
4) Die Capitularen räumen nicht ein. daß sie als Parteien vor dem meklenburgischen Hofgericht gestanden, sondern behaupten, daß sie auf eine desfallsige Ladung hätten einwenden lassen, sie seien nicht verpflichtet, der Ladung zu folgen.
An die Königin=Wittwe in Dänemark schrieb Herzog Ulrich unterm 17. Dec., die Capitularen hätten seit 1570 widerrechtlich ein besonderes Stiftsgericht begehrt. Das Stift sei kein selbständiger Reichsstand, wenn auch Bischof Magnus dem Reich einmal (1546) für das Stift besonders contribuirt, und seit dann die Stifts=


|
Seite 172 |




|
contribution in gleicher Weise habe entrichtet werden müssen, sei dies doch immer mit Protest geschehen. Durch den meklenburgischen Vertrag von 1523, welchen zwei Domherren mit unterschrieben, würde die Abhängigkeit der Stiftsstände von Meklenburg völlig bewiesen. Uebrigens habe der Propst v. Wackerbarth seit 27 Jahren als Assessor im meklenburgischen Hofgericht gesessen. Um aber Weiterungen zu vermeiden, habe er, der Herzog, sich bereit erklärt, mit Beihülfe der Stiftsstände ein eignes Gericht im Bisthum zu halten, doch müßten die Appellationen von diesem ebenfalls an das meklenburgische Hofgericht gehen. Er habe zur Schlichtung des Streites vorgeschlagen, man wolle sich Rechtsbelehrungen von zwei unparteiischen juristischen Facultäten holen, und bei ungleichem Urtheil dieser eine dritte Facultät entscheiden lassen. Diesen Vorschlag aber wollten die Capitularen nicht annehmen. Endlich erzählte er noch, daß im Jahre 1574 das ganze Capitel von Joach. v. Wopersnow beim Hofgericht zu Güstrow verklagt sei und diesem Gericht seinen Procurator gestellt habe. Nachdem die Königin den Herzog Ulrich dann noch einmal gebeten hatte, er möge, trotzdem die Verhandlungen "unfruchtbar abgegangen", noch einmal versuchen, Einigkeit herzustellen, damit "seine Successoren deshalb nicht von Meklenburg und dem Capitel beschwert" würden, versprach der Herzog, er wolle sich der Jurisdictionsfrage noch ferner angelegen sein lassen.
Einer der Domherren, Joach. v. Bassewitz, zugleich herzoglicher Amtmann zu Dobbertin, sagte sich unmittelbar nach der Güstrower Conferenz von dem Vorgehen des Capitels los. Am Montag nach Weihnachten (1595) schrieb er an Herzog Ulrich, er habe sich bisher wegen seines Eides den übrigen Capitularen angeschlossen, da aber dies von dem Herzog übel vermerkt würde, so solle ihm seines Fürsten "Wohlgewogenheit und Gnade viel lieber sein als vorgedachte Sache." Um den Herzog wieder ganz zu versöhnen, suchte er die Vermittelung von dessen Gemahlin, der Herzogin Anna, nach, und so erlangte er wieder Gnade.
Nicht so glücklich wie er war sein College Otto v. Wackerbarth, welcher zweimal an die Herzogin Anna schrieb, um die Gunst seines Fürsten wieder zu erhalten. Herzog Ulrich traute ihm als dem Hauptführer der Domherren in dem Jurisdictionsstreit nicht mehr.
Der Vorschlag Ulrichs Rechtsgutachten einzuholen kam indessen doch so weit zur Ausführung, das die Domherren die juristische Facultät zu Helmstedt unterm 22. Dec. 1595 um ein Urtheil baten. Aus dem dieser Bitte angeschlossenen Bericht mag


|
Seite 173 |




|
mitgetheilt werden, daß Herzog Ulrich, nachdem er vom Capitel und der Stadt Bützow wegen des oben erwähnten Falles beim Reichskammergericht verklagt sei, "trotz 3 erhaltener kaiserlicher Inhibitiones sich unterstanden" habe, auch andere Stiftsstände und bischöfliche Amtleute vor sein Hofgericht zu ziehen. Die Frage welche die Facultät ihnen beantworten sollte, lautete: "Hat nach Inhalt der übersandten Acten das Stift die Jurisdiction I., II. und III. instantiae an Meklenburg verloren?"
Die übersandten Acten waren nach einem Inhaltsverzeichniß Abschriften von Urkunden, welche die Stiftung und die kaiserlichen und päpstlichen Confirmationen des Bisthums, sowie die Verträge der Bischöfe und des Capitels mit den Herzogthümern Meklenburg, der Grafschaft Schwerin und dem Königreich Dänemark betreffen 1 ), und Abschriften von den Acten, die in neuerer Zeit in diesem Streit mit Herzog Ulrich erwachsen waren.
Das Helmstedter Urtheil wurde schon am 5. Jan. 1596 gefällt; es lautete: "Durch die übersandten Acten, inc. der vorgekommenen Fälle der Rechtsprechung des meklenburgischen Hofgerichts, ist die possessio jurisdictionis Meklenburgs nicht genügend erwiesen, um so weniger, das man an das Hofgericht und nicht an pro tempore administratorem appelliren müsse."
Mit diesem Gutachten wandten sich nun die Domherren an die meklenburgischen Räthe, welche der Bützower Conferenz im vorigen Monat beigewohnt hatten, und baten, sie möchten sich der Streitfrage um die Stiftsjurisdiction annehmen, damit dieselbe gütlich beigelegt werde. Die Räthe berichteten aber zunächst an ihren Herzog, und dieser erwiderte ihnen, das der Bericht der Domherren an die Juristenfacultät nicht capitulariter (jedenfalls fehlte die Mitwirkung v. Bassewitzens) gefaßt sei, und darum weder er, noch die Antwort der Facultät eine Bedeutung habe. Der Herzog wollte, daß das Capitel diese Sache noch einmal einer "unverdächtigen" Facultät vortrage.
Seinerseits ließ nun Herzog Ulrich mit dem Ersuchen um ein Rechtsgutachten einen Bericht an die Juristenfacultät zu Frankfurt (d. d. 31. Jan. 1596) aufsetzen, in welchem die Sachlage folgendermaßen dargestellt wurde:


|
Seite 174 |




|
1) Das Bisthum Schwerin sei 1062 von Ulrichs Vorfahren Gottschalk gestiftet und fundirt, 1170 von Herzog Heinrich von Sachsen renovirt und darauf von den meklenburgischen Herzogen und anderen dotirt. 1 )
2) Die meklenburgischen Herzoge hätten immer "Hoheit, Gerechtigkeit und Jurisdiction am Stift gehabt und exercirt."
3) Die Bischöfe seien von den meklenburgischen Herzogen immer zu Rath gefordert, zu Legationen gebraucht und zu Landtagen verschrieben.
4) Das Stift sei von Meklenburg mit Collecten und andern oneribus belegt.
5) Der (bekannte) Vertrag von 1523 sei vom Bischof und Capitel als einem Prälatenstand mit dem bischöflichen Secret und dem Capitelsiegel untersiegelt.
6) Seit Bischof Magnus 1546 die Türkensteuer selbständig, obwohl mit Protest, gezahlt habe, sei das Bisthum als ein besonderer Stand in die Reichsmatrikel geschrieben; aber hiergegen hätten die Herzoge von Meklenburg Verwahrung eingelegt und führten auch noch jetzt deshalb einen Proceß mtt dem Reichsfiscal.
7) Durch die Constitution von 1571 sei Meklenburg in 6 Kirchenkreise getheilt, das Bisthum Schwerin gehöre mit der Grafschaft Schwerin zu einem (dem 4.) dieser Kreise, und es müsse aus dem Stift vom Urtheil des Superintendenten an das Consistorium in Rostock appellirt werden. 2 ) Es hätten auch Stiftsunterthanen in der That an das Rostocker Consistorium und von diesem wieder an das meklenburgische Hofgericht appellirt. 3 ) Auf Bitten des


|
Seite 175 |




|
Capitels habe zwar Ulrich "auf gewisse Maße consentirt" und bisweilen ein besonderes Stiftsconsistorium gehalten; aber trotzdem habe das Rostocker Consistorium immer "freien Lauf gehabt."
8) In der verbesserten meklenburgischen Land= und Hofgerichts=Ordnung, welche 1569 vom Kaiser bestätigt und 1570 publicirt worden, werde bestimmt, daß in diesem Judicium 4 Landräthe, 4 gelehrte Räthe, 1 Doctor der Universität, 1 Gelehrter aus dem Stift und 2 Bürgermeister (aus Rostock und Wismar) sitzen sollen. Diese Gerichtsordnung sei unter Beirath von Stiftsständen entworfen, und seit ihrer Einführung habe immer Einer aus dem Stift, u. a. der Propst v. Wackerbarth, dem Hofgericht als Assessor beigewohnt. 1 )
9) "Etliche" aus dem Capitel hätten aber ein besonderes Stiftsgericht gewünscht und sich am 30. Dec. 1570 über das meklenburgische Hofgericht bei Ulrich beklagt.
10) Der Herzog habe nach vielen Verhandlungen sich endlich für den Mittelweg erklärt und soweit nachgegeben, daß er ein eignes Stiftsgericht, von welchem aber an das meklenburgische Hofgericht appellirt werden dürfe, versprochen habe.
11) Darauf sei er am 4. Mai 1593 noch weiter gegangen und habe bewilligt, daß in reinen Stiftssachen nur an den Bischof solle appellirt werden. Weil aber die Domherren auch die Appellation an das kaiserliche Kammergericht hätten haben wollen, die bisher nie stattgefunden, so hätte der Herzog am 19. Nov. 1593 sein früheres Zugeständniß wieder zurückgenommen und seinen Befehl vom 20. Jan. 1588 erneuert.
12) 1594 wäre der Magistrat zu Bützow ob male administratam justitiam vor das meklenburgische Land= und Hofgericht citirt, er hätte aber durch seinen Syndicus exceptionem fori einwenden lassen. Als nun Ulrich unterm 22. Jan. 1594 dem Magistrat befohlen, sich der Ordnung gemäß diesem Gericht zu stellen, da hätten der Magistrat und das Domcapitel an das Kammergericht appellirt. Weiter wird nun über die Bützower Conferenz im December 1595 berichtet und bei der Gelegenheit erzählt, daß trotz des Widerspruchs der Capitularen mehrere Fälle, in welchen bloße Stiftsdifferenzen von dem meklenburgischen Gericht erledigt


|
Seite 176 |




|
worden, könnten nachgewiesen werden. 1 ) Nachdem dann mitgetheilt ist, daß die Capitularen den Vorschlag des Herzogs Facultäts=Gutachten einzuholen, nicht angenommen, wird endlich die Frage gestellt, ob das meklenburgische Land= und Hofgericht in possessione vel quasi jurisdictionis et superioritatis sei.
Das aus Frankfurt geschickte Facultäts=Gutachten gab selbstredend dem Herzog Ulrich völlig Recht.
Nach Herzog Ulrichs Wunsch hätte nun, da die beiden Rechtsgutachten ungleich waren, ein drittes, entscheidendes Urtheil eingeholt werden müssen. Dazu kam es aber anscheinend nicht, doch ließ man auch die Streitfrage nicht ganz ruhen. Es verhandelten die Parteien bald wieder schriftlich. Unterm 27. April 1597 schlug der Herzog dem Capitel vor, es sei das Beste, daß bis zur Entscheidung des Kammergerichts ein Stiftsgericht erster Instanz auf des Administrators und des Capitels gemeinsame Kosten angeordnet und von diesem nöthigenfalls an das meklenburgische Hofgericht appellirt werde. Das Capitel erwiderte 22. Oct. 97, daß es diese Appellation nicht zulassen dürfe, lieber möge wieder wie früher die Berufung an die bischöfliche Kammer gestattet werden.
Seitdem geriethen die Vergleichsversuche ins Stocken, und zwar aus dem Grunde, weil der Propst v. Wackerbarth, der eifrigste Vertheidiger der Unabhängigkeit des Stifts, alt und schwach wurde und endlich, 1599, aus dem Leben schied. Erst nach mehreren Jahren, 20. Jan. 1602, fordert Herzog Ulrich das Capitel zur Fortsetzung der gütlichen Verhandlungen, die seit Wackerbarth's Tode unterbrochen seien, wieder brieflich auf. Die Domherren baten dann in ihrer Antwort auf Ulrichs Brief um eine Conferenz in Bützow, zu welcher auch der Coadjutor Ulrich II. geladen werden möchte. Sie erhielten nun zwar die Einladung nach Bützow zum 1. Nov. 1602, zugleich aber auch die entschiedene Erklärung, daß der Herzog den Coadjutor nicht laden werde, "weil wir des Stifts vollkommene Administration vor uns behalten wollen." Nach langem Besinnen antwortete das Capitel am 30. October mit einer Ausflucht, daß es die Conferenz nicht beschicken könne, weil diese nicht dem Capitel im Namen Ulrichs,


|
Seite 177 |




|
sondern nur dem Propst durch den Rath Reutze, und zwar bei Gelegenheit eines andern Schreibens angekündigt worden. Mit einer Ausflucht, sagen wir, denn jedenfalls mußte wenigstens der Propst wissen, daß das Capitel ganz förmlich eingeladen war, da sich unter den Acten, welche später im Besitz seiner Erben waren, eine von Herzog Ulrich eigenhändig unterschriebene, erbrochene Einladung an das Capitel vom 22. Juni findet.
Dies ist die letzte Nachricht über den Jurisdictionsstreit zur Zeit Ulrichs I. Mit dem Regierungsantritt Ulrichs II. änderte sich die Sachlage, wie in dem oben erzählten Streit um die Unmittelbarkeit des Stifts überhaupt, insofern wesentlich, als nun mit den Ständen der Administrator nicht nur das Jurisdictionsrecht des Stifts verfocht, sondern auch ohne Weiteres selbständige Stiftsgerichte einsetzte. Man war sich also im eignen Lande völlig einig, und es galt nur den Kampf gegen Meklenburg auszufechten.
Leider ist über die Jurisdiction im Stift während der Herrschaft der beiden dänischen Prinzen (1603 - 1626) so gut wie garnichts überliefert; aber eben weil keine Nachrichten vorhanden sind, dürfen wir annehmen, daß die Rechtspflege nach den Bestimmungen der Capitulationen der beiden Administratoren (von 1597 und 1622) und zur Zufriedenheit der Stiftsstände geübt wurde. Darnach werden die Stiftsstände in ihren Gebieten die Jurisdiction 1. Instanz erhalten, die Administratoren hingegen im Domanium und in der amtssässigen Stadt Warin die niedere Gerichtsbarkeit durch ihre Beamten verwaltet haben. Ein Gericht 2. Instanz kann nicht gefehlt haben, allem Anschein nach fungirte als solches die bischöfliche Kanzlei zu Bützow; denn nachweislich war noch unter der Herrschaft des Herzogs Adolf Friedrich die bischöfliche Kanzlei das Hauptgericht im Stift. Wo es nöthig war, werden außerdem die Administratoren die Appellation an das Reichskammergericht gestattet haben.
In Meklenburg folgte dem Herzog Ulrich dessen jüngster Bruder Karl in der Regierung (1603 bis 1610); er erbte mit dem Thron des Herzogthums Meklenburg (= Güstrow) auch den Streit um die Hoheitsrechte über das Stift. Seine Ansicht über diese Streitfrage war der seines Vorgängers gleich, aber sein Eifer und seine Ausdauer waren viel geringer. Uebrigens wurde ihm auch kräftiger Widerstand geleistet, und er befand sich nicht mehr wie Ulrich I. in possessione des streitigen Rechts.
Utrich II. hatte kaum die Stiftsregierung angetreten, als er seinen festen Willen, die selbständige Jurisdictionsgewalt des Stifts


|
Seite 178 |




|
entschieden zu vertheidigen, unzweideutig kund gab. Schon am 1. Mai 1603 nämlich verbot er dem Dompropst v. Bassewitz, einer etwaigen Einladung zur Assessur beim meklenburgischen Hofgericht zu folgen, und am Tage darauf schrieb er an Herzog Karl, daß es dem Bisthum Schwerin nicht zum Präjudiz gereichen solle, wenn das Capitel früher aus seiner Mitte einen Assessor zum Hofgericht geschickt habe. Er beanspruche völlig selbständige Jurisdiction für sein Stift, doch sei er, um den vorhandenen Streit aus der Welt zu schaffen, erbötig, in gütliche Verhandlungen mit Meklenburg zu treten. Herzog Karl antwortete (6. Mai), er wisse nichts von Differenzen wegen der Jurisdiction, müsse darum auch Ulrichs Protestation "an ihren Ort gestellt sein" lassen. Den von dem frühern Propst Otto v. Wackerbarth ohne Wissen Ulrichs I. und des Capitels beim Reiche anhängig gemachten Appellations=Proceß wolle auch er gern auf gütlichem Wege beigelegt sehen.
Wie früher dem Propst, verbot Ulrich II. unterm 8. Juni 1603 dem ganzen Capitel die Beschickung des Hofgerichts bis zur rechtlichen Entscheidung der Streitfrage, "damit kein Präjudiz entstehe." Vorgebeugt war also zur Genüge.
Als nun Herzog Karl am 30. Aug. 1603 dem Capitel befahl, "die aus seinem Mittel hiebevor dem Gericht verwandt gemachte Person" zum Hofgericht am 4. Oct. nach Wismar zu schicken, mußte der Propst v. Bassewitz dem Herzog zunächst persönlich erklären, daß das Capitel seinem Befehl nicht Folge leisten könne, und darauf (22. Septbr.) wurde vom Capitel diese Erklärung, der eine Abschrift von Ulrichs II. Verbot beigelegt war, schriftlich abgegeben. Das Capitel sandte in der That den Assessor nicht, und Herzog Karl verlangte es auch anscheinend seitdem nicht wieder.
Unter der Herrschaft der Herzoge Adolf Friedrich von Meklenburg=Schwerin (1608 bis 1658) und Johann Albrecht II. von Meklenburg=Güstrow (1611 bis 1636) wurde wiederum der Assessor vom Capitel verlangt, und zwar für das Hofgericht zu Rostock. Aber Ulrich II. verbot sofort (12. Febr. 1610) wieder den Protonotarien des Hofgerichts, Einladungen an das Domcapitel zu schicken. Sollte es geschehen, so drohte er, so würde er "die Boten dergestallt empfangen, daß andre sich daran bedenken und stoßen sollten." Und dem Capitel befahl er (eod.), die Hofgerichtsboten mit ihrem Einladungsschreiben wieder zurückzuschicken. Wenn dieselben trotzdem aber wieder kämen, so sollten sie zum dritten Mal gefangen genommen und auf den Thurm zu Warin gesetzt werden.


|
Seite 179 |




|
Natürlich theilten die Protonotarien das Schreiben Ulrichs II. den meklenburgischen Herzogen mit, und diese erklärten darauf am 7. Jan. 1611, Meklenburg habe das Recht, vom Capitel einen Assessor zum Hofgericht zu fordern; Ulrich möge daher dem Capitel befehlen, die Assessur zu leisten. Der Administrator erwiderte am 21. Jan., daß er die verlangte Assessur nicht zulassen werde. Wenn auch zu Ulrichs I. Zeit ein Domherr in Meklenburg Gerichtsassessor gewesen wäre, so bedeute das für ihn nichts, und seit seiner Regierung stelle das Capitel den Assessor nicht mehr. Das Stift sei "immediato statu dem Reiche zugethan", er wundere sich darum, daß man die Assessur aus demselben verlange. Herzog Karl habe es nie gethan. (!)
Wahrscheinlich ruhte der Streit nun wieder eine Weile, bis die beiden meklenburgischen Herzoge am 27. Nov. 1612 in einem sehr ausführlichen Schreiben, ähnlich wie Herzog Ulrich I. 1596, die Jurisdictionsrechte ihres Landes über das Stift begründeten und schließlich baten, der Administrator möge dem Capitel befehlen, daß es den Assessor wieder zum Hofgericht stelle. Ulrich II. vertrat aber in einem ebenso ausführlichen Antwortsschreiben vom 1. Jan. 1613 in der Weise, wie früher die Capitularen, die Rechte des Stifts. Neu sind nur die Behauptungen, daß die Nachricht der Historiker über die Gründung des Stifts durch Gottschalk "ungewissen Grund" habe, daß in der vom Kaiser bestätigten meklenburgischen Landgerichtsordnung nichts von der Pflicht des Stiftes stehe, und daß die Bestimmung von 1570 ein großer Mißverstand und daher nicht präjudicirlich sei, zumal da das Capitel protestirt habe. Und selbst kaiserliche Confirmationen könnten niemals Rechte Andrer nehmen. Die Capitularen hätten früher die Assessur nur precarie ihrem Administrator zu Gefallen honoris et officii gratia geleistet. Es wäre also diese Assessur nur "ein pur, lauter freiwillig Ding"; sie hätte wohl zur Zeit Ulrichs I. Platz finden mögen, für die jetzigen Verhältnisse passe sie nicht mehr. Die Herzoge möchten darum von ihrer Forderung abstehen, wie es Herzog Karl gethan, der doch auch in Meklenburg regiert habe, oder aber den Streit vor dem Kammergericht ausfechten.
Die meklenburgischen Herzoge suchten nun nach Empfang von Ulrichs II. Schreiben sich darüber zu verständigen, was zu thun sei. Johann Albrecht meinte zwar, daß der Administrator die Reichsunmittelbarkeit keineswegs besitze, und ebenso wie die Session auf den Kreistagen sich auch die Jurisdiction im Stift anmaße; aber er war doch zweifelhaft, ob Meklenburg jetzt etwas ausrichten könne. Darum stellte er es Adolf Friedrich anheim zu entscheiden,


|
Seite 180 |




|
ob der Jurisdictionsstreit fortgesetzt werden solle oder nicht. Dieser scheint übrigens nicht zur Fortsetzung geneigt gewesen zu sein, und der Streit wird in Folge dessen viele Jahre geruht haben.
Aber Herzog Johann Albrecht konnte ihn doch nicht ganz vergessen. Immerfort erwog er, wie er die schon von Ulrich I. beanspruchte Jurisdiction im Stift gewinne, und kam dabei auf den Gedanken, er wolle das Gutachten der Frankfurter Facultät, welches jener Herzog im Jahre 1596 (S. 173) einforderte, als Beweismittel für sein Recht benutzen. Dieses Gutachten war aber nicht mehr aufzufinden, und er bat darum Adolf Friedrich, daß er ein Gesuch an die genannte Facultät um eine Copie jenes Rechtsspruches mit unterschreiben und außerdem in Wismar, wo zu Johann Albrechts I. Zeit die Rechtstage gehalten worden, möge nachforschen lassen, ob das Capitel schon damals, also vor der Einführung der Hofgerichtsordnung, einen Assessor geschickt habe. Adolf Friedrich unterschrieb und ließ auch die Nachforschungen im Wismarschen Rathsarchiv anstehen. Die Resultate derselben sind nicht bekannt; vermuthlich waren sie negativ, da die Acten wiederum seit einer Reihe von Jahren über diesen Gegenstand völlig schweigen.
Indessen hatte man in den nächsten Jahren wegen der Kreisunruhen auch nicht Zeit, um diese Fragen sich zu kümmern, und ganz unmöglich war es den meklenburgischen Herzogen, als sie, aus ihrem Lande vertrieben, Wallenstein die Herrschaft in Meklenburg und im Stift Schwerin ganz überlassen mußten. Während dieser Zeit ging es eben so, wie es dem jeweiligen Gewalthaber oder dessen Räthen beliebte. Zur Zeit Wallensteins wurde das Stift für ein Meklenburg incorporirtes Land angesehen, so wünschte es vor allem die herzogliche Kammer; eine eigne Stiftsjurisdiction brauchte man darum nicht. Aus einem Schreiben des Herzogs Adolf Friedrich vom 12. Jan. 1637 geht hervor, daß die Stiftsunterthanen durch eine "Verordnung des Friedländers" an das Güstrower Gericht gewiesen wurden. Ebenso erzählt Martin Bökel (1592 - 99 Kanzlei=Substitut, 1599 - 1603 Visitations=Notar unter Herzog Ulrich), daß unter Wallenstein weder zu Bützow, noch zu Güstrow eine Stiftsregierung oder=Kanzlei gehalten sei. Alle Stiftsunterthanen hätten in der Meklenburg=Güstrow'schen Kanzlei "activ und passiv" zu Recht bestanden. Die Stiftsacten wären nicht abgesondert worden, "sondern mit den übrigen in ein Gesammtalphabet und Corpus gereiht", aber nach Aemtern geordnet. Unter der Herrschaft der Schweden kann von einer geordneten Rechtspflege um so weniger die Rede sein,


|
Seite 181 |




|
als das Stift sich damals völlig im Belagerungszustand befand. Die schwedischen militärischen Commandeure werden wie in andern Dingen auch in Rechtsfragen nach ihrem Ermessen haben entscheiden lassen. Wir haben übrigens über diese ganze Zeit actenmäßige Berichte garnicht. Erst als Herzog Adolf Friedrich Aussicht gewann, die Herrschaft im Bisthum zu erlangen, erfahren wir wieder Etwas über den Jurisdictionsstreit. Unterm 23. Sept. 1633 erinnerte nämlich Herzog Johann Albrecht daran, das das Domcapitel früher einen Assessor zum Landgericht geschickt habe. Er wünschte, das jetzt das Capitel wieder von beiden meklenburgischen Herzogen aufgefordert würde, die Assessur zu leisten. Adolf Friedrich wollte aber nicht mit auffordern; denn er verhandelte grade mit den Domherren wegen seiner Capitulation und mußte Alles vermeiden, was diese Herren ihm entfremden konnte. Ob er darum auf einen zweiten Wunsch seines Bruders, daß das Hofgericht im Namen der Herzoge ohne deren Unterschrift die Aufforderung an das Capitel erlasse, einging, ist wenigstens zweifelhaft
In der 1634 mit dem Capitel abgeschlossenen Capitulation (2. Th., S. 205 ff.) versprach Herzog Adolf Friedrich, für eine gute selbständige Justizpflege im Stift zu sorgen. Den Ständen sollte auf ihrem Gebiet, wie früher, die niedere Gerichtsbarkeit überlassen werden, als ein höheres Gericht sollte die herzogliche (Stifts=) Kanzlei fungiren, der zu dem Zwecke ein Capitular beigeordnet werde (Capitulation §. 5, 12, 13, 18). In Betreff der geistlichen Jurisdiction verhieß er "gebührende Verordnungen". Und der Herzog hielt als Stiftsregent sein Versprechen gewissenhaft. Denn die noch wiederholt versuchten Uebergriffe des meklenburgischen Hofgerichts auf die Stiftsrechtspflege wies er mit aller Entschiedenheit zurück. Als 1635 wider Jürgen v. Warnstädt auf Vogelsang (bei Neubukow), der wegen Schuld von dem Wismarschen Bürger Maaß verklagt und vom meklenburgischen Hofgericht, damals zu Sternberg, verurtheilt war, die erkannte Execution von den Beamten zu Doberan vollzogen werden sollte, verbot der Herzog die Execution, da das Hofgericht in Stiftssachen kein Urtheil fällen dürfe, weil "solche Sachen an die herzogliche Kanzlei in Schwerin gehen." Ebenso befahl er 1637 dem Sternberger Gericht, das mit Strafmandaten gegen Stiftshauptmann Heinrich v. Hagen vorging, den Stiftshauptmann nicht weiter zu belästigen, "da er billig allein für uns und unsre Schwerinsche Stiftskanzlei zu besprechen." Wiederum erklärte er 1637, das Hofgericht solle die Klage wider den Stiftslehnsmann v. Levetzow auf Gülzow fahren lassen,


|
Seite 182 |




|
da bestimmt wäre, "daß unsre Stiftsstände, =Lehnsleute und =Unterthanen für unserm Gericht zu Recht stehen sollen, deßwegen unsre bischöfliche Regierung in unsrer Residenz Schwerin angeordnet. Wir befehlen Euch demnach gnädiglich, daß Ihr diese Sache wegen des Gutes Gülzow, des Friedländers Verordnung ungeachtet, dahin remittirt."
So blieb es bis über den westfälischen Frieden hinaus; denn noch 1654 schrieb Adolf Friedrich an das Sternberger Hofgericht, es habe widerrechtlich das Testament des verstorbenen Chr. Grabow auf Prüzen publicirt, da das Gut Prüzen zum Stift gehöre. Es müsse daher das Testament sofort an die Schweriner Kanzlei geschickt werden.
Und der Proceß: Meklenburg wider das Stift pto. jurisdictionis? - Er "schwebte noch zu Speier in unerörterten Rechten."
C. Die Besitzungen und Rechte bei
Administratoren außerhalb
der
Stiftsgrenzen in Meklenburg.
1) Die Officialei Rostock.
Zwei Stiftsinstitute besonderer Art waren die Officialei zu Rostock und die Collectorei zu Waren. Mit dem Aufhören der geistlichen Gerichtsbarkeit über die ganze bischöfliche Diöcese wurden nämlich die Archidiaconate überflüssig, und es fragte sich nun, wer künftig die Hebungen derselben, den alten Bischofszehnten, einnehmen sollte. Während die Einkünfte der übrigen Archidiaconate verloren gingen, rettete der Administrator die des Rostocker und des Warener Sprengels und bildete aus diesen die genannten Hebungsämter.
Zur Officialei in Rostock gehörte ein Haus mit Nebengebäuden (jetzt das Teutenwinkelsche Amtshaus am Amberg Nr. 12), welche gewöhnlich der Einnehmer der Officialei=Hebungen, Officialist genannt, bewohnte. Die Gebäude und deren Insassen standen unter der Jurisdiction des Stiftsadministrators, waren also von der Rostocker Gerichtsbarkeit befreit, ebenso waren sie frei von allen städtischen Lasten. Als in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts neben andern Differenzen auch Streitigkeiten der Landesherren mit der Stadt Rostock wegen der Jurisdiction auf der Officialei entstanden waren, versuchte man eine gütliche Beilegung derselben. Herzog Adolf Friedrich schloß in Folge dessen unterm 22. Nov. 1642 für sich und in Vormundschaft des Herzogs Gustav Adolf


|
Seite 183 |




|
mit Rostock einen Vertrag, welcher in Bezug auf die Officialei lautete:
"Die Officialei belangend, ist beliebet und bewilliget, wann jemand daselbst delinquiren und sich in die Stadt salviren, daselbst aber oder sonst in der Stadt Botmäßigkeit betroffen oder angehalten würde, daß derselbe I. F. G. gegen einen Revers jedes Mal unweigerlich ausgefolget soll werden. Es soll aber über den Missethäter oder sonst sein Recht auf der Officialei gehalten, sondern derselbe nach geschehener Ausfolgung, oder da er auch in loco angehalten wäre worden, außerhalb der Stadt Rostock und derselben Botmäßigkeit an Ort und Enden, da es I. F. G. gefällig, von I. F. G. Dienern geführt, die Sache cognoscirt, Urtheil und Recht darüber gesprochen und exequirt werden. Hingegen haben I. F. G. gnädig versprochen, wenn jemand in der Stadt Rostock und derselben Botmäßigkeit delinquiren und sich in die Officialei retiriren würde, daß Sie denselben ebenmäßig gegen einen Revers der Stadt Rostock jedes Mal unweigerlich ausfolgen lassen wollen."
Zur Officialei gehörte um 1600 das Recht Bier und Wein zu schenken, doch wußte man 1620 nicht sicher, ob die Schankgerechtigkeit schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts bestanden habe.
Bei dem Hause lag der Garten der Oficialei; früher gehörten derselben, wie nach Aussage des Capitäns Michel Graß "der alte Elias Möller" 1620 behauptet haben soll, 2 Gärten und das "Münchefeld" bei Bentwisch von 8 Hufen Landes. Dies Mönchfeld war aber damals längst in den Besitz des Rostocker Rathes gekommen, der einen Theil davon an Henning Beselin erblich verkauft hatte. Nach andern Behauptungen sollten früher zur Officialei mehrere Häuser mit Gärten gehört haben. Wenn das der Fall war, so werden diese Besitzungen in der Reformation verloren gegangen sein.
Werthvoll war die Rostocker Officialei für das Stift weniger wegen des Wohnhauses, als wegen der beträchtlichen Hebungen, die seit alter Zeit mit ihr verbunden waren. Das Landbuch für das Stift Schwerin von 1581 berichtet, daß die Officialei beziehe:
1) Geldhebungen
aus Rostock 1 ), Lage, Gr. und Kl. Wardow, "Gr. Preßen" (Bresen bei Sülze), Gr. und Kl. Lantow, Kl. Ridsenow,


|
Seite 184 |




|
Kl. Wozezen (Wozeten bei Lage), Kronskamp, Damen, Dummerstorf, Scharstorf, Gr. Reze (Reez bei Schwan), Sanitz, Niekrenz, Reppelin, Kl. Reppelin, Petschow, Godow (A. Ribnitz), Bussewitz, Steinfeld (bei Rostock), Allerstorf, Jankendorf, Poppendorf, Fahrenhaupt (Varnnhop), Kölzow, Dettmannstorf, Kl. Tessin (bei der Stadt Tessin), Grammerstorf (jetzt nur noch Gramstorfer Feldmark bei Tessin), Helmstorf, Stormstorf, der "wüsten Feldmark Kl. Gnevitz, v. d. Lühe zu Külzow gehörig", Kammin (bei Lage), Kossow, Kötwin, Weitendorf (bei Lage), "Dopstorf (Deperstorf bei Tessin), "Warnnstorf" (Wahrstorf), "Wendorf" (Wenendorf), "Canekel" (Kankel bei Schwan), Dolgen, Siemitz, Röknitz, Knegendorf, "Luzow" 1 ), "Peryede" 2 ), Kritzkow, Zehlendorf, Bentwisch, Albersdorf, Kl. Kussewitz, Harmstorf, Riekdahl, Pastow, Teschendorf, Hohen Schwarfs ("Schwervitz"), Ikendorf, Fresendorf, Neuendorf (bei Rostock), Fienstorf, Wozeze (Zeez bei Schwan?), Kukstorf, Dudendorf, Kuhlrade, in Summe 139 Fl. 3 ßl. 6 Pf. oder 210 Mark 2 ßl.
2) Kornzehnten, a. Roggen
aus Lütten Klein, Gr. Ridsenow, Finkenberg, Bentwisch, Albertsdorf, Riekdahl, Schmadebek, Barnstorf, ("Parrenstorf, 4 Hufen hat die Stadt Rostock zu einem Hof zusammengelegt und gibt dafür"), Sildemow, Gr. Schwaß, Niendorf (Kirchsp. Biestow), in Summe 17 Dpt. 8 3/4 Schff.
b. Gerste
aus Lütten Klein, Gr. Ridsenow, Finkenberg, Bentwisch, Neuendorf (bei Rostock), Schmadebek, Barnstorf, Sildemow, Gr. Schwaß, Niendorf (Kirchsp. Biestow), in Summe 16 Dpt. 10 Schff. 3 Faß.
c. Hafer
aus Lütten Klein, Gr. und Kl. Lantow, Gr. Ridsenow, Dummerstorf, Damm, Schlage, Kokendorf, Goldenitz (bei Schwan), Finkenberg, Bussewitz, Steinfeld, Brünkendorf (Brunekend.), Helmstorf, Kammin, Kossow, Kötwin, Weitendorf, Bentwisch, Albertsdorf, Riekdahl, Pastow, Teschendorf, Schmadebek, Neuendorf (bei Rostock), Barn=


|
Seite 185 |




|
storf, Fienstorf, Kl. Kussewitz, Harmstorf, Sildemow, Gr. Schwaß, Niendorf (Kirchsp. Biestow), in Summe 130 Dpt. 5 Schff.
Die ganze Summe der Kornhebung betrug also fast 2000 Scheffel und hatte selbst im 16. Jahrhundert einen Werth von etwa 2000 Mark.
Die Officialei=Rechnung von 1670/71 zählt außer den gesperrt gedruckten Ortschaften noch auf: 1) bei der Geldhebung: Kossow, Bandelstorf, Schlage, Göldenitz, Kokendorf und Kassebohm, 2) bei der Roggenhebung: Kassebohm und Pastow. Sie kommt in der ganzen Jahreseinnahme auf 237 Fl. 14 ßl. 10 Pf., 14 Dpt. 4 Schff. Roggen, 11 Dpt. 5 Schff. Gerste und 115 Dpt. 3/4 Schff. Hafer.
Die Hebungen nahm ein im Solde des Administrators stehender Beamter, der Officialist, ein. 1567 wurde von Herzog Ulrich dem Rath Georg Kummer die Officialei (als Wohnung?) verliehen. Später besorgte der Kanzler Jacob Bording die Geschäfte eines Officialisten; doch wurden sie ihm bald lästig, und Herzog Ulrich befahl deshalb am 31. Jan. 1581 dem Amtmann Bastian Barner zu Doberan, die Schlüssel der Officialei an sich zu nehmen, natürlich um Bording abzulösen. Ob diese beiden Beamten auf der Officialei selbst wohnten, berichten die Acten nicht; aber der schon genannte alte Elias Möller sagt 1621 als Zeuge aus, daß dort nach einander ihre Wohnung hatten: Dr. Hoffmann, Dr. Bouke, "der Maler" (Geometer) Peter Bökel, Johann Thielcke und Barner. In der Reihenfolge der Bewohner irrte sich Möller, wie wir bald sehen werden, doch dürfen wir ihm sonst wohl Glauben schenken. 1600 bewarb sich Peter Lange, der früher 6 Jahre Küchenschreiber und Diener bei dem Herzog Ulrich II., dem damaligen Coadjutor des Stifts, gewesen war, um die Officialei=Wohnung, "die Bastian Barner eine geraume Zeit verwaltet." Anscheinend bekam er sie nicht oder nur für kurze Zeit, denn die Acten berichten bald, daß Johann Thielcke den Dienst erhielt. Später verrichtete den Officialeidienst "auf bestimmte Jahre", die 1613 "bald um waren", Joachim v. Bassewitz d. j. zu Hohen=Lukow; nach diesem bekam Michel Graß die Verwaltung. Die Verwalter mußten damals Caution stellen und Rechnung ablegen. 1630 wurde Chr. Polack Officialist. Unterm 9. Jan. 1634 schenkte der schwedische Kanzler Oxenstierna dem Residenten Eßken zu Erfurt zur Anerkennung seiner Dienste neben dem Hofe Wolken mit dem dienstpflichtigen Dorfe Zeppelin die Officialei zu Rostock erblich, wie sie die Schweden "jure belli" besaßen. Da aber dem


|
Seite 186 |




|
Herzog Adolf Friedrich, welcher zu der Zeit um den Besitz des Stiftes Schwerin mit dem schwedischen Kanzler verhandelte, sehr viel an der Officialei gelegen war, "durch welche das Stift die geistliche Jurisdiction und das jus patronatus über die Rostocker Akademie habe", so fragte Oxenstierna schon am 7. März desselben Jahres Eßken, ob er nicht die Officialei gegen ein anderes Geschenk abtreten wolle, da dieser Besitz wegen seiner besonderen Beziehungen zu der Universität einem Privatmanne nicht wohl anstehe. Eßken wird nun wohl dem Wunsche des mächtigen Kanzlers nicht entgegen gewesen sein, aber die Frau Eßken wollte den Besitz nicht fahren lassen. Sie hatte die Officialei dem Chr. Polack für 300 Gulden jährlich verpachtet und nannte dieselbe noch lange ihr "Haus". Indessen wurde doch Adolf Friedrich wirklicher Besitzer, denn schon am 25. März wurde der Officialist (Polack) von ihm zu Bützow vereidigt. Polack erhielt die Officialei für eine Jahrespacht von 900 Gulden; er war noch 1666, wo er sich einen alten Mann nennt, Officialist. 1 )
2) Die Collectorei Waren.
Auch von den Einkünften des früheren Archidiaconats Waren, die ebenfalls aus dem Bischofszehnten bestanden, wurden in der Reformation einige Hebungen gerettet. Man ließ diese Hebungen seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts durch einen Collector einsammeln und dann an die bischöflichen Beamten in Bützow einliefern. Die Größe der Hebungen war aber schon vor 1600 nicht mehr sicher bekannt, indem die amtlichen Register nicht übereinstimmten und wahrscheinlich die Besitzer der zahlungspflichtigen Grundstücke wieder nicht die Richtigkeit der Register anerkannten. Nach dem Bützower Verzeichnisse sollten die Hebungen 27 Fl. 11 ßl. 6 Pf. Geld, 6 Dpt. 7 Schff. Roggen und 7 Schff. Hafer betragen. Als pflichtig werden in verschiedenen Listen genannt die Orte:


|
Seite 187 |




|
1) zur Geldzahlung:
Waren, Plau, Jabel, Federow, Krase, Schlön, Varchow, Zislow, Hungerstorf, Leisten, Lansen, Garz, Malkwitz, Kl. Giwitz, Lütkendorf, Sommerstorf, Vielist, Schönau, Alt=Schwerin, Walow, Roez, Lexow, Göhren, Silz, Poppentin, Grüssow, Sparow, Torgelow;
2) zur Kornlieferung:
Damerow, Leppin, das wüste Feld Vietze 1 ), Sanz, das Feld Globen 1 ), Klink und Dratow.
Der Collector bekam für seine Dienste, die wegen der häufigen Verweigerung der Zahlungen und Lieferungen nicht grade gering waren, die ganze Kornhebung; das Geld mußte er aber, soweit er es zusammenbrachte, nach Bützow liefern.
Nach einer Notiz, die viel später einmal gelegentlich vorkommt, hieß der erste Collector Troje. Näheres wird über denselben nicht berichtet. Auf Troje folgte wahrscheinlich Georg Pfitzner, welcher nachweislich bis 1594 Collector war. In dem genannten Jahr wurde der Stadvogt zu Waren Saurwald von Herzog Ulrich I. zum Collector bestellt, 1609 aber von Herzog Ulrich II. entlassen. In seine Stelle rückte der Warensche Bürgermeister Henning Troje, der zwar 1626 von Herzog Ulrich III. seine Entlassung erhielt trotzdem aber, wenigstens scheint es so, ruhig die Hebungen weiter einforderte. Allerdings wird er in den Kriegsjahren nicht viel erhalten haben.
Ulrich III. beabsichtigte einen einfachen, ehrbaren Bürger mit der Einhebung des Zehnten zu betrauen und für diese Dienste 1 Drpt. hartes Korn zu geben. Die Einkünfte der Collectorei sollten der studirenden Jugend zu Gute kommen. Wir haben schon früher gesehen, daß die kriegerischen Ereignisse den jungen Administrator bald aus dem Lande riefen; aus diesem Grunde wurde sein ganzes Vorhaben vereitelt.
1630 bat ein Sohn des Bürgermeisters Troje 2 ), Gregor Troje, um den Dienst des Collectors, welchen sein Vater bisher verwaltet habe. Er erhielt ihn nicht. Wiederum 1634 bewarb sich ein anderer Sohn des damals schon verstorbenen alten Collectors, Namens Henning Troje, der seit 1600 als Barbier in der Welt umhergewandert


|
Seite 188 |




|
war und nun seine alte Heimath wieder aufgesucht hatte, um die Stelle bei der Collectorei. Ob er sie erhielt, wissen wir nicht, da die Acten hier plötzlich abbrechen und erst unter dem Jahre 1705 wieder mittheilen, das "über Menschen Gedenken" keine Collectorei=Hebungen mehr eingekommen seien.
3) Das Cancellariat der Universität Rostock. 1 )
In der Stiftungsbulle der Universität Rostock wurde dem Bischof von Schwerin das Cancellariat verliehen. Vermöge der Kanzlerwürde sollten die Appellationen von der Universität an den Bischof gehen, und der akademische Senat sollte zu Promotionen die Erlaubniß des Bischofs nachsuchen. Dies Kanzleramt verrichteten die Bischöfe entweder in eigner Person, oder sie ließen sich durch den Rostocker Archidiaconus vertreten. 2 )
Das Einholen der bischöflichen Zustimmung zur Ertheilung der akademischen Würden ward aber den Professoren bald lästig, vielleicht weil die Bischöfe oder deren Stellvertreter oft Schwierigkeiten machten oder in der Beantwortung der Gesuche sich nachlässig erwiesen. Genug, die Universität fühlte sich veranlaßt, den Papst um Abhülfe dieses Uebelstandes zu bitten, und sie erhielt Gewährung ihres Wunsches. Denn der Papst Martin V. bestimmte in einer Bulle vom 26. Febr. 1427, das der Rector, wenn der Bischof oder dessen Stellvertreter die Erlaubniß zu Promotionen ohne gegründete Ursache verweigere oder verzögere, alsdann unter Zuziehung von 2 oder 3 Doctoren oder Magistern diese Erlaubniß ebenso gültig solle ertheilen können, als wenn sie von dem Bischof selbst ertheilt worden wäre. Durch diese Bestimmung wurde natürlich der Einfluß des Kanzlers um ein Bedeutendes verringert. Denn wollte er Promotionen jetzt nicht zulassen, so brauchte der Rector die vom Bischof etwa angegebenen Gründe nur für ungenügend zu erklären und selbst zu promoviren.
Mit dem jus appellandi ad Cancellarium ging es bald nicht besser. Das Streben des Rostocker Magistrats nach unbeschränktem Einfluß auf die Universität machte, wie das Recht der meklenburgischen Landesherren als Patrone, so auch das jus appellandi an


|
Seite 189 |




|
den Kanzler ziemlich illusorisch. Der herzogliche Kanzler Johann v. Lucka klagte deshalb um 1550, der Zustand der Universität sei ein völlig zerrütteter, sie besitze keine besondere Jurisdiction, keinen Gerichtszwang, und das jus appellandi ad Cancellarium, sc. ad episcopum Sverinensem, sei ihr entzogen. Es war seit 100 Jahren nicht mehr an den Bischof appellirt, dafür hatte man sich aber gelegentlich mit Beschwerden an den Papst gewandt.
Unter der Regierung des Herzogs Ulrich I. treffen wir aus erklärlichen Gründen trotzdem selten auf Klagen über die Nichtbeachtung des bischöflichen Kanzlerrechtes; anders wurde es aber, als Ulrich II. das Stift regierte. Wie alle andern Rechte, so suchte der dänische Prinz auch dies Recht des Bisthums eifrigst zu vertheidigen. Das mußte ihm aber um so schwerer werden, als er außer den Universitätsprofessoren und dem Rostocker Magistrat hierbei auch noch den Herzog Karl von Meklenburg zum Gegner hatte, der als regierender Fürst von Meklenburg die Kanzlerwürde für sich selbst in Anspruch nahm. Ulrich II. wurde in diesem Streit zwar von den Stiftsständen willig und gern unterstützt, aber man stritt vergeblich; denn thatsächlich war das bischöfliche Cancellariat nicht mehr vorhanden, und von Bützow aus konnte man es sicher nicht wieder ins Leben zurückrufen.
Die großen Ereignisse des 30jährigen Krieges drängten endlich, wie andere, so auch diese kleine Streitfrage in den Hintergrund, und nach dem westfälischen Frieden war der ganze Standpunkt des Bisthums und mit ihm die Frage wegen der Kanzlerwürde ein anderer geworden.
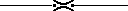


|
Seite 190 |




|



|



|
|
:
|
VII.
Die Politik des Herzogs Friedrich
von Meklenburg=Schwerin
(1756 - 1785)
in Kirchen= und Schulsachen.
Nach den Urkunden dargestellt
von
Dr. U. Hölscher,
Oberlehrer am Realgymnasium in Bützow. 1 )
W enn man den Ursachen nachforscht die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine so radicale Linkswendung der religiösen Denkart herbeiführten, so möchte man nicht weit vom Rechten abirren, wenn man dieselben sucht theils in dem Widerspruche, in welchen manche Dogmen oder Bräuche der Kirche zu den Ansichten und Bedürfnissen einer fortgeschrittenen Zeit gerathen waren, theils in dem gesteigerten Wohlstand und der damit zusammenhängenden Genußsucht, theils in der bei den herrschenden Staatsmännern aufgekommenen Meinung, daß zur Aufrechterhaltung und Regierung der Staaten es nur materieller Mittel bedürfe. Wie soll man sich anders den Beifall erklären, dessen sich irreligiöse Schriften erfreuten, wie jene Frivolität, die zur Mode geworden war? Wo aber der sittliche Ernst vergeht, erlischt auch die fromme Gesinnung und der Glaube, und wo diese aus der Seele entwichen sind, findet der Mensch mit seiner Vernunft in allem, was Andacht oder Gottesdienst heißt, nur Gegenstände seines Tadels oder Spotts.


|
Seite 191 |




|
Die Meinung war allgemein, daß gute Finanzen, gute Polizei und ein wohlgedrilltes Heer die einzigen unentbehrlichen Erfordernisse zur Blüthe eines Staates seien; und indem man daher immer nur von einer Staatsmaschine redete, vergaß man die größere Macht, welche Ideen, Grundsätze und Sitten auf die Menschen ausüben. Die großen Ereignisse der folgenden Zeit gaben die Lehre vom Gegentheil. Als die wohlgeschulten Heere geschlagen waren, die Polizei sich ohnmächtig erwies und die Staaten sich auflösten, lernte man von der Ueberschätzung der materiellen Kräfte zurückkommen und einsehen, daß zur Lenkung von Völkern und Staaten vor allem es der Macht der Idee und der guten Gesinnung bedürfe; man erkannte, welche hohe Bedeutung das wahre Christenthum für das Leben und Gedeihen der Staaten habe; und damit begannen auch die Fürsten wieder die Kirche zu ehren und ihr Wirken zu unterstützen, durch bittere Erfahrung belehrt, daß grade die Kirche in den menschlichen Gemüthern jene Gesinnung hervorrufe und fördere, aus welcher allein die bürgerliche und häusliche Tugend der Völker hervorgeht. Das Wort des Heilandes: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Andere zufallen", läßt sich auch in der Politik nicht ungestraft verachten.
Auch unserm lieben meklenburgischen Lande blieb jene bittere Erfahrung nicht erspart. Beinahe dreißig Jahre lang hatte der fromme Herzog Friedrich, "der Gesalbte des Herrn", es seine vorzüglichste Regierungssorge sein lassen, den verderblichen Geist der Aufklärung von seinem Lande fern zu halten; aber kaum hatte er die Augen geschlossen († 24. April 1785), als der gewaltsam unterdrückte Wille des Volkes, schon lange des verhaßten pietistischen Joches überdrüssig, mit stürmischer Leidenschaft die Fesseln abwarf und dem schmerzlich entbehrten Genuß der goldenen Freiheit sich hingab: ein Umschlag trat ein, wie ihn ähnlich kaum die Geschichte sonst kennt. Da zeigte sich, wie es selbst dem ernsten Willen eines kräftigen Fürsten unmöglich ist, dem Geist der Zeit einen haltenden Damm entgegenzuwerfen. Nur eine kleine Gemeinde von Frommen blieb übrig, von Gott ausersehen, durch den Sturm hindurch die Gnade in die neue Zeit zu übertragen; die Andern fielen alle ab zu dem bequemeren Rationalismus. Die Gährung aber in den Gemüthern war so tief, daß auch die Zeit der folgenden bösen Noth nicht beten lehrte, und die wiederholte ernste Mahnung des volksbeliebten Herzogs Friedrich Franz, "den hochseligen Friedrich nicht zu vergessen", ungehört verklang. Man wollte von den Wohlthaten dieses Fürsten, in dem man nur den "Unterdrücker


|
Seite 192 |




|
der Freiheit" den "frommen Eiferer", den "Pietisten" sah, nichts wissen noch hören. Erst nach und nach kehrte die ruhige Besinnung und damit auch das gerechtere Urtheil zurück. Meklenburg beginnt jetzt in ihm einen seiner trefflichsten Fürsten zu verehren.
So darf denn nunmehr auch ich die Zeit für gekommen halten, mit einer reiner rein sachlichen Darstellung der Politik des Herzogs Friedrich in Kirchen und Schulsachen hervorzutreten. Ich versichere dabei noch ausdrücklich, daß kein Augenmerk mir wichtiger sein soll, als die Zurückdrängung jeder persönlichen Theilnahme. Wenn ich nur das erreiche, daß jedermann, er stehe links oder rechts, bekennt, der Herzog Friedrich verdiene, als Wohlthäter seines Volkes von keinem Meklenburger vergessen zu werden, so habe ich meine Aufgabe gelöst.
Erster Theil. Das Kirchenwesen.
I. Der Herzog Friedrich.
Dem Geheimen Archivrath Dr. Wigger in Schwerin verdanken wir die Lebensgeschichte des Herzogs Friedrich bis zu dessen Regierungsantritt (Bd. XLV dieser Jahrbücher). Dank dieser eingehenden Arbeit steht die geistige Entwickelung, der Charakter, überhaupt das ganze Wesen des Fürsten so ausgeprägt vor unsern Augen, daß ich mich mit einem Hinweis darauf begnügen könnte, wenn es nicht nothwendig erschiene, wenigstens einige Bemerkungen über die Persönlichkeit und die persönliche Stellung des Herzogs zur Landeskirche und ihrer Lehre vorauszuschicken.
Der Herzog Friedrich 1 ), der Sohn des Herzogs Christian Ludwig II. von Meklenburg=Schwerin und der Herzogin Gustave Caroline von Meklenburg=Strelitz, war am 9. November 1717 auf dem Schlosse zu Grabow geboren. In den ersten 8 Jahren war er als der noch einzige Sohn seiner hohen Eltern der verhätschelte Liebling des ganzen Hofpersonals, darnach bekam er an Ludwig Jacob Weißensee einen ernst gerichteten, fast peinlich gewissenhaften Informator, der neben tüchtigem Unterricht besonders auch für eine strenge sittliche Erziehung sorgte. Wiederholte Besuche bei der Großtante in Dargun, der frommen Herzogin Augusta, trugen dazu bei, den unter der Noth des Landes auch selbst schwer leidenden Prinzen ernst zu stimmen. Von 1737 an war er 26 Mo=


|
Seite 193 |




|
nate auf Reisen in Holland, Belgien, Frankreich und England, überall die Merkwürdigkeiten mit großem Verständniß in Augenschein nehmend. Die Absicht des Vaters, eine Mariage mit einer englischen Prinzessin herbeizuführen, scheiterte an der Abneigung des Prinzen. Auch in Berlin, wohin ihn die Rückreise führte, suchte der Hof ihn vergebens zu fesseln. Im September 1739 kehrte er reich an Erfahrung in die lang entbehrte Heimath zurück.
Hier zeigte sich bald, daß die Welt mit ihrer Lust den Prinzen nicht zu befriedigen vermochte; unter dem Einfluß der frommen Großtante begann er von den Vergnügungen des Hofes sich zurückzuziehen und in der Stille Andachtsübungen und biblischen Studien so ganz sich zu widmen, daß der Vater nicht mit Unrecht fürchtete, daß der Sohn, von den Darguner Pietisten umstrickt und in den Irrgängen ihrer dunklen Lehren verloren, das rechte Verständniß für seine hohen Pflichten verlieren möchte. Als bestes Mittel, denselben wieder in die Welt zurückzurufen, wurde deshalb seine baldige Verheirathung mit einer weltlich gesinnten Prinzessin angesehen. Während aber der Vater noch unentschlossen suchte, hatte der Prinz bereits gewählt. Am 11. Mai 1744 wurde seine Verlobung mit der damals 22 Jahre alten würtembergischen Prinzessin Louise Friderike, der wegen ihres Reichthums viel umworbenen Enkelin des Herzogs Eberhard Ludwig von Würtemberg=Stuttgart, am Hofe ihres Oheim, des Markgrafen von Brandenburg=Schwedt, gefeiert. Am 2. März 1746 fand die Trauung ebendaselbst statt. Indessen die vom Vater erwartete Wirkung hatte diese Vermählung nicht: der Prinz hielt sich nach wie vor möglichst von rauschenden Vergnügungen des Hofes fern.
Bedenklicher indessen erschien es, das auch da noch, als mit dem Tode des Herzogs Karl Leopold (28. November 1747) dem Vater zahllose Geschäfte und Schwierigkeiten aus den Vergleichsverhandlungen mit den widerstrebenden Ständen erwuchsen, der Erbprinz, abgesehen von den kirchlichen Streitigkeiten, kaum hervorragenden Antheil an den Staatsgeschäften nahm und sein Interesse nach wie vor fast ausschließlich den wissenschaftlichen Studien widmete. Man bemerkte, daß der Gedanke, die lastende Sorge der Regierungsgeschäfte bald übernehmen zu müssen, etwas Beunruhigendes für sein Gemüth hatte, als ob es ihm dabei unmöglich sein werde, in Gottes Gnade zu bleiben; er bat und flehte zu Gott, "doch nur immer die Freude an Ihm seine einzige Freude sein zu lassen, da er sonst von keiner Freude wissen wolle." Und am Tage seines Regierungsantritts (30. Mai 1756) erflehte er


|
Seite 194 |




|
von Jesu: "ihn doch ferner so zu erhalten, und wenn er bei dieser seiner angetretenen Regierung nach seinem heiligen Willen handelte, und Er es ihm, wie schon geschehen, sehr segnete, er doch keinen andern Gefallen daran hätte, als daß sein heiliger Wille geschehen sei, und er immer wohl einsehe und bedenke, daß Er es gethan, und also immer in seiner Liebe wachse und immer zunehme und Sein Reich mächtig befördere und treu nach Seinem besten Willen handele." -
Bei dieser reinen Herzensgesinnung und tiefgegründeten Frömmigkeit, bei diesem rastlosen Streben nach dem Wahren, Guten und Schönen konnte es dem zum Throne berufenen jungen Fürsten an der allgemeinen Liebe im Lande zwar nicht fehlen; aber zum Herrschen gehörte doch mehr: dazu gehörte vor allem politische Klugheit und Erfahrung, besonders in einer Zeit, wo der große preußische König mit seinem gefürchteten Heere das Land mit Krieg zu überziehen im Begriff war. Beide Eigenschaften aber schien der Herzog wenig zu besitzen; war ihm doch nichts verhaßter als Intriguen und Winkelzüge; hielt er es doch für das größte Unrecht, auch um des größten Vortheils willen nur einen Schritt wider das Gewissen zu thun! Dazu lag in seinem ganzen Wesen nichts Kühnes, Heldenhaftes, vielmehr erschien er dem Fremden auf den ersten Blick zu wenig lebhaft und thatkräftig, wohl gar etwas pedantisch gemessen; und nur wer Gelegenheit hatte, dem Fürsten im Umgange oder im Rathe oder in dringender Noth näher zu treten, nahm wahr, daß die äußere Ruhe nicht dem angeborenen heftigen Temperamente entsprach, daß sein mildes, zurückhaltendes Urtheil doch auf natürlichem, scharfem Verstand und der vielseitigsten Bildung beruhte, und daß seine Seele bei aller Milde und Barmherzigkeit doch von einem gewissen Trotz und Argwohn nicht frei war. Daher war denn auch das Vertrauen des Landes zu der Politik des Herzogs nicht groß; man sah voraus, was kam: daß der Herzog, getrieben von seiner auch persönlichen Abneigung gegen den gewaltigen Nachbar, unabsehbares neues Kriegselend über sein kaum aufathmendes Volk bringen werde. Ebensowenig täuschte man sich über die kirchliche Politik des Herzogs, welcher schon als Erbprinz entschieden für die Pietisten von Dargun Partei genommen und ihrer Sache zum ersten Siege verholfen hatte; wieviel mehr ließ sich erwarten, daß er als Fürst diesen der Orthodoxie feindlichen Geist durch die Kirche über das ganze Land auszubreiten bestrebt sein werde! Und in der That, er machte Ernst mit dieser Sache. Wie er streng gegen sich selbst war, so war er es auch gegen seine Unterthanen, indem er von allen, den höchsten


|
Seite 195 |




|
wie den niedrigsten, die gewissenhafteste Erfüllung ihrer Pflichten forderte und in beinahe fanatischem Haß Alles verfolgte, was ihm sündlich oder verführerisch erschien. In seinem Leben war er so einfach, daß Viele daran Anstoß nahmen und den Hof mieden, der außer Andachtsübungen und erbaulichen Gesprächen oder wissenschaftlichen Discursen wenig Reizendes bot. Mochten aber die Schranzen und Schwätzer davon reden, was sie wollten, der Herzog pflegte mit Luther zu sagen: "Es zürne oder lache, wer will, so sehe ich doch und frage nach keinem Menschen, sondern sehe allein auf Christum; was der mir vorbehalten hat, das thue ich ihm zu Liebe um seines theuren Blutes willen. Wo solch Herz und Muth nicht ist, da bleibt kein Christ fromm und gläubig." Das Bewußtsein der mit seinem fürstlichen Amte verknüpften schweren Verantwortung vor Gott und Menschen erfüllte seine Seele mit unablässiger Angst und ließ ihn nur um das Eine stündlich beten, daß es ihm gelingen möge, seinem Volke "ein rechter Hoherpriester zu werden." Es ist ein köstliches Wort in dem Munde dieses, seinen Unterthanen durch alle Tugenden, durch Frömmigkeit, Fleiß und Sparsamkeit voranleuchtenden, gerechten Fürsten: "daß er sich immer vorhalte, wie seine Unterthanen auch Menschen gleich ihm seien, und er regieren müsse, wie die Gesetze es geböten, als Einer, der nicht ewig das Scepter führe, sondern stündlich abgerufen werden könnte, um vor dem Fürsten über alle Fürsten Rechenschaft abzulegen. Darum sei es auch sein höchstes Bestreben, seinem Volke ein rechtes Muster zu sein, da es eines Fürsten würdiger sei, durch den Lebenswandel als durch den Glanz der Hoheit die Liebe und Ehrfurcht der Unterthanen sich zu erwerben." Um dieses seines frommen Eifers willen hat die Geschichte dem Herzog Friedrich den Namen "Pius" gegeben, wohl nicht ohne bewußte Anspielung auf sein nahes Verhältniß zu dem von seiner Großtante, der Herzogin Augusta, im Lande angepflanzten und darnach von ihm selber verbreiteten s. g. Halleschen Pietismus. Daraus aber etwa zu folgern, daß ihm die gesunde evangelische Frömmigkeit fremd, er ein Kopfhänger oder gar ein Freund bigotter Frömmelei gewesen sei, wäre sehr verkehrt. Im Gegentheil, wie sehr der Fürst auch die Zurückgezogenheit liebte, so blieb er doch mit der Welt um ihn in engstem Verkehr; und man könnte kaum nachweisen, daß seine wissenschaftlichen Studien oder Andachtsübungen ihn jemals abgehalten hätten, seine Regierungsgeschäfte mit aller Gewissenhaftigkeit zu besorgen. Trotz der inneren Ueberzeugung, daß allein aus dem Gebete und dem Glaubensleben die rechte Kraft und Weisheit zu allen weltlichen Geschäften flösse, war er


|
Seite 196 |




|
doch weit entfernt, weltliche und geistliche Dinge zu vermischen. Es erscheint mir sogar ganz unglaublich, daß Herzog Friedrich bei seinem klaren Verstande die pietistischen Irrthümer nicht erkannt haben sollte. Als der Herzog Karl Leopold ihm einmal den Vorwurf machte, daß er ein Herrnhuter sei - verstanden waren darunter aber die Darguner Pietisten, welche Anfangs stark zu Zinzendorfs Lehre hinneigten -, antwortete der Prinz recht deutsch: "er sei sein Herrnhuter, habe vielmehr, lange bevor er nach Dargun gekommen, Gott gesucht und gefunden gehabt, in Dargun aber erst erfahren, was lebendiges Christenthum, was Buße und Belehrung sei." Indem er aber bei dieser Gelegenheit betheuerte, er sei ein gut lutherischer Christ, bezeichnete er klar die weite Kluft, welche ihn von den heterodoxen Sectirereien der Pietisten trennte. 1 ) Dennoch war der Herzog auch mit der Orthodoxie, wie sie damals war, gründlich zerfallen; er kehrte nicht allein in seinem Glaubensleben eine größere Schärfe gegenüber den s. g. Mitteldingen hervor, sondern hatte auch unter dem Einfluß des Hofes von Dargun sich gewöhnt, an der Orthodoxie nur ihre Schattenseiten, den Formalismus, das scholastische Begriffe spalten, die Polemik ihrer dogmatischen Systeme, zu erblicken. Also nicht die Lehre der Darguner war es, die ihn fesselte, sondern der fromme Bekehrungseifer der fremden Prediger, denen er darin beistimmte, daß bei der buchstabenstarren Orthodoxie der wichtigste Theil des evangelischen Gottesdienstes, die erbauende Predigt und das Sacrament, keinen rechten Bestand habe. Darum galten ihm auch die Prediger, die nicht "bekehrt" waren, wenig, und Christen, die nicht bibelfest und durch das Wort Gottes nicht erweckt, bekehrt und geheiligt waren, dünkten ihn unnütze Knechte; wer aber mit Angst und Zittern der Wiedergeburt und Erleuchtung nachjagte, der war der höchsten Gnade des Fürsten gewiß. Daß dadurch viele zu Heuchelei und Scheinheiligkeit verleitet wurden, ist leicht begreiflich; und nichts macht mir die nach dem Tode des Herzogs eintretende Reaction widerlicher als der offene Abfall so vieler Prediger und Hofbedienten zum crassesten Rationalismus; denn damit bewiesen sie, daß sie mehr dem Fürsten als Gott gedient hatten. Dem Herzog erwächst daraus kein Vorwurf, wenn ich auch nicht leugnen will, daß derselbe wohl etwas mißtrauischer hätte sein können und sollen; er


|
Seite 197 |




|
selbst meinte es ernst und wurde nicht müde, in fleißigem Gebete und gewissenhafter täglicher Selbstprüfung nach der Krone zu ringen. Alle Zeitgenossen ohne Ausnahme bezeugen es, daß sein Leben ein beständiger Gottesdienst, Gegenstände des Glaubens seine liebste Unterhaltung waren. Nahm er doch, um das Alte Testament in der Grundsprache lesen und den eben damals entbrennenden Streit über die Auctorität des Textes desselben beurtheilen zu können, noch im Alter von 52 Jahren Unterricht in der hebräischen Sprache!
Dies führt uns auf eine andere, nicht minder wichtige Frage: Wie stand der Herzog zu den Wissenschaften? Es ist ja bekannt, daß die bedenklichste Schwäche des Pietismus in der Geringschätzung aller nicht mit der Theologie zusammenhängenden Wissenschaften zu suchen ist; von dieser Einseitigkeit hielt sich aber der Herzog ganz fern; es wird ihm sogar nachgerühmt, daß er in der Philosophie, Mathematik, besonders aber in der Geschichte hervorragende Kenntnisse besessen habe. Wenn uns auch nicht ausdrücklich bezeugt würde, daß derselbe wiederholt in seinen Gesprächen das Wissen als ein hohes Gut gepriesen, welches hoch über Adel und Reichthum erhaben stünde, und bei allen Berufungen neben der Treue in erster Linie Gelehrsamkeit ihm als das nothwendigste Erforderniß gegolten: wir würden es allein aus dem innigen Verhältniß des Fürsten zu dem Geh. Rath Johann Peter Schmidt schließen dürfen. Denn dieser, früher Professor in Rostock, verdankte seine hohe Stellung und sein Vertrauen einzig seinem Wissen; ja, Dank diesem durfte er sich sogar erlauben, ohne das es ihm schadete, dem Pietismus entschieden Opposition zu machen. Während aber der Herzog mit solchen gelehrten Männern sich gern unterhielt und in Ernst oder Scherz die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens besprach, war ihm dagegen Gelehrsamkeit ohne Religiosität, alle Aufgeblasenheit und dünkelhafte Prahlerei aufs Tiefste verhaßt.
Neben den Wissenschaften liebte der Herzog besonders die Künste, die höheren wie die niederen; wie er für einen nicht gewöhnlichen Kenner von Gemälden galt, auch hervorragende Maler an seinen Hof zog, so besaß er auch selbst nicht geringe mechanische Fertigkeiten. In der Musik fand er die schönste Erholung, aber theatralische Vorstellungen duldete er nirgends im Lande, "da sie nur zu Müssiggang und Verschwendung neigten." Das beste Zeugniß für den hohen Kunstsinn desselben legen noch heute das Schloß und die großartigen Anlagen in Ludwigslust ab.


|
Seite 198 |




|
"Der Herzog Friedrich", heißt es in einer Predigt, die ein hervorragender Geistlicher dem Gedächtniß des frommen Fürsten weihte, stützte sich in dem Kampf gegen Welt, Teufel und Fleisch auf den starken Gottesarm; er war ohne Unterlaß mit und bei Gott. Um im Gebet in Andacht mit seinem Gott zu verkehren, hielt er sich von aller Eitelkeit und weltlichem Getümmel fern. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, führte er daheim und auf Reisen mit sich. Sein Stolz war, Gottes Ehre und Namen zu erweitern und zu verherrlichen. Er errichtete seinem Gott den prächtigen Tempel zu Ludwigslust; er unterstützte nach Möglichkeit die Geistlichkeit und verbesserte ihre Einkünfte; er hatte für alle Nothleidenden stets eine offene Hand; Ludwigslust war der Ort, wo Allen geholfen wurde. Den Kranken war er ein rechter Samariter; er unterstützte freigebig alle Spitäler und Krankenhäuser und öffnete sie für Alle ohne Unterschied der Confession. Dabei zeigte er eine seltene Demuth; er hielt sich selbst für den größten Sünder und verewigte in goldenen Buchstaben über der Thür der Kirche zu Ludwigslust dies Bekenntniß: Friedrich, Herzog zu Meklenburg, der erlöste Sünder, hat Christo, dem Erlöser der Sünder, diesen Tempel errichtet. In seiner Leutseligkeit und Freundlichkeit übertraf er Alle am Hofe. Er hielt sich nicht für besser als Andere, und wollte daher auch nach dem Hinscheiden Allen in der Ruhestätte auf dem Gottesacker gleich sein: mitten unter seiner Gemeinde in Ludwigslust wollte er begraben sein. Die Heilige Schrift sagt von Mose: er sei Gott und den Menschen lieb gewesen; auch von unserm Friedrich sage ich: er war Gott und den Menschen lieb, und sein Gedächtniß wird bei allen Rechtschaffenen in Ehren bleiben."
So groß dies Lob ist, wir würden doch allzu einseitig zu urtheilen scheinen, wenn wir des Tadels daneben vergessen wollten. Derselbe pietistische Feuereifer, welcher die ganze Thatkraft des Fürsten anregte und ihn zu gesegnetem Wirken in Staat und Kirche begeisterte, verleitete ihn auch oft, Zielen nachzujagen, welche dem Wohle des Ganzen widerstrebten, oder auch die Menschen anders voraussetzten, als sie sind. Das Schlimme dabei war, das die heftige Art des Fürsten sich durch keine Schwierigkeiten abschrecken ließ, vielmehr sein trotziger Eifer die Ursache davon nicht in dem verkehrten eignen Bestreben, sondern in der Sünde der Menschen sah. Und, wie zu geschehen pflegt, in solchen Fällen traute er den bösen Rathgebern, die ihm in niederträchtiger Gesinnung dienten, leichter als denen, die es wohl meinten. Ueberhaupt war es, wie bereits angedeutet, eine der gefährlichsten Schwächen des Fürsten, das er das Licht nicht genügend von der


|
Seite 199 |




|
Finsterniß zu scheiden vermochte, und daher manche heuchlerische oder sonst schlechte Subjecte sich sein Vertrauen erwarben und mit ihren Einflüsterungen oder Intriguen den Hof zu Ludwigslust in Verruf brachten. Aber die Schande trifft nur diese Frömmler, die reißenden Wölfe in Schafskleidern, welche die fürstliche Gnade in frecher Weise zu mißbrauchen wagten.
Der Lieblingsaufenthalt des Herzogs war das "paradiesische Ludwigslust", wo er am liebsten ungezwungen in engstem Kreise verkehrte. Seine Gemahlin Louise Friderike liebte von Natur harmlose weltliche Freuden, war aber klug genug, ohne Widerstreben zu den Reiz des stillen Lebens sich allmählich zu gewöhnen und durch treuen Samariterdienst als würdige Gattin ihres frommen Eheherrn zu erscheinen. Ihr Schicksal kinderlos zu sein ertrug sie mit gottergebenem Herzen; an dem innigen Verhältniß der beiden Gatten vermochte es nichts zu ändern. Doch mochte sie nicht ganz verzichten auf die Lust des Lebens, besonders aber nicht auf den Besuch des Theaters; es war ihr daher verstattet, alljährlich einige Wochen in Hamburg zu verleben, wo sie an der Alster ein eignes Haus hatte. Dem Prinzen Ludwig, dem jüngeren Bruder des Herzogs, war es am Hofe zu still; er lebte mit seiner Gemahlin, Charlotte Sophie, und den beiden Schwestern in Schwerin, ohne sich um die Regierungsgeschäfte zu kümmern. Dagegen hatte der Erbprinz Friedrich Franz bei seinem Oheim in Ludwigslust seine Residenz, wo ihm besonders die Bearbeitung der Domänen= und Kammersachen oblag.
Oberhofmarschall war der durch Gelehrsamkeit ausgezeichnete Herr v. Lützow, Oberhofmeister der beim Herzog wegen seines unfrommen Lebenswandels wenig geltende Herr v. Forstner, ein geborener Würtemberger, Oberschenk der junge "lustige" Herr v. Zülow, Mundschenk und Bibliothekar Cornelius: lauter Persönlichkeiten, welche mit der Lebensanschauung ihres Landesherrn nicht harmonirten und, wie der Adel des Landes überhaupt, von dem Pietismus nichts hielten.
Ebenso stand der Kreis der Juristen. Von J. P. Schmidt, dem Geh. Rath, war bereits die Rede, er war die rechte Hand des Präsidenten Grafen v. Bassewitz; beide von der Regierung Christian Ludwigs her übernommen, setzten die Politik des Vaters unter dem Sohne fort und waren in ihrem Zusammengehen stark genug, jeden Versuch pietistischer Streberei innerhalb der juristischen Carrière zu vereiteln. Wie dieselben z. B. als Curatoren der Friedrichs=Universität in Bützow Döderlein und seinen Anhang niederhielten, ist von mir in meiner Geschichte jener Universität er=


|
Seite 200 |




|
zählt worden. Die tüchtigen Regierungsräthe Faull und zur Nedden dachten ebenso. Dem Herzog war diese Abneigung der Juristen gegen den Pietismus wohl bekannt; er war aber einsichtsvoll genug, Staat und Kirche zu sondern. Andererseits aber faßte der Herzog die Verwaltung seines oberbischöflichen Amtes als eine persönliche Gewissenssache auf, bei der niemand mitzureden hätte, als wer besonders dazu von ihm berufen würde. Die Einzigen, welche als ständige Berather sein volles Vertrauen besaßen, waren der Cabinetssecretär Ludewig, der die Kirchen=, und der Rentmeister Kychenthal, der die Schulsachen zu behandeln hatte, beide Männer, welche dem Pietismus wenigstens sehr nahe standen.
Und endlich die Geistlichkeit? Der Herzog liebte es zwar, mit tüchtigen Predigern über Fragen der Religion sich zu unterhalten, hörte auch gern ein freimüthiges Wort oder Urtheil, im Uebrigen aber hielt er die Geistlichen von seinem Hofe fern. 1 )
II. Das Consistorium.
Als der Herzog Friedrich den Thron bestieg (1756), herrschte in Meklenburg auf keinem Gebiet größere Verwirrung als in geistlichen Sachen, so daß niemand recht wußte, was Recht war, und wie weit das Recht galt. In den verschiedenen Theilen des Landes waren nicht allein ganz verschiedene, sondern oft gar sich widersprechende Verordnungen in Kraft. Alle Versuche der vorangegangenen Zeit, eine für das ganze Land geltende Ordnung wieder herzustellen, waren an dem Widerstande der Stände oder der Schwierigkeit der Sache gescheitert. Nun war zwar im LGG. Erbvergleich von 1755, womit der Herzog Christian Ludwig seinem Sohne die Bahn geebnet hatte, die Nothwendigkeit einer Revision der bestehenden Kirchenordnung anerkannt, auch der Wunsch ausgesprochen, daß der Herzog die Initiative dazu ergreifen möchte, aber dabei zugleich zur Bedingung gemacht, das derselbe nichts unternehmen dürfe, ohne zuvor den Landtag gehört zu haben, da Kirchensachen die Wohlfahrt des ganzen Landes beträfen. Und


|
Seite 201 |




|
damit nicht genug, es war, um jedem Fürsten die Lust zum Vorgehen von vorne herein zu benehmen, die Competenz des Fürsten ausdrücklich auf Sachen allgemeiner Art beschränkt worden, zu allen übrigen aber, so weit sie nur irgend die Privilegien der Ritter= und Landschaft beträfen, ausdrücklich die Bewilligung der Stände vorbehalten. Deswegen unterließ der Herzog Friedrich auch die Arbeit im Großen anzufassen, die doch ohne schweren Conflict zu einem befriedigenden Resultat nicht gebracht werden konnte. Er begann zunächst mit einer Neuordnung der Geschäfte des Consistoriums 1 ) zu Rostock; denn diese oberste Kirchenbehörde hatte unter dem wankelmüthigen Regimente Karl Leopolds einen schlimmen Stoß bekommen und in dem Streite gegen die Darguner Pietisten beinahe ihr letztes Ansehen eingebüßt. Bereits am 30. November 1756 verordnete der Herzog: daß hinfort dem Consistorium alle Civil= und Proceßsachen abgenommen und den Landesgerichten zugewiesen sein sollten. Damit hörte die Gerichtsbarkeit desselben in weltlichen und Ehesachen (doch die Sponsalien und Ehesachen der Domanial=Unterthanen ausgenommen) auf, und die bürgerlichen Sachen waren den bürgerlichen Gerichten zurückgegeben. Was den Herzog zu dieser Aenderung der Consist.=Ordnung von 1570 2 ) bewog, war in erster Reihe wohl der Wunsch, die verwirrende Concurrenz zwischen den Landesgerichten und dem Consistorium zu beseitigen, daneben aber die Nothwendigkeit, sein altes fürstliches Recht klar zu stellen; er wollte beweisen, daß alle Ehesachen unter ihm ständen, und die der Ritter= und Landschaft, auch der Stadt Rostock eingeräumte Jurisdiction in Ehesachen Gnade sei, welche jeden Augenblick zurückgenommen werden konnte. Dies beweist auch der Vorbehalt bez. der Domanial=Unterthanen und wird klar ausgesprochen in der VO. vom 16. Mai 1776: "Die ritterschaftlichen Patrimonial= und Stadtgerichte sollten sich keine Jurisdiction in matrimonialibus anmaßen, sondern die Fassung des Endurtheils den Landgerichten überlassen."


|
Seite 202 |




|
War nun auch die Competenz des Consistortums 1756 sehr eingeschränkt, indem es jetzt wesentlich nur noch Doctrinalia, Ceremonialia, Disciplinalia unter sich hatte, so konnte es nun seine ganze Aufmerksamkeit dieser wichtigen Aufgabe, eine Disciplinarbehörde zu sein, zuwenden; und eben dies wollte der Herzog, wie wir aus dem gleichzeitigen Befehl an den Consistorial=Fiscal ersehen: hinfort "ohne alles Ansehen der Person rücksichtslos alle Excesse der Prediger und Küster zu verfolgen." Klarer noch sprach er diese Absicht aus in seiner Antwort an den Engeren Ausschuß der Ritter= und Landschaft, der sich über die einseitige Veränderung einer altbestehenden Ordnung beschwert hatte: "Die ganze Pflicht und Berechtigung des Consistoriums solle hinfort nur mehr in der Beobachtung, Ermahnung, Bescheidung Aller und Jeder, besonders aber der Prediger, Kirchen= und Schulbedienten nach der Kirchenordnung in allen Doctrinalibus, Ceremonialibus, Disciplinalibus, mithin allenfalls in der gehörigen Anzeige und Denunciation der gegen die Kirchen=Ordnung im Lande zu bemerkenden Vergehungen bestehen. Wenn daraus ein Proceß oder gerichtliches Verfahren erwachse, so gehöre die weitere Verfolgung der Sache dem weltlichen Gerichte."
In diesem Sinne entschied auch später im Jahre 1773 der Herzog den Streit, ob weltliche Sachen zu den Disciplinalibus gehörten, indem er bestimmte, daß alle Vergehungen, welche in geistlichen und weltlichen Sachen die Kirchen=Ordnung verletzten, zu den Disciplinalibus gerechnet würden; so sollten auch die causae stupri, adulterii, incestus, sowie die Irrungen zwischen Verlobten und Eheleuten zu den Consistorialsachen gehören qua primam notionem und summarischen Verfahrens; wenn aber Processe daraus entständen, so sollten die Landesgerichte die Sache annehmen; nur bei den Domanial=Unterthanen hätten die Beamten die Voruntersuchung und Instruirung bis zum rechtlichen, dem Consistorium zufallenden Entscheid zu führen. Die ganze Competenz des Consistoriums wurde dann in der VO. vom 20. Juni 1776 zusammengefaßt; sie sollte sich erstrecken
1) in Ansehung der Prediger und übrigen geistlichen Personen auf die Doctrinalien, Ceremonialien und Disciplinalien;
2) in Ansehung der übrigen Unterthanen a. auf alle groben Skandale und ärgerlichen Ausbrüche des Lasters, b. auf alle Irreligion und Verachtung der Gnadenmittel, c. auf Alles, was überhaupt gegen die Kirchen=Ordnung in geistlichen und kirchlichen Dingen verstoße;


|
Seite 203 |




|
3) auf die Matrimonial= und Sponsaliensachen der Amtsunterthanen, wozu gerechnet werden alle Irrungen zwischen Verlobten und Eheleuten, alle Ehescheidungen und Lösungen des Verlöbnisses, endlich die Desertionsprocesse;
4) auf alle Dispensationen naher Anverwandten in den bekannten 13 Fällen, in der gesetzlich geschlossenen Zeit, ohne vorherige dreimalige Aufkündigung, ferner zur Veränderung des Beichtvaters, zur Privat=Communion und Confirmation, zur stillen Beerdigung.
In Bezug auf Nr. 2 wurde noch beschränkend hinzugefügt, daß dem Consistorium nur die Einsendung der Klagesache an die Herzogl. Regierung obliegen solle, damit von dort aus nach höchsteigener Herzogl. Genehmigung die Sache zur weiteren Cognoscirung an eines der Landesgerichte hingewiesen werde. "Denn in allen wichtigen Sachen, wobei Gewissensfälle und solche Fragen, deren Entscheidung nicht certi iuris et constituti ist, zu Grunde liegen, will Serenissimus selber Richter sein." Im Jahre 1782, als das Ansehen des Consistoriums wieder zu wanken anfing, sah sich der Herzog genöthigt, zu bestimmen, daß nicht nur in wichtigen und bedenklichen, sondern überhaupt in allen Fällen die Consistorial=Erkenntnisse mit den einzelnen Votis vor der Publication an die Regierung und durch diese an den Herzog persönlich ergehen sollten. -
Soviel über die Befugnisse des Consistoriums. Die Appellation gegen die Erkenntnisse desselben ging an das Hof= und Landgericht in Güstrow; eine Appellation an die Reichsgerichte in Kirchensachen fand nur statt, wenn Landstände sich in ihren Privilegien beschwert fühlten.
Mit solchen Verordnungen und Befehlen war indessen wenig gethan, wenn nicht die Männer da waren, welche denselben Achtung verschafften. Von dem Consistorium aber, welches der Herzog bei seinem Regierungsantritt vorfand, war ein schärferes Eingreifen nicht zu erwarten; dazu besaß es auch, nachdem es in seinem Processe gegen die Darguner so schmählich unterlegen war, zu wenig Ansehen im Lande, als daß viel Gutes von ihm noch zu hoffen war. Als daher der Herzog sah, daß alle seine Ermahnungen zu gewissenhafter Amtsführung nichts fruchteten, da die Räthe ihre Auctorität durch Strafbefehle und Executionen geltend zu machen Anstand nahmen, entschloß er sich eine neue Kraft zu berufen.
Es war dies der am 16. Januar 1758 ins Consistorium eingeführte Professor Dr. Döderlein. Da wir von diesem für die Geschichte unsers Landes so merkwürdigen Manne noch keine Bio=


|
Seite 204 |




|
graphie besitzen, so möge mir ein längeres Wort, übrigens unter Hinweisung auf meine Arbeit über die Friedrichs=Universität 1 ), hier gestattet sein. Es geschieht dieses in dem vollen Bewußtsein, daß damit eine alte Ehrenschuld unserer patriotischen Geschichtsschreibung getilgt wird, welcher es längst zukam, das nebelhafte Zerrbild zu zerreißen, in dem das Andenken dieses von der Bosheit seiner Feinde tief gekränkten Mannes fortlebt, eines Mannes, dessen Grundzug Treue ohne Falsch war, der in einer Zeit, wo Heuchelei und Schein den Thron des besten Fürsten umgaben, selbstlos das eine Ziel verfolgte, seiner ihm durch Gottes und des Herzogs Gnade gestellten Aufgabe gemäß unser durch viel Noth und Elend tief gesunkenes Volk an der lebendigen Kraft des göttlichen Worts wieder emporzuheben. Es ist wahr: Döderlein hatte seine Schwächen, und die größte war seine ungezügelte Leidenschaft, wodurch er sich manche Blöße gab. Aber wo er fehlte, geschah es nirgends aus Eigennutz oder Herrschsucht, sondern einzig aus Eifer für seinen Beruf, welcher ihm schließlich auch einen Kampf zur Pflicht machte, in dem er unterliegen mußte. Nicht vermögend, dem neuen Geiste einen Damm entgegenzuwerfen, wurde er zuletzt von der Fluth mit fortgerissen, und das Große, was er geleistet hatte, von dem Undank der Welt vergessen.
Christian Albrecht Döderlein wurde am 11. December 1714 zu Seegringen, einem fruchtbaren Dörfchen des Ries, wo sein Vater Prediger war, geboren. Die erste Bildung verdankte er seinem Vater, nachher besuchte er das Gymnasium zu Oettingen. In der Wahl des theologischen Studiums folgte er mehr dem Wunsche der Eltern als der eignen Neigung. Nach beendigtem Studium in Jena, wo er sich dem herrschenden freieren Geiste hingegeben und mehr an philosophischen Speculationen und allgemein wissenschaftlichen Fragen als an der eigentlichen Theologie Gefallen gefunden hatte, zwang ihn sein Vater, indem er ihm die Mittel, als Docent in Göttingen sich zu habilitiren, verweigerte, nach einer Hauslehrerstelle sich umzusehen. Die Vorsehung brachte ihn nach Teschow (im Amt Güstrow), wo er mit den Darguner Pietisten in nächste Berührung kam und, einmal in die Bewegung hineingezogen, selbst den ganzen methodischen Bußgang durchmachte. Das ihm bald hernach von Herrn v. Maltzahn in Aussicht gestellte Predigeramt zu Camin (A. Güstrow) reizte ihn nicht: er ging 1751 als Hofmeister zweier Söhne des Grafen v. Promnitz aus der Nieder=Lausitz nach Halle, wo er sich eng an den Professor Knapp und den Kreis der


|
Seite 205 |




|
Pietisten anschloß. Nach Kurzem wurde er Inspector des Waisenhauses und 1753 Prediger an der Moritz=Kirche.
Von hier begann Döderleins öffentliche Thätigkeit. Denn seine Predigt von der Erlösung der sündigen Menschheit durch Christi Opfertod, sein gewaltiger Bekehrungseifer brachte ihn bald in Streit, sowohl mit den Orthodoxen, wie mit den Neuerern, deren Haupt Semler war; jenen warf er vor, daß sie mit ihrer dürren und des lebendigen Odems entbehrenden Logik keine trostbedürftige Seele laben und erquicken könnten, diesen verwies er den Mißbrauch, welchen sie mit der Vernunft trieben. Aufs Heftigste bestritt er der Philosophie das Recht, mit blendend=bethörendem Schein Menschenweisheit über die Offenbarung zu erheben; die einzige Quelle reiner Gotteserkenntniß und seligen Gnadenlebens, das Buch aller Weisheit sei die Heilige Schrift. Diese Angriffe, mit Leidenschaft geführt und mit Leidenschaft erwidert, mußten Döderlein in den Ruf des intolerantesten Fanatikers bringen, und ohne Zweifel wäre der Streit mit der Niederlage des streitbaren, aber allzu heftigen Gottesmannes geendigt worden, wenn die Vorsehung ihn nicht als Werkzeug auserkoren hätte, im höheren Amte reichen Segen einem armen, schwer heimgesuchten Volke zu bringen.
Der Herzog Friedrich von Meklenburg=Schwerin, zweifellos genau von Allem, was in Halle vorging, unterrichtet, stellte schon im ersten Jahre seiner Regierung (1756) die Anfrage an Döderlein, ob er bereit wäre, eine Anstellung an der Rostocker Universität anzunehmen, worauf Letzterer weder zusagend noch ablehnend antwortete. Zwar entsprach die neue Stellung seinem alten Wunsche akademischer Lehrer zu werden, es war ihm aber doch selbst bedenklich, ob er auch das Rüstzeug zu einem Professor der Theologie hätte. Dazu kannte er aus eigner Erfahrung den bittern Haß der orthodoxen Rostocker Facultät gegen alles Pietistische; er wußte, daß seine Berufung den bestimmten Zweck hatte, den Dargunern die letzte Genugthuung zu verschaffen. So zog die Verhandlung sich hin; das Zureden der Freunde vermochte die gerechten Bedenken in Döderlein nicht zu überwinden. Im folgenden Jahre bot ihm der Herzog außer der Professur noch die Stelle eines Raths im Consistorium und ein Einkommen von 1000 Thlrn. an, bedang aber dabei aus, daß Döderlein bis zum Ende des Jahres sich die Doctorwürde in Halle erwerben sollte. Die Verlockung war zu groß: "im Vertrauen, daß die göttliche Vorsehung durch die überschwengliche Kraft des Heiligen Geistes ihn kräftig machen werde, als Gefäß der Barmherzigkeit zum Dienste der Kirche und des


|
Seite 206 |




|
gemeinen Wesens den christfürstlichen Endzweck Serenissimi fördern zu helfen", nahm er am 20. October 1757 den Ruf an.
Der Haß der Feinde, durch die große Ehre des Gegners noch mehr gereizt, wollte ihn nicht ungezeichnet von dannen ziehen lassen; der Professor Semler sprach es offen aus, daß er die Ehren=Promotion Döderleins dazu benutzen wolle, den Candidaten als pietistischen Fanatiker und Schwärmer vor der gelehrten Welt bloßzustellen. So fand vor einem großen Publicum die von Morgens bis Abends dauernde Disputation statt, und die Gegensätze wurden von beiden Seiten aufs Schärfste hervorgekehrt, bis zuletzt der Angegriffene die Hand zum Frieden bot: er bat Semler, die Augen vor dem der evangelischen Kirche drohenden Verderben nicht zu verschließen und die Stätte, wo einst Spener und Francke leuchtende Vorbilder christlichen Glaubens und Wandels gewesen, allen wahren Christen nicht zum Aergerniß zu machen; er bezeuge vor Gottes Angesicht, daß er in keinem wesentlichen Punkte von der reinen Lehre der evangelischen Kirche abweiche. Semler wies die Versöhnung zurück, er war mit seiner Theologie bereits zu weit in den Rationalismus verrannt; aber später sah er das Unrecht, welches er Döderlein zugefügt hatte, ein und bekannte es öffentlich.
Am 16. Januar 1758 wurde Döderlein in das Consistorium eingeführt. An ein energisches Durchgreifen war aber bei der Kriegsnoth des Landes nicht zu denken; auch lähmte der erbitterte Streit mit der theologischen Facultät in Rostock wegen der Reception Döderleins Thatkraft. Wie viel der Herzog zu strengerem Eingreifen ermahnte 1 ), das Consistorium verblieb in seiner alten Passivität. Die beiden Juristen, Kanzlei=Director Taddel und Vice=Director v. Hannecken, die mit Döderlein das Consistorium ausmachten, waren nicht zu bewegen, Doctrinalien, außer wenn sie zu grobem Aergerniß Anlaß gegeben hatten, zu verfolgen. Dazu


|
Seite 207 |




|
kam, daß Döderlein als Director der neu gegründeten Universität zu Bützow seit Michaelis 1760 vollauf beschäftigt war, so daß man nur die riesige Arbeitskraft des Mannes bewundern kann, der es trotz aller Geschäfte fertig brachte, die ihm vom Herzog aufgetragene Revision des neuen Gesangbuches 1 ) 1764 "zur A. H. Befriedigung Serenissimi" zu vollenden.
Die Allerhöchst befohlene Einführung dieses Gesangbuches in allen Gemeinen des Landes war der Anlaß zu neuen erbitterten Angriffen auf Döderlein. Der Herd der Opposition war diesmal Güstrow, wo die schon lange gährende Wuth auf die Pietisten durch die Berufung Keßlers als Superintendenten daselbst zu öffentlichem Skandale führte. Das Militär mußte den Pöbel, "der dem Pietisten zu Leib wollte", mit Gewalt auseinander treiben. Der Magister Hahn schimpfte die Pietisten auf der Kanzel Lügenprediger, Lästerer, Heuchler und Rottenmacher, deren Gedächtniß ausgetilgt werden müßte; und der Senior Jantke verstieg sich 1767 zu Aeußerungen über das neue Gesangbuch, welche eine Beleidigung des Landesherrn enthielten. Er wurde daher von Keßler wegen Aufreizung der Gemeinde gegen den Herzog beim Consistorium denuncirt: Mit Berufung auf Ephes. 5, 19 habe er gesagt, zu dem Beten und Lobsingen müsse eine Gewißheit des Herzens treten, daß das Beten und Lobsingen auch nach dem im Worte Gottes geoffenbarten Willen des Höchsten geschehe, und man wisse und verstehe, was man singe und bete. Dies könne aber nicht wohl allerwege geschehen, wenn in dem neuen Gesangbuche manche alte schriftgemäße und geistreiche Lieder weggelassen würden, die bekannt und in allen Kirchen gebräuchlich seien, an deren Statt aber neue eingeführt würden, die unbekannt, auch wohl in manchen Dingen undeutlich und unverständlich seien; wer also solches singe, und doch nicht wisse und verstehe, was er singe, zumalen nicht Jeder den geübten Sinn habe, der könne nicht wissen, daß er nach dem Willen Gottes thue und Gott gefalle."
Diese Aeußerung des im Dienste bereits ergrauten Predigers wäre wohl ohne besondere Folgen geblieben, wenn sie nicht mit einer durch das ganze Land gehenden Gährung wider das "pietistische Gesangbuch, das den Gemeinden aufgezwungen würde", in Verbindung gestanden, und daher die Verfolgung der Klage dem am meisten betheiligten Consistorialrath Döderlein das Mittel an


|
Seite 208 |




|
die Hand gegeben hätte, durch Statuirung eines Exempels an einem hochangesehenen Geistlichen die andern Widersacher abzuschrecken. Döderlein kannte gut genug die schwache Stelle des Herzogs; es hätte völlig hingereicht, daran zu erinnern, daß die eben glücklich unterdrückten pietistischen Wirren aufs Neue der Ruhe des Landes gefährlich zu werden im Begriff ständen, um Jantke zu einem verlorenen Mann zu machen, aber Döderlein ging weiter. In einer persönlichen Audienz stellte er dem Herzog vor, daß es sich um nichts Geringeres als um ein höchst sträfliches, vollbewußtes Eingreifen in das oberbischöfliche Recht des Fürsten handele, welches als Sühne die alsbaldige Entlassung Jantkes aus dem Amte verlange. In Folge dessen wurde der Angeklagte sofort, ohne gehört zu sein, suspendirt. Aber die beiden Directoren Taddel und v. Hannecken, welche in dem Streit nur eine persönliche Reibung zwischen Keßler und den Güstrower Predigern sehen wollten, bestürmten die Regierung, dem würdigen und im Amte ergrauten Angeklagten wenigstens eine schriftliche Verantwortung auszuwirken, da sie überzeugt seien, daß leicht eine gütliche Beilegung der Sache sich finden ließe. Jedoch durch diese Machinationen seiner Collegen im Consistorium noch mehr gereizt, erklärte Döderlein, sein Amt niederlegen zu wollen, wenn er in dieser Sache keine Unterstützung fände. So blieb es bei der Suspension; aber Jantke erhielt die Erlaubniß, sich schriftlich vor dem Consistorium zu rechtfertigen. Erst am 6. Juli 1770 reichte er seine Vertheidigung ein. Der alte Mann hatte nicht den Muth zum entschiedenen Auftreten und suchte sich durch die Erklärung zu retten, er habe garnicht das neue Gesangbuch gemeint, auch von einem hzgl. Befehl, das Gesangbuch in allen Gemeinden einzuführen, nichts gewußt. Im Uebrigen könne er aber das Buch nicht von allen Irrthümern freisprechen und halte dies auszusprechen für sein Recht; es sei ein zu harter Gewissenszwang, von ihm zu fordern, daß er dasselbe glauben solle wie Döderlein, vor dem er sonst persönlich alle Achtung habe.
Die Absetzung Jantkes ohne Verhör trug aber nicht dazu bei, die Aufregung im Lande zu mindern, sondern lenkte die Aufmerksamkeit Aller, auch da, wo schon die Opposition verstummt war, auf das neue Gesangbuch und seinen Verfasser. Man suchte und fand, was man suchte: den Anstoß und das Aergerniß. Die von Güstrow ausgegangene Opposition verbreitete sich über das ganze Land; Ritter= und Landschaft, Gemeinden und Prediger - Alles protestirte gegen das pietistische Gesangbuch. Unangenehmer noch als dieser unerwartete Widerstand war dem Herzog, daß der


|
Seite 209 |




|
Streit in öffentlichen Blättern, besonders in den Hamburger Nachrichten, mit scharfen Federn geführt wurde: was konnte ihm auch widerlicher sein, als in Zeitungen Dinge, welche die höchste Ehrfurcht fordern, mit Spott und Hohn behandelt zu sehen? Zwar dem Engeren Ausschuß, der am 25. April 1768 für den Angeklagten eingetreten war, mit dem Hinweis darauf, daß das neue Kirchengesangbuch so Vielen, nicht bloß den meisten Predigern, anstößig sei, und Jantke nur ausgesprochen habe, was Viele dächten, antwortete der Herzog noch sehr ungnädig; aber seiner natürlichen Gerechtigkeit war es nicht unwillkommen, als die Directoren im Consistorium Jantke für einen durch seine Vertheidigung als einfältig erwiesenen Mann in Schutz nahmen und die Sache der juristischen Facultät in Kiel zur Begutachtung zu übergeben riethen. Trotz Döderleins Widerspruch ging der Herzog darauf ein, und so wurde der Angeklagte von der Facultät zwar als schuldig der Unehrerbietigkeit gegen Serenissimum erkannt, aber als Milderung geltend gemacht, daß wirklich das neue Gesangbuch nicht ganz frei von Anstößen sei. In Folge dessen wurde Jantke am 6. Mai 1771 (kurz vor seinem Tode) wieder in sein Amt eingesetzt, aber zur Tragung aller Kosten verurtheilt.
Inzwischen war aber auf Döderleins Vorstellung eine durchgreifende Aenderung im Consistorium vorgenommen worden: im Jahre 1768 war der Superintendent Keßler, und im folgenden Jahre der Professor der Theologie zu Bützow Mauritii als ordentliche Räthe berufen worden. So brauchte Döderlein nicht mehr zu fürchten, von den beiden juristischen Collegen niedergehalten zu werden. Auf die neuen Mitglieder konnte er sich verlassen; sie waren seine Gesinnungsgenossen und darin mit ihm einig, daß im äußersten Falle die Opposition im Lande mit Gewalt unterdrückt werden müßte. Während aber Keßler ein schneidiger Mann war, der keinem Streit auswich, war Mauritii mehr für das Gehenlassen, soweit es ihm mit dem Wohl der Kirche verträglich erschien; und da er seine Ruhe und Ueberlegung auch in der größten Hitze des Streits niemals verlor, beherrschte er, ohne hervorzutreten, die beiden Parteien. sein gerechter Sinn machte ihn zum besondern Liebling seines Fürsten und zum Vertrauensmann der Regierung.
Der Streit wegen des neuen Gesangbuchs war noch nicht beendet, als eine neue und größere Sorge erwuchs: es zeigte sich, daß der Rationalismus in Meklenburg Boden zu fassen begann. Um keinen Preis wollte aber der Herzog diesen Angriff auf den Frieden der Kirche in seinem Lande dulden. Er befahl daher dem


|
Seite 210 |




|
Consistorial=Fiscal auf alle im Herzogthum erscheinenden Schriften ein wachsames Auge zu haben und jede Antastung der Fundamental=Artikel von Seiten der Landesprediger ohne Rücksicht zu verfolgen. Aber schon hatte, ohne daß der Herzog sich dessen bewußt war, die Lehre der neuen Reformatoren selbst bei Hofe sich eingebürgert, ja der Herzog hatte die Dedication einer solchen Schrift dankend angenommen. Der Präpositus zu Waren nämlich, Johann August Hermes, der Schwiegersohn des Superintendenten Zachariä zu Parchim, hatte den ersten Band seiner "Wochenschrift" am 30. September 1771 mit folgendem Schreiben dem Herzog, unterthänigst zugeeignet:
"Der Herr meiner Väter führte mich nach Meklenburg, um Ew. Herzogl. Durchlaucht Unterthan zu werden und in Dero Landen das evangelische Lehramt zu führen. Nach seinem untadelhaften Willen und auf Dero Höchstgnädigstem Rufe stehe ich nun als Lehrer bei der dritten Gemeinde. Ich verehre diese Wege der Vorsehung, obgleich sie nicht immer mit meinen natürlichen Wünschen übereinstimmen, ob ich gleich durch Ehre und Schande, durch böse und gute Gerüchte und durch manche Noth bis hieher fortgehen müssen. Nicht weniger erkenne ich die Gnade, welche Ew. Herzogl. Durchlaucht mir als einem Fremdling erwiesen haben, mit dem lebhaften Gefühle des unterthänigsten Dankes. Noch nie habe ich das Glück empfunden, Ew. Herzogl. Durchlaucht nähere Rechenschaft von den Gesinnungen bei der Führung meines Amtes geben zu dürfen. Jetzt kann es einigermaßen durch die öffentlichen Arbeiten geschehen, welche ich seit einem Jahre zur Beförderung der Gottseligkeit unternommen habe. Und dies brachte mich zu dem Entschluß, sie Höchstdenenselben in Demuth zuzueignen. Manche Mängel der Schrift sind mir selbst nicht unbekannt, ja es ist möglich, daß ich hin und wider irre. Bei einer sorgfältigen, unparteiischen Untersuchung behalten auch nicht alle sonst wohl beliebten Methoden im praktischen Christenthum ihr altehrwürdiges Ansehen und lange behaupteten Werth. Wer mit einem zärtlichen Herzen der Wahrheit nachforscht und sich nicht sklavisch nach dem oder jenem redlichen Manne bildet, der findet wirklich zuweilen in seinem Gewissen sich gedrungen von der gebahnten Heerstraße abzuweichen und manche verjährte Vorurtheile zu bestreiten. Ich gestehe es mit vieler Freimüthigkeit, daß es mir bei Ausarbeitung der Schrift manchmal so ergangen ist. Indeß bin ich mir meiner redlichen Absicht so vollkommen bewußt, daß, wenn auch Menschen nicht richten oder verurtheilen wollten, ich mit getrostem Muthe vor den Allerhöchsten hinträte und sagte: Du Allsehender weißt


|
Seite 211 |




|
es, daß ich die Weisheit lieb habe, daß ich bei dieser geringen Arbeit nur die Wahrheit, die Ausbreitung richtiger Erkenntniß und wahrer Gottseligkeit suche. Gott allein kann die Absichten segnen und fördern; voll Zuversicht erwarte ich solches von ihm, und mit entzückender Freude betrachte ich Ew. Herzogl. Durchl. als den gesegneten Regenten, unter dessen Schutze ich diese Bemühungen fortsetzen kann, ja als das erste und vornehmste Werkzeug in der Hand Gottes zur Beförderung der Wahrheit und Gottseligkeit in den meklenburgischen Landen. Glückliche Fürsten, welche der König aller Könige zur Ausführung so besonderer Absichten gebrauchen kann! Er, der Herr, den Ew. Hzgl. Durchl. so kindlich fürchten und zärtlich lieben, lenke und heilige Dero Anschläge, so oft Sie vor ihm in der Stille über das wahre Wohl Dero Unterthanen nachdenken! Er mache da Bahnen, wo bisher noch keine waren, Er schenke treue Diener und Lehrer, die mit Weisheit, Rechtschaffenheit und standhaftem Muthe begabt sind! Das wünscht und erbittet" u. s. w.
Der Herzog nahm, wie gesagt, dankend die Zueignung entgegen, und die Schriften des Präpositus wurden sogar während der Tafel vorgelesen, ohne daß Einer die gefährliche Tendenz deutlich erkannte, welche doch klar genug in dem obigen Schreiben ausgesprochen war. Hermes galt für durchaus zuverlässig; war er doch einer von den fremden, dem Kreise der Hallenser zugehörigen Prediger! 1 ) Um so mehr war man verwundert, als plötzlich jene selbige Wochenschrift von verschiedenen Seiten aufs Heftigste angegriffen wurde, und sich immer klarer in der Entwickelung des Streites ergab, daß der Präpositus, in enger Verbindung mit den Rationalisten in Berlin, mit vollem Bewußtsein die Lehren der evangelischen Kirche angriff. Das Consistorium, wohl bekannt mit der Gunst, deren sich die Schriften des Präpositus bei Hofe erfreuten, wußte Anfangs nicht, wie es sich dem dreisten Angreifer gegenüber verhalten sollte. v. Hannecken warnte dringendst vor dem Prozeß; auch Mauritii meinte, daß der an sich unbedeutenden Sache damit eine unverdiente Wichtigkeit beigelegt würde. Aber für Döderlein und Keßler bestand nur die eine Frage, ob der Herzog für das Processualverfahren zu gewinnen sei. Döderlein stellte daher in einem längeren Pro memoria dem Herzog die Verwirrung vor, in welche Hermes die Gewissen bringe, indem derselbe, auf die Gnade seines Landesherrn bauend, offen als So=


|
Seite 212 |




|
cinianer die Heilige Schrift aufs Unverantwortlichste mißhandle und mit all den verwerflichen Auslegungsregeln naturalisch Gesinnter die Grundfesten der christlichen Religion untergrabe und dadurch, daß er öffentlich von den symbolischen Büchern sich lossage, bei allen Rechtdenkenden großes Aergerniß errege; er bäte daher dringendst um Verfolgung der Sache im Consistorium. Der Herzog erwiderte kurz: die Theologen in consistorio möchten das Aergerniß beseitigen. Damit war aber die Schwierigkeit nur gewachsen; denn in wessen Namen sollten die Theologen vorgehen? Ein processualisches Verfahren im Namen des Herzogs ohne Consistorial=Beschluß war nicht herkömmlich und konnte leicht als Inquisition angesehen werden. Durfte man die Spottgeister und Lästerer reizen ?
In eben dieser Zeit trat als neues Mitglied der "Proselyt" Ferdinand Ambrosius Fidler, Professor der Theologie zu Bützow, ins Consistorium ein, ein Mann, dessen Lebensgang zu merkwürdig ist, um nicht an dieser Stelle seinen Platz zu finden. Es ist einer jener Elenden, die durch Heuchelei und Schein in das Vertrauen des Herzogs sich einzuschmeicheln verstanden und hinterher den besten Fürsten ruchlos prostituirten.
Ferdinand Ambrosius Fidler, der Sohn eines Bürgers in Wien, dem es schwer fiel, für seine zehn Kinder das redliche Brot zu verdienen, war von der Stunde seiner Geburt an dem Dienste der Kirche bestimmt. Dank seiner seltenen Geschmeidigkeit und Begabung wurde er schon im Alter von 24 Jahren als Correpetitor ins Kaiserliche Hofkloster der Augustiner zu Wien berufen und im folgenden Jahre zum Geheim=Protocollisten der ganzen Augustiner=Provinz ernannt. Eine glänzende Zukunft war ihm damit gewiß. Vier Jahre später war er auf der Flucht, der Untersuchung wegen schwerer Vergehen sich entziehend. Worin dieselben bestanden, ist mit Bestimmtheit aus der vorliegenden Correspondenz Fidlers mit seinen Brüdern Marianus und Dominicus nicht mehr zu ersehen; es scheint aber, daß er aus dem ihm zugänglichen Archiv seines Ordens Geheimnisse verrathen hat. Daß er der Schuldige war, ersieht man deutlich aus dem Verhalten der Brüder, von denen der eine ihn den Auswürfling der Familie nennt, der andere seinem Gedächtniß flucht.
Nach einjährigem Aufenthalt in Leipzig trat Fidler zur lutherischen Kirche über; aber Schulden zwangen ihn, bei einem Vetter in Hamburg, Namens Vogel, seine Zuflucht zu suchen. Hier gelang es dem "armen, gehaßten, verfolgten, in seinem Leben bedrohten Proselyten" Gönner zu finden, die sich aber bald wieder


|
Seite 213 |




|
von ihm abwandten, als sein leichtsinniger Lebenswandel bekannt wurde. Vergebens suchte er die Schuld auf den "unsauberen Vetter" zu wälzen; mit der Noth des Lebens ringend, mußte er suchen, selbst sein Brot zu verdienen. Er wurde Schriftsteller, und sein Glück war es, daß er an dem Prediger Aloysius Merz von der Societät Jesu in Augsburg (dem bekannten "leibhaftigen Pater Merz") einen ebenso leidenschaftlichen als ungeschickten Gegner fand. Denn nur diesem Federkriege verdankten die mit Schmutz und Unflath erfüllten Schandblätter Fidlers, "Der Proselyt" und "Das antipapistische Journal", ein gewisses Ansehen.
Auf dieses gestützt, näherte sich Fidler dem Thron des Herzogs Friedrich mit der Bitte, ihm in Meklenburg Schutz vor den Nachstellungen seiner Todfeinde zu gewähren. Die Audienz, in welcher er sich als eifriger Crusianer aufspielte, endete mit dem Siege der gleißnerischen Heuchelei und unverschämtesten Offenherzigkeit. Nachdem er wiederholt vor dem Herzog gepredigt hatte, erhob dieser in mitleidigem Erbarmen den "armen Verfolgten" am 17. Januar 1772 zu seinem Hofprediger, "als was er schon vordem in Wien gewesen." Der 17. Januar war der Jahrestag der Flucht Fidlers aus dem Kloster.
In dieser seiner neuen Stellung wagte der Freche unter den Augen seines Landesherrn und zum Schimpfe der Kanzel die ekelhafte Comödie zu spielen in der Rolle eines zweiten Luther; und meisterlich verstand er es, den Seelenkampf, der ihn aus dem Kloster getrieben, darzustellen und die Menschen zu täuschen. Die Hölle triumphirte auf Erden.
Das Amt eines Hofpredigers befriedigte den Ehrgeiz des Lügenapostels nicht lange. Er wußte dem Herzog als bloße Gerechtigkeit darzustellen, daß er wieder zu der Stellung eines Professors, die er vordem im Orden eingenommen hätte, emporgehoben würde. Am 13. September 1772 erhielt er die Zusage und am 12. October die Vocation als Professor der polemischen Theologie in Bützow und zugleich als Consistorialrath.
Von Fidlers Thätigkeit in Bützow habe ich in meiner Geschichte der Universität Bützow gehandelt; fassen wir hier seine Wirksamkeit im Consistorium ins Auge! Bei seinem Eintritt in dasselbe am 23. Januar 1773 harrte eben, wie wir sehen, die Sache gegen Hermes ihrer Entscheidung. Der schlaue Fidler wußte Rath: er bearbeitete den Fiscal Rath Weinland so lange, bis dieser am 28. Mai 1773 den Präpositus Hermes denuncirte, daß er "seinen Eid auf die symbolischen Bücher gebrochen" habe. Entrüstet wies zwar der Director v. Hannecken (Taddel war vor


|
Seite 214 |




|
Kurzem gestorben) einen solchen Proceß zurück, er konnte aber nicht durchdringen; allein gegen Viele stehend, mußte er in die Vorforderung des Denuncirten einwilligen. Das ausführliche Votum Döderleins, welches ich folgen lasse, hatte durchgeschlagen.
"Ich bin so weit von der Verfolgungssucht entfernt als nur irgend Einer sein kann. Aber wir müssen uns auch vor dem andern Extrem hüten, das: vielleicht diejenigen, welche die Fundamente unserer Kirche angreifen, in übertriebener Nachsicht treiben lassen, was sie wollen, und damit die Rechte unserer evangelischen Kirche preisgeben, wodurch wir Aergerniß gäben. Die Kirche hat gewisse von Christo und den Aposteln gesetzte Rechte, Vollmachten und Befugnisse, wozu vor Allem gehört, daß sie Alle, welche ihren Grundlehren zuwider handeln oder lehren, ausschließen kann. Sogar die auf den Umsturz unserer Kirche hinarbeitenden Männer bekennen, daß jede kirchliche Gesellschaft das Recht habe, den Lehrbegriff, den sie als Grund ihrer Religion, ihres Trostes und ihrer Beruhigung unter sich gemeinschaftlich gehalten haben will, festzusetzen, daß ein Jeder, der ein Glied solcher Gemeinschaft und gar ein Lehrer derselben sein will, sich darnach zu richten, oder aber dieselbe zu meiden verbunden sei; und daß selbst der bürgerliche Staat hierin eine kirchliche Gesellschaft nicht beeinträchtigen dürfe, so lange sie in ihren angenommenen Grundsätzen nichts hat, was der Wohlfahrt des Staats entgegen wäre. Es wäre gegen alle Billigkeit, die kirchliche Gesellschaft darin zu behindern."
"Daraus folgt, daß
a. die Behauptung dieser Rechte unserer evangelischen Kirche und die sorgfältige Verhütung, daß die Grundlehren nicht angetastet werden, kein Verfolgungsgeist sei. Vielmehr würde es das sein, wenn man unsere Kirche hindern wollte diese ihre Rechte auszuüben, und wenn man insbesondere ihr Lehrer aufbürden wollte, die geradezu erklären, nach den symbolischen Büchern und den gemeinschaftlichen Grundsätzen sich nicht richten zu wollen, welche sie heruntermachen und die Verehrer derselben davon abführen wollten. Unsere Kirche erfährt heutzutage wirklich hin und wieder solche Bedrückung von Leuten, welche, wenn man sie Juden und Muhamedanern zufügte, laut schreien würden."
"b. daß diejenigen, welche die Kirche zu Administratoren ihrer Rechte und Wohlfahrt gesetzt hat, wider alle Pflicht und Gewissen handeln würden, wenn sie diese Rechte widriggesinnten Leuten preisgäben. Sind dieselben von dem Grundsystem ihrer Kirche nicht überzeugt und halten das Hauptsächliche für Bagatelle, so hinter=


|
Seite 215 |




|
gehen sie die Kirche und beleidigen sie, obwohl sie doch Vorsteher bleiben; sind sie aber von der Wahrheit ihrer Kirche überzeugt, so handeln sie gewissenlos."
"c. daß es nur dann Verfolgungsgeist wäre, wenn man entweder solche, welche man nach dem Rechte der Kirche nicht für Mitglieder erkennen könnte, auch im bürgerlichen Staate nicht leiden und sie mit bürgerlichen Strafen verfolgen wollte; oder wenn man solche, welche das Grundsystem aufrichtig annehmen, um einiger Nebendinge willen, welche non fundamentalia, bedrücken und ausstoßen wollte."
"Es kommt nicht darauf an, ob der Präpositus Hermes sich gegen irgend ein menschliches Gesetz vergangen, auch nicht, ob er civiliter klug oder thöricht gehandelt habe, sondern, ob seine Lehren und Betragen nach den göttlichen Kirchengesetzen so beschaffen sind, daß sie den Grundsätzen der evangelischen Kirche entsprechen; und ob wir unserer Pflicht genügen? Da ist es aber klar, daß die Lehre des Präpositus Hermes den Grund unserer Kirche antastet, daß er die Grundsätze unserer Kirche, ohne welche kein praktisches Christenthum und kein wahrer Weg zur Seligkeit möglich ist, gering schätzt, daß er den symbolischen Büchern Hohn spricht, daß er solche Hypothesen annimmt, welche den Umsturz nicht nur unserer evangelischen Kirche, sondern der ganzen christlichen Religion nach sich ziehen und die Bibel zu einem unnützen, verächtlichen Buche machen würden. Es ist keine Entschuldigung, daß er noch Christum als den Grund der Seligkeit gelten läßt; was er von der Versöhnung u. s. w. spricht, ist ein bloßes Spielwerk um die Begriffe herumzukommen; ebenso wenig entschuldigt ihn, daß er sein System für evangelisch ausgiebt, da es sich weit von dem evangelischen Grunde entfernt. Und wenn er kein Erzheuchler ist, so ist es unmöglich, daß er nicht auch auf der Kanzel der Gemeinde anstößig wird."
"Es ist ferner zu bedenken, daß die evangelische Kirche in Waren einen evangelischen Kirchenlehrer von Serentissimo verlangt hat, der ihr das Evangelium lauter und rein nach den Grundsätzen der Kirche predige; und sie hat das Recht, solches von Serenissimo zu verlangen. Ich bin unterthänigst versichert, daß Serenissimus diese Höchstdero Verpflichtung gegen Gott und die Kirche erlauchtest erkennen und fühlen und redlichst zu erfüllen bemüht sind; was mir auch durch das jüngste Rescript bestätigt scheint, wornach uns qua consistorium aufgegeben wird, daß wir sorgfältig in ceremonialibus et disciplinalibus die Rechte der mekl. Landeskirche wahren sollen. Ich bin überzeugt, daß, wenn wir nicht mit allen


|
Seite 216 |




|
Kräften den Irrlehren des Präpositus Hermes vorbeugen, wir uns nicht verantworten können, nicht vor Gott und unserm Gewissen, nicht vor dem ganzen meklenburgischen Lande, nicht vor der evangelischen Kirche überhaupt."
"Der Fiscal hat demnach nur gehandelt, wie er es schuldig war, und wir dürfen nicht eher an Serenissimum berichten, bis wir gethan haben, was uns zukommt vermöge unserer Instruction, und Alles von uns zur Definitiv=Erkenntniß reif gemacht ist. Was würde Serenissimus denken, wenn wir zuvor fragten, ob wir auch thun sollten, was zu thun wir schuldig sind? Meiner Meinung nach müssen wir dahin sehen, ob wir nicht unter göttlichem Segen diesen irrenden Mann zurechtweisen können; dazu scheint aber eine schriftliche Vertheidigung gar nicht zweckdienlich. Wir würden uns in einen weitläufigen Schriftwechsel einlassen müssen. Ist die mündliche Zurechtweisung vergeblich, so haben wir alsdann darauf anzutragen, daß mit reo nach dem evangelischen Kirchenrecht verfahren werde; man communicire also dem Präpositus die Fiscal=Eingabe und citire ihn, mündlich sich vor dem Consistorium zu erklären; in consistorio versuche man den Mann mit aller Sanftmuth von seinem Irrthum abzubringen; gelingt dies, so ist es erfreulich, wo nicht, so sende man das ganze Examen, welches sorgfältigst von Wort zu Wort protocollirt werden muß, unterthänigst an Serenissimum mit Beifügen unsers Erachtens und trage an, daß dem Consistorio erlaubt sein möge, das Definitiv=Urtheil von einigen unverdächtigen theologischen und juristischen Facultäten einzuholen.
C. A. Döderlein.
Sic voto, sic sentio!
Rostock, den 3. Juni 1773."
Diesem "gründlichen und gewissenhaften" Votum Döderleins trat Keßler "in allen Stücken und Worten" aus völliger Ueberzeugung bei. Fidler votirte: "Entweder er widerruft - oder er suche sich eine Gemeinde von Socinianern." Mauritii, "der valetudinarius", meinte auch, "das Consistorium dürfe diese Verbreitung der gröbsten Irrlehren zum Anstoß und Aerger aller Christen im Lande nicht leiden", wenngleich er zur Milde rieth; er kenne den Präpositus und wisse, daß er den Frieden wünsche. v. Hannecken erklärte, mit der Sache sich nicht weiter befassen zu wollen, der Herzog habe den Theologen die Erledigung aufgetragen, so möchten sie sehen, wie sie fertig würden.
Am 29. Juni erfolgte die Ladung, welche Hermes vorbereitet fand; er bat den Herzog, in Anbetracht, daß er einen ehrenvollen und


|
Seite 217 |




|
verlockenden Ruf in seine Heimath, als Prediger und Inspector nach Jerichau, bekommen habe, ihm bis zur Erledigung dieser Sache Aufschub zu gewähren. Als aber die Frist nur auf 3 Wochen bemessen wurde, bat er aufs Neue um gnädigen völligen Dispens, da er sich entschlossen habe, dem Rufe zu folgen. Unter solchen Verhältnissen erschien dem Herzog eine möglichst friedliche Endigung des Processes wünschenswerth, um so mehr, als Hermes nicht aus böser Lust oder Eitelkeit, sondern von seinem Gewissen in die Opposition gedrängt war. Er gab daher dem Rath Fidler den Auftrag, mit Hermes vertraulich zu reden, damit sich zeige, ob die Sistirung vor das Consistorium nothwendig bleibe. Aber Fidlers Ungeschick verdarb Alles; er scheute sich, mit Hermes in eine Disputation einzutreten, bei der er in seiner Unwissenheit der Unterliegende sein mußte. Er bat daher, "wegen der großen Verantwortung" ihm Döderlein zuzugesellen, obwohl dieser dringendst vorstellte, daß es ihm unmöglich sei, anders als nach seiner Instruction als Consistorialrath zu handeln. Aber Fidlers Bitte fand Gehör. Döderlein, an ein Nachgeben nicht gewöhnt, griff die Sache mit Eifer an und trieb bei dem Colloquium in Waren den Gegner so in die Enge, daß dieser bereits am zweiten Tage sich krank meldete und den Herzog um seine Entlassung bat.
Begreiflicher Weise war der Herzog über diesen Ausgang der Commission sehr unwillig und forderte Rechenschaft. Döderlein antwortete: "Wir haben einen Mann gefunden, der alles dasjenige, was ein Verbesserer der Religion haben sollte, gerade nicht hatte. Die Grundsätze einer gesunden Philosophie sind ihm unbekannt. Die Theologie besitzt er, ohne ein gewisses System zu haben, oder nur zu wissen, was ein eigentliches System ist. In der Hermeneutik und Exgese folgt er den Regeln, welche seinen Grundsätzen schmeicheln; er ist Polemiker, aber nur dann, wenn die Frage entsteht, ob ein Jeder im Lande von der Religion denken, reden und schreiben könne, was und wie er wolle. Die Kirchengeschichte hat er nie gelesen, sondern nur einige Auszüge aus Semlers Werken durchgeblättert. Wie viel wir in Liebe und Bescheidenheit mit ihm geredet, so haben wir doch keine einzige kategorische Antwort bekommen, sondern immer nur das alte Lied gehört: er könne sich nicht sogleich besinnen, aus dem Stegreif könne er das nicht beantworten. Da er also sah, daß er nicht einmal die ersten Seiten seiner Pièce vertheidigen konnte, ergriff er das Mittel, sich krank zu melden. Wir sahen also, daß keine Besserung von ihm zu erreichen war, und mußten gar auf den Gedanken kommen, daß nicht er selbst, sondern Andere die Ver=


|
Seite 218 |




|
fasser der von ihm herausgegebenen Schriften seien." Der Herzog mit dieser Rechtfertigung nicht zufrieden, forderte zugleich mit der Einsendung des Protocolls ein Erachten Fidlers über das Benehmen Döderleins: "ob es wahr sei, daß dieser, wie Hermes klage, aus jeder Periode der Streitschrift Gift gesaugt habe?" Der schlaue Fuchs, welcher sich gehütet hatte in das Colloquium einzugreifen, und daher auch wegen seiner "Mäßigung" das äußerste Lob von Hermes bekommen hatte, bezeugte bei seinem guten Gewissen, daß sein College dem Präpositus "keine einzige verfängliche Frage" vorgelegt, auch aller harten Anstichelungen und bittern Vorwürfe sich enthalten habe; im Uebrigen aber könne er nur unterschreiben, was Döderlein von dem theologischen Wissen des Angeklagten berichtet habe.
Bei solcher Lage der Dinge suchte der Herzog dem bösen Streite ein möglichst gutes Ende zu geben. Am Weihnachtstage 1773 gab er Hermes in folgendem Schreiben seine Entlassung:
. . . . . . "daß Wir Unser äußerstes Mißfallen über euer doppelt anstößiges Benehmen sowohl in Ansehung eurer durch den öffentlichen Druck eigenmächtig geäußerten, von dem Lehrbegriff unserer Kirche abweichenden Meinungen, als auch in Ansehung eurer Widersetzlichkeit gegen Verfügungen Unsers Consistoriums nicht unbezeugt lassen können noch wollen. Nur in Hinsicht eurer erhaltenen und angenommenen auswärtigen Vocation wollen Wir euch hiemit der sonst unausbleiblich erfolgten verdienten Beahndung bei weiterem rechtlichen Verfahren übersehen, und sollet auf euer unterthänigstes Ansuchen des bisher in Unserer Stadt Waren geführten Predigtamts hierdurch entlassen sein. Aus vordringender Gnade und bei dem von euch unterthänigst vorgestellten Umstande, daß die euch angetragene Pfarrstelle erst zu Ostern k. J. von euch angetreten werden kann, lassen wir es auch geschehen, daß ihr bei eurem bisherigen Amte und Genuß eurer Einkünfte in Waren verbleiben möget. Doch habet ihr die Kosten der verursachten Commission zu berichtigen."
Dies ist die actenmäßige Darstellung des Processes gegen Hermes, aus welcher jeder Unparteiische erkennen muß, daß in erster Reihe die Schuld des bösen Ausgangs an Fidler lag, dem eine Ausgleichung im Sinne des Herzogs leicht geworden wäre, wenn er gewollt hätte. Die Furcht vor Hermes ließ ihn aber das Zusammengehen mit Döderlein wünschen, welcher zu einer Versöhnung gewiß die ungeeignetste Mittelsperson war, besonders wo ein solcher Trotzkopf wie Hermes gegenüberstand. Konnte Döderlein


|
Seite 219 |




|
anders handeln? Das ist eine andere Frage, die Jeder beantworten mag, wie er will. Ich sage: nein!
Es ist bekannt, daß dieser Streit mit großer Erbitterung diesseits und jenseits, besonders von Berlin aus, weitergeführt wurde und am meisten das Geschrei der Freigeister über das dunkle Meklenburg wachrief; man wagte sogar, die Person des Herzogs in den Kampf hineinzuziehen. Als das Spotten und Zetern zu arg wurde, beauftragte der Herzog das Consistorium eine Gegenschrift auszuarbeiten, "bei der Darlegung und Widerlegung der Irrthümer in den Schriften des fr. Präpositus Hermes aber aller einem rechtschaffenen Geistlichen so anständigen als natürlichen Sanftmuth sich zu befleißigen und insbesondere aller Beleidigungen der Gegner und aller sectirerischen Schimpfnamen sich zu enthalten." Der ihm vom Consistorium gestellten Aufgabe unterzog sich Döderlein mit solchem Geschick, daß selbst die "Nicolaiten" ihr Anerkennen nicht versagten.
Ein weiteres Eingehen auf diesen Proceß lehne ich ab, die Druckschriften geben alle gewünschte Auskunft.
Für das Consistorium hatte aber diese Sache bedeutsame Folgen. Der Director v. Hannecken nämlich nahm seinen Abschied, und an seine Stelle trat der Professor jur. prim. Adolf Friedrich Reinhard von Bützow 1 ), ein Mann, welcher Döderlein nicht allein an Schärfe des Verstandes und Vielseitigkeit des Geistes überlegen war, sondern auch in der Gunst des Herzogs so fest stand, daß er Alles, was er wollte, durchsetzte. Seine entschiedene Hervorkehrung des Crusianischen Standpunktes gegenüber dem Hallischen Pietismus, welcher damals bereits kraftlos zu werden begann, war noch nicht Döderleins größter Aerger, sondern Reinhards gewaltsames, keine Opposition duldendes Wesen verhinderte geradezu jedes fruchtbare Zusammenwirken. Döderlein sah sich daher veranlaßt, als der Herzog im Jahre 1777 seinem Gegner Reinhard den Charakter eines beständigen Consistorialdirectors beilegte und dadurch vor dem ganzen Lande zu erkennen gab, daß er in der Wahl zwischen beiden jenem den Vorzug gäbe, sein Amt niederzulegen. Bis zum Jahre 1780 blieb Reinhard in seiner Stellung.
War schon Döderlein von den Geistlichen im Lande gefürchtet gewesen, so wurde Reinhard geradezu der Schrecken derselben; denn von ihm hatte Keiner, der mit dem Consistorium in Streit gerieth,


|
Seite 220 |




|
irgend welche Nachsicht zu erwarten. Daher war denn auch die Zeit, in welcher Reinhard das Consistorium nach seinem Willen lenkte, an hervorragenden Processen sehr arm; aber allein der kurzsichtige könnte daraus schließen, daß Alles in der Kirche so stand, wie es sollte. Mochte der Herzog auch die Zeit für gekommen halten, wo er mit den durchgreifendsten Reformen hervortreten dürfte, mochte er auch das harte Verfahren Reinhards billigen und jede Abweichung von der reinen Lehre auf das Härteste ahnden 1 ): dem scharfen Beobachter entging doch nicht die wachsende Gährung unter den Predigern und der zunehmende Unwille gegen ein Regiment, das jede freie Bewegung unterdrückte. Ja, wenn die Räthe im Consistorium selbst in Wandel und Lehre noch unsträflich gewesen wären! Aber daran fehlte viel. Die bittere Feindschaft der "Hallenser" und "Crusianer" war noch das Wenigste: was sollte das Land dazu sagen, daß von einem Mitglied des Consistoriums die gesammte Geistlichkeit öffentlich an den Pranger gestellt wurde? Mit unglaublicher Dreistigkeit hatte nämlich der hochmüthige Fidler in seinem antipapistischen Journal zur folgenden Charakteristik der meklenburgischen Geistlichkeit ohne allen Anlaß sich hinreißen lassen:
"Man kann Meklenburg in Ansehung der Gelehrten füglich in drei Classen eintheilen. Es giebt einige, die ihre ganze Gelehrsamkeit in eine gewisse altväterliche Methode setzen und steif und fest glauben, daß keine Predigt tauge, in der nicht die ganze Heilsordnung eben nach ihrer Methode enthalten ist. Solche Männer sind wohl gar so kühn und dreist, man möchte bald sagen: so dumm und einfältig, daß sie Alles für ketzerisch und teuflisch erklären, was auf eine gesunde, natürliche Philosophie gegründet und mit dem Worte Gottes befestigt und ergänzt wird. Erst ein Christ, dann ein Mensch (nein, nie ein Mensch, wollen sie sagen) - dies ist ihr Wahlspruch. Andere giebt es, die garnichts gelernt


|
Seite 221 |




|
haben und sich befriedigen, wenn sie ein Bischen ohne Empfindung aus dem Herzen beten können; solche Extemporanei treten auf die Kanzel, winseln und seufzen, ohne dabei gerührt zu sein oder Etwas zu denken, verdrehen die Augen, wiegen mit dem Körper und stellen sich an, daß einem angst und bange wird; und wenn Einer sich mit ihnen in die geringste Unterhaltung einläßt, um zu erfahren, was sie denn eigentlich gelernt haben, so nicken sie mit dem Kopfe und wissen weiter nichts zu sagen als: Ach Gott, Herr Amtsbruder! Der natürliche Mensch begreift nichts von dem, was vom Geiste Gottes ist; ich habe das, ach Gott! sehr oft in meiner Gemeinde erfahren! Und unter dieser Classe giebt es noch andere, die wirklich redlich denken und in Ansehung ihres praktischen Christenthums hoch zu schätzen sind, die aber lieber ein Handwerk als die Theologie hätten lernen sollen; denn sie sind gute Schafe, aber schlechte Hirten. Andere endlich giebt es, die wirklich etwas Gründliches gelernt haben, die nicht allein das praktische Christenthum predigen, sondern es auch schön predigen, die die rechte Sache der Bekehrung mit den Worten und die Worte mit den Sachen zu verbinden wissen, kurz, die sich in unsere böse Zeiten zu schicken wissen und das freigeistische Gift mit eben der Beredsamkeit aus dem Kopf zu bringen wissen, mit der es hineingekommen ist. Solche Männer machen unserm Meklenburg Ehre; aber es giebt nur wenige von dieser Classe, weil sie von dem großen Schwarm der Methodisten und Ungelehrten verachtet und für Teufelskinder ausgescholten werden."
Eine Erregung ohnegleichen entstand unter der geschmähten Geistlichkeit, um so mehr, als diese vom Consistorium, wie man meinte, ausgehende Charakterisirung den durch den Proceß gegen Hermes bereits geöffneten Spottmäulern ein neuer Beweis für die traurige Lage der pietistischen Kirche Meklenburgs war. Von allen Seiten wurde Fidler aufgefordert, seine Behauptungen zu beweisen oder zu widerrufen; er that aber keines von beiden, sondern rechtfertigte sich nur vor dem Herzog: "daß es nicht ohne Gottes Willen und Eingebung geschehen sei" (sic!). Um das Consistorium von dem Verdacht zu befreien, daß es mit Fidler einer Meinung sei, auch zugleich als Rächer der beleidigten Ehre der meklenburgischen Geistlichkeit, erhob sich Keßler und erklärte rundweg, Fidler sei außer Stande, auch nur einen einzigen von allen Vorwürfen zu beweisen; vielmehr müsse er (Keßler), genau bekannt mit dem Leben der Kirche, öffentlich bezeugen, daß das Land auf die Bildung und den Eifer seiner Geistlichkeit stolz sein dürfe.


|
Seite 222 |




|
Diese öffentliche Zurechtweisung nahm der Verläumder selbst zwar stillschweigend hin; aber er reizte einen Bekannten, den Pastor Wichmann zu Zwäzen und Löbstedt in Obersachsen, auf, in einem anonymen Sendschreiben Keßler zu verdächtigen, daß er nur deswegen gegen Fidler aufgetreten sei, weil er sich getroffen gefühlt habe; "denn wer Meklenburg kennte, wüßte, daß dieser der Führer der von Fidler so treffend als "Methodisten" bezeichneten Secte sei, die das reine Evangelium von den Kanzeln verdränge und dafür ein herz=, geist= und trostloses Gewäsch von Buße, Durchbruch und Bekehrung, von Teufeln und Teufelswerken einführe."
Der Streit, Anfangs mit großer Hitze von beiden Seiten geführt, verstummte sofort, als ein Landsmann dem verkappten Ritter die Lanze zerbrach, indem er zeigte, daß der Verfasser des Sendschreibens an Keßler kein Anderer als der berüchtigte Wichmann, der Urheber der "Bibliothek der elenden Scribenten", sei. Der Freund war Fidlers würdig.
Man ist indessen versucht, in dem Angriffe mehr zu sehen als eine bloße Unverschämtheit des verruchten Proselyten: er muß, meine ich, gewußt haben, daß der Anlauf gegen den herrschenden Pietismus, der sich als unfähig das innere Leben der Gemeinden zu erneuern erwiesen hatte, ihm nicht zu großem Schaden gereichen werde; es ist das erste Zeichen der hereinbrechenden neuen Aera, wo der Pietismus, soweit er nicht in seiner breiten Masse zum Rationalismus sich bekannte, überschwenkend in Crusius' Lehre, einen neuen Halt sucht und findet. Die Todten begräbt man aber schnell. Reinhards Sieg über Döderlein (1777) bezeichnete den Sieg Leipzigs über Halle.
Der Stern Fidlers neigte sich zum Untergange. Im Jahre 1774 hatte er das letzte Ziel seiner Wünsche erreicht, er war Superintendent mit dem Wohnsitz in Doberan geworden. Das lasterhafte Leben, welches er hier führte, schrie zum Himmel. Dazu zeigten verschiedene Untersuchungen, welche er im Auftrage des Consistoriums gegen Prediger führte, seine gänzliche Unfähigleit. So behandelte ihn der Pastor Hacker in Westenbrügge wie einen Schulbuben, so daß Reinhard nach Durchlesung der Acten urtheilte: "Der Herr Rath solle doch bei dem Pastor in die Lehre gehen." - Ein ander Mal ließ er einen "Catechismus" die Censur passiren, der förmlich von Irrlehren strotzte. Mehr Noth aber verursachte Fidler die Aufbringung der Gelder zur Bestreitung seiner "lustigen Wirthschaft". Die Schulden wuchsen trotz der unterschlagenen Collectengelder und des angetasteten Vermögens vieler Kirchen ins Ungeheure. Der Versuch, seinen Ruf durch ein


|
Seite 223 |




|
neues Werk: "Die Geschichte der Ceremonien in der römischen Kirche", 1777 wieder herzustellen, schlug gänzlich fehl; die Kritik nannte es einen wahren Skandal für die meklenburgische Gelehrtenwelt, und der Witz der Rostocker: "dat Book van dei Kattenjagd".
Am 22. Januar 1778 floh Fidler, wegen betrügerischen Bankerotts, wegen Unterschlagung von Kirchengeldern, wegen Ausstellung eines falschen Todtenscheins angeklagt, aus Meklenburg; er konnte sich, wie er selbst schrieb, "weder vor Gott, noch Hzgl. Durchlaucht, noch vor der Welt rechtfertigen." 1 )
Die von der Justiz=Kanzlei eingeleitete Untersuchung gegen den Bösewicht wurde zwar auf landesherrlichen Befehl sistirt; aber die Menge dessen, was landeskundig, war groß genug, um die Erbitterung gegen das herrschende Kirchensystem so zu steigern, daß der Herzog, um dem lauten Geschrei ein Ende zu machen, sich zuletzt entschloß, Reinhard zu opfern. Denn es half diesem Manne nichts, daß er alle Schuld daran von sich abwies, daß er öffentlich erklärte, den bösen Ausgang vorhergesehen und deshalb bereits in den letzten Jahren Fidler möglichst von allen wichtigeren Verchandlungen ausgeschlossen zu haben: die Pietisten sagten, so etwas sei unter Döderleins Leitung ganz unmöglich gewesen, und nur die Secte der Crusianer könne solche Ausgeburten der Hölle erzeugen. Die Katholiken triumphirten laut, daß ihr Todfeind seinen gerechten Richter gefunden hatte; das lauteste Geschrei aber erhoben Hemes' Freunde, welche das Gedächtniß an den "famosen" Proceß erneuerten und darauf hinwiesen, daß dieser jetzt zum Schelm gewordene Erzheuchler als Richter das Condemno über einen so hochachtbaren, in der ganzen protestantischen Kirche angesehenen Mann wie Hermes ausgesprochen habe. Es konnte nicht anders sein: im Publicum mußten diese Stimmen Recht behalten. Bei solcher Lage der Dinge wäre es vielleicht besser gewesen, wenn der Herzog dem Proceß gegen Fidler seinen Gang gelassen hätte; denn dabei würde klar geworden sein, wie viel oder wie wenig Schuld auf Reinhard und die andern Mitglieder des Consistoriums mit


|
Seite 224 |




|
Recht geworfen werden konnte; indem aber, in der lautern Absicht, den Skandal der Kirche möglichst zu unterdrücken, das Verfahren eingestellt und alle Acten und Privatpapiere Fidlers confiscirt wurden, erwachte nothwendig der Verdacht, daß die Enthüllungen auch Andere, besonders aber Reinhard, compromittirt hätten. Da das Geschrei nicht verstummte, und man immer offener den verhaßten Reinhard als Einen, der auch zu der infalliblen und incorrigiblen Rotte der Crusianer gehörte, für allen Skandal verantwortlich zu machen anfing, bat dieser um des Heiles der Kirche willen um seinen Abschied. Der Herzog aber, der den gewandten und verdienstvollen Mann nicht fallen lassen wollte, gab ihm den ehrenvollen Auftrag, auf ein Jahr in Wetzlar als Assessor beim Reichskammergericht zu fungiren, in der Hoffnung, daß inzwischen sich der Sturm legen würde. Als jedoch nach Reinhards Rückkehr klar wurde, daß dies nicht der Fall war, enthob er unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken denselben seines Amtes und ernannte ihn zu seinem beständigen Assessor in Wetzlar (1780). Mit Reinhard fiel die letzte Stütze der Orthodoxie im Consistorium. Denn von denen, welche darin verblieben, war kein Einziger fähig, seine Stelle zu vertreten: der Jurist Dr. Friedlieb (1773 berufen) besaß weder die erforderliche Schneide, noch auch als Döderleins Schwiegersohn das erforderliche Vertrauen; der Superintendent Keßler hatte sich mit seinem Pietismus überlebt, der Professor Mauritii war ein kranker Mann, und endlich der auf Reinhards Vorschlag mit der Leitung der Sachen betraute bisherige Fiscal Weinland war in mehr als einer Hinsicht ein verdächtiger Charakter. Der neuernannte Fiscal Dr. jur. Sprewitz ließ daher Alles gehen, wie es wollte. Um diesem Unwesen zu steuern, wurde 1782 Döderlein aufs Neue mit der Leitung des Consistoriums betraut. Aber zugleich mit ihm trat an Stelle des aus Meklenburg fortziehenden Raths Weinland der Professor jur. Prehn aus Bützow ein, der sich darin gefiel, die Rolle seines Freundes Reinhard zu spielen und alle wohlgemeinten Vorschläge Döderleins zu vereiteln. In diesem Unfrieden ging dem Consistorium die letzte Kraft energischen Handelns verloren. Der Herzog ließ es an Vorstellungen, daß nur ein einmüthiges Zusammenwirken das bedrohte Ansehen des Consistoriums wieder zu Ehren bringen könnte, nicht fehlen, griff auch selbst wohl, wenn aus dem schleppenden Verfahren Gefahren erwuchsen, energisch ein, aber auch sein Vertrauen war so sehr erschüttert, daß er sein Erkenntniß dieser Behörde mehr rechtskräftig werden ließ, bevor nicht die Acten zu seiner persönlichen Einsicht vorgelegen hatten. Es kam in diesen letzten


|
Seite 225 |




|
Jahren sogar wiederholt vor, daß der Herzog, da die Processe "in consistorio doch nur unnütz verschleppt würden und nur als Mittel zu höchst verwerflichen unchristlichen Reibereien unter den Räthen dienten", mit Uebergehung des Consistoriums über die Prediger, die sich in Wandel oder Lehre Etwas zu Schulden kommen ließen, sofort Suspension vom Amte verfügte; denn er wollte zeigen, daß er noch das Regiment habe und nicht gewillt sei, Ausschweifungen seiner Prediger zu dulden.
Im Jahre 1785, kurz vor dem Tode des Herzogs, nahm Döderlein abermals seinen Abschied; denn der an die Stelle von Dr. Sprewitz berufene Fiscal Dr. Ditmar hatte ihm zu laxe Principien. "Wenn man in der Kirche Alles vertusche, anstatt dem Hzgl. Befehl zufolge ohne Ansehen der Person Alles, was nicht recht sei, zu rügen, so sei das unchristlich; und er könne und wolle in einem Consistorium nicht mehr Sitz und Stimme haben, welches bei den Predigern in so geringem Ansehen stehe, daß sie sich schon als über ein Unrecht beschwerten, wenn sie citirt würden, um sich von einem Verdachte zu reinigen."
Die Saat war reif. Der neue Geist des Rationalismus brach durch. Lange gewaltsam unterdrückt, konnte die Umwälzung auch keine andere als eine gewaltsame sein.
Der Rationalismus hat Recht, wenn er von seinem Standpunkte aus den Herzog Friedrich der Intoleranz beschuldigt; indessen auch nur von diesem Standpunkte aus hat diese Anklage ihre Berechtigung. Im Allgemeinen war der fromme Fürst, wie wir das nachher beweisen werden, im besten Sinne des Wortes duldsam im höchsten Maße, indem er jeden Glauben, bei dem die wahre Gottesfurcht bestehen konnte, ehrte und schützte; verhaßt war ihm allein jenes "wüste" Verneinen der letzten Grundwahrheiten, womit sich damals die Gottesgelehrten und Unbekehrten breit machten. Und darin hatte er Recht; denn die Gottesfurcht ist die Stütze des Staates; wo sie schwindet, wanken die Throne und herrschen die Leidenschaften. Und um so größeren Lobes werth erscheint diese Energie des frommen Fürsten, als, wie gesagt, ringsum höchst gefährliche Grundsätze das politische Leben des deutschen Volkes zu leiten begannen. Inmitten der großen Bewegung, welche, Fürsten und Völker ergreifend, eine Umwälzung aller Verhältnisse hervorrief, stand der Herzog Friedrich fest in dem Entschluß, sein Land und Volk vor der Revolution zu bewahren und in dem Worte Gottes gegen alle Verführungen stark zu machen. Daß es ihm nicht gelang, war nicht seine Schuld: der


|
Seite 226 |




|
Geist der Zeit ist mächtiger als Fürstenwille; aber so Großes gewollt zu haben, bleibt des Herzogs ewiger Ruhm.
Und wenn man den Namen des edlen Herzogs nennt, darf man den Namen Döderleins, des treuesten Dieners seines Herrn, nicht vergessen. Wir müssen noch einen Augenblick bei ihm verweilen; denn wir würden ihm Unrecht thun, wenn wir seine übrigen Consistorialarbeiten, die uns seine Pläne und Gedanken zeigen, unerwähnt ließen. In den Archivacten findet sich nämlich noch eine Reihe von merkwürdigen Entwürfen. Da ist zunächst vom Jahre 1774 ein im allerh. Auftrage ausgearbeiteter Entwurf zu einer neuen Kirchen=Ordnung, der wegen der Schwierigkeiten, die sich entgegenstellten, unbeachtet gelassen wurde. Wenn es nach Döderleins Sinne gegangen wäre, so würde eine, wenn auch unter möglichster Schonung der bestehenden Verhältnisse, doch radicale Aufräumung mit den vielen Uebelständen vorgenommen worden sein; aber sein heftiger und wenig praktischer Geist, dessen Ideal es war, alle Gewalt über die Kirche dem Fürsten anzuvertrauen, verkannte die damit verbundenen Gefahren für die Kirche und die Unmöglichkeit, ohne grobe Verletzung des Rechts die einmal vorhandenen politischen Verhältnisse in Meklenburg, von denen doch die kirchlichen abhingen, zu Gunsten eines fürstlichen Absolutismus zu ändern. Darum ging der Herzog, dem ein solcher Rechtsbruch wider das Gewissen war, auf die Vorschläge Döderleins nicht weiter ein: er wollte lieber auf dem hergebrachten Wege der Verhandlungen mit den Ständen nach und nach zu bessern suchen, was nöthig war, und erlangte dadurch auch mehr, als einem seiner Vorgänger eingeräumt war. - Eine zweite Arbeit ist überschrieben: "Von der Nothwendigkeit eines Examens der Candidaten vor dem Consistorium." Nach der alten Ordnung fand nämlich das Tentamen der Candidaten vor einem Superintendenten statt, welcher auch die licentia conciodandi ertheilte. Dieses Zeugniß konnte jeder Superintendent ausstellen. Das zweite dagegen, das examen rigorosum, lag bei dem Superintendenten (nebst Zuziehung einiger clerici) desjenigen Kreises, in welchem der Candidat präsentirt worden war. Ohne ein solches Zeugniß sollte Keiner, auch wenn er auswärts schon Prediger gewesen war, angestellt werden. Diese Ordnung war im Allgemeinen in Geltung geblieben. Döderlein wünschte eine Aenderung dahin, daß das erste Examen vor dem Superintendenten bestehen bliebe, das zweite aber dem Consistorium übertragen würde, "damit der Unwissenheit der meisten zum Predigeramte tretenden Candidaten ein gründliches Ende bereitet werde." Er wollte, daß die Candidaten einer scharfen Prüfung a. in der


|
Seite 227 |




|
Kenntniß der biblischen Grundsprachen, b. in der Exegese, c. in der Kirchengeschichte, d. in der Dogmatik und Moral unterworfen würden; denn auch in anderen evangelischen Ländern hätten sich die guten Früchte eines solchen Examens, namentlich hinsichtlich des anständigen Lebenswandels der Theologen auf der Universität und in ihrem Candidaten =Amte, gezeigt. Das Schicksal dieses Vorschlages ist mir unbekannt. In Zusammenhang damit mag die VO. vom 27. Sept. 1776 stehen, wornach "kein Prediger im Lande angestellt werden solle, der nicht gehörig tentirt worden sei."
Ueber eine dritte Arbeit, betreffend die Einsetzung von Special=Superintendenten, werden wir bald Weiteres hören. Ueberhaupt aber müssen wir bei unserer ganzen Betrachtung immer lebendig im Bewußtsein behalten, daß der Herzog bei Allem, was er zur Verbesserung des Kirchenwesens unternahm, nie des Rathes und der Unterstützung Döderleins entbehren mochte. Auch in den Jahren von 1777 - 1782, wo Döderlein nicht im Consistorium war, fand ein unausgesetzter Verkehr zwischen dem Fürsten und seinem Rathe statt; und wenn nach dem Tode des Herzogs die Reaction den überlebenden Döderlein für Alles verantwortlich machte und ihn ihren ganzen Haß fühlen ließ, so hatte sie ein volles Recht dazu: nicht moralisch, denn Döderlein stand in der Reinheit seines Gewissens und in dem Bewußtsein, nur das Beste gewollt zu haben, hoch über seinen Gegnern erhaben, sondern factisch. Sollte Einer das Regiment des Pietismus entgelten, so war in ihm der Rechte getroffen.
III. Die Superintendenten.
Der Superintendentur=Ordnung gemäß umfaßte das Herzogthum Meklenburg die sechs Kreise: 1) Superintendentur Meklenburg (Wismar), 2) Sup. Wenden, östlicher Kreis (Güstrow), 3) Sup. Wenden, westlicher Kreis (Parchim), 4) Sup. Schwerin (Schwerin), 5) Sup. Rostock (Rostock), 6) Sup. Stargard (Neubrandenburg). Der letzte strelitzsche District geht uns hier nicht weiter an.
Diese ursprünglich politische Eintheilung war im Großen und Ganzen von Bestand geblieben, wenn auch innerhalb der einzelnen Districte die mannigfachsten Verschiebungen hinsichtlich der Parochien stattgefunden hatten, und besonders auch die unpraktische Eintheilung derselben nach Aemtern und Städten fallen gelassen war. Der größte Uebelstand war die Ungleichheit der einzelnen Districte. Als


|
Seite 228 |




|
der Herzog Friedrich 1756 die Herrschaft antrat, umfaßte die Rostocker Superintendentur 50 Kirchen und 27 Filialen,
die Schweriner 16 Kirchen und 11 Filialen,
die Güstrower 86 Kirchen und 80 Filialen,
die Parchimer 82 Kirchen und 70 Filiaen,
die Meklenburgische 65 Kirchen und 17 Filialen.
Ebenso ungleich war das mit den Stellen verbundene baare Einkommen: bei der Rostocker trug es etwa 200 Thlr., bei der Schweriner 400 Thlr., der Güstrower 650 Thlr., der Parchimer 400 Thlr. der Meklenburger 550 Thlr.
Diese Ungerechtigkeit wollte der Herzog zunächst beseitigen, indem ohne jede Rücksicht auf die doch ganz veraltete und bedeutungslose historische Eintheilung des Landes nur 3 Superintendenturen, jede mit etwa 100 Kirchen nnd mit gleichem baarem Einkommen, von Bestand bleiben sollten: 1) die Güstrower, 2) die Schweriner, 3) die Parchimer.
Aber in den ersten zehn Jahren blieb dieser, wenngleich viel bearbeitete Plan in Folge der Kriegswirren unausgeführt; erst 1767 wurde mit der Sache Ernst gemacht, indem die Rostocker Superintendentur mit der Güstrower, die Meklenburgische 1768 mit der Schweriner vereinigt wurde. Es zeigte sich aber bald, daß, abgesehen von den Schwierigkeiten, die sich der neuen Vertheilung der Sprengel entgegenstellten, die Arbeitslast für nur drei Superintendenten zu groß war. 1774 wurde die Superintendentur Doberan von Güstrow abgetrennt und 1775 in Sternberg eine neue Superintendentur für Meklenburg eingerichtet. Nachdem die Doberaner Superintendentur 1779 wieder eingegangen war, blieben die Geschäfte derselben unter die drei andern vertheilt. 1 )
Demgemäß war die Eintheilung des Landes seit 1779 folgende:
1) Die Güstrower Superintendentur umfaßte die Präposituren Plau, Lüssow, Teterow, Goldberg, Penzlin, Röbel, Malchin;
2) die Parchimer: Neustadt, Wittenburg, Waren, Lübz, Hagenow, Grabow, Crivitz;
3) die Schweriner: Meklenburg, Lübow, Doberan, Bützow;
4) die Sternberger: Schwan, Ribnitz, Gnoien, Bukow, Rehna, Neukalen, Grevesmühlen, Boizenburg.


|
Seite 229 |




|
Die beabsichtigte Aufhebung der Ungleichheit war also nur zum Theil ausgeführt.
Die Geschäfte der meklenburgischen Superintendenten waren sehr weitgehend: sie hatten das Leben und die Lehre der einzelnen Prediger genau zu überwachen, die Candidaten zu prüfen, zu präsentiren, zu ordiniren und zu introduciren. die Kirchenökonomen zu beaufsichtigen, die Kirchenvorsteher zu beeidigen, in den lateinischen Schulen das Scholarchat zu üben, die Küster, Organisten und Schulmeister zu prüfen u. a. m. Tüchtige Superintendenten zu haben, auf die er sich verlassen konnte, die neben der erforderlichen Energie auch sanfte, die Herzen ziehende Liebe zeigten, - das war das vorzüglichste Augenmerk des Herzogs. Dabei aber ging er von der allerdings verkehrten Ansicht aus, daß Nicht=Meklenburger, weil sie durch keine andere Beziehungen gebunden noch gehindert würden, zur Verwaltung eines so verantwortungsvollen Amts vorzuziehen seien; und da er bei seiner Großtante, der Horzogin Augusta in Dargun, den Eifer der fremden Prediger kennen gelernt hatte, so war es nur natürlich, daß Pietisten die Stellen bekamen.
Unter den Superintendenten war der einflußreichste ohne Zweifel der am 28. August 1756 nach Parchim berufene Karl Heinrich Zachariä, von dessen Thätigkeit in Dargun Wilhelmi ein so fesselndes Bild entworfen hat. (S. Jahrb. XLVIII, S. 141 f.) Von ganzer Seele dem Pietismus zugethan, hatte sich Zachariä doch bereits in Dargun nicht allein als den entschiedensten Gegner aller Ausschweifungen in der Lehre, sondern auch als praktischen Mann bewiesen. Bei seiner Berufung nach Parchim war er sich der neuen Pflicht in der neuen Stellung voll bewußt. "Ich werde", schrieb er am 6. September an den Herzog, "dahin gehen, wohin mein Heiland mich ruft; er hat mir ein erbarmendes Herz gegen die armen Sünder gegeben; die armen Sünder will ich nicht aufhören mit Bitten und Flehen zu ihrem großen und freundlichen Erlöser zu locken. Die Liebe ist geduldig und langmüthig: so werde ich mich mit dem Evangelium durchzudrücken suchen. Mein theurer Immanuel, den ich bisher treu, weise, mächtig erfunden, wird mit mir sein und mich gewiß zum Segen setzen. Er hat bisher mein armes Gebet in allen Stücken gnädig erhöret und mein Vertrauen auf seine Verheißungen nicht vergeblich sein lassen."
Also nicht durch heftigen Bekehrungseifer, der den Pietismus den Predigern und Gemeinden bisher anstößig gemacht hatte sondern durch Liebe wollte er die Seelen locken. Und in der That,


|
Seite 230 |




|
die unermüdete Thätigkeit, die mit Milde verbundene stramme Zucht machte ihn zum beliebtesten Vorgesetzten. Wie große Achtung er sich erworben hatte, zeigte der 10. November 1776, als er sein 50jähriges Amtsjubiläum feierte. Von allen Seiten wurden ihm die Beweise innigster Verehrung zu Theil. Den ganzen Mann aber zeigt sein Verhältniß zum Herzog, dem er oft mit seltenem Freimuthe begegnete, wenn falscher Eifer das Heil der Kirche zu bedrohen schien. Die Gefahr der Ungnade schreckte ihn nicht; denn Unrecht leiden schien ihm besser als Unrecht thun. An Spannungen fehlte es daher nicht; aber der Herzog erkannte zuletzt doch immer, daß Zachariä Recht hatte, und nur brennende Liebe ihn in Allem leitete. Zachariä starb am 21. October 1782. Sein letzter Wunsch war gewesen, den durch Amtstreue und Frömmigkeit ausgezeichneten Hofprediger zu Ludwigslust Georg Gottlieb Beyer als Nachfolger zu erhalten. Sein Wunsch ging 1784 in Erfüllung trotz der Intrigue des Superintendenten Martini. Da der Herzog Beyer an seinem Hofe behalten wollte, bekam derselbe seinen Wohnsitz zunächst in Ludwigslust.
In Schwerin war 1756 Superintendent Karl Witsche, der Sohn des ehemaligen Beichtvaters der Herzogin Augusta in Güstrow. Wie der Vater, so stand auch der Sohn zu den Halleschen Pietisten in enger Beziehung, ohne aber, so weit ich sehe, mit den Dargunern gemeinsame Sache zu machen. Da er beim Regierungsantritt des Herzogs schon hochbetagt war, wurde ihm Menckel als Adjunct beigegeben, der 1757 sein Nachfolger wurde.
Johann Christian Menckel, am 2. November 1702 zu Bromskirchen in Hessen=Darmstadt geboren, Sohn eines pietistischen Predigers, hatte seit 1721 in Halle studirt und darnach von 1725 bis 1729 in Rußland als Prediger gewirkt. Auf Callenbergs Empfehlung hatte ihn der Herzog Karl Leopold bei seinem Hofstaat in Danzig angenommen und im Mai 1730 als Hofprediger an der Schloßkirche zu Schwerin angestellt. Als ihn später 1735 der Herzog von hier fort nach Wismar zu sich beschieden hatte, war er nicht gefolgt, da sein Gewissen ihm verbot, die Gemeinde zu verlassen; aber daß er sich trotz der schlimmsten Drohungen seines Herrn unter den Schutz des Administrators Christian Ludwig stellte, konnten ihm der Herzog Karl Leopold und die Schweriner nie verzeihen.
Im November 1756 machte der Herzog Friedrich ihn zum ersten Prediger der Domgemeinde zu Schwerin, gleichzeitig auch zum Adjuncten Witsches und zum Superintendenten des Stifts Schwerin. Im folgenden Jahre wurde er Witsches Nachfolger,


|
Seite 231 |




|
Obgleich Menckel nach dem Zeugniß seiner Zeit ein tüchtiger Prediger war, "bemüht das Bild des Satans in den Seelen der Sünder zu zerstören und dagegen das Bild Jesu, des Heilandes, aufzurichten, unermüdlich, die Unwissenden zu belehren, die Gottlosen zu strafen, die Mühseligen und Beladenen zu dem offenen Born der Wunden Christi zu locken", - so hatte er doch keinen Dank davon: die Gemeinde konnte ihm seinen vermeintlichen Treubruch nicht verzeihen. Dazu lebte er in beständigen Reibungen, besonders mit den Lehrern an der Domschule, und sein Amtsbruder Martini trug auch nicht dazu bei, die Bürde des Amts ihm zu erleichtern. Als Superintendent bewies er sich trotz dem Herzog, der bei allem sonstigen Wohlwollen den Feuereifer an ihm vermißte, als tüchtigen Hirten; mild geworden durchs Alter, war er eifrig im Dienste der Kirche, ohne Hitze. Im Jahre 1768 wurde ihm auch die Meklenburgische Superintendentur ad interim anvertraut, die er bis 1774 verwaltete. Bei der Abnahme dieser dem Greise zu großen Bürde verlieh die Herzogliche Gnade "dem treuen Diener" den Titel eines Consistorialraths. Im folgenden Jahre, am 2. Juli 1775, feierte Menckel noch sein 50jähriges Amtsjubiläum; wenige Tage darauf, am 16. Juli, starb er. Sein Leben war Mühe und Arbeit gewesen. Sein Nachfolger im Amte ward Friedrich Heinrich Martini, ein Mann von bedeutenden Fähigkeiten, aber von schwachem Charakter. Er war der Sohn eines Predigers, am 16. August 1727 zu Marnitz geboren. Als Student hatte er sich in Rostock als Orthodoxer hervorgethan, war dann in das Lager der Pietisten übergegangen und wegen seines Eifers 1756 Hofdiakonus und 1758 Hofprediger in Schwerin geworden. Obwohl das glatte Wesen des Mannes dem Herzog wenig gefiel, war er doch nicht ohne mächtigen Einfluß, da er, wo der gerade Weg verschlossen war, auch Umwege und krumme Wege zu gehen sich nicht scheute und bei Allen, die in der Umgebung des Herzogs waren oder sonst bei Hof etwas galten, sich einzuschmeicheln verstand. Der Herzog durchschaute auch das Wesen des Mannes und wollte ihn deshalb nach Menckels Tode nicht zum Superintendenten machen, sondern wandte sich an den Consistorialrath Struensee in Rendsburg mit der Bitte, ihm einen tüchtigen und bewährten Mann zu empfehlen. Indessen Martini wußte diesen Plan zu vereiteln; seine guten Freunde stellten es als eine "unverdiente Kränkung des verdienten Mannes" dar, und so wurde denn Martini am 18. September 1776 zum Superintendenten ernannt. Im Jahre 1782 wünschte er Zachariäs Nachfolger mit dem Wohnsitz


|
Seite 232 |




|
in Ludwigslust zu werden; aber der Herzog ließ sich nicht darauf ein, wenngleich er die abschlägige Antwort dem Hochstrebenden durch den Titel eines Consistorialraths versüßte.
Ich bin weit entfernt, Martini einen Heuchler zu nennen, wenn auch seine abermalige rasche Schwenkung zum Rationalismus noch bei Lebzeiten des Herzogs Friedrich diesen Verdacht bestärken könnte; aber er gehört zu jenen Strebern, deren nimmer befriedigter Ehrgeiz vor der Welt den wahren innern Kern so leicht verbirgt. Und das muß auch der Neid Martini lassen, daß er bei seiner Bewerbung um die Superintendentur nicht nach einem Amte gestrebt hatte das er nicht völlig zu bekleiden fähig gewesen wäre. In allen Geschäften erwies er sich als brauchbar, und sein kluger Geist bewahrte ihn vor Mißgriffen. Nur das tadele ich, daß er oft nicht den Muth hatte, wo es sein Amt forderte, gerade vorzugehen; was Zachariäs größte Stärke war, war Martinis größte Schwäche: er war kein fester Charakter.
In Güstrow war 1756 Bernhard Heinrich Rönnberg Superintendent. Bei der feindlichen Stellung, welche das dortige geistliche Ministerium stets den Pietisten gegenüber einnahm, mußte dem Herzog daran liegen, nach Rönnbergs Tode einen ganz energischen Mann an seine Stelle zu setzen. So wurde 1763 Johann Christian Keßler berufen. Er war am 15. October 1728 zu Freiburg in Thüringen geboren und hatte als Prediger in Magdeburg dem Kreise der gemäßigten Pietisten angehörte. In den ersten Jahren seines Wirkens in Güstrow hatte Keßler viel von den Orthodoxen zu leiden und erfreute sich auch bei den Predigern wegen der Hervorkehrung des Pietismus und Begünstigung der "Bekehrten" keiner besonderen Liebe. Aber seine Treue im Amte und die Reinheit seines Herzens gewannen ihm allmählich die allgemeine Achtung, und seit 1773, wo er die meklenburgische Geistlichkeit gegen Fidler so brav vertheidigt hatte, besaß er die größte Verehrung. Nach gesegnetem Wirken starb er im Jahre 1785.
Von dem wahren Ausbund der Verlogenheit und Tücke Ferdinand Ambrosius Fidler ist oben ausführlich gehandelt worden. Die ihm 1774 verliehene Superintendentur umfaßte die Präposituren: Doberan, Neubukow, Lübow, Meklenburg, Gnoien, Ribnitz, Schwan. Als Fidlers Nachfolger wurde 1778 der Präpositus Glöckler aus Boizenburg berufen, der sich dem Herzog besonders durch eine Schrift über die Synoden in Würtemberg und ihre Geschichte empfohlen hatte. Leider starb der treffliche Mann bereits im nächsten Jahre am Herzschlag. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt.


|
Seite 233 |




|
Zuletzt haben wir noch von dem Sternberger Superintendenten Johann Gottlieb Friederich zu handeln. Er war 1770 von Parchim als zweiter Hofprediger mit der Anwartschaft auf die nächst=erledigte Superintendentur nach Ludwigslust berufen worden. Indessen seine am Sonntag Sexagesimä gehaltene Antrittspredigt, in welcher er sich als pietistischer Heißsporn bewies, zeigte, daß er als Hofprediger nicht zu gebrauchen war; hatte er es doch gewagt, über eine Cabale am Hofe wider ihn und seine pietistischen Glaubensgenossen - von der Kanzel herab seine Bemerkungen zu machen! So wurde ihm am 8. April 1774, bevor noch Menckel gestorben war, die Meklenburgische Superintendentur mit dem Wohnsitz in dem Landstädtchen Sternberg angewiesen, was einer Verbannung gleichbedeutend war. Auch in Sternberg gab seine Amtsführung zu mancherlei Klagen Anlaß; namentlich wich er oft von dem hergebrachten Cultus ab und beschwerte unnütz die Gewissen seiner Gemeinde. Es fehlt mir indessen das nöthige Actenmaterial, um zu einem abschließenden Urtheil mich berechtigt zu halten; für ganz unverdächtig kann ich ihn aber nicht halten, da er Fidlers bester Freund war, und dessen hinterlassene Papiere ergaben, daß er aus dem Fortgang des Processes schwerlich ganz gereinigt herausgekommen wäre. Doch dies nur nebenbei!
Die Amtsführung der Superintendenten war bei der Strenge des Herzogs nichts weniger als leicht; denn derselbe forderte, daß "seine Superintendenten" in der Treue der Arbeit gesegnete Vorbilder der gesammten ihnen untergebenen Geistlichkeit seien, und genug konnte ihm darin nicht leicht einer thun, vielmehr spornte er zu immer größerem Eifer im Amte an. Die Klagen wegen zu vieler Geschäfte nahmen daher kein Ende; bei dem besten Willen und dem größten Eifer mußte Vieles unerledigt bleiben. Bei dem Herzog fanden die Vorstellungen aber so wenig Ohr, daß er, wie wir sahen, im Jahre 1767 drei Männern zu verwalten übertrug, was fünf nicht hatten verwalten können. Drei Superintendenten für das ganze Land, und dabei schien es bleiben zu sollen! Aber dem ehrgeizigen Fidler, der 1774 mit der Verwaltung der kleinen Doberaner Superintendentur ad interim betraut wurde, war auch die geringe neue Arbeit eine Last die er nicht tragen wollte. Schlau, wie er war, hatte er bald das Richtige herausgefunden. Er stellte dem Herzog vor: es sei nöthig, um den Landes=Superintendenten die unerträgliche Last zu erleichtern, ihnen Gehilfen zu geben; solche Seniores oder Inspectores seien auch in der Präpositur=Ordnung zu finden. Er wußte dies dem Herzog so verlockend darzustellen, daß dieser den Gedanken begierig ergriff und sofort Dö=


|
Seite 234 |




|
derlein zum Bericht aufforderte, ob Bedenken entgegenstünden. Das Pro memoria Döderleins ist zu interessant, um übergangen zu werden. Datirt ist es vom 2. April 1774.
1) Da die kirchenordnungsmäßige Aufsicht über die Geistlichen und Gemeinden wegen der Weitläufigkeit der Diöcesen von den Superintendenten nicht gehörig besorgt werden kann, so vernothwendigt sich die Einsetzung von Special=Superintendenten, welche unter dem Consistorium und den Landes=Superintendenten stehen.
2) Ihr Amt ist: die lebendige Erkenntniß Jesu Christi und das wahre, thätige Christenthum zu fördern und Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten, weswegen sie besonders Acht zu geben haben, ob die Schulen in gehöriger Ordnung sind, die Gemeinden das Katechismus=Examen fleißig besuchen, die Hausväter den Hausgottesdienst treu versehen, ob Laster im Schwange sind, und ob die Candidaten ein ordentliches Leben führen. Zu dem Zwecke haben sie die Prediger dazu anzutreiben, daß sie allmonatlich mit den Juraten und Honoratioren ihrer Gemeinde einen Convent abhalten, in welchem alles Wichtige besprochen wird. Besonders haben sie auch darauf zu sehen, daß die Prediger sich sorgfältig auf die Predigt vorbereiten und faßlich und eindringlich, lauter und rein lehren, die Kanzel nicht zu Allotriis, noch weniger zu Sticheleien auf Personen oder Seelen mißbrauchen. Es ist ferner ihre Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Prediger die Beichte ordnungsmäßig abhalten, das Katechismus=Examen zur Stärkung der Gemeinde nachdrücklich anwenden, die Schulen wöchentlich besuchen, die Kranken gewissenhaft besorgen, die Sünden und Laster privatim strafen und in keiner Willkür von der Gottesdienst=Ordnung abweichen. Endlich sind sie auch für die sorgfältige Führung der Kirchenbücher verantwortlich. Sie sollen aber auch das Privatleben der Geistlichen und ihrer Familie nicht außer Acht lassen; denn ein Geistlicher soll auch in seinem häuslichen Leben das Vorbild der Gemeinde sein.
3) Jeder Geistliche ist verpflichtet, dem Special=Superintendenten wahrheitsgetreu alle Uebelstände in seiner Gemeinde zu berichten, auch alles Anstößige aus seinen Nachbargemeinden zu melden; der Special=Superintendent aber soll, wenn ihm irgendwo etwas Verdächtiges angezeigt wird, sofort und unvermuthet die Gemeinde aufsuchen und in den Häusern nachforschen.
4) Zum Behuf genauer Nachrichten von dem Zustand der Gemeinden ist jährlich ein Frage=Plan an jeden Geistlichen zu senden, den dieser gewissenhaft zu beantworten und dann an den Special=Superintendenten einzuschicken hat. Die Punkte aber,


|
Seite 235 |




|
worüber Prediger, Küster und Gemeinde sollen examinirt werden, sind öffentlich von der Kanzel vorzulesen. Der Vortheil davon ist: 1) daß der Prediger dadurch ausdrücklich an seine Pflicht erinnert, und wenn er davon abweicht, beschämt wird; 2) daß redlich gesinnte Gemeinde=Mitglieder dadurch Muth bekommen, die Vergehungen ihrer Prediger höheren Orts zu melden; 3) daß rechtschaffene Prediger dadurch unterstützt werden, mit dem Hinweis auf die klare landesherrliche Verordnung den in den Gemeinden umgehenden Sünden und Lastern entgegenzutreten, da dann die ganze Gemeinde siehet und höret, daß der Prediger solches alles thun muß, wofern er nicht selber in Verantwortung und Strafe fallen will. -
Soviel von diesem ohne Bedenken wenigstens als unpraktisch zu bezeichnenden Vorschlage Döderleins. Von dem zweiten Theile desselben, dem Verhältniß der Synoden zu den Special=Superintendenten, werden wir später sprechen.
Dem Eifer des Herzogs gefiel der Vorschlag Döderleins ganz ausnehmend; um so mehr war er verwundert, von Zachariä, dem er denselben zur Begutachtung übersandt hatte ein ganz abfälliges Urtheil zu hören. Denn dessen redlicher Sinn lehnte sich gegen ein solches Spionirsystem auf, "bei dem nur die Bösen gewinnen könnten, der Friede der Gemeinden aber untergraben würde"; er erklärte daher rundweg, daß er abgehen werde, sobald der Herzog diesen Plan genehmige, da er alsdann als Superintendent überflüssig sei, wenigstens nicht mehr mit Segen in seinem Amte wirken könne. Der Herzog nahm diese kurze Abweisung einer, wie es ihm schien, so heilsamen Sache Anfangs Zachariä sehr übel, verzichtete aber auf die Verfolgung des Plans, und so hatte unser Land dem Muthe Zachariäs zu danken, daß, was der Herzog beabsichtigte, auch nicht gerüchtweise ins Publicum kam. Wie viel böses Gerede wäre damals, wo eben der Hermes'sche Proceß im Gange war, daraus entstanden! Und was schlimmer gewesen, mit der gesegneten Amtsführung unserer Superintendenten wäre es zu Ende gewesen; die Special=Superintendenten hätten bald die Superintendenten verdrängt!
Aber, wird man hier verwundert fragen, wie vereinigt sich dieser Vorschlag Döderleins mit dessen Rechtschaffenheit? Sah nur sein blinder Eifer nicht die Folgen? Oder wollte er etwa die Superintendenten beseitigen? - Ich bin nicht ganz abgeneigt, dies zu glauben. Denn so treu dieselben nach ihren Kräften ihres Amts walteten, so waren sie doch weit entfernt, einen Druck auf die Prediger auszuüben, durch den ihre Gewissen beschwert und ein


|
Seite 236 |




|
Streit hervorgerufen worden wäre, welcher weder dem Frieden der Kirche noch dem Wohl des Staats gefrommt hätte. Alle waren darin einig, mit Liebe sich Liebe zu erwerben, und selbst der eifrigste, der Güstrower Superintendent Keßler, beklagte wohl, daß so wenige Prediger sich bekehrten, aber niemals wollte er zur gewaltsamen Bekehrung seine Hand bieten. Das war aber nicht nach Döderleins Sinn. Dazu trat, daß die Superintendenten eine Selbständigkeit besaßen, welche dem Consistorium wenig nachgab. Wie, wenn es gelang, denselben ihren Einfluß zu nehmen, indem sie zu dem höheren Regiment im Consistorium zugezogen würden? Mit den Special=Superintendenten durfte Döderlein hoffen fertig zu werden und sie zu gefügigeren Werkzeugen zu machen. Doch lassen wir die Frage vorläufig noch offen: sie wird bald ihre Erledigung finden.
Bei dem energischen Widerspruch Zachariäs, der in dem ganzen Plane richtig einen neuen ruchlosen Anschlag des leider zum Schaden der Kirche bei Döderlein zu viel geltenden Fidler sah, ließ der Herzog das Project fallen und stellte auch bald die fünfte Superintendentur wieder her (1774).
IV. Die Präpositi und die Synoden.
Die Präpositi, oder wie sie früher vor 1671, resp. 1707 hießen, die Seniores, hatten beim Regierungsantritt des Herzogs Friedrich keine festumschriebene Amtsthätigkeit; denn da die in den ältesten mekl. Kirchen=Gesetzen vorgeschriebenen "Synoden zwecks Verbesserung des Kirchen= und Schulwesens, überhaupt alles dessen, was zur Beförderung und Ausbreitung der reinen evangelischen Lehre und zur Vorbeugung irriger Lehren und Unordnungen der Prediger und Gemeinden gereichen kann", seit Langem aufgehört hatten anders als gelegentlich zu besondern Zwecken berufen zu werden, so war auch damit die Hauptsorge der Präpositi oder Synodal=Vorstände gefallen, und es war ihnen nichts geblieben als die Durchführung des von den Superintendenten Angeordneten in ihren Cirkeln, und in sehr beschränktem Maße die Vertretung des etwa behinderten Superintendenten. Diesem Uebelstande mußte abgeholfen werden, wenn eine straffere Zucht der Prediger zurückkehren sollte. Alle wiederholt von den Predigern eingeforderten Berichte über das äußere und innere Leben der Gemeinden lauteten darin mehr oder minder überein, daß gegenüber der Rohheit der Sitten und dem finstersten Aberglauben, welche besonders bei dem


|
Seite 237 |




|
Landvolke herrschten, auch der beste Prediger machtlos sei. Der Herzog meinte aber, daß die Schuld allein an dem Mangel kirchlichen Lebens läge; er hatte selbst erfahren, mit wie großem Segen die "fremden Prediger" in ihren Gemeinden gewirkt, wie sie nicht müde geworden waren, überall Leben zu schaffen, wo keines war; der mangelnde Eifer der Pastoren, die schlechte Hirten seien, müßte also an Allem schuld sein. So lange der Krieg auf dem Lande lastete, war an ein energisches Durchgreifen nicht zu denken, denn die armen Prediger litten selbst am meisten unter dem Jammer. Aber kaum hatte das Land sich etwas erholt, als der Herzog begann, die Prediger sein Mißfallen fühlen zu lassen. Nicht allein, daß er die besseren Stellen des Landes an Fremde gab, die ihm aus dem pietistischen Kreise empfohlen wurden; er forderte auch die Superintendenten auf, daß sie die Prediger besonders auf dem Lande unter die schärfste Aufsicht nähmen und dieselben für das geistige Leben der Gemeinden verantwortlich machten; sie sollten unvermuthet Zuhörer der Predigten werden, ohne Wissen des Predigers in der Gemeinde Umfrage nach dessen Lehre und Wandel halten, auch Examina aufstellen und die daraus sich ergebenden Conduitenlisten jährlich an ihn einsenden, damit die Säumigen dem Consistorium zur Bestrafung angezeigt würden (1767). Aber keiner der Superintendenten kam dem Befehle nach. Keßler schickte zwar im ersten Jahre einen allgemeinen Bericht über seine Diöcese ein; aber er machte doch keinen einzigen Pastor so namhaft, daß er hätte bestraft werden können; vielmehr rühmte er, bei aller Klage, daß die "wahre Bekehrung" den Predigern schon von fern als Greuel erschiene, den lobenswerthen Eifer der ihm unterstellten Geistlichkeit. "Und wie die Lage des Landes nach den schweren Leiden des Krieges sei, müßten ja die Prediger zufrieden sein, wenn sie als gute Berather des armen, hilflosen Landvolks der Verzweiflung und den gröbsten Ausbrüchen des Lasters wehrten; es fehle noch viel daran, daß der Boden bereitet sei, gute, von allem Unkraut reine Saaten hervorzubringen." Menckel entschuldigte sich wiederholt, daß es ihm nicht möglich sei, dem Herzoglichen Befehl nachzukommen, und schickte zuletzt auf vieles Drängen nichtssagende Angaben. Zachariä endlich weigerte sich geradezu, "da er fürchten müsse, die Ehre seiner Prediger zu beleidigen und ein böses Denunciantenwesen zu wecken."
Da griff der Herzog im Februar 1769 auf die alte Kirchenordnungs=Bestimmung zurück und befahl: daß hinfort in allen Präposituren des Landes jährlich einmal eine Synode aller Prediger stattfinden solle. Zu diesem Zweck sollten die Präpositi als die


|
Seite 238 |




|
berufenen Vorsitzenden den Predigern aufgeben: 1) die sorgfältigste Ausarbeitung eines von den Superintendenten gestellten wissenschaftlichen Themas aus der praktischen Theologie und 2) einen gewissenhaften Bericht über den Stand und Fortschritt des Schulwesens in ihren Gemeinden. Die spätestens vier Wochen vor der Synode eingelieferten Arbeiten seiner Prediger sollte der Präpositus genau prüfen und darnach dasjenige, was ihm daraus geeignet erschienen, auf der Synode zur allgemeinen Besprechung bringen. Nach Beendigung der Synode sollten dann die vom Präpositus gewissenhaft beurtheilten Arbeiten nebst klarer Angabe, wie dieselben zu dem Leben und der Lehre der Verfasser sich verhielten, zur weiteren Prüfung an die Superintendenten gehen und zuletzt, nachdem auch diese ihr Gutachten hinzugefügt hätten, an den Herzog eingesandt werden. - Es ist begreiflich, daß die Präpositi durch diesen Befehl in nicht geringe Verlegenheit geriethen; es schien ihnen bei der noch nicht erstickten Gährung in Folge des Pietistenstreits die Saat der verderblichsten Zwietracht. Da sie dem Auftrage sich nicht entziehen konnten, verfielen die einen auf denselben Ausweg wie die Superintendenten, nämlich alle Personalien in ihren Berichten zu vermeiden und nur die besten und die schwächsten Arbeiten namhaft zu machen. Andere aber unter denselben, welche in der neuen Einrichtung eine unleidliche Bedrückung ihres Gewissens erblickten, suchten auf allerlei Weise um den Befehl überhaupt wegzukommen. Von den Predigern widersetzten sich besonders die ritterschaftlichen; denn von ihnen einen jährlichen Bericht über das Schulwesen in ihren Gemeinden zu verlangen, hieße nichts Anderes, als sie mit ihren Patronen verfeinden. Eben dieses war auch der Anlaß, weshalb der Engere Ausschuß, als er des Herzogs ernste, auf eine Reform des ganzen Kirchen= und Schulwesens gerichtete Absicht erkannte, 1773 beim Herzog vorstellig wurde und unterthänigst um eine Proposition in einer so wichtigen Landessache bat. Denn wenn es der Herzogl. Regierung gelang, durch die Synoden alles geistige Wesen im Lande unter sich zu bekommen, so war es mit der vielfach noch herrschenden Willkür der Patrone vorbei. Der Herzog ließ sich aber auf keine Verhandlung über diese zum Heile der Kirche erneuerte Einrichtung herbei; denn überzeugt, das Ritter= und Landschaft in der Opposition einmüthig zusammenständen, war er sich der Rückwirkung eines auf dem Landtage gefaßten förmlichen Protestes auf die ohnehin schon widerwillige Geistlichkeit völlig bewußt. Er antwortete daher, daß zu einer Vorlage auf dem Landtage gar kein Grund vorläge, da die Synoden kirchenordnungsmäßig wären und auf ihnen auch nichts


|
Seite 239 |




|
Anderes verhandelt würde, als was kirchenordnungsmäßig vorgeschrieben wäre. Dennoch: der Herzog wollte mehr; sein Wunsch war unzweifelhaft, durch die Synoden die ganze Geistlichkeit unter sich und seinen Willen zu bekommen. Aber das konnte nur gelingen, wenn die Präpositi mithalfen. Diese indessen folgten dem Beispiele ihrer Superintendenten, welche für die Sache nur so weit zu gewinnen waren, als der Friede der Kirche dadurch nicht gefährdet wurde. Was waren aber die von den Präpositis geforderten Berichte über Leben und Lehre der einzelnen Prediger Anderes als Conduitenlisten? Durch diesen Widerstand der Präpositi wurde der Herzog aufs Höchste gereizt; aber ohne die Superintendenten konnte er nach der bestehenden Ordnung denselben nicht beikommen. Die Macht der Superintendenten mußte also gebrochen werden. In diesem Zusammenhang möchte es daher als mehr denn eine bloße Meinung von mir erscheinen, daß der Herzog durch die eben damals geplante Einsetzung von Special=Superintendenten den Einfluß der Superintendenten und Präpositi zu brechen beabsichtigte. Denn hören wir, was Döderlein vorschlug:
1) Der Special=Superintendent giebt sechs Wochen vor der Synode den biblischen Text auf, über welchen jeder Prediger schriftlich sich auszulassen hat, und bestimmt zugleich die Artikel aus der Theologie, worüber das Colloquium in pleno stattfinden soll. Beide Aufgaben müssen das Wesentliche des Christenthums betreffen und sich auf die mancherlei theoretischen oder praktischen Irrthümer, welche im Schwange sind, beziehen.
2) Vier Wochen vor der Synode haben die Prediger ihre Arbeiten an den Präpositus, und dieser dieselben mit einer sorgfältigen Kritik 14 Tage vor der Synode an den Special=Superintendenten zu übersenden.
3) Die Synode beginnt um 9 Uhr Morgens; kein Prediger darf ohne genügende Entschuldigung dieselbe versäumen.
4) Die Synode wird mit einem kurzen Gebet eröffnet.
5) Der Vorsitzende ist der Special=Superintendent oder der von diesem mit seiner Vertretung betraute Präpositus.
6) Ueber Alles, was verhandelt wird, ist ein genaues Protocoll aufzunehmen.
7) Die einzelnen Predigten werden, ohne Nennung der Verfasser, censirt, die bedenklichen Irrthümer berichtigt; wenn eine Disputation entsteht, so werden die verschiedenen Ansichten genau zu Protocoll genommen.


|
Seite 240 |




|
8) Bei dem zweiten Theil der Synode, dem Colloquium über den Artikel aus der Theologie, muß jeder Prediger zu Worte kommen, und das Protocoll deutlich seine Meinung aufweisen.
9) Der dritte Theil der Synoden beschäftigt sich besonders mit der Besprechung der Gemeinde=Angelegenheiten und dem Schulwesen.
10) Die Synode wird mit einem kurzen Gebet geschlossen.
Nach gehaltener Synode schickt der Special=Superintendent ohne Verzug alle Acten nebst Beilagen zur Kenntnißnahme an seinen Landes=Superintendenten, der sie dann an das Consistorium weiter befördert. Das Consistorium wird dann aber Serenissimo vollständigen Bericht daraus erstatten und darum bitten, daß die verdienten Prediger auch durch die Verleihung der besten Pfarren belohnt werden. -
Ich trage kein Bedenken, das Scheitern dieses Plans ein großes Glück für die meklenburgische Landeskirche zu nennen. Denn davon abgesehen, daß die Synoden dadurch ihren höchst heilsamen Zweck verfehlt und zu nichts als gefährlichen Reibungen geführt hätten, wäre durch dieselben jede freie Bewegung der Kirche unterdrückt worden. Welcher Prediger hätte unter solcher Polizei noch gewagt, freimüthig seine Meinung zu äußern, oder Fragen, welche sein Gewissen berührten, zur Discussion zu bringen, wenn ihm als Folge davon drohende Processe oder leibliches Elend vor Augen standen? Die besten hätten geschwiegen und Gott um Hilfe in der Noth gebeten, und die Streber wären zu den besten Pfarren gelangt. Gerade was für die Kirche das Wünschenswertheste ist, der wissenschaftliche Eifer der Prediger, wäre dadurch gelähmt worden. Daß dies verhütet wurde, verdankt unsere Kirche dem Muthe der Geistlichkeit überhaupt und insbesondere dem Einspruche des Superintendenten Zachariä zu Parchim, eines Mannes, der dem Herzog doch zu nahe stand, und dessen ehrlicher Eifer im Dienst doch zu bekannt war, als daß er hätte beseitigt werden können. Obwohl der Herzog ihm deswegen zürnte und auch seinen landesfürstlichen Unwillen ihn fühlen ließ, durfte der redliche Mann sich doch mit seiner gerechten Sache trösten und hoffen, wie es auch geschah, das die Gnade seines Herrn ihm bald wieder leuchten würde. Daß aber Zachariä es war, an dessen Widerspruch der Plan scheiterte, geht mir außer vielem Anderen besonders daraus hervor, das der Herzog kurz nach dessen Tode, am 4. April 1783 den Superintendenten befahl:


|
Seite 241 |




|
"Wenn Wir zur Einführung und Beobachtung einer allgemeinen Gleichförmigkeit in den angeordneten Synodal - Versammlungen eine regelmäßigere Ordnung durchgängig zum Grunde gelegt wissen wollen: So verordnen Wir hiemit gnädigst, daß, so wie es
Erstlich in einigen Synoden schon eingeführt ist, daß jeder Prediger über die Aufgabe, welche zur Abhandlung bei der Zusammenkunft gewählt worden, seine Erklärung schriftlich mitbringen und zur Beilegung zum Protocoll abgeben, oder dagegen bei der Versammlung die mündliche Erklärung eines jeden Mitglieds zu Protocoll genommen werden muß, also
Zweitens jeder Prediger zugleich eine schriftliche Anzeige zu machen hat,
- wie es mit der thätigen Gottesfurcht in seiner Gemeinde beschaffen sei,
- ob die Schulen in gutem Gange und Stande sind, und besonders die Sommerschulen richtig gehalten werden,
- ob und was etwa sonst überhaupt bei seiner Pfarre im Kirchen= und Schulwesen, auch in der Kirchenökonomie fehle oder eine Verbesserung nöthig habe.
Drittens: damit weder die Unbequemlichkeit der Jahreszeit noch die Beschaffenheit der Wege oder die Unentbehrlichkeit der Fuhren u. s. w. einen Vorwand zur Erschwerung, Verzögerung oder gar gänzlichen Unterbleibung dieser nach Unseren Absichten so heilsamen Anstalten abgeben möge, wollen Wir so gnädigst als ernstlich, das die sämmtlichen Synodal=Zusammenkünfte in Unsern Herzog=, Fürstenthümern und Landen auf eine bestimmte Zeit in jedem Jahre, und zwar im Sommer sogleich nach vollendeter Saatzeit, vor Eintritt der Heuernte, solchergestalt angestellt werden sollen, daß spätestens allemal vor Michaelis alle dabei gehaltenen Protocolle vermittels eures Berichts in Unsern Händen sich befinden müssen; auch soll davon Aussetzung oder Verschließung keineswegs von der Willkür des Ehren=Präpositus abhängen, sondern dieser im erweislichen Nothfall darüber Unsere General=Concession nachsuchen und nach Befinden Verordnung gewärtigen.
Viertens wird jedem Präpositus hierdurch zur Pflicht gemacht, bei Einreichung des Synodal=Protocolls gewissenhaft und ausdrücklich zu berichten, ob ein oder etliche Prediger in seinem Cirkel auch etwa


|
Seite 242 |




|
eine irrige Lehre vortragen, ihr Amt im Studiren, Predigen oder sonstigen Verrichtungen vernachlässigen und keinen guten exemplarischen Wandel führen?
Würde der Präpositus diese pflichtgemäße Anzeige unterlassen, so soll er deshalb mit dem Schuldigen in gleiche, nach Befinden schwerere Strafe verfallen, und seine etwaige Entschuldigung der Unwissenheit von ihm angenommen werden, indem ihm als bestelltem Aufseher in seinem Cirkel oblieget und hiedurch zum Ueberfluß nochmals anbefohlen wird, nach der Amtsführung und dem Lebenswandel eines jeden ihm angewiesenen Lehrers fleißig und genau sich zu erkundigen.
Diese Unsere erneute höchste Willensmeinung habt ihr durch alle Cirkel Unserer euch anvertrauten Superintendentur gewöhnlichermaßen bekannt zu machen; und wie Wir uns dessen gnädig versehen, Unsere Superintendenten werden nach der Wichtigkeit des ihnen übertragenen Amtes an der nothwendigen Wachsamkeit und dem thätigsten Fleiße zur Ausbreitung des Reiches Gottes in seinem Stücke es ermangeln lassen: so habt ihr auch insbesondere auf die genaueste Befolgung dieser Unserer Vorschrift bei Vermeidung eigner schwerer Verantwortung sorgfältig zu halten. An dem - und Wir verbleiben -"
An die Ehren=Superintendenten.
Also: bis zum Jahre 1783 waren zwar die Synoden fast allgemein eingeführt, aber es gab doch noch Präpositi, die unter allerhand Vorwänden die regelmäßige Abhaltung derselben unterließen, andere, die die Personalien vernachlässigten, endlich andere, die in den Objecten der Synode willkürlich verfuhren. Dieser Schluß ward auch durch die in großer Menge noch vorliegenden Synodalberichte bestätigt: in den meisten Cirkeln verfuhren die Präpositi nach der Vorschrift, anderwärts aber, wie es ihnen gut dünkte. Nur sehr wenige ließen sich auf Klagen gegen die ihnen unterstellten Prediger ein, diese selbst hüteten sich, heterodoxe Meinungen vorzutragen, woraus ihnen Processe entstehen konnten, und wenn es mit oder ohne ihren Willen geschah, so gaben sie nach. Ich bin kein competenter Beurtheiler dieser theologischen Arbeiten, habe mir aber doch die Mühe gemacht, viele derselben durchzulesen und darauf anzusehen, in welchem Geiste dieselben geschrieben sind. Bei weitem die größere Menge würde den heutigen Ansprüchen nicht genügen; ohne auf die Kernfrage einzugehen, sucht sie gut oder schlecht das Thema in der Form einer Predigt mit der obligaten Dreitheilung zu behandeln; man merkt auch vielen die saure


|
Seite 243 |




|
Arbeit an, die an solche wissenschaftliche Lösung von Principien=Fragen entweder nicht mehr gewöhnt oder niemals derselben gewachsen gewesen ist. Manche sind aber auch darunter, die recht tüchtig sind, und namentlich kann man hier an den jüngeren Kräften die neue Schulung wahrnehmen. Die Zeit, wo das Studiren Nebensache war und das Predigen Hauptsache, war Dank dem Einfluß Döderleins vorüber; es wurde Keiner mehr zum Examen zugelassen, der nicht wenigstens sein Triennium absolvirt hatte und ein Attest über seinen Fleiß und seine Qualification von der Universität beibrachte; an ein unverdientes Durchschlüpfen war unter den damaligen Superintendenten nicht zu denken. Was mir aber besonders aufgefallen ist: die Zahl der pietistischen Hauch verrathenden Predigten ist zwar nicht gering, aber es ist der Pietismus, der ins orthodoxe Lager übergegangen ist; die Kunstausdrücke finden sich wohl noch, auch wohl noch der eigenartige Stil, aber von den bösen Auswüchsen bemerkt man nur selten mehr Etwas. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, darauf zu achten, wenn der Nicht=Meklenburger in der Sprache sich verrieth, und habe zu meinem Verwundern die Zahl nur gering gefunden, so daß bis auf weitern glaubwürdigen Beweis die Zahl der von auswärts berufenen Prediger mir durch den Haß der Nachzeit um Vieles vergrößert erscheint. Es ist mir bekannt, daß der Herzog in verantwortungsvolle Stellen, besonders auch in die Präposituren, gern Sachsen aus der Haller Schule einsetzte; so weit ich aber sehe, fanden seit etwa dem Jahre 1770 nur in seltenen Fällen mehr Berufungen von auswärts statt. Und ist das nicht erklärlich? Seitdem die zukünftigen meklenburgischen Theologen sich gebunden sahen, Döderleins Schüler in Bützow zu sein, drang der vom Herzog begünstigte Geist der pietistischen Orthodoxie auch in Meklenburg durch, und das Suchen auswärtiger Kräfte hörte nach und nach ganz auf.
Der Gesammteindruck aber, den die Predigten machen, ist der einer stillen Zeit, welcher jede Kampfeslust gegen das persönliche Kirchenregiment des Herzogs abging. Darum war aber dieser Friede kein ehrlicher, im Gegentheil, wir stoßen überall bei der gesammten meklenburgischen Geistlichkeit auf eine passive Opposition, und von einem Siege des Pietismus, von dem man so bedingungslos zu sprechen pflegt, kann erst recht keine Rede sein. "Wir müssen froh sein", schreibt einmal Keßler in seinem Berichte, "wenn wir wissenschaftlichen Sinn und ehrbares Leben bei allen Predigern finden; von der Bekehrung (er meint die pietistische) wollen sie nichts wissen." So bedauert auch Zachariä, daß die Prediger in


|
Seite 244 |




|
seinem Sprengel einen wahren Abschrecken vor dem Pietismus haben und darin von ihren Präpositis bestärkt werden. Es sei nichts auszurichten. Der Herzog aber strebte bis an sein Lebensende darnach, diese Opposition zu unterdrücken. Noch am 26. Februar 1784 befahl er den Superintendenten, alle Quartale über jeden Prediger an ihn persönlich zu berichten; und als dieselben aufs Neue das rein Unmögliche der Forderung geltend machten, verordnete er: das Consistorium habe hinfort alle Quartale von jedem Superintendenten über die Prediger seines Sprengels Bericht einzufordern und denselben immediate originaliter einzusenden. "Denn es kann Uns bei Unserm Oberbischöflichen Amt und Würde nicht gleich viel sein, unbekannt mit den sämmtlichen Lehrern Unsres Landes zu sein, indem Wir dereinst Rechenschaft geben sollen, wie Wir hienieden auf Erden die Kirche Christi gebaut haben." Dem Befehl des Consistoriums gehorchten zwar die Superintendenten; aber die von ihnen eingesandten Berichte enthielten, abgesehen von einzelnen Klagen über den anstößigen Lebenswandel einzelner Geistlichen, nur die kurze Angabe, "daß Besonderes nicht zu melden sei." Auf den theologischen Standpunkt der Prediger ging keiner ein.
Wir müssen also sagen: der Versuch des Herzogs, durch die Synoden einen besonderen Druck auf die Präpositi, und durch diese wiederum auf die Geistlichen auszuüben, war ebenso gescheitert wie der frühere, die Superintendenten für ein gewaltsames Vorgehen zu gewinnen. Aber dennoch gereichte die Wiederbelebung der Synoden dem Lande zu großem Segen, nicht so sehr durch die Nöthigung der Prediger, ihrem Berufe allseitig zu genügen, als durch die Herbeiführung eines engeren Bandes unter den Geistlichen: sie hatten Gelegenheit sich persönlich kennen zu lernen und über alle wichtigen, die Zeit bewegenden Fragen sich auszusprechen. Daß zugleich aber durch diese Synoden die Widerstandskraft der vereinigten Geistlichkeit gegen alle Versuche, wider ihr Gewissen sie zu zwingen, gestärkt wurde, wer wollte das verkennen oder leugnen?
Nun liegt uns aber am Schluß dieses Capitels die Beantwortung einer Frage ob, auf welche viel ankommt. Was wollte der Herzog, was wollte sein Vertrauter Rath Döderlein? Die Prediger zwingen, daß sie zum Halleschen Pietismus sich bekehrten? Das wäre unverständig gewesen und ungerecht, und beide waren davon auch weit entfernt. Oder dieselben sonst von der Orthodoxie abbringen? Auch das nicht; sagte doch Döderlein selbst einmal, das er sich bewußt wäre, in keinem einzigen Punkte von der Orthodoxie abzuweichen, und der Herzog forderte als Erstes von


|
Seite 245 |




|
seinen Predigern die unbedingte Anerkennung des in den symbolischen Büchern aufgestellten Lehrsystems. Nicht in diesem Dogmatischen lag der Schwerpunkt, sondern in der verschiedenen Auffassung der s. g. Mitteldinge. Denn mochte die Orthodoxie das Bekenntniß aus der reinen Lehre, also das Polemische, als das Erste betonen, der Hallesche Pietismus dagegen das christlich=kirchliche Leben voranstellen, so waren doch beide in dem einen Endzweck, die Sünder zur Buße zu reizen, einig. Aber eben in der Methode unterschieden sich beide; jene suchten das Heil in der Weltflucht, in einem seligen Schwelgen in Gottes Liebe, das seines Gnadenstandes durch die einmal erfolgte Bekehrung sich gewiß ist, diese in einer die weltliche Luft täglich überwindenden und täglich sich erneuernden Gnadenwirkung des Heiligen Geistes: dort ein Finden und Gefundenhaben, hier ein Suchen und Sichfindenlassen. In diesen den ganzen Christenstand verschieden auffassenden Gegensätzen bewegte sich der Streit hüben und drüben: während die Orthodoxen den Pietisten vorwarfen, daß sie durch ihre Lehre den Christen zur Täuschung über seinen Gnadenstand verführten, schalten die Pietisten auf die Orthodoxen als unfertige, unbekehrte Christen, die des Muthes zum rechten Gottesdienste entbehrten und lieber über das Wort Gottes zankten, als in dem Worte Gottes lebten. Der Herzog stand in diesem Streit entschieden auf der Seite der Pietisten, das Volk dagegen auf der Seite der Orthodoxen, nicht um ihrer Orthodoxie willen, sondern weil sie Meklenburger waren, während die "Pietisten" meist Fremde waren.
V. Die Prediger und die Gemeinden.
Der erbitterte Kampf der Ritterschaft Meklenburgs gegen den Absolutismus des Herzogs Karl Leopold hatte mit der Niederlage des Fürsten geendigt; der Adel war im Besitz all seiner Vorzüge und Privilegien geblieben. Wie sein Vater Christian Ludwig, so hütete sich auch der Herzog Friedrich, obgleich die ständische Beschränkung ihm persönlich verhaßt war, die leidenschaftliche Eifersucht der Ritterschaft zu verletzen, und verzichtete lieber, wo er durch gütliche Verhandlungen auf dem Boden des bestehenden Rechts oder der Gewohnheiten nicht durchdringen konnte, auf die Erreichung der Wünsche, als daß er es auf Processe vor Kaiser und Reich ankommen ließ. Durch diese scheinbare Nachgiebigkeit, die im Unterhandeln nicht müde wurde, erreichte der Herzog in den meisten Fällen wenigstens den besten Theil seines Wünschens.


|
Seite 246 |




|
Es fehlte allerdings nicht an Conflicten, in denen der Engere Ausschuß der Ritter= und Landschaft dem Herzog das Recht dieser oder jener eigenmächtigen Neuerung in Kirchensachen bestritt, unter Anziehung des L. G. G. E. V. von 1755, daß die Stände in allen die Wohlfahrt des Landes betreffenden Kirchensachen gehört werden sollten; aber es waren doch fast immer nur Bitten und Vorstellungen, in denen jede Antastung des oberbischöflichen Rechtes des Landesherrn ängstlich vermieden wurde. Denn darin ließ der Herzog sich seinen Buchstaben streichen, und selbst auf Vorstellungen derart unterließ er nie mit einer gewissen Härte zu antworten. So blieb zwischen dem Fürsten und seiner Ritterschaft ein dauernd gutes Verhältniß bestehen; jener tastete nicht an die Patronatsrechte des Adels, ohne deshalb zu dulden, daß die Rechte der Geistlichen oder der Unterthanen gekränkt wurden, diese willfahrte, wenn auch nach der Gewohnheit widerstrebend, den gerechten Wünschen des Fürsten, ohne zu unterlassen, dem Herzog von Zeit zu Zeit ins Gedächtniß zu rufen, daß jeder Zwang vor Ordnung der Sache mit dem Landtag gegen den Erbvergleich sei. Als die Strelitzsche Regierung den Herrn v. Arenstorf wegen Vernachlässigung der Kirche zu Krümmel verklagte, genügte die Drohung des Herzogs, einen Prediger seiner Wahl dorthin setzen und das Patronatsrecht selbst ausüben zu wollen; als der Herzog im Jahre 1783 die Ritterschaft zwingen wollte, das neue Gesangbuch anzunehmen, wich er doch "vor dem trotzigen Hochmuth" der Ständeherren zurück. -
Im Allgemeinen waren die ritterschaftlichen Pfarren die wenigst gesuchten; denn wenn die Geistlichen auch rechtlich von dem Patron unabhängig, weder civiliter noch in delictis unter der Gerichtsbarkeit des Gutsherrn standen, so gab es doch unzählige Mittel, ihnen, wenn sie obstinat waren und anders handelten, als der Patron wünschte, das Leben sauer zu machen und die Freude des Amts zu verderben. Welche Verwirrung und Willkür damals noch herrschte, möge dies Eine beweisen: Als der Herzog im Jahre 1784 auch die ritterschaftlichen Prediger aufforderte, über ihr Einkommen möglichst genaue Angaben zu machen, waren mehrere darunter, welche nicht zu sagen wußten, was Hof= und was Pfarracker wäre, andere klagten, daß ihnen der Patron eigenmächtig um einen von ihm geliebten Preis den Acker weggenommen hätte; andere endlich erklärten geradezu, das sie ganz von der Gnade lebten, nachdem sie vergebens versucht hätten, in Processen ihr Recht zu beweisen. Die Zahl der ritterschaftlichen Pfarren war aber keine unbedeutende: in der Bukower Präpositur waren es 5,


|
Seite 247 |




|
in der Doberaner 0, in der Grevesmühlener 7, in der Lübower 2, in der Meklenburger 4, in der Rehnaer 5, in der Sternberger 6, in der Parchimer 0, in der Crivitzer 7, in der Grabower 2, in der Hagenower 3, in der Lübzer 3, in der Neustädter 1, in der Warener 2, in der Wittenburger 6, in der Güstrower 0, in der Goldberger 1, in der Lüssower 3, in der Malchiner 24, in der Penzliner 11, in der Plauer 7, in der Röbeler 11, in der Teterower 5, in der Boizenburger 1, in der Darguner 2, in der Gnoiener 8, in der Ribnitzer 3, in der Schwaner 0, im Schweriner Cirkel 0, in dem Bützower 1, im Ganzen: 130.
Die Lage der Bauern in der Ritterschaft war die Leibeigener; zu Grund und Boden gehörig, seufzten sie unter schwerer Arbeit und dankten Gott, wenn er ihnen einen gnädigen Herrn gegeben hatte. Rohheit der Sitten und tiefste Finsterniß des Unglaubens und Aberglaubens waren die natürliche Folge des traurigen Looses. War auch der Kirchenbesuch durchweg gut zu nennen, so täuschte sich doch sein Prediger über das Vergebliche seiner Arbeit an diesen Seelen. "Der Bauer hat seine eigne Religion", klagt einmal ein Prediger, "er nickt zu Allem, was wir ihm sagen, mit dem Kopfe, aber im Herzen lacht der Teufel." Und ein anderer: "Alles Locken und Rufen zu wahrer Ergötzung ist hier umsonst; das Fressen und Saufen, Spielen und Tanzen ist des Bauern einzige Lust." Dennoch arbeitete der Herzog unermüdlich darauf hin, auch in der Ritterschaft "dem armen Manne" zu helfen, indem er nicht allein die Prediger antrieb, ohne Unterlaß "durch Liebe und eindringliche Ermahnung" auf die Herzen einzuwirken, sondern auch die, wir müssen es leider bekennen, widerstrebende Ritterschaft ermahnte, dafür zu sorgen, daß die greulichen Unsitten und Laster aufhörten, vornehmlich aber, daß die Sonntagsarbeit der Bauern nicht geduldet würde; denn der Bauer müßte auch einen Tag haben, den er frei von Sorge und Arbeit Gott heiligen könnte. Wie geringes Verständniß aber die Ritterschaft für diese Bestrebungen ihres Landesfürsten hatte, zeigt die Abweisung des letzteren Wunsches: das Bestellen seines Ackers am Sonntag Nachmittag nach geendigtem Gottesdienst sei dem Arbeitsmann dienlicher als das Umherlungern, welches niemand ihm verbieten könnte. Da der Herzog bei seinem Willen beharrte, kam sie endlich so weit entgegen, daß Sonntags nur Noth= und Liebeswerke erlaubt, dem Tagelöhner und Einlieger aber nach der Predigt auch das häusliche Arbeiten nicht verwehrt sein sollte.
Obgleich das äußere Resultat der allerh. Bemühungen, durch gesetzliche Bestimmungen Ordnung und Wandlung zu schaffen, der


|
Seite 248 |




|
Ritterschaft gegenüber ein sehr geringes war, so dürfen wir doch den Segen im Stillen gewiß hoch anschlagen; denn dazu sind ja von Gott die Throne errichtet, daß der Geist der Wahrheit und Liebe von ihnen über das ganze Volk Ströme des Segens verbreite, und immer hat sich noch das gute Beispiel mächtiger erwiesen als des Gesetzes Strenge.
Landschaftliche Pfarren 1 ), d. h. Pfarren städtischen Patronats, waren nur noch die zu Rostock und Güstrow. Von Rostock besetzt wurde außerdem die Pfarrei zu Rövershagen, von Parchim die zu Gischow. Die Domkirche in Güstrow war herzoglich. Die übrigen Städte des Landes hatten auf das Patronat zu Gunsten der Herzoge verzichtet.
Auch in den Städten war das geistige Leben der Bürger nicht so, wie der Herzog es wünschte. Die Industrie lag überall gänzlich darnieder, und alle Versuche ihr aufzuhelfen waren vergeblich. Die Handwerker in den kleinen Oertern waren meist zugleich Ackerbauer, und in dieser unglücklichen Verbindung zweier Geschäfte kam keines zu seinem Rechte. Die Klage über die Vergnügungssucht und den zu der Einnahme in keinem Verhältniß stehenden Luxus der Kleinbürger war allgemein. Der Herzog hätte gern diese alten üblen Gewohnheiten beseitigt, aber die Bürger "raisonnirten gegen alle wohlgemeinten Vorschläge der Regierung"; so erschien ihnen auch die Aufhebung der Theater und das Verbot aller belustigenden Schaustellungen, "als durch welche die Bürger in ihrem Müssiggang nur bestärkt und zu unnützen Ausgaben veranlaßt würden", als eine unerträgliche Bevormundung. Der Kirchenbesuch war ziemlich regelmäßig, und das Verhältniß der Gemeinden zu den Predigern durchweg gut; aber das war nur so, weil es von Alters her so gewesen war: ein wirklich thätig=christliches Leben, wie es der Herzog wünschte, war nur in wenigen Gemeinden zu finden. Und daran vermochten auch die Geistlichen wenig zu ändern; sie waren froh, wenn der kleine Kreis der Frommen zu des Herrn Freude wuchs, und die große Menge ein ehrbares, zur Einkehr vorbereitendes Leben führte.
Anders aber stand es mit der großen Masse der ländlichen Bevölkerung in dem herzoglichen Domanium, den Aemtern und incamecirten Gütern. Hier herrschte der Fürst nach seiner Willkür. Die brennende Frage jener Zeit war die Berechtigung der Leibeigenschaft. Schon Karl Leopold, und wir wollen ihm das nicht


|
Seite 249 |




|
vergessen, hatte im Jahre 1715 erklärt: die Leibeigenschaft sei der Fluch des Landes, und er wolle dieselbe aufheben, auch alle vermögenden und geschickten Bauern zur Erbpacht einladen, um ihnen statt des beschwerlichen Frohndienstes die Freiheit zu geben. Indessen bei dem guten Willen war es geblieben, und Dank hatte der Fürst damit nicht geerntet. So war der Bauer Leibeigener geblieben und blieb es noch lange, obwohl viele Einsichtige dagegen ihre Stimme erhoben. Die Folge davon war, daß die Landwirtschaft sich nicht heben wollte, viele Felder wüst lagen und das reiche Futter auf den Wiesen verdarb. Denn es fehlte an Arbeitern überhaupt, und die Arbeiter, welche da waren, lebten stumpf und dumm dahin, nur dem Zwange gehorchend. Sie hätten es besser haben können, wenn sie ihr Interesse verstanden hätten; denn das ihnen angewiesene Bauernfeld war groß genug, um alle vor Hunger und Elend zu schützen. Aber mit großer Hartnäckigkeit hielten sie fest an der verderblichen Communion, innerhalb deren der eine durch den andern gebunden war; mochte der Acker naß sein, er mußte bestellt werden, wenn der Nachbar den seinigen bestellte; wenn der Nachbar die Saat zu schneiden begann, so mußte sein Nachbar auch schneiden, mochte die Saat reif oder unreif sein. Niemand gönnte dem andern, sein Vieh zuerst hinauszutreiben, obgleich die Wiesen dadurch gänzlich verdorben wurden. So waren die Bauern an ihrem Elend zum großen Theile selbst schuld. Indessen die Verdienste des Herzogs um die Beseitigung dieses Uebelstandes gehören nicht hierher.
Innerhalb der Dorfcommunion aber lag der Priesteracker, und seine Bestellung war Sache des Predigers. Es ist mir unbegreiflich, warum die Regierung den vielen Vorstellungen der Pastoren, daß alle Arbeit verloren sei, so lange jene Communion bestände, kein Ohr lieh und lieber dem unverständigen Verlangen der Prediger nach Abgabe des ganzen Ackers willfahrte. Es gab doch einsichtige Leute genug, welche die große Gefahr der Vererbpachtung des Pfarrlandes auf ewige Zeiten erkannten und voraussagten, es würden "die Prediger bald seufzen und den Landesherrn um Brot bitten." Die Klage der Prediger, die Bestellung ihres Ackers bringe kaum die Kosten des damit verbundenen großen Haushalts auf, durfte meines Erachtens keinen Grund abgeben, die Pfarrländereien für ewige Zeiten den Kirchen abzunehmen; mochte dies auch für die Gegenwart als eine Wohlthat erscheinen, so mußte doch die Regierung einsichtig genug sein, auf den Unverstand der Prediger nicht einzugehen. Den Kirchen


|
Seite 250 |




|
in Meklenburg ist damit ein unberechenbares Vermögen entzogen worden.
Zu dem, was der Prediger aus der Bestellung seines Ackers oder der Pacht an Einkommen hatte, kamen noch hinzu die nicht geringen Hebungen an baarem Gelde, die gelieferten Hammel, Schweine, Korn, Heu, Holz, Hühner Eier, Würste, Käse u. s. w., nebst den Accidentien für geistliche Handlungen bei Taufen, Kirchgang, Confirmation, Beichte, Hochzeit, Leichen u. a. m., und diese Nebeneinnahmen waren oft so bedeutend, daß manche Prediger, die schlechte Landwirthe waren, davon mehr oder minder leben mußten.
Als der Herzog Friedrich die Regierung antrat, war die leibliche Noth, in welche die Geistlichkeit während der Wirren unter Karl Leopold gerathen war, noch sehr groß; der neue, sieben schreckliche Jahre dauernde Krieg brachte sie dem Verhungern nahe. Nur ein Beispiel statt vieler. Im Jahre 1759 sah sich der Herzog gezwungen, dem Lande eine neue Steuer aufzuerlegen. Da erklärten die Prediger der Hagenower Präpositur auf ihr Gewissen, "daß es ihnen ganz unmöglich wäre, die neue Steuer zu erschwingen; denn durch die Verschlechterung des Geldes verlören sie an jedem Thaler 10 Schillinge, ihre Wirthschaft trüge garnichts ein, ihr Vieh sei an der Pest gestorben, ihre Häuser würden von den preußischen Truppen mit Vorliebe belegt, die Gemeinden seien verarmt und in Folge davon die Accidentien sehr verringert; sie hätten kaum das trockene Brot, woher sie noch den zehnten Pfennig mehr Steuer nehmen sollten? Sie bäten daher flehentlich, da sie ja nicht unter einem barbarischen Scepter, sondern unter einem echten Freunde Gottes lebten, das ihnen diese Steuer erlassen würde." Der Herzog antwortete: er wisse Alles und kenne auch die Noth seiner Prediger, aber, "ob ihm auch das Herz blute", so könne er doch vor dem Lande, in welchem Alles litte, die Prediger nicht davon erlösen, mitzuleiden. Er werde, so bald der Krieg vorbei sei, ihrer Noth abhelfen.
Und er hielt sein fürstliches Wort; die Prediger hatten sich nicht zu beklagen. Sobald es die Lage der Cassen erlaubte, ersetzte er den einzelnen den erlittenen Schaden, schoß vor, wo kein Geld war, gab Korn zur Einsaat, lieferte Holz zu Neubauten oder Reparaturen, kurz, sorgte für jeden so, "daß er an seinem Landesherrn einen milden Vater zu haben verspürte." Als im Jahre 1784 jedem Prediger aufgegeben wurde, sein Einkommen genau zu fixiren, fanden sich nur wenige, die zu klagen gerechte Ursache hatten. Die meisten waren zufrieden, obgleich sie, wie die Kammer


|
Seite 251 |




|
urtheilte, durchgängig ihr Einkommen viel zu niedrig geschätzt hatten. Wenn daher die meklenburgische Geistlichkeit mit Vorliebe den Herzog "ihren Friedrich" nannte, so hatte sie dazu volle Berechtigung. Aber trotz aller äußersten Sparsamkeit, die von der Noth der Lage geboten war, betrug doch im Jahre 1783 das durch die Kriege, durch die Bauten von Kirchen und Pfarrhäusern hervorgerufene ungedeckte Schulddeficit der Kirche nach der Angabe der Prediger noch 13,000 Thlr., nach der genaueren Feststellung durch die Renterei aber mehr als 60,000 Thlr. Der Herzog wollte diese Schuld in der Weise tilgen, daß die reichen Kirchen den armen von ihrem Vermögen abgäben. Die Renterei aber schlug vor, die Licentgelder um den fünften Pfennig zu erhöhen, wodurch etwa 3000 Thlr. jährlich aufkommen würden. Diesen Vorschlag genehmigte der Herzog mit der Einschränkung, daß von dem einkommenden Gelde nur eine gewisse Quote an die armen Kirchen fließen, aus dem größeren Reste aber ein Fonds gesammelt werden sollte, der auch in der Zukunft den armen Patronatskirchen, welche unvermögend seien ihre Kirchen und Schulen zu erhalten, zu Gute kommen könnte. Er verbot aber, aus diesem Fonds Gelder zur Aufbesserung der Prediger=Salarien zu nehmen.
Indem der Herzog so der Noth der Kirchen und seiner Prediger im Domanium abhalf, meinte er dafür aber auch fordern zu dürfen, daß die Diener der Kirche ihre ganze Schuldigkeit in dem Aufbau des Reiches Gottes thäten. Ein Prediger, welcher sich mehr um seinen Leib als um die Seelen der Eingepfarrten kümmerte, dem an Streit und Zank mehr lag als an dem Werk der Liebe, durfte sich vom Herzog nichts Gutes versehen, er durfte gewiß sein, daß seine, auch gerechten Bitten keine Erhörung fanden. Bei allen Bittgesuchen der Prediger ließ der Herzog sich zunächst über das kirchliche Leben der Gemeinde von den Superintendenten berichten, und nach den Früchten richtete sich das Maß seiner Gnade.
Verfolgen wir nun aber im Einzelnen die herzoglichen Verordnungen!
Gleich beim Beginn seiner Regierung, am 6. August 1756, verwies er mit aller Schärfe den Predigern alles ungebührliche Schelten auf den Kanzeln, da ihr Amt allerdings die Bestrafung der Sünden von ihnen fordere, aber nicht mit beleidigender Bloßstellung des Sünders: in der Stille sollten sie den Verbrechern ihre Vergehen vorhalten, selbigen das Gewissen aufs Aeußerste schärfen, an ihrer Lebensbesserung unermüdlich arbeiten und, dafern diese nicht erfolgen sollte, sich Raths bei ihren Superintendenten erholen oder auch nach Befinden das böse Leben und Wandel dem


|
Seite 252 |




|
Fiscal zur weiteren Verfolgung anzeigen. Als ein Bauer sich beklagt hatte, daß sein Prediger ihn nicht zum Abendmahl zulassen wollte, schrieb der Herzog mit eigner Hand an den Rand des Consistorial=Berichts: "das Abendmahl vorenthalten bessert nicht, sondern verbittert; der Prediger soll durch eindringliche Mahnungen die Seelen wecken."
Am 22. October 1756 verbot der Herzog seinen Leibeigenen alles laute Lärmen bei Hochzeiten, Kindtaufen und andern Festen; selbst das Erntefest wurde beseitigt und den Leuten durch baares Geld ersetzt. Alle Spielleute wurden verbannt, und jede Ausübung dieser Kunst, womit "dem Reigen= und Tanz=Teufel gedient würde", mit der schwersten Strafe belegt. Im Jahre 1762 wurde das Hazardspielen allen Landeseinwohnern ohne Unterschied des Standes und Wesens verboten und dieses Verbot 1766 noch verschärft; indessen Frucht scheint es bei der damaligen Spielwuth wenig gehabt zu haben. Im Jahre 1769 beauftragte der Herzog das Consistorium, von den Predigern gewissenhafte Berichte einzufordern, wie weit sich das Leben besonders in den Domanialbezirken gebessert habe? Die Antwort lautete wenig erfreulich; die Meisten dienten nach wie vor den Werken des Fleisches, und vor Allem verhindere die Spiel= und Tanzwuth trotz der größten äußeren Noth die Umkehr. Einer schlägt sogar vor, man sollte, um endlich den Spielleuten das Handwerk zu legen, sie von der Kirche und dem ehrlichen Begräbniß ausschließen. Doch waren es nicht diese Sünden allein, welche den Predigern die Arbeit erschwerten; ich bin ganz außer Stande, alle den greulichen Aberglauben des blinden Heidenthums und Türkenglauben zu schildern, oder von den Unsitten auch nur ein annähernd treffendes Bild zu geben. Da saßen an den Sonntagen während des Gottesdienstes die Bauern in den Schenken und machten heillosen Lärm bei ihrem Fressen und Saufen; andere arbeiteten und wirthschafteten am Sonntag als schlimme Sabbathschänder; die Sonntage dienten besonders dazu, Hochzeiten. Taufen u. s. w. zu feiern. Hören wir den Bericht eines Predigers über den Kirchgang der Sechswöchnerinnen und jungen Frauen! "Am Sonntagmorgen finden sich oft 40 bis 50 Personen im Hause der Kirchgangsfrau ein und erhalten Frühstück, wobei sie sich rund und voll saufen. Auf dem Wege zur Kirche ist dann ein Geschrei und Gejuche, nicht anders als wenn ein Corps unbändiger Rekruten daher käme. Unter dem Hauptgesang kommen sie dann eine nach der andern in die Kirche und wählen zum Eingang die Thüre, die von dem Stuhl am weitesten entfernt ist, damit der Zug auch ja durch die Kirche


|
Seite 253 |




|
paradire. Nach geschlossener Predigt geht die Kirchgangsfrau aus ihrem Stuhl um den Altar herum, ihr folgen ihre Begleiterinnen, und die Priesterin und die Küsterin müssen diesen Gang mitmachen. Alle Umgehenden legen dann etwas Geld auf den Altar, das dem Priester zufließt, die Kirchfrau aber giebt dem Küster etwas. Während dessen lachen und sprechen die Leute und machen den Gottesdienst unmöglich. Alles dies ist aber eine günstige Gelegenheit für den Teufel, das Wort, das etwa in die Herzen der Zuhörer gefallen ist, mit leichter Mühe wieder wegzunehmen. 1 )
Dieses traurige Ergebniß der Umfrage veranlaßte die Patent=Verordnung vom 30. December 1769, in welcher allen Domanial=Unterthanen und Hauswirthen verboten wird,
1) Verlöbnisse durch eine Mahlzeit zu feiern;
2) zu Hochzeiten mehr als 14 Personen einzuladen, dieselben über einen Tag hinauszudehnen, mehr als 3 Gerichte und 1 Tonne Bier vorzusetzen;
3) zu den Kindtaufen Andere als die Gevattern und leiblichen Geschwister einzuladen;
4) bei Begräbnissen zu essen zu geben und mehr als höchstens 1/2 Tonne Bier aufzulegen;
5) Spielleute, sei es unter welchem Vorwande immer, herbeizuholen;
6) Pfingst=, Fastnachts= oder andere Gilden zu halten,
7) Wettel=Bier aufzulegen,
8) Ernte=Bier zu reichen.
9) Aber auch allen im Domanium wohnenden freien Leuten soll bei 10 Gulden Strafe untersagt sein, bei irgend welchen fröhlichen Zusammenkünften Musik zu nehmen oder Musikanten herbeizuholen.
Diese Verfügung sollte fortan jährlich an dem kurz vor der Ernte einfallenden Buß= und Bettage von den Kanzeln verlesen und die Gemeinde mit allem Ernst gemahnt werden, daß es Serenissimi Wille sei, dem lästerlichen Leben und der Schwärmerei ein Ende zu machen.
Nicht alle Prediger waren mit dieser Strenge einverstanden; sie meinten, daß das plötzliche Eingreifen in alte Gewohnheiten


|
Seite 254 |




|
mißlich wäre und die Gemeinden gegen den Prediger aufbrächte; es stecke hinter dem Bösen doch oft ein guter Kern, den man erhalten müsse.
Im Ganzen wirkte auch diese Verordnung wohl nicht allzu viel. Denn im Jahre 1780 mußte der Herzog von Neuem einschreiten und das Saufen, Tanzen, Spielen und Musikmachen, sowie die Hochzeits= und Kindtaufsgastereien verbieten und mit dem strengen Eingreifen der Obrigkeit drohen.
Dem Uebel mußte auf andere Weise gesteuert werden. Denn was half es, die Sonntagsheiligung äußerlich zu erzwingen, wenn das Leben selbst nicht geheiligt war? Was nützte es, Verbote zu erlassen, deren Geist dem Herkommen und den Gewohnheiten des Volkes widersprachen, so lange die Hoffnung nicht da war, daß an dem Gebot die Sünde sich erkannte? Wird doch jegliches Gesetz erst durch den Geist lebendig! Dies erkannte auch der Herzog gar wohl und ließ es sich darum vor Allem angelegen sein, die Erziehung und den fleißigen Unterricht der Jugend in dem Wort Gottes zu fördern; wir müssen diesem, vielleicht dem größten Verdienst desselben, ein eignes Capitel widmen. Mit dem Schulunterricht in enger Verbindung stand die 1759 befohlene allgemeine Wiedereinführung der beinahe überall außer Brauch gekommenen öffentlichen Confirmation und die Verordnung, daß dem Landvolk alle Sonntag=Nachmittage statt der Predigt der Catechismus ausgelegt und die Jugend im ersten Jahre nach der Gonfirmation noch gezwungen werden sollte, an dieser Katechese theilzunehmen. Aber auch in den regelmäßigen Gottesdienst waren viele Mißbräuche eingedrungen, die der Wirkung des H. Geistes schadeten; besonders waren es die langen ermüdenden Predigten und das endlose Singen aus dem Gesangbuch. Darum bestimmte der Herzog 1780, daß die Predigt während des Winters nicht länger als 3/4 Stunden dauern solle. Bei der Frühpredigt sei es genug, ein Morgenlied und ein Hauptlied zu singen; im Hauptgottesdienst solle nicht mehr gesungen werden als zu Anfang "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", in der Mitte das Hauptlied und der Glaube, und am Schluß einige Verse. Beim Nachmittagsdienst solle nur zweimal, am Anfang und am Schluß, gesungen werden. Statt der langen Kirchenmusiken, die ohnehin dem mehrsten Theil der Zuhörer unverständlich seien, möge allenfalls bloß das Hauptlied musikalisch angestimmt werden. - Ferner: Das Evangelium solle künftig nicht doppelt, wie bisher, einmal vor dem Altar und das zweite Mal von der Kanzel, sondern bloß von der Kanzel, wenn nämlich über das Evangelium gepredigt


|
Seite 255 |




|
wird, sonst aber bloß vom Altar verlesen werden. Auch sollte hinfort nicht stets über die Evangelien und Episteln, sondern auf dem Lande wechselsweise ein Jahr über das Evangelium und das andere Jahr über die Episteln, in den Städten aber, besonders den größeren, abwechselnd auch über ganze biblische Bücher des Neuen Testaments ein Jahr lang gepredigt werden, ausgenommen an den hohen Festen, an welchen der Prediger solche Texte wählen könne und möge, die sich zu dem Feste, das gefeiert wird, vorzüglich schickten."
Wie viel aber dem Herzog auch an der Beförderung des kirchlichen Lebens in den Gemeinden gelegen war, und obschon alle Anstalten, die er traf, darauf gerichtet waren, die Hindernisse der Bekehrung zu beseitigen, so übersah er doch nicht, daß das Beten erst in der Arbeit seinen vollen Segen zeigt. Wenn er selbst das unablässige Gebet als eine Kraft ansah, die Berge versetzte, so blieb ihm doch das Gebet immer auch die Quelle, aus welcher reicher Segen für alle Arbeit erwüchse: seiner thätigen Natur war nichts mehr zuwider als Müssiggang, und für Alles, was mönchisch war oder scheinen wollte, hatte er nur ein Wort der Verachtung. Für die praktische Denkweise des Herzogs legt ein schönes Zeugniß die Motivirung seiner VO. ab, durch welche die Aposteltage, die dritten Feiertage zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das Fest der drei Könige, die Marienfeste, die Johannis= und Michaelistage als kirchliche Festtage beseitigt wurden (25. Juni 1774): "In Anbetracht, das an vielen Feiertagen die Gotteshäuser fast von niemandem besucht, hingegen allerhand Unordnungen und Müssiggang in den Wirthshäusern betrieben werden, wollen Wir u. s. w. und befehlen sämmtlichen Amts=, Guts= und Stadtobrigkeiten, mit Nachdruck darauf zu halten, daß die Tage, deren Feier nun eingehet, nicht zum Müssiggang angewandt werden." Und in den Verhandlungen mit dem Landtage wegen der Beseitigung dieser ganz unnützen Festtage hatte er sich auf Luthers Wort berufen, "daß es genug sei, den siebenten Tag zu heiligen, sintemalen der Wohlstand und das Gedeihen des Landes den Fleiß der Unterthanen erforderten." So könnte ich noch eine Reihe von segensvollen Anordnungen des Herzogs Friedrich in Kirchen=Sachen aufzählen; aber die genannten reichen aus für den Beweis, daß dem Fürsten mit Kopfhängern garnicht gedient war. (Vgl. übrigens Siggelkow's Handbuch, bes. §§. 190 bis 201.)
So war der Herzog mit allem Eifer darauf bedacht, durch bessere Prediger und Abstellung der vielen Uebelstände den kirchlichen Gottesdienst wieder zu Ehren zu bringen. Und wenn man


|
Seite 256 |




|
liest, wie im Beginn der Regierungszeit des Herzogs die Kanzeln in schimpflichster Weise nicht allein zu leidenschaftlichen Wuthausbrüchen, sondern auch zu weltlichen Dingen, besonders öffentlichen Verkündigungen, wie Auctionen u. dgl., mißbraucht wurden, wie nur die Geduld und liebe Gewohnheit die langen Predigten und das endlose Singen ertrug; und wiederum, wie Alles bei der neuen, in 30 Jahren herangewachsenen Generation anders war: gebildete, friedfertige Prediger, geordneter Gottesdienst, in Gottes Wort wohlunterrichtete Gemeinden, - so möchte dieser Hinweis allein genügen, das Andenken an den trefflichen Fürsten, den frommen Herzog Friedrich, zu segnen. Ohne diesen der Kirche und ihrer Wirksamkeit gegebenen festen Grund würde, dessen bin ich trotz aller Widerrede überzeugt, die nachfolgende Zeit der Feindschaft den vollen Sieg davongetragen haben; es würde nicht möglich gewesen sein, unsere Landeskirche so rasch zu ihrer jetzigen festen Organisation zurückzuführen.
VI. DasVerhalten des Herzogs Friedrich gegen Andersgläubige.
A. Die Reformirten.
Die reformirte Gemeinde in Meklenburg verdankt ihren Ursprung den aus Frankreich vertriebenen Protestanten, welche im Jahre 1698 vom Herzog Friedrich Wilhelm die Erlaubniß erhalten hatten, in der durch Krieg und Feuer verödeten Stadt Bützow sich niederzulassen und eine besondere Gemeinde unter dem Schutz des Herzogs zu bilden. Die Zahl derselben war gering, nur nahezu 100 Seelen; aber ihre Kunst in der neuen französischen Manufactur schien dem verarmten Lande eine Quelle des Reichthums zu verheißen. Diese Hoffnung schlug nun allerdings gänzlich fehl, denn trotz der energischen landesherrlichen Hülfe und Unterstützung wollte die Manufactur nicht zur Blüthe gelangen; die verheerende Feuersbrunst von 1713 zerstörte die letzten Aussichten. Obgleich so das arme Land nur um eine arme Gemeinde bereichert war, genoß dieselbe doch die unveränderte Gunst des Hofes, und zumal der reformirten Herzogin Sophie Charlotte (von Hessen=Cassel); denn es waren fleißige Leute, die niemand zur Last fielen. Nach dem Tode ihres Gemahls nahm die Herzogin=Wittwe sogar ihren Wohnsitz unter ihnen und förderte das Wohl derselben nach ihren Kräften. Dennoch war diese Uebersiedelung der Herzogin kein Glück für die Gemeinde; denn da sie ihren


|
Seite 257 |




|
eignen Prediger mitbrachte, so zerspaltete sich die kleine Zahl bald in zwei getrennte Gemeinden, die französische und die deutsche, die nicht ohne Neid einander gegenüberstanden.
Bei den vielen Besuchen, welche der Erbprinz Friedrich der geliebten Tante in Bützow abstattete, hatte derselbe wohl Veranlassung genommen, das Leben der kleinen Colonie genauer kennen zu lernen; und es war daher natürlich, daß derselbe, zur Regierung berufen, die innige Zuneigung, welche er seiner 1749 verstorbenen Tante bewahrte, auf die reformirte Gemeinde übertrug. Ich führe des Herzogs besonderes Interesse für Bützow, welches er 1760 zum Musensitz erhob, auch auf dieses Verhältniß zu seiner Tante zurück. Als im Jahre 1760 die bisher von den Reformirten benutzte Schloßkirche in Bützow für das neubegründete Pädagogium nicht zu entbehren war, wies der Herzog als vorläufigen Ersatz einen Saal an und erlaubte daneben nicht allein den Bau einer neuen Kirche, sondern förderte denselben auch durch einen namhaften Beitrag zu der von dem Prediger der deutschen Gemeinde, Finmann, ins Werk gesetzten Collecte. 1 ) Auch die Prinzessin Amalie, die jüngste Schwester des Herzogs, begünstigte, soviel sie konnte, die Reformirten; so ließ sie alle Monat einmal Finmann von Bützow nach Schwerin kommen, um für die wenigen reformirten Familien daselbst Gottesdienst zu halten. Die größte Wohlthat aber war die im Jahre 1778 vollzogene Verschmelzung der französischen und der deutschen Gemeinde. Denn als das Ableben des französischen Predigers, Jean de Convenant, der übrigens ein streitsüchtiger Mann war, höchsten Orts gemeldet worden, ließ der Herzog feststellen, wie viele Seelen in ganz Meklenburg noch zu dessen Gemeinde zu zählen seien; und da fand sich, daß nicht Einer mehr der deutschen Sprache "ohnmächtig" war. In Folge dessen wurde der Wittwe des Verstorbenen ein Gnadengeld von 100 Thlrn. auf Lebenszeit bewilligt, der Rest des Gehalts aber dem andern Prediger zugelegt. Seitdem gab es, wie auch heute noch, nur eine reformirte Gemeinde in Meklenburg mehr.
Indessen dieses Wohlwollen des Herzogs Friedrich gegen die Reformirten bezog sich nicht auf ihre Lehre, die er nur geduldet wissen wollte. Mit Eifer wachte er darüber, daß mit derselben keine Propaganda auf Kosten der Landeskirche getrieben würde. Solche Versuche kamen allerdings vereinzelt vor, aber im Ganzen waren die Reformirten sehr friedfertig und gaben dem


|
Seite 258 |




|
Herzog, dessen Gnade sie so viel verdankten, zu ernsterem Einschreiten niemals Veranlassung. Der Prediger Finmann stand sogar bei Hofe in nicht gewöhnlicher Gunst; der Herzog unterhielt sich gern mit dem wissenschaftlich ebenso hochgebildeten, als weltklugen Manne. Die niederträchtige Anklage, daß er von den Collectengeldern etwas unterschlagen habe, endete mit der Blame seiner Gegner, die ihn gern entfernt hätten. -
B. Die Katholiken.
Wie die Reformirten, so bildeten auch die Katholiken in Meklenburg nur eine kleine geduldete Gemeinde, deren Gottesdienst auf die Stadt Schwerin beschränkt war. Ihren Anfang hatte dieselbe genommen im Jahre 1663, als der zum Katholicismus sich bekennende Herzog Christian Louis die Abhaltung einer regelmäßigen Messe in der Schweriner Schloßkirche anordnete. Sechs Wochen nach seinem Absterben, im Jahre 1692, hörte diese Messe seiner letztwilligen Bestimmung gemäß wieder auf: aber die bei Hofe viel geltende Ober=Hofmeisterin von Bibow, welche eine geborene Französin [Mlle. de Beau] und mit der katholischen Herzogin Isabelle Angélique ins Land gekommen war, erwirkte vom Herzog Friedrich Wilhelm die Erlaubniß, daß sie mit den andern Katholiken, so lange sie lebte, in einem über ihrem Pferdestall belegenen Saale den Gottesdienst fortsetzen durfte. Als sie 1725 starb, war die Gemeinde bereits so gewachsen, daß sie es nicht mehr nöthig erachtete, aufs Neue um Erlaubniß zu bitten. Bei dem Herzog Karl Leopold stand sie sogar in besonderer Gunst, wenn sie auch zeitweise von seinen Launen zu leiden hatte. Anders bei Herzog Friedrich. Er war ein zu gut lutherischer Christ, um den Katholiken weiter, als es seine landesherrliche Pflicht erforderte, wohlzuwollen. Dennoch, meine ich, hatten sich jene nicht zu beklagen: der gerechte Sinn des Fürsten erlaubte ihm keine ungerechte Bedrückung, und sein frommes Herz freute sich, so oft es, und wenn's auch in fremdem Glauben geschah, wahre Gottesfurcht spürte. So wuchs auch unter seinem Regiment die Zahl der Katholiken verhältnißmäßig rasch, im Jahre 1775 wurden 500 Seelen gezählt; aus dem elenden Futterboden war eine kleine Kirche mit Altar, Kanzel und Orgel geworden; selbst eine kleine Glocke fehlte nicht. Aber die wiederholt nachgesuchte Erlaubniß einen Thurm mit rechten Glocken bauen zu dürfen, wurde nicht gegeben. Als Priester fungirten zwei Jesuiten=Patres, Frings und Dechêne, die


|
Seite 259 |




|
auch eine Schule von etwa 12 Zöglingen unterhielten. Im Ganzen war aber die Gemeinde arm.
Es ist ganz bezeichnend für des Herzogs kirchlichen Standpunkt, daß, während er die Sektirer und Neuerer in seinem Lande nicht dulden wollte, weil ihre offenen oder versteckten Angriffe auf die heiligsten Güter der Christenheit ihm unleidlich erschienen, er dagegen den Gottesdienst der Katholiken persönlich gern im ganzen Lande freigegeben hätte, wenn es die Verhältnisse erlaubt hätten. Denn er urtheilte, daß nur die menschliche Schwäche oder Sünde an dem Mangel der reinen Erkenntniß schuld sei und die Vereinigung Aller zu einer Kirche verhindere; wer nur die eine Wahrheit in Christo mit ihm suchte, war ihm als Christ willkommen, vorausgesetzt daß dabei die landeskirchlichen Rechte ungeschmälert blieben. An dem Herzog lag es daher nicht, daß im Jahre 1765 die Bitte der Katholiken um freie Religionsübung im ganzen Lande Meklenburg abgeschlagen wurde, sondern seine Räthe waren es, die aufs Entschiedenste sich dagegen erklärten, indem sie darauf hinwiesen, daß die ganze evangelische Kirche gerechten Anstoß daran nehmen würde, wenn der Herzog gegen die Tradition seines Hauses dem Katholicismus eine Freistätte in Seinem Lande bereitete; dazu würde auch unvermeidlich die ertheilte Erlaubniß eine sehr ernste Collision mit den Landständen herbeiführen, die eine so tiefgreifende einseitige Aenderung des bestehenden Rechts (s. Reversalen v. 1621) niemals zugeben könnten, um so mehr, als die dem Bischofe von Hildesheim gehorchenden Patres sich niemals als friedfertig bewiesen hätten. Dieser eindringlichen Vorstellung der Gefahr gab der Herzog nach und schlug die Bitte der katholischen Gemeinde rundweg ab.
Und allerdings - die katholischen Patres hielten sich nicht darnach, daß der Herzog großes Vertrauen zu ihrer Friedfertigkeit hätte haben können. Die Irrungen nahmen beinahe kein Ende. Um von minder wichtigen Versuchen derselben, das bestehende Recht zu ihren Gunsten zu durchbrechen, nicht zu reden, so erhoben sie 1764 den Anspruch, bei Trauungen von Katholiken und Protestanten die kirchliche Einsegnung rechtsgültig vornehmen zu können. Der Herzog entschied am 31. August: nur, wenn beide Brautleute katholisch seien, sei die katholische Eheschließung statthaft, sonst nicht. Das sei alte Ordnung, und dabei müsse es bleiben.
Noch mehr kränkte es die Katholiken, daß der Herzog im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der Regierung, welche viel durch die Finger gesehen hatten, mit aller Strenge die alte Ver=


|
Seite 260 |




|
ordnung über die Taufe und Erziehung der Kinder aus Mischehen geltend machte. Die Bestimmung, daß solche Kinder, Knaben sowohl wie Mädchen, ohne Rücksicht auf die Wünsche der Eltern zur lutherischen Kirche gehören und alle damit im Widerspruch stehenden, vor der Ehe etwa abgegebenen Gelobungen, wie sie die katholische Kirche zu fordern pflegte, nicht allein null und nichtig, sondern auch strafbar sein sollten, erschien als unerträglicher Druck.
Ein für den Bestand der katholischen Gemeinde höchst gefährlicher Proceß wurde im Jahre 1773 dadurch veranlaßt, daß die beiden Patres, ohne die pflichtschuldige Dispensation vom Herzog nachgesucht zu haben zu einer zweiten Verlobung nach eigenmächtiger Aufhebung der ersten das placet ihrer Kirche gegeben und durch mancherlei Umstände den Verdacht erregt hatten, "als Missionarii die potestas delegata von ihrem Bischof sich beilegen zu lassen." Im höchsten Grade aufgebracht, beschloß der Herzog, bei einem Proceß es nicht bewenden, sondern die Gemeinde fühlen zu lassen, daß man nicht ungestraft die höchsten fürstlichen Rechte antaste. Sein nächster Gedanke war, die beiden Priester ohne Weiteres aus dem Lande zu jagen und die fernere Ausübung des katholischen Gottesdienstes überhaupt zu verbieten; die Beweise, daß er ein historisches Recht dazu hatte, waren bereits in seinen Händen. Indessen die Rücksicht auf die mehr als 500 Seelen, welche er damit aus seinem Lande vertrieben hätte, ließ ihn von dieser harten Maßregel abstehen; er begnügte sich, der Gemeinde zu verbieten, fortan noch Jesuiten als Priester zu halten, widrigenfalls ohne Barmherzigkeit die Gnade der Toleranz aufhören sollte. Den beiden Priestern ließ er aber den Proceß machen; sie sollten nach Abbüßung ihrer Strafe das Land meiden. Die Angeklagten waren klug genug, einzusehen, daß sie vor diesem Zorn des gereizten Fürsten in Allem klein beigeben müßten. Sie wiesen also mit Entrüstung jede böse Auslegung ihres Handelns von sich und erklärten sich zu aller Genugthuung und Buße nach dem Rechte bereit; sie brachten auch das Zeugniß des Bischofs von Hildesheim bei, daß nichts ferner liege, als ein Attentat auf die Rechte eines Fürsten, der sich allzeit als der beste Freund der katholischen Gemeinde gezeigt hätte. Dadurch milder gestimmt, übergab der Herzog die Untersuchung dem Regierungsfiscal Bouchholtz und nach deren Beendigung dem Rostocker Consistorium, auf dessen Anrathen die Acten an die juristische Facultät zu Kiel eingesandt wurden. Von dieser wurden beide schuldig befunden und der P. Frings zu 100 Thlr., der P. Dechêne zu 50 Thlr. und


|
Seite 261 |




|
beide zu gleichen Theilen in die Tragung der Kosten verurtheilt. Die Buße wurde am 26. Februar 1776 bezahlt.
Indessen waren bei der Untersuchung noch viele andere Ungehörigkeiten ans Licht gekommen. So hatte der Fiscal in dem Kirchenbuche gefunden, daß die Patres die evangelischen Geistlichen immer nur praedicatii titulirten, vielfach Proclamationen unterließen, heimlich Taufen und Trauungen bei gemischten Ehen wiederholten, auch nach wie vor sich Reverse bezüglich der katholischen Kindererziehung ausstellen ließen. Wenn es nach dem Sinne des Fiscals Bouchholtz gegangen wäre, so würde ein neuer, schlimmer Proceß daraus entstanden sein. Aber der Herzog verweigerte, obwohl die Hofprediger Martini und Fidler das Feuer nach Kräften schürten, zu der Verfolgung dieser Sache seine Einwilligung und erklärte sich mit der eingeforderten, allerdings mehr als nichtssagenden, Rechtfertigung der beiden Priester zufriedengestellt; er hoffte durch das eine Exempel der Strenge genug gethan zu haben.
Aber diese Erwartung schlug gänzlich fehl; vielmehr erhielten die Patres den Herzog immer an der äußersten Grenze der Geduld. Wahrhaftig, wäre der edle Fürst nicht so tolerant gewesen, wie er es war, es wäre den Katholiken, die doch rechtlich keinen Anspruch hatten geduldet zu sein, übel ergangen. Denn was sie wagten, bewies das Jahr 1784 von Neuem. Durch eine gelegentliche Notiz in der Schwerin'schen Zeitung vom 26. Juni 1784 wurde nämlich der Regierung bekannt, das der Rostocker Rath für den Gottesdienst der Katholiken ein eignes Zimmer im Rathhaus eingeräumt hatte und gegen die feierliche Beerdigung eines Katholischen unter Glockengeläute nicht eingeschritten war, obwohl beides gegen alles Recht war. Die Sache war eine höchst verwickelte. Denn wenn der Herzog auch unangefochten das jus circa sacra besaß, so war doch der Rath der Stadt auch in Kirchensachen immer so widerspenstig und selbstherrlich gewesen, daß ohne einen langen Proceß eine Erledigung des neuen Rechtsfalls nicht zu erwarten stand. In seinen jüngeren Jahren hätte der Herzog einen so eclatanten Rechtsbruch weder vom Rathe noch von den Priestern sich gefallen lassen; aber er war des ewigen Streitens mit der Stadt Rostock müde und überließ die Erledigung der Sache seinem Nachfolger auf dem Throne. -
Fassen wir das Resultat kurz zusammen, so sehen wir die katholische Kirche unter dem Schutze des Herzogs sich langsam, aber stetig weiter entwickeln: wir bemerken, wie der Herzog persönlich dem Wunsche der katholischen Kirche nach freier Religionsübung


|
Seite 262 |




|
nahe steht, denselben aber mit Rücksicht auf das Land abschlagen muß. In dem Streite über bisher versagte Rechte stellt sich der Herzog fest auf den Boden der bestehenden Rechtsordnung und wacht eifrig darüber, daß die Propaganda der katholischen Patres der Landeskirche zu keinem Schaden gereiche. Andererseits aber schirmt und stützt er die geduldete Gemeinde, so weit es nur angeht, und leidet nicht, daß Fidler und Genossen den Frieden derselben stören. Selbst die beiden Jesuitenpatres, welche nicht aufhören zu queruliren und zu intriguiren, und dadurch gelegentlich den höchsten Zorn ihres Fürsten reizen, nimmt er immer wieder zu Gnaden an; und als der alte P. Frings stirbt, ist es seine fürstlich=christliche Huld, die ein feierliches Begräbniß desselben anordnet.
So haben auch die Katholiken alle Ursache, das Andenken des Herzogs Friedrich als das eines gerechten, gnädigen Herrn in Ehren zu halten.
C. Die Sektirer.
Der klare Geist des Herzogs Friedrich war für phantastische Schwärmereien wenig zugänglich. Nach dem Zeugniß seines eignen Mundes und aller Zeitgenossen, die ihm näherzutreten das Glück hatten, war er ein gut lutherischer Christ, der treu zu Gottes Wort und Sacrament hielt und Alles, was von diesem Troste der Christen ableitete, gründlich haßte, mochte es einen Namen haben, welchen es wollte. Vor ihm machte es keinen Unterschied, ob einer seinen Abfall von der Kirche mit seiner "wissenschaftlichen Ueberzeugung" oder mit "Visionen" oder wie immer begründete; er nannte es Hochmuth und Trotz.
Und wie ihm jede Wissenschaft verwerflich erschien, welche, anstatt zu Gott zu führen, mit ihren Zweifeln die Herzen der Gläubigen beunruhige und den Unglauben der Menge stärke, so hielt er es auch für seine erste landesväterliche Pflicht, alle diese Angriffe auf die Religion wenigstens in seinem Lande nicht zu dulden. Gefährlicher aber noch erschien ihm alle geheime Sektirerei, die eben damals üppig wucherte.
In meinen Augen waren aber die dem Herzog so nahe stehenden Darguner Pietisten auch Sektirer, und zwar von der schlimmsten Art, um so gefährlicher, als sie selber rechtgläubig im Sinne Luthers zu sein behaupteten, und dabei die Entwickelung der lutherischen Lehre verurtheilten.


|
Seite 263 |




|
Es ist ein großes Verdienst, welches sich Herr Pastor Wilhelmi durch seine durchaus objectiv gehaltene Arbeit über die Entwickelung und theologische Bedeutung des Darguner Pietismus erworben hat; denn nun kann niemand, bei williger Anerkennung des Glaubenseifers "der fremden Prediger" und ihrer segensreichen Wirksamkeit in ihren Gemeinden, mehr eine hohe Meinung von denselben haben. In ihrem ersten Auftreten waren sie nicht viel besser als die ihnen nahe verwandten Herrnhuter: und als sie darnach im Streit über den methodischen Bußkampf die Verbindung lösten und die "Pest= und Schlangenbrut" mit dem ganzen Haß ihres Fanatismus verfolgten, blieben sie doch mit Zinzendorf und seiner Gemeinde in dem pietistischen Grundsatz von der Kirche in der Kirche einig. Aber dies ist noch nicht der schlimmste Vorwurf; den sehe ich vielmehr darin, daß sie erst den Boden Meklenburgs für das Wuchern des Unkrauts der Sektirerei bereiteten. Denn nachdem ihre Führer, Zachariä voran, von dem Rottenmachen sich abgewandt und ihren Frieden mit der Landeskirche gemacht hatten, blieben die Geister, welche sie wachgerufen hatten, lebendig; und diese, nicht vermögend den rechten Weg wiederzufinden, gingen, von ihren Führern verlassen, zu der Bekenntnißlosigkeit der mährischen Brüder über. Und wohl ihnen, wenn die Innigkeit des persönlichen Verhältnisses zum Heilande der feste Boden blieb, worauf sie dem Unglauben ihrer Zeit widerstanden! Aber leider endeten die meisten da, wo auch die nicht mit vollem Herzen zur Kirche zurückgekehrten Pietisten endeten, im Rationalismus oder völligen Atheismus. Besonders aber waren es die pietistisch "erweckten und bekehrten" Lehrer, welche sich Zinzendorf zuwandten und in und durch die Schulen Propaganda für dessen Lehre machten. Der Herzog war aber nicht gewillt diesem Treiben geduldig zuzusehen. Denn so sympathisch ihm die "brennende Liebe zum Heilande" war, so widerwärtig waren ihm die Extravaganzen der Brüdergemeinde, deren der Meister nicht hatte Meister werden können oder wollen. Die Herrnhuter sollten in seinem Lande keine Freistätte finden, auch nicht, wenn sie sich äußerlich zur Augsburgischen Confession bekannten, in ihrem Innern aber fortfuhren, sich für eine besonders begnadigte Gesellschaft in Jesu Christo außerhalb der allgemeinen Kirche zu halten. Wie genau der Herzog diese Bewegung auch außerhalb des Landes verfolgte, möge folgender Brief, ein Bericht über die Gemeinde der mährischen Brüder in Schleswig=Holstein beweisen. Der Consistorialrath Struensee in Rendsburg, auch sonst vielfach vom Herzog ins Vertrauen gezogen, schrieb am 16. Febr. 1775 an den Rentmeister Kychenthal:


|
Seite 264 |




|
"Daß Seine regierende Herzogliche Durchlaucht von Meklenburg=Schwerin sich meiner gnädig erinnern, solches erkenne ich mit tiefster Devotion. Ich freue mich von Herzen, daß ich Ihro Herzogl. Durchl. vor dem Throne des Lammes in ewiger Herrlichkeit nach vollendeter Pilgrimschaft erblicken werde. Da Höchstdieselben in huldreichster Herablassung von meinem Befinden und dem Zustand des Reiches Gottes, auch den Herrnhutern in diesem Lande, benachrichtigt sein wollen, so kann ich zum Preise Gottes melden: der Herr ist meines Angesichts Hilfe und mein Gott, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr schenkt mir Kräfte des Leibes und des Gemüths, daß ich meinem schweren Amte unermüdlich vorstehen kann. Dem Ziel meines mühseligen Hierseins sehe ich täglich mit Freuden entgegen, und seit einigen Jahren sind mir die Worte des Heilandes tief in die Seele gedrückt: "Ich will zu euch kommen und euch zu mir nehmen, daß ihr sein sollt, wo ich bin." In diesen Worten finde ich Alles, was ich von meinem Abschiede von der Welt und dem Zustande meiner Seele nach dem Tode zu wissen nöthig habe. Wenn mein Freund, mein Erlöser, mein Seligmacher, bei der Scheidung Leibes und der Seele seine nahe Gegenwart meinen Geist verspüren läßt, meine Seele in seine Liebesarme aufnimmt, und ich nur immer unzertrennlich bei ihm sein kann, so begehre ich weiter nichts. Denn ich habe in ihm Alles, und das unendliche Verlangen meines unsterblichen Geistes ist in ihm gesättigt und befriedigt.
"Was den Zustand des Reiches Gottes in den hiesigen Herzogthümern anbetrifft, so wird demselben nicht allein kein Hinderniß in den Weg gelegt, sondern es werden auch alle Anstalten zur Förderung desselben getroffen, und es ist der ausdrückliche Wille meines königlichen Herrn, daß die gesammten Einwohner zu einem rechtschaffenen Wesen des Christenthums geführt werden sollen. Mein tägliches Flehen zu Gott ist nur, daß er uns treue Arbeiter senden wolle.
"Die mährischen Brüder haben zwar im Amte Hadersleben einen Wohnungsort, den sie Christiansfeld nennen, und es ist ihnen freie Religionsübung verstattet worden; jedoch mit der Beschränkung, daß sie nur geduldet sein sollen. Im vorigen Jahre war ich bei ihnen und äußerte mein Bedenken wegen ihrer Lehren und Anstalten in Liebe und mit der Wahrheit. Sie erklärten mir, daß sie seit einigen Jahren von Herzen zum Augsburgischen Bekenntniß sich hielten und nichts mit den Ausschweifungen Zinzendorfs mehr zu thun hätten. Sie seien evangelisch=lutherisch, und


|
Seite 265 |




|
das mit innerer Ueberzeugung. Ich konnte also nichts thun, als sie in ihrem Glauben zu kräftigen und vor Irrlehren zu warnen. Die Folgezeit wird lehren, wie weit ihre Erklärung mit ihrem Verhalten übereinstimmt. In liturgicis sind sie verschieden von unserer Kirche, und ihr ritus paßt nicht für unsere Kirche; die Trennung ist betrübt. Ich hasse den Indifferentismus, aber feinde fremde Religionsverwandte nicht an, sondern halte es für meine Pflicht, in meinem Verhalten gegen alle Menschen Liebe und Wahrheit zu beweisen. Der Herr, unser Gott, kennt die Seinen. Die verschiedenen Einsichten zeugen von unserer Unvollkommenheit. In Christo Jesu gilt nichts als eine neue Creatur, und wie Viele nach der regula einhergehen, über die ist Friede. In Christo ist Wahrheit. Was den Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Der Herr vermehre allzeit die Zahl seiner wahren Bekenner! Diese Sehnsucht ist ein Feuer in meiner Seele, welches Tag und Nacht brennt, und das Seufzen in mir erweckt: "Ach Vater, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe!" -
Auf den Herzog Friedrich hatte der Brief keine Einwirkung; dieser blieb dabei, daß die Lehre der Herrnhuter unterdrückt werden müsse. Er befahl den Predigern, auf die Lehrer ein scharfes Auge zu haben, auf die in den Gemeinden verbreiteten Bücher zu vigiliren und Alle, die zu der Lehre Zinzendorfs und seinesgleichen sich bekennten, dem Fiscal anzuzeigen. Auch auf den Synoden wurde viel über die "böse Irrlehre" geklagt und das Vorkommen derselben in allen Sprengeln des Landes constatirt. Selbst Prediger kamen deswegen in Untersuchung, zwei wurden, weil sie sich "zum Herrnhutianismus" bekannten, abgesetzt. So wurde die neue Lehre in Meklenburg verfolgt; dennoch that sie dem kirchlichen Leben im Volke vielen Schaden.
Auch an andern "Schwärmereien" fehlte es derzeit in Meklenburg nicht, und es waren nicht Alle so thöricht, ihre Angriffe gegen die Kirche und ihre Gnadenmittel offen hervorzukehren und dadurch ihr unvermeidliches Loos über sich herbeizuziehen; sondern manche von diesen neuen Propheten und überspannten Narren waren so schlau, unter dem Deckmantel der Pietisterei sich bei diesem oder jenem Hofprediger einzuschmeicheln; selbst bis an den Thron wagten sie sich vor. Das merkwürdigste Beispiel bot wohl ein gewisser Henning in Sternberg, ein "Erzschelm", der, aus Altona ausgewiesen, in Meklenburg, ich weiß nicht wie, sich die Gunst des Herzogs erworben hatte. Schon nach Kurzem hatte er durch seine Geisterseherei unter den Spiritisten ein gewisses Ansehen gewonnen, und Sternberg erschien ihm wohl wegen der Nähe des im Pie=


|
Seite 266 |




|
tismus damals am weitesten rechts stehenden Superintendenten Friederich, der geeignetste Ort für seine Wirksamkeit. Sobald er die Erlaubniß bekommen hatte, sich hier niederzulassen, begann er die Prediger des Landes insgesammt Lügner und Werkzeuge des Teufels, Brotknechte und Judasse zu schimpfen, auch in Schriften wahrhaft gottlose Prophezeihungen von dem nahen Blutgerichte über alle Baalsknechte zu verbreiten. Vergebens beklagte sich der Pastor Kaysel in Sternberg bei seinem Superintendenten. daß die ganze Gemeinde, besonders aber das Landvolk, welches in seinem Hang zum Aberglauben den Inspirationen des dreisten Menschen Glauben schenke, ihm rebellisch werde; vergebens wies er auf die Gefahr hin, welche die lockende Irrlehre von der Gleichheit und Freiheit für die Ruhe des Bauernstandes habe: der Superintendent erklärte Henning für einen Schwachkopf, der den Leuten nur zum Spotte diene. Als aber die Bewegung lebendiger wurde und sich über das ganze Land ausbreitete, mußte das Consistorium einschreiten, und da fand sich, daß die Schriften des "Schwachkopfs" bereits überall im Lande bekannt waren. Der weiteren Verfolgung entzog sich der verruchte Schelm, nicht ohne noch das Consistorium in gemeiner Weise zu verhöhnen, durch die Flucht (1782).
Aehnliche, wenn auch nicht so schlau angelegte, bösgesinnte Versuche, die Leidenschaften aufzuwiegeln, kamen häufig vor und fanden durchweg günstigen Boden. Denn wie Luthers Predigt von der Freiheit des Christenmenschen vormals in den Bauern verkehrte Vorstellungen erweckt hatte, so hörte auch der gedrückte Bauer in Meklenburg gern jede Stimme, die seine nahe Erlösung in dem neuen Zion ihm predigte. Von all dem andern Kram der Schwarmgeister verstand der Bauer nichts; wer ihm aber von seiner Befreiung redete, den hielt er für einen Himmelsboten und glaubte gern an die Inspirationen. Es konnte nicht anders sein: wenn er die lockenden Versprechungen dieser "Zionswächter" mit der Predigt vom Gehorsam gegen die Obrigkeit verglich, so mußte ihm scheinen, daß die Kirche ihm Steine statt Brot reichte! Um so schärfer mußte daher auch das Verfahren gegen diese Verführer sein, die das arme Volk zur Empörung reizten. Der Herzog machte mit ihnen kurzen Proceß: er ließ sie mit Schimpf aus dem Lande jagen. Aber trotz der Wachsamkeit der Beamten gelang es nur selten, einen dieser schlauen Gesellen festzukriegen: nur an dem treffenden Gift merkte man die geheime Wühlerei.


|
Seite 267 |




|
D. Die Juden.
Das Land Meklenburg mit seiner vorwiegend ackerbauenden, der Industrie abgewandten Bevölkerung ist niemals ein Eldorado für die Juden gewesen; was sich hier niedergelassen, hat sich zumeist kümmerlich vom Schacher und Trödel ernähren müssen. Wem es aber von ihnen gelang, wohlhabend zu werden, der zog, wie es noch heute zu sein pflegt, nach Hamburg, wo sich mit dem Capital besser arbeiten läßt. Trotz dieser gedrückten Lage der Juden hat auch Meklenburg seine "Judenhetzen" gehabt, ja sogar Zeiträume, wo ihnen im Lande zu wohnen verboten war. Die Stadt Rostock hat erst in neuester Zeit sie aufgenommen. Von denen, welche unter Herzog Friedrich in Wort und Schrift "die Austreibung der verworfenen Rotte" (!) betrieben, "weil dieselbe der Predigt des Heils nicht anders als in der höchsten Noth ihre Ohren öffne", war der heftigste der Professor Tychsen zu Bützow, der seinen früheren Beruf eines Kallenbergschen Missionars nicht vergessen konnte. Er fand damit aber beim Herzog Friedrich schlechte Aufnahme; denn wenn dessen hoher christ=fürstlicher Sinn auch die Mission unter dem armen blinden Volke in jeder Weise förderte und für die Arbeit an irrenden Seelen immer eine offene Hand hatte, so war ihm doch alle Anwendung von Gewalt verhaßt. Wie er darüber dachte, bewies er einmal gelegentlich, als Tychsen seine von bitterm Haß erfüllte "Geschichte der Judenschaft in Meklenburg" in den vielgelesenen Schweriner Blättern zu veröffentlichen unternahm: er verbot nicht allein die Fortsetzung aufs Strengste, sondern gab der beleidigten Judenschaft auch die Genugthuung, daß er solche dem christlichen Geiste widersprechende und das Interesse des Staats gefährdende Angriffe auf die jüdische Religion überhaupt in seinem Lande nicht dulden zu wollen erklärte. Tychsen mußte sich daher begnügen, seine Arbeit in den "Bützower Nebenstunden" herauszugeben. Einen andern Beweis seiner Gnade gab der hochgesinnte Fürst im Jahre 1774, als er der Schweriner Judenschaft erlaubte eine Synagoge zu bauen; denn er hielt dafür, daß es eine grausame Bedrückung sei, "dem fremden Volke", welches sich unter seinen Schutz begeben hätte, in der Ausübung seines Gottesdienstes auch nur hinderlich zu sein. Wo aber immer die Juden durch Processionen oder auf andere Weise den Christen ein öffentliches Aergerniß gaben, da verwies er ihnen solche Anmaßung aufs Ernsteste.
Die Zahl der Schutzjuden=Familien in den meklenburgischen Städten betrug damals etwa 300; es waren meist fleißige Leute,


|
Seite 268 |




|
welche dafür angesehen wurden, daß sie viel Geld in das arme Land brächten. Es gab allerdings aber auch sehr viele unter ihnen, welche entweder als Trödler das ganze Land durchzogen und den Kaufleuten in den Städten die Kundschaft wegnahmen, oder durch Pfand= und Wuchergeschäfte auf unehrliche Weise schnellerem Reichthum nachjagten und dadurch scharfe herzogliche Edicte wider solche Plage nöthig machten.
Wollten wir die Gegensätze der Ansichten über die Juden in zwei Männern der damaligen Zeit darstellen, so müßten wir Tychsen Reinhard gegenüberstellen: während jener, noch ganz von dem finstern Geist der fanatischen Verfolgungssucht beseelt, als das Heil der Staaten die Austreibung oder gewaltsame Bekehrung der Juden ansah, sah dieser in den Juden zunächst irrende Menschen, mit deren Blindheit man Mitleid haben müsse, die man aber doch, wenn sie echte Kinder Abrahams seien, hoch achten könne. Und andererseits als Bürger wollte er sie den Christen gleichgestellt wissen und billigte darum nicht, daß sie zu einer besonderen, der s. g. Judensteuer verpflichtet würden. Denn in einem wirthschaftlich so tief heruntergekommenen Staate, wie in dem damaligen Meklenburg, wären trotz allem Schaden, den ihre Sucht nach Reichthum anstiftete, die Juden mit ihrem Unternehmungsgeist als Förderer des Handels und Verkehrs ein unersetzlicher Gewinn. Der Herzog stand zwischen beiden: er erkannte den Nutzen des jüdischen Handels an, aber die Religion der Juden schien ihm jede Concession an bürgerlichen Rechten zu verbieten.
Zweiter Theil. Das Schulwesen.
Die Bemühungen des Herzogs Friedrich um die Hebung der einer Reform sehr bedürftigen höheren Schulen seines Landes lasse ich hier unberührt; im Ganzen kümmerte er sich nicht viel um dieselben. Sein Ideal waren die damaligen Gymnasien nicht: der christliche Geist schien ihm in denselben nicht genug gepflegt, und das praktische Leben nicht genug berücksichtigt zu werden. Ich habe in meiner Arbeit über das nach dem Muster der Halle'schen und der Berliner Realschule eingerichtete herzogliche Pädagogium zu Bützow neben den Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts, wie sie dem Wunsche des Fürsten entsprachen, auch den Kampf des Realismus gegen den Nominalismus, der die damalige Zeit


|
Seite 269 |




|
nicht minder als die heutige bewegte, darzustellen gesucht. Vgl. das Programm der Bützower Realschule I. O. 1881.
Die ganze Aufmerksamkeit des Herzogs war auf die Reformation des niederen Schulwesens gerichtet; denn alle Arbeit der Kirche an den Gemeinden war verloren, wenn die Jugend nicht in Gottes Wort sorgfältig unterrichtet und zu frommer Sitte erzogen wurde. Mit dem Schulwesen sah es aber trostlos aus.
Nach der Superintendenten=Ordnung von 1570 war es den Pastoren überlassen, geeignete, vom Superintendenten geprüfte Subjecte als Küster anzunehmen, jedoch vorausgesetzt, daß "die Personen nicht dem Patrone entgegen seien." Die revidirte Kirchen=Ordnung von 1650 machte zur Aufgabe der Synoden, über das Schulwesen zu berathen und zu berichten, wie weit auch auf dem Lande die Schulen ihrer Aufgabe des Unterrichts im Katechismus, in Gebeten, im Lesen und Schreiben, resp. Nähen genügten. In der VO. von 1694, wo aufs Neue allen Schulen zur Pflicht gemacht wurde, neben den andern Gegenstünden besonders den Katechismus fleißig zu tractiren, ist vom Schreiben nicht mehr die Rede: nur Lesen, Gebete, Sprüche, Psalmen und Gesänge werden hier angeführt.
Auch in dem LGG. Erbvergleich von 1755 wurde an alle dem, was Observanz war, nichts geändert: in der Ritterschaft stellte der Patron in Uebereinstimmung mit dem Prediger den Lehrer an, in den Städten der Magistrat, "sofern er die Schulen unterhält", "jedoch dem Landesherrn an dero Ober=Inspection unschädlich", und endlich im Domanium der Herzog. Jedoch wurde 1755 hinzugefügt: daß ohne Beibringung guter Zeugnisse fortan kein Schulmeister mehr, weder im Ritterschaftlichen, noch im Landschaftlichen, noch überhaupt mehr angenommen werden solle. An dem Recht der Gutsobrigkeit, unter Zuziehung des Predigers den Dorfschulmeister unter beliebigen Bedingungen anzustellen, sowie an der Jurisdiction über denselben wurde nichts geändert. Den Predigern wurde aber von Neuem eingeschärft, daß es ihre Pflicht sei, die Schulen in ihren Gemeinden, sowohl auf dem Lande als in den Städten, fleißig zu besuchen und den Schulmeistern Anleitung zu geben, auch von Zeit zu Zeit zu examiniren, wie weit die Kinder von dem Unterrichte ihres Schulmeisters profitirten.
So fehlte es also dem Herzog Friedrich nicht an Handhaben, eine gründliche Besserung des Schulwesens herbeizuführen, und er war entschlossen, das, was die Herzogin Augusta zu großem Segen in ihrem beschränkten Kreise begonnen hatte, auf das ganze Land zu übertragen. Der 1756 eingeforderte Bericht über den Stand


|
Seite 270 |




|
des Schulwesens konnte nicht trauriger lauten: nirgends war geregelter Schulbesuch, die Kinder lungerten umher, die Schulmeister verhungerten, die Geistlichkeit kümmerte sich nicht um die Schulen u. s. w. Von den Superintendenten war der einzige, welcher den Muth hatte für eine energische Aenderung des Unwesens einzutreten, Quistorp in Rostock. Er faßte die Sache am rechten Ende: die Besserung der Noth hänge ganz von der Besserung der Lage der Lehrer ab, denen man bei der jämmerlichen Einnahme nicht zumuthen könnte das Schulhalten als ihren Beruf anzusehen. So lange nur kranke und zu sonst nichts mehr nütze Subjecte Schulmeister seien, so lange sei jede Hoffnung umsonst. Als Zweites sei erforderlich die Einführung der allgemeinen Schulpflicht für alle Kinder vom 6. Jahre an und Bestrafung der säumigen Eltern, wobei es sich empfehle, zugleich alle Klipp=, Neben= oder Candidaten=Schulen aufzuheben, weil dadurch den schlechten Eltern die Möglichkeit genommen werde, der Staatsaufsicht sich zu entziehen. Wenn die Lehrer besser gestellt wären, die Prediger sich der Schulen mit Wärme annähmen, auch statt des Nachmittags=Gottesdienstes an den Sonntagen fleißig den Katechismus übten, und die Eltern mit Strenge angehalten würden ihre Kinder zur Schule zu schicken: so könnte der reichste Segen dem Lande nicht fehlen.
Der Herzog ging sofort mit Eifer an die Ausführung dieser vortrefflichen Rathschläge. Am 13. December 1756 führte er den allgemeinen Schulzwang ein und verbot den Predigern und Beamten hinfort noch ohne allerh. Befehl einen Küster oder Schulmeister anzunehmen. Im folgenden Jahre wurde der Befehl, da er meist unbeachtet gelassen war, wiederholt und dahin erweitert, daß die Beamten unnachsichtlich mit Strafen die Eltern zwingen sollten, ihre Kinder vom 6. Jahre an nicht bloß im Winter, sondern auch im Sommer zur Schule zu schicken.
Aber dieser Maßregel widersetzte sich Alles: die Schulmeister erklärten sich außer Stande im Sommer Schule zu halten, da sie ihre Felder bestellen müßten, die Einlieger verweigerten den Gehorsam, weil ihre Kinder im Sommer Hofdienst hätten, die Hauswirthe gaben an, ihre Kinder zum Hüten gebrauchen zu müssen. Auch Superintendent Quistorp konnte nur rathen, die Sommerschulen nicht obligatorisch zu machen, dafür aber auf den regelmäßigen Winterbesuch um so strenger zu halten.
Die Art des Herzogs war aber nicht, nachzugeben, wenn er Etwas für nothwendig erkannt hatte. Nur das zunehmende Kriegsgedränge verhinderte ihn, seinen Befehlen sofort Achtung zu


|
Seite 271 |




|
verschaffen. Aber selbst in dieser Zeit der Noth unterließ er nicht, wiederholt die Beamten zu ermahnen, für Herstellung eines bessern Schulwesens zu sorgen und vor der Einsetzung untüchtiger Subjecte zu warnen. Dem Schloßschulhalter Wegener in Schwerin gab er auf, für die noch untüchtigen Subjecte, die sich zum Dienst meldeten, eine Vorbildungsschule einzurichten. Die Schulordnungen der Stadt Bützow (1760) und der Stadt Neustadt (1763) lehren, wie ernst sich der Herzog auch in dem Kriegsgedränge mit dem Schulwesen und seiner Reorganisation beschäftigte. Die Grundzüge alles dessen, was später der Herzog durchführte, liegen hier schon klar vor:
"Alle Kinder vom 5. Jahre an sind schulpflichtig und haben nicht allein im Winter von Martini bis Ostern, sondern auch so viel als möglich im Sommer die Schule zu besuchen. Der Unterricht soll täglich außer Sonnabend=Nachmittags und Sonntags in 3 Stunden Vormittags und 3 Stunden Nachmittags ertheilt werden, außerdem aber die Kinder, welche sich vorbereiten zum Tische des Herrn zu gehen, in 1 bis 2 Abendstunden besondern Unterricht empfangen. Während des Schulhaltens ist dem Lehrer bei 1 Thlr. Strafe verboten andere Arbeit zu betreiben oder gar die Kinder zu seinen Haus= und Feldgeschäften zu verwenden. Für den Unterricht empfängt der Schulmeister von jedem Kinde seinen Lohn, den die Obrigkeit für ihn einzieht. Bei Strafe von 2 Thlrn. hat der Schulmeister genaue Versäumnißlisten zu führen und dieselben quartaliter an die Obrigkeit abzuliefern, die ihrerseits für jede leichtfertig versäumte Schulwoche von den Eltern 8 ßl. Strafgeld einzieht."
Am 3. Juli 1763 wurde das meklenburgische Dankfest wegen des beendigten Krieges, der so schwere, schwere Wunden geschlagen hatte, gefeiert: da war nach sieben Jahren endlich die Zeit eines gesegneten friedlichen Regiments gekommen. Aber noch vergingen drei Jahre, bis das Land sich so weit erholt hatte, daß der Herzog glaubte, mit Nachdruck in der Herstellung eines geordneten Schulwesens vorgehen zu können. Er hatte inzwischen eingesehen, daß eine solche Reform ebensowohl große Opfer forderte, die er den Gemeinden allein nicht auferlegen konnte, als sie tief in das Leben der unteren Volksclassen eingriff und Rechte und Einrichtungen berührte, an deren Bestande die Ritterschaft ein besonderes Interesse hatte. So schlug der Herzog den alten Weg allmählichen Gewinnens ein: 1767 wurden alle Nebenschulen, welches Namens auch immer, aufgehoben. "weil sie theils den Schulmeistern ihren Lohn verringerten, theils von solchen Subjecten gehalten würden,


|
Seite 272 |




|
die den Bauern in Allem zu Willen wären." Solcher Klipp= oder Winkelschulen gab es aber eine große Menge: nicht bloß in den Städten, wo den alten Candidaten, die nichts mehr hofften, sondern allein um des Hungers Willen Unterricht ertheilten, die ganze Menge der zuchtlosen Jugend zuströmte, sondern auch auf dem Lande; selbst in den kleinsten Dörfern waren Neben=Schulhalter, welche um so größeren Zulaufs sich erfreuten, je nachsichtiger sie waren. Zu dem guten Schulmeister, der Zucht und Ordnung hielt, gingen immer nur wenige Kinder. Das wurde nun mit einem Male anders: trotz Bitten und Vorstellungen wußten alle Schulhalter, welche nicht rechtmäßig angestellt waren, ihre "Stuben" schließen und einem Gewerbe entsagen, welches sie den Dorfschaften zu Willen, aber dem Staate zum Schaden ausgeübt hatten. Es wurden aber auch alle ordnungsmäßig angestellten Lehrer, welche unfähig waren, oder gegen welche die Gemeinde sonst gerechte Klagen hatte, nach und nach entfernt und durch bessere Kräfte ersetzt.
Fast gleichzeitig mit dieser Verordnung über Beseitigung der Nebenschulen erschien eine zweite, welche das Schulgeld auf jährlich 24 ßl. für jedes Kind, und 1 bis 2 ßl. wöchentlich extra für Rechnen und Schreiben festsetzte. Wer sich widerspenstig zeige, solle durch harte Leibesstrafen zur Pflicht angehalten, die etwa säumigen Schulmeister aber ohne Gnade abgesetzt werden. Obwohl die Beamten, welchen die Ausführung dieses allerh. Befehls oblag, begriffen, daß die Zeit des Abwartens und der Lindigkeit vorüber war, vermochten sie bei bestem Willen nicht durchzugreifen. Denn die Lehrer konnten von dem Schullohn allein nicht leben, und es war von ihnen nicht zu verlangen, daß sie ihre Hauptbeschäftigung, das Handwerk, welches sie betrieben, nun als Nebensache betrachteten; dazu fehlte es noch fast überall an Schulkaten. Andererseits waren viele Eltern wirklich so arm, daß sie das Schulgeld für mehrere Kinder nicht bezahlen konnten. Die Beamten stellten daher anheim, ob es nicht möglich wäre, das Schulgeld ganz aufzuheben und die Erhaltung der Lehrer und Schulen der Renterei zu übertragen.
Dies hatte zur Folge, daß am 1. December 1768 den Aemtern befohlen wurde, die Einkünfte jedes Dorfschulmeisters genau festzustellen und Vorschläge zu machen, wie eine Verbesserung und möglichste Egalisirung aller Schulstellen herbeizuführen sei. Lange Berathungen, zu denen auch die Superintendenten herangezogen wurden, ergaben endlich als Resultat das wichtige Reglement von 18. October 1770:


|
Seite 273 |




|
Jeder Landschulmeister, Schulhalter, Organist, Küster soll mindestens haben: eine Wohnung mit Schulstube, einen Garten von 100 □ Ruthen, etwa 4 Scheffel Saatacker, eine Wiese von 2 Fudern Heu, freie Weide für 2 Kühe, 1 Kalb, 2 Schweine, 10 Schafe (ohne Weidegeld und Weidelohn), freie Feuerung, freie Mühlenfuhren. An Schullohn soll der Schulmeister erhalten bei 5 bis 20 Kindern für jedes 42 ßl., für jedes mehr 8 ßl, bei 30 bis 50 Kindern für jedes 31 1/2 ßl., für jedes über 50 8 ßl. mehr; dieser Lohn soll halb in baar, halb in Roggen, den Scheffel zu 24 ßl. (1777 zu 32 ßl.) gerechnet, vom Amte ausgezahlt werden.
Dafür hat der Schulmeister zu leisten: die Abhaltung der Winterschule von Michaelis bis Ostern in 3 Stunden Vormittags und 3 Stunden Nachmittags für alle Kinder vom 4. Jahre an (für größere Kinder vom 7. Jahre an soll im Nothfalle der Unterricht erst um Martini beginnen). Der Schulhalter hat genau und gewissenhaft, unbekümmert um den Trotz unverständiger Eltern, Versäumnißlisten zu führen und von den Strafgeldern, 1 Sechsling pro Tag, Bibeln u. a. Bücher, Rechentafeln, Papier u. a. für die armen Kinder zu kaufen. Im Sommer hat derselbe, mit Ausnahme der vier Erntewochen, wenigstens an zwei Tagen der Woche mit sämmtlichen schulpflichtigen Kindern Schule zu halten, um das Gelernte zu wiederholen und auf das öffentliche Katechismus=Examen vorzubereiten. Die Kinder, welche fertig lesen können und im Christenthum nicht ungegründet sind, sollen auch schreiben und rechnen lernen, wofür sie einen Sechsling extra die Woche bezahlen. Bei großen Classen sollen die kleinen von der Schulmeisterin oder sonst einem Verwandten des Schulmeisters, der dazu Geschick hat, gesondert unterrichtet, die großen aber nach Anleitung des Stresow'schen Handbuchs in Classen abgetheilt werden. Von dem, was durchgenommen ist, sollen Tabellen Auskunft geben, damit die Prediger bei der Inspection und Prüfung ihren Anhalt haben. Den Anweisungen und Erinnerungen der Prediger haben die Schulmeister ohne Widerrede zu folgen, wie sie denn denselben in Allem als ihren Vorgesetzten bescheiden und ehrerbietig begegnen sollen. Damit sie aber auch merken, wo es in der Religion den Kindern noch besonders fehle, sollen die Schulhalter beim Confirmations=Unterricht zugegen sein, und die Schulmeisterin während dessen Schule halten.
Die Beamten und Prediger, welche sich der Sache besonders annehmen und für die Vermehrung des Unterrichts auch in den Sommerschulen sorgen, versichert der Herzog seines landesväterlichen Höchsten Wohlwollens. -


|
Seite 274 |




|
Dieses Reglement wurde dann noch durch die Bestimmung über die Pflichten der Dorfschaft ergänzt:
Jeder Hüfner, Kossat, Büdner zahlt, er mag schulpflichtige Kinder haben oder nicht, an den Schulmeister 24 ßl. Courant und 1 Scheffel Roggen, jeder Einlieger und Hirte 36 ßl. Die Dorfschaft bestellt den Schulmeisteracker und fährt das Korn ein; was aber über 4 Scheffel Aussaat ist, soll der Schulmeister selbst bestellen. Die Schulwiese hat die Dorfschaft unentgeltlich zu werben und das Heu einzufahren. Das vom Schulzen angewiesene Brennholz wird von der Dorfschaft im Frühling geschlagen, von dem Schulmeister selbst in Faden gesetzt, aber von der Dorfschaft unentgeltlich eingefahren. Wo noch kein eignes Schulhaus, hat die Dorfschaft auf ihre Kosten eine Wohnung zu miethen, zum Neubau eines solchen werden ihr alle Materialien umsonst geliefert. Alle Leistungen, außer den Mühlenfuhren, als Lieferung von Broten, Holz, Lichtgeld, Würsten, Eiern, Geschenken u. s. w., fallen hingegen fort, und haben die Schulmeister nichts mehr zu beanspruchen.
Am 30. August 1771 trat auch dieses Reglement in Kraft. Damit war vorerst für das Domanium eine heilsame Ordnung geschaffen.
Für die Stadtschulen faßte die Regierung folgende Einrichtung ins Auge:
Das Recht, ihre Lehrer zu berufen, verbleibt den Städten; doch sollen sie, damit sie nicht unbefähigte oder unchristliche Lehrer anstellen, Serenissimum jedesmal um Confirmation unterthänigst bitten. Das Consistorium, als unmittelbare Aufsichtsbehörde eingesetzt soll jährlich berichten und die thunlichste Verbesserung der Organisation sich angelegen sein lassen. Die Obrigkeit sorgt für die Handhabung des Schulzwanges, für vollständige Trennung der deutschen und der lateinischen Schule, für Beseitigung alles Streits zwischen dem Küster, der hinfort nur die Kinder von 4 bis 9 Jahren, und dem Rector, der die Kinder vom 9. Jahre bis zur Confirmation unterrichtet. Mehr als 60 bis 80 Kinder sollen in einer Classe nicht sein; jedes Kind bezahlt vierteljährlich 16 ßl. Schulgeld. Die Hauptgegenstände des auch im Sommer fortgesetzten Unterrichts (täglich 6 Stunden) sollen sein: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen. Die Obrigkeit stellt halbjährlich unter Zuziehung der Geistlichen des Orts Examina an und berichtet über das Ergebniß an das Consistorium. Das Gehalt der Schulmeister müsse mindestens baar 80 Thlr. außer Wohnung, Feuerung, Garten und Wiese betragen, wogegen alle Natural=Hebungen weg=


|
Seite 275 |




|
fallen sollten. Die Kosten, soweit sie nicht durch das Schulgeld aufkommen, sollen durch eine Steuer (Hauscollecte) aufgebracht werden. Erwünscht sei auch, wenn die Städte dem Gedanken, für die armen Kinder besondere Freischulen einzurichten, näherträten.
Die meisten Städte verhielten sich diesen so heilsamen Plänen der Regierung gegenüber möglichst abweisend; sie thaten weder Etwas für die Aufbesserung der Schullöhne, noch für die Renovirung der meist mehr als elenden Schullocale; selbst in Bezug auf die Durchführung des Schulzwanges waren sie so lässig, daß der Herzog wiederholt eingreifen mußte. Die Folge war, daß auch der Unterricht an den städtischen Schulen bald viel schlechter war als an den Landschulen im Domanium. Klagte doch noch im Jahre 1795 eine gerechte Stimme, daß, wer von den Bürgern immer nur das Schulgeld aufbringen könne, seine Kinder lieber in die Lateinschulen schicke als in die deutschen Schulen, wo garnichts gelernt, ja sogar noch nicht für regelmäßigen Sommer=Unterricht, wie auf dem Lande, Sorge getragen würde! Indessen, es gab auch Städte, die an dem schönen Vorgang des Herzogs sich ein Beispiel nahmen und, wenn sie auch weit von den Wünschen der Regierung entfernt blieben, so doch nach Kräften für geordneten Unterricht in den niederen Schulen sorgten. Im Ganzen aber waren die städtischen Schulen nicht auf der Höhe der ländlichen, und die Schulmeister selbst zogen den herzoglichen Dienst weit vor. Beispiels halber sei nur erwähnt, daß in Neustadt im Jahre 1826 noch kein Rechenunterricht an der Stadtschule ertheilt wurde.
Auch die Ritterschaft zeigte sich den Plänen des Herzogs betr. völlige Umgestaltung des Volksschulwesens sehr wenig geneigt. Denn als die Regierung im Jahre 1772 dem Engern Ausschuß der Ritter= und Landschaft die Proposition machte, ein gemeinsames Schullehrer=Seminar für das ganze Land einzurichten, damit hinfort nur mehr tüchtig geschulten Subjecten das Seelenheil der Kinder anvertraut würde, antwortete der Engere Ausschuß: die Stände könnten sich nicht entschließen, zu ihrem Theile zu dem Seminar beizutragen, noch viel weniger aber nur auf einem Seminar Vorgebildete als ihre Lehrer anzunehmen.
Der Herzog ließ sich aber nicht abschrecken; mit dem Hinweis auf den von der Ritterschaft bisher unerfüllt gelassenen Erbvergleich, wonach nur geprüfte Lehrer angestellt werden sollten, erinnerte er den Engern Ausschuß an seine Pflicht, für eine gründliche Verbesserung des Schulwesens einzutreten; es sei ja das von ihm Begehrte keine Machtfrage, sondern nur eine heilsame, die Ausbreitung des


|
Seite 276 |




|
Christenthums und der Frömmigkeit zum Zwecke habende Neuerung. Der Engere Ausschuß lehnte aber jede weitere Verhandlung ab. Da erfolgte der allerh. Befehl, die Frage wegen des Schulwesens und der Einrichtung eines Seminars den versammelten Ständen vorzulegen. Der Engere Ausschuß protestirte gegen solchen Zwang: Die Lehrer stünden unter dem Willen ihrer Gutsherren, die schon selbst, soweit es die Umstände erlaubten, für guten Unterricht Sorge trügen. Besonders die Sommerschulen seien unnütz und nicht einführbar, weil die Kinder bis Martini hüten müßten. Die Gutsherrschaft verschaffe ihren unterthänigen Kindern freien Unterricht in der Gottesfurcht, damit die Eltern aus Armuth oder Sparsamkeit sie zur Schule zu schicken nicht abgehalten werden möchten, und nach dem Verhältniß der damit für den Schullehrer verknüpften Arbeit werde derselbe hinlänglich salarirt. Der Bauersmann frage nicht darnach, ob sein Kind auch im Schreiben und Rechnen unterrichtet werde, die Gutsherrschaft aber habe nur Schaden davon. Für die in den Gütern wohnenden freien Leute habe die Gutsherrschaft keine Verbindlichkeit und wolle auch nicht, daß um 1 ßl. Lohn ihre Lehrer gezwungen würden, 1 bis 3 Kinder im Rechnen oder Schreiben zu unterrichten, wo sie mit ihrer Arbeit viel mehr verdienen könnten; sie habe keinen Nutzen davon, ob der Sohn des Schäfers oder Holländers schreiben lerne oder nicht.
Darauf erwiderte der Herzog am 9. Juni 1774: Es sei eine Anmaßung, wo es sich um nichts als um Aufbesserung des allgemeinen Schulwesens handele, von wohl erworbenen Rechten zu reden. Nicht darauf komme es an, ob die Schulmeister noch ferner unter der Gutsobrigkeit stehen sollten, sondern nur darauf, sie besser zu besolden, damit sie ihr Amt nicht als Nebenwerk betrieben, und überhaupt tüchtige Subjecte gefunden werden könnten. Dafür zu sorgen sei seine landesherrliche Pflicht.
Der Engere Ausschuß entgegnete: In §. 199 des LGG. Erbvergleichs sei ausgemacht, daß der Ritter= und Landschaft ohne ihre Zustimmung nichts Neuerliches auferlegt werden solle; als solches müsse er aber die neuerliche VO. vom 31. December 1773 ansehen, worin der Herzog einseitig das für seine Domanialschulen erlassene Reglement vom 18. October 1770, wenn auch mit Weglassung der Gehaltsbestimmungen, als für das ganze Land bindend publicirt habe; er müsse unterthänigst um Aufhebung desselben bitten. Denn wenn der Prediger das Recht habe, einen zum Unterrichten auch im Rechnen und Schreiben befähigten Schulhalter von der Gutsobrigkeit zu fordern, so folge daraus, daß ein


|
Seite 277 |




|
anderer, sonst in der Gottesfurcht und Lehre des Heiligen Worts genugsam geübter und mit Segen lehrender Handwerksmann, der sich außerhalb der Schulzeit sehr nützlich beschäftige und sich ein bequemes Auskommen verschaffe, bloß deswegen, weil er im Schreiben und Rechnen ungeübt, oder sich vielleicht sonst nicht der Nebenabsicht des Geistlichen gemäß zu betragen wisse, seinen Platz aufgeben müsse, um ihn einem wahren Müssiggänger, den die Gutsherrschaft mit doppelten Kosten und mit ihrer so viel größeren Beschwerde unterhalten müsse, zu überlassen, nur deswegen, weil ein im Rechnen und Schreiben geübter Mann gefordert würde. Und alles dieses würde doch nur um des bald hier, bald dort sich aufhaltenden freien Mannes willen übernommen werden; denn der Unterthan dürfe nicht schreiben noch rechnen lernen, das sei gegen seine Bestimmung. -
So war demnach die Ritterschaft für die guten Absichten des Landesfürsten nicht zu gewinnen. Fortgesetzte Verhandlungen und Ermahnungen hatten aber doch den einen Erfolg, daß im Jahre 1782 die Ritterschaft einwilligte, versuchsweise für die nächsten zwanzig Jahre keine anderen als von den Superintendenten geprüfte Subjecte anzustellen; doch sollte dies ohne rückwirkende Kraft auf die bereits berufenen Schulmeister gelten und ohne allen Einfluß auf die anderen constitutionsmäßigen Rechte der Herren über ihre Schulmeister bleiben.
Wenn aber die Ritterschaft dem Herzoge gegenüber sich darauf berief, daß kein Grund zu einer Aenderung des Bestehenden vorliege, da Alles in bester Ordnung sei, so lehrten die Synodalberichte der Prediger das Gegentheil. Die Schulmeister waren meist ganz untaugliche Subjecte, entweder Guts=Handwerksleute, die sonst nichts mehr leisteten, oder altersschwache Bedienten, von denen man nichts "prätendiren" könnte, sondern froh sein müßte, wenn die Frau sich der Jugend annähme. Schulkaten gab es fast nirgends, sondern der Unterricht wurde in der Wohnstube in Gegenwart der Frau und Kinder ertheilt. An Schulzwang wurde garnicht gedacht, noch weniger an die "verwerflichen" Sommerschulen; der Unterricht begann um Martini und endigte vier Wochen vor Ostern. "Was hilft aber das Lamentiren?" heißt es in einem solchen Bericht. "Und wenn ein Engel vom Himmel käme, so blieben diese Herren doch taub, die von Bildung und Unterricht ihrer Jugend nichts wissen wollen." Und in einem andern Bericht: "Wenn alle Begüterten, welche Leibeigenen zu befehlen haben, dem preiswürdigen Beispiel unsers Landesvaters folgten, so würden wir Schulen haben, wie sie in Sachsen sind. so lange aber der mo=


|
Seite 278 |




|
ralische Charakter mancher Gutsherren, ingleichen die politische Verfassung und ökonomische Einrichtung unsers lieben Vaterlandes hin und her viele Hindernisse bieten, kann man weiter nichts thun, als die Hindernisse sich vor Augen klar zu halten. Und diese bestehen: 1) in dem Mangel an Schulhäusern, 2) an guten Schulmeistern, 3) in dem Unverstand und der Lieblosigkeit der Eltern, 4) in den schweren Hofdiensten, 5) in den Maximen der Gutsherren die Leute in Unwissenheit zu erhalten, 6) in der Gewohnheit, die Kinder hüten zu lassen, 7) in dem Mangel einer gesetzlichen Ordnung, 8) in dem Mangel der Aufsicht, da die Geistlichen keine Auctorität haben, und endlich 9) in der ganz unzulänglichen Besoldung der Schulmeister." Ohne gesetzliche Regelung mit der Ritter= und Landschaft sei nichts zu erreichen. -
Blieb nun auch der Wunsch des Herzogs, das Schulwesen des ganzen Landes einheitlich zu ordnen und zu verbessern, unerfüllt, weil die Ritter= und Landschaft, sei es aus Mißtrauen gegen die Reform, mit welcher der Fürst andere als bloß geistliche Zwecke zu verfolgen schien, sei es aus Unverstand widerstrebte, so war doch das, was der Herzog erreichte, auch allein des höchsten Lobes werth und leuchtet herrlich in dem Kranze seines unvergänglichen Ruhmes.
Seit 1763 war sein Lehrer mehr im Domanium angestellt worden, welcher sich nicht in einem Examen als tauglich zu dem Amte ausgewiesen hätte; die trägen, schlechten oder sonst unbrauchbaren waren allmählich beseitigt. Die Sorge um das tägliche Hungerbrot hatte aufgehört; ja in manchen Dörfern standen sich die Schulmeister, besonders wenn sie zugleich Küster waren, so gut, daß manche Prediger sie beneideten.
Die Rückwirkung davon war, daß die Schulmeister ihrerseits mit Eifer auf die allerh. Intentionen eingingen und ihr Amt, das sie bisher als Noth= und Nebensache angesehen hatten, mit Treue verwalteten. Bei dem großen Andrang von Bewerbern um die vielbegehrten Schulhalterstellen verschwand bald der alte Stamm der unfähigen Subjecte, und die neue Generation machte mit den erhöhten Ansprüchen erhöhte Anforderungen, kaum mit dem zufrieden, was der Herzog ihr zugebilligt hatte. Das Wort von der Gleichheit der Schulstellen erregte vielen Neid; denn was der eine mehr hatte oder zu haben schien, sei es, weil der Acker besser war, sei es, weil sonst die Stelle mehr eintrug, das wollte der andere auch haben und suchte es, wenn die Kammer nicht darauf einging, von der Dorfschaft zu bekommen; gar mancher


|
Seite 279 |




|
wußte die alten schönen Lieferungen an Wurst und Eiern als freiwillige Gaben sich zu bewahren. Denn auch die Dorfschaften verschlossen sich nicht vor der Einsicht, daß ein guter Schulmeister der Jugend ebenso großen Segen als ein schlechter Unsegen brächte; und gab es auch vielen Streit, so waren doch die neuen Schulhalter wichtige und in der Dorfschaft viel geltende Personen, die an Ansehen dem Pastor gleichzukommen sich bemühten.
Wie viel anders es seit dem Jahre 1768, wo die Reform des Schulwesens begonnen hatte, mit den Schulen im Domanium geworden war, lehren am deutlichsten die Synodalberichte aus den Jahren 1783 und 1784. Die Klage über den Widerstand und unverständigen Trotz der Dörfer ist verstummt; es fehlt zwar nicht an kleinen Leuten, welche am liebsten ihre Kinder in der alten Dummheit großgezogen hätten, aber der Geist ist anders geworden. Seitdem die Dorfschaften erkannt haben, wie großer Segen der Jugend aus dem treuen und geschickten Unterricht der neuen Schulmeister erwächst, streben sie selbst darnach, die alten unfähigen Schulhalter loszuwerden. Der Bauer gewöhnt sich langsam an neue Einrichtungen und fügt sich nur dem Zwang; aber wenn er erst zur Einsicht des eignen Vortheils dabei gekommen ist, so erwärmt er sich auch leicht für die früher gehaßte Sache und bringt freiwillige Opfer. Man darf vielleicht sagen, wenn man diesen Synodalberichten glaubt, daß der Eifer der Dorfleute größer war als der Eifer der Lehrer, die besonders den Sommer=Unterricht als eine große Last betrachteten und denselben über zwei Tage der Woche hinaus auszudehnen sich nur schwer entschlossen; aber in dieser Beschränkung war der Sommerunterricht auch beinahe im ganzen Domanium durchgeführt. Auch gab es nur sehr wenige Dörfer mehr, welche nicht einen eignen "Schulkaten" hatten; beispielsweise war in der ganzen Präpositur Hagenow, einer der am wenigsten gesegneten des Landes, nur ein einziger solcher Ort mehr da.
Das Verdienst, durch energische Einwirkung auf die Beamten binnen verhältnißmäßig so wenigen Jahren so Großes vollendet zu haben, gebührte nächst dem Herzog dem Rentmeister Kychenthal, welcher ohne Bedenken, wie viel Schwierigkeiten sich auch oft aus der Finanznoth des Landes und dem Widerspruche der Forstbeamten drohend erhoben, doch alle gerechten Ansprüche zu erfüllen immer bereit war; und was besonders hoch zu schätzen ist, er handelte so, nicht um dem Wunsch seines Landesherrn zu dienen, sondern aus eignem warmem Interesse an einer Sache,


|
Seite 280 |




|
deren unberechenbaren Segen für das ganze Land er erkannte. Bei ihm vor Allen hatten sich die Schulmeister für die Besserung ihrer Lage zu bedanken; er blieb trotz aller Anfeindungen der Sache, von denen sich auch viele Prediger nicht frei zu halten vermochten, bei seinem Grundsatze feststehen, daß nur sorgenfreie Stellung die Schulmeister zu treuer Arbeit führe und sie verantwortlich mache. Mit seinem Lieblingsgedanken, daß auch die Prediger an dem Unterricht sich betheiligen müßten, vermochte er allerdings nicht durchzubringen; und wie ich meine, nicht zum Schaden der Schulen. Denn bereits begannen die Prediger nicht mehr so sehr über die Unwissenheit der ihnen unterstellten Lehrer zu klagen, als über deren Dünkel, der sie aufblähe und des Herzens Demuth ihnen raube; sie seien ungehorsam und widerspenstig und wollten sich nichts mehr sagen lassen, obgleich sie doch hinter ihrem Hochmuth die Rohheit der Seele nur schlecht zu verbergen wüßten. Diese Aufgeblasenheit bewirke auch, daß sie gern mit den Sektirern, vor allen den Herrenhutern, gemeine Sache machten, in der Absicht, dadurch sich den Schein zu geben, als ob sie auch Etwas von der Theologie verstünden. Solche in den Synodalberichten immer allgemeiner werdenden Klagen veranlaßten den Herzog im Jahre 1784 nicht allein zu dem Befehl an die Superintendenten, hinfort nur mehr Lehrer anzunehmen, die eine wahre Sinnesänderung erfahren hätten und solches in Wandel und That bewiesen, sondern sie boten auch vornehmlich den Anlaß, mit Ernst den lang gehegten Plan der Errichtung eines Landes=Seminars in Ausführung zu bringen. Nur eine tüchtige, gesunde Schulung konnte der Ueberhebung vorbeugen. Aber man war über den Plan und das innere Leben einer solchen Anstalt damals doch noch zu wenig im Klaren, um gleich das Richtige zu treffen; die Versuche, welche gemacht wurden, scheiterten kläglich. Indessen auch das Streben, das Gute gewollt zu haben, war löblich, und der Gedanke, einmal lebendig geworden, wurde nachher zur gesegneten That. Die Anregung gegeben zu haben, bleibt ein großes Verdienst des Herzogs Friedrich.
Ich bin am Ziele meiner Betrachtungen. Da geziemt es sich denn wohl, noch einmal zurückzublicken. Wir lernten den Herzog Friedrich als einen Fürsten erkennen, dessen Leben Gott geweiht und wohlgefällig war; wir durften ihn nicht zu den Pietisten in dem Sinne rechnen, daß er den Sektirereien der Darguner gehuldigt hätte, sondern er war als Fürst ein gut lutherischer Christ, der


|
Seite 281 |




|
auch in seiner Landeskirche nicht die geringste Abweichung von dem lutherischen Bekenntniß dulden wollte; daß er im Uebrigen die Halleschen Theologen den in Rostock erzogenen vorzog, lag nicht sowohl in seiner tief wurzelnden Abneigung gegen den damaligen buchstabentodten Geist der Orthodoxie an sich, als an der in Dargun gewonnenen Ueberzeugung, daß die fremden Prediger eifriger und brennender im Dienst seien; als der Pietismus aber schlaff wurde, wandte er seine ganze Gunst den orthodoxen Leipzigern zu. Was er verlangte, war, daß die Prediger neues kräftiges Leben in die Gemeinden brächten, und seinem eignen Feuereifer im Aufbau des Reiches Gottes konnte keiner genug thun. Dem Consistorium gab er das alte Ansehen zurück und machte es zu einer mehr, als gut war, gefürchteten Disciplinar=Behörde. Als Superintendenten berief er glaubensfeste, treue Männer, die ihm nach ihrem Glauben gehorsam waren, aber auch den Muth des Widerstandes hatten, wo das Heil der Kirche ihnen von dem falschen Eifer des Fürsten gefährdet erschien. In den Synoden gab er den Präpositis das Mittel, die Gesinnungen der einzelnen Prediger genauer kennen zu lernen und dieselben mahnend und strafend auf dem rechten Wege zu erhalten. Den Predigern half er mit kräftiger Unterstützung, die Noth des langen Krieges zu überwinden; er förderte überall den Bau der Kirchen. Aber auch auf die Gemeinden übte er den möglichsten Druck aus, um sie für ein frommes Leben vorzubereiten; er hinderte Alles, was von der Einkehr abhalten konnte; er milderte die rohen Sitten, beseitigte die tiefsten Schatten des Aberglaubens und Unglaubens, und förderte neben der Sparsamkeit den Fleiß der Arbeit.
Aber nicht allein für seine Landeskirche war der Herzog ein guter Regent; ihm war jeder Glaube, der das Leben durchdrang und zu Gott führte, in seinem Lande recht, mochte das Bekenntniß sein, welches es wollte, reformirt, katholisch oder jüdisch. Nur die Sektirer und Neuerer, welche mit ihren Lehren das Volk verführten, fanden vor ihm keine Gnade; er hatte auch vor den größten Gelehrten, die freisinnig waren, keinen Respect.
Den größten Segen aber brachte die Neuordnung des Schulwesens. Zwar scheiterte sein Streben, das ganze Land für seine Pläne zu gewinnen, an dem Widerstand der Ritterschaft; doch war der glänzende Erfolg desselben im Domanium bedeutend genug, um den Herzog auch in dieser Hinsicht mit Recht den größten Wohlthäter an seinen Unterthanen zu nennen.
Bei allen Bestrebungen des frommen Fürsten insgesammt aber fanden wir, das seine Politik, wie sehr sie von subjectiven Zwecken


|
Seite 282 |




|
geleitet war, sich nimmer wider das Recht wandte. Nicht als ob seiner Seele die subjective Willkür des Pietismus fremd gewesen wäre, und er nicht Vieles in seiner Landeskirche anders gewünscht hätte! Wir sahen ja, wie leicht er sich von seinem brennenden Eifer hinreißen ließ, wie hartnäckig er z. B. die Einführung des neuen Kirchen=Gesangbuchs, "der Bibel der kleinen Leute", erzwang. Im Großen und Ganzen überwog aber den Eifer der besonnene Verstand, der lieber verzichtete auf das, was er nicht mit Recht und Willen erreichen konnte. Daher war denn auch das Werk des Fürsten an der Landeskirche mehr ein innerliches: an den äußeren Instituten hat es fast nichts geändert. Gerade diese, seine Politik in Kirchen= und Schulsachen durchdringende Gerechtigkeit ist es, welche seiner Frömmigkeit erst den hohen Werth verlieh, daß die Geschichte ihn Herzog Friedrich den Frommen genannt hat; die Gerechtigkeitsliebe ist der schönste Edelstein in seiner Krone.
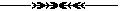


|
Seite 283 |




|



|



|
|
:
|
VIII.
Wallenstein
und
die Stadt Rostock
Ein Beitrag zur Specialgeschichte des 30jährigen Krieges.
Von
Dr.
Wilhelm Rogge
(† 31. Jan. 1882).
I. Einleitung.
I m Laufe des 15. Jahrhunderts hatte Rostocks politische Größe ihren Höhepunkt erreicht. Mit den Händeln wegen des von den Landesherren errichteten Domstifts zu St. Jacob beginnt aber die Zeit des Verfalls. Wohl war früher der aristokratische Rath mit den demokratischen Elementen der Zünfte wiederholt in erbitterte Kämpfe gerathen; doch war weder die eine noch die andere Partei völlig besiegt worden, noch hatten diese Streitigkeiten zu einer dauernden und nachdrücklichen Befestigung der landesherrlichen Macht in der Stadt geführt. Die Domhändel dagegen endeten mit einer Niederlage der Stadt. Der blutige Volksaufstand vom 16. Jan. 1487 gegen die katholische Priesterschaft, in welchem der Dompropst erschlagen wurde, war der Anfang derselben. Im Jahre 1491 endigten sie mit der Enthauptung der demokratischen Führer Hans Runge, Berend Wartenberg u. a. Die Stadt war in dem fünfjährigen Kriege materiell geschwächt worden, Rath und Bürgerschaft mußten "mit enem Knee vp de Erde rörende" vor


|
Seite 284 |




|
dem Thore den Herzogen Abbitte thun und eine Geldbuße von 21,000 Gulden erlegen. 1 )
Der Handel war die Lebensquelle der Stadt. Es gab zahlreiche Kaufmannsgilden, von denen jede ihr besonderes Gelag hatte, in welchem sie ihre Zusammenkünfte hielt: die Rigafahrergesellschaft mit dem Gelag in der Kosfelderstraße, die Wiekfahrer, die Bergenfahrer, die Schonenfahrer, deren Gelag an der Südseite der gr. Bäckerstraße lag; Flandernfahrer, Landskronafahrer, Spanienfahrer. Diese Gesellschaften bildeten zugleich kirchliche Brüderschaften. Der größte Theil war in der Marienkirche eingepfarrt, wo sie ihre besonderen Meßaltäre hatten. Rostock handelte mit Leinen, Tuch, Salz, Korn, Mehl, Hopfen, Bier, Vieh, Holz, gesalzenen Fischen, Fleisch, Eisen. Nach Schweden allein sollen jährlich 400,000 Tonnen Bier verschifft worden sein.
Aber auch der Handel, bisher durch alte und zahlreiche Privilegien der nordischen Könige geschützt, war im Abnehmen begriffen. Die neuen Bahnen, welche der Welthandel im 16. Jahrhundert einschlug, und das gleichzeitige Bemühen des europäischen Nordens, sich von der Vormundschaft der Hansa zu befreien, schädigten die Handelsinteressen der wendischen Städte. Schon 1476 war eine Zeit lang eine Accise auf das Bier der wendischen Hansa gelegt; der i. J. 1490 abgeschlossene englisch=nordische Handelsvertrag war den Interessen der Hanseaten höchst nachtheilig.
Bald erneuerten sich in Rostock die Kämpfe zwischen Rath und Bürgerschaft wegen der Theilnahme an den dänischen Reichshändeln und den dabei aufgewandten Kosten. Diese führten 1533 zu einem Siege der Demokratie, welche neue Sechsziger ernannte und die Bestätigung des großen Freiheitsbriefes vom Jahre 1428 ertrotzte. 2 ) Die folgenden Streitigkeiten in den Jahren 1557 u. 58 mit den Landesherren, welche aus Kirchenangelegenheiten entstanden, brachten neue Niederlagen, die wiederum große Geldbußen verursachten. 3 ) Und endlich führten die im Jahre 1562 ausbrechenden innern Unruhen und ein Streit mit den Landesfürsten, der hauptsächlich wegen des Antheiles der Stadt zur Abtragung der landesherrlichen Schulden entstand, außerdem aber noch die Hochschule und die Beibehaltung einer vom Rath eigenmächtig ein=


|
Seite 285 |




|
geführten Malz =Accise betraf, zum Erbvertrag von 1573. 1 ) Durch diesen ward das Verhältniß der Stadt zu den Landesherren geordnet. Hatten diese bisher, da die Stadt von ihren Vorfahren ihres Reichthums wegen durch Hoheitsrechte und Privilegien so begnadigt worden, daß sie selbst wenig in ihr zu sagen hatten, daselbst nur ein "Schattenrecht" besessen, so mußte die Stadt nun ihre "Erbunterthänigkeit", die Landeshoheit und Obergerichtsbarkeit der Herzoge anerkennen. In Folge dessen war sie verpflichtet, diesen zum Kriegsdienste 400 Mann zu stellen, außerdem zur Uebernahme öffentlicher Lasten, der allgemeinen Landhülfe nach Uebereinkunft mit der Landschaft, zum Erscheinen auf Landtagen u. s. w. Dagegen wurden von Seiten der Herzoge die Privilegien der Stadt erneuert und bestätigt.
Trotz dieser Demüthigungen war der Stolz der Bürger und das Ansehen, in welchem die Stadt bei ihren Nachbarn stand, beim Beginn des 17. Jahrhunderts immer noch bedeutend. Namentlich war es der Ruf ihrer Universität, die recht eigentlich als die Hochschule des Hansabundes angesehen werden kann, welcher um diese Zeit von Neuem ihren Ruhm über die Landesgrenzen hinaus verbreitete. Zahlreiche Lübeker und Hamburger machten ihre Studien daselbst. Aus den östlichen Gegenden, aus Stettin, Danzig und Königsberg, strömten die Studirenden herbei, um auf der Academia Rosarum ihren Studien obzuliegen. Hanseatische Gelehrte wurden in Rostock zu Professoren gewählt, während Rostocker in den Hansestädten als geachtete Prediger, Rechtsgelehrte, Aerzte und Schulmänner wirkten.
Ueber den Sittenzustand jener Zeit giebt ein Rostocker Tagebuch 2 ) von 1600 - 1625 genügenden Aufschluß. Aeußerlich präsentirte sich die Stadt nicht unansehnlich. Sie zählte vor dem 30jährigen Kriege 241 Brauhäuser, 489 große Giebelhäuser, 1296 Buden, 119 Kellerbuden, 75 Querhäuser, 80 Säle, 1082 Dönsken=(Stuben =) Keller und 324 gemeine Wohnkeller, also zusammen 2101 Häuser und Buden und 1605 Keller, Kellerbuden und Säle. Die Saalwohnungen wurden meistens von Studenten bewohnt. Die großen Brauhäuser mit ihren gothischen Giebeln befanden sich größtentheils in den nach dem Strande führenden Hauptstraßen.


|
Seite 286 |




|
In der Kosfelderstraße, wo sich allein 25 Brauhäuser befanden, lag das Wieker=Gelag der Brauercompagnie.
Rostocker Bier war in Dänemark noch immer das beliebteste Getränk bei Gastmählern; aber am 16. Februar 1621 erließ König Christian IV., um die einheimische Brauerei zu heben, eine Verordnung, durch welche ein hoher Zoll auf das Rostocker Bier gelegt wurde. Hierdurch ward Rostock viel Nahrung entzogen. Auf Anhalten der Brauer schickte der Rath am 5. Sept. den Bürgermeister Joachim Schütte und die Rathsherren Dr. Th. Lindemann und Joh. Luttermann, welche mit Fürschriften der Königin Sophia, des Bruders des Königs, Herzogs Ulrich (zu Bützow), des Herzogs Johann Albrecht und der meklenburgischen Ritterschaft versehen waren, an den König nach Kopenhagen. Sie hatten am 18. Audienz im Schlosse beim Reichsrath; aber dieser ertheilte ihnen im Namen des Königs eine abschlägige Antwort.
Nachfolgendes Verzeichniß der Stadtgüter, von Wengiersky 1628 entworfen, zeigt uns, wie bedeutend der Grundbesitz Rostocks beim Beginn des Krieges war. Aus denselben bezog es seine Einkünfte.
Bürgermeisterhöfe:
| Stove, | Sildemow. |
Stadtgüter:
|
Willershagen.
Rövershagen. Wulfshagen. Voigtshagen. Volkenshagen. Gr. Kusssewitz. Kl. Kussewitz. Alberstorf. Bentwisch. Bartelsdorf. |
Rickthal.
Kassebohm. Kessin. Hohen Schwarfs. Beselin. Ikendorf. Broderdorf. Göldenitz. Zum Hofe. |
Hospitalgüter:
| St. Georg. | Heil. Geist. |
|
Lüsewitz.
Göldenitz, Hof u. Dorf. Schlage, Dorf. Hove, Dorf. Niendorf. Dietrichshagen. Elmenhorst. Grawetop. Dalwitz, Hof u. Mühle. Dierkow. |
Barnstorf.
Bramow. Gr. Klein. Gr. Schwaß. Lütten Stove. Voigtshagen. Dierkow. Bentwisch. |


|
Seite 287 |




|
Was die Wehrverfassung der Stadt betrifft, so zählte sie um 1620 ungefähr 6000 waffenfähige Bürger. Dieselben waren jedoch nicht mehr jene abgehärteten und kriegstüchtigen Männer, welche Lanze und Armbrust ebenso gut wie Elle und Bügeleisen zu führen verstanden. Der Wohlstand und die lange Ruhe hatten friedliebende Herzen erzeugt. Die Schützengesellschaften, in denen das Waffenhandwerk fortgeübt wurde, vernachlässigte der Rath. 1607 hatten diese Gesellschaften noch keine obrigkeitliche Anerkennung gefunden und kamen deshalb schriftlich beim Rathe ein. Es heißt in der Eingabe 1 ) u. a.:
"Wir können aber E. E. u. Hochw. klagend nicht verhalten, daß uns solch für undenklichen Jahren verordnete Gewandt nun etliche Jahr nicht allein entzogen, sondern auch dasjenige, darumb wir abgelaufene etliche Jahr aus Erlaubniß E. E. Raths geschossen, aus unsrem Seckel zu bezahlen uns uffgedrungen wird. Und aber E. E. Hochw. Rath, als eine löbliche Obrigkeit, über alle wohlangeordnete Gebräuche und Zusagen festiglich zu halten und, was zu der Stadt Ehr und Ruhm gereicht, lieber zu= als abzubringen pflegen, wird vernünftiglich erachten, daß solche Uebung im Schießen, bevoraus in diesen gefährlichen Zeiten, sehr nöthig, dann auch die Bürgerschaft sich daher mit guten Büchsen versorgen und zu der Stadt bringen wird. Da auch sonsten wohl gefunden worden solche, die im Falle der Noth nicht ein Rohr abschießen konnten und so Freunde als Feinde verletzten, und solch Gewandt der Stadt zu geringem Schaden, ja vielmehr zu großem Vortheil gereicht; angesehen, da über alle gefaßte Hoffnung solch von Alters uns vermachtes Gewandt sollte entzogen werden, wir nicht allein das Schießen ganz angeben müssen, dadurch denn die Gewehr und sonderlich die Büchsen ganz von der Stadt gebracht."
Um diese Zeit bestanden 3 Schützengilden, 1) die Krämer=Compagnie, 2) die Schützencompagnie der Stadtjunker oder des Wieker=Gelages, 3) die Schützencompagnie des Wokrenter=Gelages; hierzu gehörten auch die Tuchhändler, Seiden= und Gewürzkrämer. 2 ) Im Laufe des 30jährigen Krieges wurde das Vogelschießen aber gänzlich eingestellt.
Die Unterdrückung der Protestanten in den kaiserlichen Erbländern, sowie die Grenzverletzungen der Spanier, von denen Deutschland während 30 Jahre seit den niederländischen Befreiungskriegen heimgesucht wurde, hatten in den evangelischen Ständen zwischen Rhein und Elbe die Befürchtung wachgerufen, daß das nordwestliche Deutschland zuerst dem katholischen Angriff ausgesetzt sein werde. Dies veranlaßte auch den Rath zu Rostock, mehr auf


|
Seite 288 |




|
die Vertheidigung der Stadt bedacht zu sein. Wir werden an einer andern Stelle zeigen, wie Rostock gemeinschaftlich mit den übrigen Hansestädten Ingenieure zum Bau der Festungswerke annahm. Gleichzeitig (1620) zog der Rath einen holländischen Capitain Thomas Kars in seinen Dienst, der die Bürger einexerciren sollte. Seine Vorschläge waren folgende:
Die Stadt sollte in 20 Fahnen eingetheilt werden, die vier Bürgermeister sollten als Oberste je 5 Fahnen commandiren. Die Fahne zählte 300 Mann, mit 3 Sergeanten, 6 Corporalen und 30 Gefreiten. Diese Fahnen sollten bei einer Belagerung auf die Wälle vertheilt werden, so daß der Raum von einem Rondeel zum andern mit je einer Fahne besetzt würde, ebenso die Rondeele selbst mit 1 Fahne. An schwächeren Stellen, z. B. am Zwinger, sollten 2. Fahnen placirt werden. Dagegen glaubte man den vom Wasser geschützten Strand vom Fischer= bis zum Petrithor mit 2 Fahnen vertheidigen zu können. Diese wollte der Capitain selbst commandiren. Ob man dagegen das unbewaffnete Volk an dieser Stelle, und die 2 Fähnlein sonst im Nothfall an andern Oertern aufstelle, möchte man bedenken, weil man dieselben als Reserve gebrauchen müsse. Es wäre dies auch außerdem gut, damit der Feind die Zahl der Bürger nicht in Erfahrung brächte. Aus eben den Gründen möge man die unbewaffneten Bürger bei den Stücken und Artillerie verwenden; diejenigen aber, welche noch etwas "bewehrt" seien, müßte man unter das beste Volk stecken. Zudem könne auch das unbewehrte Volk den Constablern helfen die Stücke laden und anfahren, auch Holz und Bretter herbeischaffen. Ferner sollten im Innern der Stadt auf dem Hopfenmarkt 3, auf dem Neumarkt 2 und auf dem Altmarkt 1 Fähnlein als Reserve placirt und im Nothfall auf den Wall geworfen werden. Außerdem sei ihre Verwendung bei Verrath, Feuersnoth und Aufruhr nothwendig.
Die Disciplin betreffend, so soll ein Bürger, der nicht erscheint, auf die Anzeige des Officiers, unter dessen Fahne er steht, entsprechend bestraft werden. Im Falle ein starkes Vergehen stattfindet, soll er mit einer Geldstrafe belegt werden, von der die eine Hälfte dem Armenhause, die andere den Officieren zugewiesen wird. Wenn ein Bürger den Posten verläßt, so soll der Officier ihn nach Gutdünken strafen; ist aber das Vergehen so groß, daß der betreffende Capitain allein die Sache nicht auf sich nehmen will, so soll ein Kriegsgericht gehalten werden.
Der Rath solle ferner Commissarien ernennen, die die Bürgerschaft musterten. Einige könnten das Zeughaus beaufsichtigen, einige die Lieferung von Pulver und Blei übernehmen, einige bei


|
Seite 289 |




|
der Artillerie und den Geschützen, einige bei den Batterien und Constablern die nöthigen Befehle ertheilen.
Recht ernstlich scheint man jedoch auch jetzt noch nicht zu Werke gegangen zu sein; es blieb bei Waffenvisitationen und Musterungen der Bürgerschaft. Der Capitain beschwert sich, daß er in den zwei Jahren, die er hier sei, so wenig zu thun habe, und bittet den Rath, die Augen aufzuthun, so lange es noch Zeit sei. Er trat deshalb bald darauf in Wallensteins Dienste.
Im August 1625 ist die Stadt in 18 Theile oder Fahnen mit je 1 Capitain, 1 Lieutenant, 1 Fähndrich, 1 Sergeant, 4 Corporalen und 4 Gefreiten eingetheilt werden. Sie besaß einen eignen Büchsenmeister, Schwertfeger und Harnischmacher; auch Geschützgießer wurden angenommen. Gleichzeitig warb Rostock Söldner an. Die Gelder hierzu wurden durch Contribution, s. g. Soldatengelder, beigetrieben. Bei einer solchen Werbung wurde unter Trommelschlag Folgendes öffentlich ausgerufen: "Also, liebe Soldaten, so jemand vorhanden ist, der Lust und Liebe hat der Stadt Rostock zu dienen, der wolle sich auf dem Rathhause bei der Kasten angeben, der soll gut Geld entfangen."
"Ein Anders, wann sie convociret werden:" "Also, ihr liebe Soldaten und Kriegsleute, wer der Herrn Geld entfangen hat, der soll morgen vmb 6 Uhr mit sein Vnter= vnd Obergewehr vor des Capitains Thueren sein, bei Leibes= und Lebensstrafe vnd Verlust seiner Gewehr."
Der "Aufruf zur Musterung" lautete: "Also, ihr Bürger vnd Einwohner, ein Ehrbar Rahtt lest anzeigen, das ein Jeder seine Rüstung, Wehr und Wapffen fertigk haben sol, also, wan die Trummel zum andern mahl gerühret wird, daß er zur Musterung gefaßt vnd fertig erscheinen konne, bei strafe des Raths."
Der Fahneneid wurde in Gegenwart dreier Bürgermeister und mehrerer Rathsmitglieder auf dem Rondeel vor dem Mühlenthor geleistet. Nachdem die Soldaten einen Kreis geschlossen, wurde ihnen von dem Stadtregistrator Daniel Braun der Artikelsbrief vorgelesen, worauf sie gleichzeitig den Eid ablegten. Der worthabende Bürgermeister Schütte ermahnte sie alle fleißig, Eid und Artikelsbrief zu halten, und wünschte ihnen Glück und Heil. -
Bevor die Drangsale des Krieges über Rostock hereinbrachen, wurde es durch ein anderes großes Unglück heimgesucht. Der im Jahre 1624 in der Stadt ausbrechenden Pest, in Folge deren Rostock von allem Verkehr mit den Nachbarn ausgeschlossen, und


|
Seite 290 |




|
die schon herrschende Theurung noch größer wurde, folgte am 20. und 21. Februar 1625, bei einem starken Nordost, eine Sturmfluth, deren Höhe in Warnemünde 12, und in Rostock am Mönchenthore 8 Fuß betrug. Der Schade an Schiffen, Häusern und Gärten war sehr groß; in Warnemünde allein wurden von den 150 Häusern, aus denen der Ort bestand, 74 stark beschädigt und 18 völlig von den Fluthen fortgerissen. Dies Unglück wurde von den Zeitgenossen als Strafe Gottes und als die Vorboten des herannahenden Krieges gedeutet. Die Wasserfluth war ihnen Vorbild der späteren Ueberschwemmung durch die fremden Kriegsvölker und der kommenden Verwüstung.
II. Husans Gesandtschaft.
Die Rostocker wünschten ohne Zweifel den Frieden, bei welchem der Handel blühte; das Handelsinteresse überwog den Eifer für den Protestantismus. Wie auch die meklenburgische Ritterschaft, mißbilligten sie es, daß die Herzoge Adolf Friedrich und Johann Albrecht sich dem König Christian IV. von Dänemark, als dem Kreisobersten, 1625 zur Defension des Niedersächsischen Kreises gegen Tilly anschlossen. Aus diesem Grunde wurden die 400 Mann nebst Rüstwagen und zwei Falconetlein, die Rostock erbvertragsmäßig stellen mußte, verweigert, als dieselben 1625 von den Herzogen zum Schutze der Landesgrenzen aufgeboten wurden, und erst auf Bedrohen mit dem Verlust ihrer Privilegien sandten sie dieselben unter Protest nach Grabow und Dömitz. Vergebens wurden sie im Februar 1626 ersucht, ihre Soldatesca dem König von Dänemark zu überlassen; auch auf das Ersuchen des Königs Gustav Adolf von Schweden, zum polnischen Kriege ihm geworbene Mannschaften abzustehen, gingen sie nicht ein; und nur widerwillig, in Rücksicht auf ihren Handel, gestatteten sie (den kaiserlichen Patenten entgegen) dem schwedischen Geh. Rath Ritter Rasche und dem schwedischen Commissarius Fegräus einige Monate hindurch in den Rostocker Stadtgütern ihren Laufplatz zu halten, um dort Reiter für das schwedische Heer anzuwerben. Das Ansuchen der meklenburgischen Herzoge um eine Anleihe von 6000 Rthlrn. zu Zwecken der Landesvertheidigung ward abgeschlagen; der Rath zu Rostock antwortete, "daß durch die concurrirende und fast täglich gehende Kreis=, Land= und Stadtsteuer, auch continuirliche Unterhaltung der geworbenen Soldaten und andere Ausgaben ihr Aerarium erschöpfet" sei,


|
Seite 291 |




|
Am 14. Sept. 1626 überreichte der ehemals meklenburgische, nunmehr kaiserliche Rath Edler Heinrich v. Husan, der auch die meklenburgischen Stände im Namen des Kaisers zu verwarnen hatte, daß sie sich von jeder Verbindung mit Dänemarks sogen. Kreisdefension fern hielten, dem Rath zu Rostock sein Creditiv und proponirte andern Tages mündlich und schriftlich seinen kaiserlichen Auftrag. Er ermahnte die Rostocker, sie möchten "zu keiner wiederwärtigen Verfassung, wie sie jetzt im Schwange gehe, sich begeben und einlassen, noch im wenigsten weder für sich selbst oder durch ihre Bürgerschaft und Unterthanen, es würde solches gleich unter dem Namen einer Kreisbewilligung, Landes=Defension oder anderem Schein gefordert, einige Contribution zur Continuirung dieser durch offene Mandate verbotenen Armatur nichts entrichten -, sondern in der I. Ks. Maj. und dem Reich gehörigen Devotion standhaft und rühmlich verharren - und zu I. M. als Römischem Kaiser und weltlichem Oberhaupt wirklich treten." Er warnte sie, "kein widerwärtig=verdächtiges aus= oder einländisches Kriegsvolk einzunehmen, noch in einigerlei Weise solchen, durch Dero kais. Mandata verbotenen Kriegsheeren einigen Vorschub mit Contribution, Einquartierung, Proviant, Kleidung oder Munition zu erzeigen, sondern vielmehr ihre Meerhäfen und Pässe, woran I. Ks. M. und dem Heil. Reiche hoch und viel gelegen, ihrer selbst Wohlfahrt und Freiheit zum Besten mit Gott wohl verwahren, versichern und defendiren." Dagegen verheiße der Kaiser der Stadt wie allen gehorsamen Ständen den wirksamsten Schutz. Im Uebrigen aber würde dem Kaiser jetzt um so mehr Parition zu leisten sein, "demnach die Niedersächsische Armatur sich nit weiter mit dem Mantel der Kreis=Defension bedecken lasse, sondern das Haupt derselben" (König Christian von Dänemark) "sein Fürnehmen und Intention bei der mit Engelland und Holland gemachten, auch hin und her ins H. Reich selbst publicirten hochgefährlichen Bündniß viel zu einem andern Ende zu erkennen gegeben."
Am 18. Sept. resolvirten sich hierauf Rath und Bürgerschaft schriftlich. "Gleichwie Ihrer Ks. Maj. unterthänigst zu gehorsamen und in den Schranken gemeldter Reichs=Constitution sie sich zu verhalten schuldig: als contestiren und bezeugen sie öffentlich und mit gutem Gewissen, daß ihnen niemals in ihre Gedanken gekommen, ichtes was vorsätzlich und wissentlich zu verhängen, vorzunehmen oder zuzulassen, das obbesagten kais. Patenten und Reichs=Satzung in einigen Wegen, wie es immer geschehen möchte, zuwider laufen konnte, sondern sind jederzeit in I. Ks. Maj. unterthänigster Devotion und gehorsamster Treue und was dahero


|
Seite 292 |




|
rühret und ihnen unterthänigst gebühret,
beständig und unabsetzlich verblieben. Dabei sie
auch ihrer Vorfahren rühmlichem Exempel zufolge,
so viel in ihren Mächten bestehet, ferner
unverrücket, aufrichtig und redlich zu beharren
unterthänigst entschlossen. Wollten sich demnach
vielgedachten kais. erneuerten Mandaten und
Reichs=Constitution unterthänigst gemäß
verhalten, in keine damit streitende
Kriegswerbung sich einlassen, keine
Einquartierung, so lange sie gewaltsamen Zwangs
entfreiet, verstatten, auch kein verdächtiges
Volk einnehmen, sondern sich in Allem insgemein
dergestalt, wie es getreuen, gehorsamen
Unterthanen wohl anstehet und gebühret, im Werke
bezeigen"
 .
.
Ob solcher Erklärung trug der kaiserliche Gesandte ein gutes Gefallen, und mit Genugthuung erfuhr hernach der Rostocker Rath, daß der Kaiser diese Bezeugung ihrer Unterthänigkeit gnädig aufgenommen habe. Seitdem sie solcher kaiserlichen Special=Gesandtschaft gewürdigt waren, wurden die Rostocker erst recht ungemein loyal gegen den Kaiser und bemüheten sich auf allen Land= und Hansetagen oder bei sonstigen Verhandlungen, zu denen sie zugezogen wurden, oder wo ihre Stimme Geltung hatte, ihre beharrliche Devotion in Wort und That zu beweisen und den äußersten Fleiß daran zu setzen, allen falschen Schein von sich abzuwälzen.
Als Husan Rostock besuchte, war schon der König Christian IV. von Tilly bei Lutter entscheidend geschlagen, die Dänen zogen sich im Herbst 1626 mehr und mehr auf Meklenburg zurück; und wer konnte berechnen, wann Tilly ihnen folgen würde? Das Streben der meklenburgischen Herzoge ging dahin, thunlichst beide Parteien aus ihrem Gebiete fernzuhalten; aber ihre Defensions=Absichten fanden bei ihren Ständen keinen Beifall und keine rechte Unterstützung. Die Rostocker versagten wiederum ihr Contingent, so daß Herzog Adolf Friedrich ihnen ihr Fähnlein und ihr Geschütz abnehmen und erst nach 4 Monaten (im Febr. 1627) zurückstellen ließ. Allmählich hatten die Dänen sich ganz in Meklenburg einquartiert; auch bei dem besten Willen hätten unsere Herzoge nicht die Macht gehabt, dieselben aus dem Lande zu treiben. Daß auch in ihren Stadtgütern Dänen einquartiert wurden, ließen die Rostocker sich gefallen. Denn wie eifrig sie auch dem Kaiser zugethan waren, hüteten sie sich doch wohl, ebenso wie die andern Hansestädte, mit den Dänen zu brechen. Ihre Handelspolitik erforderte Neutralität.
Bei alle dem aber war die Stimmung keine behagliche, als im Sommer 1627 der "Imperator armatus", das Kaiserthum in Waffen, nördlich der Elbe erschien, der ligistische Feldherr Tilly


|
Seite 293 |




|
am 28. Juli unweit Boizenburg die Elbe überschritt, E. Juli der Oberst Hans Georg v. Arnim als Vortrab Wallensteins das östliche Meklenburg erreichte und Wallenstein selbst von Schlesien her durch Brandenburg gleichfalls auf Meklenburg seine Richtung nahm. Der Rath zu Rostock ließ Gebete von der Kanzel verlesen, daß der allmächtige Gott das bevorstehende große Unglück von der Stadt abwenden möge.
Als Herzog Adolf Friedrich beim Anmarsch Arnims den Rostockern aufgab, ihr Contingent nach Neubrandenburg zu schicken, gehorchten sie - ihrer Politik getreu - nicht diesem Befehl. Sie sollten aber bald erfahren, wie die Kaiserlichen ihnen ihre Anhänglichkeit lohnten.
III. Rostock verweigert den Kaiserlichen Einlaß.
Die Rostocker unterließen nicht, die heranmarschirenden Oberfeldherren ihrer Loyalität zu versichern. Auf ihre Zuschrift an Tilly vom 3. Aug. 1627, worin sie baten, sie bei diesen Kriegesläuften in den kaiserlichen Schutz zu nehmen, erfolgte am 27. Aug. die Antwort, daß der Graf einstweilen noch einer schließlichen Erklärung der Herzoge von Meklenburg entgegensehe; bis dahin möchten sich die Rostocker gedulden, inzwischen aber sich jeder Correspondenz mit den Feinden des Reiches enthalten, ihnen keinerlei Hülfe oder Vorschub leisten, insonderheit ihrer "Stadt porten, Meerhafen und andere Befestigungen in behutsame, vleißige vnd sorgfältige gute Obacht nehmen."
Das war allerdings eine correcte Antwort; aber sie bedeutete eben nichts, denn Wallenstein war keineswegs gesonnen, Tilly in Meklenburg irgendwie festen Fuß fassen zu lassen. Schon am 21. Aug., aus seinem Quartier zu Cottbus, hatte der Herzog von Friedland seinem Obersten Hans Georg v. Arnim den Befehl gesandt: "Er wolle im Land zu Meckhelburg so viel, alß sich thuen lässt, örter occupiern und dieselben mit kaiserl. Volck besetzen", - "auch mit bäyden Städten, Rostock und Wißmar, tractiern und Sie ermahnen, daß Sie die Kays. genadt zeitlich suchen." 1 )
Inzwischen aber hatten die Rostocker auch schon zu Anfang des August Wallenstein ihre Devotion bezeugt in einem Schreiben, welches dem Rath v. Husan zur Beförderung übermittelt war; und sie hatten insonderheit gebeten, ihrer selbst und ihrer Dörfer in


|
Seite 294 |




|
Gnaden zu schonen, sie in kaiserliches Geleite zu nehmen, alle Kriegspressuren von ihnen abzuwenden und sie ihrer Treue genießen zu lassen. Als dann hernach der Herzog Johann Albrecht dem Herzog von Friedland eine Gesandtschaft nach Dömitz entgegensandte, gesellten sich dieser Rostocker Abgeordnete bei und brachten einen Schutzbrief von ihm heim, der viel bestimmter lautete als der Tillysche. 1 ) Ja mündlich erklärte sich Wallenstein gegen die Rostocker Deputirten sogar dahin: weil er von ihnen vernommen habe, daß die Stadt sich selbst zu vertheidigen im Stande wäre, so wolle er dieselbe mit Garnison in Gnaden gern verschonen, in Anbetracht, daß er sein Heer lieber beisammen als an viele Oerter vertheilt haben möchte.
Das war ja allerdings eine Erklärung, die sehr tröstlich klang. Aber was war sie werth? Wallenstein eilte am nächsten Tage weiter über Lauenburg nach Holstein, um mit Tilly gemeinsam den König von Dänemark zu verfolgen. Seine Unterfeldherren hatten aber ganz andere Weisungen!
Schon am 18. Aug. erschien zu Rostock der Obrist=Wachtmeister Moritz Adolf v. Dehn mit 70 Pferden. Weil es ihm in einem Bürgerhause nicht gefiel, ward er beim Bürgermeister Luttermann einquartiert; denn er kam mit wichtigen Depeschen, mit einem Schreiben des Feldmarschalls Hendrich Schlick, Grafen zu Paßow, aus dem Walleinsteinschen Hauptquartier zu Wittenberge vom 14/.24. Aug., und mit einem Briefe H. G. v. Arnims, d. d. New=
Ehrnueste Wollweiße Besonders Liebe vnd gute Freunde. Wir haben Eur schreiben den 17 dits datieret woll empfangen vnd deßen inhalt mit mehrern vernomen, Wann vnnß dan Jr. Kays. Mayt. gndst. anbeuolen, die Jenige welche deroselben genad vnd schutz anhalten würden, souiel immer muglich zuuerschonen vnd in dero gndsten. schutz anzunehmen auch wider dero Feinden zue defendiren vnndt Handt zuhaben, Also seindt wir geneigt, solches im werckh erzeigen vnd gegen Euch alß Höchsteruenter Kay. Mayt. getreue spüren zulaßen vnd wider die Widerwertige Euch zuschutzen. Geben im Haubtquartier zue Dömitz den 30 Augusty Anno 1627.Kriegß=Rath, Caemmerer, Obrister zu Prag vnd General Obrister Veldthaubtmann.
Denen Ernuesten vnd Wohlweisen Unsern besonders liben vnd
guten Freunden N. Bürgermaistern vnd Rath deß H.
Römischen Reichs Stadt Rostockh.
N. d. Originale im
Stadt=Archive zu
Rostock.
30jähr. Kr. 3143 I.


|
Seite 295 |




|
stadt, d. 17/.27. Augusti 1627, welche beide an Rostock das Ansuchen stellten, eine kaiserliche Besatzung einzunehmen. "Als haben wir", schrieb Schlick, "auch nicht alsofort wieder Sie" (Bürgermeister und Rath) "verfahren, besondern in güte an sie begehren wollen, damit die Röm. Kais. Maytt. im werk [ver]spüren, das Sie an allem, was bishero vorgelauffen, unschuldig vnd in alle wege in Ihrer schuldigen deuotion gegen die Röm. Kaiß. Maytt. vorblieben, daß auch Sie (wie von andern vornehmen Reichsstädten, alß Wormbs, Speier und mehren beschehen) eine Kaiserliche Besatzung einnehmen wollen. Dieweil doch beiderseits Ihre Fürsten, die Hertzog von Mecklenburgk, zu Ihrer Kais. Maytt. Devotion sowohl durch schriften als Ihre Gesandten soweit sich erklert, alle örter und Plätze, so zu nutzen Ihrer Kaiß. Maytt. können besetzet werden, einzureumen: Alß werden Sie auch so viel weniger difficultiren; dann damit werden Sie Ihrer Kayß. Maytt. Ihre bestendige vnterthenigste treu versichern und alle böse suspicion, welche im widrigen fall würde erregett werden, gentzlichen benehmen, Ihrer Kayßerl. Maytt. auch ursache geben, Sie nicht alleine bei vorigen Ihren Privilegien zu lassen, besondern auch nach begebenden gelegenheiten mit mehreren zu begnadigen" u. s. w. (Orig. im Rost. Rathsarchiv.) - Denselben Ton schlug auch Arnim an: "Nun bezeuge Ich mit Gott, das mir solchs" - das Kriegsunglück Meklenburgs - "soweit es die Kayserl. Pflichten zulaßen, von Herzen leidt, Insonderheit, daß solche vornehme Stadt, wie die Ihrige, in vnheil und verderb solte gesetzt werden. Dahero ich mich (Weill ich der gudtthat, so mir auch darinnen vnterschiedlichen wiederfahren, mich erinnert) zum höchsten bemühet, Sie von allem, Was bißhero mochte vorgelaufen sein, auf's beste zue entschuldigen - -. Worauff dan vmb ein guhtes die Gemühter gemiltert vnd so viel Frucht, durch Gottes Gnade, geschaffet, das mir anbefohlen worden, Ihnen zuerst beigefügtes Kays. Patent zu überschicken, daraus - - Ihnen hoch angenehm sein wirtt, zu ihrem schutz vnd beßerer Versicherung die Kayserl. besatzung, welches die Röm. Kays. Maytt. von Ihnen fordern, Ihre Fürstl. Gnaden der Herr General" (Wallenstein) "auch begehren --, gantz willigk vnd gerne einzunehmen, welche dann also soll beschaffen sein, das Ihnen solches zu keinen beschwerden gereichen soll. Damit sie auch ferner sehen, das es nicht anders als gudt gemeinett, sollen Sie mit keinen frembden Nationes belestiget, besondern von Meinem eigenen Regimente solche leute hinein gelegtt werden, die in allen sachen ordre halten sollen, daß keinem auff 1 Thalers wertt schaden soll zugefüget werden," u. s. w.


|
Seite 296 |




|
Also trotz aller fast geflissentlich zur Schau getragenen Loyalität gegen den Kaiser ward den Rostockern von den kaiserlichen Feldherren gar nicht verhehlt, daß man sie gleichwohl mit Mißtrauen ansah und die Einnehmung kaiserlicher Besatzung als ein Zeichen der Treue erwartete. Der einzige Grund zu solcher Forderung war freilich dies Mißtrauen nicht; Wallenstein begehrte, wie wir hernach weiter sehen werden, vor Allem feste Plätze an der Ostsee für sich und fürchtete, der König von Dänemark könnte dieselben besetzen. Schon im April 1627 war Rostock von Lübek aus durch Husan vor einer Ueberrumpelung von 9000 Dänen gewarnt worden!
Ob die Kaiserlichen auch schon den König Gustav Adolf ins Auge faßten? Wegen dessen naher Verwandtschaft mit den beiden Herzogen von Meklenburg (ihre Mütter waren Schwestern) und wegen seiner vertrauten Freundschaft mit Herzog Adolf Friedrich konnte dieser wohl in Betracht kommen; und sein Abgesandter Peter Banér regte allerdings im Sommer 1627 den Gedanken an, Wismar und Rostock sollten weder dänische noch kaiserliche Besatzung einnehmen, sondern eine schwedische.
Diesen Gedanken wiesen die Rostocker zwar sofort zurück; ebenso lehnten sie aber auch Schlicks und Arnims Ansinnen ab. Sie entschuldigten sich deswegen sowohl mündlich gegen v. Dehn, welchen sie mit einer goldenen Kette beschenkten, als auch schriftlich gegen beide Feldherren. An Arnim schrieb der Rath: "Demnach gelangt an E. Gestr. vnsere vnterdinstliche Bitte, Sie geruhen Ihrer hohen tiscretion vnd großgünstiger affection nach für vns zu laboriren, die vns angesonnene Besatzung durch oben angezogene vnd andere dienliche motiven zu verbitten."
Aber auch das schien noch nicht genug. Weil bald darauf der Herzog Hans Albrecht den meklenburgischen Landrath Gregor Bevernest nebst einem anhaltischen Gesandten an den Feldmarschall Grafen Schlick abzuschicken beabsichtigte, und demselben u. a. den Auftrag machte, die den Rostockern angemuthete Besatzung zu verbitten: so wurde demselben von Rostock folgendes Memorial vom 23. Aug. mitgegeben, worauf der Landrath bei seiner Zurückkunft der Stadt gute Vertröstung gab, daß sie wegen der angeführten Gründe mit der Einquartierung hoffentlich verschont bleiben würde. Aus den Gründen, warum Rostock mit der angemutheten Besatzung verschont bleiben wollte, erkennt man zugleich die Stellung, welche die Stadt, auf ihre Privilegien sich berufend, im Herzogthum einnahm.


|
Seite 297 |




|
Memorial.
1) Die Stadt beruft sich auf ihre Treue und Devotion von Anfang an;
2) daß der Kaiser die seinem Gesandten Heinr. Husan gegebene Versicherung ihrer Treue gnädig aufgenommen habe;
3) daß die Rostocker diese Gesinnung auf allen Landtagen und Versammlungen durch ihre Stimmen bethätigt haben, was ihnen Lübek bezeugen kann;
4) können sie ihre Unschuld mit reinem Gewissen bezeugen.
5) ist ihnen durch den kaiserl. Gesandten zugesagt, daß sie als Lohn ihrer Treue beim Kriege nicht durch Pressuren belastet werden sollen:
6) daß sie gleich anderen vornehmen Städten des niedersächsischen Kreises mit einer Besatzung verschont bleiben möchten.
7) Hoffentlich würden die Generale dadurch bewogen werden, daß die Stadt von ihrer Gründung an sich gegen den Kaiser dergestalt benommen, daß ihr nie eine Garnison angemuthet sei, sondern sie vielmehr mit diesem Privilegium begnadigt, daß sie nicht allein jus fortalicii, aufs Beste sich zu befestigen, sondern auch keine Festung auf zwei Meilen Weges herum zu dulden erlanget, was auch die Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. fest gehalten; und von dem jetzt regierenden Ferdinand II. Victoriosus sei dasselbe und alle anderen Privilegien dieser Stadt gnädigst confirmirt 1 ).
8) ist die Stadt mit Bürgern und sich hier jetzt aufhaltenden Landständen und geworbenen Soldaten zur Zeit so zahlreich, daß sie im Stande ist, sowohl sich selbst als Warnemünde zu vertheidigen, zumal noch täglich mehr Soldaten angeworben werden und sowohl die Festung der Stadt als der Hafen also versehen, daß die Bürger ohne fremde Garnison sich getrauen können, die Stadt für Kaiser und Reich, für ihre Freiheit, Leib und Leben, Weib und Kinder ritterlich zu vertheidigen.
9) Herzog Johann Albrecht hat sich die Fortificationen persönlich angesehen und sie so beschaffen gefunden, daß die Stadt einer kaiserlichen Besatzung nicht bedürfte. 2 )


|
Seite 298 |




|
10) Weil sie nie zu einer Differenz Ursache gegeben, und der Kaiser ihrer Devotion versichert sei, sie auch den eigentlichen Zweck einer kaiserlichen Besatzung selbst schon in der That erreicht hätten, so bäten sie um Verschonung. Sie behaupten
11) daß andererseits die Stadt mit Garnison zu besetzen, nicht allein keine bessere Sicherheit und Vortheil für den Kaiser und dieses Land gewähre, sondern vielmehr nachtheilig sei, den Totalruin dieser Stadt herbeiführen würde. Da dieselbe vermöge ihrer Lage an der Ostsee auf den Handel angewiesen sei und das ganze Land von ihr mit Waaren versehen werde, zumal es unmöglich sei, diese Lande ohne freien Meerhafen im Wohlstande zu erhalten, so wäre, wenn Garnison hierher gelegt würde, nichts gewisser, als daß ihnen die Nahrung zu Wasser und zu Lande abgeschnitten würde, da sich dann ja kein fremder Schiffer hierher begäbe. Durch eine solche Einschließung des Hafens würden sie nicht allein blokirt, sondern ebenso hart, als wenn sie feindlich bezwungen, gänzlich ruinirt werden;
12) daß der Zweck der Gründung der Stadt die Verhinderung der incursiones gentium septentrionalium gewesen sei, daß dieselben durch eine Besatzung aber von Neuem hierher gezogen würden.
13) möchten die Generale bedenken, daß der kaiserl. Armee selbst an der Freiheit des Meerhafens nicht wenig gelegen. Denn, wenn von diesem Orte die Zufuhr zu Wasser abgeschnitten und die Abfuhr verboten, und sie sich also der Lebensmittel beraubt sähen, dann würde auch solcher Mangel an allen Orten des Landes empfunden, und die Gelegenheit zu aller Unterstützung verhindert werden, zumal der ganze Ritterstand, wenn der Handel der Seestädte abgeschnitten sei, von seinen Gütern nicht leben könne.
14) Es wäre im Interesse der ganzen hansa Teutonica; darum verwende sich auch Lübek für sie um Verschonung mit Besatzung. 1 )
15) Daß in dieser Stadt die Landstände ihre Zusammenkünfte hielten und die Contributionen hierher eingebracht würden, was dann aufhören würde;
16) sei diese Stadt jederzeit dieses Fürstenthums Meerhafen gewesen, daß die Landstände und Fürsten sie pro communi totius provinciae refugio gehalten; diese Gerechtsame seien von den Kaisern Maximilian II. und Ferdinand I. bestätigt worden.


|
Seite 299 |




|
17) ist hier eine Universität und a pontifice ac imperatoria Majestate confirmiret; dieselbe hat bis auf diese Stunde geblüht, woraus nicht nur der Stadt, sondern auch dem ganzen Lande ein großer Nutzen erwachsen ist. Durch die Besatzung würde eine gänzliche Auflösung rei litterariae et academiae erfolgen.
18) Große Eroberer hätten ihren Ruhm dadurch erhöht, daß sie die Akademien und Lehrer geschont, wie noch vor wenig Jahren Kaiser Rudolf der Akademie specialem salvam guardiam ertheilet, zumal da daselbst täglich für den Fortgang der kaiserl. Sache gestritten würde. Wenn also dem Ansuchen getrauet würde, so sei dabei keine Gefahr vorhanden, sondern es der eigene Vortheil; alsdann könnte der Kaiser der Stadt ebenso versichert sein, als ob er Garnison hineingelegt hätte. Deshalb bitten die Rostocker die Herren Generale um Verschonung mit Besatzung.
IV. Rostocks Contributionen.
Aber dies Memorial blieb ohne Wirkung. Oberst Arnim rückte bald hernach auf die in den Händen der Dänen befindliche bischöfliche Stadt Bützow 1 ) vor und verlegte während der Belagerung sein Hauptquartier am 27. Aug. (6. Sept.) nach Schwan. Hier wurden die Verhandlungen wegen der angemutheten Besatzung mit Rostock fortgesetzt. Als der Herzog Einige aus der Ritterschaft dahin abschickte, wurden auch von Rostock aus der Bürgermeister Joachim Schütte, Dr. Thomas Lindemann und Joachim Gerdes dahin abgeordnet, um mündlich die oben angedeuteten Motive, warum es unverantwortlich wäre die Stadt mit einer Garnison zu belegen, dem Obersten vorzutragen. Derselbe erklärte hierauf, daß er ihre Gründe für seine Person für erheblich ansehen und halten müsse; er wolle auch hoffen, daß dieselben, wenn sie den kaiserl. Generalen vorgetragen würden, Berücksichtigung fänden. Er rieth ihnen deshalb aus ihrer Mitte Einige an Wallenstein abzuschicken, wobei er hinzufügte, daß, wenn sie sich erbieten würden, ihren Kriegshaufen zu kaiserlichen Diensten verwenden zu lassen, er dafür halte, dies würde ein besonderer Grund sein, Wallenstein zu bewegen.
Nebst diesem verlangte er schriftlich "an Proviant täglichen, so lange das Kay. Volck alhier liegen pleibet, 10000 Pf. brodt


|
Seite 300 |




|
und 150 Tonnen bier", auch Pulver, Lunten und Munition von Rostock; und die Stadt lieferte Alles, um einen Realbeweis ihrer Devotion zu geben.
Am 2./12. Sept. schreibt Arnim an die Rostocker wieder, daß "sie wegen ihrer Haeffen allein, und nicht der schiffe sich ercleret, weniger, daß im Nottfall sie die fremden zu Ihr. May. Diensten, wenn Es begehrett wurde, anhallten wollten." Desgleichen an demselben Tage: "Dieweyll die Herrn wegen der Stücke zu Ihr. May. diensten abfolgen zu lassen Bedenken getragen, vermeinen, I. May. zu willfahren mitt 50 Ctrn. Pulver, 100 Ctrn. Lunten, 100 Ctrn. Blei."
Am 14. Septbr. übersendet ihm die Stadt 6 Tonnen Pulver, 10 Ctr. Lunten nach Schwan, am 15. an den Kaiserl. Proviantmeister Hauptmann v. Bülow auf Kressin durch den Büchsenmeister Heinr. Warkentien 10 Ctr. Lunten und 6 Tonnen Pulver. Am 16. Sept., von Bützow aus, begehrt der Proviantmeister v. Bülow wieder von Rostock, daß die Stadt "eilent proviant an Brott vnd Viehe einschicken" solle, "weiln gar wenigk Vorrath vorhanden, vndt die Soldaten für Pöl (von wo sie eben die Dänen verdrängen wollten) große Noth leiden."
Inzwischen machte sich die Nähe der kais. Armee in der Umgegend Rostocks in bedenklicher Weise fühlbar und erbitterte den gemeinen Mann. Schon am 30. Aug. war eine Legation an Arnim geschickt, um demselben die von den Soldaten gegen die Bürger und ihre Güter begangenen Feindseligkeiten vorzutragen und deswegen salvaguardia auf die Stadt= und Landgüter zu erbitten. Die Soldaten verkauften die den Bauern abgenommenen Güter in der Stadt! - Dann am 3. Septbr. schreibt der Rath an Arnim: "daß für vnsern thoren in vnsern Dörffern so viel insolentien täglich verübet, auch große troupen Reuter sich zu der Stadt nehern, daß wir vns fast nicht darin zu schicken vermögen, auch keine Stunde besorglichen Ueberfalls assecuriren (?) müssen". - Desgl. 9. Septbr.: da "je länger je mehr unsere Dörfer ausgeplündert, das Korn ausgedroschen und hier für den halben Preis verkauft und Alles so ruinirt wird, daß fast alle Bauern verlaufen und Alles stehen lassen, und wir diese gerne so lange salviret sehen möchten, bis der Ackerbau und die Wintersaat bestellt und die besorgliche Totalverwüstung verhütet werde, bitten wir nochmals um salvaguardia." - Am 8 /18. Septbr. beschwert sich dagegen Arnim beim Rath über grobe Excesse zwischen den Bürgern und seinen Soldaten: "Wie denn gestriger Tage, da das kaiserl. Volk nothdürftig Futter von ihren Dörfern holen wollen, etzliche der


|
Seite 301 |




|
Rostocker Soldaten und Bürger ausgefallen, die Reuter jämmerlich zerschlagen und ihre Pferde abgenommen." - Da solches von den Bürgern geschehen, so könne es nicht ohne Consens der Obrigkeit sein. Auch leichtfertige Reden würden wider den Kaiser selbst ausgestoßen, vor den Thoren. Wenn man das Volk in der Stadt begehret, würde es hinausgestoßen, auch Officiere würden vor die Stadt gewiesen, und wenn sie hinein gekommen, mit Musketieren, ja sogar mit Stadtknechten zu ihrer Verachtung begleitet. Es würde eben wenig der Proviantlieferung nachgekommen; denn in 8 Tagen seien statt der täglichen 20000 Pfd. Brot nicht so viel geliefert. Er bittet den gemeinen Mann besser im Zügel zu halten.
Die Räubereien dauerten noch fort, wie die Armee von Schwan längst aufgebrochen war, so daß wegen der Unsicherheit der Straßen die Zufuhr nach Rostock gehemmt blieb. -
Während die Stadt die kaiserl. Armee so auf alle Weise unterstützte, hatte sie dem dänischen Befehlshaber, welcher sich mit dringenden Bitten an sie wandte, Alles abgeschlagen. Georg Friedrich, Markgraf von Baden, begehrte von seinem Hauptquartier Ström[ken]dorf aus unterm 12. Aug. von Rostock, Proviant gegen Bezahlung zur Unterhaltung der dänischen Armee nach der Insel Pöl zu schicken. Die Rostocker entschuldigten sich aber unterm 14. August, daß die Stadt mit dem hinein geflüchteten Adel und Unadel überfüllt, die Landstraßen durch den Krieg gesperrt, die Früchte noch nicht eingeerntet, theils die Felder verheert, die Früchte verzehrt und verdorben seien, daher wenig Zufuhr zu vermuthen, und sie selbst Mangel an Proviant besorgen müßten, daher sie unlängst die Verschiffung von Korn verboten hätten.
Georg Friedrich wiederholte unterm 17. Aug. sein Begehr, worauf die Rostocker unterm 24. antworten: Sie hätten leider erfahren, daß vor wenig Tagen alle Zufuhr in Lebensmitteln u. a. aus Dänemark in diese und benachbarte Hansestädte verboten sein solle, auch hätten sie die Wirkung dieses Verbots seither verspüret; und, da durch den Krieg der Handel darniederliege, auch bei ihnen sich Mängel fände, so wäre es ihnen unmöglich.
Wie groß übrigens der Schrecken war, den die auf ihrer Flucht Meklenburg überschwemmenden Dänen verbreiteten, zeigt eine Verordnung Herzog Adolf Friedrichs vom 12. August 1627, worin es heißt, "daß unsere in den Aemtern Doberan und Bukow wohnende Unterthanen mit ihren Knechten und Mägden ihre Häuser und Höfe, wie auch das Korn im Felde stehen lassen und sich nach Rostock begeben haben. Da hier nicht allein das Korn im Felde stehen bleibt, sondern verdirbt, so [sollet ihr] von den Kanzeln


|
Seite 302 |




|
verkündigen lassen, daß jeder sich wieder an seinen Ort begeben soll, weil die Soldaten alles Ihrige wegnehmen, auch wohl die Höfe in Brand stecken; deshalb sie aus Rostock gewiesen werden sollen." -
V. Weitere Verhandlungen mit Wallenstein und Arnim.
Weil kein anderer Weg übrig blieb, von der angemutheten beschwerlichen Garnison befreit zu bleiben, als den kaiserl. General selbst zu beschicken, und Herzog Hans Albrecht ebenfalls eine Legation dahin absandte, so wurden derselben Bürgermeister Johann Luttermann, Bernhard Klinge und Hieronymus Roß 1 ) beigegeben, welche nun ihren Weg auf Güstrow nahmen und von dannen mit den fürstlichen Gesandten Gregor Bevernest, Ludwig Hahn und Johann Bartels nach Wismar und weiter ins Lager zu Strömkendorf und nach Pöl zu Arnim reisten, bei dem sie durch weitere Verhandlungen und durch entsprechende Mittel auch soviel erreichten, daß er ihnen ein bewegliches Intercessions=Schreiben an die kaiserlichen Generale mitgab. Weil die fürstlichen Gesandten es für rathsam hielten, auch den Grafen Tilly zu begrüßen, benutzten die Rostocker diese Gelegenheit und trugen Sr. Excellenz der Stadt Anliegen vor, erlangten von demselben auch ein Empfehlungsschreiben. Zugleich gab ihnen Lübek ein Fürschreiben an den Herzog von Friedland mit. Die Instruction der Gesandten vom 16. Septbr. führte dieselben Gründe auf, wie das oben bereits mitgetheilte Memorial. Rostock beruft sich hier darauf, daß seine Treue gegen den Kaiser bereits "weltkundig" geworden sei. "Daferne nun darauf gnädige Erklärung pure erfolgen würde, so hätten unsere Abgesandten Gott uud I. F. G. unterthänig dafür zu danken. Zum Fall aber in unsere Abgeordnete wegen einer sonderbaren Abfindung hart gedrungen, und eine hohe Summe gefordert werden sollte, so hätten sie dagegen unser Unvermögen, Abgang der Nahrung, immerwährende Contributionen und ausgestandene Pressuren, und daher vor Augen stehende Impossibilität anzuzeigen; zuletzt, da es nicht zu erbitten, sich zu einer Summe Geldes, die sie wissen mögen aufzubringen, dergestalt zu erbieten, daß dieselbe in leidlichen Terminen und mit dem Bedinge ausgezahlt würde, daß wir dagegen bei diesem Kriegswesen ferner nicht graviret, sondern deswegen


|
Seite 303 |




|
genugsam assecuriret werden möchten. Sollte aber solche Summe nicht acceptirt werden, so hätten unsere Abgesandten es ad referendum anzunehmen." - Auf ihrer Rückreise sollten die Gesandten den Rathschlag Lübeks mitbringen, um Empfehlungsbriefe anhalten und dieselben an Husan zur Beförderung übergeben. Sie sollten auch zu Lübek oder Hamburg eine Anleihe auf der Stadt Credit machen, und wenn sie Neues erfahren könnten, solches durch Geld herauslocken. Außerdem verpflichtete sich Rostock bei der Unsicherheit der Wege, wenn die Gesandten beraubt oder angehalten werden sollten, alle Mittel zu ihrer Befreiung aufzubieten.
So langten die Gesandten im Hauptquartier vor Rendsburg an. Als sie dort ihre Werbung vortrugen und die Intercessionsschreiben präsentirten, äußerte Wallenstein ganz gnädig, die Stadt Rostock wäre ihm genugsam empfohlen und sollte mit keiner Einquartierung beschwert werden; denn es wäre eine Hanse= und Handelsstadt. Sie müßte aber, fügte er hinzu, nichtsdestoweniger zur Erhaltung der kaiserlichen Armee Etwas contribuiren. Wie nun die Abgeordneten weiter von dem Unvermögen der Stadt sprachen und sie mit großen Summen zu verschonen baten, da antwortete Wallenstein, er wisse wohl, daß sie nicht Hamburg oder Lübek wäre, man müßte sie nicht auf einmal ausrupfen. Weil die von Wismar von den Rostockern begehrt, ihrethalben den General um Verschonung zu bitten, und diese zu dem Zweck ein Creditiv übergaben, und also der Stadt Drangsal beweglich vortrugen, erklärte er, er wisse nicht, ob er dieselbe verschonen könne, weil sie dem Feinde Zufuhr gethan. Als die Abgeordneten dies entschuldigten und um gnädigen Bescheid anhielten, antwortete der General, er wolle an Arnim seine Meinung schreiben. Was die Rostocker Werbung betraf, so dictirte er in ihrer Gegenwart dem Secretär ein Schreiben an Arnim und erzeigte sich sowohl bei der Audienz als bei der fürstlichen Tafel gegen dieselben sowohl im Wort wie im Benehmen sehr gnädig, wie er denn auch dieselben aufforderte, weil um diese Zeit die Stadt Rendsburg sich ergeben, mit ihm dahin zu reisen; und darauf wurden sie mit dem Schreiben an Arnim, von dem sie allerdings keine Copie erlangen konnten, und Creditiv entlassen. Die Gesandten kamen am 11. October in Wismar an, wie eben vorigen Tages die Kaiserlichen in diese Stadt eingezogen waren. Sie überreichten daselbst dem Obristen Arnim das Schreiben Wallensteins, das er erbrach und las, ihnen aber den Inhalt vorenthielt. Dieses beruhte hauptsächlich darauf: da sich Rostock eine


|
Seite 304 |




|
Besatzung verbeten, so sei dieselbe mit einer starken Contribution zu belegen. Dieser Passus war am Rande von einer andern Hand, welche nach Arnims Aussage die Wallensteins war, stark notirt gewesen. "Das der herr mitt denen von Rostock klümpflich procedirt" (schreibt er am 9. Oct. an Arnim), "höre ichs von Herzen gern. Die bedenken, worumb der herr kein volck der Zeit hinein legt, seindt erheblich 1 ); drumb remitire ich alles dem herrn, er sehe, wie wir eine gewisse gelts=Contribucion von ihnen bekommen." 2 ) Darauf theilte Arnim ihnen mit, daß sie gerade zu rechter Zeit kämen; denn er hätte schon Tags vorher den Obristen Sparre nach Rostock geschickt und der Stadt befohlen die Aufnahme einer Garnison weiter ins Werk zu setzen, auch Befehl ertheilt, daß die ganze Armee dahin marschiren solle. Jetzt solle man ihm in Folge des Schreibens von Wallenstein Etliche zuschicken, mit denen er verhandeln könne. Die Abgesandten machten sich nach dieser Erklärung eilig auf den Weg und gelangten glücklicher Weise noch mit dem Obristen Sparre zugleich am 12. October Mittags vor dem Kröpeliner Thore an. Nachdem sie ihm bei der Thorwache Einlaß verschafft hatten, begaben sich Alle aufs Rathhaus, worauf Sparre zuerst seinen Auftrag wegen der geforderten Garnison ausrichtete. Als jedoch die Gesandten bei den 100=Männern Bericht darüber ablegten, was sie bei Wallenstein ausgerichtet, und dem Obristen der Beschluß des Generals vorgehalten wurde, war derselbe zuerst etwas entrüstet, beruhigte sich jedoch, da der Proviantmeister Arnims, v. Bülow, welcher noch vor des Obristen Abreise hier angelangt war, den Bericht der Abgeordneten bestätigte und dabei dem Rathe andeutete, daß Arnim sein Heer nicht an die Stadt führen werde, sondern zuvor mit ihnen wegen der Contribution sich abfinden wolle, und wünschte, weil Arnim am folgenden Tage (d. 14. October) zu Güstrow sein werde, sie möchten Einige dahin abordnen. Der Obrist Sparre erklärte, er müßte nunmehr ihren Einwänden Glauben schenken, verlangte aber darüber einen schriftlichen Schein vom Rath, welcher ihm auch ertheilt wurde.
Zur bestimmten Zeit wurden der Bürgermeister Luttermann, Bernhard Klinge, Dr. Nicol. Scharfenberg und Valentin Strelenius nebst einigen Bürgern, Rodrich Koch, Joachim Gerdes, Klaus Frese, Hieronymus Roß und noch andern, nach


|
Seite 305 |




|
Güstrow deputirt. Zu gleicher Zeit wurden die vom Schweriner Landtage zurückkehrenden Bürgermeister Joach. Schütte, der Dr. Lindemann nebst Daniel Brun benachrichtigt, zur bestimmten Zeit in Güstrow zu den andern Deputirten zu stoßen, was der Verabredung gemäß geschah. Am 15. October begannen die Verhandlungen im Hause des Obristen Arnim. Er hat daselbst abermals den Abgeordneten vorgeschlagen, daß, obwohl in des Herrn Generals Schreiben nicht expreß enthalten sei, sie mit der Garnison ganz zu verschonen, er dennoch zur Einleitung, zumal ihm die Contribution an die Hand gegeben sei, und er das Schreiben so verstehe, mit ihnen wegen der anbefohlenen starken Contribution verhandeln wolle und hören, was sie zu thun gewillt seien. Er schlug vor, die Stadt solle 1 Regiment zu Pferde und 1 Regiment zu Fuß (das Arnimsche) auf 3 Monate unterhalten, wozu 140,000 Thlr. gehörten; außerdem verlangte er Quartiere für dieselben, und für den Fall, daß sie solche nicht hätten, sollten sie mit Ihro Fürstl. Gnaden unterhandeln, ihnen dazu einige kleine Städte einzuräumen.
Die Deputirten boten, nachdem sie das Unvermögen der Stadt hervorgehoben hatten, 25,000, dann 30,000 Thlr., jedoch ein für alle Mal unter der Bedingung, daß die Stadt sowie deren Spital= und Landgüter stets von Einquartierung befreit bleiben müßten.
Darauf erklärte Arnim, er glaube wohl, daß es ihnen schwer fallen würde die Summe aufzubringen; er habe jedoch nicht die Vollmacht, die angebotene Summe, wenn sie gleich noch viel höher wäre, anzunehmen, sondern er müsse des Herrn Generals Befehl ihnen andeuten, daß die Stadt 2 Regimenter zu Fuß und zu Roß unterhalten solle, und wenn ihnen das zu viel wäre, so wolle er das dem Herrn General berichten; er wolle sie aber in guter Absicht erinnern sich vorzusehen, daß man den General nicht erzürne; derselbe könnte dann leicht seine Bedingungen und Zusage zurücknehmen. Wenn die Stadt jedoch die angedeutete Summe zum Unterhalt von 2 Regimentern geben wolle, so werde er für die Quartiere sorgen; im andern Falle müsse er vor die Stadt rücken, wie vor Wismar, und dieselbe so lange belagern, bis sie sich geeinigt hätten.
Hierauf haben die Deputirten 50,000 Thlr. geboten.
Arnim entgegnete, daß er weder befugt sei, die Summe von 100,000 Thlrn. noch die von 50,000 Thlrn. anzunehmen; er wolle aber hierüber mit Wallenstein conferiren, jedoch so lange müßte das Volk unterhalten und einquartiert, oder eine Summe von we=


|
Seite 306 |




|
nigstens 30,000 Thlrn. zum Unterhalt bis zu seiner Zurückkunft erlegt werden. Er müsse morgen das Volk marschiren lassen; er wolle in eigner Person zu Wallenstein reisen und hoffe dies in 10 Tagen abzumachen. Sie möchten sich die Sache überlegen und gegen 1 Uhr sich erklären; er wolle jetzt in die Kirche gehen.
Gegen 4 Uhr schickten die Deputirten einige aus ihrer Mitte wieder zum Obersten. Gegen diese erklärte er, daß er für seine Person privatim zufrieden sein und 50,000 Thlr. annehmen würde; er wisse wohl, wie schwer es fiele eine solche Summe auszugeben, aber es könnten nach seinem Erachten nicht unter 140,000 Thlr. sein, damit dem General nicht Ursache zur Unzufriedenheit gegeben würde; außerdem stünde es nicht in des Generals Macht, das zu ändern, was im großen Kriegsrath beschlossen sei. Wenn aber 100,000 Thlr. deponirt würden, dann solle die Armee von Rostock abgeführt werden; er glaube, daß die Rostocker dann ziemlich gesichert sein würden, könne jedoch nicht versichern, daß sie gänzlich frei sein sollten; er würde freilich beim General sein Bestes thun, er betheuerte aber, daß es nicht rathsam sei demselben unter 100,000 Thlrn. zu bieten. Wenn endlich die Summe von 50,000 Thlrn. fest abgemacht sei, so müßten 25,000 Thlr. sofort binnen 8 Tagen deponirt werden. Die Erklärung hierüber wolle er am Dienstag in Schwan oder in Bützow entgegennehmen. -
Die Gesandten verhießen zu berichten und verfügten sich hierauf in Güstrow zu Herzog Hans Albrecht. Derselbe versicherte sie seiner Fürsprache. Ebenso ersuchte man auf dem Landtage zu Schwerin den Herzog Adolf Friedrich die Sache in die Hand zu nehmen. Dieser schlug es jedoch ab und erklärte, daß er selbst mit keinem Gelde die Einquartierung habe verhüten können; er riethe ihnen die Bedingungen anzunehmen und zu halten. Nach 2 Tagen haben sich dann die Deputirten abermals zu Bützow eingefunden und die Verhandlungen soweit geschlossen, daß man bei der Unmöglichkeit, die 100,000 Thlr. aufzubringen, allerdings den General zu erzürnen fürchte, aber alles Vertrauen auf ihn (Arnim) setze, er würde für ihr Bestes handeln. Sie wollten in seiner Person gleichsam versprechen, was er auf die geforderte Summe abhandeln und schließen werde, zu ratificiren. Dazu wurden, um ihn für sich zu gewinnen, abermals dienliche Mittel gebraucht. Er versprach bereitwillig bei dem General von der gebotenen Summe etwas abzuhandeln, oder wenn das nicht möglich wäre, die gewünschte Sicherheit mitzubringen. Mit solcher Verabredung reiste der Oberst zu dem Kaiserlichen General ins Hauptquartier ab.


|
Seite 307 |




|
Als aber einer der Deputirten kurz darauf in Privatgeschäften nach Wismar kam, erfuhr er, daß an demselben Tage, wie Arnim nach Lübek hatte aufbrechen wollen, der Obrist Götze bei ihm von Wallenstein angelangt sei und geäußert habe, er hätte den Befehl bei sich, daß Rostock eine Besatzung einnehmen solle. Diese Nachricht brachte eine große Bestürzung hervor, so daß man sofort durch einen Einspänner ein Schreiben an den Obersten Arnim nachschickte, und ebenfalls an den Grafen Schwarzenberg und an Lübek Briefe abgehen ließ. Der Einspänner brachte jedoch nur eine Empfangsbescheinigung aus der Kriegskanzlei (Octbr. 27) zurück. Lübek und Schwarzenberg antworteten gleichfalls schriftlich (Novbr. 8). Weil der Obrist Arnim auf der Rückreise den Einspänner in Wismar vorfand, gab er demselben noch ein Schreiben an die Deputirten und den Bürgermeister Luttermann mit.
Darauf wurden einige der Deputirten abermals nach Bützow gesandt. Aber schon auf dem halben Wege kam ihnen der Proviantmeister v. Bülow entgegen und berichtete, der Obrist sei eilend nach Güstrow gereist und habe ihm zwei Schreiben von Wallenstein übergeben, welche er ihnen zustellen solle mit der Weisung, daß sie am folgenden Montag, am 5. November, sich zu Bützow einstellen möchten. Wie diese Briefe nach der Rückkehr geöffnet wurden, enthielt der eine derselben nochmals die Zumuthung eine Besatzung einzunehmen. Da man sich den Hergang der Sache nicht erklären konnte, beschloß man durch eine Deputation an den Obristen Arnim sich hierüber Aufklärung zu verschaffen. Dieselben fanden jedoch diesen bei ihrer Ankunft nicht vor, erfuhren aber am folgenden Tage, daß der Obrist=Lieutenant v. Kaldewitz von Arnim angewiesen sei, mit ihnen zu reden und ihnen Wallensteins Meinung anzufügen. Dieser ließ die Deputirten auf das bischöfliche Schloß fordern und machte ihnen folgende Mittheilung. Obwohl Arnim seinem Versprechen gemäß mit dem General verhandelt hätte, daß es bei den 100,000 Thlrn. bewendet bleiben möge, so habe Wallenstein dennoch diese Summe nicht annehmen wollen und sich dahin entschieden, die Rostocker sollten entweder zwei Regimenter unterhalten oder dem Befehle des Obristen gemäß eine Besatzung einnehmen.
Diese neue Zumuthung erregte bei den Deputirten großes Befremden. Der Obrist=Lieutenant erklärte ihnen hierauf, daß er weiter keine genügende Instruction habe, und verwies die Gesandten, um die Verhandlungen zum vollen Abschluß zu bringen, an Arnim selbst, welcher am 8. November zu Neubrandenburg sein werde. Die dorthin Abgesandten trafen ihn jedoch zur angegebenen Zeit


|
Seite 308 |




|
nicht vor, wohl aber seine schriftliche Aufforderung an den Rath, Deputirte zum 12. Nov. nach Bützow zu schicken.
Dort stellten sich nun der Bürgermeister Joachim Schütte, Bernhard Klinge, Joachim Gerdes und Nicolaus Bötticher ein. Der Obrist wiederholte dieselbe Forderung, mit welcher sie schon der Obrist=Lieutenant in Bützow bekannt gemacht hatte und bestand auf derselben. Weil aber die Deputirten Bedenken trugen diese anzunehmen, andererseits jedoch auch die Verhandlungen sich nicht zerschlagen lassen wollten, so bewogen sie den Obristen, nach Rostock zu kommen. Daselbst wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und (am 15. Nov.) soweit gebracht, daß Arnim die 100,000 Thlr. schlechtweg annahm, aber auf die Unterhaltung zweier Regimenter drang. Da er endlich von letzterer Bedingung abzusehen sich bereit erklärte, wenn man dagegen zu den 100,000 Thlrn. noch eine ansehnliche Summe zulegte, so erbot sich der Rath zu 140,000 Thlrn., aber gegen die Zusicherung: "dafür uns, neben uns und unsern Bürgern Stadt, Hafen, Land=, Kloster= und Hospitalgüter für alle und jede exactionen nicht allein in sicheren Schutz und Schirm zu nehmen, sondern auch für alle Einquartierung und Drangsale uns künftig zu verschonen." Obwohl Arnim dieses Anerbieten ohne Wissen und Genehmigung Wallensteins nicht annehmen wollte, so war er doch bereit, eine Quittung darüber auszustellen, und versprach, wenn die vorgeschlagene Summe bei Wallenstein zur Sprache komme, für ihren Vortheil zu sprechen und Alles anzuwenden, um die gewünschte Versicherung für sie auszuwirken. Dabei hielt er um Auszahlung des ersten Termins inständig an; und man mußte fest versprechen, den andern gegen Neujahr zu halten. Hierauf wurden ihm zu den sofort erlegten 14,000 Thlrn. noch 10,000 Thlr. gegen Quittung baar entrichtet; und er ermahnte den Rath ernstlich, ferner mit dem andern Termine, nämlich 36,000 Thlrn., auf Neujahr bereit zu sein, 40,000 Thlr. sollten zu Ostern erlegt werden.
Daß es Wallenstein jedoch bei der Contribution nicht bewenden lassen wollte, ersieht man aus seinem Briefe an Arnim vom 2. Decbr. 1627 (Förster Nr. 91): "was itzt die von Rostock bewilligt haben, darbey kanns bleiben noch ein par monat; aber nacher wirdt die contribucion auf eine andere weis von ihnen gefordert werden, welches ich dem herrn (Arnim) aufs eheste durch den Obristen Sant Julien werde zu müssen thun." - Die Verwendung dieser Summen ersieht man aus weiteren Verfügungen Wallensteins. Da die Pferde anderweitig unterhalten wurden, betimmte er von den 20,000 fl., welche die Rostocker monatlich


|
Seite 309 |




|
hierzu zahlen mußten, 6000 fl. zu seinem monatlichen Deputat, 3000 fl. monatlich für den Commandirenden v. Arnim, "weil derselbige große Spesen führen muß", und die übrigen 11,000 fl. zum Ankauf von Getreide und Munition. Doch schon im December sollte die Stadt 50,000 Thlr. über jene anfänglich festgesetzte Summe zahlen. (Förster Nr. 106.)
Als bald darauf ein Wendischer (Hanse =) Tag zu Lübek ausgeschrieben war, brachten daselbst die Rostocker Abgeordneten die bedrängte Lage ihrer Stadt zur Sprache und ersuchten die andern Städte um Rath und Hülfe. Weil jedoch auch die andern Beschwerden hatten, so wurde für gut angesehen, eine gemeinsame Gesandtschaft an den Kaiser zu schicken und um Erleichterung anzuhalten. Doch wurde jeder einzelnen Stadt freigestellt, ihre Beschwerden dem Kaiser und den Generalen besonders vorzutragen.
VI. Kaiser Ferdinand sucht die Hansestädte zu gewinnen.
Man durfte sich allerdings von einer solchen Gesandtschaft einigen Erfolg versprechen; denn Kaiser Ferdinand gab sich eben damals alle Mühe die Hansestädte für sich zu gewinnen.
Er war entschlossen, seinen Sieg über Christian IV. bis aufs Aeußerste zu verfolgen und den flüchtigen Feind auf seinen Inseln anzugreifen; aber es mangelte hierzu an Schiffen. Alles, was Deutschland an Fahrzeugen besaß, war die Handelsmarine der Hansa. Schon Maximilian II. hatte auf dem Reichstage zu Speier 1567 vorgeschlagen, von den burgundischen, westfälischen und sächsischen Kreisen ein Reichsadmiralsamt zu bilden und einen Reichsadmiral zu ernennen. Jetzt wollte der Kaiser Ferdinand II., des alten Ruhmes der einst so mächtigen Hansa gedenkend, ihre ehemalige Größe wieder herstellen 1 ), woran seine Vorgänger wegen der Türkenkriege, der Religionshändel u. s. w. nicht hätten denken können. Im Grunde aber verfolgte er in Gemeinschaft mit dem König von Spanien rein Habsburgische Interessen. Eine spanische Gesandtschaft erschien schon Ende Septembers in Danzig, und zu Anfang Novembers 1627 zu Lübek als kaiserlicher Gesandter der Graf Ludwig v. Schwarzenberg, begleitet von dem spanischen Agenten Gabriel de Roy um den Hansestädten verlockende Vorschläge zu machen. Der Kaiser verlangte von ihnen, sie sollten


|
Seite 310 |




|
aus ihrer Neutralität heraustreten, sich entschieden in seinen Dienst und seinen Schutz stellen und zunächst ihre Schiffe zum Kriege gegen Dänemark hergeben. Spanien seinerseits bot ihnen einen schon bis auf die Unterschriften fertigen Handelsvertrag an, wonach sie allein von allen Mächten an der Ostsee und Nordsee mit Spanien handeln, auch allein den Handel zwischen Spanien und den spanischen Colonien in Gemeinschaft mit den Spaniern selbst treiben sollten. England, Holland, Schweden und Dänemark sollten ihre nach Spanien bestimmten Waaren in die hansischen Häfen schaffen, damit sie dort auf hansische oder spanische Schiffe verladen und an den Ort ihrer Bestimmung gebracht würden, und aus den hansischen Häfen sollten sie die spanischen Waaren beziehen.
Ueber diese Propositionen vom 8. Nov. ward nun zu Lübek bis in den December hinein (gerade sowie auch in Danzig) fruchtlos verhandelt. Rostock war dabei vertreten durch den Bürgermeister Luttermann und B. Klinge, denen Schwarzenberg am 4. Dec. seine an Bürgermeister und Rath der Stadt Rostock gerichtete kaiserl. Creditive vom 4. Sept. überreichen ließ (die sich noch im Rathsarchiv zu Rostock befindet). Fruchtlos aber blieben die Verhandlungen vornehmlich darum, weil die Hanseaten kein Vertrauen zu der Habsburgischen Politik hatten und voraussahen, daß sie alsdann mit allen Nachbarn zerfallen, etwanige Kriege deswegen aber allein auszufechten haben würden. Schon mahnte König Christian IV. am 12. Dec. 1627 durch seinen Gesandten Dr. Kratz entschieden bei der Neutralität zu verharren. Er erwarte von seinen Freunden Hülfe, sei aber zum Frieden geneigt und bereit die Vermittelung der Hanseaten anzunehmen. Die Städte mochten erwägen, daß es sich für sie um Religion und Libertät handle; und wenn sie dem Kaiser Beistand leisteten, so würde er mit den Schweden, Engländern und Niederländern eine Macht zusammenbringen, daß es um den hansischen Handel geschehen wäre. Vergebens erklärten die hansischen Deputirten dem kaiserl. Gesandten, sie seien auf seine Propositionen nicht instruirt; Schwarzenberg erinnerte daran, daß nicht umsonst kaiserliche Heere in der Nähe seien. Nur die Vorstellung, lieber den Sommer abzuwarten, da die Schiffe in den fremden Ländern sich auf dem Winterlager befänden und nicht wiederkehren würden, wenn sie diese Botschaft erführen, auch wohl von den fremden Nationen an der Rückkehr verhindert werden möchten, fand so weit Gehör, daß weitere Verhandlungen bis zum Februar 1628 verschoben wurden.


|
Seite 311 |




|
Inzwischen aber versuchten die Kaiserlichen von
den einzelnen Städten Schiffe zu erlangen. Am
19. Decbr. schrieb Schwarzenberg an den
Commandanten zu Wismar, den Obersten Daniel v.
Hebron, er habe "vff Erforderung Hrn.
General=Wachtmeisters (Gordon), vornemblich aber
auf Beuelig I. Frstl. Gn. Hrn. Generals,
Hertzogen zu Friedlandt" "ehist
etliche Schiff von 20 oder 30 Lasten, deren 12
oder wenigist 10 sein sollen", von Wismar
"nach Neustadt in Wagerlandt" (in
Holstein) "mit gutten Schiffleuthen"
abzuschicken. "Vnd saien solche Schiff
daselbsten nit vorhanden, wolle der Herr
vnverzogenlich nach Rostock senden vnd Befelg
geben, daß von dannen so uiel geschicket werden
khönnen. Dieselben aber sollen zu der Neustadt
nit aufgehalten werden, sondern bald wieder
zuruckh gelassen." Da nun, wie begreiflich,
die Stadt Wismar "ihre erhebliche
Entschuldigungen wegen Mangelung der Schiffen
vnd anderer Vrsachen eingewandt", theilte
Gordon Bürgermeister und Rath zu Rostock am 11.
Dec. obiges Schreiben abschriftlich mit, und
"weile dieselben", schrieb er ihnen
zugleich, "ihre Schiffarth noch im Meer
frei und eine viel größere Anzahl der Schiffen
haben, als werden die hern sich dergestalt
darauff zue resolviren wißen, daß
vorhochgedachte I. F. Gn. der Hr. Generall wie
auch I. Exc. der Herr Graf von Schwarzberg daran
ein gnädiges Benugen haben mügen." - Doch
der Rostocker Rath antwortete am 15. Dec. dem
Öb.=Wachtmeister ablehnend: Man habe auf
Erkundigung erfahren, "daß dergleichen
Schiffe von hinnen auß weinig geführet, sondern
fast alle größerer Ladung vnd vber daß eben itzo
bei der annoch wehrenden weichen Zeit an die
benachbarten orte, dahin sie sicher kommen, für
der annahenden beschlossenen Winterzeit noch
eine Reise thun konnen, außgefahren sein. Vber
das mögen E. g. dienstlich nicht bergen,
waßmassen vnsere Schiffer auß der See von
unterschiedtlichen orden her, daß sich etzliche
streifende Pinken schon sehen lassen, vnd also
keine geringe Gefahr sich ereugen soll,
advisiret"
 . -
. -
VII. Warnemünde befestigt und blokirt.
Die Absichten, welche Wallenstein mit Rostock hatte, spricht er von Fehrbellin aus am 15. Nov. in einer Instruction an den Obersten v. Arnim aus (Förster Nr. 67; I, 133): "Rostock und Wismar, sehe der herr, das sie auf solche weis fortificiert werden, auf das sie mitt wenig volck können vor feindts einfellen versichert, und wenn der Pewel oder sonsten böse leit in der statt tumultuiren wolten, im Zaum gehalten; und das muß ein Citadella sein,


|
Seite 312 |




|
doch das sie sich nicht acorgieren" (daß sie den Zweck nicht merken): "in summa, der Herr wirdts wüssen, wie ers anstellen wirdt; bitt, er eile nur, denn ich kann kein ruhe haben, bis es gericht wirdt." - "Denen von Rostock wird man müssen den Port mit Schanzen spören." Seitdem Wallenstein unsere Gegenden wieder verlassen, ergehen regelmäßig in seinen Briefen an die Obristen die Weisungen, Rostock und Wismar mit Citadellen zu versehen, die Getreideausfuhr zu verbieten und die Meerhäfen der Ostsee gegen die Feinde zu sichern. 1 )
Als Wallenstein die Weisung Warnemünde zu befestigen von Prag am 9. Februar 1628 und aus Gitschin am 27. Febr. 2 ) an San Julian erließ, hatte Arnim bereits die nöthigen Schritte hierzu gethan. Am 10. Februar 1628 schickte derselbe in dieser Angelegenheit den Obristen S. Julian nach Rostock und ließ den Rath auffordern, Deputirte zu diesem zu schicken. Als der Bürgermeister Luttermann, Johann Mars und Joh. Buchius bei ihm erschienen, theilte er ihnen mit, daß, da der Kaiser die Stadt hoch empfohlen habe und ihr in Gnaden gewogen sei, weil sie in der kaiserlichen Devotion geblieben, sie nun von der Einquartierung verschont bleiben solle. Was aber Warnemünde beträfe, dessen müßte man sich für den Kaiser versichern; da man Nachricht habe, daß der Feind (König Christian) sich sehr rüste, so müsse der Ort befestigt und besetzt werden. Dies sollte jedoch nicht geschehen, ohne daß es dem Rathe mitgetheilt sei, nicht mit Gewalt; und man würde gestatten, daß die Schanzen zur Hälfte mit kaiserlichen und zur Hälfte mit Rostocker Soldaten besetzt würden. Es sei dies nöthig, damit man Controle über die Ein= und Ausfahrenden führen könnte, und diese Maßregel würde nach dem Frieden wieder aufgehoben werden. Nachdem im Rathe dieser wichtige Punkt reiflich überlegt war, wurde der Entschluß dem Obristen durch eine Deputation überbracht; er lautete dahin, daß man selbst den Hafen besetzen und eine Schanze bauen wolle. Man hoffe, daß der Obrist Arnim sein gegebenes Versprechen halten würde; man sei bereit, wenn es nöthig sei, noch am selben Tage 100 Soldaten dahin zu schicken und sofort mit dem Schanzenbau anfangen zu lassen. Mit dieser Erklärung aber war S. Julian nicht zufrieden; endlich einigte man sich mit ihm dahin, daß man dieserwegen an den Obristen Arnim selbst gehen wolle. Die Deputirten reisten also am 12. nach Greifswald. Der Rath meldete aber bereits am 15.


|
Seite 313 |




|
an Arnim, daß der Obrist S. Julian mit etzlichen Regimentern aufgebrochen und auf den Flecken Warnemünde marschirt sei, sein Volk in den umliegenden Stadt= und Hospitaldörfern einquartiert und dem Rath angezeigt habe, daß Sr. Gnaden Intention sei, auf Arnims Ordinanz zu Warnemünde eine Schanze anzulegen, und während daran gearbeitet würde, dabei eine Wacht von 300 kaiserlichen Musketieren zu halten. Die Bauern im Amte Schwan seien aufgeboten, mit Schaufel und Spaten in dem Quartier zu arbeiten. Die Deputirten baten anfänglich den Obristen noch, daß die Leuchte stehen bliebe; und obwohl zuerst ein Realwerk gemacht werden sollte, so wurde doch endlich vom Obersten nachgegeben, nur eine vierkantige Schanze zu bauen. Weiter erreichte man nichts. Schon am 2. Februar hatte S. Julian von seinem Hauptquartier Elmenhorst aus von der Stadt gefordert, man solle ihm aus den Universitäts=, Kloster= und Hospitaldörfern 100 Bauern mit Schaufeln, Spaten und Kost nach Warnemünde zum Schanzen schicken. 1 ) Alle Vorstellungen dagegen bei S. Julian blieben erfolglos. Der Schanzenbau schritt rasch vor. Die Bauern mußten Holz und Strauch von allen Orten zuführen und wurden mit Zwang zur harten Arbeit angehalten, die auch Sonntags fortgesetzt wurde. Am 29. Febr. konnte der Obrist schon Wallenstein von Warnemünde aus die Vollendung der Schanze melden; er verhehlte jedoch demselben nicht den ungeheuren Schaden, welcher der Stadt hieraus erwüchse und ihren gänzlichen Untergang herbeiführen könnte. Er rieth deshalb selbst die Schanze mit Stadtsoldaten zu besetzen. 2 ) Am 9. März ertheilte S. Julian dem Rathe ein Patent, daß die Schanze nur zur Vertheidigung gegen die Feinde des Kaisers aufgeworfen sei, und verhieß den Handelsleuten und Seefahrern aller Nationen freie Aus= und Einfahrt, wenn sie nicht Kriegsvorräthe mit sich führten. Dieses Patent wurde zu Rostock und Warnemünde öffentlich angeschlagen. 3 ) - Es war aber vorauszusehen, daß Rostock durch jene Hafenschanze in den schlimmsten Conflict mit Dänemark gerieth.
Von Dänemark hatten einst die Protestanten, hauptsächlich die Partei Friedrichs V., des Winterkönigs, die Wiederherstellung der früheren Zustände gehofft. Es war der vorgeschobene Posten einer großen europäischen Combination gewesen. England und Holland


|
Seite 314 |




|
hatten 1625 eine Allianz zur Unterdrückung der spanisch=österreichischen Macht geschlossen, welche durch ihre großen Waffenerfolge noch einmal anfing, in Europa das Uebergewicht zu erhalten, und König Christian IV. war diesem Bündnisse beigetreten. England und Frankreich, dessen Cardinal Richelieu an der Politik Heinrichs IV. festhielt die habsburgische Monarchie zu schwächen, hatten Subsidiengelder zur Führung des Krieges an Dänemark gezahlt. Aber dieses Bündniß mit fremden Mächten hatte Christian IV., der als Herzog von Holstein Vasall des Kaisers und von den Niedersächsischen Ständen zum Kreisobersten erwählt worden war, seinen norddeutschen Bundesgenossen entfremdet; sie hatten sich, wie ihn das Kriegsglück 1626 bei Lutter verließ, von ihm losgesagt. Jetzt sah er sich in seinem eignen Lande von den Kaiserlichen bedroht, die sich der Seehäfen bemächtigten, um ihn von dort aus zu Schiff auf seinen Inseln anzugreifen. Um dies zu verhindern, wandte er sich an die Hansestädte. Bereits unter dem 23. August 1627, von Kolding aus, hatte der dänisch=norwegische Reichsrath den Rath zu Rostock auf die Gefahr aufmerksam gemacht, welche ihnen durch die Päpstlichen und die Ligisten erwachse, indem "sie nemlich den Krieg und ihre äußerste Gewalt nunmehr in diese benachbarte Quartiere geführet mit dem ungezweifelten Vorsatz der Ostsee sich zu nahen und, da möglich, sich derselben zu impatroniren." Der Reichsrath erinnert an die Praktiken, durch welche die Gegner die Stände des deutschen Reiches entzweiet und geschwächt, betont, daß die Rostocker ("so durch Gott und die Natur mit uns in so gute Nachbarschaft gesetzet und conjungiret") die "vor Augen schwebende", gemeinsame Gefahr erkennen und sich nicht durch "der Widerwärtigen listige Praktiken (deren sie jedoch ohne das wohl informirt)" aus der natürlichen Verbindung reißen lassen möchten, da die allgemeine Wohlfahrt nur "durch göttliche Verleihung gegen der Widrigen Partie Macht und Anschläge mit Tapferkeit einig und allein zu erhalten stehe." Die Dänen versichern ihrerseits es an nichts fehlen zu lassen, was zur gemeinsamen Wohlfahrt und Vertheidigung der althergebrachten Libertät dienen könne.
Aber Rostock hatte sich bereits für die Kaiserlichen entschieden, und seitdem Dänemark vom Kaiser für seinen Feind erklärt war, demselben alle Unterstützung entzogen. Dieser Gehorsam der Stadt gegen den Kaiser war nachgerade weltbekannt geworden. Durch die Besetzung Warnemündes war die Neutralität, die Rostock wünschte, völlig unhaltbar geworden. Am 14. Jan. 1628 gelangte an den Rath zu Rostock ein Schreiben vom 28. Dec. 1627, worin


|
Seite 315 |




|
König Christian von Dänemark notificirte, daß er vermöge Kriegsgebrauchs und Völkerrechts sich entschlossen habe, die "Zufuhr und Segellation" in alle seine Lande "und alle andere Orte und Städte, so vom Feinde occupirt und Garnison eingenommen, gänzlich zu schließen", und alle Schiffe, so dahin zu laufen sich unterstehen würden, so weit er deren könne mächtig werden, durch seine "Auslieger anzuhalten und preis zu machen."
Der König wollte jedoch, bevor er die Feindseligkeiten begann, nochmals den Weg der Unterhandlung betreten. Am 24. Februar erschien ein dänisches Orlogschiff auf der Rhede vor Warnemünde und ging daselbst vor Anker. Auf demselben befand sich der dänische Gesandte Dr. Steinberg, der Aufträge von Christian IV. an Rostock, Stralsund und Stettin bei sich führte. Wie derselbe Warnemünde von den Kaiserlichen besetzt fand, wagte er nicht ans Land zu gehen, sondern ließ durch einen als Kaufmann verkleideten Schiffslieutenant dem Rath sein Creditiv übergeben mit dem Ansuchen, zwei Deputirte aus der Stadt zu ihm aufs Schiff zu senden, um seine Werbung zu vernehmen. Hierauf wurden Herr Johannes Maas, Joh. Bernh. Buchius, Klaus Frese und Hieronymus Roß deputirt, mit dem Befehl, bevor sie zum Orlogschiffe überführen, ihre Absicht erst dem Obristen S. Julian zu eröffnen, damit sie nicht unschuldig in Verdacht gerathen möchten. Der Oberst gab dazu gern seine Einwilligung. Die dänische Werbung, welche Steinberg hatte, beruhte in zwei Forderungen an Rostock: 1) keine kaiserliche Garnison in die Stadt aufzunehmen, und 2) den Kaiserlichen keinen Proviant, Kraut und Anderes verabfolgen zu lassen.
Als man dies dem Obristen bei der Zurückkunft vom Schiffe ebenfalls mittheilte, rühmte er dies sehr hoch und rieth den Rostockern, den Dänen darauf zu antworten: 1) daß es Unrecht wäre, Unterthanen von ihrem Herrn abzuführen, 2) daß sie ihren eignen Nutzen und Schaden nicht ansehen, aber 3) wohl bedenken möchten, ob man der kaiserlichen Armee Widerstand leisten könne.
Auf das Einkommen solcher Resolution einigte man sich dahin, dem Gesandten ebenfalls eine schriftliche Erklärung zu schicken, welche ihm auch am 2. März durch die Deputirten übergeben wurde. Dieselbe mußte jedoch vorher dem Obristen mitgetheilt werden, weil die Vermuthung auf der Hand lag, daß er Alles an Wallenstein berichten würde. Auch erhielt er eine Copie dieser Schrift, welche folgenden Inhalt hatte: Daß man die kaiserliche Garnison durch eine Geldsumme abgehandelt habe; die von S. Julian angelegte Fortification habe man sich freilich verbeten, müsse


|
Seite 316 |




|
aber der Gewalt weichen; da ihnen jedoch gestattet sei, eigne Besatzung hineinzulegen, so hoffe man, daß der König von Dänemark sich nicht dadurch beleidigt fühlen, sondern ihnen freie Schifffahrt verstatten würde. Munitionslieferungen wären ihnen von den Kaiserlichen nicht zugemuthet, und Proviant würde nur gegen Zahlung verabfolgt, weil man sonst die Dörfer vollkommen ausplündern würde.
Der dänische Gesandte war freilich mit dieser Erklärung nicht zufrieden; aber man mußte es dabei bewenden lassen. Während der Zeit, wo das Kriegsschiff auf der Rhede lag, wurden drei Rostocker Schiffe, aus Dänemark und Schweden kommend, von dem Orlogschiff angehalten, auf Bitten der Deputirten wieder frei gegeben, ihnen aber 1800 fl. abgenommen. Es befanden sich zu dieser Zeit noch 8 oder 9 Rostocker Bergenfahrer auf See, welche theilweise zu Kopenhagen eingebracht wurden. Am 12. März entfernte sich das Orlogschiff und nahm drei fremde Fahrzeuge mit.
Sofort beim Erscheinen des Kriegsschiffes hatte S. Julian nicht nur die schon fortgeschickten Mannschaften wieder zurückgerufen, sondern in Warnemünde allein 2000 Mann und auf den Dörfern 5000 Mann zusammengezogen, wo nun die Bauern wieder große Beschwerden ausstehen mußten, so daß viele von Haus und Hof liefen und sich nach Rostock flüchteten. Dazu wurde der Stadt gegen die Verabredung zugemuthet, Lebensmittel zum Unterhalt der Truppen herbeizuschaffen, was man jedoch nur gegen das Versprechen zusagte, daß dieselben von der Contribution abgekürzt würden.
Am 9. März 1628 kehrte das dänische Schiff, welches den Gesandten nach Kopenhagen zurückgebracht hatte, in Begleitung mehrerer Raubschiffe zurück; sie kreuzten auf der Rhede und nahmen Angesichts der Kaiserlichen verschiedene Rostocker Schiffe weg. Als sie wiederum ein von Lübek kommendes Fahrzeug bei neblichtem, dickem Schneewetter durch 10 Mann in einem Boote fortnahmen, gerieth S. Julian darüber in solchen Zorn, daß er die Wache, die auf der Schanze stand, einziehen und sofort stranguliren ließ. Obwohl der Rath nun an den König und die Reichsrathe schrieb und sich entschuldigte, zu keiner Beleidigung Ursache gegeben zu haben, so wurden dennoch die Feindseligkeiten in verstärktem Grade erneuert. Am 1. April erschien der Unteradmiral P. Mund mit 3 Schiffen auf der Rhede und begann mit Anbruch des Tages eine starke Kanonade auf die Schanze und auf Warnemünde, welche bis Nachmittags anhielt. S. Julian hatte beide


|
Seite 317 |




|
Bollwerke stark mit Soldaten besetzt, es wurden jedoch nur 2 Mann getödtet. Aber gegen 10 Uhr lief eine große, mit Steinen gefüllte Schute auf den Hafen zu, welche, nachdem sie an das "Hövet" gekommen war, sank, glücklicher Weise aber zu sehr ostwärts getrieben war, so daß sie dem Tief nicht schadete. Um 12 Uhr kam noch eine Schute von 20 Last, mit Steinen beladen, lief rechts auf den Hafen zu, wurde jedoch außerhalb desselben gesenkt. Nach dem Bericht der Seeleute konnte dieselbe wohl wieder, wenn die Kanonade aufhörte, entfernt werden.
In Folge dieser Feindseligkeiten konnte sich kein Schiffer herein oder hinaus wagen, so daß der Handel gänzlich darnieder lag, was in Rostock bei dem gemeinen Mann und den Seefahrern, deren hier im Ganzen 400 vorhanden waren, eine große Niedergeschlagenheit verursachte. Etwa 80 Bootsleute versammelten sich in der St. Johanniskirche und beschlossen eine Deputation an den Bürgermeister zu schicken, um sich einen guten Rath bei ihrer Brotlosigkeit zu erbitten. Es wurde ihnen der Bescheid zu Theil, man wolle an den König, die Reichsräthe und sämmtliche zu Lübek versammelte Hansestädte schreiben; damit mußten sie sich zufrieden geben.
Die geraubten Rostocker Schiffe, deren Werth sich auf über 2 Tonnen Goldes (200,000 Thlr.) belief, wurden von Dänemark dazu benutzt, um Proviant nach Stralsund zu bringen.
Am 22. März wandte sich auf Rostocks Bitte der zu Lübek versammelte Hansetag ("Vereinigtte Stette der Teutschen Hansee") mit einem ausführlichen Schreiben an König Christian. Die Städte erinnerten ihn an ihre bisher bestehenden freundschaftlichen Beziehungen und ersuchten ihn die Blokade von Warnemünde aufzuheben und die aufgebrachten Schiffe zurückzugeben. Sie wünschten sehnlichst die Wiederherstellung des Friedens und hätten soeben beschlossen deswegen an den Kaiser eine Gesandtschaft abzuordnen, der König aber würde durch Freigabe des Handels und der Schifffahrt dazu viel beitragen.
Die Rostocker versäumten auch sonst nichts, um durch Fürschreiben Anderer eine Sinnesänderung beim König v. Dänemark herbeizuführen. Insbesondere sandten sie Bitten um solche Intercession, welche von Empfehlungen der meklenburgischen Herzoge begleitet waren, unterm 29. März, 3. April und 15. Mai an den König Gustav Adolf von Schweden, worauf dieser ihnen am 5. Mai von Landsort aus folgende Antwort zu Theil werden


|
Seite 318 |




|
ließ
1
): "Die von ihm
verlangte Intercession bei dem Könige von
Dänemark zur Aufhebung der Sperre ihres Hafens
hätte er wohl bewillgen wollen, und seine
Bemühungen würden ihm auch schon gelungen sein,
wenn er nicht gedacht hätte, wie Rostock gleich
den übrigen Hansestädten verblendet gewesen sei
und seine früheren Vorschläge abgelehnt habe;
indeß, wenn man ihm nur versichern wolle, daß in
ihrem Hafen sich keine Feinde einnisten sollten,
und daß sie im Stande wären dies abzuwehren, so
werde er schon thun, was ihm als Beschützer der
Ostsee gebühre." Gleichzeitig bat der Rath
den schwedischen Gesandten Ritter Rasche am 8.
Mai um Fürsprache bei Gustav Adolf: "vnd
veber das (der König von Dänemark) alle vnsere
Schiffe, so in mari Balthico angetroffen,
wegknehmen vnd die wahren ins Proviant=Hauß zu
Kopenhagen führen laßen, darunter auch der
Schiffe, so aus dem Reiche Schweden kommen vnd
anhero gewollt, nicht geschonet, da doch der
Kaiserlicher Oberster durch öffentlich
angeschlagene patenta allen frembden nationen
und in spe[cie] den Schwedischen und
Dennemarkischen trafiquanten die navigation frei
in dieser Stadt Port zu verstatten
contestiret"
 . Unter demselben Datum bittet die
Stadt die Königin von Dänemark um ein
Intercessionalschreiben an König Christian:
"wie hart wir durch Sperr= vnd Senkung
vnseres Meerhauens, also abschneidung aller
vnserer trafiq vnd nahrung, nicht allein
bedruecket, sondern vns auch alle vnsere
Schiffe, so dem Reich Dännemark Zufuhr gethan
vnd wieder anhero vff der rückreiße geweßen vnd
sonsten angetroffen, abgenommen, solches haben
Ew. K. M. aus dem weltkundig erschollenen ruff
zweifelsfrei genugsamb erfahren." --
Christian antwortete den Rostockern endlich
unterm 22. Mai aus Kopenhagen, daß er nur nach
dem Völkerrecht handle und wie es sein
Kriegszustand erfordere, und daß er die Blokade
nicht eher aufheben könne, bis der Hafen von den
Kaiserlichen frei, und den dänischen Schiffen
die freie Einfahrt gesichert sei. Uebrigens
versicherte er seine Friedensliebe. -
. Unter demselben Datum bittet die
Stadt die Königin von Dänemark um ein
Intercessionalschreiben an König Christian:
"wie hart wir durch Sperr= vnd Senkung
vnseres Meerhauens, also abschneidung aller
vnserer trafiq vnd nahrung, nicht allein
bedruecket, sondern vns auch alle vnsere
Schiffe, so dem Reich Dännemark Zufuhr gethan
vnd wieder anhero vff der rückreiße geweßen vnd
sonsten angetroffen, abgenommen, solches haben
Ew. K. M. aus dem weltkundig erschollenen ruff
zweifelsfrei genugsamb erfahren." --
Christian antwortete den Rostockern endlich
unterm 22. Mai aus Kopenhagen, daß er nur nach
dem Völkerrecht handle und wie es sein
Kriegszustand erfordere, und daß er die Blokade
nicht eher aufheben könne, bis der Hafen von den
Kaiserlichen frei, und den dänischen Schiffen
die freie Einfahrt gesichert sei. Uebrigens
versicherte er seine Friedensliebe. -
Trotz dieser Vergewaltigung Rostocks durch Wallenstein ward in Lübek im Februar noch lebhaft von Schwarzenberg mit den Sendeboten der Hansestädte über das enge Bündniß mit dem Kaiser und das Handelsprivilegium von Spanien verhandelt. Mit beredten Worten versicherte der kaiserliche Gesandte die Städte der Gunst seines Herrn; er erinnerte sie an alle Beleidigungen und Beeinträchtigungen, die sie von England und Schweden erfahren,


|
Seite 319 |




|
an die Schmach des Sundzolls u. s. w.; der Kaiser beabsichtige eben, den alten Flor der Hansa herzustellen. Indessen, wie verlockend und gewinnreich auch die Hoffnungen, welche Schwarzenberg vorspiegelte, klangen: er vermochte nicht das Mißtrauen der Hanseaten zu dämpfen, und Flugschriften wie "der hansische Wecker" nährten es. Sie lehnten das Ansinnen Schiffe gegen Dänemark zu stellen ab, und desgleichen den spanischen Handelsvertrag, weil sie sich den Potentaten, so auf dem Meere mächtig wären und deren Pässe sie gebrauchen müßten, nicht widersetzen oder selbige sich zu Feinden machen könnten. Doch beschlossen sie Ende März, eine Gesandtschaft an den Kaiser abzuordnen und am 1. Sept. 1628 einen neuen Hansetag zu halten. - Trotzdem trug man sich am Kaiserhofe noch mit großen Hoffnungen; ward doch im April Wallenstein zum General des Oceanischen und Baltischen Meeres ernannt ! - Inzwischen aber nahmen Meklenburgs Geschicke eine Wendung, durch welche Rostock mit dem Herzog von Friedland anderweitig in eine viel beängstigendere Beziehung trat.
VIII. Pfandhuldigung der Stände.
Die Rückreise Wallensteins von dem dänischen Feldzuge im November 1627 nach seiner Residenz Gitschin ging über Prag, wo die ersten Verhandlungen mit dem Kaiser wegen Meklenburgs stattfanden. Sein Aufenthalt war von Erfolg gekrönt, bereits am 20. Dec. konnte er Arnim melden, daß in wenigen Tagen eine Mutation mit selbigem Land vorgehen würde. 1 ) Endlich am 15. Januar 1628 schrieb er an denselben: "Mit Mechelburg die sach ist schon in der Feder, in kurzem wirds ausbrechen." - Ferdinand hatte von seinen Räthen ein Gutachten verlangt. Aber es gab am Hofe zwei Parteien. Die starken Gegner Wallensteins hatten dem Kaiser abgerathen, die Herzoge von Meklenburg wider die Bestimmung der Wahlcapitulation ohne Verhör und Proceß ihres Landes zu entsetzen. Endlich jedoch siegte die Wallensteinsche Partei und geistlicher Einfluß, indem diese Partei dem Kaiser vorstellte, die Ueberweisung Meklenburgs an Wallenstein sei eine Gewissenssache, weil dadurch der Katholicismus befördert werde (machte doch Wallenstein damals den Jesuiten Hoffnung auf das Stift Bützow und auf die Gründung zweier Collegien für sie in Rostock und Wismar!), weil auch die Gerechtigkeit die Bestrafung der mekl.


|
Seite 320 |




|
Herzoge verlange, und endlich, weil der Kaiser sich dadurch der Verpflichtungen gegen den Herzog von Friedland entledigen könne. Diese Partei setzte dem Kaiser so lange zu, daß er endlich am 19. Dec. 1627 1 ) den Herzog von Friedland zu Brandeis in Böhmen auf seinem Schlosse zu einem Reichs=Fürsten erhob und ihm die Lehen über das Herzogthum Meklenburg wie auch das Fürstenthum Sagan in Schlesien ertheilte; "und haben Ihre Maj., als sie Tafel gehalten, und der Hertzog aufgewartet, ihn als einen regierenden Hertzog von Mecklenburg den Hudt aufsetzen heißen." 2 ) Unterm 26. Januar wurde dann auch der Kaufbrief über Meklenburg ausgestellt, demzufolge die herzoglichen Brüder Adolf Friedrich und Johann Albrecht ihrer Lande entsetzt, und Wallenstein "obangeregtes Herzogthumb Meckelburg, Fürstenthumb Wenden, Grafschaft Schwerin, Herrschaft der Lande Rostock und Stargart, und in Summa der ganze stato, den erstbesagte Herzogen sonsten besitzen, mit aller Landsfürstlicher Hoheit, Superiorität, Jurisdiction und Regalien, sambt allen Ein= und Zugehörungen, Recht und Gerechtigkeiten, aus römischer Kaiserl. Macht und Vollkommenheit, wissentlich und in Kraft dieses Briefs, dergestalt zu einem rechten, wahren und beständigen Kauf überlassen" (werden), "daß unerachtet der hohen Landesfürstlichen Dignität, Präeminenz, Jurisdiction und Regalien, so gegen andere billich gar hoch zu ästimiren und zu halten wären, dennoch sein, Unsers Oheimbs und Herzogs zu Friedland L., seiner Weltkündigen, uns erwiesener ersprießlicher und rühmlicher Dienst halber, dieselben frey, zu einem Voraus, und ohne allen Anschlag, haben und halten, und nur allein die Einkommen, und Entraden, gedachter Herzogthumb, Fürstenthumb, Grafschaft, Herrschaft und Länder gegen vier per Cento zu erkaufen und uns zu bezahlen schuldig seyn solle."
Gleichzeitig belehnte der Kaiser in einem andern Briefe Wallenstein mit Meklenburg und gestattete ihm die künftige Successionsordnung festzustellen. Außerdem verpfändete er seinem Generalissimus um 750,000 fl. das Bisthum Schwerin und die sonstigen geistlichen Stifter in Meklenburg. 3 ) -
Jener Kaufbrief ward aber geheim gehalten, öffentlich nur von einem Pfandbesitz geredet. In einem Patent an die Meklenburger vom 1. Febr. erklärte der Kaiser, das Land zu Handen genommen zu haben, "biß wir des angewandten schweren Unkostens


|
Seite 321 |




|
und Schadens Abtragh von denjenigen Landen und Herrschaften, so dazu Ursach gegeben, vollenkömblich erlangen"; und da der Herzog von Friedland durch Tapferkeit und gehabte Auslagen sich hoch verdient gemacht, "haben wir vmb eines theils solches Kriegs Unkosten, auch erst angeregte angenehmen Dienst willen, wie nicht weniger, damit wir uns dieses Landes desto besser versichern und dergleichen Gefahr hinführo nicht mehr zu besorgen haben mögen, obgedachtes Fürstenthumb Meklenburg. . . S. L. zu einem Unterpfande eingesetzet" - Frhr. Joh. Altringer und der Rath v. Walmerode erschienen als kaiserliche Commissare, um die Meklenburger des Eides gegen ihre Herzoge zu entbinden und dem Wallenstein huldigen zu lassen; Letzterer ernannte zu seinen Abgeordneten den Obersten San Julian und zwei Rechtsgelehrte.
Am 1. März 1628 erging von den Kaiserl. Commissarien eine schriftliche und gedruckte Edictal=Citation, worin der Rath der Stadt Rostock besonders und insgemein die Ritterschaft, Städte und Stände Meklenburgs zum 23. März bei Verlust aller ihrer Privilegien und Eigenthums citirt wurden zu Güstrow zu erscheinen. Die Citation wurde am 12. März zu Rostock eingereicht, und sofort die beiden Bürgermeister M. Tancke und Joh. Schütte nebst dem Rathsverwandten Val. Strelenius abgeschickt mit der Instruction, die Proposition anzuhören und darüber zu referiren. Am 24. März machten die Kaiserl. Commissare im Beisein der Räthe des Herzogs von Friedland die Proposition, welche darauf hinausging, daß der Kaiser jure retentionis wegen der von dem Herzoge von Friedland aufgewandten großen Kriegskosten demselben und dessen Erben dies Land Meklenburg anvertrauen lassen, um dasselbe so lange zu behalten, bis solche Unkosten vollkommen wieder gehoben und eingenommen seien; sie haben deswegen alle Unterthanen ihrer Eide und Pflichten entlassen, und befohlen, dem Herzoge zu Friedland alsbald zu huldigen u. s. w. Nachdem die Kaiserl. Commission öffentlich verlesen war, wurde dieselbe von den Friedländischen Gesandten acceptirt, welche darauf auch ihre Instruction verlesen ließen. Die Ritterschaft aber bat um Aufschub und ersuchte ihre angestammten Herzoge nach Güstrow zu kommen. Es ist bekannt, welche Anstrengungen und Anerbietungen die Stände nun machten, um die Pfandhuldigung abzuwehren, und mit wie wenig Erfolg. Sie sahen sich schließlich doch zum Huldigungseide genöthigt.
Die Rostocker Abgesandten zogen sich alsbald zurück und berichteten den Verlauf nach Hause, wo ausgemacht wurde, daß der Eid durch Deputirte zu Güstrow abgelegt werden sollte. Die dahin


|
Seite 322 |




|
Abgeschickten kamen jedoch mit der Antwort zurück, man werde ihnen den Eid zu Hause abnehmen. Am 8. April kamen die Friedländischen Commissarien Statthalter San Julian, Dr. Lüders, Balthasar Moltke, Gregorius Bevernest und Dr. L. Stephani mit 40 Pferden nach Rostock, worauf am 9. der Rath und die Bürgerschaft ihnen auf dem Rathhause denselben Eid leisteten, wie die Ritterschaft gethan hatte. -
IX. Die Gesandtschaft an den Kaiser und an Wallenstein.
Im Januar 1628 waren die Verhandlungen mit Arnim wegen der Contribution noch nicht zum Schluß gekommen. Deshalb verwandten sich die meklenburgische Ritterschaft und die Stadt Lübek bei Wallenstein und dem Kaiser, Rostock mit Einquartierung zu verschonen und die Verhandlungen zum Abschluß zu bringen. Da ferner auf dem Hansetage zu Lübek ausgemacht war, daß jede Stadt dem Kaiser ihre Wünsche und Beschwerden selbst vortragen sollte, so entsandte Rostock den Bürgermeister Luttermann und Dr. Th. Lindemann, welche am 23. Februar 1628 mit der Stadtkutsche von Rostock abfuhren, am 4. März in Leipzig eintrafen und über Dresden Prag am 12. erreichten. Ehe sie nach Gitschin weiterreisten, sprachen sie jedoch erst mit dem kaiserlichen Rath v. Stralendorf, dessen Förderung sie empfohlen waren. Am 15. reisten sie dann von Prag nach Gitschin, wo sie am 17. anlangten. Alsbald übergaben sie ihr Creditiv und wurden darauf zu Mittag hinauf zu der freien Tafel geladen; der Herzog speiste in seinem Privatzimmer, weil er durch den Genuß von Fleischspeisen während der Fasten kein öffentliches Aergerniß erregen wollte. Am Nachmittage ertheilte er ihnen Audienz. Er war ziemlich wohl disponirt und hörte gnädig ihre Proposition folgenden Inhalts an:
1) die vertröstete Assecuration, daß die Stadt und deren Land= und Hospitalgüter von der Einquartierung entfreiet sein sollten, zu ertheilen.
2) bitten die Deputirten, S. F. G. wolle geruhen, die dem Obersten von Arnim angebotenen 100,000 Thlr. zu acceptiren und zu deren vollkommener Abstattung eine ziemliche Frist gnädigst zu indulgiren. Sie bitten
3) die in der Stadt Rostock und in allen benachbarten Städten über Menschen Gedenken auch annoch übliche Accise und Tiefgeld gleich andern Städten nach Gelegenheit der jetzigen großen Noth zu verhöhen und Rostock ungehindert gegönnet bleiben zu lassen.


|
Seite 323 |




|
4) daß ihnen die Schanze zu Warnemünde eingeräumt werden möge, um sie mit ihrer Soldatesca zu besetzen, welche I. F. G. und der Stadt schwören sollte.
5) daß während des Krieges die freie Schiffahrt allen verwandten Hansestädten nicht allein, sondern auch Schweden, Dänen und anderen Völkern ungehindert vergönnt werden möge.
6) keinen heimlichen und verbotenen portus außerhalb der ordinarii alten privilegirten Meerhäfen Rostock und Wismar Jemand zu gebrauchen zu verstatten.
Hierauf äußerte Wallenstein seine Meinung folgendermaßen: er wolle sie nicht nach Hofart von Herodes zu Pilatus schicken, sondern ihnen seine Resolution kurz andeuten. Zuerst versicherte er ihnen, daß es niemals (!) seine Meinung gewesen sei, Rostock mit Einquartierung zu belegen, er sei vielmehr auf der Stadt Bestes bedacht. Darum hätte die Rostocker in diesem Punkte nichts zu besorgen. Die Erlassung der 40,000 Thlr. betreffend, wolle er sich bedenken. Wie sie aber weiter anhielten, erklärte er gnädig, er wolle Alles dem v. Arnim anheim stellen.
Die Beförderung der Accise beim Kaiser betreffend, so sei seine Meinung, daß er ihnen in allen Punkten Satisfaction widerfahren lassen wolle, wenn er nach Meklenburg käme, und daß sie garnicht nöthig hätten, beim Kaiserlichen Hofe etwas dieserhalb zu suchen, denn sie wüßten doch wohl, daß ihm Meklenburg übergeben sei; wenn er dahin käme, so wolle er sich informiren und, soviel er könne, helfen, wie sie auch in Bezug auf die Landescontribution nicht über die Gebühr beschwert werden sollten.
Ueber ihr Gesuch wegen Wiedereinräumung der Schanze hätten sie sich wohl zu bedenken; denn es könnte leicht geschehen, daß ihre Officiere gleich dem Magdeburgischen Capitain zum Schelm würden, sich bestechen ließen und dem König von Dänemark die Schanze übergäben. Dann würde es aber heißen:
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim.
Er wolle, wenn er hinunterkäme, den Sachen weiter nachsinnen; jedoch solle die Nahrung frei bleiben, und er wolle sich an Ort und Stelle nach der Richtigkeit ihres Berichts erkundigen.
Wie sie abermals in Betreff der Accise dem Fürsten andeuteten, daß die Rostocker wohl berechtigt seien, dieselbe anzulegen, aber doch beim Kaiser um Confirmation ihres Privilegiums anhalten wollten, ließ er sich vernehmen, daß dieses Vorhaben einen Widerspruch in sich enthielte; denn er sei selbst geneigt ihnen zu helfen. Und er brauchte dabei die tiefsinnigen Worte: Amor et


|
Seite 324 |




|
dominium non patiuntur socium. Daneben ließ er weiter merken, daß, wenn sie dieserhalb oder sonst Etwas beim Kaiser suchen würden, sie doch keinen Bescheid bekommen sollten. 1 )
Am Mittwoch, 19. März, Vormittags wurden sie wieder gefordert. Die Gesandten nahmen Gelegenheit weiter von der Befreiung von der Landescontribution zu reden und dem Fürsten die Unbilligkeit des Verlangens zu Gemüthe zu führen. Nachdem er solches bei sich erwogen, ließ er sofort den Secretair holen und befahl demselben in der Gesandten Gegenwart ein Schreiben an Arnim auszufertigen: Weil die Rostocker zur Kaiserlichen Armee absonderlich contribuirten, so wäre es unbillig, daß sie zur Landescontribution noch Etwas geben sollten, deswegen die Stadt nebst Land= und Hospitaldörfern davon exempt seien. Gegen Mittag wurden die Deputirten vom Fürsten zur Tafel gefordert und ihnen dabei angedeutet, daß eben ein Schreiben von San Julian angekommen sei. Die Gesandten waren im Begriff sich zu verabschieden, als Wallenstein ihnen das Schreiben von San Julian zeigte, worin derselbe meldete, daß der Pöbel und die Seefahrer zu Rostock sich bei 2000 zusammengerottet und den Kaiserlichen gedroht hätten, sie wollten die Schanze zu Warnemünde, sobald sie Hülfe von den dänischen Schiffen erhielten, niederreißen und die Soldaten daraus entfernen. Ueber den Bescheid des Raths an den dänischen Gesandten Dr. Steinberg, welchen er ihnen vorlas, äußerte er sich zufrieden. Die Ritterschaft wurde von San Julian beschuldigt, das Land zum Aufstand reizen zu wollen. Hierüber zeigte sich Wallenstein sehr entrüstet und drohte mit harten Worten, es hätten sich die guten Herren wohl vorzusehen. Die Deputirten berichteten darüber nach Hause: "Wir mögen fast nicht schreiben, wie gar gefährlich es von dieser Stunde an mit unserm gnädigen Fürsten und Herrn stehet. Wir beklagen die guten Herren. Gott verzeihe es denen, die es anders hätten dirigiren sollen! Man wird in wenig Tagen große Veränderung erleben. Wir bitten inmittelst, E. E. Rath wollte die ehrliebende Bürgerschaft zu guter discretion und patientz ermahnen." Der bei der Rückkehr der Deputirten verfaßte amtliche Bericht sucht den Zorn Wallensteins, wo nicht direct zu leugnen, so doch abzuschwächen, indem er erklärt, er sei darüber nicht sehr alterirt gewesen, während die unter dem ersten Eindruck nach Hause ge=


|
Seite 325 |




|
schriebenen Briefe den furchtbaren Eindruck und das Gefährliche der Situation deutlich erkennen lassen.
Obwohl der Zweck ihrer Gesandtschaft soweit erreicht war, das die von Wallenstein erlangten Schreiben an Arnim und San Julian bis zur Unterschrift ausgefertigt waren, so wurde bei dieser Nachricht die vollkommene Ausfertigung verboten, bis mit nächster Post weitere Zeitung angekommen wäre. Den Gesandten wurde befohlen, sich während dieser Zeit in Prag aufzuhalten. Wallenstein antwortete dem Obersten San Julian unterm 2. April: "Aus des Herrn Schreiben von Warnemündt, den 5. Marcii datirt, hab ich vernommen, was der poeuel in der statt Rostock vor die handt zu nehmen sich unterstehen will, wie der König nicht unterlest, sie durch seine gesandten zum ungehorsam zu solicitiren, auch was der adel sich vor impertinenzen anzufangen verlauten lest. Diesem allem vorzukommen ist dies mitl: der herr halte bey dem Ob. von Zieman an vmb mehr Volck, im fall, daß diese zwey Regiment des Torquato undt Farensbach nicht genug sein. Der herr sehe, daß in continenti die bürger zu Rostock disarmirt werden und ein Citadellen angefangen; dies soll auch zu Wismar geschehen; dahere ich denn den herrn aufs fleißigste bitten thue, er wolle keine Zeit verliehren, sondern ohne eine einzige mora dies ins Werck richten; ihre Abgesandten seindt noch dahie." - - -
Am 21. März langten die Deputirten wieder zu Prag an. Am 24. hatten sie beim Geh. Rath Frh. v. Stralendorf 1 ) Audienz. Derselbe war Rostock wohl gewogen und betrauerte tief die jetzt vor sich gehende Veränderung in Meklenburg. Er erklärte, es würde der Herzog von Friedland bei allem ihrem Ansuchen sein eigenes Interesse, so er nunmehr am fürstlichen Hause Meklenburg hätte, in Acht nehmen, und hätten sie sich deshalb vorzusehen, beim Kaiser Etwas zu suchen, wodurch er beleidigt werden könnte, denn es würde ihm Alles hinterbracht werden.
Am 26. März wurde den Rostockern auch eine Audienz beim Kaiser verstattet. Derselbe erinnerte sich der Abschickung Heinrich Husan's und ihrer darauf eingekommenen allerunterthänigsten Erklärung; er habe an ihnen nichts Anderes als Treue und Gehorsam verspürt, er wolle sie in seinen Schutz nehmen und ihr gnädigster Kaiser sein und bleiben. Was sie auch für Anliegen hätten,


|
Seite 326 |




|
solche sollten reiflich überlegt werden, und sie darauf gnädigste Resolution erlangen. Sie konnten jedoch nicht Alles, wie sie wohl wünschten, proponiren, weil sie wußten, daß es Wallenstein doch hinterbracht werden würde, und derselbe sie gewarnt hatte, daß sie wohl bedenken sollten, Etwas nachzusuchen, was gegen seine ihnen bekannte Meinung sei.
Den 28. März ließ Wallenstein die Deputirten wieder zu sich fordern und sprach ausführlich mit ihnen über seine beabsichtigten Friedensverhandlungen. Ferner redete er von den Mitteln, durch einen Kanal die Ost= und Nordsee zu verbinden, und entdeckte ihnen seinen Plan, den Kanal von Schwerin nach Wismar zu vollenden. Bei dieser Gelegenheit kam er auf die Gesandtschaft Schwarzenbergs an die Hansestädte zu reden, dessen Heftigkeit er mißbilligte, indem er andeutete, er wolle, daß Städte nur sich gegenseitig näherten. In diesem Falle wolle er schon fordern, daß der Graf abberufen würde. Er sähe es gern, daß die Hansestädte Gesandte an ihn abschickten und den Frieden und freien Handel forderten; denn er könne leicht einsehen, daß die Städte mit Spanien sich nicht einlassen würden. Als die Deputirten seine Politik hoch lobten und u. A. erwähnten, daß bei den Friedensverhandlungen auch ihrer Herzöge gedacht werden, und sie wieder zu ihrem Fürstenthum kommen würden, wollte Wallenstein nichts davon hören. Die Deputirten unterließen auch bei dieser Gelegenheit nicht, die Erlassung der 40,000 Thlr., wie auch eine schriftliche Versicherung wegen der Einquartierung zu fordern, worauf er bei dem Punkte der Remission motu capitis pro more suo suspensivum, wo nicht gar obnutivum angedeutet. Wegen der Einquartierung äußerte er, wann es ratio belli erforderte, so legte er die Soldaten auch wohl auf den Altar. Sie könnten jedoch deshalb ein Memorial an die Kanzlei einschicken.
Die Gesandten wurden von Tag zu Tag aufgehalten, weil man erst Nachricht über den Verlauf des mekl. Landtages haben wollte, ehe man sie entließ. Sie schrieben nach Hause: "Hätten wir die Botschaft San Julians vor unserm Aufbruch erfahren, so wollten wir lieber den syrraxim in loco erwarten. Wir sehen unsere Gefahr schon vor Augen, wollen aber nicht hoffen, daß E. E. R. uns in Gefahr stürzen lassen werdet. Jedoch ist Alles gut gemeint. Wir wollen ferner unser Bestes thun." - Am 9. April kam endlich die erwünschte Nachricht an, daß die Huldigung schon geschehen sei, worauf nun Wallenstein die Rostocker fordern ließ und ihnen hiervon Anzeige machte, sowie, das ihre


|
Seite 327 |




|
Abreise nunmehr erfolgen solle. Dabei berichtete er ihnen die Einwände der Landschaft wegen Confirmation der Privilegien und der Religion, indem er erklärte, er wolle dieselbe wider ihre Privilegien nicht beschweren, auch in der Religion keine Aenderung vornehmen. Er begehre niemand zur Religion zu zwingen, er habe mehr Evangelische als Katholische in seiner Armee, und wäre ihm der Arnim, trotz dessen er ein eifriger Lutheraner sei, ebenso lieb als San Julian, der Katholische. Die Religion gebe und nehme der Aufrichtigkeit nichts. Er fügte noch hinzu, der König von Spanien hätte vorlängst besser gethan, wenn er den Niederländern das Privilegium libertatis religionis oder libere zum Teufel zu fahren gegeben hätte.
Am andern Tage ließen sich die Deputirten im Vertrauen von dem Cancellarius den auf ihr eingereichtes Memorial erfolgten Befehl Wallensteins zeigen, welcher lautete, daß man ihnen ein Schreiben an Arnim und San Julian mitgeben sollte in diesem Sinne, daß sie mit Einquartierung verschont bleiben sollten, wenn nicht ratio belli das Gegentheil erfordere. Item sollten sie von der Landescontribution eximiret sein. Dabei berichtete der Cancellarius, Wallenstein habe sich wegen der Erlassung der 40,000 Thlr. erklärt, bis Michaelis wäre zu lange, aber bis Johannis möchte sein. Weil Wallenstein den 11./21. "confitiret", unterblieb die Ausfertigung den Abend. Nichts destoweniger kamen die Gesandten noch nach 7 Uhr zu ihm. Er fragte sie besonders nach der Fürstinnen Leibgedingen; weil sie davon aber keine genaue Nachricht geben konnten, und der Rittmeister Petersdorf eben draußen wartete, so verwiesen sie auf diesen, den der Fürst auch darauf hereinrief und über eine Stunde mit ihm sprach. Den 12. verlangten sie abermals ihre Beförderung und empfingen zuletzt die Copie eines Schreibens an San Julian. 1 ) Obwohl dasselbe mit
 .
.
Wohlgeborner, besonders lieber Herr Obrister, Vnnß haben Vnser Statt Rostock Ageordnete zuuernehmen geben, vnangesehen Sie auf daß Kay. Volck in der Statt contribuiren auch â parte eine ansehnliche Summa geldes zu geben bewilliget, gleichwol der Statt zum Land auch zu contribuiren auferlegt werde, Welches Wir Ihnen beschwerlich zu sein erachten.
Wird derowegen der Herr darob sein, daß ermeldte Statt Rostock neben Ihren Hospitalen= vnd Landgütern von dero Lands=Contribution exempt, wie auch mit einlosierung des Kriegsvolckes verschonet werden möge, woferne nur ratio belli nicht ein anders erfordert. Also wollen Wir auch, daß man mit einforderung der restirenden Neuntzig Taufend Reichsthaler biß zu ynser Ankunfft temporisire. Wie Er dann den ( ... )


|
Seite 328 |




|
dem vorigen Concept nicht völlig übereinstimmte, so wagten sie doch nicht um eine Aenderung anzuhalten. Endlich am 14./24. April begaben sie sich auf die Rückreise und gelangten am Freitag vor Misericordias domini (25. April/5. Mai) in Rostock an.
X. Verhandlungen mit Stralsund. 1 )
Im Herbste 1627 hatte Arnim Pommern besetzt, dem Herzoge Bogislav jedoch, welcher an dem dänischen Kriege keinen Theil genommen hatte, die Regierung gelassen. Die Städte Stettin, Wolgast, Cöslin und Damm sollten mit Einquartierung verschont bleiben, während man Stralsund dieselbe zumuthete. Diese Stadt weigerte sich, ließ sich jedoch auf Unterhandlungen mit Arnim ein, welcher erklärte: "wofern die Stadt mit der Einquartierung verschont werden wollte, würde sie eben das thun müssen, was Rostock sich bereits erboten habe und ferner thun müßte (also 140,000 Thlr. geboten); und wenn Stralsund sich desgleichen erbieten würde, wollte er Alles des Herrn Generals F. G. im Besten referiren." Die Stadt erbot sich jedoch nur zu 30,000 Thalern.
Am Schlusse des Jahres 1627 war ihr das herzogliche Steuer=Edict zugesandt worden; da es aber unbillig und unmöglich schien beide Lasten - Loskaufung von der Einquartierung und Steuer - einer Ursache wegen zu tragen, so hatte man am letzten Tage des Jahres dem Protonotarius Joh. Wahl aufgetragen, dagegen zu appelliren, zumal da die der Stadt zuertheilte Steuer schon am 2. Januar zur allgemeinen Landeskasse eingesandt werden sollte. Da Arnim in seinen Forderungen sich auf das Beispiel der Stadt Rostock berief, so ward jener Protonotarius Wahl dahin abgefertigt, sich genau zu befragen: 1) wann, wie und gegen welche Quittung Rostock die erste Summe (14,000 Thlr.) erlegt habe? 2) was darüber für eine Vertröstung und Quittung
An Obr. von
S. Julian.
Collationatum et
concordat
cum originali.
Testor id
Georg Graff ab
Ehrenfeld
Secretarius m. ppria.


|
Seite 329 |




|
vorhanden sei? 3) ob Rostock zu der kaiserlichen Armee ins Land aus der Stadt steure? 4) ob es von den Landgütern oder von ihrer Bürger Gütern geschehen? 5) ob Rostock bei seiner gewissen Quota verbleibe? und 6) ob Schiffe von Rostock begehrt worden, wie es von Stralsund im Namen des Obersten Götze geschehen?
Nach 4 Tagen kehrte Wahl von Rostock zurück und überbrachte als Antwort, daß diese Stadt sowohl von dem Herzog von Friedland als von dem Grafen von Tilly nur die Vertröstung bekommen, daß sie mit der Einquartierung verschont bleiben sollte, statt aller übrigen Versicherungen aber nur eine Quittung für die bezahlten 14,000 Thlr. erhalten habe und bald darauf ebenfalls noch über 10,000 Thlr. Auf den 3. Punkt ward von den Rostockern geantwortet, es wäre unrecht und von ihnen nicht verlangt worden, daß sie doppelte Lasten tragen sollten; auch wären bisher keine Schiffe von ihnen gefordert; dem Lande gäben sie ihre Quota, nämlich den 12. Theil.
Mitten in den Verhandlungen hatte sich nun aber Arnim des Dänholms bemächtigt und fuhr fort die Stadt zu bedrängen. Es half den Stralsundern nichts, daß sie am 12./22. Febr. jene 30,000 Rthlr. an Arnim zahlten; denn Wallenstein schrieb diesem am 27. Febr. 1628: "Der Herr muß sehen, die von Stralsund mit ernst angreifen und nicht eher weck ziehen, bis sie ein stark guarnizon eingenommen haben; denn ich will nicht dazu kommen lassen, das sie etwas wieder uns erhalten undt dadurch sie und andere ihres gleichen herz fassen und ungebührlichkeiten anfangen." (Förster, Br. I, 212.)
Am 18. April kam der Rostocker Rathsherr Joh. Maaß in Stralsund an, um im Namen seiner Stadt einen Mittler zwischen ihr und dem Obersten v. Arnim abzugeben. Nur durch Vermittelung des kaiserlichen Obersten S. Julian hatte Maaß von dem aufgebrachten Arnim die Erlaubniß erhalten, zu versuchen, ob die Stadt sich auf gütliche Unterhandlungen einlassen und nachgeben wollte. Das Erscheinen dieses Rostocker Abgesandten war aber nur die Folge eines unüberlegten Schrittes des von Stralsund nach Lübek abgesandten Joach. Martens, der aus Besorgniß für seine Vaterstadt, ohne dazu bevollmächtigt zu sein, den Rostocker Rath um Vermittelung ersucht hatte. Der Stralsunder Rath konnte sich auf den Antrag des Rostocker Abgesandten nicht bestimmt erklären, da seine eigenen Deputirten vom Hansetag zu Lübek noch nicht zurück waren; dessenungeachtet gab er Maaß eine ausführliche Antwort, worin sich die schon oft angeführten Klagen


|
Seite 330 |




|
wiederholten, und die Stadt Rostock ersucht ward, mit Lübek und Hamburg gemeinschaftlich die Vermittelung mit Arnim zu übernehmen.
Dazu erklärte sich Rostock bereit und bat zugleich Arnim, den Ort zu bestimmen, wo eine Zusammenkunft stattfinden solle. Am 8. Mai erschienen Maaß und Abgeordnete von Lübek und Hamburg zu Stralsund auf Einladung des dortigen Raths. - Aber die Entscheidung erfolgte auf anderm Wege.
Rostock hatte die Hülfe Dänemarks und Schwedens zurückgewiesen; Stralsund dagegen, durch dieses Beispiel gewarnt, ergriff bereitwillig die dargebotene Hand und erwarb sich unsterblichen Ruhm.
Von den Hansestädten durfte Stralsund keine Hülfe erwarten; vergebens versuchte Gustav Adolf sie mit fortzureißen, und die 15,000 Rthlr., welche die Hansa Stralsund versprach, sind erst im September erfolgt, nachdem die Entscheidung bereits gefallen war. Alle Stürme, die Wallenstein Ende Juni und im Juli auf Stralsund persönlich unternahm, blieben ebenso erfolglos wie seine Unterhandlungen; und da neue Hülfstruppen aus Dänemark und Schweden anlangten, sah er sich veranlaßt, am 14./24. Juli abzuziehen.
Vom 17./27. Juli bis zum August weilte er in seiner Residenz zu Güstrow, von wo ihn die gefährliche Landung der Dänen bei Wolgast wieder auf den Kriegsschauplatz rief. Die Flucht der Dänen veranlaßte einen erneuerten Angriff auf Stralsund. Arnim zog wieder ins Gebiet der Stadt und hielt sich bis Anfang Octobers in Mützkow eine starke Meile von den Wällen entfernt, während welcher Zeit er vergeblich sich Stralsunds durch Verrath zu bemächtigen suchte.
XI. Wallenstein zwingt Rostock zu capituliren.
Nicht umsonst schien Wallenstein am 27. Febr. Arnim geschrieben zu haben, er dürfe von Stralsund nicht ablassen; sonst würden "alle anderen stett ihnen nachfolgen und vermeinen, ist es diesen hingangen, das diese auch recht dran thun, wann sie sich zur wehr stellen." - Da Wismar bereits eine kaiserliche Besatzung hatte, scheinen jene Worte besonders auf Rostock hinzuzielen.
Vor Stralsund hatte Wallenstein erfahren, wie eifrig Rostock an seinen Befestigungen arbeitete; er hatte jedoch geglaubt, daß dies auf S. Julians Befehl geschehe. Da er nun aber aus dessen


|
Seite 331 |




|
eigenem Munde hörte, daß dem nicht so sei, so ließ er es verbieten. Argwöhnisch fürchtend, das erfolgreiche Beispiel Stralsunds möchte die Rostocker nun zur Nachahmung aufreizen, hielt er es jetzt für den geeigneten Zeitpunkt, seine schon lange gehegte Absicht auszuführen, sich dieser seiner Stadt zu versichern. Er bediente sich zu diesem Zwecke einer List, um die Rostocker um ihren Proviant zu bringen und dadurch für jeden längeren Widerstand unfähig zu machen.
Nämlich nachdem er, in Stralsunds Nähe überall starke Besatzungen zurücklassend, aus dem Hauptquartier zu Mützkow mit 6 Regimentern zu Fuß, auch Cavallerie und Artillerie, aufgebrochen war, ließ er am 8./18. October die Rostocker durch den Statthalter Wingiersky benachrichtigen, daß er durch Meklenburg nach Holstein zu marschiren beabsichtige, und sie zur Verproviantirung der Armee rechtzeitig 10,000 Pfd. Brot und 100 Tonnen Bier nach Tessin schicken möchten. Ein anderes Schreiben vom 19. forderte die Stadt auf, ebensoviel nach Schwan zu senden, mit der Versicherung, daß man dafür erkenntlich sein würde. Dem Befehle wurde von dem nichts ahnenden Rathe und der Bürgerschaft nachgekommen. Außerdem wurde Bespannung für die Artillerie und Ausbesserung der Brücken begehrt, konnte jedoch nicht bewilligt werden. Jeder glaubte, der Marsch würde vorbeigehen, zumal Wallenstein gegen die bei ihm weilenden Rostocker Gesandten geäußert hatte, er wolle nach Holstein, um die Stadt Krempe zu nehmen und damit noch vor dem Winter dem dänischen Kriege ein Ende zu machen. Nachdem der Einmarsch in Meklenburg über Tribsees aufgegeben war, weil das Wasser daselbst gestiegen, erfolgte derselbe am 12. October zwischen Damgarten und Ribnitz, und bei Volkenshagen diesseit Ribnitz wurde bivouakirt. Am 13. wurde der Marsch auf Schwan fortgesetzt, wo Wallenstein zwei Tage, am 14. und 15. October, Halt machen ließ, bis die ganze Armee nachgefolgt wäre. Die Rostocker waren um so sicherer, da noch am selben Tage Altringer und andere hohe Officiere mit Einigen vom Rath Conferenz gehalten hatten. Am folgenden Tage hieß es, man könne die Kanonen nicht an der bestimmten Stelle durchbringen und müsse deshalb den Weg zurück und näher bei der Stadt nehmen; auch zeigten sich einige Reiterschaaren in der Nähe der Thore. Hieraus glaubte man schließen zu dürfen, daß die Armee jetzt langsam vorbeimarschiren würde. Allein bald wurde die Stadt durch allerlei Gerüchte beunruhigt. Man vermuthete zuerst eine Ueberrumpelung. Obwohl der Rath hiedurch bestürzt wurde, so traute er doch der Zusage Wallensteins unbedingt.


|
Seite 332 |




|
Die Bürgerschaft hatte am vorigen Tage unter den Waffen gestanden und Wache gehalten. Jetzt hielt man dieselbe weiter nicht für nothwendig; weshalb nur 2 Fahnen wachten, während die übrigen schliefen. Erstere versahen die Wache so gewissenhaft, daß am andern Morgen ihre "Gespeiseten" vom vorigen Abend sich dem Stadtgraben nähern konnten 1 ) und von ihnen Quartier forderten, widrigenfalls sie ihnen den Garaus machten. Wallenstein war nämlich um Mitternacht vom 15. auf den 16. October mit der Armee von Schwan aufgebrochen und nach Rostock marschirt, in dessen Nähe er um 3 Uhr Nachts anlangte. Die Fortbringung der Kanonen hielt ihn jedoch so lange auf, daß die Regimenter erst gegen Morgen in unmittelbarer Nähe der Stadt anlangten. Durch den vor einem Jahre aus Rostockschen Diensten entlassenen holländischen Capitain Kars, der sein Ehrenwort gegeben hatte, nicht gegen die Stadt zu dienen, wurde den Kaiserlichen der Weg unten an den Wiesen durch einen Garten gezeigt, wodurch die Außenwerke umgangen wurden. Die 12 Stadtsoldaten, welche in denselben Wache hielten, machten sich, als ihnen der Haufe auf den Hals kam, eiligst davon. Sie sahen noch, wie die Kaiserlichen über den Graben in den Garten und von dort nach dem Sanct Georg geführt wurden, wo sie sich haufenweise lagerten. Durch die in die Stadt eilende Wache wurde die Nachricht verbreitet, daß es draußen voll Kriegsvolk liege. Es wurde Alarm geschlagen und die Sturmglocken gezogen. Die mit ihren Waffen herbeieilenden Bürger wurden auf den Wällen aufgestellt, während der Rath sich versammelte. Unterdessen rückten die Kaiserlichen von allen Seiten heran und auf das Steinthor zu. Um 6 1/2 Uhr Morgens erschien der Freiherr v. Altringer vor demselben und schickte durch Wingiersky sein Creditiv an den Rath, indem er verlangte, weil die Thorwache ihn nicht habe einlassen wollen, möchte man seine Werbung vor dem Thore anhören. Hierauf wurde der Bürgermeister Joachim Schütte und Dr. Thom. Lindemann nebst einigen aus der Bürgerschaft zu ihm gesandt, denen der Obrist Folgendes ankündigte: Wallenstein habe erfahren, das König Gustav Adolf beabsichtige sich der Stadt zu bemächtigen. Um dies zu verhüten, wolle er eine Besatzung von 2000 Mann hineinlegen; dabei versicherte er, das es nicht zum Verderben, sondern zur Wohlfahrt der Stadt geschehen solle. Die bestürzten Deputirten


|
Seite 333 |




|
baten Altringer mit hinein zu kommen, damit man solches mit der Bürgerschaft berathen und einen gültigen Beschluß fassen könne. Er schlug dies jedoch aus, ermahnte aber die Deputirten einen schnellen Entschluß zu fassen; denn Wallenstein halte sich in der Nähe der Stadt auf und warte auf die Antwort.
Da der Rath sich mit der Bürgerschaft nicht einigen, noch in so kurzer Zeit zu einem Entschluß kommen konnte, Altringer aber durch einen abgesandten Officier dringend um Entscheidung bat, so wählte der Rath zu Deputirten Marcus Tancke, den Bürgermeister Joachim Schütte und Dr. Lindemann nebst den Bürgern Peter Eggers und Joachim Schnäkel bei Altringer um Aufschub zu bitten. Als die Deputirten auf den Rosengarten kamen und noch glaubten an die Ziegelei gehen zu müssen, sahen sie schon, daß vor dem St. Georg=Spital Alles mit Soldaten angefüllt war. Vor ihnen her gingen hohe Officiere auf und ab. Es waren der Herzog Franz Karl von Sachsen, Fürst Ernst von Anhalt, der Feldmarschall v. Arnim und Wingiersky. Die Deputirten näherten sich der Gruppe, beschwerten sich über das Eindringen der Soldatesca und hielten ihnen das fürstliche Versprechen vor, wobei sie um Frist baten.
Wie sie so im eifrigen Gespräch begriffen waren, kam Wallenstein selbst heran, bot den Deputirten die Hand und sagte, er begehre zu seiner Sicherheit und zu ihrer Erhaltung eine Garnison in die Stadt zu legen; dieselbe solle aber dadurch so wenig wie möglich belästigt, und ihr alle Privilegien, sowohl in Religions= als weltlichen Angelegenheiten, gelassen werden; auch solle die Unterhaltung der Soldaten vom Lande aus beschafft, und die Einquartierung dem Gutachten des Rathes überlassen werden. Sie möchten in die Stadt zurückkehren und sich bald bedenken; bis 1 Uhr wolle er ihnen Zeit geben. Wie nun die Deputirten sich wegen der kurzen Zeit beschwerten, so gab er ihnen nochmals die Weisung, sich nach der Stadt zurückzuverfügen und sich baldigst zu bedenken; denn wenn man die Garnison nicht gutwillig annehmen wollte, so hätte er die Mittel dieselbe einzuführen.
Mit diesem Bescheid erschienen die Deputirten wieder auf dem Rathhause. Daselbst fand man es geboten, daß Etliche vom Rath auf die Wälle gingen und den Bürgern, welche dort in 18 Fahnen vollzählig aufgestellt waren, Wallensteins Forderung eröffneten und sie um ihre Meinung fragten. Dies geschah auch. Sämmtliche 4 Bürgermeister begaben sich auf den Wall, führten der versammelten Bürgerschaft alle Umstände zu Gemüthe und baten und ermahnten fleißig, sie möchten der Stadt und ihre eigene Wohl=


|
Seite 334 |




|
fahrt wohl bedenken, sich nicht übereilen, auch nicht schießen und ausfallen, sondern solange einhalten, bis man sehe, ob Gott nicht Mittel an die Hand geben möchte, diesem verruchten Unglück zu entrinnen. Die vornehmen Bürger überlegten und erwogen die Gründe, die ihnen ans Herz gelegt waren, reiflich; aber der große Haufe und gemeine Mann rief, sie wollten sich wehren, man würde ihnen doch - wie es sich leider auch später ereignete - keinen Glauben halten. Zuletzt schlugen sie vor, man sollte versuchen, ob man sich nicht mit Geld befreien könnte. - Dennoch waren sie soweit gehorsam, daß sie nicht schossen oder sich sonst zu Thätlichkeiten verleiten ließen.
Darauf wurden abermals der Bürgermeister Luttermann, Dr. Scharfenberg, Peter Eggers, Christ. Gusebier, Paul Havemann deputirt, welche sich gegen Abend zum Herzog begaben und abermals um Schonung der Stadt, welche jederzeit treu gegen den Kaiser gewesen sei, baten. Die Bürgerschaft sei erbötig, dies mit Erlegung des rückständigen Geldes, soweit es menschenmöglich sei, zu unterstützen. Darauf antwortete Wallenstein: so wäre schon Stralsund vom Reich gekommen; er könne nicht verantworten, daß es auch mit Rostock geschähe; er wolle die Stadt durch die Garnison nicht verderben, sondern conserviren. Er sei nicht Geldes halber gekommen. Er setzte hinzu, ein Graf v. Mansfeld hätte ihm geschrieben, daß Rostocker Bürger geäußert hätten, die Stadt würde 800 schwedische Soldaten einnehmen, dies Schreiben könne er ihnen vorlegen; auch hätten sie mit der Schanzenarbeit nicht eingehalten, da doch Stettin, obwohl nicht abhängig von ihm wie sie, ohne seinen Willen keine Schaufel ansetzen wollte. Jedoch habe er das alles vergessen; sie sollten sich nur bald erklären, was sie thun wollten, er wolle noch an diesem Tage - es war S. Galli (16. Oct.) - endlichen Bescheid haben, und die Deputirten möchten sich nach der Stadt verfügen, um solchen zu holen. Alle Bitten, die erwähnten Bürger, welche Obiges geredet, namhaft zu machen oder das Schreiben, welches gegen die Wahrheit sei, ihnen zu zeigen, blieben erfolglos. Die Deputirten mußten sich nach der Stadt zurückwenden.
Hier ließen sie den Rath, alle Bürger und Soldaten=Capitaine aufs Rathhaus fordern und zeigten ihnen daselbst des Generals Meinung an. Der Rath brachte gewichtige Gründe vor, warum es gefährlich sei, mit Macht sich dagegen aufzulehnen, befragte auch den Stadtcapitain Wormbs, ob er die Stadt so befände, daß er sich getraue, dieselbe ehrenvoll und mit Erfolg zum Nutzen und zur Wohlfahrt des gemeinen Besten zu halten. Dieser erklärte hierauf,


|
Seite 335 |




|
er wolle an dem Ort, wo er commandire, sich redlich, wie es es einem Officier zukäme, wehren; weiter könne er für nichts stehen. Denn die Stadt sei an vielen Orten offen. Die anderen Stadtcapitaine traten zurück und verschoben ihre Antwort. Sie dürften sich zu dieser Zeit da man im Begriff sei die Garnison einzunehmen, nicht äußern; denn sie wären allesammt entschlossen, für ihr Vaterland zu fechten. Sie bäten jedoch, daß man um Bedenkzeit - bis zum folgenden Morgen - dem 17. October - anhalten sollte.
Hierauf gingen die Deputirten des Raths und der Bürgerschaft am späten Abend wieder hinaus und zeigten sowohl dem Feldmarschall Arnim, wie dem Herzoge von Sachsen und Altringer an, daß diese Verhandlungen zu wichtig seien, und unmöglich in so kurzer Zeit die Sache den Bürgern, wie es die Nothwendigkeit erforderte, vorzutragen und ein fester Entschluß zu fassen sei; man müßte noch ferner darüber die Meinungen austauschen. Hierauf traten die Unterhändler an Wallenstein heran. Dieser verstand ihren Antrag so, als wäre dieser Aufschub nur, um die Capitulation weiter zu behandeln, und setzte voraus, man würde dem Hauptpunkte, die Einlassung der Garnison betreffend, sich schon anbequemt haben. Als sie sich aber nicht ermächtigt erklärten, solches rein zuzusagen, gerieth Wallenstein in Zorn und sagte, wenn sie noch unentschlossen wären, so wolle er diese Nacht noch stürmen lassen und keine fernere Verzögerung einräumen. Dagegen hielten sie sehr flehentlich und inständig um Aufschub bis zum nächsten Tage an, so daß der General sich so weit erweichen ließ, ihnen solchen bis zum andern Tage um 8, höchstens 10 Uhr zu bewilligen.
Er nahm es auch sehr ungnädig auf, daß die Bürgerschaft ihre Fahnen wehen ließ und während der Verhandlungen an den Schanzen arbeitete. Deshalb begann er ebenfalls auf dem Felde beim Rosengarten Erdarbeiten und erklärte, als er schon die Frist eingeräumt hatte, er wolle zwar diese Nacht die Feindseligkeiten nicht beginnen, aber weil die Stadt bauete, wolle er auch Redouten aufwerfen lassen.
Die Deputirten kamen erst spät am Abend wieder in die Stadt und ließen gegen 8 Uhr die vornehmsten Bürger aufs Rathhaus fordern; und als dieselben in großer Anzahl mit ihren Waffen erschienen, theilten sie ihnen mit, wie hart es gehalten hätte, Aufschub bis morgen zu erlangen, und in welcher Gefahr sich in jedem Falle die Stadt befinde. Sie empfahlen den Anwesenden, jeder möchte während der Nacht den Schutz Gottes anrufen. Am fol=


|
Seite 336 |




|
genden Morgen um 6 Uhr sollten sie wieder zusammenkommen und alsdann in Gottes Namen das gemeine Wohl beschließen.
Vor den Augen der Bürger wurde nun eine Schanze auf dem Camp zu bauen angefangen und ungeheure Massen Strauchwerks und Schanzkörbe herbeigeschafft. Die Kaiserlichen arbeiteten die ganze Nacht eifrig; doch wurde von beiden Seiten nichts Feindliches unternommen, außer daß viele Gärtengeländer und andere Gegenstände draußen heruntergerissen und in die Schanzen verbaut wurden. Außen vor der Stadt zwischen Bistow und Sildemow war das eigentliche Zeltlager aufgeschlagen. Wallenstein aber kam an beiden Tagen in die Zingel und saß während der Zeit bei den Reiferbuden am Wachtfeuer.
Hierauf wurde die Zusammenkunft für den Abend aufgelöst und am nächsten Morgen (17.) wieder aufgenommen. Unterdessen hatte der Rath, die Unmöglichkeit, der stündlich sich verstärkenden kaiserlichen Macht Wallensteins Widerstand zu leisten, eingesehen. Auch konnte man dies wegen der Eide und Pflichten nicht verantworten und wußte nicht die geringste Hülfe, zumal man sich darauf gefaßt machen mußte, daß, wenn Wallenstein die Stadt durch Gewalt in seine Hände bekäme, er dieselbe der Plünderung preisgeben und ihrer Freiheit, Privilegien und besonders der ihr theuren Religion berauben würde. Man hatte ja nicht soviel Zeit gehabt, um sich zur Gegenwehr vorzubereiten, dagegen Wallenstein hatte einen großen Vortheil voraus, und bei der allgemeinen Bestürzung mußte man fürchten, daß er die Bürger eilig und schnell überrumpeln könne. Um diesem Unglück vorzubeugen, richtete der Rath seine Ueberlegung, im Falle man durch Bitten nicht erreichte sie abzuwenden, auf die Form, in welche die Capitulationsbedingungen zu fassen sein möchten, um sie dann der Bürgerschaft vorzulesen. Obgleich die auf dem Rathhause versammelten Bürger in die gemeldete Fassung einwilligten, sich auch die beiden Rathsherren Joh. Maaß und Dr. Scharfenberg zum Zeichen, daß sie ihrerseits damit einig seien, die Hand reichten, so war doch zur selbigen Zeit die ganze Bürgerschaft auf dem Walle in Waffen, und ohne deren Wissen konnte kein feststehender Entschluß gefaßt werden. Deshalb gingen der Bürgermeister Luttermann, Konrad und Albrecht Dobbin, Johann Willbrand und Dr. Scharfenberg auf den Wall zu allen Fahnen, um ihnen die Meinung des Rathes und der vornehmsten Bürger anzudeuten und das Concept der Capitulation durch den Registrator Brun verlesen zu lassen. Das Volk hatte das Bewußtsein, das Verrath im Spiele sei. Wie daher die Verlesung bei der ersten Fahne auf dem Rondeel beim Zwinger geschah,


|
Seite 337 |




|
wurden von den Seefahrern und dem gemeinen Mann gefährliche Drohungen und Schimpfreden gegen den Rath ausgestoßen; man drohte die Deputirten todtzuschlagen, richtete sogar Musketen auf einen Abgeordneten und hob die Degen auf; so fehlte nicht viel, daß ("wenn Gott es nicht verhütet hätte") alsbald ein Aufstand erregt wäre. In der anderen Fahne fing während der Verlesung des Conceptes die am Bandelier hangende Pulverbüchse eines Bürgers Feuer, so daß eine Explosion entstand, von der etliche Bürger niedergerissen wurden; und man glaubte, es hätte einer aus dem Haufen geschossen. In der Verwirrung geriethen die Deputirten theils auseinander, theils wollten sie sich entfernen und von dem Werke abstehen; sie ermuthigten sich jedoch wieder und setzten es dessenungeachtet in allen Fahnen fort. Es konnte aber sobald kein gewisser Entschluß erfolgen, sondern die Deputirten kamen mit dem Bescheide, sie möchten sich besprechen, und jeder Fahnen=Capitain solle den Beschluß aufs Rathhaus einbringen, wieder dahin zurück. Dies zog sich sehr lange, fast bis 3 Uhr Nachmittags, hin. Es kam nämlich ein Capitain nach dem andern an und brachte den Beschluß seiner Fahne, daß man mit der Vollziehung der Capitulation, so wie sie abgefaßt war, einverstanden sei. Um sich noch mehr zu sichern, wurde noch der Protonotarius Dr. Möhring zu allen Fahnen geschickt; er brachte die Erklärung heim, daß sie sämmtlich damit einverstanden seien.
Nach dem Verlauf der Dinge muß man bemerken, daß es gefährlich und sehr gewagt war, das Concept den Bürgern so, wie es vom Rathe verfaßt war, vorzulesen, da man nicht voraussehen konnte, ob es in dieser Fassung Wallenstein recht sein würde; jedoch wagte man es. Es wurden vom Rathe die beiden Bürgermeister Vinc. Gladow und Luttermann, Nicol. Wineke, Alb. Dobbin und Dr. Scharfenberg nebst mehreren Bürgern und dem Registrator Brun deputirt. Man verfügte sich in die Wohnung des Priesters an dem St. Georg, wohin der Feldmarschall Arnim und Altringer als Unterhändler sie beschieden hatten und wo die Punkte der Capitulation vorgenommen wurden. Von Zeit zu Zeit holte man sich über den einen oder den andern Punkt Instruction von Wallenstein, welcher sich während der Zeit auf der Reiferbahn aufhielt. In der Capitulation war von Rostock nur dreierlei vermerkt worden: 1) daß ehelichen Weibern der Soldaten der Eintritt in die Stadt gestattet würde; 2) daß der Rath auf Disciplin sehen würde; 3) daß die Erlassung der nachstelligen Gelder eingefügt würde.


|
Seite 338 |




|
Die beiden ersten Erinnerungen waren bald geregelt; aber der dritte Punkt hatte seine große Schwierigkeit, weil Wallenstein anzeigen ließ, die Gelder wären schon angewiesen und könnten nicht erlassen werden. Die Deputirten dagegen konnten diesen Punkt nicht auslassen oder übergehen. Darüber gerieth Wallenstein sehr in Zorn und sagte, er wolle von Arnims Verträgen nichts mehr wissen: man solle den Befehl austheilen, daß das Volk sich zum Sturm vorbereite, und das Geschütz aufpflanzen. Dann winkte er den Deputirten mit dem Hute sich zu entfernen. Inzwischen wurde das Kriegsvolk zu Fuß und zu Roß in voller Schlachtordnung durch die Zingel im Laufschritt gegen die Stadt geführt und mit der Schanzenarbeit, die seit 1 Uhr geruht hatte, wieder begonnen.
Bei diesem Anblick geriethen die Deputirten in große Angst, da sie zumal bedachten, daß der Punkt des nachstehenden Geldes nicht Hauptsache in der Berathung gewesen, es also bedenklich sei, dieserhalb den feindlichen Angriff heraufzubeschwören. In dieser Verwirrung eilten der Bürgermeister Luttermann und Dr. Scharfenberg wieder in die Stadt, in der Absicht, dem Senat den Verlauf zu berichten. Die übrigen Deputirten verloren sich aus Furcht; nur der Bürgermeister Gladow, Dr. Lindemann, Albrecht Dobbin, Joch. Schnäkel, Wilh. Gerdes, N. Bötticher und Brun blieben allein stehen, unentschlossen, ob sie den Vertrag anerkennen könnten. Zuletzt, als sie die Heeresmacht, den Ernst der Stunde und die herannahende Gefahr erkannt hatten, faßten sie einen Entschluß und erklärten dem Feldmarschall Arnim: Obwohl sie eine große Gefahr befürchten müßten, wenn sie von dem den Bürgern vorgelegten Concepte abwichen, so bäten sie doch, damit der Fürst sähe, daß man sich demselben in allen Forderungen anbequemen wolle, er möge in den übrigen Punkten den Vergleich unterschreiben, oder man wolle es seiner fürstlichen Gnade anheimstellen, mit ihnen wie mit gehorsamen Unterthanen zu verfahren. Arnim überbrachte dies eilenden Schritts. Wohl mochte die Erinnerung an die in dieser Stadt empfangenen Wohlthaten in diesem Augenblicke seine Schritte beschleunigen. Wie dem Fürsten dieser Entschluß überbracht wurde und die Anwesenden Fürsprache thaten, besänftigte sich der Herzog nnd ließ den Deputirten durch Arnim sagen, weil er sähe, daß sie auf ihren harten Köpfen nicht bestünden, so wolle er ihnen den ganzen Nachstand erlassen, was die Deputirten mit unterthänigstem Danke annahmen. Hierauf wurde die Capitulation, wie sie vom Rathe verfaßt war, abgeschrieben und den Unterhändlern zugestellt, welche dieselbe als ihr Concept


|
Seite 339 |




|
dem Generalissimus unterbreiteten. Wallenstein saß in dem Gange vor den Reiferbuden vor der Scheune Martin Sillers am Wachtfeuer. Nachdem er es gelesen und Alles genehmigt, unterschrieb er es in der Gegenwart der Deputirten und ließ es sofort durch seinen Kammerherrn versiegeln und den Deputirten zustellen. Unterdessen wurde das aufgestellte Kriegsvolk wieder zurückgeführt und die Schanzarbeit eingestellt.
Wie man mit Allem fertig war und die Deputirten zu dem Fürsten herantraten, um demselben ihren Dank auszusprechen, bot er ihnen die Hand und sagte: "Ihr habt mir das Geld abgeschwatzt", und setzte noch hinzu, der Rath solle versichert sein, die eingewilligte Garnison sei nicht, um Rostock zu verderben, sondern um es zu erhalten. Wenn der Stadt etwas dem Widersprechendes zugemuthet würde, so könnte man das principiis obsta ausüben und gegen ihn klagbar werden. Damit verabschiedete er die Deputirten, welche dem Rathe und den Bürgern in der Stadt hinterbrachten, wie es abgelaufen war.
Die kaiserlichen Officiere waren über den Ausgang sehr unwillig, weil ihnen die gehoffte Beute entwischt war, und ein Artillerie=Obrist N. Koddewitz versicherte mit einem Schwure, wäre die Sache nicht so gekommen, so würde er in der Nacht mit etlichen Tausend Mann in die Stadt eingedrungen sein, denn man habe in der nächsten Nacht Bresche schießen und stürmen wollen, und wenn er nur 3 Schüsse gethan hätte, so wäre Rostock sein gewesen; er wisse den Ort zum Eindringen besser als sie selbst, und wolle ihnen die Stelle zeigen; dann wäre alles dort vorhandene Zinn und Kupfer ihm anheimgefallen, welches die Rostocker wenigstens mit 20,000 Thlrn. hätten einlösen müssen. Auch Altringer hatte geäußert, er habe sich die Gelegenheit so gut ausersehen, daß er sich hätte anheischig machen wollen, am folgenden Abend in Rostock zu sein.
Das hier nun überflüssig gewordene Kriegsvolk marschirte sofort nach Holstein weiter. Auch Wallenstein selbst hat die Stadt Rostock innerhalb ihrer Mauern nicht betreten, wahrscheinlich aus Furcht vor dem Pöbel. Nur die tausend Mann, aus einem Arnimschen und einem Dohnaschen Regiment zusammengesetzt, welche auf dem Rosengarten aufgestellt waren, marschirten 6 Uhr Abends in 200 Gliedern zu 5 Mann in guter Ordnung durchs Steinthor in die Stadt und campirten die Nacht auf dem Markte, wo sie auch am folgenden Tage blieben. Gegen Abend wurden sie vorläufig, bis man sich wegen der Einquartierung geeinigt hatte, in die Handwerker=Schüttinge verlegt.


|
Seite 340 |




|
Am Abend wurde die Wache durch 300 Kaiserliche und zwei Fahnen der Bürger gebildet, welche abwechselnd die Runde machten. An alle Straßenecken wurde eine Wache von je einem Bürger und Soldaten gestellt. Obwohl der Pöbel sich bemerklich machte, so schwiegen die Kaiserlichen doch still; denn es war ihnen strenge befohlen, niemand durch Worte oder thätlich zu beleidigen. Der kaiserliche Commandant und der Rath hatten beide Schlüssel zum Thore. Die Parole wurde vom Commandanten dem worthabenden Bürgermeister mitgetheilt.
Bald verbreitete sich das Gerücht in der Stadt, daß dieselbe durch Verrath Wallenstein in die Hände gespielt sei. Dasselbe war so nachhaltig, daß später die Herzoge von Meklenburg dieserhalb eine gerichtliche Untersuchung gegen die beschuldigten Rathspersonen, Bürgermeister Luttermann, Joh. Maaß und Clinge, anstellen ließen und denselben einen Proceß anhingen.
Die Beurtheilung, welche das Verfahren Wallensteins mit Rostock bei den Hanseaten erfuhr, möge hier folgen. 1 ) "Seht nun, Ihr lieben Hänse (der Herr kommt doch auch zu Zeiten mit in ihren Rath), und spiegelt euch hieran, im Fall euch je die Memoria so schwach, daß die Stralsundischen und Wismarschen Proceduren euch entfallen. Wollet ihr noch trauen? 1) Präpariret euch, glaubet keinen papiernen Sincerationen und Promissionen, als dadurch bald ein Loch gemacht. Richtet euch nicht mehr mit euren Syndicis und Doctoribus juris nach Recht oder den Reichsabschieden: denn sie sind abgeschieden und verschieden, gelten wie alte Münze, die man gern hat oder aufhebt, es ist aber derselbigen im Handel und Wandel keiner oder gar geringer Nutzen, und auch sonst wenig damit auszurichten. 2) Lasset dann die Rostocker euch ein Exempel sein! Schicket das Eurige nicht euern Feind zu stärken hinaus, wie diese gethan und ihr noch täglich thuet! Nehmet eine bessere Resolution, für eure Libertet zu fechten! bedenket und bewerbet euch, woher, wie bald und wie stark ihr Succurs könnt erlangen, oder saget hernach mit den Rostockern das non putaram oder intonirt das klägliche ejulate, den Gesang mit Heulen und Weinen vermischet; welches ihr für eure selbsteigene Weiber und Kinder, sammt Allen, so euch angehören, auch der lieben posteritet schwer zu verantworten haben werden. Und ihr beiden guten Städte Hamburg und Lübek, habet wohl Acht auf eure Schanzen! Um euch ist's nun zu thun, über euch wird die Glocke gegossen, euertwegen werden nunmehr die geheimsten und vornehmsten cousultationes


|
Seite 341 |




|
angestellet; über euch gehet es; über euch sind Pilatus und Herodes neulicher Zeit Freunde geworden. Ihr habts Leberle gefressen. Ihr seid diejenigen, die den Kaiser an der Ausführung seines Sieges hindern. Ihr seid es, die S. Kais. Maj. machen sagen: man werde und könne dero keine Victoriam einbilden, so lange ihr beiden nicht überwunden seid. Fürwahr ihm ist auch also: sintemal, so lange noch etwas übrig, daß den Victorem hindert oder aufhält, seine Intention völliglich zu erlangen oder zu prosequiren, so lange ist das Spiel noch nicht gewonnen, und ist noch niemals erfahren, daß Einiger so glücklich gewesen, daß, wenn es mit dem Kriege sich verzogen, ihm das Glück stetiglich ohne Wendung beigestanden habe. Ihr seid es nun, sage ich, ihr lieben beiden Städte, welche annoch merklich verhindern, daß mit der allgemeinen Reformation nicht also, wie es Manchem wohl ums Herz ist, herausgefahren wird. Wäre man mit euch fertig, ihr würdet wohl ein ander Liedlein in euren Kirchen hören intoniren, und was darauf für sequentien mehr folgten. Trauet doch derowegen nicht schönen und betrieglichen Friedensworten! - Bedenket doch nur, was der General von Friedland mit euch nunmehr nach eroberter Krempe im Sinne habe! Sobald er derselben Festung (Gott verzeihe denjenigen, die Ursache an Versäumniß des Entsatzes eines so stattlichen Orts) mächtig worden, da hat er also fort darauf an euch beide Schreiben pro imperio geschicket: ihr solltet ihm Schiffe hergeben, leihen oder verkaufen, oder die Materialien, deren man zum Bau derselbigen benöthigt, darreichen, und auch seinen Soldaten in euern Territorien Einquartierung verordnen oder gestatten."


|
Seite 342 |




|
Anhang.
Zur Geschichte der Fortification Rostocks.
Rostocks Wälle und Mauern sind, wie bei vielen alten Städten, scheinbar zu einem einheitlichen Werk vereinigt; ihre Geschichte umfaßt jedoch einen langen Zeitraum und umschließt die verschiedenen Entwicklungsstadien der Befestigungskunst, welche durch die Anwendung und Verbreitung des Schießpulvers in zwei Hauptperioden zerfällt. Die seit dem 13. Jahrhundert nachzuweisenden Stadtmauern, 2 Fuß dick, von verschiedener Höhe, auf einem Fundament von Granit (erratischen Blöcken) aus Ziegeln aufgeführt, mit schräger Ziegelbedachung, mit schmalen, nach innen sich erweiternden Schießscharten, in bestimmten Abständen verstärkt durch sogenannte Wikh'äuser, die mit halbkreisförmigem oder polygonem Grundriß aus der Mauer in gleicher Höhe heraustreten, genügte mit dem umgebenden Graben zunächst dem Vertheidigungsbedürfnisse. Dann kamen Thürme hinzu, unter denen namentlich der blaue Thurm (der Fischerbastion gegenüber) und der Kaiserthurm (zwischen dem Fischer= und dem Grapengießerthore) zu nennen sind. Außerdem waren die Landthore selbst Befestigungsthürme. Das schönste erhaltene Beispiel dieser Art, das Kröpeliner Thor, ist ein hoher, viereckiger, mit Giebeln und Dachreiter verzierter gothischer Backsteinbau. Unter den Giebeln sind auf 3 Seiten große Thüröffnungen angebracht, durch welche man auf einen hölzernen Umgang hinaustrat, der 1620 schon sehr schadhaft war 1 ) und von dem jetzt nur noch die viereckigen Oeffnungen zeugen, in welchen die Tragebalken steckten. 2 ) - Ein isolirter runder Thurmbau war der Zwinger (dwenger) vor dem Steinthor, der erst 1526 begonnen, 1528 von Meister Hans Percham aus Wittstock fortgesetzt und 1532 vollendet ward. 3 )
Gegen die Unsicherheit des fehdelustigen 15. Jahrhunderts schützten sich alle Städte dadurch, daß sie ihre Feldmarken mit


|
Seite 343 |




|
Landwehren umgaben, großen Gräben mit nach innen aufgeworfenem Wall, die mit der Zeit durch Bäume und Sträucher fast undurchdringlich wurden, während die Eingänge mit Schlagbäumen, Warten und Thürmen versehen und stets mit ausspähenden Wächtern besetzt waren.
Aber auch die Stadt Rostock selbst ward, nachweislich seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, wenigstens schon mit einzelnen Schanzen versehen, die ihren Namen anscheinend nach den Zünften erhielten, welche sie zu Vertheidigen hatten. Z. B. wird etwa 1494 der "wall vppe deme Küterbroke" 1 ), zu Anfang des 16. Jahrh. der "Wullenweuer=Wall" erwähnt. Diese Befestigungsweise ward dann im 16. Jahrh. fortgesetzt; Bürger verlangten 1525 sogar 2 ), auch die geistlichen Personen sollten "in den Grauen ghaen" und mit Karren "vp den stadtwal foren." Endlich 1559 beschloß der Rath die Stadt mit Rondeelen und Wällen zu befestigen und beeidigte einen Hauptmann oder Commandanten; und daß man 1563 bereits mitten in der Arbeit war, bezeugt der Vertrag des Raths mit der Universität vom 11. Mai, nach welchem die Professoren für die Befreiung vom Wachen und "Graben gehen" der Stadt von jedem ihrer Brauhäuser 1 Thlr. und von jedem ihrer Wohnhäuser 1 Mk. Lüb. jährlich entrichten sollten. Da der Camp vor dem Steinthore seiner hohen Lage wegen für die Stadt gefährlich war, hatte der Rath schon 1558 wegen Applanirung desselben mit Hans v. Herforden einen Vertrag geschlossen. 3 )
Allein alle diese Befestigungsarbeiten erfuhren eine unliebsame Unterbrechung, als die beiden Herzoge Johann Albrecht I. und Ulrich, um die Stadt Rostock, mit welcher sie seit mehreren Jahren im Streit lagen, zu bezwingen, ihrerseits 1566 4 ) eine Feste vor derselben zu bauen begannen. Sie ließen den Rosengarten rasiren, das Steinthor, einen schönen, mit Kupfer gedeckten Turm, sammt der Stadtmauer zu beiden Seiten niederreißen bis zum Kuhthor hin, das, seit vielen Jahren vermauert, nun wieder dem Verkehr geöffnet werden mußte, da man den Raum, der durch die Entfernung des Steinthors und der Mauer gewonnen wurde, in die Feste hineinzog. Herzog Johann Albrecht stieg am 25. Febr. beim Zwinger vom Pferde, um den ersten Spaten voll Erde zur Schanze


|
Seite 344 |




|
aufzuwerfen, und ließ dann von 500 Bauern aus der Umgegend ununterbrochen an der Festung arbeiten. Das Johanniskloster ward der Steine wegen bis auf die Kirche abgebrochen; die Rostocker mußten gleichfalls Materialien liefern, und die Festung wurde mit Geschützen und Munition, die man der Stadt abgenommen hatte, versehen, die Mündungen der Geschütze gegen diese gerichtet. Der Herzog gedachte (nach einem Briefe vom 4. Aug.) sein Werk so stark wie Ziegenhain zu machen! - Der Bau ward dann auch noch in den nächsten Jahren fortgesetzt. Die Stadt aber schützte sich gegen Ueberfälle durch Schlagbäume, Ketten und Wachen. Endlich, als die langen Streitigkeiten 1573 durch einen Vertrag zwischen den Herzogen und der Stadt beigelegt waren, begann am 15. Febr. 1574 die Schleifung dieser Feste, welche so gründlich durchgeführt ward, daß keine Spur davon übrig geblieben ist. 1 )
Alsbald verschrieb sich nun der Rostocker Rath einen guten Baumeister, Anton Bawald, um an Stelle der zerstörten Festung Wall und Mauer aufführen zu lassen; man begann den Aufbau der Mauer am 10. Mai am Kuhthor, und gleichzeitig das Aufwerfen des Walles vom Zwinger bis an das Mühlenthor; am 17. Juni ward auf der Stelle des ehemaligen Gefangenthurms das Fundament zu einem neuen Thurm gelegt, im Sommer 1570 das heutige Steinthor erbaut, 1576 der Bau der Mauer bis zum St. Johann fortgesetzt. Die Arbeiten an den Erdwällen wurden 1582 unterbrochen, weil man "das Tief" mit Macht in Angriff nahm, aber 1586 und 87 wurden wieder Klagen über beschwerliche Grabenarbeit laut. 1584 waren aus allen Kirchspielen Männer verordnet, welche in den Gemeinden Kupfer und Messing sammelten, um daraus 9 Geschütze zu gießen.
Wenngleich nun die Rostocker auch im Anfange des 17. Jahrh. in ihren Befestigungswerken nicht nachlässig waren, 1608, am 7. März, den Bau des Rondeels beim blauen Thurm am Strande (die Fischerbastion), 1611, am 29. April, den Bau der steinernen Brücke vor dem Steinthore begannen, 1617 das äußerste Thor vor dem Kröpeliner Thore beim St. Gertruden=Kirchhof, bisher aus Holz, nun in Backsteinen aufführten und 1618 den hölzernen Schlagbaum vor dem Steinthor durch ein äußeres Thor ersetzten: so fand doch der schon oben mehrfach erwähnte holländische Capitain Kars, als er 1620 in den Dienst des Rostocker Rathes trat, die Fortificationen


|




|


|




|
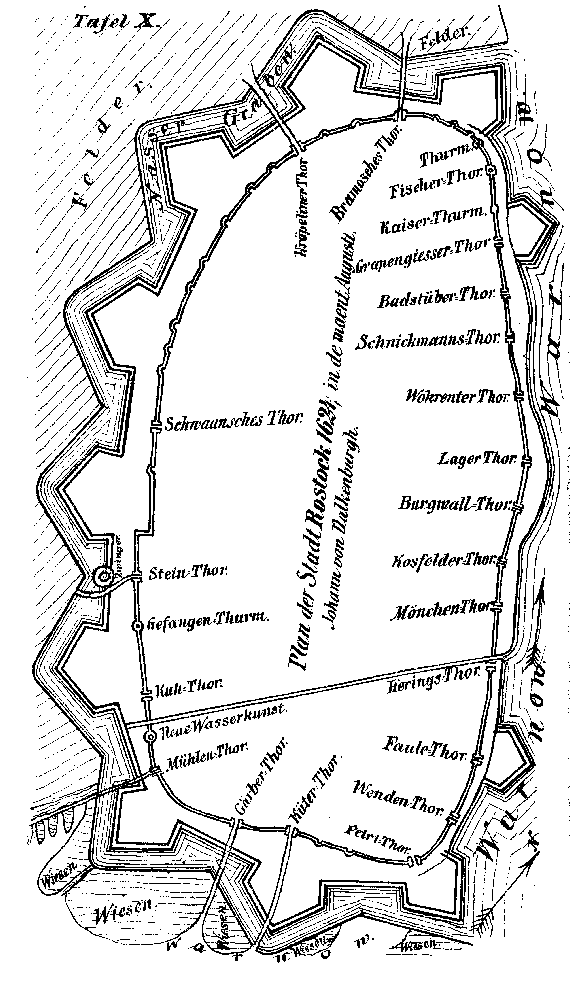


|




|
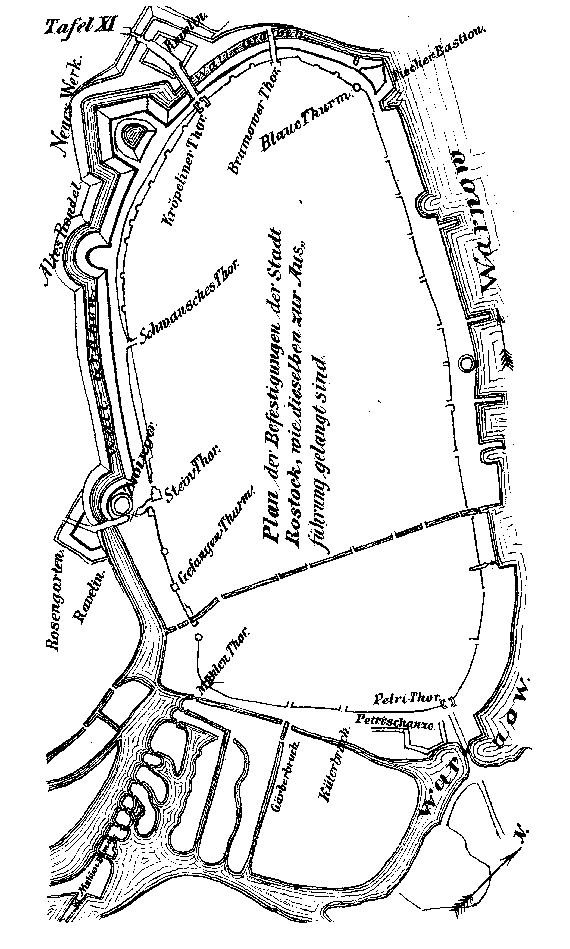


|




|


|
Seite 345 |




|
ganz unzureichend. 1 ) Die hölzernen Thorflügel waren nicht genügend mit Eisen beschlagen und verriegelt, im Innern der Thore mangelte es an Treppen und Böden für die Wachmannschaft, auch Geschütz mußte noch hinaufgebracht werden; desgleichen mangelte es in den (von armen Leuten bewohnten) Wikhäusern an Treppen, um den dort aufgestellten Wächtern freien Ausblick zu gewähren; an der inneren Seite der Stadtmauer verhinderten Ställe die Erdaufschüttungen oder Gallerien, so daß man nicht an die Schießscharten kommen konnte; und auf den Wällen wuchsen Eschen und Obstbäume und mangelte es an Brustwehren. Am Kuhthore war die Stadt so gut wie offen, und gerade dieser Punkt ward vom höher gelegenen Rosengarten völlig beherrscht. Auf der Unter=Warnow vom Strande nach der Fähre hielt Kars für nöthig das Fahrwasser durch Pfahlreihen einzuengen und die Durchfahrt mit einem Schlagbaum zu versehen, um das Einlaufen feindlicher Schiffe verhüten zu können. Er erlangte auch, daß zwei ihm bekannte Officiere aus Holland herbei gerufen wurden, die ihm beim Einexerciren der Bürger helfen sollten; sie empfingen je eine Gage von 300 holländ. Gulden und freie Wohnung. Am 20. Aug. 1620 ward auch eine Verordnung 2 ) gegeben, wonach den zum Graben gehenden Bürgern Quartiere zugewiesen wurden, der St. Marien= und der Jacobi=Gemeinde 8 Quartiere, denen von St. Peter und St. Nicolai 4.
In einem zweiten Memorial vom 3. Jan. 1623 3 ) begehrte Kars vom Rathe Anordnungen für Mauer und Wälle, so lange es noch Zeit sei. Er schlägt vor, draußen bei der Steinthor=Zingel einen Halbmond (demi - lune) zu erbauen, was man ohne einen Ingenieur selbst könne, damit sich die in der Noth zur Stadt flüchtenden Bauern dort schützen und vertheidigen könnten, bis man ihnen zu Hülfe käme; auch sei es Zeit an den Straßenecken die Sperrketten einzuhängen. Namentlich aber dringt er auf die Verschanzung Warnemündes, die schnell und, indem man das dazu nöthige Holz aus der Markgrafenheide entnehme, ohne große Mühe auszuführen sei; denn wer Warnemünde habe, sei Rostocks Meister; so lange die Schiffahrt frei sei, habe es mit der Stadt keine Noth. Uebrigens beklagt Kars sich bei dem Rath, daß er bisher so wenig


|
Seite 346 |




|
für die Stadt habe thun können; der Rath möge ihn mehr beschäftigen.
Dies scheint aber doch nicht geschehen zu sein; unzufrieden verließ er bald hernach den Dienst der Stadt, und später leistete er Wallenstein, wie erzählt ist, 1628 gute Dienste gegen dieselbe!
Rücksichtlich der Fortification scheint der Rath zu Kars auch kein großes Vertrauen gehegt zu haben, ließ vielmehr schon im Mai 1620 durch den Rath zu Hamburg den bewährten holländischen Ingenieur Johann v. Falkenburg, der zu Hamburg und Bremen Befestigungswerke ausführte, um seinen Rath bitten; allein dieser kam damals nicht, aber am 5. Febr. 1623 konnte Rostock Stralsund melden, daß Falkenburg einen Riß gemacht, und über denselben mit dem Prinzen Moritz von Oranien gesprochen habe, Letzterer auch auf das Project eingegangen sei. Falkenburg empfahl zur Ausführung seinen Mitverordneten Gerhard v. Wenen, der auch Rostock in Augenschein nahm. Am 8. Oct. dankte der Rostocker Rath Falkenburg brieflich dafür, daß er selbst ihre Stadt besichtigt und zu der Fortification derselben einen vollkommenen Riß angefertigt habe; und am 4. Decbr. benachrichtigte Falkenburg wiederum den Rath zu Rostock, daß er über die Befestigung dieser Stadt wiederum mit Oranien eine Unterredung gehabt, und dieser ihm seine Ansicht mitgetheilt habe, wie die Rostocker fürs Erste mit keinen großen Unkosten überhäuft werden sollten.
Aber man mußte sich noch gedulden; erst im August 1624 gelangte Falkenburg persönlich nach Rostock und entwarf den Befestigungsplan mit 9 Bollwerken, der noch im Stadtarchiv aufbewahrt wird, und von welchem wir auf Taf. X eine Skizze in halbem Maßstab geben. Wäre dieses Project bis zum Eintreffen der Wallensteinschen Armee im J. 1627 ausgeführt worden, so hätte Rostock mit Unterstützung von Seiten Gustav Adolfs, der dazu sehr geneigt war, immerhin eine Belagerung wie Stralsund aushalten können. Allein der Plan kam, weil der Capitain v. Falkenburg nicht lange hernach (vor dem 1. Nov. 1625) verstarb, nicht zur Ausführung. Die Rostocker nahmen freilich 1626 den von diesem empfohlenen Werkmeister Peter v. Kampen in ihren Dienst und stellten ihn unter die Oberleitung des meklenburg=güstrowschen Artillerie= und Ingenieur=Officiers Paul de Montront; aber wirklich ausgeführt ward von Falkenburgs Project doch nur "das neue Werk" bei dem Kröpeliner Thore, eine Drei=Wall=Bastion, die mit einem Vorwalle (fausse braye) ausgestattet ward. Der Bürgermeister Luttermann schob die erste Karre voll Erde dazu, Rathsherren und Bürger folgten ihm.


|
Seite 347 |




|
Es war seit 1626 die Stadt also nun durch folgende, durch die Wälle verbundene Werke, wie unsere Skizze auf Tafel XI zeigt, geschützt: 1 )
1) das Fischer=Rondeel. 2) die Schanze vor dem Bramowschen Thore (die Clyren=Schanze genannt), 3) das neue Werk beim Kröpeliner Thor, 4) das alte Rondeel, 5) das Rondeel vor dem Steinthore mit dem Zwinger, 6) das Mühlen=Rondeel vor dem Mühlenthore; dazu kommt ferner noch ein isolirtes Werk beim St. Georg. 2 ) Die Wälle waren mit 70 Geschützen besetzt. Die Hauptsache aber war nun, daß die Befestigungen in gutem Stande erhalten wurden. Im April 1626 erließ zu dem Ende der Rath eine strenge Verordnung über die Verrichtung der Arbeit an den Wällen. Die Bürger, welche in Fahnen und Corporalschaften eingetheilt waren, ließen sich die Arbeit umgehen, die Reihenfolge theilte der sie beaufsichtigende Wallschreiber den Corporalen mit. Die vom Werkmeister abgesteckten Strecken wurden durchs Loos unter die Bürger vertheilt, die nicht eher aufhören durften, als bis die Arbeit fertig war. Karren und Schanzgeräthe verwahrte der Wallschreiber Abends und lieferte sie Morgens dem Baumeister aus. Bei Regenwetter ruhete die Arbeit. Die Corporale controlirten die Bürger: wer von diesen ausblieb, ward ausgepfändet, die Pfänder jeden Sonnabend mit einem Verzeichnisse von den Corporalen abgeliefert, die Strafgelder zum Werk verwandt. Widersetzlichkeiten und verdrießliche Worte gegen die Corporale wurden den Wallherren gemeldet und bestraft. 3 )
Als der Rath Michaelis 1626 den Dr. Joachim Jungius zum Professor der Mathematik bestellte, trug er demselben auch auf, ihm nöthigenfalls mit seinem Rathe in Fortificationssachen zu dienen 4 ); aber wir verspüren von dieser Verpflichtung keine besonderen Erfolge.
Der Eifer der Rostocker für ihre Stadtwälle erwachte erst wieder, nachdem die Kaiserlichen ins Land gekommen waren, erregte aber nun deren ganzes Mißtrauen. Vergeblich entschuldigte sich der Rath am 1. Juli 1628 bei Arnim damit, daß nur ein Ort, der zur großen Unzierde der Stadt offen stehe, verwahrt werde. San Julian erklärte in einem Schreiben vom 3./13. Juli ganz offen,


|
Seite 348 |




|
es könne nur Argwohn erregen, daß man eben jetzt mit so viel Tausenden von Menschen nach so langer Unterbrechung an den Befestigungen arbeitete; er rieth diese Arbeit auf günstigere Zeit zu verschieben. Und Wallenstein ließ durch S. Julian, nachdem er, wie schon erzählt, von diesem den Sachverhalt erfahren, am 7. Juli einfach schreiben, daß Rostock davon abstehen sollte. Denn, wie Wingiersky der Stadt am 27. Juli /6. Aug. meldete, wollte der Herzog es nicht eher gestatten, als bis er selbst es befehle. Rostock erklärte am 28. Juli seinen Gehorsam, entschuldigte sich aber damit, daß einst der kaiserliche Gesandte Husan den Eifer angespornt habe, und erwähnte zugleich, daß der Regen an dem Wall großen Schaden anrichte, da derselbe von unten auf noch nicht mit Setzerde und Rasen befestigt sei! 1 ) -
Damals lag Wallenstein freilich daran, die Stadtbefestigung in dem schadhaften Zustande zu lassen. Nachdem aber Rostock am 17. Oct. 1628 in seine Hand gekommen war, und als ein Krieg mit Gustav Adolf in Aussicht stand, hatten die Kaiserlichen das entgegengesetzte Interesse. Sie selbst baueten nun im Juli 1629 eine Brustwehr auf dem Mühlen=Rondeel, wozu sie von den Wiesen an der Ober=Warnow Rasen herbeiholten, setzten im Septbr. das Geschütz in Stand und fingen am 21. Sept. an am Strande vorm Mönchen=, Lager= und Wokrenterthor, im October auch vor der Bramower Zingel Schanzen aufzuwerfen. Von den Rostockern begehrte am 5./15. Oct. der Statthalter Wingiersky, sie sollten sich täglich aus den umliegenden Dörfern 300 Mann zu Hülfe nehmen, um eine Schanze vor dem Petrithore zu bauen. Doch blieb diese unvollendet. Aber die Stadtmauer daselbst ward mit Schießscharten versehen.
Am 26. März 1630 besichtigten Wingiersky und S. Julian die Festungswerke 2 ) und begannen Unterhandlungen über deren dringend nöthige Verstärkungen mit dem Rath. Die Ausführung des Falkenburgschen Plans fanden sie zu weit aussehend. Man vereinbarte, daß die Ravelins vor dem Kröpeliner und dem Steinthore von den Kaiserlichen mit Hülfe der aus dem Lande requirirten Schanzgräber, die Schanzen vor dem Schwanschen und dem Petrithore aber von den Bürgern hergestellt wurden. Man richtete sich auf eine Belagerung ein; im Juni und Juli wurden die Windmühlen vor der Stadt heruntergenommen und dafür Roßmühlen an den Wällen errichtet, 22. - 25. Aug. der St. Georg von den


|
Seite 349 |




|
Kaiserlichen zerstört; am 25. Oct. (4. Nov.) kam vom Statthalter der Befehl, das Terrain vor der Festung ganz zu rasiren; die Forderung, an den Wällen Baracken zur Unterbringung der Kaiserlichen zu erbauen, hate er schon im August gestellt. -
Alle diese Maßregeln nützten schließlich jedoch recht wenig. Im September 1631 ward Rostock von den Herzogen von Meklenburg und den Schweden unter Tott eingeschlossen, und schon am 6. Oct. übergab der kaiserliche Oberst Virmond ihnen die Stadt gegen freien Abzug.
Die Herzoge zürnten der Stadt wohl wegen der Capitulation v. J. 1628; aber sie achteten darauf, daß die Rostocker für die Sicherung ihrer Befestigungen thätig waren. Am 8. Oct. gab ihnen Herzog Johann Albrecht auf, die Werke des (schwedischen) Lagers und die Landwehr, wenn's noch nicht geschehen, in möglichster Eile zu zerstören, an den Wällen und auch den Außenwerken das Nöthige zu repariren und sich wieder Gewehr anzuschaffen (da sie durch die Kaiserlichen entwaffnet waren). Am 16. Novbr. antwortete der Rath auf eine aus Güstrow erfolgte Weisung, mit der Demolirung des Klappengrabens hinter dem St. Georg sei längst der Anfang gemacht, das Werk sei unter die gesammte Bürgerschaft vertheilt, doch könne diese in solcher Eile damit allein nicht fertig werden; er bat daher um Bauern aus dem Domanium und den ritterschaftlichen Aemtern, um "solch undienlich Werk" rasiren zu können.
Die zahlreichen durch Meklenburg ziehenden Truppen verlangten stete Wachsamkeit. Nach einem Vertrage vom 1. Oct 1635 nahm die Stadt eine herzogliche Besatzung von 1400 Mann ein und verpflichtete sich ihre Befestigungen in Stand zu setzen. In einem Memorial vom 28. Jan. 1636 erwähnt der Rath als nöthig: daß den Thurmwächtern befohlen werde Tag und Nacht zu wachen; die Corps de guarde vor dem faulen Thore zu repariren, auf dem neuen Werke die Brücke abzubrechen, die Löcher an den Brustwehren zu füllen und unten ans Werk Pallisaden zu setzen, auch das Fischer=Rondeel je eher je lieber auszubessern, und endlich, damit kein feindlich Volk auf "Schuten und Schlupen" von Warnemünde hereingebracht werden möge, den Baum auf der Unter=Warnow zu schließen, einen Prahm mit Soldaten und wo möglich die fürstliche "Gallei" dabei zu placiren. Auch der Capitain der Garnison begehrte am 9. Febr. 1636 vom Rath das neue Werk besser einzurichten 1 ); man nehme seit 4 Jahren die Vertheidigung zu wenig ernst. -


|
Seite 350 |




|
Aus der späteren Zeit sind sehr wenig Nachrichten über die Rostocker Fortificationen vorhanden. Doch werden im Hauptregister der Kämmerei=Intraden (Cap. 8, Platzheuer S. 11, 196, 204) Andeutungen von neuen Befestigungen gegeben, daß nämlich die Scheune des Ziegelmeisters vor dem Kröpeliner Thor und ein Platz vor dem Schwanschen Thore, wo früher die Hornschanze gelegen habe, mit in die Befestigungen hineingezogen, und eine steinerne Brücke vor dem Kröpelinschen Thore gebauet sei. -
Mit dem Jahre 1832 beginnt die Zerstörung der Befestigungen, welche bei dem Mühlenthore ihren Anfang nahm und seit der Zeit weit fortgeschritten ist.
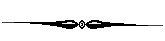


|
[ Seite 351 ] |




|
Berichtigung und Zusatz zu Jahrg. 50.
S. 310, Z. 4. Se. Hoheit Herzog Johann Albrecht ist nicht in Ludwigslust, sondern im Schlosse zu Schwerin geboren.
S. 311. Zu den Kindern S. H. des Herzogs Paul Friedrich füge nunmehr hinzu:
d. Heinrich Borwin Albert Hugo Joseph Paul, geboren zu Venedig am 16. Decbr. 1885.


|




|